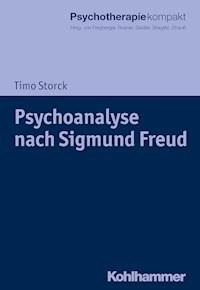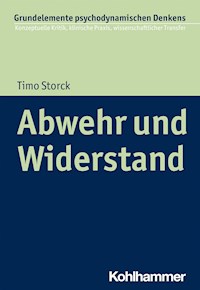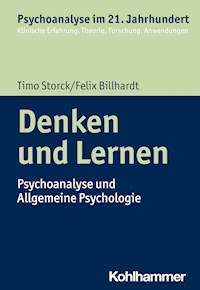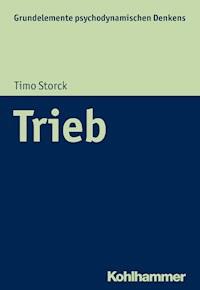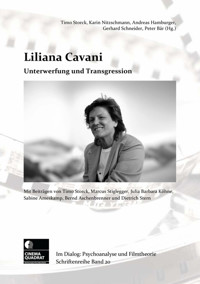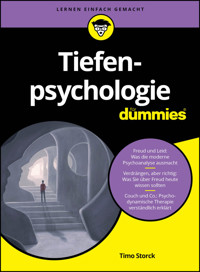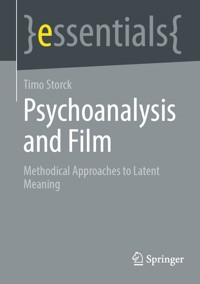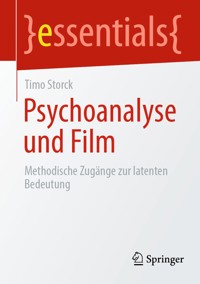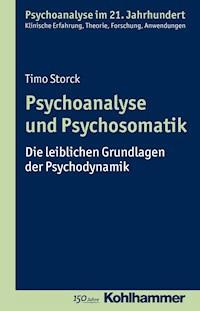
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Freud and body are located close to each other: The concepts of psychoanalysis refer to the connection to the physical and require a differentiated conception of the mind-body relationship. Starting with Freud comments on actual neurosis, questions arise on the development of psychopathology, psychodynamics and treatment technology. First of all, the conceptual developments are examined in general terms before diagnosis, classification and specific disease teaching are handled. The volume concludes with treatment settings, social aspects of psychosomatics and exemplary research fields.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 355
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Psychoanalyse im 21. Jahrhundert
Klinische Erfahrung, Theorie, Forschung, Anwendungen
Herausgegeben von Cord Benecke, Lilli Gast, Marianne Leuzinger-Bohleber und Wolfgang Mertens
Berater der Herausgeber
Ulrich Moser
Henri Parens
Christa Rohde-Dachser
Anne-Marie Sandler
Daniel Widlöcher
Timo Storck
Psychoanalyse und Psychosomatik
Die leiblichen Grundlagen der Psychodynamik
Verlag W. Kohlhammer
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen und sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche gekennzeichnet sind.
1. Auflage 2016
Alle Rechte vorbehalten
© W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Gesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Print:
ISBN 978-3-17-024838-0
E-Book-Formate:
pdf: ISBN 978-3-17-024839-7
epub: ISBN 978-3-17-024840-3
mobi: ISBN 978-3-17-024841-0
Für den Inhalt abgedruckter oder verlinkter Websites ist ausschließlich der jeweilige Betreiber verantwortlich. Die W. Kohlhammer GmbH hat keinen Einfluss auf die verknüpften Seiten und übernimmt hierfür keinerlei Haftung.
Geleitwort zur Reihe
Die Psychoanalyse hat auch im 21. Jahrhundert nichts von ihrer Bedeutung und Faszination verloren. Sie hat sich im Laufe ihres nun mehr als einhundertjährigen Bestehens zu einer vielfältigen und durchaus auch heterogenen Wissenschaft entwickelt, mit einem reichhaltigen theoretischen Fundus sowie einer breiten Ausrichtung ihrer Anwendungen.
In dieser Buchreihe werden die grundlegenden Konzepte, Methoden und Anwendungen der modernen Psychoanalyse allgemeinverständlich dargestellt. Worin besteht die genuin psychoanalytische Sichtweise auf Forschungsgegenstände wie z. B. unbewusste Prozesse, Wahrnehmen, Denken, Affekt, Trieb/Motiv/Instinkt, Kindheit, Entwicklung, Persönlichkeit, Konflikt, Trauma, Behandlung, Interaktion, Gruppe, Kultur, Gesellschaft u. a. m.? Anders als bei psychologischen Theorien und deren Überprüfung mittels empirischer Methoden ist der Ausgangspunkt der psychoanalytischen Theoriebildung und Konzeptforschung in der Regel zunächst die analytische Situation, in der dichte Erkenntnisse gewonnen werden. In weiteren Schritten können diese methodisch trianguliert werden: durch Konzeptforschung, Grundlagenforschung, experimentelle Überprüfung, Heranziehung von Befunden aus den Nachbarwissenschaften sowie Psychotherapieforschung.
Seit ihren Anfängen hat sich die Psychoanalyse nicht nur als eine psychologische Betrachtungsweise verstanden, sondern auch kulturwissenschaftliche, sozialwissenschaftliche sowie geisteswissenschaftliche Perspektiven hinzugezogen. Bereits Freud machte ja nicht nur Anleihen bei den Metaphern der Naturwissenschaft des 19. Jahrhunderts, sondern entwickelte die Psychoanalyse im engen Austausch mit geistes- und kulturwissenschaftlichen Erkenntnissen. In den letzten Jahren sind vor allem neurowissenschaftliche und kognitionspsychologische Konzepte und Befunde hinzugekommen. Dennoch war und ist die klinische Situation mit ihren spezifischen Methoden der Ursprung psychoanalytischer Erkenntnisse. Der Blick auf die Nachbarwissenschaften kann je nach Fragestellung und Untersuchungsgegenstand bereichernd sein, ohne dabei allerdings das psychoanalytische Anliegen, mit spezifischer Methodik Aufschlüsse über unbewusste Prozesse zu gewinnen, aus den Augen zu verlieren.
Auch wenn psychoanalytische Erkenntnisse zunächst einmal in der genuin psychoanalytischen Diskursebene verbleiben, bilden implizite Konstrukte aus einschlägigen Nachbarwissenschaften einen stillschweigenden Hintergrund wie z. B. die derzeitige Unterscheidung von zwei grundlegenden Gedächtnissystemen. Eine Betrachtung über die unterschiedlichen Perspektiven kann den spezifisch psychoanalytischen Zugang jedoch noch einmal verdeutlichen.
Der interdisziplinäre Austausch wird auf verschiedene Weise erfolgen: Zum einen bei der Fragestellung, inwieweit z. B. Klinische Psychologie, Entwicklungspsychologie, Entwicklungs-psychopathologie, Neurobiologie, Medizinische Anthropologie zur teilweisen Klärung von psychoanalytischen Kontroversen beitragen können, zum anderen inwieweit die psychoanalytische Perspektive bei der Beschäftigung mit den obigen Fächern, aber auch z. B. bei politischen, sozial-, kultur-, sprach-, literatur- und kunstwissenschaftlichen Themen eine wesentliche Bereicherung bringen kann.
In der Psychoanalyse fehlen derzeit gut verständliche Einführungen in die verschiedenen Themenbereiche, die den gegenwärtigen Kenntnisstand nicht nur klassisch freudianisch oder auf eine bestimmte Richtung bezogen, sondern nach Möglichkeit auch richtungsübergreifend und Gemeinsamkeiten aufzeigend darstellen. Deshalb wird in dieser Reihe auch auf einen allgemein verständlichen Stil besonderer Wert gelegt.
Wir haben die Hoffnung, dass die einzelnen Bände für den psychotherapeutischen Praktiker in gleichem Maße gewinnbringend sein können wie auch für sozial- und kulturwissenschaftlich interessierte Leser, die sich einen Überblick über Konzepte, Methoden und Anwendungen der modernen Psychoanalyse verschaffen wollen.
Die Herausgeberinnen und Herausgeber
Cord Benecke, Lilli Gast,
Marianne Leuzinger-Bohleber und Wolfgang Mertens
Inhalt
Geleitwort zur Reihe
Vorwort
1 Einleitung: Freud und Leib liegen nah beieinander
2 Leiblichkeit
2.1 Wer hält wen gefangen? Kurze Skizze zu Leib und Seele bei Platon und Aristoteles
2.2 Körper haben und Leib sein
2.3 Phänomenologische Bezüge der Psychoanalyse
3 Ätiologie und Psychodynamik psychosomatischer Erkrankungen I: Abwehrformen, Objekterfahrung und frühe Bildungsprozesse
3.1 Freuds Aktualneurose
3.2 Auf dem Weg zur psychoanalytischen psychosomatischen Medizin
3.2.1 Prägenitale Konversion: F. Deutsch, S. Ferenczi
3.2.2 Organneurose und Affektäquivalent: O. Fenichel
3.2.3 Entwicklungspsychopathologische Skizzen: J. Ruesch, M. Sperling, H. Deutsch
3.2.4 Die »Heiligen Sieben« und die Theorie der Konfliktspezifität: F. Alexander
3.3 Abwehrfiguren und Reifegrade
3.3.1 De- und Resomatisierung: M. Schur
3.3.2 Zweiphasige Verdrängung: A. Mitscherlich
3.3.3 Hilf- und Hoffnungslosigkeit und »Schlüsselperson«: G. Engel und A. Schmale
3.4 Operatives Denken und Alexithymie
3.4.1 Die Pariser Schule der Psychosomatik: P. Marty, M. de M’Uzan, M. Fain
3.4.2 Das Alexithymiekonzept: J. Nemiah und P. Sifneos
3.4.2.1 Kritik und zeitgenössische Konzeption
3.5 Strukturen des Objekterlebens
3.5.1 Körper und Organ im Verhältnis zur Objekterfahrung: D. Eicke, P. Kutter, R. Plassmann, M. Hirsch
3.6 Mechanismen früher psychischer Bildungsprozesse
3.6.1 Umgekehrte Alpha-Funktion und bizarre Körperobjekte: W. Bion
3.6.2 Organ-Objekt-Einheiten: J. Kestenberg
3.6.3 Zone-Objekt-Komplemente und Originärprozess: P. Aulagnier
3.6.4 Der Ansatz J. McDougalls als Verknüpfung verschiedener Untersuchungsstränge
4 Ätiologie und Psychodynamik psychosomatischer Erkrankungen II: Symbolisierung und Repräsentation
4.1 Affekt, Symbol und Sprache in pathopsychosomatogenen Sozialisationsprozessen: S. Zepf
4.2 Multiple Codes und die Verbindung zur Kognitionswissenschaft: W. Bucci
4.2.1 Diskonnexion bei L. Solano
4.2.2 Embodimentforschung
4.3 Die Pariser Schule heute: C. Smadja, M. Aisenstein
4.4 Die »italienische Schule« der Psychosomatik
4.4.1 Psychische Basisorganisation: E. Gaddini
4.4.2 Objekteklipse und Zweifaltigkeit: A. B. Ferrari
4.4.3 Der Leib als Organisator des Psychischen: R. Lombardi
4.5 Die Arbeit des Negativen in der psychosomatischen Erkrankung
4.5.1 Negative Kommunikation: J. Küchenhoff
4.5.2 Verneinungsunmöglichkeiten: T. Storck
4.6 Encore en corps: Der struktural-psychoanalytische Ansatz in der Psychosomatik
5 Diagnostik, Klassifikation und spezielle Psychodynamik
5.1 Psychoanalytisch-psychosomatische Diagnostik
5.1.1 Übertragung und Gegenübertragung und psychosomatische Diagnostik
5.1.2 Diagnostische Instrumente
5.1.2.1 Fragebögen und Interviews
5.1.2.2 Körperbild-Diagnostik
5.1.2.3 Alexithymie-Diagnostik
5.2 Klassifikation und differenzielle Krankheitslehre
5.2.1 ICD-10 und DSM-5
5.2.2 Psychodynamik spezieller Störungsbilder
5.2.2.1 Hypochondrie
5.2.2.2 Somatisierungsstörung und somatoforme Funktionsstörungen
5.2.2.3 Somatoforme Schmerzstörung
5.2.2.4 Psychosomatosen
5.2.2.5 Anpassungs- und Belastungsstörungen als somatopsychische Erkrankungen
5.2.2.6 Zur Bedeutung von Angst- und Paniksymptomen
6 Behandlung und Behandlungssettings
6.1 Ambulante Behandlung in psychoanalytischen Verfahren
6.2 Stationäre Psychotherapie
6.2.1 Die Besonderheiten des tagesklinischen Settings
7 Psychosomatik und Gesellschaft
7.1 Sozialisationsbedingungen auf mikro- und makrosozialer Ebene
7.2 Geschlechtsspezifische Aspekte der Psychosomatik
7.3 Die Kultur der Psychosomatischen Medizin und Psychotherapie
8 Forschung
8.1 Alexithymieforschung
8.2 Elemente stationär-psychosomatischer Psychotherapie
9 Fazit: Psychoanalyse als Leibesertüchtigung
Literatur
Sachregister
Vorwort
Die Reihe Psychoanalyse im 21. Jahrhundert nimmt sich die Erörterungen der Aktualität der Psychoanalyse, ihrer Konzepte, ihrer Behandlungstheorie und -technik, ihrer Forschungs- und Erkenntnismethoden und ihre interdisziplinären Anschlüsse zum Thema. Bisher erschienene Bände haben zeigen können, welche Aspekte der psychoanalytischen Praxis und des psychoanalytischen Theorie-Korpus noch heute einen wichtigen Stellenwert haben, welche Wandlungen der Psychoanalyse sich ergeben haben, welche Korrekturen, Weiterführungen oder Einsprüche. Wie steht es nun mit ihrer Korpus-Theorie? Was heißt »Psychoanalytische Psychosomatik im 21. Jahrhundert«?
Im vorliegenden Band soll Berücksichtigung finden, dass Körper- und Leiblichkeit nicht erst im Rahmen pathologischer Zustände und Prozesse für die Psychoanalyse interessant werden. Sondern vielmehr geht es darum aufzuzeigen, in welcher Weise die psychoanalytische Theorie und Praxis immer schon als eine psychosomatische zu bezeichnen ist, auch dort, wo sie allgemeine Psychologie oder Entwicklungstheorie zu sein beansprucht. Dieser Akzent soll als Ausgangspunkt der Darstellung genommen werden. Im Folgenden baue ich auf Überlegungen aus einer anderen Arbeit (Storck, 2016a) auf und führe diese fort.
Im Anschluss an eine Einleitung, die zu erörtern versucht, in welcher Weise der Leib auch für die Psychoanalyse zentraler Referenzpunkt bleiben muss (ob nun im 20. oder 21. Jahrhundert), soll es im zweiten Kapitel zunächst um eine Auslotung phänomenologischer Anschlüsse der Psychoanalyse gehen. Da diese einen differenzierten Begriff von Leiblichkeit voranzubringen erlauben, kann eine Grundlage dafür gelegt werden, das Verhältnis von Psyche und Soma in der Psychoanalyse zu diskutieren. Im dritten Kapitel wird es daher um einen konzeptgeschichtlichen und -kritischen Blick auf Modelle der psychoanalytischen Psychosomatik gehen. Dieser wird sich entlang einer Diskussion der Vorstellungen Freuds über die Überlegungen einiger seiner Nachfolger vollziehen, die sich vor allen Dingen an einer Konzeption der Rolle von Trieb, Affekt und Abwehr in der psychosomatischen Symptombildung orientiert haben, um dann über die Diskussion der Ansätze von Autorinnen und Autoren, welche die Bedeutung des Objekts in der psychosomatischen Erkrankung in den Mittelpunkt stellen, im vierten Kapitel zu gegenwärtig leitenden Ansätzen kommen. In diesen werden »ökonomische« Aspekte von Trieb, Affekt oder Regression mit objektbezogenen in differenzierter Weise verknüpft, und sie erlauben es schließlich, psychosomatische Erkrankungen im Zusammenhang mit einer aufgrund frühster Konflikte beeinträchtigten Fähigkeit zu Symbolisierung und Repräsentation zu denken. Ich werde dabei vorschlagen, von ihnen als strukturiert durch eine grundlegende »Verneinungsunmöglichkeit« im Sinne einer erschwerten bis fehlenden psychischen Bewältigung von Nähe und Distanz in Beziehungen auszugehen. Darauf folgend soll es im fünften Kapitel um diagnostische und differentialdiagnostische Überlegungen und Verfahren gehen, sowie daran anknüpfend um Klassifikationen im Sinne einer syndromalen diagnostischen Abgrenzung. Im Kapitel 6 werden Behandlungstechnik und Behandlungssettings im Mittelpunkt stehen. Im siebten Kapitel wird es um eine knappe Diskussion der Bedeutung von Gesellschaft und Sozialisation hinsichtlich psychosomatischer Entwicklung und Erkrankung gehen, bevor das Buch im Kapitel 8 mit einem Blick in zwei Themenbereiche psychoanalytischer psychosomatischer Forschung zum Ende gelangt: Wirksamkeit und Wirkungsweisen stationärer Settings zum einen, Alexithymie zum anderen. Das Buch wird mit einem Plädoyer für einen Blick auf Psychoanalyse als »Leibesertüchtigung« beschlossen, also als ein Verfahren des gelingenden Einbezugs des Leiblichen.
Eine wichtige Dimension der (psychoanalytischen) Psychosomatik wird sich dabei nur »zwischen den Zeilen« finden lassen, nämlich die Psychosomatik des Kindes- und Jugendalters. Da ein Großteil der Darstellung entwicklungspsychologische Überlegungen einschließt, werde ich sie nicht gesondert herausstellen (vgl. explizit Zimprich, 1995; Storck & Izat, in Vorb.). Dieses Feld würde auch den Ausgangspunkt genauerer Überlegungen zur Resilienz liefern.
Bedanken möchte ich mich bei den Herausgeberinnen und Herausgebern der Buchreihe, Cord Benecke, Lilli Gast, Marianne Leuzinger-Bohleber und Wolfgang Mertens, für die Einladung, mich mit diesem Band am Projekt zu beteiligen. Für kritische Anmerkungen zu den Abschnitten zur philosophischen Phänomenologie danke ich Heidi Wilm und Gerhard Unterthurner, bei einer Prüfung der übrigen Teile waren Hinweise von Merve Winter hilfreich. Judith Krüger danke ich für die Erstellung des Registers und die formale wie inhaltliche Prüfung des Manuskripts. Außerdem danke ich Ruprecht Poensgen und Ulrike Albrecht vom Kohlhammer Verlag für die angenehme Zusammenarbeit in der Fertigstellung des Bandes.
Heidelberg, im Dezember 2015
Timo Storck
1 Einleitung: Freud und Leib liegen nah beieinander
Einführung
In einigen ihrer zentralen Begriffe – (infantile) Sexualität, Trieb, Konversion, erogene Zone – thematisiert die Psychoanalyse seit Freud die Leiblichkeit des Menschen und dessen psychosomatische Grundverfasstheit. Dem steht gegenüber, dass zumindest Freud keine psychosomatische Krankheitslehre entwickelt hat und sich der Behandelbarkeit von Patientinnen und Patienten mit psychosomatischen Erkrankungen gegenüber sehr skeptisch gezeigt hat. Wie kann also die Psychoanalyse als Psychosomatik formuliert werden? Ein weiterer Ausgangspunkt besteht in der unhintergehbaren Interdisziplinarität der psychoanalytischen Psychosomatik: Diese berührt Felder der Medizin, Psychologie, Soziologie, Neurobiologie und Philosophie. Was ist von psychoanalytischer Seite nötig, um in einen entsprechenden Dia- bzw. Polylog einzutreten, und worin besteht ihr Beitrag zu einer psychosomatischen Anthropologie?
Lernziele
• Den psychosomatischen, d. h. leibseelischen Charakter zentraler psychoanalytischer Konzepte erkennen
• Die Art der Beteiligung verschiedener wissenschaftlicher Disziplinen an der Psychosomatik wahrnehmen und unterscheiden
• Den spezifischen Beitrag der Psychoanalyse zur Psychosomatik ausweisen
Freud und Leib liegen nah beieinander. Der Begründer der Psychoanalyse nahm nicht nur neurophysiologische bzw. neuropsychologische Überlegungen zum Ausgangspunkt, um seine Konflikttheorie oder seine Praxis der Traumdeutung und der analytischen Kur zu begründen, er formulierte auch in zentralen psychoanalytischen Konzepten und Krankheitskonzeptionen im Kern Psychosomatisches: Was könnte beispielsweise ein psychosomatischeres Geschehen sein als die Scheinschwangerschaft von Anna O., derjenigen Patientin Josef Breuers, welcher dieser und Freud bereits in den Studien über Hysterie (Freud, 1895d) die wesentlichen Bestimmungen der Psychoanalyse zuschreiben: die talking cure. Bekanntlich entwickelt Freud aus der irritierenden Konstellation, dass Anna O. fest davon überzeugt war, das einer Liebes- und Sexualbeziehung entsprungene Kind Breuers zu erwarten, einige Grundkonzepte der Psychoanalyse, insbesondere das der unbewussten Fantasie. Deren Wirkung ist hier, so muss erkannt werden, eine bidirektionale: Sie entspringt sowohl leiblichen, triebhaften, psychosomatischen Vorgängen, als sie auch auf diese zurückwirkt. Die unbewusste Fantasie bzw. der unbewusste, auf Breuer gerichtete Triebwunsch Anna O.s zeitigt somatische Ereignisse, die Scheinschwangerschaft. Hier sind psychoanalytische Begriffe von Konversion oder der später von Freud beschriebene »rätselhafte Sprung« ins Somatische bereits angelegt – ebenso wie die Konzeption der infantilen Sexualität. An dieser lässt sich nun der Hinweis auf den psychosomatischen Charakter der psychoanalytischen Theorie des Psychischen am eindrücklichsten markieren, ist es doch die Sexualität, die weder auf den Körper/Leib (zur konzeptuellen Unterscheidung beider Kap. 2), noch auf das psychische Erleben verzichten kann bzw. sich einer Spaltung beider verschließt, es sei denn im Rahmen einer (psychosomatischen) Pathologie.
Konsequenterweise beschreibt die Freud‘sche Psychoanalyse den Trieb als »Grenzbegriff zwischen Psyche und Soma« (Freud, 1915c, S. 214) bzw. als »Grenzbegriff zwischen psychologischer und biologischer Auffassung« (Freud, 1912e, S. 410 f.) und als »eine[n] der Begriff der Abgrenzung des Seelischen vom Körperlichen« (Freud, 1905d, S. 70). Deutlich wird dies auch, wenn Freud (a. a. O.) vom Trieb als der »psychische[n] Repräsentanz einer kontinuierlich fließenden, innersomatischen Reizquelle« spricht. Dies macht nicht nur deutlich, weshalb der psychoanalytische Triebbegriff sich entscheidend vom Instinkt unterscheidet, es kennzeichnet auch die vier Komponenten des Triebes, die Freud (1915c) identifiziert – Quelle, Drang, Ziel und Objekt –, als Teil einer leibseelischen Durchdrungenheit. Begreift man die Triebquelle als diejenige Körperregion, an der eine Reizung erfolgt, ferner den Triebdrang als das (quantitative) »Maß an Arbeitsaufforderung« für das Psychische, das Triebziel als diejenige (Wunsch-)Vorstellung, die in Handlung und Abfuhr umgesetzt werden soll, und schließlich das Triebobjekt als die (objektale) Repräsentanz, auf die sich der Trieb richtet, dann ist akzentuiert, in welcher Weise hier Psyche und Soma, Erregung und Vorstellung ineinander wirken.
Das wiederum hat eine Konsequenz für die Entwicklungstheorie der Psychoanalyse. Der Trieb ist hier konstitutiv für Psychisches, mit ihm ist konzeptuell auf den Begriff gebracht, in welcher Weise leibliche Empfindungen in die Repräsentation treiben – leibliche Empfindungen, die sowohl aus innerkörperlichen Zuständen erwachsen als auch aus Interaktionen mit den frühsten Bezugspersonen. Mag auch Freud (1915c) betonen, das Objekt sei das Variabelste am Trieb, so kann doch beispielsweise unter Rückgriff auf die Entwicklungstheorie Laplanches (z. B. 1987) dafür argumentiert werden, dass es das frühe Objekt ist, das der sich entwickelnden Psyche die Notwendigkeit der Repräsentation derjenigen psychosomatischen, sexuellen Vorgänge aufnötigt, mit denen erste Sinnlichkeitserfahrungen verbunden sind.
Psychische Repräsentation erwächst also aus der Leiblichkeit (ohne den Anschluss an diese zu verlieren). Freud formuliert nicht ohne Grund den oft rezipierten Befund:
»Der eigene Körper und vor allem die Oberfläche desselben ist ein Ort, von dem gleichzeitig äußere und innere Wahrnehmungen ausgehen können. Er wird wie ein anderes Objekt gesehen, ergibt aber dem Getast zweierlei Empfindungen, von denen die eine einer inneren Wahrnehmung gleichkommen kann. Es ist in der Psychophysiologie hinreichend erörtert worden, auf welche Weise sich der eigene Körper aus der Wahrnehmungswelt heraushebt. Auch der Schmerz scheint dabei eine Rolle zu spielen, und die Art, wie man bei schmerzhaften Erkrankungen eine neue Kenntnis seiner Organe erwirbt, ist vielleicht vorbildlich für die Art, wie man überhaupt zur Vorstellung seines eigenen Körpers kommt. Das Ich ist vor allem ein körperliches, es ist nicht nur ein Oberflächenwesen, sondern selbst die Projektion einer Oberfläche.« (Freud, 1923b, S. 253; Hervorh. TS).
In einer Fußnote zu Standard Edition fügt Freud Folgendes hinzu (vgl. die editorische Bemerkung zum Text in der Studienausgabe, Band 3, S. 294):
»Das heißt, das Ich leitet sich letztlich von körperlichen Gefühlen ab, hauptsächlich von solchen, die auf der Körperoberfläche entstehen. Es könnte deswegen als eine psychische Projektion der Körperoberfläche angesehen werden und nicht nur, wie wir oben gesehen haben, als Darstellung der Oberfläche des psychischen Apparates.«
In seinem Kommentar zu dieser Passage Freuds bemerkt Rangell (1986, S. 36), dass sie drei Aspekte umfasse: Erstens die »profunde Einsicht«, dass das Ich »aus dem Körper kommt« und »von Anfang an« mit diesem in Beziehung stehe, zweitens eine »subtile Feststellung, die in die Irre führen kann: Das Ich ist nicht ein Teil des Körpers; es ist keine somatische, sondern eine seelische Struktur; der Körper im Ich ist nicht die somatische Körper-Struktur, sondern deren Repräsentanz« und schließlich drittens eine »Kern-Feststellung«, die bislang kaum ausgeschöpft worden sei.1
En passant ist damit eine bis heute so anzugebende konzeptuelle Entwicklungsaufgabe für die Psychoanalyse benannt, nämlich die Erörterung des Verhältnisses von Psyche und Soma. Aber damit ist auch hervorgehoben, dass eine Reihe von Trivialisierungen oder Spaltungen droht, wenn es darum geht, Ich und Körper miteinander ins Verhältnis zu setzen. Zwar ist der Hinweis Rangells unerlässlich, dass »der Körper im Ich« als Repräsentanz auftauche, und ebenso wichtig ist der Hinweis auf die uranfängliche Beziehung zwischen Ich und Körper, jedoch hat die Geschichte der psychoanalytischen Psychosomatik auch gezeigt, in welcher Weise eine Tendenz dazu besteht, Körperliches/Leibliches als unreife Vorstufe des eigentlich Psychischen zu thematisieren und so eine Theorie des Psychischen voranzutreiben, in welcher dieses sich den Körper gleichsam vom Leib halten sollte.
Hinsichtlich zentraler Konzepte und insbesondere hinsichtlich ihrer Entwicklungstheorie kann die Psychoanalyse im Anschluss an diese erste Sichtung als psychosomatisch bezeichnet werden. Eine weitere Frage berührt allerdings die Frage, ob die psychoanalytische Behandlung dann auch eine sein kann, die psychosomatisch »wirkt«. Bereits Ferenczi (1915, S. 239 f.) bezeichnet in seinem Kommentar zu den Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie (Freud, 1905d) Freuds Vorgehen insofern als »Umsturz alles Hergebrachten«, als der Anspruch vertreten wird, dass »eine ›introspektive‹ Methode ein biologisches Problem erklären helfen könne«. Freud (1890a, S. 289) bemerkt doch wohl zurecht, dass »[d]er Laie […] es wohl schwer begreiflich finden [wird], daß krankhafte Störungen des Leibes und der Seele durch ›bloße Worte‹ des Arztes beseitigt werden sollen. Er wird meinen, man mute ihm zu, an Zauberei zu glauben.« Selbst dass der »Austausch von Worten« (Freud 1916/17, S. 9) des analytischen Gesprächs etwas an psychischem Leiden verändert, ist rätselhaft genug, und noch weitere Fragen werfen das Verstehen und Verändern leiblicher Vorgänge auf: Wie kann der Leib überhaupt verstanden werden, wo er doch als Körper (auch) Natur im Menschlichen ist?
Der Hinweis auf die Probleme, welche sich aus der Psychosomatik der Psychoanalyse für die Behandlung ergeben, führt dabei zu Freuds skeptischen Bemerkungen zur Behandelbarkeit dessen, was er aktualneurotische Erkrankungen genannt und den Übertragungsneurosen gegenüber gestellt hat: In der Arbeit beispielsweise mit hypochondrischen, angstneurotischen oder neurasthenischen Patientinnen und Patienten bilde sich keine Übertragung aus und das Symptom trage keinen Sinn, keine psychische Bedeutung (Freud 1916/17, S. 402) – insofern würden die Grundlagen einer psychoanalytischen Arbeit fehlen und vielmehr sexualpädagogische Aufklärung bzw. Anleitung angezeigt sein. Einwände gegen eine solche Haltung werden in den Kapiteln 3 und 4 Platz finden.
Aber diese Position Freuds kann verdeutlichen, dass die Psychosomatik trotz aller Hinweise auf den Körper, trotz dessen zentraler Position in Trieb- bzw. Sexualtheorie und Entwicklungstheorie, keinen selbstverständlichen Platz in der Psychoanalyse hat. Zwar gibt es verschiedene Stimmen, die dafür argumentieren, dass die psychoanalytische Theorie des Psychischen eine Grundlage für eine psychosomatische Theorie liefere (z. B. Fischbein, 2011), oder dass in Freud »der Vater der modernen Psychosomatik zu sehen« sei (de M’Uzan, 2011, S. 115), doch darf nicht übersehen werden, dass in Freuds Schriften »das Wort ›psychosomatisch‹ kaum auftaucht« (Aisenstein, 2008, S. 103; Übers. TS) und dass »die psychosomatischen Erkrankungen keinen metapsychologischen Ort« in seinen Arbeiten gefunden haben (Zepf, 2013, S. 454).
Ihnen einen solchen Ort zu geben, erfordert eine interdisziplinäre Ausrichtung, ein »Interesse der Psychoanalyse für die nicht-psychologischen Wissenschaften«, unter denen Freud (1913j, S. 407 ff.) auch das »biologische Interesse« nennt. Auch eine psychoanalytische Beschäftigung mit Psychosomatik führt also an andere Felder heran:
• an die (psychosomatische) Medizin, ohne deren Berücksichtigung schwer die Verantwortung für einen Patienten oder eine Patientin übernommen werden könnte (die chronische Darmentzündung bleibt immer auch eine Entzündung des Darmes),
• an die Soziologie im Sinne eines Einbezugs einer psychosomatischen Sozialisationstheorie, die auch Theorie des Sozialen sein muss,
• an die Psychologie, die sich als Theorie des Psychischen damit auseinandersetzt, wie der Körper in Relation zu Vorstellungen, Gedanken und Gefühlen zu setzen ist,
• an die Philosophie in deren Thematisierung von Erfahrung, Leiblichkeit oder Alterität,
• und schließlich an die Neurobiologie, die auf dem Weg zu einer Neuropsychosomatik (vgl. z. B. Henningsen, Gündel & Ceballos-Baumann, 2006; Rüegg, 2007) sowohl das Gehirn als psychosomatisch erkrankt d. h. funktionell gestört zu betrachten hilft als auch das physiologische Korrelat psychosomatopathologischer Prozesse einbezieht.
Der spezifische Beitrag der Psychoanalyse zu einer solchen, wie man formulieren müsste: psychosomatischen Anthropologie verläuft dabei über ihren eigenen Gegenstand, als welcher das (dynamisch) Unbewusste zu gelten hat (vgl. Freuds Bemerkungen dazu: 1925d, S. 96; 1926e, S. 283; außerdem zuletzt Kettner & Mertens, 2010; Gödde & Buchholz, 2011; Leuzinger-Bohleber & Weiß, 2014; Storck, 2016a). Vor dem Hintergrund dieser Gegenstandsbestimmung bringt die Psychoanalyse eine (psychische) Konflikttheorie sowie eine Theorie der Behandlungstechnik ein, in welcher (Trieb-)Wunsch und Abwehr ein In-Beziehung-Stehen strukturieren und auf klinischer Ebene Prozesse von Übertragung, Gegenübertragung und Widerstand zeitigen, denen gleichschwebend aufmerksam bzw. frei assoziierend begegnet wird.
Gelingt der Psychoanalyse solcherart ein Anschluss an die anderen an einer psychosomatischen Anthropologie beteiligten Felder, dann ist der Körper mitnichten das »Aschenputtel« der Theoriebildung der zeitgenössischen Psychoanalyse (Lombardi, 2009, S. 87), und ebenso wenig bleibt die Psychosomatik deren »Schmuddelkind« (Meyer, 1997), sondern es kann unter Rekurs auf ein offensiv vertretenes Modell von Theoriebildung und Methode (sowohl forscherisch wie klinisch-behandlungstechnisch) eine »streitlustige psychoanalytische Psychosomatik« geben, wie Haynal (2013) sie kürzlich propagiert hat (vgl. für ein »minding the body« zuletzt auch Lemma, 2014, oder für einen allgemeinen Überblick Plab, 2015).
Eine knappe Bemerkung ist noch zur Terminologie zu machen. In psychoanalytischen Arbeiten wird nicht immer genauer zwischen verschiedenen Formen psychosomatischer Erkrankungen differenziert, sondern es werden hinsichtlich der Psychodynamik oft allgemeine entwicklungspsychopathologische oder klinische Bedingungen und Prozesse identifiziert. Bevor ich im Kapitel 5 zu genaueren (differenzial-)diagnostischen und nosografisch-klassifikatorischen Überlegungen kommen werde, verwende ich den Ausdruck »psychosomatische Erkrankungen«. Darin sind diejenigen Erkrankungen einbegriffen, die in der ICD-10 als »somatoforme Störungen« auftauchen (F45), sowie die klassischerweise als »Psychosomatosen« bezeichneten Erkrankungen (ICD-10: Psychologische Faktoren und Verhaltensfaktoren bei andernorts klassifizierten Krankheiten; F54).
Zusammenfassung
In der (Freud‘schen) Psychoanalyse ergab sich anfangs ein Spannungsfeld zwischen dem Anerkennen des psychosomatischen Charakters zentraler Konzepte und dem, was sie einzubegreifen versuchen, einerseits und einer Skepsis hinsichtlich der psychoanalytischen Behandelbarkeit psychosomatischer Erkrankungen anderseits. Der theoretische und praktische Beitrag der Psychoanalyse zu dem, was man psychosomatische Anthropologie nennen kann, besteht im Einbringen der Auffassung vom dynamisch Unbewussten, von Wunsch-Abwehr-Konflikten und der spezifischen Beziehungsdynamik der klinischen Situation.
Literatur zur vertiefenden Lektüre
Freud, S. (1905d). Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie. GW V, S. 27–145.
Küchenhoff, J. (2012). Körper und Sprache. Theoretische und klinische Beiträge zu einem intersubjektiven Verständnis des Körpererlebens. Gießen: Psychosozial.
Laplanche, J. (1987). Neue Grundlagen für die Psychoanalyse. Gießen 2011: Psychosozial.
Fragen zum weiteren Nachdenken
• Was am Unbewussten ist körperlich?
• Wie wird in psychotherapeutischen Prozessen durch das Gespräch der Körper erreicht?
• Gibt es etwas in der Medizin, das nicht psychosomatisch ist?
• Wie unterscheidet sich ein instinkthaftes Verhältnis von Körper, Wahrnehmung und Verhalten von einem triebhaften?
1 Eine wesentliche Weiterentwicklung hat die Freud‘sche Formulierung vom Ich als einem körperlichen durch Anzieus (1985; vgl. a. Bick, 1968; Brosig & Gieler, 2004) Überlegungen zum Haut-Ich erfahren. Eine weitere Akzentuierung des Verhältnisses von Ich/Selbst und Körper(-bild) findet sich im Konzept des Spiegelstadiumsals Bildner der Ich-Funktion bei Lacan (1936; vgl. a. Gondek, 2010), welches ich hier vorerst übergehe, um es im Kapitel 4.6 ausführlich darzustellen.
2 Leiblichkeit
Einführung
Mit der Freud‘schen Bemerkung zum Ich als (zuallererst) einem körperlichen und ihrer grundlegenden Thematisierung innerer und äußerer »Objekte« sowie ihrer Konzeption der Objektrepräsentanz, die ohne eine Theorie des Körperlichen nicht zu denken sind, stellt sich die Psychoanalyse in eine bestimmte geistesgeschichtliche Linie. Der Anschluss an philosophische Konzeptionen von Psyche und Soma und insbesondere der Dialog mit der philosophischen Phänomenologie erlaubt es ihr, die Verhältnisse von Innen und Außen, Psyche und Soma, Selbst und Anderem, Eigenem und Fremdem auf eine nicht-triviale Weise zu denken und ihre Begriffe weiter zu entwickeln. Dabei geht es zunächst nicht um das Begreifen pathologischer Zustände oder Prozesse, sondern um grundlegende Fragen nach dem Menschen. »Wer« ist müde – mein Körper, mein Geist, mein Selbst? »Wer« ist sexuell erregt, »wessen« Herz schlägt, »wer« denkt, »wer« wird ohnmächtig, »wer« schleppt sich zur Arbeit etc.? Eine Auseinandersetzung mit solchen Fragen führt zur Unterscheidung von Leib und Körper und zu Überlegungen zur leibseelischen Verfasstheit des Individuums.
Lernziele
• Erkennen, in welche Schwierigkeit ein hierarchisches Verhältnis von Psyche und Soma führt
• Begriffe von Körper und Leib unterscheiden können
• Grundzüge einer phänomenologischen Konzeption von Leiblichkeit kennen
• Mit den Dimensionen Innen/Außen, Selbst/Anderer, Eigenheit/Fremdheit im Hinblick auf Leibseelisches vertraut sein
Freuds Skepsis und seine – womöglich wissenschafts- und berufspolitisch motivierte – Abgrenzung gegenüber der Philosophie (z. B. Freud, 1933, S. 172) ist hinreichend bekannt, ebenso wie die Explikation zentraler Bezüge seiner Theoriebildung, etwa zu Arthur Schopenhauer oder Friedrich Nietzsche (Gödde, 2009), aber auch zu Franz Brentano (Schöpf, 2013, S. 30 ff.). Mit einer Formulierung und der damit verbundenen theoretischen Konzeption wie »Das Ich ist vor allem ein körperliches« stellt er sich gleichwohl, gewollt oder nicht, in eine philosophiegeschichtlich bedeutsame Linie, sind doch Fragen nach »Ich« und »Körper« und deren Verhältnis solche, die eine Erkundung des Wesens des Menschen grundlegend sind. Diese philosophischen Probleme durchdringen unsere Alltagserfahrung: Wenn »ich« müde bin, was meine ich dann damit? »Wer« hat Sex, wenn ich mit einem Partner oder einer Partnerin schlafe? Wenn »ich« »mich« traurig, ängstlich, wütend oder euphorisch fühle, »wo« findet das statt? »Wer« kann eine Abhängigkeitserkrankung entwickeln? Wenn »ich« »meinen« »Körper« morgens ins Bad schleppe, wer macht dann was mit wem? Wie ist es zu begreifen, dass »ich« ohnmächtig werde – hat dann auch »mein« »Körper« das Bewusstsein verloren? Wenn »ich« unter Phantomschmerzen im Anschluss an eine Amputation leide (vgl. Waldenfels, 2000), habe »ich« dann Schmerzen, die »meine« sind – oder tut »mir« etwas weh, das gar nicht (mehr) »meins« ist?
Im Weiteren möchte ich aus der – meist latenten – Bezugnahme der Psychoanalyse auf die Philosophie den Aspekt herausgreifen, der für die Formulierung einer psychoanalytischen Psychosomatik zentral bleibt, nämlich die Theorie des Körpers/Leibes, und dabei in drei Schritten vorgehen:
• in Form der Gegenüberstellung zweier Weisen, das Leib-Seele-Verhältnis zu denken, bei Platon und Aristoteles,
• durch die Unterscheidung zwischen »Körper haben« und »Leib sein«,
• in einer Explikation des möglichen Anschlusses an die Phänomenologie.
Ein solcher Aufweis der Verknüpfungen zwischen Psychoanalyse und Philosophie/Phänomenologie dient nicht nur dem Zweck, Freuds Überlegungen in den geistesgeschichtlichen Rahmen zu stellen, in den sie (auch) gehören, sondern soll eine Vorbereitung dafür darstellen, die Konzepte und Theoreme der psychoanalytischen Psychosomatik auf das grundlegende Fundament eines nicht-trivialen Verhältnisses von Innen und Außen, Selbst und Anderem, Eigenem und Fremdem zu stellen.
2.1 Wer hält wen gefangen? Kurze Skizze zu Leib und Seele bei Platon und Aristoteles
Bereits in den beiden großen Werken Homers, der Ilias und der Odyssee (wobei zu beachten ist, dass seine Autorenschaft nicht für beide Werke als gesichert gilt), findet sich eine für die weitere Philosophiegeschichte2 bedeutsame Thematisierung von psyche und soma: Marzano (2013, S. 15) führt etwa an, dass in den beiden Dramen »die Figuren nicht von ihren Körpern zu trennen« seien: »Das Ich und sein Körper sind sich einig, draußen und drinnen, Oberfläche und Tiefe, Inneres und Äußeres überlagern sich ständig«. Bei Homer gebe es, so die Autorin, »kein Wort, das den Körper getrennt von der Seele beschreiben würde«. Warsitz (1989, S. 36 f.) nimmt dabei für das Werk Homers eine Art Binnendifferenzierung vor: Während in der (früheren) Ilias »der Körper, nicht die Seele« als das Selbst des Subjekts gelte, sei hingegen in der Odyssee für die Seele der Status des Selbst (autos) identifizierbar (vgl. genauer dazu Schmitz, 1965). Einen solchen Gedanken fasst auch Küchenhoff (1992, S. 18) zusammen:
»Der Autor der Ilias scheint noch keine Vorstellungen von einem körperlichen Einheitserleben im Sinne eines ganzheitlichen Körperschemas zu haben. Es ist nicht der Geist, der Wille oder sonst eine psychische Instanz, die den Körper dirigiert. Vielmehr sind die Körperteile in dem Sinne beseelt, dass ihnen eine eigene leibliche Autonomie zukommt. So wirft ein troischer oder griechischer Held nicht den Speer, sondern der Arm entsendet ihn. […] Ganz anders in der Odyssee; Odysseus ist der Held, der sich seines Körpers bedient, dessen Autonomie nicht körperlich ist oder eine Autonomie von Körperteilen bedeutet, sondern die geistig bestimmt ist, der der Körper dienstbar gemacht wird.«
Der Wandel ist zwiespältig: Während zwar von einer »Entstehung des Subjekts«, die sich zwischen beiden Werken verorten lasse, die Rede sein kann (Küchenhoff, a. a. O.), so bringt die Autonomie der Seele bzw. des Geistes auch eine eigentümliche Exterritorialisierung des Körpers mit sich, der mal ausführendes Organ, mal Störgröße, mal rätselhafter Gegenspieler wird. Küchenhoff (a. a. O., S. 19) nennt das in der Odyssee auffindbare Verhältnis von Körper und Seele »hierarchisch« und »antilogisch«: »Körperliche Autonomie im Sinne der Ilias gefährdet die persönliche Subjektivität, umgekehrt restringiert diese Subjektivität die körperlichen Ausdrucksmöglichkeiten.«
Es ist also etwas problematisch an der psychischen Autonomie, der Herrschaft der Psyche und deren Absichten. Noch deutlicher als im Werk Homers werden divergierende Konzepte des Verhältnisses von Seele und Körper/Leib in einem Vergleich der Konzeptionen bei Platon und Aristoteles. So benennt etwa Waldenfels (2000, S. 17) die Tendenz des Erstgenannten, »das Somatische auf eine niedere Seinsstufe zu rücken«, während Seele und Leib beim Letztgenannten stärker miteinander verbunden seien und die Seele die Form des Leibes sei: »die Seele durchformt den Leib«. Auch Marzano (2013, S. 16 ff.) thematisiert die »Teilung zwischen Körper und Seele« bei Platon, weist aber darauf hin, dass vor allem die Rezeption der Werke Platons eine solche verfestigt habe, so dass gemeinhin die Platonische Ideenlehre als eine tendenziell a-somatische wahrgenommen wird. Bei Platon ist der Körper Spiel- bzw. Denk-Verderber des Individuums: »Die Seele kann […] dem Seienden nur nahe kommen im Akt des Denkens, dann also, wenn sie sich von dem Körper und seinen Ansprüchen gelöst hat. Die Seele ist […] Sitz […] des reinen Denkens, was den Menschen vom Tier unterscheidet« (a. a. O., S. 17). Zwar ist in dieser Vorstellung der Mensch im Körper gefangen, insofern er »Sklave der körperlichen Bedürfnisse« ist (a. a. O.), doch prinzipiell davon loslösbar, um Freiheit zu erlangen bzw. vermittels seiner Seele als »Element des Ewigen und Göttlichen« an der »Schau der Ideen« teilzuhaben: »Die Seele kann die Wahrheit erkennen, der Körper sie nur verhüllen. Die Seele kann Vollkommenheit erlangen, der Körper hingegen ist nicht mehr als ein Hindernis« (a. a. O., S. 18). Dabei erscheint die Frage nach der Auto-nomie wieder auf: Für Platon ist idealtypisch einzig die Seele selbstbestimmt und »autokinetisch« (Küchenhoff, 1992, S. 22): »Der Körper hingegen wird bewegt, seine Bewegung wird durch die Seele initiiert und ist also fremdbestimmt.« Skandalös dabei ist nun, dass und wenn der Körper »eigenmächtig, sich nicht an der Seelenmacht orientierend, Eigenbeweglichkeit entfaltet« (König, 1989, S. 32; zit. n. Küchenhoff, 1992, S. 22). Drei Möglichkeiten gibt es für Platon, mit diesem somatischen Ärgernis fertig zu werden: den Tod, die Disziplinierung und die »Veredelung« des triebhaften Körpers als einer Vergeistigung (vgl. zum psychoanalytischen Sublimierungskonzept, das hier anklingt, Storck & Soldt, 2007). Küchenhoff weist darauf hin, dass hier keinerlei Harmonie von Körper und Seele angestrebt wird oder denkbar ist: »zu sehr ist der Körper das Gefängnis der Seele« (a. a. O., S. 23). Zwar ist einerseits die Seele Sklavin des Körpers und dessen Verlangen ausgeliefert, andererseits ist es die Aufgabe des Individuums, den Körper zu unterwerfen, ihm seine triebhafte Eigenbestimmtheit auszutreiben, so dass »in jedem von uns ein Krieg gegen uns selbst« stattfindet (Platon in den Nomoi, zit. n. Küchenhoff, a. a. O., S. 22). Das ist auch deshalb problematisch, weil auf diese Weise etwa Affektivität oder Sexualität unter der Hand prinzipiell als denkfeindlich oder unreif angesehen werden müssten.
Warsitz (1989, S. 37) weist nun auf das entgegengerichtete Anliegen Aristoteles’ hin, die Seele aus diesem Gefängnis der platonischen Ideenlehre samt deren hierarchischer Dualisierung zu befreien. Er tue dies auf der Grundlage seines Konzepts einer Entelechie des (lebendigen biologischen) Körpers, die verstanden wird als eine »energetische Tendenz, die sich zunächst als Möglichkeit der Veränderung, der Entwicklung bestimmen lässt«. Die Seele sei dabei, wie oben mit Waldenfels kurz benannt, »die Form oder die Gestalt eines Körpers«, welcher vermittels seiner Lebendigkeit formendes Potential hat: »In der biologischen Substanz wirkt die Seele als Möglichkeit einer Entwicklung […], in verwirklichter Form ist die Seele die Energie […] des Körpers, seine Gestalt« (a. a. O., S. 38). Hier wird im Vergleich zum Modell Platons etwas in entscheidender Weise umgewendet: Statt dass der Körper die Freiheit oder Tätigkeit der Seele stört, für sie ein Gefängnis bedeutet oder sich sie zur Sklavin macht, ist er nun das Prinzip von Lebendigkeit, Formgebung und Entwicklung. Das ist deshalb eine Herausforderung für unsere – platonisch inspirierte – Denkgewohnheit, als hier gerade keine Antinomie oder Trennung von Seele und Körper gedacht werden soll. Küchenhoff (1992, S. 24) markiert den lebendigen Körper folglich als »Gepräge« oder »Formprinzip«, und Warsitz (1989, S. 54) formuliert diese Figur konsequent psychoanalytisch-besetzungstheoretisch, wenn er darauf hinweist, dass hier das Ich aus Besetzungen gebildet ist statt dass es diese autonom aussendet.
Was lässt sich in der Gegenüberstellung der Positionen Platons und Aristoteles zeigen? Während das platonische, idealistische Modell den Blick auf den Körper als Gefängnis der Seele nahelegt und ein hierarchisches, antinomisches Verhältnis zwischen beiden voranbringt, kann unter Bezugnahme auf Aristoteles eine Konzeption gestützt werden, in welcher die Lebendigkeit des Körpers nicht schlicht Störmoment des Denkens oder dessen Verunreinigung durch Naturhaftes ist, sondern konstitutives, formgebendes Moment und die Realisierung einer Potenzialität der Psyche. Insbesondere für den Durchgang durch die Geschichte der Theorieentwicklung in der psychoanalytischen Psychosomatik im Kapitel 3 wird es wichtig bleiben, ein eher platonisch-idealistisch geprägtes Modell, in welchem Körperliches irgendwie verdächtig bleiben muss, und eines, in welchem Psychisches sich einer Durchströmtheit mit naturhafter Lebendigkeit verdankt, zu unterscheiden.
Dabei ist wichtig, Konzeptionen nachzuspüren, die nicht nur einer Psyche-Soma-Hierarchisierung eine Absage erteilen, sondern auch versuchen, ein wechselseitiges Durchdrungensein in nicht-dissoziativen Termini zu formulieren – das sind im vorliegenden Zusammenhang solche der phänomenologischen Philosophie.
2.2 Körper haben und Leib sein
Bevor ich zu einer Darstellung dieser komme, die sich bereits an einer Engführung auf psychoanalytisch besonders anschlussfähige Überlegungen orientieren wird, möchte ich eine begriffliche Gepflogenheit konkretisieren: die Unterscheidung zwischen Leib und Körper. Weder im Englischen (wo es sich um den »body« dreht) noch im Französischen (wo von verschiedenen Autoren darum gerungen wird, in den »corps« eine Differenzierung einzuziehen) gibt es auf sprachlicher Ebene zunächst die Möglichkeit einer solchen Unterscheidung, wie es im Deutschen der Fall ist. Spricht man vom Körper, dann umfasst dies eben neben der menschlichen oder tierischen Anatomie auch den physikalischen Körper im allgemeineren Sinn (etwa einen Schreibtisch, aber auch einen Himmelskörper) oder den mathematischen (z. B. einen Würfel). Spreche ich vom menschlichen Soma als einem Körper, dann stelle ich es damit in eine Reihe mit diesen anderen Körpern. Ganz offensichtlich ist dabei mein »Körper« auch ein physikalischer.
Die Philosophie, insbesondere die Phänomenologie, bietet hierfür eine terminologische und damit auch konzeptuelle Unterscheidung an (vgl. a. Waldenfels, 2000; Fuchs, 2011/12; Wiegerling, 2008), die üblicherweise dem anthropologischen Philosophen Plessner (1928, S. 294) zugeschrieben wird, der zwischen »Leib sein« und »Körper haben« zwar unterscheidet, jedoch für den Menschen von einem »unaufhebbaren Doppelaspekt[.]« spricht. Hier erscheinen offenkundig die beiden Aspekte des Leib-Seele-Verhältnisses bei Homer bzw. Platon und Aristoteles wieder. Einerseits geht es um denjenigen Körper, über den ich autonom verfügen zu können glaube: Ich »habe« ihn und kann mit ihm etwas anstellen bzw., wenn er sich dem nicht fügt, er mit mir. Und andererseits wird eine Figur thematisch, in welcher ich Leib »bin«, von einem solchen durchformt und ununterscheidbar. Auch bei Mauss oder dem noch genauer zu Wort kommenden Merleau-Ponty spielt eine solche Unterscheidung zwischen dem »Leib, der ich bin«, und dem »Körper, den ich habe«, eine Rolle.3
Etwa mit Küchenhoff (1987, S. 82 f.) kann dabei nun der von Plessner benannte Doppelaspekt über eine Dynamik des Changierens beschrieben werden: »Als Leib bin ich mir Subjekt, ich lebe als mein Leib, als Körper vergegenständlicht sich mir der Leib zum Objekt, das ich habe.« Wiegerling (2008, S. 68) bezeichnet »Leib« als »symbolische[n] Relationsbegriff«, der »auf seine Konstitutiva Natur und die Kultur verweist, [..der] als Zentrierungsorgan die Welt auf uns fokussiert und […] dieses beseelte Stück Natur ist, das unsere besondere Zeitlichkeit markiert«. Damit ist angedeutet, dass zwischen dem erlebten und dem gelebten Körper eine Trennung nur entweder abstrakt oder passager erfolgt: Ich kann meinen Körper als das erleben, das ich für einen gelingenden Hundert-Meter-Lauf in geeigneter Geschwindigkeit in Bewegung versetze, und in dieser Weise eine bestimmte innere Wahrnehmungseinstellung einnehmen. Oder aber ich erfahre »mich« in der Bewegung selbst auf leiblich-sinnliche Weise, und dabei ist eine Trennung zwischen der Instanz, die Absichten hat, und der Instanz, welcher diese vermittelt werden, im Erleben aufgehoben enttarnt. Fuchs (2000, S. 334) bindet eine solche Figur an den Gedanken der Konstituierung der »Person« an (vergleichbar mit dem Selbst als autonomem wie oben dargestellt), die er als ein »Wesen« versteht, »das sich seinem leiblichen Erleben gegenüberzustellen vermag; das einen exzentrischen Standpunkt einnimmt«.4
Diese Überlegungen haben einen hohen, auch interdisziplinären Stellenwert, wenn man sich etwa vergegenwärtigt, das von einem »corporeal turn« und einer besonderen Rolle des Leiblichen in aktuellen philosophischen Entwürfen (vgl. Alloa et al., 2012) gesprochen werden kann, eine Wende, die wie andere (linguistischer, ikonischer oder sonstiger Art) eben nicht nur das Feld einer einzelnen Wissenschaft umwendet, sondern Folgerungen für die Geistes- oder Humanwissenschaften als ganze nach sich zieht.
Die begrifflichen Möglichkeiten, die sich aus einer solchen Weise der Beschreibung von Erfahrung ergeben, werde ich im nächsten Kapitel zur Phänomenologie entwickeln. Ich schließe mich im Weiteren der Praxis an, vom »Leibkörper« zu sprechen, wenn es um den Plessner‘schen Doppelaspekt geht. Ferner werde ich mit »leibseelisch« diejenige unaufhebbare Durchdrungenheit psychischer und leibkörperlicher Ebenen miteinander bezeichnen, als welche sich die menschliche Erfahrung darstellt.
Fallvignette Frau E., Teil 1
Die Bedeutsamkeit einer solchen Herangehensweise, in der das menschliche Leib-Seele-Verhältnis sich durch ein Changieren zwischen Körper-Haben und Leib-Sein bzw. dem erlebten und erlebenden Leib bestimmt und sich nicht zuletzt in der »Störung« dessen zu erkennen gibt, kann anhand eines knappen klinischen Kommentars demonstriert werden (vgl. ausführlich Storck, 2016a; 2016b; Storck & Warsitz, 2016). Die 52-jährige Patientin Frau E. sucht eine teilstationäre Psychotherapie auf, da sie an »Ganzkörperschmerzen« leide, die »durch den Körper wandern« (außerdem an Migräne, einer COPD, Schlafstörungen, Hypervigilanz und verschiedenen Allergien). Im Verlauf der Behandlung berichtet Frau E. auf betont flapsig-burschikose Weise von einer zurückliegenden Total-OP (der Entfernung von Gebärmutter und Eierstöcken) und einer unvollständig durchgeführten Kürettage. Auch formuliert sie gegenüber den Behandelnden zu ihren aktuellen Beschwerden mehrmals: »Ich will es weghaben« und verweist damit auf eine bestimmte Sicht auf ihre Erkrankung und die Symptomatik. Frau E., so wird im Verlauf der Behandlung aus der Biografie deutlich, hat einige Jahre als Prostituierte gearbeitet und in ihren Schilderungen zeigt sich eine Figur, in der sie ihren Körper hergibt und verkauft, ihn jemand anderes gebrauchen lässt, jedoch weitestgehend unklar bleibt, wie es um ihre Leiblichkeit bestellt ist. Es ergeben sich verschiedene Hinweise, dass das leibseelische Changieren hier zu einer Spaltung geworden ist, in welcher bestimmte somatische Aspekte abgetrennt werden (»es weghaben«, den Körper verkaufen) und andere von einer rätselhaften Präsenz bestimmt sind (etwas wandert durch den Körper, die Überreste der Kürettage). Der weitere Verlauf der Darstellung wird zeigen können, wie hier auch bestimmte Formen der Objekt(re)präsentation und deren Zurückweisung (die »total« entfernte Mutter beispielsweise) eine zentrale Rolle spielen.
2.3 Phänomenologische Bezüge der Psychoanalyse
Box 1: Phänomenologie
Als philosophische Richtung und Methode wurde die Phänomenologie ab dem Ende des 19. Jahrhunderts durch Edmund Husserl (1859–1938) begründet. Husserls Lebenszeit deckt sich nicht nur nahezu vollkommen mit der Sigmund Freuds, beide teilen zudem einen Bezug zu Franz Brentano (dessen Vorlesungen beide besuchten), auf dessen Lehre vom intentionalen Bewusstsein Husserl seine Überlegungen aufbaut. Die Zeitgenossen Husserl und Freud selbst sind allerdings in keinen Austausch getreten. Husserl ging es um die Begründung der Philosophie als erster Wissenschaft und dies dahingehend, in einem »Zurück zu den Sachen selbst« einen Weg zu finden, die Welt der Phänomene losgelöst von Vorurteilen oder Vorannahmen zu untersuchen. Eine »Wesensschau« liefert dazu die Möglichkeit, unter Vollziehen eines Einklammerns all dessen, was nicht Teil des Phänomens ist. In einem solchen Vorgehen werden Begriffe der Erfahrung und damit auch der Wahrnehmung zentral: Um »die Sachen selbst« untersuchen zu können, bedarf es notwendigerweise einer Untersuchung dessen, wie die Sachen sich dem Bewusstsein zeigen und zwar von diesen ausgehend betrachtet. Dies wiederum führt zum Erfordernis einer Theorie der Intentionalität, d. h. des Wie und Wodurch dessen, dass Bewusstsein immer Bewusstsein von etwas ist. Dieses Etwas, das Phänomen als Gegenstand der Phänomenologie, ist zu untersuchen, indem die Bedingungen geklärt werden, das Wie ihres Erscheinens. Darin wird nur scheinbar bzw. zunächst eine Spaltung zwischen Subjekt und Objekt vorgenommen: ein nicht-triviales Konzept der Intentionalität im Husserl‘schen Sinn untersucht Wahrnehmungsvollzug und Wahrgenommenes als Teile eines Ganzen, nämlich des Phänomens, und bietet theoretisch und methodisch damit die Möglichkeit des Aufweises von Regelstrukturen der Erfahrung.
Fortgeführt wird dies u. a. durch die Arbeiten Maurice Merleau-Pontys (1908–1961). Merleau-Ponty bringt eine Konzeption des Leiblichen voran, die einer Aufteilung in Subjekt und Objekt bzw. Selbst und Objekt phänomenologisch eine Absage erteilt und die leibseelische Verfasstheit des Menschen über die Figur des »Chiasmus«, der Verschränkung, zu denken erlaubt. Er bereitet damit auch die Arbeiten Bernhard Waldenfels’ (*1934) vor, dessen Beiträge (u. a. im Rekurs auf die Arbeiten von Emanuel Levinas oder Paul Ricoeur) besonders den Aspekt der Fremdheit oder Alterität hervorheben. Dabei ist für seine Konzeption eine Figur wie die der Responsivität entscheidend oder auch der Gedanke eines Pathischen in der Erfahrung, ein Getroffensein, das den klassisch-phänomenologischen Gedanken einer (mehr oder weniger) aktiven Intentionalität des Bewusstseins um ein Ausgesetztsein der Erfahrung angesichts der Phänomene erweitert.
Literatur
Husserl, E. (1936). Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie: Eine Einleitung in die phänomenologische Philosophie. Hamburg 1996: Meiner.
Merleau-Ponty, M. (1964). Das Sichtbare und das Unsichtbare. München 1986: Fink.
Waldenfels, B. (2000). Das leibliche Selbst. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
Insbesondere für eine psychoanalytische Theorie der Psychosomatik bzw. des Leiblichen eignet sich ein Einbezug der philosophischen Phänomenologie und zwar insofern, als diese Verhältnisse in nicht-trivialer Weise zu denken erlaubt (vgl. gar zu einem Founding psychoanalysis phenomenologically Lohmar & Brudzinska, 2012). Hinzu kommt, dass Psychoanalyse und Phänomenologie einen bestimmten Begriff von Empirie miteinander teilen, der zumindest für erstere einer forschungsmethodischen Explizierung noch weitestgehend harrt. Auch wenn dabei, wie Cremonini (2012, S. 187) herausstellt, Freuds Bemerkung zum Ich als eines körperlichen, einen – wenn auch »dürftige[n]« – Anknüpfungspunkt für eine »leibphänomenologische Rekonstruktion der Psychoanalyse« bietet, so bleibt es doch weiterer Forschung überlassen, die Bezüge zu konkretisieren.
Oben habe ich auf das hingewiesen, was Wiegerling (2008, S. 130) die »Provokation für die Architektur des Erkennens« durch die Leiblichkeit nennt.