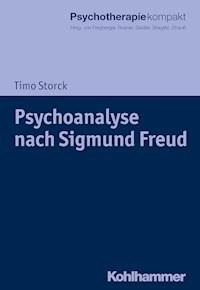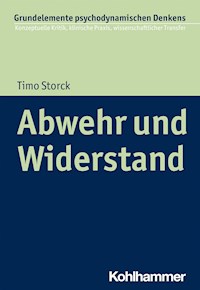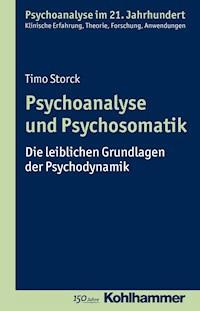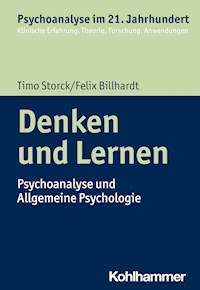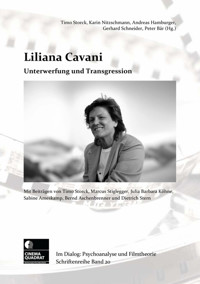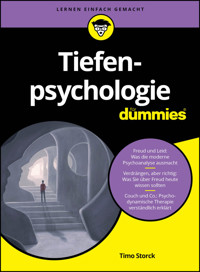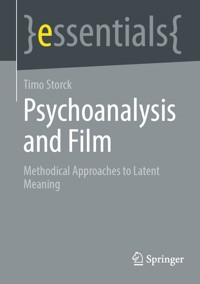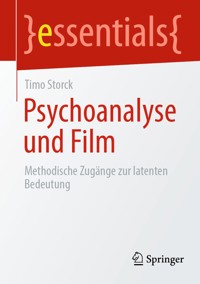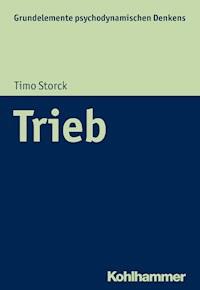
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Im ersten Band der Reihe werden Freuds Bemerkungen zum Trieb vorgestellt und kritisch erörtert, insbesondere die Charakterisierung des Triebs als "Grenzbegriff zwischen Somatischem und Psychischem". Es findet eine Einordnung verschiedener Fassungen des Konzepts in der Entwicklung des Freud'schen Werkes statt. Mit den Konzeptionen bei Melanie Klein und Jean Laplanche werden zwei Linien der Weiterentwicklung akzentuiert. Zudem findet das Verhältnis von Trieb und Affekt Erwähnung. Schließlich wird geprüft, wie sich das Triebkonzept in Relation zu psychologischen Motivationstheorien, zur Neurobiologie und zur Konzeptualisierung vergleichbarer klinischer Phänomene durch andere therapeutische Richtungen setzen lässt. Falldarstellungen dienen der Veranschaulichung der Konzeptionen. Hierzu erhältlich: Memorystick mit Video aller fünf Vorlesungen (978-3-17-034651-2).
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 257
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Autor
Timo Storck, Prof. Dr. phil., Jahrgang 1980, ist Professor für Klinische Psychologie und Psychotherapie an der Psychologischen Hochschule Berlin und Psychologischer Psychotherapeut (AP/TP). Studium der Psychologie, Religionswissenschaften und Philosophie an der Universität Bremen, Diplom 2005. Wissenschaftlicher Mitarbeiter an den Universitäten Bremen (2006–2007), Kassel (2009–2015) sowie an der Medizinischen Universität Wien (2014–2016). Promotion an der Universität Bremen 2010 mit einer Arbeit zu künstlerischen Arbeitsprozessen, Habilitation an der Universität Kassel 2015 zum psychoanalytischen Verstehen in der teilstationären Behandlung psychosomatisch Erkrankter. Mitherausgeber der Zeitschriften Psychoanalyse – Texte zur Sozialforschung und Forum der Psychoanalyse sowie der Buchreihe Im Dialog: Psychoanalyse und Filmtheorie, Mitglied des Herausgeberbeirats der Buchreihe Internationale Psychoanalyse. Forschungsschwerpunkte: psychoanalytische Theorie und Methodologie, psychosomatische Erkrankungen, Fallbesprechungen in der stationären Psychotherapie, Kulturpsychoanalyse, konzeptvergleichende Psychotherapieforschung.
Timo Storck
Trieb
Verlag W. Kohlhammer
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen und sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche gekennzeichnet sind.
Es konnten nicht alle Rechtsinhaber von Abbildungen ermittelt werden. Sollte dem Verlag gegenüber der Nachweis der Rechtsinhaberschaft geführt werden, wird das branchenübliche Honorar nachträglich gezahlt.
1. Auflage 2018
Alle Rechte vorbehalten
© W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Gesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Print:
ISBN 978-3-17-033748-0
E-Book-Formate:
pdf: ISBN 978-3-17-033749-7
epub: ISBN 978-3-17-033750-3
mobi: ISBN 978-3-17-033751-0
Video der Vorlesungen auf Memorystick:
ISBN 978-3-17-034651-2
Für den Inhalt abgedruckter oder verlinkter Websites ist ausschließlich der jeweilige Betreiber verantwortlich. Die W. Kohlhammer GmbH hat keinen Einfluss auf die verknüpften Seiten und übernimmt hierfür keinerlei Haftung.
Inhalt
Vorwort
1 Einleitung
2 Was sind psychoanalytische Konzepte?
3 Die Triebtheorie bei Freud
3.1 Der psychosomatische und sozialisatorische Trieb
3.2 Drang, Objekt, Ziel, Quelle
3.3 Trieb als Sexualtrieb: Partialität, erogene Zonen, Libido
3.4 Trieb und Neurose
3.5 Fallbeispiel Antonia
3.6 Das Problem der Aggression: Todestrieb
3.7 Kultur und Triebverzicht
3.8 Fallbeispiel Auke
4 Trieb und Objekt in Entwicklungstheorien des Triebes
4.1 Trieb und unbewusste Phantasie bei Melanie Klein
4.2 Trieb und »allgemeine Verführung« bei Jean Laplanche
4.3 Fallbeispiel Anna
5 Trieb und Affekt
5.1 Freuds Affektverständnis
5.2 Die Affekttheorie André Greens
5.3 Die Affekttheorie Otto F. Kernbergs
5.4 Die Affekttheorie Siegfried Zepfs
5.5 Gemeinsamkeiten und Unterschiede
5.6 Fallbeispiel Leo
6 Trieb interdisziplinär
6.1 Ist die Triebtheorie eine Triebpsychologie?
6.2 Trieb und Motivationstheorien
6.3 Trieb und Neurobiologie
6.4 Klinische Praxis: Braucht die kognitive Verhaltenstherapie ein Triebkonzept?
6.5 Fallbeispiel Frau K.
7 Ausblick
Literatur
Verzeichnis der zitierten Medien
Stichwortverzeichnis
Vorwort
Beim vorliegenden Band handelt es sich um eine bearbeitete Mitschrift von fünf öffentlichen Vorlesungen, die ich im Wintersemester 2016/17 an der Psychologischen Hochschule Berlin gehalten habe. Die Vorlesungsreihe ist Teil eines langfristig angelegten Projekts zu den Grundelementen psychodynamischen Denkens, in dem es unter der dreifachen Perspektive »Konzeptuelle Kritik, klinische Praxis, wissenschaftlicher Transfer« darum geht, sich mit psychoanalytischen Konzepten auseinanderzusetzen: Trieb (Band 1), Sexualität und Konflikt (Band 2), Das dynamisch Unbewusste (Band 3), Objekte (Band 4) und einige weitere. Ziel ist dabei, sowohl in der öffentlichen Diskussion, als auch im vorliegenden Format einer Reihe von Buchpublikationen eine Art kritisches Kompendium psychoanalytischer Konzepte zu entwickeln, ohne dabei den Anschluss an das Behandlungssetting oder den wissenschaftlichen Austausch zu vernachlässigen. Die Buchreihe, deren erster Band hier vorliegt, wird ergänzt durch Videomaterial zu den Vorlesungen. Wenn es um Grundelemente psychodynamischen Denkens gehen soll, dann soll damit auch der Hinweis darauf gegeben werden, dass aus Sicht der Psychoanalyse jedes, also auch das wissenschaftliche, Denken selbstreflexiv ist: Das Denken über Psychodynamik ist unweigerlich selbst psychodynamisch, d. h. es erkundet die Struktur der Konzeptzusammenhänge auch auf der Ebene der Bedeutung von Konzeptbildung selbst.
Für ein solches Vorgehen ist das Werk Freuds der Ausgangs- und ein kontinuierlicher Bezugspunkt. Mir geht es um eine genaue Prüfung dessen, was Freud mit seinen Konzepten »vorhat«, d. h. welche Funktion diese haben und welches ihr argumentativer Status ist. Dabei soll nicht eine bloße Freud-Exegese geschehen, sondern eher ein Lesen Freuds »mit Freud gegen Freud«. Es wird deutlich werden, dass der grundlegende konzeptuelle Rahmen, den Freud seiner Psychoanalyse gibt, es auch erlaubt, aufzuzeigen, wo er hinter den Möglichkeiten seiner Konzeptbildung zurückbleibt.
Über den Ausgangspunkt der Vorlesungen erklärt sich die Form des vorliegenden Textes, der nah an der gesprochenen Darstellung verbleibt. Auch ist, wie in jeder Vorlesung, eine Reihe von inhaltlichen Bezugnahmen auf Arbeiten anderer Autorinnen und Autoren eingeflossen, die mein Denken grundlegend beeinflussen, ohne dass dazu durchgängig im Detail eine Referenz erfolgt. Für das Triebkonzept im Besonderen verdankt mein Denken den Arbeiten von Müller-Pozzi (2008) oder Laplanche (2007) viel. Der Gedanke, konsequent einer »psychosomatischen« Konzeption des Triebes zu folgen, ruht auf Überlegungen Küchenhoffs (z. B. 2008).
Bedanken möchte ich mich bei den Autorinnen und Autoren, die sich damit einverstanden erklärt haben, dass ich im vorliegenden Rahmen von ihnen publiziertes Material aus Behandlungen verwende – und bei den Verlagen, in denen dieses veröffentlicht wurde. Dank gebührt außerdem den Teilnehmenden an den öffentlichen Vorlesungen für ihr Interesse, sowie beim Kohlhammer Verlag, namentlich Ruprecht Poensgen und Ulrike Albrecht, für die Unterstützung bei der Vorlesung und der Veröffentlichung. Außerdem danke ich Judith Krüger und Janna Otten für die Anfertigung von Transkripten zur Audio-Aufzeichnung und Katharina Schmatolla für die planerische, emotionale und technische Unterstützung bei der Durchführung der Vorlesungen. Der Psychologischen Hochschule Berlin danke ich schließlich für die Möglichkeit, eine solche Vorlesungsreihe durchzuführen.
Heidelberg, September 2017
Timo Storck
1 Einleitung
In der öffentlichen Vorlesung »Grundelemente psychodynamischen Denkens« geht es mir um drei Bereiche:
Das ist erstens der Bereich der konzeptuellen Kritik, also eine Prüfung der psychoanalytischen Konzepte, ihres argumentativen Status und der Entwicklung bis heute. So wichtig und interessant es bis heute ist, was sich bei Freud dazu finden lässt, hat sich die konzeptuelle Geschichte der Psychoanalyse nicht vor 80 Jahren erledigt, sondern sie ist lebendig weitergegangen.
Zweitens geht es um die klinische Praxis, das heißt darum, den Bezug zu Behandlungen herzustellen, wie sie heute stattfinden. Dabei spielt es auch eine Rolle, das psychoanalytische Vorgehen mit dem Vorgehen in anderen psychotherapeutischen Verfahren zu vergleichen und in Bezug zu setzen. Das schließt es ein, im Hinblick auf die Konzepte zu prüfen: Wie stellen sich andere psychotherapeutische Verfahren und deren Störungs- und Veränderungstheorie ähnliche Phänomene vor, die in der Psychoanalyse in bestimmten Konzepten gefasst sind?
Drittens ist mir der wissenschaftliche Transfer wichtig. Es soll darum gehen, die psychoanalytischen Konzepte in Relation zu setzen zu psychologischen Theorien und an einigen Stellen auch zu anderen wissenschaftlichen Theorien und Ergebnissen. Das bedeutet auch, sie für eine wissenschaftliche Interdisziplinarität anschlussfähig zu machen. Beim Triebkonzept etwa gibt es eine naheliegende Brücke zur Neurobiologie, von deren Begrifflichkeiten es sich in einigen Punkten offensichtlich unterscheidet, in der aber gleichzeitig der Versuch zu sehen ist, etwas Ähnliches fassbar zu machen.
Ich werde eingangs etwas zum Rahmen der Überlegungen darstellen, nämlich im Hinblick auf psychoanalytische Konzepte zu definieren, was ich unter einem Konzept und unter »Psychoanalyse« und »psychoanalytisch« verstehe (Kap. 2), bevor ich zum Triebkonzept im Besonderen komme. Beginnen werde ich dabei mit einer Darstellung von Freuds Konzeption (Kap. 3). Dabei werde ich mich vorrangig an der Arbeit Triebe und Triebschicksale (Freud, 1915c) orientieren, weil sich dort die m. E. zentralen Merkmale des Triebes finden lassen, wie Freud sie beschreibt. Zum einen das, was man als den »psychosomatischen« Charakter des Triebes in konzeptueller Hinsicht verstehen kann, zum anderen die weiteren Merkmale: Sein Wirken als »konstante Kraft« oder die Unterteilung in Drang, Ziel, Objekt und Quelle des Triebes. Eine knappe Diskussion der Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie (Freud, 1905d) wird das um weitere Aspekte ergänzen, in erster Linie um die Freud’schen Überlegungen zum Partialtrieb. Im Anschluss an Hinweise dazu, was der Trieb mit der Neurose zu tun hat, werde ich ein Fallbeispiel im Licht der Freud’schen Überlegungen diskutieren. Freuds Bemerkungen zum Trieb umfassen auch die Frage nach der Rolle der Aggression und schließlich die Konzeption der Kultur als etwas, das auf »Triebverzicht« (sexueller und aggressiver Art) aufgebaut ist. Anhand eines weiteren Fallbeispiels wird die Bedeutung der Aggression erörtert werden. Im darauffolgenden Abschnitt (Kap. 4) geht es um zwei wichtige psychoanalytische Weiterentwicklungen der Freud’schen Triebtheorie, in denen jeweils das Verhältnis von Trieb und Objekt (zur Wahl dieser Terminologie s. u.) genauer beleuchtet wird: Die Ansätze Melanie Kleins und Jean Laplanches. Dabei spielen die Konzepte der unbewussten Phantasie einerseits und der rätselhaften Botschaften andererseits als Elemente früher Entwicklungsprozesse in Relation zum Trieb eine bedeutende Rolle. Auch diese Überlegungen werden durch ein Fallbeispiel, hier aus einer Kinderbehandlung, ergänzt. Im nächsten Kapitel (Kap. 5) werde ich das Verhältnis von Trieb und Affekt in unterschiedlichen Konzeptionen diskutieren. Angefangen mit Freuds (wenig ausgearbeiteter) Theorie der Affekte wird der Gang der Darstellung den Weg über die Ansätze André Greens, Otto F. Kernbergs und Siegfried Zepfs nehmen. Dabei werden die unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen und Referenzpunkte deutlich werden, es wird sich aber auch zeigen, wie alle drei Ansätze als Weiterführung Freud’scher Überlegungen angesehen werden können; auch hier soll ein Fallbeispiel das Gesagte veranschaulichen. Daran anknüpfend (Kap. 6) geht es um interdisziplinäre und schulenübergreifende Aspekte der psychoanalytischen Triebtheorie. Dazu werde ich zuerst diskutieren, ob diese als eine (psychologische) Motivationstheorie aufzufassen ist, und sie in Relation zu Ansätzen zu Motiven und Motivation in der Psychologie setzen. Ebenfalls werde ich die Bedeutung des Triebes gegenüber Konzepten der Neurobiologie betrachten und schließlich knapp untersuchen, welche Motivationsauffassungen die Grundlage für andere psychotherapeutische Verfahren bilden. Ein Fallbeispiel aus einer kognitiv-verhaltenstherapeutischen Behandlung dient zur Weiterführung der Gedanken. Ich schließe mit einem Ausblick (Kap. 7) auf die durch das hier Dargestellte möglich und nötig werdende Diskussion weiterer Konzepte.
2 Was sind psychoanalytische Konzepte?
In einem Videoclip aus der Sesamstraße sehen wir das Krümelmonster beim Versuch einer Demonstration des Unterschieds zwischen »schnell« und »langsam«. Dazu isst es erst einen Keks schnell – und bei seinem anschließenden Versuch, einen weiteren Keks langsam zu essen, sehen wir, wie das Krümelmonster immer stärker in einen Zustand gerät, in dem es seine Erregung kaum noch beherrschen kann, bis dahin, dass es schließlich auch den eigentlich langsam zu essenden Keks herunterschlingt: »Ich sag’s ganz ehrlich: Ich kann’s besser schnell.«…1
Das Krümelmonster, das einen Keks langsam zu essen versucht, scheitert an dem, was man psychoanalytisch im Zusammenhang des sekundärprozesshaften Funktionierens beschreiben kann, d. h. es gibt keine Möglichkeit von Triebaufschub oder ein Verschieben der Triebbefriedigung oder des Verlangens, welches das Krümelmonster nach dem Verzehr des Kekses hat. Wie kann nun der Sprung vom Krümelmonster zu Freud bzw. einer Theorie des Psychischen oder des Triebes gefunden werden? Was unterscheidet eine Darstellung in der »Sesamstraße«, die den Unterschied zwischen »schnell« und »langsam« auf diese Weise erklärt, von einer wissenschaftlichen Theorie über Triebhaftigkeit, Impulssteuerung o. ä.?
Dazu ist es wichtig zu klären, was im Weiteren unter einem Konzept verstanden werden soll. Eine ganz allgemeine Definition wäre, dass ein wissenschaftliches Konzept auf der Grundlage eines methodischen Zugangs zur Empirie etwas über deren Phänomene sagt. Die Empirie kann man ganz grundlegend verstehen als Welt der Erfahrung. Im ganz weiten Sinne des Begriffes (vgl. z. B. Bonß, 1982) sind wir bereits beim Besuch einer Vorlesung, beim Lesen eines Buchs etc. mitten in der Empirie. Empirische Forschung, wie es in der wissenschaftlichen Literatur meistens terminologisch verwendet wird, meint einen engeren Begriff. Dieser bezieht sich dann nicht nur einfach auf eine Erfahrungswelt, wie wir sie auch im Alltag haben, sondern auf eine forscherisch-empirische, messbare, vergleichbare, vielleicht sogar auch auf Vorhersagbarkeit abzielende Weise, mit der die Erfahrung untersucht wird. Empirische Forschung in diesem Sinn ist also eine Art Meta-Empirie im eigentlichen, erfahrungsbezogenen Sinn. Dabei ist es wichtig, dass wir in einem empirischen, wissenschaftlichen Zugang die Konzepte nicht als Dinge in der Welt finden, die wir als solche beobachten könnten. Das gilt für die Psychoanalyse, aber natürlich auch für die Physik und für alle anderen Wissenschaften. Die Schwerkraft beispielsweise beobachte ich nicht, ich beobachte die Wirkung der Schwerkraft, also ein Phänomen, auf das ich mit Konzepten antworte, die hier dann noch zu einer Gesetzesaussage verknüpft sind. Aber zunächst sind es Konzepte. Auf einer stark abstrakten Ebene ist das ein einheitswissenschaftlicher Gedanke, die Forderung nach einer Einheitswissenschaft wird schließlich erst dann problematisch, wo auf niedrigeren Abstraktionsstufen eine Einheitlichkeit von Methodologie, Methode und zulässigen Schlüssen gefordert wird. Auf der Ebene des allgemeinen Verhältnisses von Konzept und Empirie ist das noch nicht so problematisch (sofern man gut darüber nachdenkt, was als »Beobachtung« gelten soll).
So ähnlich wie über das Konzept »Schwerkraft« kann man das auch über psychoanalytische Konzepte sagen: Die Verdrängung lässt sich nicht beobachten. Es lässt sich etwas beobachten, das ich mir auf konzeptueller Ebene versuche darüber begreiflich zu machen, dass man sich manchmal an affektiv bedeutsame Dinge nicht erinnern kann, weil sie affektiv bedeutsam sind. Ähnlich kann man auch nicht sagen, Freud habe das Über-Ich »entdeckt«, sondern er ist auf bestimmte klinische Phänomene gestoßen und hat versucht, darauf eine konzeptuelle Antwort zu finden.
Konzepte stehen dabei nicht alleine, sondern in einem konzeptuellen Zusammenhang. Wenn ich versuche, das Über-Ich der Psychoanalyse etwa mit der Schwerkraft konzeptuell in Bezug zu setzen, scheitere ich daran, weil sie in anderen konzeptuellen Zusammenhängen stehen und einander vermittelt werden müssten (auch wenn vielleicht zunächst einmal der Zweck genau dieser Vermittlung fraglich wäre…). Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass ein Konzept dann wissenschaftlich ist, wenn es auf der Basis eines methodischen Zugangs zur Empirie etwas über die Empirie sagt. Der wissenschaftliche Zugang zur Welt der Erfahrung ist ein methodischer. Das heißt auch, dass Konzept und Methode in Wechselwirkung zueinander stehen und in Wechselwirkung zueinander entwickelt werden. Deshalb bezeichnet man die Theorie der Methode als Methodologie, und sie ist vom theoretischen Zusammenhang beeinflusst, in dem eine Methode steht. Das wiederum bedeutet, dass wissenschaftliche Ergebnisse immer methodenspezifisch gewonnen werden. Wenn ich irgendetwas experimentell überprüfe, dann interessiert mich natürlich, durch welches Experiment eine bestimmte Hypothese geprüft oder eine andere verworfen wird. Über den Umweg der Methode sind damit wissenschaftliche Ergebnisse immer in Bezug zur Theorie zu setzen. Es gibt keine theoriefreie Methode, es gibt keine methodenunspezifischen Forschungsergebnisse – und damit stehen Ergebnisse immer schon im Kontext von Theorie und theoretischen Konzepten.
Das macht die ganze Sache natürlich nicht einfacher. Wenn Sie zum Beispiel an die Spiegel-Titel der letzten 20 Jahre denken, dann wurde dort immer mal wieder die Frage aufgeworfen: Sind Freuds Konzepte belegt? Dann ist natürlich wichtig, sich anzugucken, was es bedeutet, ein Konzept zu prüfen. Ich kann es über Beobachtung prüfen – wie bei der Schwerkraft: Wenn ich feststelle, dass die Dinge nicht mehr nach unten fallen, dann ist die Theorie der Schwerkraft, wie wir sie kennen, zumindest erweiterungsbedürftig, denn dann machen Konzepte hier die Empirie nicht mehr begreifbar. Ich kann bei der Prüfung von Konzepten durch (im weitesten Sinn:) Beobachtung auch eine Ebene weiter gehen, nämlich in der Operationalisierung von Konzepten. Operationalisierungen machen Konzepte methodenspezifisch handhabbar – das ist z. B. die Grundlage für wissenschaftliche Interdisziplinarität. Wenn ich das Triebkonzept im MRT-Scanner untersuchen will, dann brauche ich eine Operationalisierung dessen, die überhaupt den methodischen Zugang brauchbar sein lässt. »Trieb« ist kein Konzept, das ich beobachten kann, und es ist auch kein Konzept, das ich messen kann. Es ist schließlich auch kein Konzept, das den Methoden der Neurobiologie ohne Weiteres zugänglich ist. Das ist es erst als ein im Bezug auf die Untersuchungsmethoden operationalisiertes (sofern dieser Schritt gelingt).
Die Beobachtungsebene ist allerdings nicht die einzige Ebene von Prüfbarkeit. Ich kann ein Konzept auch argumentativ prüfen oder widerlegen. Da es in einem konzeptuellen Zusammenhang steht, geht es immer auch um die Frage, an welcher Stelle eine Veränderung der Theorie vorgenommen wird, wenn die Erfahrung etwas anderes zeigt als das, was ein einzelnes Konzept begreifbar macht. Das ist ein klassisches Problem der Wissenschaftstheorie: Was muss verändert werden, wenn die Beobachtungen nicht zu meiner Theorie passen? Das bekannteste Beispiel ist die Frage nach dem schwarzen Schwan, woran sich wissenschaftsphilosophiegeschichtlich der Unterschied zwischen Verifikation und Falsifikation deutlich machen lässt (etwa bei Popper, 1935). Ich kann durch die Welt gehen und sagen, die Aussage »Alle Schwäne sind weiß« ist dann richtig, wenn ich alle Schwäne beobachtet habe und alle weiß sind. Das wäre die Verifikation. Ich kann es mir allerdings auch ein bisschen leichter machen, nämlich mit der Falsifikation, und sagen, der Satz: »Alle Schwäne sind weiß« ist wahr, solange ich keinen andersfarbigen Schwan gesehen habe, z. B. einen schwarzen. Ich gebe also an, unter welchen möglichen Bedingungen ich meine Annahme widerlegt sehen würde. Damit habe ich sie falsifizierbar gemacht bzw. ihr eine falsifizierbare Struktur gegeben. Aber so einfach ist es nicht, denn angenommen, ich finde etwas, das aussieht wie ein Schwan und schwarz ist – dann weiß ich immer noch nicht, was an meiner Annahme bzw. Theorie verändert werden muss. Ich könnte sagen: »Das ist gar kein Schwan, denn alle Schwäne sind ja weiß«. Oder ich könnte sagen: »Schwäne sind trotzdem weiß, aber es gibt einige Schwäne, die haben eine andere Farbe.« Bei diesen beiden Alternativen verändere ich entweder meine Konzepte von Tieren (Es gibt Tiere, die genau so aussehen wie Schwäne, aber eine andere Farbe haben und deshalb keine Schwäne sind) oder ich verändere mein Konzept von Schwänen (Es gibt Ausnahmen unter den eigentlich weißen Schwänen – oder radikaler: Schwäne haben verschiedene Farben). In diesem Spannungsfeld bewegt man sich immer, wenn es darum geht, konzeptuelle Zusammenhänge zu prüfen: Entweder führe ich neue theoretische Annahmen oder Konzepte ein, um die Empirie begreiflich zu machen, oder ich ändere bzw. erweitere meine Theorie. Was von beiden ich tue, darüber ist schwer zu entscheiden: Selbst wenn ich sehe, wie die Dinge nicht mehr zu Boden fallen, wenn ich sie loslasse, könnte ich prinzipiell auch die Theorie der Schwerkraft aufrechterhalten, sie jedoch um Zusatzannahmen erweitern, z. B. solche über Aufwinde.
Ein nächster Aspekt wäre die Sparsamkeit einer Theorie. Es muss einen angemessenen Komplexitätsgrad im Verhältnis zwischen den Phänomenen der Empirie und deren Konzeptualisierung geben. Ich kann etwas Richtung Boden fallen lassen und sagen: »Ich nehme gar nicht an, dass die Wirkung der Schwerkraft dafür verantwortlich ist, sondern ein kompliziertes Zusammenspiel aus Licht, Wind, Aufwind und dem Magnetismus der Möbel im Raum«. Das ist einigermaßen absurd, aber vor allem ist es auch überkomplex. Die Wirkung der Schwerkraft ist eine sparsamere und prüfbare Erklärung für das Phänomen.
Was ist nun psychoanalytisch, und in welcher Weise sind psychoanalytische Konzepte spezifisch? Die Frage der empirischen Fundiertheit psychoanalytischer Konzepte bedeutet vor allem, dass Freud und andere Psychoanalytiker die Konzepte im klinischen Zusammenhang entwickelt haben (vgl. zu den Grundlagen psychoanalytischer Konzeptforschung auch Dreher, 1998). Freud ist dort auf bestimmte Phänomene gestoßen und hat versucht, sich einen Reim darauf zu machen, indem er eine Theorie dazu entwickelt hat. Als die Grundlage auch der psychoanalytischen Theorie der Methode, der Methodologie, lehnt sich die Behandlungstechnik an das Geschehen in der klinischen Situation an. Freud (1927a, S. 293f.) hat das ausgedrückt als ein »Junktim aus Heilen und Forschen«: Die Psychoanalyse war immer eine Art von Krankenbehandlung, aber daraus hat sich eine Theorie auch über das nichtpathologische Psychische entwickelt. Das wird zum Beispiel deutlich, wenn man die Konzepte »Unbewusste Phantasie« oder »Übertragung« betrachtet. Das hat sich Freud nicht einfach so ausgedacht, sondern er hat versucht, damit Phänomene aus klinischen Behandlungen zu erklären. Eine wichtige Folgerung dessen ist, dass die Verallgemeinerung der Psychoanalyse auf der Ebene der Konzeptbildung geschieht, nicht so sehr auf der Ebene der Vorhersagbarkeit – auch wenn es Wege dahin ebenso gibt. Es gibt einzelne Behandlungen, und auf diese Weise findet Konzeptbildung statt, also über den Versuch, zumindest etwas aus Einzelfällen zu verallgemeinern. Freud ging es um mehr als um eine Theorie psychischer Erkrankungen oder einen Weg, damit umzugehen. Er definiert die Psychoanalyse auf drei Ebenen:
»PSYCHOANALYSE ist der Name 1) eines Verfahrens zur Untersuchung seelischer Vorgänge, welche sonst kaum zugänglich sind; 2) einer Behandlungsmethode neurotischer Störungen, die sich auf diese Untersuchung gründet; 3) einer Reihe von psychologischen, auf solchem Wege gewonnenen Einsichten, die allmählich zu einer neuen wissenschaftlichen Disziplin zusammenwachsen.« (Freud, 1923a, S. 211)
Es ist ein Verfahren zur Untersuchung seelischer Vorgänge und eine Behandlungsmethode, das ist ein Unterschied: einmal eher eine allgemeine Methode, die sich auch z. B. auf soziale Phänomene und Prozesse prinzipiell transferieren lässt, einmal eine klinische Behandlungsmethode und schließlich ein Theoriegebäude.
Welche Art von Konzepten bildet nun Freud? Das kann man zunächst einmal in negativer Hinsicht betrachten, indem man das ansieht, wovon Freud sich abgrenzen wollte. Man findet recht deutliche abgrenzende Positionierungen Freuds gegenüber der Philosophie und der Psychologie. Das hat damit zu tun, dass die Psychologie um die Jahrhundertwende bei Weitem nicht die Stellung hatte wie heute und dass Freud als Arzt seiner Zeit ein bestimmtes Wissenschaftsverständnis hatte und für ihn insofern die Philosophie dubios war. Er war der Ansicht, dass philosophische Spekulationen, die man durchaus auch im positiven Sinne verstehen kann, sich nicht auf das Gebiet der Erkenntnisse übertragen lassen. Er formuliert: »Man ist bereit zu verfolgen, welche Erfüllungen dieselben [der Wünsche; TS] sich in den Leistungen der Kunst, in den Systemen der Religion und der Philosophie geschaffen haben, aber man kann doch nicht übersehen, daß es unrechtmäßig und in hohem Grade unzweckmäßig wäre, die Übertragung dieser Ansprüche auf das Gebiet der Erkenntnis zuzulassen. Denn damit öffnet man die Wege, die ins Reich der Psychose, sei es der individuellen oder der Massenpsychose, führen.« (Freud, 1933a, S. 172)
Noch ein bisschen härter geht er mit der Psychologie ins Gericht, wenn er z. B. sagt, in der Psychologie komme »die konstitutionelle Untauglichkeit des Menschen zu wissenschaftlicher Forschung in vollem Ausmaß zum Vorschein« (a. a. O., S. 4). Oder wenn er meint, »daß es auf psychologischem Boden sozusagen keinen Respekt und keine Autorität gibt. Jedermann kann da nach Belieben ›wildern‹. […] Wahrscheinlich gibt es auf diesem Gebiet keine ›Fachkenntnisse‹. Jedermann hat sein Seelenleben und darum hält sich jedermann für einen Psychologen. Aber das scheint mir kein gültiger Rechtstitel zu sein.« (Freud, 1926e, S. 219).
Das hat für Freud so etwas wie berufslogische oder disziplinlogische Gründe, weshalb er die Nähe zur Medizin sucht oder auch in einigen seiner Begriffe eine große Nähe zur Physik, auch zur Neurobiologie oder Neuroanatomie, deutlich macht. Allerdings kann man auch dafür argumentieren, dass Freud der Philosophie sehr viel näher steht, als er es selbst sehen wollte oder dachte (vgl. zu Freuds Grundlagen in der Philosophie z. B. Gödde, 1999; Schöpf, 2014).
Freud geht es um die Formulierung einer Meta-Psychologie. Damit meint er eine Psychologie unter Einbeziehung des Unbewussten, anders als es in der Psychologie seiner Zeit üblich war. Meta-Psychologie ist für Freud der »Name[.]« für »meine hinter das Bewußtsein führende Psychologie« (Freud, 1985, S. 329). Er definiert die Meta-Psychologie noch in genauerer Weise: Sie enthält die theoretischen Annahmen der Psychoanalyse und beschreibt »einen psychischen Vorgang nach seinen dynamischen, topischen und ökonomischen Beziehungen« (Freud 1915c, S. 281).
Abschließend komme ich hinsichtlich der Frage, was ein psychoanalytisches Konzept ist, noch zu drei terminologischen Bemerkungen. Wenn ich im Weiteren von »psychoanalytisch« spreche, meine ich – wie in der Definition von Freud, die wir eben gesehen haben – die Theorie und Methode der Psychoanalyse inklusive der klinischen Behandlungsmethode. Unter »psychodynamisch« verstehe ich die Beschreibung eines psychischen Geschehens, ein konfliktbedingtes Gegenüberstehen von drängenden und verdrängenden psychischen Kräften. Und »tiefenpsychologisch« verwende ich bezogen auf das therapeutische Verfahren der tiefenpsychologisch-fundierten Psychotherapie. Die Tiefe darin ist etwas, was nicht ganz unproblematisch ist. So legt es doch nahe, dass die analytisch begründeten Verfahren darauf abzielen, immer möglichst weit in die Tiefe zu gehen und das in den Blick zu nehmen, was ganz fern vom Bewussten und ganz tief vergraben ist. Das wäre in dieser Konsequenz ein irriges Bild der modernen Psychoanalyse, der es vielmehr um »eine Vertiefung in die Oberfläche« (Krejci, 2009) geht, die am aktuellen Geschehen bleibt und sich von dort aus anschaut, was sich wiederholt und aktualisiert. Freuds bekanntes Bild des Eisbergs, von dem nur ein geringer Teil an der Oberfläche zu sehen ist, ist da einerseits ganz treffend, wenn man sich anschaut, wie viel unseres Erlebens bewusst und wie viel unbewusst ist. Gleichzeitig ist die Tiefenmetaphorik irreführend (vgl. auch Buchholz & Gödde, 2013).
Soweit einleitend zu den psychoanalytischen Konzepten (ausführlich in Storck, 2018b). Freud formuliert einigermaßen apodiktisch: »Die Annahme unbewußter seelischer Vorgänge – erstens – , die Anerkennung der Lehre vom Widerstand und der Verdrängung – zweitens – , die Einschätzung der Sexualität und des Ödipus-Komplexes sind die Hauptinhalte der Psychoanalyse und die Grundlagen ihrer Theorie, und wer sie nicht alle gutheißen vermag, sollte sich nicht zu den Psychoanalytikern zählen.« (Freud, 1923a, S. 223) Im Folgenden geht es darum, den argumentativen Gehalt solcher Konzepte zu prüfen, und auch dabei gehe ich von Freud aus: »Man versteht die Psychoanalyse immer noch am besten, wenn man ihre Entstehung und Entwicklung verfolgt.« (a. a. O.)
1 Verfügbar unter: https://www.youtube.com/watch?v=DKGWlsUdAcI.
3 Die Triebtheorie bei Freud
Ich werde im Folgenden in der Prüfung des Triebkonzepts nicht chronologisch vorgehen, sondern einen Text in den Mittelpunkt stellen, den ich für zentral halte und in dem Freud (1915c) sein triebtheoretisches Verständnis entwickelt hat, nämlich Triebe und Triebschicksale.
Wir finden Beispiele für »Triebhaftes« in vielen Bereichen der Kunst oder medialen Darstellung. Eine Szene aus dem Film Basic Instinct (Paul Verhoeven, USA, Frankreich 1992) etwa zeigt eine Szene in einer mit Menschen gefüllten Disco. Wir sehen einen Mann auf die Tanzfläche schreiten, eine Frau nimmt Blickkontakt zu ihm auf und tanzt offensichtlich »demonstrativ« und lasziv mit einer Frau, ihn dabei auffordernd anblickend. Ohne dass gesprochen wird, verändert sich die Szene, bald tanzen Mann und Frau miteinander. Nicht von ungefähr geht es hier titelgemäß um einen »basic instinct« (um den Unterschied zwischen Trieb und Instinkt wird es weiter unten gehen). Triebhaftes hat mit Sexualität zu tun (und im Film dann auch mit Aggression), zudem hier mit Verlangen und Ausgeschlossenheit.
Triebhaftes kann aber auch eine andere Facette meinen. Wenn wir uns einige Szenen aus der TV-Serie The Walking Dead ansehen, in der es um die Welt im Anschluss an eine Zombie-Apokalypse geht (v.€a. im Hinblick auf soziale Strukturen, die sich aus sich selbst heraus bilden und regulieren müssen, wenn externe Ordnungsstrukturen weggefallen sind; vgl. Taubner, 2017), dann zeigt sich im Drängen der Zombie-Horden ebenso ein Moment, das man als Bild für Triebhaftes nehmen kann. Wenn unzählige Zombies gegen einen Zaun drängen, auf deren anderen Seite einige der überlebenden Menschen Befestigungen anbringen, damit er nicht einstürzt (»Internment«, 2014), dann zeigt es auch etwas davon, wie innerpsychisch die Vernunft (und Sozialität) mit einem unmittelbaren (destruktiven, todbringenden) Drängen fertig werden muss, das alles andere verzehrt.
Wir sehen also auf der (kulturell-medialen) Ebene der Betrachtung zwei Facetten der Triebtheorie: Sexualität und Destruktivität. Eine recht lange Definition Freuds als Ausgangspunktes lautet:
»Wir haben oftmals die Forderung vertreten gehört, daß eine Wissenschaft über klaren und scharf definierten Grundbegriffen aufgebaut sein soll. In Wirklichkeit beginnt keine Wissenschaft mit solchen Definitionen, auch die exaktesten nicht. Der richtige Anfang der wissenschaftlichen Tätigkeit besteht vielmehr in der Beschreibung von Erscheinungen, die dann weiterhin gruppiert, angeordnet und in Zusammenhänge eingetragen werden. […] Sie [›gewisse abstrakte Ideen‹] müssen zunächst ein gewisses Maß von Unbestimmtheit an sich tragen; von einer klaren Umzeichnung ihres Inhaltes kann keine Rede sein. […] Sie haben also streng genommen den Charakter von Konventionen, wobei aber alles darauf ankommt, daß sie doch nicht willkürlich gewählt werden, sondern durch bedeutsame Beziehungen zum empirischen Stoffe bestimmt sind, die man zu erraten vermeint, noch ehe man sie erkennen und nachweisen kann. Erst nach gründlicherer Erforschung des betreffenden Erscheinungsgebietes kann man auch dessen wissenschaftliche Grundbegriffe schärfer erfassen und sie fortschreitend so abändern, daß sie in großem Umfange brauchbar und dabei durchaus widerspruchsfrei werden. […] Wie das Beispiel der Physik in glänzender Weise lehrt, erfahren auch die in Definitionen festgelegten ›Grundbegriffe‹ einen stetigen Inhaltswandel. Ein solcher konventioneller, vorläufig noch ziemlich dunkler Grundbegriff, den wir aber in der Psychologie nicht entbehren können, ist der des Triebes.« (1915c, S. 210f.).
Dabei ist eine Sache entscheidend, nämlich dass »Trieb« ein Begriff sei, den »wir in der Psychologie nicht entbehren können«. Freud spricht nicht über Ethologie oder über Biologie, sondern er versteht den Trieb, das Triebkonzept als einen Begriff, der sich auf Psychisches beziehen soll und der in einer Theorie des Psychischen unverzichtbar ist. Er eignet sich auch deshalb besonders als erstes unter den »Grundelementen« psychoanalytischen bzw. psychodynamischen Denkens. Ein ähnliches Zitat, in dem Freud sich auf das Verhältnis von Trieb und Psychologie bezieht, lautet: »Die Psychoanalyse, die bald erkannte, daß sie alles seelische Geschehen über dem Kräftespiel der elementaren Triebe aufbauen müsse, sah sich in der übelsten Lage, da es in der Psychologie eine Trieblehre nicht gab und ihr niemand sagen konnte, was ein Trieb eigentlich ist. Es herrschte vollste Willkür, jeder Psychologe pflegte solche und so viele Triebe anzunehmen, als ihm beliebte.« (Freud, 1923a, S. 229f) Was ist nun Freuds Antwort auf diese Befunde?
3.1 Der psychosomatische und sozialisatorische Trieb
»Trieb« als Konzept kann bei Freud psychosomatisch verstanden werden. Er steht zwischen Psyche und Soma, zwischen Psychischem und Körperlichem. Das ist deshalb der entscheidende Punkt, weil sich der Trieb damit vom Instinktbegriff (der Verhaltenslehre) unterscheidet. Das Konzept bezieht sich nicht auf irgendeine Art von ins Psychische gehobenem Reiz-Reaktions-Mechanismus. Es ist allerdings auch mehr als ein psychologischer Motivationsbegriff (Kap. 6). In seiner Entstehung steht er zwischen Psyche und Soma. Freuds Theoriebildung ist nicht immer ganz eindeutig oder linear voranschreitend gewesen, sondern sie hat sich über den Verlauf von mehr als 40 Jahren zum Teil auch sehr deutlich verändert und ist erweitert worden (kritischer Überblick bei Zepf, 2005, oder Zepf & Seel, 2016; mit dem Ziel einer Reformulierung auch bei Schmidt-Hellerau, 2003). Aber ein Aspekt der Triebtheorie, der zu verschiedenen Zeitpunkten von Freuds Überlegungen im Kern gleich bleibt, ist das, was ich psychosomatisch am Trieb genannt habe. Freud meint, der Trieb sei ein »Grenzbegriff zwischen Seelischem und Somatischem, als psychischer Repräsentant der aus dem Körperinnern stammenden, in die Seele gelangenden Reize, als ein Maß der Arbeitsanforderung, die dem Seelischen infolge seines Zusammenhanges mit dem Körperlichen auferlegt ist.« (1915c, S. 214) In ähnlicher Weise formuliert er bereits etwas früher, der Trieb sei die »psychische Repräsentanz einer kontinuierlich fließenden, innersomatischen Reizquelle« (1905d, S. 67), oder er bezeichnet den Trieb als »den Grenzbegriff des Somatischen gegen das Seelische […, als] den psychischen Repräsentanten organischer Mächte« (1911c, S. 311).