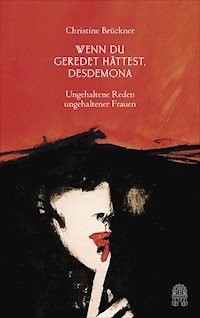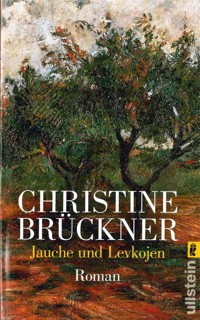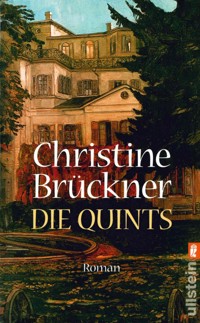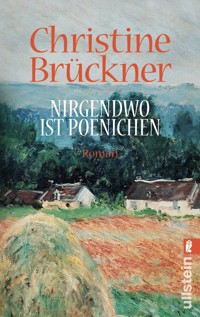3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Refinery
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Ich versuche nichts weiter, als verständlich zu machen, warum Menschen sind, wie sie sind." Jener von Christine Brückner im Zusammenhang mit ihren "Überlebensgeschichten" geäußerter Satz könnte als Motto über diesem Band stehen. Er vereinigt 26 Erzählungen, die, beginnend mit der Faschingsgeschichte "Blaue Hyazinthen" aus dem Jahr 1957, in chronologischer Reihenfolge einen Einblick in die Entwicklung der Erzählerin Christine Brückner geben. Einer Erzählerin, deren Anspruch es war, "Zeitgeschehen in unerhörten Begebenheiten aufs Exemplarische zu reduzieren", wie der Herausgeber Heinz Gockel in seinem Nachwort anmerkt, "alltägliche Begebenheiten, die in den Erzählungen zu 'unerhört' werden."
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 341
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Die AutorinChristine Brückner (1921 - 1996) zählt zu den renommiertesten Schriftstellerinnen Deutschlands. Sie verfasste Romane, Erzählungen, Kommentare, Essays, Schauspiele, auch Jugend- und Bilderbücher. Besonders mit der Poenichen-Trilogie wurde sie einem großen Publikum bekannt. Mehr über Christine Brückner erfahren Sie über die Stiftung Brückner-Kühner unter http://www.brueckner-kuehner.de/.
Das Buch
»Ich versuche nichts weiter, als verständlich zu machen, warum Menschen sind, wie sie sind.« Jener von Christine Brückner im Zusammenhang mit ihren »Überlebensgeschichten« geäußerter Satz könnte als Motto über diesem Band stehen. Er vereinigt 26 Erzählungen, die, beginnend mit der Faschingsgeschichte »Blaue Hyazinthen« aus dem Jahr 1957, in chronologischer Reihenfolge einen Einblick in die Entwicklung der Erzählerin Christine Brückner geben. Einer Erzählerin, deren Anspruch es war, »Zeitgeschehen in unerhörten Begebenheiten aufs Exemplarische zu reduzieren«, wie der Herausgeber Heinz Gockel in seinem Nachwort anmerkt, »alltägliche Begebenheiten, die in den Erzählungen zu 'unerhört' werden.«
Christine Brückner
Alles geht gut
Erzählungen
…
Refinery by Ullsteinwww.ullteinbucherlage.de/verlage/refinery
Neuausgabe bei Refinery Refinery ist ein Digitalverlag der Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin Oktober 2017 (1) © Ullstein Buchverlage GmbH & Co. KG, Berlin 1998 Covergestaltung: © Sabine Wimmer, Berlin ISBN 978-3-96048-081-5 Hinweis zu Urheberrechten Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben. In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Blaue Hyazinthen
Heinrich Grebe, Immobilien
Wann – wenn nicht jetzt
Die Zuflucht
Frau Marcellus prüft die Marktlage
Am Neuen Wall 81
Frau Zanders seriöse Lebensberatung
Begegnung am Fünfundzwanzigsten
Der Stellvertreter
Geboren am 24. Dezember 1945
Bella Vista
Batschka – wo liegt das überhaupt?
Ein Mann ohne Phantasie
Eine Liebesgeschichte
Das Begräbnis der Filomena
Was ist schon ein Jahr
Die Untat des Jochen Fauling
Geburtsort Kassel
Theaterleidenschaft
Das Ereignis fand in aller Stille statt
Dr. med. Anna K., alle Kassen
»Machen Sie doch Ihren eigenen Laden auf!«
Jeanette und ihre Väter
Alles geht gut
»Wir wollen einen anderen Lehrer!«
Meinleo und Franziska
Nachwort
Editorische Hinweise
Erstveröffentlichungen
Blaue Hyazinthen
»Kindchen«, sagte sie, legte ihre Hand leicht auf meinen Arm, und wir nahmen unseren Rundgang durch die Märzsonne wieder auf. »Wir müssen lernen, unsere Erinnerungen zu pflegen und sie ein bißchen aufzuputzen. Sie müssen lange vorhalten.« Sie lächelte und zog den Schal enger, den sie um ihre Schultern gelegt hatte, als der Ostwind, der um die Hausecke blies, nach uns faßte.
Was konnten mir ihre lächelnden Weisheiten helfen! Es war leicht, mit Siebzig als Torheit abzutun, was einem mit Zwanzig das Herz schwermacht.
»Sehen Sie dieses Beet an, Stina! Trostlos, nicht wahr? Aber wenn Sie in ein paar Wochen zu mir kommen, und ich denke, daß Sie wiederkommen«, ihre Hand legte sich herzlicher auf meinen Arm, »dann wird es blühen. Über und über, enzianfarben wie der Himmel über unserer See. Blaue Hyazinthen. Nicht jeder hat seine Erinnerungen so fein säuberlich auf einem Gartenbeet beisammen. Aber Pflege brauchen sie schon.
Nun denken Sie, daß ich anfange, ein wenig wunderlich zu werden. Wehren Sie nicht ab! Wunderlich sind wir nun einmal, wenn es um die Herzensdinge geht, Kindchen, mit Zwanzig so gut wie mit Siebzig. Kommen Sie! Wir wollen uns einen Tee aufbrühen, und ich erzähle Ihnen die Geschichte dieses Beetes.
Ich war nicht mehr so jung, wie Sie es heute sind, Stina, aber ich empfand wie Sie: Das Leben war mir etwas schuldig! Es war zu Anfang des Jahrhunderts, in der guten alten Zeit, wie Sie es heute nennen. Ob sie so gut war, weiß ich nicht, gewiß war sie nicht alt! – Ich war noch nicht lange verheiratet. Nicht einmal zwei Jahre. Mein Mann war monatelang auf Reisen. Damals war er im Orient. Es war sehr ehrenvoll – für ihn. Aber ich war allein. Die wenigen Male, wenn ich ohne ihn ausging, im Schutze seiner Familie, versäumte keiner der Herren, mir zu versichern, wie leichtsinnig es von meinem Mann sei, eine so junge und hübsche« – sie lächelte dazu – »Frau allein zu lassen. Bei uns ist der Winter sehr lang.
An einem Tag im Februar fand ich unter meiner Post die Einladung zu einem Maskenball. Fragen Sie nicht, welcher Zufall mir das Couvert, das nicht meine Anschrift trug, zuspielte! Es waren wohl die Widerstände, die mich reizten, heimlich zu gehen, ohne den Schutz eines männlichen Verwandten, der allein mein Erscheinen auf einem Maskenball erlaubt, wenn auch nicht begreiflich gemacht hätte.
Der zwanzigste Februar! Ein dunkler Abend. Im Licht der Gaslaternen sah man, daß es ein wenig schneite. Ich mied die Hauptstraßen. Den Schal eng um den Kopf geschlungen, erregt und ängstlich zugleich, ging ich den Weg zu Fuß. Die Heimlichkeit zum Abenteuer steigernd. Dieser Augenblick – eben noch in der Verschwiegenheit der Winternacht geborgen, und plötzlich griff helles Licht, Musik und Lachen aus Fenstern und Türen nach mir.
Ich zeigte die Karte, man nahm mir Mantel und Schal ab, und erst als ich die Arme hob, um die goldene Maske ein wenig höher zu rücken, erkannte ich in einem Spiegel, daß ich es war: das Haar im losen schwarzen Knoten, vom goldenen Lorbeer gehalten, nilgrüner Stoff floß von den Schultern zu Boden, einmal nur gegürtet, auch der Überwurf aus der gleichen Seide verhüllte mich nicht. Ich drückte meine Leier enger an mich – eine ängstliche Sappho! Unsicher setzte ich den Fuß auf die unterste Stufe der Treppe, die zu dem Festsaal führte. Und oben auf dem Treppenabsatz, leicht an eine der Säulen gelehnt, stand er, stand da und lächelte und sah mir entgegen, als ob er auf mich gewartet hätte. Er lächelte nicht spöttisch, eher hilfreich. Die letzten Stufen kam er mir entgegen, reichte mir die Hand und zog mich – mitten in das Fest hinein.
Er war jung und schön! Ein Minnesänger. Beide waren wir zu diesem Fest gekommen als Sänger der Liebe. Er beugte das Knie und nannte mich: ›Hove frouwe‹, und ich griff in die Leier und dankte ihm. Wir redeten in der Sprache der Dichter, von Mond und Waldesrauschen, zartem Glück und holdem Wahn. Unsere Hände redeten die Sprache aller Liebenden wie unsere Augen, und unsere Füße trugen uns im Takt von Walzer und Mazurka von einer Wolke der Glückseligkeit zur anderen.
War je eine Nacht so lang? Wie hätte Wein uns müde machen können! Lange schon lehnten Leier und Gambe nebeneinander an einer Säule. Kein Instrument vermochte zu klingen wie die leichtherzigen Worte meines Freundes!
Und doch kam der Morgen! Wir gingen, bevor er sich grau und ernüchternd durch die Fenster schieben konnte und entblößen, was Nacht und Kerzenlicht in ihren Schutz genommen hatten. Mein Troubadour hüllte mich in meinen Mantel, legte den Schal mit jener zärtlichen Behutsamkeit, nach der ich mich immer gesehnt hatte, um mich und zog sich die hohe Pelzmütze, die man damals noch bei uns trug, tief in die Stirn. Arm in Arm verließen wir das Fest. Leier und Gambe blieben vergessen zurück.
Die Sichel des abnehmenden Mondes stand am Himmel, Jupiter und Venus leuchteten. Es hatte geschneit; kein Knirschen verriet unseren stillen Gang durch den Wintermorgen.
In der Dämmerung des folgenden Tages brachte ein Bote Blumen. Eine Schale mit blauen Hyazinthen. Ihr Duft löste die Tränen. Alles war nur ein Traum. Vorbei war die Verzauberung, dies war der Abschied und der Dank. Kein Wort. Ich wußte nicht seinen Namen. Was wußte er von mir? Er hatte gefragt: Was tust du an den langen Winternachmittagen, und ich hatte geantwortet: Ich stehe am Fenster, sehe in den weißen Garten und träume von blauen Hyazinthen.
Im März kam dann mein Mann zurück. Er erwartete kein Geständnis über das, was man ihm bereits zugetragen hatte. Er wurde noch kühler, und ich hätte Wärme gebraucht. Noch blühten vor meinem Fenster die Hyazinthen. Als er mich einmal in der Dämmerung vor meinen Blumen fand, fragte er: ›Von ihm?‹ Ich sagte mit fremder Stimme: ›Ja, von ihm.‹ Das war das einzige Mal, daß wir davon sprachen. Ich schnitt die welkenden Stengel ab und bewahrte die Zwiebeln auf.
Im Sommer nahm mich mein Mann mit nach Peking, den Winter über blieben wir in Riga. Er führte mich aus, er gab mir neue Pflichten, die mich ablenkten und aufheiterten. Als ich an einem Nachmittag im Februar spät von einer Einladung zurückkam, waren Blumen abgegeben für mich. Sie vermuten recht: blaue Hyazinthen! Ich stellte sie vor mein Fenster, aus Trotz, weil mein Mann mich fragen sollte, aber auch, weil eine Welle zärtlichen Erinnerns mich erfaßt hatte und mich aufs neue verwirrte. Ich begriff nicht gleich, daß der Gruß meines Freundes nicht mehr wollte als mich erfreuen, mir sagen, daß er an diesem Tage an mich dachte. Ich meinte, es sei eine Aufforderung, mich zu entscheiden, es nicht bei der Verzauberung einer Ballnacht zu belassen. Ich stand lange am Fenster und sah in den Schnee. Alle meine Wünsche eilten aus dem Haus meines Mannes auf verbotene Wege, von denen ich nur zu gut wußte, wieviel Schranken mir den Zutritt verwehrten.
So ging es Jahr für Jahr! Das eine Mal wartete ich mit Ungeduld auf seinen Gruß, in anderen, glücklicheren Jahren überraschte er mich. Die Langmut meines Mannes nahm ich lange Zeit für kränkende Gleichgültigkeit und ließ darum die Blumen – länger, als Ansehen und Duft es rechtfertigten – auf der Fensterbank stehen.
Die Zwiebeln setzte ich in ein Beet meines Gartens und beobachtete mit Genugtuung und einer leisen Wehmut, die sich einstellt, wenn ein glückliches Erlebnis lange Jahre zurückliegt, wie mein blaues Beet von Jahr zu Jahr wuchs.
Kurz vor dem Krieg wurden rasch nacheinander meine Kinder geboren. Ich nahm kaum wahr, daß die Blumen ausblieben. Mein Mann wurde interniert, ich mußte mit den Kindern zum ersten Mal fliehen, nach Königsberg. Ich war, wie ich meinte, eine vom Leben hart angefaßte Frau, als der Krieg zu Ende war und noch ein weiteres Jahr verging, bis mein Mann zurückkehrte. Zehn Jahre waren verstrichen, seitdem zum letzten Mal an einem 20. Februar blaue Hyazinthen für mich abgegeben wurden. Zeit genug, das Datum zu vergessen.
Als dann wieder eine Blumenschale abgegeben wurde, in einer fremden Stadt, in der ich nicht heimisch werden konnte, war sie wie ein Gruß aus einer Zeit, der ich anfing, den Beinamen ›gut und alt‹ zu geben.
Wieder wuchs in dem Garten vor meinem Fenster ein Hyazinthenbeet. Die Kinder fragten danach. Mein Mann und ich sahen uns an und lächelten uns zu wie zwei Verschwörer.
Ich blieb ahnungslos. Erst als ich seinen Nachlaß ordnete, fand ich unter seinen gewissenhaft aufbewahrten Abrechnungen und Quittungen auch die eines Königsberger Blumenhauses. Sie hatten alle den 20. Februar zum Datum.
Dann mußte ich wieder fliehen. Wieder ein Stück weiter in den Westen. Wie alles andere blieb auch mein blaues Beet zurück. Als ich wieder ein wenig Kraft gesammelt hatte und neuen Mut, ging ich und kaufte mir Blumenzwiebeln für diesen Garten. Viel Zeit hatte ich nicht mehr. Ich konnte nicht noch einmal mit ein paar Hyazinthenzwiebeln anfangen. Aber ich kann nun wieder in den langen Winterdämmerungen an meinem Fenster stehen und von blauen Hyazinthen träumen. Und meine Gedanken gehen weit zurück. Selten bis zu jenem Fest. Sie werden unterwegs oft aufgehalten. An wieviel Liebe haben sie sich zu erinnern in dem langen Leben an der Seite meines Mannes!
Wenn sich im Frühling die Knospen auftun, ist mir jedesmal, als habe seine gütige Hand mir ein kleines Stück unseres baltischen Himmels vor mein Fenster gelegt.«
Heinrich Grebe, Immobilien
Er ist ein Durchschnittsmensch, ohne daß ich bereits mit dieser Bemerkung etwas Nachteiliges über ihn sagen möchte. Er selbst würde es ablehnen, als »Durchschnitt« bezeichnet zu werden, er schätzt sich anders ein. Begegnen ihm beim Lesen der Zeitung Worte wie »Masse« oder »Durchschnittspublikum« oder »der einfache Mann von der Straße«, wird er keinen Augenblick annehmen, daß er selbst genau das ist. Neben ihm fahren in den gleichen chromglänzenden Wagen die gleichen einfachen Männer von der Straße, wie er im grauen Anzug, mit Nylonsocken, Kentkragen und einer Aktentasche, die keine Thermosflasche enthält, sondern tatsächlich Akten; Quittungen, mit Namen und Daten versehen, für das Finanzamt bestimmt, zur Rechtfertigung der Spesen, und dann natürlich die Briefe, für die man zu Hause keinen sicheren Platz hat, die man beantworten muß und zum Antworten nicht den rechten Ort und nicht die richtige Stunde findet, Briefe, die man wochenlang mit sich herumschleppt, die einem lästig sind, aber die man beileibe nicht missen möchte. Bestätigen diese Briefe doch, daß man beliebt ist, daß irgendwo ein Mensch an einen denkt, auf eine Antwort wartet, und das ist, von den kleinen Unannehmlichkeiten abgesehen, die durch ihre Entdeckung entstehen könnten, gar kein schlechtes Gefühl.
Wie er so dahinfährt, die Strecke, die er seit Monaten kennt, nicht gedankenlos, aber auch nicht nachdenklich, ist er auf dem Wege – dem besten Wege –, das zehnte Gebot zu überschreiten. Aber: woher soll er das wissen! Es hat ihn seit vierzig Jahren niemand mehr nach dem Wortlaut der Gebote gefragt. Das zehnte nun gar! Hätte man nach dem elften gefragt! Verblüffen? Nein, verblüffen ließ sich ein Heinrich Grebe nicht mehr. Aus dem Alter war man – Gott sei Dank! – heraus.
Wenn das Gewissen ein Hund ist, der anschlägt, dessen Leine an unserem Herzen angeknüpft ist und zerrt – das ist schon behauptet worden –, dann mußte jemand seinem Hund Gift gegeben haben, oder der Hund war einfach an Altersschwäche gestorben. Wie lange leben denn Hunde? Heute ist dieser Mann ein guter Fünfziger, und so eine Geschichte wie die mit dem Hund würde ihm höchstens ein Lächeln abnötigen. Weiß Gott, er liebte solche Gespräche nicht. Bloß keine Bilder oder so was wie Gleichnisse!
Ich bin nicht sicher, ob er sich an die Reihenfolge hielt, als er sich daran begab, die Zehn Gebote zu übertreten, eines nach dem anderen. Man sagt schon mal, und wer tut das nicht: »Mein Gott!« oder »Zum Teufel auch!« Natürlich mußten die Kinder konfirmiert werden, aber was hat das denn mit der Fahrt zu tun, die er jetzt vorhat! Es gibt Dinge, die muß man einfach auseinanderhalten. Schließlich und endlich kann man nicht alles und jedes dem Beruf und der Familie opfern.
Schließlich und endlich. Alles und jedes. Er lockert den Hemdkragen mit der linken Hand – ein ziemlich heißer Tag heute! –, nimmt das Gas weg, biegt in den Seitenweg ein, und niemand sagt ihm, und schon gar nicht die Stimme in ihm, die des Hundes, wenn es den überhaupt gibt: »Du sollst nicht.«
Ach, er ist kein großer Sünder! Er sündigt immer nur aus Versehen, ohne sich etwas dabei zu denken. Er ist Durchschnitt, in allem, ich sagte es wohl schon. Seine Sünden sind die kleinen, alltäglichen, es lohnt am Ende gar nicht, darüber zu reden. Er hatte sie nicht einmal genossen. Denn Sünde, das ist doch wohl etwas, das man genießen möchte. Etwas Angenehmes muß es schließlich und endlich sein, warum macht man sonst soviel Aufhebens davon? Es hing irgendwie mit Liebe zusammen, mit Unerlaubtem, und wenn er das Wort las und seinen Gedanken freien Lauf ließ, was er meist tut, denn er ist nicht diszipliniert im Denken, dann sah er Zarah Leander in ihren besten Zeiten vor sich: in einem Kleid aus Fischschuppen, die Hände unter der üppigen Brust, den Kopf zurückgeworfen, die Oberschenkel vibrierten, und sie sang: »Kann denn Liebe Sünde sein …« So etwa war seine Vorstellung von Sünde. Sie war landläufig. Er genoß einen Augenblick dieses Bild und hielt sich, genauso lange, für einen Sünder. Aber was hatte das alles mit dem Kindergeplapper von »Du sollst nicht!« zu tun? Dafür war seine Frau da, die Kinder Gesangbuchverse und die Gebote und was sonst noch dazugehört abzufragen, schließlich und endlich hatte ein Mann in seiner Position an anderes zu denken.
Er bremst. Sein Wagen hält vor dem Haus jenes Mannes, den er –. Aber davon später.
Halten wir uns ruhig an die Reihenfolge, eins bis zehn, wenigstens darin wollen wir korrekt sein. Wenn schon, denn schon, schließlich und endlich, alles und jedes. Wenn man eine Weile mit diesem Mann zusammengewesen ist, hat man Mühe, sich nicht seines »nach Lage der Dinge« und seiner »schließlich und endlich« zu bedienen.
Heinrich Grebe. Seit er das erreicht hat, was er eine Position zu nennen pflegt, besitzt er so etwas wie ein Standesgefühl, eine Art Hochachtung vor sich selbst. Als sein Neffe in eine Unterschlagungsaffäre verwickelt war, gebrauchte er mit wirklicher Überzeugung Ausdrücke wie »den alten Namen sauberhalten« und »unser guter ehrlicher Name«. Grebe hieß er, ein nicht ungewöhnlicher Name in der Gegend, aber ein guter ehrlicher Name, auf den man nichts kommen ließ. Heinrich mit Vornamen. Er hatte sich vor einigen Jahren mit dem Gedanken getragen, Henry daraus zu machen. Aber heute, nachdem die Konjunktur wieder anders lief, war er ganz froh, daß er diesem unsoliden Zug nicht nachgegeben hatte. Heinrich Grebe, das klang zuverlässig, da wurde man nicht übers Ohr gehauen, und daran mußte man glauben, wenn man zu einem Makler ging. An seinem Haus stand mit kleinen goldenen Buchstaben auf schwarzem Granit »Heinrich Grebe, Immobilien«, dezent und gediegen. Gediegen, das war auch so eines seiner Lieblingsworte. Dezent und gediegen wie die Ausstattung seines Büros. Lediglich eine oberbayrische Landschaft mit einer Jagdhütte hinter einem Holzgatter, von Sonnenblumen umstanden, war ein Zugeständnis an das, was die Käufer suchten und bei ihm zu finden hofften. Ein Haus am Waldrand, weißer Rauch, der sich vorm blauen Himmel kräuselt, ein Garten. Auch wenn man einen Lagerplatz für Altmetall suchte, mit zwei Toreinfahrten und Gleisanschluß – einen Augenblick lang konnte man von dem Sessel aus, der dem Bild gegenüberstand, glauben, man würde stattdessen dieses Haus bekommen. Wenn nicht jetzt, so doch später. Der Lagerplatz, das ganze alte Gerümpel, das war nur ein Umweg. Auf seine Weise verstand Heinrich Grebe etwas von Psychologie. Wenn Psychologie wirklich die Kenntnis von der zweckmäßigsten Behandlung des Menschen bedeutet. Eine Annahme, die er mit vielen anderen Geschäftsleuten teilt.
Wie hätte er denn andere Götter haben sollen? Hatte er denn überhaupt einen Gott? Aber das sind Spitzfindigkeiten. Er selbst hielt sich für einen Christen, was denn sonst? Er füllte die Rubrik der Konfession auf einem Fragebogen mit einer Geläufigkeit aus, die sich nur noch mit dem »dtsch.« der Staatsangehörigkeit und dem »verh.« des Familienstandes vergleichen läßt. So selbstverständlich, daß man gar nicht darüber reden sollte.
Aber wie ist das nun mit den anderen Göttern? Soll man wirklich diese dumme alte Geschichte noch einmal hervorholen? Er selbst hat sie längst vergessen. Er hat ein rücksichtsvolles Gedächtnis. Es gab eine Zeit, und so ganz weit liegt sie nicht einmal zurück, da hatte er etwas wie einen Götterglauben, in dem sich die Vorsehung, Wodan, germanische Helden und ein Gefühl der Auserwähltheit seiner nordischen Rasse – zu der er sich seinem blonden Aussehen nach ohne weiteres zählen durfte – verworren mischten. Alles zusammen hatte damals bewirkt, daß er sich für einen gläubigen Menschen hielt. Als die Ideale des Dritten Reiches dann nichts mehr galten, setzte er an ihre Stelle das Geld.
Ein Gott, das ist doch wohl etwas, dem der Mensch recht nahe zu kommen trachtet, was er bewundert, anbetet – nun, bei Heinrich Grebe war das seit langem das Geld. Zunächst das Geld, das andere und nur er nicht hatten, später das eigene Geld, das man günstig anlegen mußte, damit es sich vermehrte. Er hoffte auf eine Zeit, in der nicht mehr er arbeitete, sondern nur noch sein Geld. Seit einiger Zeit war das Geld etwas in den Hintergrund getreten: er besaß ein Auto. Er hatte nicht erst mit einem Kleinwagen oder einem Volkswagen angefangen. Wenn schon, denn schon, und schließlich und endlich war man sich – und auch der Familie! – ein gewisses Auftreten schuldig. Auch ein Auto ist ein Gott, den man verteidigen muß, für den man eintritt. Zum Beispiel beim Finanzamt. Auch gegenüber seiner Frau verteidigt er seinen Gott, wenn sie sich sorgt, weil er unterwegs ist, aber auch, wenn sie ihm die Kosten vorrechnet. Ein Gott, den er so sehr liebt, daß er ihn, wenn es seine Vermögensverhältnisse gestatten würden, gewiß vergolden ließe. Diese Behauptung stammt von seiner Frau, die einmal zu ihm gesagt hat: »Laß es dir doch vergolden, dein Auto, Heini!« Von diesem »Heini« hatte er sie in achtzehn Ehejahren nicht abbringen können.
Ich darf mich nicht schon beim ersten Gebot zu lange aufhalten. Schließlich und endlich ist das eines, was Heinrich Grebe gar nicht kennt. Aber in der Mitte, da kennt er ein paar, und es will doch wohl niemand im Ernst behaupten, daß er die jemals übertreten hätte! Stehlen! Töten! Ehebrechen! – das sollte ihm einmal einer nachsagen! Er würde ihn auf der Stelle wegen Beleidigung verklagen, er würde verlangen, daß man derartige Äußerungen offiziell zurücknahm, mit dem Ausdruck des Bedauerns.
Er ist kein Mann, der flucht. Die Zeiten, in denen er »Herrgottsakramentnochmal!« sagte, sind lange vorbei. Er hat es auch nie anders gesagt als »verdammtnochmal« und »verflixtundzugenäht«. Heute konnte es ihm höchstens noch mal passieren, daß er mit diesem treuherzigen Ausdruck, der sein hellhäutiges Gesicht etwas dümmlich macht, sagte: Bei Gott, das verspreche ich Ihnen! Er sagte auch: Weiß Gott! Aber in der Regel benutzte er dieses »Bei Gott«, und es verfehlte selten seine Wirkung. – Wir wollen uns doch nicht an Worten stoßen! Er klopft nicht einmal unter den Tisch, wie andere das tun und dabei toi, toi, toi! sagen. Er war nicht abergläubisch, er las gelegentlich mal ein Horoskop, aber er hatte seiner Frau, vor Jahren schon, strikt untersagt, zur Wahrsagerin zu gehen. Er hatte so ein unangenehmes Gefühl, als könnten da Sachen herauskommen, die nach Lage der Dinge besser blieben, wo sie waren, in der Vergessenheit.
Wir sind beim Feiertag. Beim Sonntag von Grebes. Den Sonntag verbringt er in der Familie, mit seiner Frau und den beiden Töchtern. Ich will Sie damit nicht langweilen, Sie kennen diese Sonntage, die dann im Kino enden.
Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. – Ehren? Was hat man darunter zu verstehen? Dafür sorgen? Nun, bei Gott, das tat er! Seine Eltern waren fünfundvierzig aus Schlesien geflohen, nach Thüringen, in ein kleines Dorf, nicht weit vom Eisernen Vorhang entfernt. Er ließ durch ein Lebensmittelgeschäft monatlich ein Paket hinschicken. Für vierzig Mark. Er fand das Geld auch nicht auf der Straße. Sie kriegten ihre Rente, und was brauchen alte Leute schon viel. Die Mutter hatte ihren Kaffee und der Vater seine Stumpen. Zum Geburtstag schrieb er ihnen sogar eigenhändig eine Karte. Bis zum vorigen Jahr hatte er die Eltern in jedem Jahr für vierzehn Tage zu sich eingeladen. Aber jetzt war der Vater nicht mehr reisefähig. Im Grunde ganz gut so. Sie waren ein bißchen wunderlich geworden, die Alten. Man konnte sich mit den beiden nicht mehr sehen lassen. Sie wirkten ärmlich und ängstlich, fürchteten sich, Auto zu fahren, hatten Angst vor dem Fahrstuhl und wollten nicht auf die Rolltreppe, wollten überhaupt nichts unternehmen, saßen immer im Zimmer herum, man wußte nicht, was man mit ihnen reden sollte, und am Ende atmeten alle auf, wenn sie weg waren. Man schickte Pakete, umfangreiche sogar, mit Wertangabe. Ich will nicht ungerecht sein, auf seine Weise hielt er das vierte Gebot ein. Vielleicht liebte er seine Eltern nicht, ehrte sie nicht, aber er sorgte für sie. Von der Pflicht, sie zu lieben, kaufte er sich mit monatlich vierzig Mark los. Da er sein Geld über alles liebte, darf man diese Summe, die alljährlich in seiner Einkommensteuererklärung unter »außergewöhnliche Belastungen« auftaucht, auch nicht zu gering einschätzen.
Vor zwei Jahren war Heinrich Grebe mit seiner Frau in der Schweiz. Er hatte Verbindungen mit Schweizer Maklern angeknüpft, er mußte endlich auch dort ins Geschäft kommen. Auf dem Rückweg hatten sie einen Abstecher an den Lago Maggiore gemacht. Sie hatten etwas getrunken, einen halben Liter Rosatello, mehr nicht, und bei Bellinzona, an der Abzweigung zum kleinen Bernardino, hatte er einen jungen Franzosen überfahren, tödlich. Vielleicht war der Junge auf seinem Motorroller wirklich zu weit in der Mitte der Straße gefahren und hatte sein Abbiegen nicht mit dem rechten Arm angezeigt – vielleicht, wer wollte das dem tüchtigen Anwalt widerlegen, Augenzeugen gab es nicht. Grebe bekam sogar seine Kaution zurück. Es war ein Schatten auf diese Reise gefallen, aber schließlich und endlich hatte nach der letzten Verhandlung nicht einmal mehr er selber das Gefühl, am Tod des jungen Franzosen schuld zu sein.
Jetzt sind wir schon in der zweiten Hälfte. Die zweite Halbzeit würde Grebe es nennen, und die beginnt lapidar: »Du sollst nicht ehebrechen.« Im Krieg – er war wegen eines geringfügigen Herzfehlers bei der Verwaltung, zuletzt als Zahlmeister – hatte sein Stabszahlmeister mal zu ihm gesagt: Im Krieg sind wir alle Junggesellen! Ich will nicht strenger sein als sein Vorgesetzter. Lassen wir den Krieg aus, nehmen wir auch nicht die wenigen Male, bei denen er die Courage hatte, eine günstige Gelegenheit auszunutzen. Das liegt lange zurück, so lange, daß er donnerstags schon mal am Stammtisch die eine oder andere Affäre zum besten geben kann. Er muß sie herausputzen, um überhaupt mit den anderen konkurrieren zu können, so dürftig sind diese Geschichten.
Heute riskiert er nicht mehr als einen zudringlichen Blick, ein Zufassen, wenn keiner es sieht. Was er unter »Liebe« versteht, findet er in seinem eigenen Schlafzimmer, aber man darf es ihm nicht allzu hoch anrechnen, wenn man sagt, er sei ein solider Ehemann.
Halten wir uns nicht bei den Gänsen auf, die er aus Polen mit nach Hause schleppte! Und nicht bei der Kette für seine Frau, die er in Lyon im Haus eines geflüchteten Juden fand, das war Kriegsbeute. Er hat niemals ein Schild mit der Aufschrift »Ich habe geplündert, ich werde erschossen« um den Hals getragen. Als das Nachbarhaus abbrannte, während er auf Heimaturlaub war, mußten die Sachen schließlich von der Straße, die Leute waren ja kopflos, ließen ihre Brocken im Stich – lassen wir’s gut sein, es war eben Krieg. Ausnahmezustand. Später, nach dem Krieg, zog er nachts mit Rucksack und Einkaufstaschen zum Güterbahnhof, wo Züge mit Koks standen. Im Keller schlug er die Kohlen klein, damit man sie im Küchenherd verbrennen konnte. Mein Gott, die Kinder waren noch Säuglinge! Man konnte sie nicht erfrieren lassen, und sollten sie denn verhungern? Es waren die Jahre vor der Währungsreform, man mußte zusehen, wie man durchkam. Mundraub! Das bestrafen nicht mal die Gesetze. Ich bitte Sie! Er war ein ordentlicher Mann. Lassen wir es doch endlich genug sein mit diesem: »Du sollst nicht stehlen!« Mag sein, daß es Zeiten gibt, in denen man sich besser daran halten kann. Jetzt hat unser Mann, was er braucht. Reichlich sogar. Wenn er seinen guten Tag hat, sagt er schon mal zu einem Klienten: »Mehr als ein Kotelett ißt unsereins ja auch nicht auf einmal!« Und dann lacht er behaglich und tut einen kräftigen Zug an seiner Zigarre. Seit etwa fünf Jahren raucht er Zigarren, das macht einen gediegenen Eindruck, findet er.
»Falsch Zeugnis ablegen!« – soll das Denunziation heißen? Die Sache mit dem Kollegen, das war achtunddreißig – das dürfte doch wohl verjährt sein! Außerdem war der Kollege nach einem halben Jahr aus dem Konzentrationslager zurückgekommen. Die Firma hatte ihn entlassen, und das war gut so, da brauchte er ihm wenigstens später nicht am Schreibtisch gegenüberzusitzen. Er hat tatsächlich noch immer ein ungutes Gefühl, wenn er an diesen Mann denkt, schließlich hätte er sich nach dem Krieg rächen können. Er hat es nicht getan, er wird schon seinen Grund gehabt haben, den Mund zu halten; vielleicht hat er auch gar nicht gewußt, wer ihn verpfiffen hatte. Und dann die Spruchkammer! Was war er denn anderes gewesen als ein Mitläufer, bitte! Man könnte Leute nennen, die hatten ganz andere Dinger gedreht.
Es hat doch keinen Sinn, alten Idealen nachzutrauern! Es werden schon noch mal andere Zeiten kommen, aber noch mal wird er sich nicht …
Sagen Sie selbst, hatte sein Schwager das Haus nötig? Er als Junggeselle? Bettlägerig, wie er war. Und er, Grebe, als Familienvater, mußte er nicht endlich daran denken, sich selbständig zu machen? Das Erbe blieb in der Familie, das war nach Lage der Dinge doch wohl die Hauptsache. Das neunte Gebot? Wer hatte denn ein Testament gesehen? Hatte nicht die Schwiegermutter noch auf dem Sterbebett … Sie wäre da schon tot gewesen? Ach was denn! Der Schwager war doch ganz einverstanden gewesen.
Und jetzt steigt er wieder in sein goldenes Auto. Er ist zufrieden. Er sitzt einen Augenblick untätig am Steuer, faßt mit der Rechten sein Ohrläppchen und reibt es, wie er es immer tut, wenn ihm etwas geraten ist. Nein – nein, er denkt wirklich nicht daran, daß er gerade das letzte der Zehn Gebote übertreten hat. Er ist in Geschäften unterwegs. Es ging um ein Grundstück, um nichts anderes. Kaufen – verkaufen. Günstig kaufen, günstig verkaufen. Man mußte nur zusehen, daß es für einen selber günstig war und nicht für den anderen. Steht davon etwas in der Bibel, daß man die Dummheit des anderen oder seine Notlage nicht ausnutzen dürfte? Na also!
Ehrlich gesagt, ich weiß es auch nicht. Er sieht so ordentlich aus, dieser Heinrich Grebe, wie er den Rückwärtsgang einlegt und behutsam sein Auto um die Ecke setzt, richtig bieder, niemand traut ihm etwas Schlechtes zu. Er sieht aus wie andere Leute auch, vielleicht sogar noch ein bißchen besser.
Wann – wenn nicht jetzt
»Wenn er nur wiederkommt –«, so hatten viele Sätze des alten L. begonnen, und viele hatten so geendet. Seine Frau hatte aus diesen Worten ihren Trost genommen; zuerst den, daß er noch an die Heimkehr des Sohnes glaubte, aber dann auch den, daß alles besser werden würde zwischen den beiden. Daß der Junge dann seinen eigenen Willen würde haben dürfen und daß der Starrsinn des Vaters nicht wiederkehrte, der schon im letzten Kriegsjahr, als der Sohn nach Rußland verlegt wurde, einer ungewohnten Müdigkeit und Nachgiebigkeit gewichen war.
»Wenn er nur wiederkommt –«, dann sollte ein Trekker angeschafft werden, und dann sollte auch Lisa, das Flüchtlingsmädchen, bleiben, damit alle es leichter hätten als früher, der Junge sollte sich eine Frau suchen, tüchtig und ordentlich sollte sie sein, wenn sie auch nichts mitbrachte. Wenn er nur wiederkäme …
Nach drei Jahren erhielten sie die erste vorgedruckte Karte von ihm. Sie besaßen jetzt eine Lagernummer und konnten ihm schreiben. Er würde aus den drei Sätzen, die man schreiben durfte, schon alles herauslesen: daß sie noch gesund waren und daß auf dem Hof alles in Ordnung war. Daß seine Schwester geheiratet hatte und daß sie nur noch ein einziges Pferd besaßen. Dahinter hatte er zu lesen: Der Vater wird alt. Wenn du nur erst wieder zu Hause wärest!
Im letzten Sommer vor der Heimkehr des Sohnes benahm sich der alte L. oft recht sonderbar. Einmal sagte er abends beim Füttern zu seiner Frau: »Weißt du noch, als das Wilhelmken seinen Schuh in den Schweinetrog geworfen hat?« Und ein anderes Mal erzählte er der Lisa, die alle längst Wieschen nannten, wie das im Dorf üblich war, daß das Wilhelmken …
Immer häufiger sagte er »das Wilhelmken« und immer seltener »wenn er nur wiederkommt«. Dieses Wilhelmken war in der Erinnerung des nun bald Siebzigjährigen ein Junge von acht oder neun Jahren. Ein Junge, der abends auf dem Handpferd saß, wenn sein Vater mit dem letzten Fuder Heu von der abgelegenen Waldwiese kam; den man die Wagenbremsen anziehen ließ und den man in die Schmiede schickte mit dem Pferd; der immer ein wenig kränklich gewesen war, immer schweigsam, immer anders, als man sich den einzigen Sohn und Hoferben gewünscht hatte.
Fünf Jahre nach Kriegsende, im August, kehrte der junge L. dann doch zurück.
Nicht, daß sein Vater ihn nicht gleich erkannt hätte! Er war ja nicht schwach im Kopf. Er wurde aber auch nicht von einem Tag zum anderen wieder der alte, der er früher gewesen war. So etwas kommt nicht von heute auf morgen. Er sagte: »Da bist du ja nun wieder« und richtete sich ein Stück auf, um nicht kleiner zu erscheinen als der Sohn. Er hörte sich auch an, was der von der Bewirtschaftung der Kolchosen erzählte und was daran, nach Ansicht des Sohnes, gut war und was man vielleicht sogar übernehmen sollte. Er sagte auch nur ein einziges Mal, während seine Frau das Essen auf den Tisch brachte: »Rauchst du denn jetzt?« Seine Frau warf ihm einen Blick zu, und er gab sich dann gleich zufrieden.
Dieser erste Abend nach der Rückkehr blieb der einzige, an dem die beiden Männer zusammen auf dem Sofa saßen, jeder in seiner Ecke. Die Mutter, die von der Speisekammer zum Herd, vom Herd zum Tisch ging und im Vorbeigehen rasch von einem zum anderen sah, dachte sich, daß ihr Wilhelm heute dort nicht säße, wenn er nicht geworden wäre wie sein Vater. Im Guten, aber auch im Schlimmen. Vielleicht durfte man so etwas gar nicht denken. Wie denn die Auswahl aussah, die zuerst der Krieg und nachher die Gefangenschaft getroffen hatte. Wer blieb denn übrig am Ende? Der Stärkere oder der Schwache? Der Mutige oder der Feige?
Er säße heute nicht neben dem Vater auf dem Sofa in der Küche, wenn er nicht gelernt hätte, sich zu behaupten, das war wohl sicher. Gegen den Vater hatte er das nicht gekonnt, da hatte sie manches Mal im stillen gedacht, er sei ein Duckmäuser. Aber im Lager, da hatte er es offenbar gelernt. Bei den ersten zu sein, wenn es Essen gab, und bei den letzten, wenn die Arbeitskommandos zusammengestellt wurden, und vielleicht hatte er auch gelernt, mit den Wachmannschaften besserzustehen als mit den anderen Gefangenen.
In den nächsten Wochen – die Kartoffelernte war schon im Gange – kam fast an jedem Abend einer aus der Nachbarschaft und wollte etwas von Rußland hören. Meist waren es die Alten, die im vorigen Krieg dort gekämpft hatten, aber auch Väter, die jetzt keine Söhne mehr besaßen. Und weil dieser Wilhelm L. noch immer nicht das Reden gelernt hatte, tat es sein Vater. Zuerst zu Hause, auf der Bank vor der Tür, und später, als er anfing sich zu ärgern, wenn der Wilhelm in den Stall oder in die Scheune ging und dabei nur mit zwei Fingern an die Mütze tippte, da setzte er sich zu den anderen Männern ins Wirtshaus und erzählte dort. »Ja, der Wilhelm, als der nach Smolensk kam –« Er geriet ins Prahlen und schmückte die paar Geschichten, die sein Sohn in den ersten Tagen erzählt hatte, immer großartiger aus. Er machte aus ihm einen Helden. Aber es war kein Held zurückgekehrt. Nur ein Mann, der endlich tun wollte, was er für richtig hielt. Der nicht mehr nur gehorchen, nicht mehr nur fragen wollte. Nur arbeiten wollte er. Für sich, wohlgemerkt: für sich. Für das, was ihm gehörte. Männer von seinem Schlage konnten mit Zeitungsworten wie Freiheit nichts anfangen. In dem ersten Jahr, als sie in Güterwagen gepfercht wurden und hinter Stacheldraht lagen, da war noch Krieg gewesen, das hatte er hingenommen, ohne darüber nachzudenken, aber nachher, als man ihn behandelte wie den letzten dämlichen Knecht, den es nichts anging, ob der Mais ausgereift war beim Schnitt, ob die Schweine krepierten, ob der Weizen gut ausgedroschen war – da hatte es ihn gepackt. Er wollte nach Hause! Er wollte dorthin, wo alles ihm gehörte: der Stall und die Weiden, die Scheune und der Hund. Und andere sollten für ihn arbeiten. Das kam noch dazu. Manchmal stand er abends an der Scheunentür, den Rücken fest an das Tor gelegt, und murmelte: »Meins, alles meins.«
Und dann war da dieses Mädchen, diese Lisa. Sie war nicht wie die Mädchen aus dem Dorf. Eher wie die Mädchen, die er in Polen gesehen hatte. Vielleicht hatte sie ihn auf den ersten Blick auch an Wanda erinnert, Wanda aus Lodz. Es war das Fremde an ihr, das Dunkle. Nie wußte er genau, warum sie lachte, und erst recht nicht, warum sie plötzlich schwermütig wurde. Manchmal hockte er oben in der Futterluke, durch die er das Heu geschüttet hatte, und hörte ihr zu, wenn sie mit den Kühen schwatzte. Einmal sah er, wie sie beim Melken ihr Gesicht am breiten Leib einer Kuh rieb. Das erste, was er anschaffte, war eine Melkmaschine.
Sie lachte anders als die Mädchen im Dorf, die sich schämen, wenn sie lachen, und rot werden und kichern. Sie lachte mit den Augen und mit den Schultern.
Einmal, als sie zusammen aufs Feld fuhren, um die »Runkeln« zu holen, lachte sie ihn aus. »Was habt ihr für komische Wörter hier! Das sind doch Rüben, Futterrüben!« Auf dem Rückweg, als sie neben dem beladenen Wagen hergingen, pflückte sie am Wegrand Schlehen und hielt ihm die gefüllte Hand unter den Mund. Als er abwehrte und sagte, sie seien ihm zu bitter, lachte sie wieder und sagte: »Deshalb, weil sie bitter sind und weil man so taub im Mund wird!«
Es gefiel ihm, ihr Befehle zu erteilen. Tu das! Hol das! Mach rasch, Lisa, los! Aber dann sagte sie: Gern! Und: Ja, sofort! Sie nahm ihm die Genugtuung an Befehl und Gehorsam. Vor ihrer fröhlichen Bereitwilligkeit wurde er machtlos, das war es: Er hatte keine Macht über sie, so wie er meinte, daß ein Mann über eine Frau Macht haben müsse. Er wollte Herr über einen fremden Willen sein, und Lisa hatte keinen anderen Willen als seinen.
Seine Mutter stellte ihn zur Rede: »Worauf wartet ihr noch?« Er tat, als verstünde er nicht. Sie mußte es noch deutlicher sagen: »Warum heiratet ihr nicht?« Und noch immer schien er nicht zu begreifen: Heiraten? Die Lisa etwa? Ein Mädchen, von dem man nicht einmal wußte, woher sie kam? Die nichts mitbrachte? Wenn der junge L. heiratete, dann mußte es eine aus der Gegend sein. Wo eins zum anderen paßte. Eine, die auch was an den Füßen hatte, Wiesen, Äcker!
Seine Mutter meinte ihren Mann zu hören, mit dem sie am Abend zuvor darüber geredet hatte. »Das Wieschen, das ist doch kein Mädchen zum Heiraten!«
Sie versuchte es weiter. Sie sagte genau dasselbe, was sie am Abend auch gesagt hatte: »Lisa ist gesund, sie kann arbeiten, sie ist verträglich.« Und: »Ihr liebt euch doch.« Sie hörte die Stimme ihrer eigenen Mutter. Als sie merkte, daß sie zu tauben Ohren sprach, sagte sie, was sie nicht hatte sagen wollen: »Und dein Vater? Was besaß er denn? Er war Knecht bei meinem Vater. Knecht und nichts weiter! Woher kam er denn? Dies hier ist mein Hof, und was er heute ist, das haben wir beide geschafft, dein Vater und ich. Sechzig Hektar! Und nicht mehr vierzig.«
»Als ob der Vater dich geheiratet hätte, wenn ich nicht unterwegs gewesen wäre!« Er schlug die Tür hinter sich zu.
Am nächsten Morgen verließ Lisa den Hof. Die Mutter schickte sie fort, ohne es den Männern zu sagen. Als am Abend der Sohn fragte: »Wo ist sie? Wer hat sie fortgeschickt?«, sagte sie: »Ich«, und er fragte nicht weiter.
Von diesem Tage an verstockten die drei gegeneinander. Sie redeten nur noch das Nötigste. An einem Morgen im März ging der alte L. zum Kunstdüngerstreuen aufs Feld, und als er nicht zum Essen kam und es immer später wurde, setzte sich der Sohn aufs Fahrrad, um nach ihm zu sehen. Er fand ihn am Feldrand liegend, noch bei Besinnung, aber die Beine trugen ihn nicht mehr. Am Abend stellte der Arzt außer dem Schlaganfall, von dem er sich vielleicht noch einmal erholt hätte, eine Lungenentzündung fest. Drei Wochen lang lag er auf Leben und Tod. Seine Frau rief Lisa zurück, damit sie ihr bei der Pflege zur Hand ginge.
Einmal trafen sich Mutter und Sohn unter der Tür des Krankenzimmers. »Wenn er bloß wieder wird, der Vater!« sagte er. Die Mutter sah ihn an. »Wenn er nur! Was ist dann, wenn er wieder gesund wird? Was soll denn dann anders werden? Du? Oder er? Nichts wird anders! Immer sagt ihr: Wenn, wenn –! und: Dann, dann –!«
In seinen letzten Tagen verlor der alte L. das Gedächtnis. Er kehrte in jene Zeit zurück, in der sie auf den Wilhelm gewartet hatten. Noch einmal mußte seine Frau sein »Wenn er nur wiederkommt –« mit anhören, und der Sohn hörte seinen Vater vom Wilhelmken reden und fühlte, daß der Vater einen anderen Sohn meinte als den, der an seinem Bett stand; einen, auf den sich das jahrelange Warten gelohnt hätte.
Am Abend, als er mit Lisa das Vieh besorgte, lauerte er ihr auf und tat, als ob er noch etwas an der Melkmaschine zu reparieren hätte. Sie wollte rasch an ihm vorbei, aber er packte sie an den Armen. Sie versuchte, ihn abzuwehren, sagte: »Jetzt doch nicht, Wilhelm! Warte doch, bis der Vater –!« Er hielt ihr den Mund zu. »Jetzt, Lisa, jetzt muß ich es sagen. Wann – wenn nicht jetzt?«
Die Zuflucht
Am Abend hatte Anton W. noch zu seiner Frau gesagt: »Binde dir doch wenigstens einen Strumpf um den Hals und sieh zu, daß du schläfst«, hatte sich auf die Seite gelegt und war eingeschlafen.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: