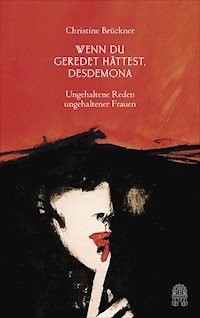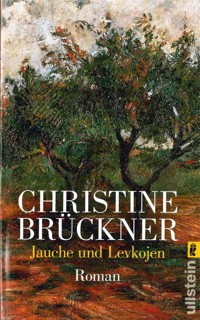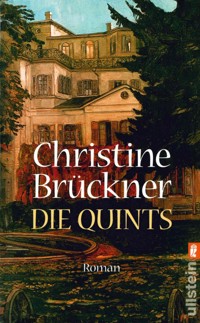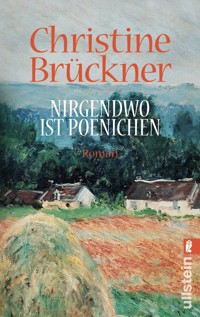16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Christine Brückner, über vierzig Jahre Erfolgsautorin des Ullstein Verlags, und ihr Schriftstellerkollege Otto Heinrich Kühner trafen erstmals 1954 während einer Literaturtagung aufeinander. Zwölf Jahre später wurden sie ein Paar, das dann drei Jahrzehnte lang als 'einziger funktionierender Autorenverband' zusammen lebte und arbeitete. Dass diese beiden anders als die meisten schreibenden Paare die Spannung zwischen intimer Nähe und Schreibisolation meisterten, davon zeugt der Briefwechsel, der sich im Nachlass fand und der hier zum ersten Mal zugänglich gemacht wird. Auch wenn die Korrespondenz mit einem handfesten Krach einsetzt, entwickelt sie schnell einen humorvollen Grundton. Der ebenso heitere wie kluge Briefwechsel zeigt, wie Kunst und Leben sich glücklich zur Lebenskunst verbinden. Mehr über Christine Brückner erfahren Sie über die Stiftung Brückner-Kühner unter http://www.brueckner-kuehner.de/.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Ich will Dich den Sommer lehren
Die Autoren
Das Buch
Christine Brückner, über vierzig Jahre Erfolgsautorin des Ullstein Verlags, und ihr Schriftstellerkollege Otto Heinrich Kühner trafen erstmals 1954 während einer Literaturtagung aufeinander. Zwölf Jahre später wurden sie ein Paar, das dann drei Jahrzehnte lang als 'einziger funktionierender Autorenverband' zusammen lebte und arbeitete. Dass diese beiden anders als die meisten schreibenden Paare die Spannung zwischen intimer Nähe und Schreibisolation meisterten, davon zeugt der Briefwechsel, der sich im Nachlass fand und der hier zum ersten Mal zugänglich gemacht wird. Auch wenn die Korrespondenz mit einem handfesten Krach einsetzt, entwickelt sie schnell einen humorvollen Grundton. Der ebenso heitere wie kluge Briefwechsel zeigt, wie Kunst und Leben sich glücklich zur Lebenskunst verbinden. Mehr über Christine Brückner erfahren Sie über die Stiftung Brückner-Kühner unter http://www.brueckner-kuehner.de/.
Christine Brückner und Otto H Kühner
Ich will Dich den Sommer lehren
Briefe aus vierzig Jahren
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein-buchverlage.de
ISBN 978-3-8437-2450-0© 2020 by Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin Alle Rechte vorbehaltenE-Book-Konvertierung powered by pepyrus.comAlle Rechte vorbehalten.
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Titelei
Die Autoren / Das Buch
Titelseite
Impressum
Vorwort
»Der einzige funktionierende Autorenverband«
Anhang
Anmerkungen
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
Vorwort
Vorwort
Der private Schriftwechsel zwischen Christine Brückner und Otto Heinrich Kühner beginnt in aller Öffentlichkeit – mit einem Krach: Die Autorin hatte 1956 im christlichen »Sonntagsblatt« eine Kirchentags-Lesung ihres Kollegen kommentiert und ihm darin abgesprochen, ein ›christlicher Autor‹ zu sein. Die Gegendarstellung Kühners folgte alsbald in einem Brief an die Zeitung zur Rettung seiner, wie es heißt, ›christlichen Ehre‹. Das war schon der eigenen Familie geschuldet; im Nachlaß Kühners findet sich auch die Reaktion des Vaters. Der Theologe stellt darin dem Sohn mit langen, rot unterstrichenen Brückner-Zitaten besorgt die Gretchenfrage: Wie hast du’s mit der Religion?
Literaturhistorisch scheint dieser Vorfall eine Marginalie zu sein, eine Kuriosität vielleicht – um vieles kümmert sich die deutschsprachige Literatur der fünfziger Jahre, nach ›Kahlschlag‹ und ›Stunde Null‹ jedoch gewiß selten um die christliche Ehre!
Und doch weist das Ereignis auf die Sonderstellung hin, die Christine Brückner und Otto Heinrich Kühner in der sonst überwiegend tragischen Geschichte schreibender Paare einnehmen. Denn hinter dem Streit steckt eine gemeinsame Grundhaltung, aus der heraus die beiden in der Kunst und im Leben zusammenfinden – und zusammenbleiben. Die Übereinstimmung nimmt seinen Anfang im evangelischen Pfarrhaus, dem beide entstammen, sie aus Waldeck, er vom Kaiserstuhl, im selben Jahr geboren, jeweils als jüngstes Kind an einem 10. des Monats. Die Biographien der beiden Autoren verlaufen in Parallelen – bis zu ihrem kurz aufeinanderfolgenden Ende im Jahr 1996. Näheres zu diesem, wie sie sich selbst gern nannten, »einzigen funktionierenden Autorenverband« erzählt in der Mitte dieses Buches die kleine Lebensgeschichte in Text und Bild.
Der öffentliche Konflikt im »Sonntagsblatt«, der in der darauf einsetzenden Korrespondenz schnell als ›Mißverständnis‹ beigelegt wird, ist zugleich Bekenntnis zur genannten protestantischen Weltsicht, die für beide Autoren zeitlebens bestimmend bleibt. Sie durchzieht auch den gesamten Briefwechsel, ausdrücklich z. B. in Gebetsformeln oder Choralzitaten. Gerade die Intimität der Liebesbriefe, die sich das Paar seit 1966 und auch nach der Heirat schreibt, erlaubt eine offene Religiosität, die sich im literarischen Werk allenfalls unterschwellig ausmachen läßt. Der Ton ist dabei über weite Strecken heiter und humorvoll – darin stimmen der Briefwechsel und die literarischen Texte beider Autoren überein. Ansonsten hat man es jedoch mit grundverschiedenen Schreibweisen zu tun: Die Briefe sind nicht als Literatur gestaltet oder beabsichtigt, auch wenn sie kunstvolle Formulierungen oder – im Falle Kühners – immer wieder Gedichte enthalten. Ein Blick auf die literarischen Briefe Christine Brückners, z. B. in dem Band »Lieber alter Freund« (1992), macht diesen Unterschied deutlich: Als Adressaten sind hier in erster Linie die Leser gemeint; Briefpartner und -stil sind diesem Zweck unterworfen. Die privaten Briefe sind dagegen intimes Gespräch, das sich – besonders deutlich bei Kühner – auch Sentimentalität erlaubt oder – bei Christine Brückner – wie mündliche Rede liest.
Für den Herausgeber und Wächter über den Nachlaß des Schriftstellerpaares stellte sich daher die Frage, ob diese Briefe überhaupt veröffentlicht und einer breiteren Leserschaft zugeführt werden sollten. Solche Zweifel aber schwinden angesichts der langen Geschichte der Briefveröffentlichungen von Schriftstellern oder anderen Personen des öffentlichen Lebens. Sie verfliegen endgültig mit der Erkenntnis, daß die Autoren durchaus mit der Möglichkeit einer späteren Veröffentlichung gerechnet haben. Im Brief vom 6. November 1966 etwa verkneift sich Kühner eine kleine Frivolität, denn: »… das kann ich nicht so einfach hier hinschreiben, weil unsere Briefe vielleicht einmal veröffentlicht werden (!!)« Zwei Ausrufezeichen! Noch schwerer wiegt die Entdeckung, daß der Briefwechsel nicht nur als intimes Archiv aufbewahrt, sondern zu einem guten Teil bereits in Christine Brückners Briefroman »Das glückliche Buch der a.p.« literarisch verarbeitet wurde. Das Buch entstand – übrigens auf eine Anregung Kühners hin – in den ersten Ehejahren. Es beschreibt eine glückliche Beziehung zwischen zwei Schriftstellern und hat dabei viele authentische Briefe fast wortwörtlich übernommen; man möge es einmal anhand einiger Stichproben für das Jahr 1966 hier und im Roman überprüfen. An eine Fortsetzung wurde gedacht, wie es in einem Brief Christine Brückners einmal heißt: »Du schreibst sehr literarische, sogar poetische Briefe vom Lande! Ich sehe kommen, daß ich in 10 Jahren den zweiten Teil der ›a.p.‹ schreiben muß!« (4. 2. 1972)
Bei allem Unterschied zwischen den literarischen Briefen und ihren privaten Gegenstücken zeigt Christine Brückner gerade in ihrem Briefroman, wie eng sich Lebenswirklichkeit und ästhetische Fiktion durchdringen können. Das versteht sich schon von ihrer Maxime her, die sie im Aufzeichnungsband »Mein schwarzes Sofa« (1981) mitteilt, nämlich »nichts zu schreiben, was ich nicht bereit wäre, auch zu leben«. Das ›Du‹ aus dem Gespräch mit ihrem Mann wird übrigens auch in diese autobiographischen Mitteilungen übernommen. Bei Christine Brückner ist das Briefeschreiben, das sie – anders als ihr Mann – außerordentlich passioniert mit einem täglichen Pensum von oft zehn Briefen und mehr betreibt, eine Bedingung für die Arbeit an den Romanen. Als sogenannte Fingerübungen gelten die Briefe dem Eintauchen in die Welt der Schrift und einer ersten, mehr oder weniger vorläufigen Verarbeitung von Lebenserfahrung. Andererseits hat die »a.p.« wohl auch die Funktion, das Glück der zweiten Ehe festzuschreiben bzw. als Aufgabe und Verantwortung für die Zukunft festzulegen: »Glück ist Sache des einzelnen. Die Bewältigung des eigenen Schicksals.«
Bei Otto Heinrich Kühner hat der Brief nicht diese unmittelbare Anbindung an die literarische Arbeit. Dennoch gibt es auch bei ihm eine Entsprechung von Kunst und Lebenspraxis: Der Brief ist immer wieder eine Art der Einsicht, des Bekennens und der Vergewisserung gegenüber der Partnerin – und auch gegenüber sich selbst. Dazu gibt es gleichfalls eine Parallele in seinem Werk, ebenfalls einen Eheroman in Briefen, der im Jahr 1966 erscheint und somit unmittelbar vor der Liebesbeziehung zu Christine Brückner entstanden ist: In der »Heiratsannonce« schreibt sich ein in Trennung befindliches Ehepaar monatelang Briefe. Allerdings ohne das Wissen, daß es sich um den Gatten, die Gattin handelt, sondern im Glauben, der andere sei der neue Partner, mit dem man sich – jeweils vermittelt über eine heimliche Heiratsannonce – noch vor der Scheidung absichern möchte. Nur geraten die Eheleute eben zufällig selbst aneinander und finden sich so über viele Verwicklungen neu. Während bei Christine Brückner also das Schreiben des Paares zum Ausdruck einer gemeinsamen Lebensgestaltung hin zum Glück stilisiert wird, ist es bei Kühner ein Mittel, das in der Ironie des Schicksals dem einzelnen Einsicht und Wandlung und daher auch Liebe ermöglicht.
Was sich also über den Briefwechsel von Christine Brückner und Otto Heinrich Kühner insbesondere vermittelt, ist ein Stück Lebenskunst. Seit der Antike versteht man darunter die Möglichkeit, das eigene Leben in der Sorge um sich selbst und den anderen bewußt zu gestalten. Lange Zeit wurde Lebenskunst durch das Christentum überliefert – wohl auch deswegen ist sie den beiden Autoren so nahe. Bereits Friedrich Nietzsche, moderner Verfechter der Lebenskunst (und selbst ein Pfarrerskind), betonte, daß Erleben immer auch ein Erdichten ist. In Christine Brückners Roman »Jauche und Levkojen« heißt es einmal: »Das Leben hält sich oft eng an die Literatur und vermeidet dabei kein Klischee.« Literarische Kunst ist ›Probehandeln‹, und erfülltes Leben folgt – wie die Kunst – einer bewußten Wahl, Erschließung und kreativen Ausgestaltung von Möglichkeiten.
Zur Lebenskunst gehört aber auch die Kunst der Freundschaft und der Liebe. Davon zeugt der Briefwechsel in besonderem Maße. Zunächst ist es die kollegiale Freundschaft, in der man sich Lob und konstruktive Kritik für das neueste Buch zukommen läßt, um Vermittlung ersucht (vor allem Christine Brückner bei dem Hörspiellektor und -dramaturgen Kühner, meist vergeblich) oder dem anderen als Gleichgesinntem die momentanen Lebensumstände mitteilt. Mit der Liebe steigert sich dieser Dialog zum Wechselspiel zwischen Sorge und Sorglosigkeit. Die Sorge um sich selbst, so sagt die Philosophie der Lebenskunst, braucht geradezu die Sorge um den anderen, auch wenn sie sich immer wieder lustvoll in der Leidenschaft füreinander verliert. Sorge gilt, wie die Briefe zeigen, vermehrt zunächst der Partnerin: Ein Einschnitt ist hier die Erfahrung von Todesnähe, als das Paar im Frühjahr 1972 mit einem von Kühner gelenkten Wagen verunglückt und Christine Brückner dabei schwer verletzt wird (vgl. Kühners Brief zu Ostern 1972, der die Auferstehung ganz persönlich nimmt). Auffällig ist auch die Unterstützung, die er seitdem der literarischen Arbeit seiner Frau zukommen läßt: Er hilft bei der Konzeption der Romane, lektoriert sie immer als erster, sucht nach Titeln, lobt, versucht aufzumuntern, wenn der Erfolg durch negative Kritik geschmälert wird. Dann aber wird Otto Heinrich Kühner Mitte der achtziger Jahre mit seiner schweren Kopfkrankheit zum Sorgenkind. Die Melancholie hält Einzug in die seltener werdenden Mitteilungen, ohne daß das Ur- oder Gottvertrauen ernsthaft in Frage gestellt würde.
So eröffnen sich dem Leser dieser Briefe nicht nur Einblicke in den Alltag der beiden Schriftsteller, Einblicke, die sich weder durch die autobiographischen Aufzeichnungen noch durch andere Briefveröffentlichungen (vgl. den Band der »Briefe von c.b.« in den Gesammelten Werken) vermitteln. Sie veranschaulichen auch, wie das literarische Geschäft selbst eingebettet ist in einen individuellen Lebensprozeß. Und sie zeigen die Kommunikation eines außergewöhnlichen Paares, das – geradezu gegenläufig zum Zeitgeist – die Gemeinschaft in Kunst und Leben erlebt und »erdichtet«.
Der vorliegende Band ist eine Auswahl aus knapp 500 Briefen, Karten und Kassibern, die das Paar Brückner-Kühner sich über vierzig Jahre hinweg geschrieben und aufbewahrt hat. Die subjektive Zusammenstellung folgt weit mehr dem Verfahren, das dem »Glücklichen Buch der a.p.« zugrunde liegt, als dem einer wissenschaftlich kritischen Ausgabe. Maßgeblich war im Sinne der beiden Schriftsteller vor allem die Lesbarkeit. Daher wurde auch die Rechtschreibung behutsam vereinheitlicht, ohne gezielte Eigenheiten der Diktion einzuebnen. Die sparsamen Anmerkungen im Anhang möchten Verständnishilfen, die kommentierten Bilder eine biographische Orientierung geben. Zeitliche Lücken in der Abfolge der Briefe bis 1966 erklären sich daraus, daß wohl nicht konsequent alles behalten wurde, was der andere schrieb. In die Zeit bis zur Heirat und dem Beginn des Zusammenlebens in Kassel fällt naheliegenderweise ein verhältnismäßig großer Teil des Briefwechsels. Gleichwohl ist erstaunlich, wie diese Form des Austauschs auch danach gepflegt wurde, sei es, daß man sich bei räumlicher Trennung, z. B. durch Reisen, schrieb, sei es, daß man dem anderen ein Briefchen unter den Regalen durchschob, die die Arbeitszimmer trennen bzw. verbinden, es ins Bett oder den Koffer legte. In den achtziger Jahren läßt der Schreibfluß dann deutlich nach, was in erster Linie mit der schweren Erkrankung Kühners zusammenhängt.
Die Briefe sind chronologisch geordnet – mit einer Ausnahme: Die Sammlung schließt mit einer kurzen Passage aus einem Brief Kühners aus dem Jahr 1973, die beweist, daß das Paar tatsächlich einen guten Kontakt zum Himmel unterhielt und daß Wünsche auch einmal erhört werden.
Dichterlesung Sonntagsblatt, 19. 8. 19561
»Ich bin doch gar kein ›christlicher‹ Dichter«, sagt er, später am Abend. Und er hatte recht: Er ist kein christlicher Dichter, auch wenn in der Geschichte, die er am Abend in der Paulskirche liest (als außer ihm vier Autoren lasen, eine nicht sehr geschickte Veranstaltung), ein Mann vorkommt, der immer eine Bibel bei sich trägt. Allerdings: es ist nur die Hülle einer Bibel, statt der beiden Testamente ist eine Pistole darin. Für alle Fälle – wenn es gar nicht mehr geht. Dieser Mann heißt Bob, ein amerikanischer Flieger. Sein Flugzeug ist abgestürzt, ein Splitter nimmt ihm das Augenlicht, er treibt auf dem Meer, angeklammert an eine Tragfläche seines Flugzeugs, als letzter. Der vorletzte hat sich die Schlagader aufgeschnitten, aus Durst. Er konnte den Tod nicht mehr erwarten. Und dieser Bob trinkt das Meerwasser, und es schmeckt süß, und er bleibt am Leben.
»Merkt man denn«, fragt er nachher, »daß es kein ›Wunder‹ ist? Daß es einfach der Amazonas war, der ins Meer mündet und einen breiten Strom Süßwasser hineintreibt. Das ist keine wundersame Errettung, das ist nur: Der eine hat Vertrauen, der andere nicht. Wenn Sie wollen, können Sie es einfach eine pessimistische und eine optimistische Lebenseinstellung nennen.« Und dann sagt er noch: »Ich halte nämlich nichts von Wundern.«
Ich weiß nicht einmal, ob das Wort »Vertrauen« fällt in dieser Geschichte, gewiß nicht das Wort »Gottvertrauen«. Aber worauf vertraut denn dieser blinde Mensch, der hilflos im Meer treibt?
Der, der das geschrieben hat (O. H. Kühner), scheint mir, ist ein Christ und ein Dichter. Vielleicht ist er auch erst auf dem Wege zu beidem, ein christlicher Dichter ist er nicht.
Ähnliches ließe sich von den anderen Autoren sagen. Da ist die stark beeindruckende Geschichte von den »Schorschen« (Helmut Harun2: »Die Holzfäller«), die Geschichte von Stipu, dem alten Säufer ( Johannes Weidenheim: »Stipu will leben«), der aus Versehen und eigentlich doch nur um zwei Glas Branntwein den Gekreuzigten trägt in der Auferstehungsprozession. Da ist der junge, pfeifende Tapezierer Sonnenschein (Rudolf O. Wiemer) und der Fischer Salvadore und seine Frau Katerin (Lipinski-Gottersdorf).
Man möchte denken, es gibt keine Parallele. Jede Geschichte ist für sich. Schicksale, viel zuviel Schicksal, um es auch nur anhören zu können an einem einzigen Abend. Aber: Da ist etwas Gemeinsames. Immer ist Alltag. Der Alltag von einfachen, scheinbar primitiven Menschen. Die Arbeit der Hände wird exakt beschrieben, und man muß es schon heraushören, was währenddem in den Köpfen und in den Herzen vor sich geht. Und dann wird man gewahr, wieviel Versöhnliches zwischen diesen Menschen ist, wieviel Behutsamkeit. Als Eindruck bleibt die Untergründigkeit im scheinbar Realen.
Christine Brückner
Brief an das Sonntagsblatt
Ich bin zutiefst darüber bestürzt, wie Christine Brückner in ihrem Bericht über die Dichterlesung in der Paulskirche (»Dichterlesung«/»Sonntagsblatt« vom 19. Aug. 56) meine in einem privaten Gespräch geäußerten Worte zusammenhangslos und deshalb sinnentstellend wiedergegeben hat. Ich kann und will dies nur damit erklären, daß sich die Verfasserin keine Notizen gemacht hat und daß dieses Gespräch gewissermaßen zwischen Tür und Angel in einem Strom von Menschen stattfand.
Der Sinn meiner Worte war folgender: Ich habe gesagt, ich sei – im Gegensatz etwa zu anderen Autoren, die sich ausschließlich dem religiösen Schrifttum widmen – kein ausgesprochen christlicher Autor, d. h. daß ich in der Mehrzahl profane Werke verfaßt habe, die auch in einem rein belletristischen Verlag erschienen sind bzw. im Rahmen rein literarischer Sendungen wiedergegeben wurden. (Selbst bei diesen Arbeiten ließe sich leicht nachprüfen, daß auch sie fast alle ein christlich-religiöses Anliegen haben.) Es handelt sich dabei zum größten Teil um Versuche, Vernunft und Wissen in Einklang mit dem Glauben zu bringen und das reale Geschehen zum Gleichnis werden zu lassen. Wenn man bei der heutigen Denkart der Menschen noch auf breite Schichten wirken will, dann scheint mir dies wichtig und notwendig zu sein; vielleicht rührt diese meine Einstellung hierzu daher, daß ich längere Zeit an dem ›Massenpublikationsmittel‹ Funk tätig war.
Damit hängt es auch zusammen, daß ich im Falle des erblindeten Bob – und damit komme ich auf die von Christine Brückner zitierte Erzählung – allerdings nicht an ein Wunder im eigentlichen Sinne glaube, sondern an eine Fügung. Das ›Wunder‹ in meiner Erzählung (und ich habe dies keineswegs verschleiert) löst sich ja auch in einen durchaus erklärbaren physikalischen Vorgang auf. Das ›Wunder‹ in diesem Falle liegt darin, daß ein Mensch das objektive Geschehen zu sich selbst, zum Subjekt hin, organisiert und in Beziehung zu sich selbst setzt, nicht in einem naturwidrigen Vorgang, etwa, daß ein Bach plötzlich den Berg hinauffließt. Wunder im eigentlichen Sinne sind nur einmal in der Menschheitsgeschichte und nur von Christus selbst vollbracht worden. Darum ging es mir in meiner Erzählung nicht, sondern um die Glaubenszuversicht; und, psychologisch gesehen, ist (in der Tat!) – hierüber hat die Tiefenpsychologie schon genügend berichtet – der gläubige Mensch fast ausschließlich der optimistische und der ungläubige oder skeptische Mensch der pessimistische.
Wenn ich mich selbst für das hielte, für das mich Christine Brückner hält und was sie mir in ihrem Bericht unterstellt, würde ich es dabei bewenden lassen (denn ich habe ja keinen äußeren Schaden davon, und meine literarische Ehre wird ja davon nicht berührt); was aber treibt mich so sehr, mich zu rechtfertigen und hier vor der Öffentlichkeit geradezu ein Bekenntnis abzulegen? Nun, dann eben: meine christliche Ehre.
Otto Heinrich Kühner
Düsseldorf, 17. September 1956Starenweg 34
Also! Fällt man denn einer Kollegin so heimtückisch in den Rücken – lieber Herr Kühner? Einer Kollegin, die eine so miserable Reporterin ist, daß ihr zu so von der Anlage her mißratenen Unternehmungen wie der in der Paulskirche schier gar nichts, und vor allem nicht bis morgens um acht! Ordentliches einfällt. Dabei war mir doch, als wären wir uns völlig einig: über das Wunderbare sowohl wie über den christlichen Dichter. Nehmen wir an, es lag an der Formulierung, die allerdings war flüchtig. Dafür entschuldige ich mich.
Sie also gehen hin und fallen mich hinterrücks und öffentlich an – und ich hatte, nach der Rückkehr aus Frankfurt, vor, Ihnen endlich einmal zu sagen – sehen Sie, dazu hätte ich jetzt Ihre Hörspiele noch einmal lesen müssen und kann’s gerade aus akutem Zeitmangel nicht. Ich hätte so gern mit Ihnen einmal drüber geredet. Ihre Geschichten haben das, was ich die doppelte Pointe nenne, vor allem fiel mir das auf bei der »Übungspatrone«3 (die mein Mann so gern mit seinen Gymnasiasten liest, von der Mittel- bis zur Oberstufe), aber auch beim »Tramp«. Warum mußte eigentlich Maria tot sein? Warum diese doppelte Sinnlosigkeit? –
Ach, ich sehe schon, so sieht es nach Kritik aus. Die soll es nicht sein. Mir schien nur, diese ›doppelte Pointe‹ nimmt die Ergriffenheit weg, läßt ein merkwürdig unbestimmtes Gefühl zurück, jene fatale Sinn- und Ratlosigkeit, dieses Gefühl »Was können wir schon tun –?«. Wissen Sie in etwa, wie ich’s meine?