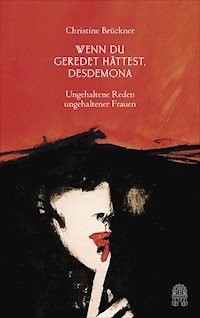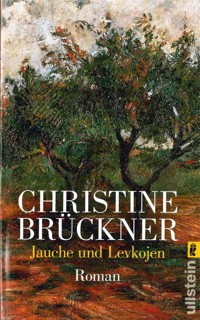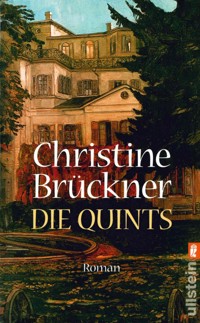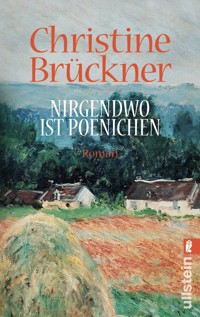9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Mann in mittleren Jahren überfährt eine junge Frau. Hat sie den Tod gesucht, oder war sie nur unaufmerksam? So unaufmerksam wie der Fahrer des Autos, der nun den Spuren dieses Lebens nachgeht, das er schuldlos-schuldig ausgelöscht hat? Wo hat sie gelebt? Woher stammt sie? Wen hat sie geliebt? Am Ende seiner Reise in die Vergangenheit der geheimnisvollen Toten verliebt auch er sich in sie. Mehr über Christine Brückner erfahren Sie über die Stiftung Brückner-Kühner unter http://www.brueckner-kuehner.de/.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Das Buch
Eine junge Frau läuft – absichtlich oder unabsichtlich? – in ein fahrendes Auto und verunglückt tödlich. Das Ende ihres Lebens wird zum Beginn dieses Buches. Denn der Fahrer des Autos begnügt sich nicht damit, daß seine Unschuld an dem Unfall erwiesen ist. Er verläßt die eingefahrenen Gleise seines wohlgeordneten Lebens und folgt den Spuren der Toten. Immer tiefer dringt er in die Lebensgeheimnisse der jungen Gärtnerin Gabriele Feldcamp ein, die er schließlich zu kennen – ja, auf geheimnisvolle Weise sogar zu lieben glaubt.
»Es ist unmöglich, von diesem Buch nicht mit Achtung zu sprechen«, schrieb Friedrich Sieburg, der Altmeister der Literaturkritik. »Ein starkes Buch, bitter und tröstlich zugleich«, hieß es im Neuen Österreich. Christine Brückners Erstlingswerk, 1954 mit dem ersten Preis eines großen Romanwettbewerbs ausgezeichnet, hat auch nach über vierzig Jahren nichts von seiner Spannung und seinem Zauber verloren.
Die Autorin
Christine Brückner, am 10.12.1921 in einem waldeckischen Pfarrhaus geboren, am 21.12.1996 in Kassel gestorben. Nach Abitur, Kriegseinsatz, Studium, häufigem Berufs- und Ortswechsel wurde sie in Kassel seßhaft. 1954 erhielt sie für ihren ersten Roman einen ersten Preis und war seitdem eine hauptberufliche Schriftstellerin, schrieb Romane, Erzählungen, Kommentare, Essays, Schauspiele, auch Jugend- und Bilderbücher. Von 1980–1984 war sie Vizepräsidentin des deutschen PEN; 1982 wurde sie mit der Goethe-Plakette des Landes Hessen ausgezeichnet, 1990 mit dem Hessischen Verdienstorden, 1991 mit dem Bundesverdienstkreuz 1. Klasse. Christine Brückner war Ehrenbürgerin der Stadt Kassel und stiftete 1984, zusammen mit ihrem Ehemann Otto Heinrich Kühner, den »Kasseler Literaturpreis für grotesken Humor«.
Christine Brückner
Ehe die Spuren verwehen
Roman
Ullstein
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
ISBN 978-3-8437-0385-7
Ullstein TaschenbuchverlagDer Ullstein Taschenbuchverlag ist ein Unternehmen der Econ Ullstein List Verlag GmbH & Co. KG, MünchenUngekürzte Ausgabe28. Auflage März 2002Alle Rechte vorbehalten© 2002 by Econ Ullstein List Verlag GmbH & Co. KG, München© 1978 Ullstein Buchverlage GmbH & Co. KG, BerlinUmschlagkonzept: Lohmüller Werbeagentur GmbH & Co. KG, BerlinUmschlaggestaltung: Thomas Jarzina, KölnTitelabbildung: Zefa, Düsseldorf
E-Book-Konvertierung: CPI books GmbH, Leck
Da ist ein Land der Lebenden
und ein Land der Toten,
und die Brücke zwischen ihnen ist die Liebe –
das einzige Bleibende, der einzige Sinn.
Thornton Wilder: Die Brücke von San Luis Rey
Wenn es stimmt, daß ein großes Glück oder auch ein Unglück sich ankündigt, so habe ich die Zeichen nicht verstanden.
Es war ein Tag wie jeder andere. Oder nein. Er unterschied sich von den vorhergegangenen, obwohl nicht in Dingen, die mit jenem Ereignis im Zusammenhang stehen können.
Die Kinder hatten seit dem 6. August Schulferien. Während ich sonst Ingrid mit dem Auto bis an die Ecke des Schulplatzes mitnehme, schlief sie am 8. noch, und ich hatte sie vor dem Weggehen nicht gesehen. Jochen hatte mit meiner Frau und mir auf dem Balkon Kaffee getrunken. Ich hatte mich von Hanna mit einem Kuß verabschiedet, und sie sagte: »Ach laß, ich bin so eilig heute morgen!« Dann verließ ich mein Haus und holte den Wagen aus der Garage, ging mit dem Staubwedel über Kühler und Verdeck und beschloß, den Wagen am Abend selbst zu waschen. Ingrid würde mir dabei helfen und vielleicht auch Hanna. Später fiel mir dann ein, daß es Freitag war, der Tag, an dem meine Frau in die Sauna geht. Ich habe den Wagen in den letzten Jahren an meiner Tankstelle waschen lassen, aber früher hat es mir Freude gemacht, ihn mit dem Gartenschlauch abzuspritzen und den triefenden Schwamm über das helle Blau gehen zu lassen. Jetzt habe ich einen grünen Borgward, den neuen, aber ich glaube nicht, daß ich ihn noch länger fahren kann.
Es war schon um acht Uhr sehr warm; es wehte ein leichter Wind, der den Straßenstaub vor sich her blies, so daß ich nicht gut sehen konnte und deshalb noch langsamer fuhr als sonst. Ich bin ein vorsichtiger Fahrer. Hanna hält mich für ängstlich, und ich bin überzeugt, daß mein Sohn mich deshalb verachtet.
Seit etwas mehr als drei Jahren bin ich Leiter der Städtischen Sparkasse und gehöre zu den angesehenen Bürgern unserer Stadt. Aber ich bilde mir nichts darauf ein. Ich war an der Reihe, als mein Vorgänger sehr plötzlich starb, und rückte auf seinen Posten. Im Vorjahr haben wir gebaut wie alle großen Banken und Versicherungen. Mein Arbeitszimmer ist geräumig und neuzeitlich eingerichtet, ebenso mein Vorzimmer und vor allem die Schalterräume. Ich bin stolz darauf, obwohl auch das nicht mein Verdienst ist.
Meine Frau kann nicht verstehen, daß mir meine Arbeit Freude macht. Wahrscheinlich ist es für jeden anderen unbegreiflich, daß man Freude haben kann an Zahlen und daß für mich eine Zahl etwas Lebendiges ist, lebendiger oft als Menschen. Darüber spreche ich jedoch mit niemandem. Ich erkläre meine Arbeitsleidenschaft damit, daß es eine erhabene Beschäftigung sei, »den Groschen des kleinen Sparers zu verwalten und zu mehren«, obwohl das viel zu pathetisch klingt. Ich glaube übrigens nicht, daß mein Vater an den Spargroschen des kleinen Mannes gedacht hat, als er mich auf die Provinzialbank als Sparkassenlehrling schickte. – Manchmal, wenn mir ein Kontoauszug vorgelegt wird, sehe ich hinter den Zahlen auf Soll und Haben ein richtiges Menschenleben, ohne alle Beschönigungen. In der Regel habe ich aber dazu keine Zeit. Ich habe sehr viel zu tun, wenn es auch in der Ferienzeit ruhiger ist. Dafür war der erste Kassierer in Urlaub, und der Leiter der Giroabteilung sollte in der darauffolgenden Woche gehen.
Der Parkplatz an der Sparkasse war an jenem Tag sehr sonnig, und darum fuhr ich meinen Wagen ein Stück weiter, wo einige Kastanien etwas Schatten geben. Mir fiel auf, daß die Blätter schon gelb wurden, und ich beschloß, mit Hanna über die Ferien zu reden. – Zuerst gehe ich an jedem Morgen durch die Schalterräume, in denen um kurz nach halb neun noch wenig Verkehr ist. Ich habe meine Angestellten gebeten, mich nicht mit einem lauten »Guten Morgen, Herr Direktor!« zu begrüßen; es ist mir peinlich, wenn Kunden sich nach mir umdrehen. Der zweite Kassierer, der Herrn Müller vertrat, hielt mir im Vorbeigehen, obwohl ich das nicht schätze, eine Karteikarte hin und fragte mit auffälliger Diskretion, ob es möglich sei, das Konto von Herrn X. noch einmal zu überziehen. Ich achte peinlich darauf, daß ich mein Wissen um die privaten Verhältnisse unserer Kunden nicht mit Angelegenheiten der Kasse verquicke, glaubte jedoch hier eine Ausnahme machen zu können, da ich Herrn X. als zuverlässig einschätze. – Anschließend diktierte ich Fräulein Junghans, meiner Sekretärin, einige Briefe und sah die eingegangene Post durch. Zum Frühstück ließ ich mir durch den Botenjungen ein Pfund Pfirsiche mitbringen, da Hanna beschlossen hat, daß ich abnehmen muß, und mir kein zweites Frühstück mitgibt. Sie weiß, daß ich mir Obst mitbringen lasse. Ich habe keine Geheimnisse vor meiner Frau.
Auf die Stunde vor Tisch kann ich mich nicht besinnen. Vermutlich hat mich Herr Wagner aus der Revisionsabteilung wieder mit einer Reihe von Fragen aufgehalten. Ich war jedenfalls ungeduldig, als mich Hanna anrief und fragte, ob ich nicht Jochen an die Bahn bringen könnte. Der Schülertransport ginge nicht, wie sie angenommen habe, erst am Abend, sondern schon um 14.15 Uhr, und ich müsse dem Jungen doch auf Wiedersehn sagen. Am Freitag fahre ich mittags nicht nach Hause, sondern esse zusammen mit ein paar Herren aus der Stadtverwaltung im Ratskeller. Hanna hat ihren Putztag, und sie hält es für richtig, wenn ein Mann zwischendurch einmal im Gasthaus ißt, weil er dann um so eher das häusliche Essen zu schätzen weiß.
Es war mir nicht recht, nach Hause fahren zu müssen; ich liebe es nicht, wenn etwas meinen Tageslauf stört. Aber natürlich mußte ich Jochen auf Wiedersehn sagen und ihm gute Ermahnungen mitgeben. Er fuhr nun schon das dritte Mal an die See mit derselben Gruppe. Im Grunde brauchte ich nur zu wiederholen, was ich in den früheren Jahren gesagt hatte. Er kannte das schon und hörte gehorsam und ungeduldig zu, und manchmal denke ich, daß ich genauso gehorsam und ungeduldig bin wie er.
Ich ließ mich durch Fräulein Junghans im Ratskeller entschuldigen und fuhr nach Hause; den Wagen ließ ich vor der Haustür stehen. Ingrid war zum Schwimmen gegangen und wollte später zum Bahnhof kommen. Meine Frau hatte uns den Tisch wieder auf dem Balkon gedeckt, obwohl ich nicht gerne draußen esse; das Frühstück ausgenommen. Im Freien verlieren die Speisen an Geschmack, man selbst wird durch eine Vielzahl von Gerüchen abgelenkt, außerdem ist es mir unangenehm, wenn uns Frau Degenhardt von gegenüber zusieht, und das tut sie. Im Eßzimmer machte Frau Neugebauer noch sauber. In der Diele standen Jochens Rucksack und seine Schultasche. Zum ersten Mal wollte er sein Segelschiff nicht mitnehmen. Meine Frau war nervös. Ein paarmal sprang sie vom Tisch auf und sah nach, ob das, was ihr eben einfiel, auch wirklich in Jochens Rucksack war. Sie kam zurück und entschuldigte sich, wobei sie immer ein wenig lächelte, aber ich zog sie nicht mit ihrer Vergeßlichkeit und Flüchtigkeit auf, wie ich es sonst wohl tue. Wir aßen Rührei und Tomatensalat und jeder einen Joghurt. Übrigens glaube ich nicht, daß mein Magen Joghurt gut verträgt.
Meine Frau drängte, Jochen hielt uns zurück. Er sagte es zwar nicht, aber ich glaube, daß er gern mit Vaters neuem Wagen protzen und deshalb erst in letzter Minute ankommen wollte, wenn alle schon da waren. Sicherlich hätte ich als Kind auch so gedacht, und bis zu diesem Tage war auch ich immer stolz auf meinen Wagen gewesen. Ich hielt auf dem Weg zur Bahn noch einmal an und kaufte Jochen den Luftring zum Aufblasen, den er sich schon lange wünschte. Ich hebe mir meine Überraschungen gern so lange auf, bis der andere nicht mehr mit der Erfüllung rechnet.
Auf dem Bahnsteig weinte Hanna ein bißchen, Jochen erschien noch einmal am Abteilfenster, und ich sagte ihm, daß er nicht erhitzt ins Wasser gehen solle und nicht mehr als zweimal täglich schwimmen, daß er ordentlich essen und dreimal in der Woche schreiben müsse. Ich lachte ihm kameradschaftlich zu, als ich ihm die Hand schüttelte, und war traurig, daß ich noch nie mit meinem Jungen zusammen an der See war. Hanna fährt lieber in die Berge, Seeluft macht sie nervös. Es ist nicht jedermanns Sache, stundenlang am Strand zu liegen und den Sand durch die Finger rinnen zu lassen. – Meine Frau traf die Mutter von Jochens Freund, und ich fuhr sie nach Hause. Meine Frau versuchte zwar, mich zu entschuldigen, weil sie weiß, wie ungern ich den Chauffeur ihrer Bekannten spiele, aber es ließ sich nicht vermeiden, da Herr Sander ebenfalls im Stadtrat sitzt.
Es mochte gegen drei Uhr sein, als ich wieder in meinem Arbeitszimmer saß. Obwohl der Ventilator seit Stunden lief, war es sehr heiß. Mein Zimmer liegt nach Westen. Morgensonne würde mich noch mehr bei der Arbeit stören. Ich ging mit Fräulein Wellm ein paar Wertpapiere durch. Sie machte einen abgespannten Eindruck, deshalb beurlaubte ich sie für den nächsten Tag. Sie schien dankbar dafür zu sein. Ich müßte mich mehr um das Privatleben meiner Angestellten kümmern. Sie schien Sorgen zu haben. Aber ich fühle mich immer gehemmt, da ich fürchten muß, daß ich die wirkliche Leistung, die allein entscheiden darf, beeinflußt sähe und meine Objektivität verlieren würde.
Um 17.30 Uhr ist Dienstschluß. Ich beschäftigte mich noch etwa eine halbe Stunde mit dem Fall Siebert, einer schwierigen Beleihungssache, dann ging ich durch den hinteren Ausgang, schloß ab und reichte den Schlüssel in die Pförtnerwohnung. Es war sehr sonnig, und ich bedauerte, kein Kabriolett gekauft zu haben; trotz der Klimaanlage ist im Sommer die Luft im Auto stickig. Ich wäre gerne zu Fuß gegangen, aber ich konnte den Wagen nicht stehenlassen, und ihn erst am Abend holen mochte ich auch nicht. Als ich die Hauptstraße kreuzte, beschloß ich, abzubiegen und zum Fluß zu fahren. Ich wollte noch eine Stunde den Anglern zusehen und vielleicht im »Wiesengrund« ein Bier trinken. Hanna würde nicht vor acht Uhr zu Hause sein, und Ingrid war gewiß bei ihrer Freundin.
An der Georgstraße hielt ich an und kaufte bei meinem Tabakhändler ein Kistchen Zigarillos. Der Arzt hat mir geraten, die Zigarre durch einen leichten Zigarillo zu ersetzen. Mein Tabakhändler wollte im September nach Spanien fahren und deshalb den Kurs wissen. Ich bin froh, kein Arzt und kein Jurist zu sein und Sprechstunden auf der Straße abhalten zu müssen. Auch ich werde oft genug privat mit Bankangelegenheiten belästigt. – Ich steckte mir gleich im Laden einen Zigarillo an. Wir bestätigten uns gegenseitig, daß es ein sehr heißer August sei, nachdem es im Juli sehr kühl und naß war, und dann stieg ich wieder in den Wagen.
Ich habe lange darüber nachgedacht, warum ich gerade heute zum Fluß fahren mußte, warum ich ausgerechnet diesmal nicht gleich durch die Albrechtstraße nach Hause gefahren bin, warum ich Zigarillos kaufte, obwohl ich noch zwei Zigarren im Etui hatte. Ich rauche abends nie mehr als zwei Zigarren.
Ich war nach rechts in die Uferstraße eingebogen, und dort ist es passiert. – Ich fuhr höchstens dreißig, wahrscheinlich sogar weniger, die Polizei hat die Bremsspuren geprüft.
Ich weiß eigentlich nichts.
Ich muß aber etwas bemerkt haben, sonst hätte ich ja nicht gebremst. Das erste, was ich hörte, war ein Schrei, aber der kann nicht von ihr gekommen sein.
Ich hatte noch nie einen Unfall gehabt. Seit fünf Jahren fahre ich ein eigenes Auto, und im Krieg habe ich vorübergehend einen Lastzug gefahren. Einmal hat mich ein Auto von hinten gerammt, aber da traf mich keinerlei Schuld.
Als ich den Schrei hörte, hielt ich an. Ich saß mehrere Sekunden wie gelähmt, als ob mich eine Hand festhielte. Dann stieg ich schwerfällig aus. Fünf, vielleicht auch zehn Schritte hinter meinem Auto lag rechts, nicht weit vom Bordstein, eine Frau. Ich konnte sie höchstens angestoßen haben, bestimmt hatte ich sie nicht überfahren. Sie würde gleich aufstehen. Die Straße war fast leer. Eine ältere Frau stand schon daneben, sie mußte es gewesen sein, die geschrien hatte, dann kamen noch zwei Männer und mehrere Kinder dazu.
Die Frau war jung. Sie hatte den Arm voll Blumen, die über sie ausgestreut lagen. Die Augen waren weit geöffnet. Sie mußte ohnmächtig sein. Ich weiß nicht, ob man in einer Ohnmacht die Augen schließt. Einer der Männer lief fort, um die Polizei zu benachrichtigen und einen Arzt zu holen. Ich zog mein Jackett aus, faltete es zusammen und schob es ihr unter den Kopf, weil ich einmal gehört hatte, daß man Ohnmächtigen den Kopf hoch legen soll. Ich lief zurück zum Wagen und holte aus der Tasche ein Fläschchen Lavendel, das Hanna dort verwahrt, und hielt es der Frau unter die Nase. Inzwischen waren noch mehr Leute gekommen und redeten auf mich ein, was man tun müßte. Ich versuchte, alle von ihr fernzuhalten. Die Frau, die geschrien hatte, war die einzige, die den Unfall gesehen hatte. Sie erzählte es immer wieder: »Die ist ja einfach drauflos, nicht rechts und nicht links hat sie geguckt, und gesungen hat sie auch noch. Der Autofahrer kann nichts dafür, der fuhr langsam, die ist ganz plötzlich umgebogen und vom Bürgersteig runter und –«
Das Unfallauto hupte, fast gleichzeitig kam der Arzt.
Sie war tot. Der Arzt suchte den Puls, horchte, schob das untere Augenlid herab, sah zu mir hoch und zog die Lider über die toten Augen.
Es war ganz still, als sie die Frau auf die Bahre hoben und mit ihr fortfuhren. Ich selbst habe die Blumen aufgesammelt und neben sie gelegt. Ein Polizist ist mit in mein Auto gestiegen, zwei andere sind am Unfallort geblieben. Ich habe eine Reihe Fragen beantwortet. Die Beamten kannten mich. Man weiß, daß ich ein vorsichtiger Fahrer bin. Ich bin noch einmal auf der Wache vernommen worden, man hat auch eine Blutprobe gemacht.
Man sagte, ich sei schuldlos.
Ich habe den Wagen an der Polizei stehenlassen und bin zu Fuß nach Hause gegangen. Man schien sich darüber zu verwundern.
Es blieb mir noch eine Stunde, in der ich allein sein konnte, dann würde Hanna kommen. Ich schloß die Korridortür auf. Es roch nach Bohnerwachs. Ich ging in die Wohnstube und setzte mich in meinen Sessel und dachte nach.
Ich hatte einen Menschen getötet. Nicht absichtlich, nicht einmal fahrlässig, aber getötet. Das machte keinen Unterschied, tot blieb tot. Es half mir auch nichts, zu wissen, daß laut Statistik vierzig Menschen täglich in unserem Land durch Verkehrsunfälle ums Leben kommen. Diesmal war ich dran. Ganz allein. Ich hatte auch im Krieg getötet, aber das war etwas anderes. Ich hatte niemals zuvor einen Menschen gesehen, den ich getötet hatte. Eine Frau.
Sie hatte glücklich ausgesehen. Nicht einmal ein Erschrecken war bis in ihr Gesicht vorgedrungen, so rasch war der Tod, mein Tod, gekommen. Sie hatte am Straßenrand gelegen, wie eine aufgebahrte Tote mit Blumen geschmückt, unverletzt. Jetzt weiß ich auch, daß ich sofort wußte, sie war tot; das muß an den Blumen gelegen haben. Ich versuchte mir vorzustellen, was das für Blumen gewesen sein konnten. Meine Eltern haben einen großen Garten gehabt, ich kenne mich mit Blumen aus. Rittersporn, Tausendgüldenkraut, Phlox und Silberdisteln vermutlich.
Man hat in ihrer Handtasche einen Reisepaß gefunden. Sie hieß Gabriele Feldcamp.
Ich hatte mir eine Zigarre angesteckt. Aber dann mußte ich aufstehen, zum Telefon gehen und, ohne es mir überlegt zu haben, anrufen. Beim Unfallkommando. Daß ich sofort hinkommen würde und die Angelegenheit soweit wie möglich selbst in die Hand nehmen.
Ich schrieb auf den Block, der immer auf dem Tisch in der Diele liegt, ein paar Worte für meine Frau, daß ich noch etwas zu tun hätte und spät zurückkommen würde. Ich nahm den Omnibus und fuhr bis zum Marktplatz. Wieder war ich überrascht, daß die Beamten auf der Wache mich nicht wie einen Mörder behandelten, sondern wie den Direktor der Städtischen Sparkasse. – Die Frau lag in einem Nebenraum. Ein Polizist hatte die Blumen in einen Wassereimer gestellt. Ich bin nicht nach nebenan gegangen.
Inzwischen hatte man auf dem Einwohnermeldeamt festgestellt, wo die Frau wohnte. Im Geiger 82. Angehörige des gleichen Namens gab es nicht. Handtasche und Einkaufsnetz lagen auf dem Schreibtisch des diensttuenden Beamten. Der Arzt hatte den Totenschein ausgestellt, der auf »Gehirnschlag infolge eines Unfalls« lautete. Der Schein lag neben dem Inhalt der Handtasche: Eine Puderdose, ein Taschentuch mit ihren Initialen, der Reisepaß, der nicht in unserer Stadt ausgestellt war, ein Notizbuch, ein Füllhalter, das war schon alles. Eine sehr ordentliche Handtasche. Ich dachte, daß in der Tasche meiner Frau immer ein Durcheinander von Zetteln und alten Fahrscheinen, Briefschaften, Lippenstift, Streichhölzern ist, und dachte, wenn sie einmal überfahren würde … Was für ein entsetzlicher Gedanke: Meine eigene Frau! Tot in der Wachstube des Polizeireviers …
Der Beamte war gerade dabei, den Inhalt des Netzes auszupacken: vier Paprikaschoten, eine Tüte Pfirsiche, ein Bündel Küchenkräuter, Gehacktes in Cellophanpapier, eine Schachtel Kekse, eine Packung Weinbrandkirschen, eine Dose Ananas, eine Flasche Asbach Uralt.
Ich fragte, ob man schon etwas unternommen habe, um die Angehörigen festzustellen. Das hatte man nicht, da sie über das Einwohnermeldeamt nicht zu ermitteln waren. Man pflegte abzuwarten, bis sich jemand auf Grund der Zeitungsnotiz meldete. Ich erkundigte mich, was man mit der Frau nun tun würde.
»Der Leiche?« fragte der Beamte.
Ich zuckte zusammen.
»Die kommt morgen in die Leichenhalle, heute nacht bleibt sie hier stehen, wenn sich niemand meldet.«
Ich sagte: »Solange kein anderer da ist, betrachten Sie mich als den nächsten Angehörigen. Darf ich das Notizbuch an mich nehmen?« Das lehnte der Beamte ab, weil er damit seine Befugnisse überschreiten würde. Ich notierte mir die Adresse und fragte den Beamten, wo die Straße liege, da ich sie nie gehört hatte.
Ich mußte durch dieselbe Straße gehen, in der es passiert ist. Es war ein Weg von einer halben Stunde, aber ich wollte nicht fahren, weil ich fürchtete, Bekannten im Omnibus zu begegnen. Gewiß wußten es schon die meisten. Es war fast dunkel, als ich vor dem Haus Nummer 82 stand. Ich fand den Namen Feldcamp nicht und klingelte im Erdgeschoß.
»Das Fräulein wohnt im Gartenhaus, da müssen Sie um das Haus herumgehen.«
Ich ging um das Haus herum. Ich fand einen Klingelzug. Eine rothaarige Frau öffnete. »Ja. Fräulein Feldcamp wohnt hier. Aber ich habe sie heute abend noch nicht gehört, wird wohl bald kommen.«
Ich habe es ihr gesagt. Sie schienen sich nicht nahegestanden zu haben. Sie hat nicht lange dort gewohnt, das Haus ist noch neu. Nein, von Angehörigen wußte sie nichts. Ob ich hinaufgehen wollte, einen Schlüssel hätte sie. In eine fremde Wohnung? Ich sagte danke nein und verabschiedete mich.
Draußen blieb ich noch einen Augenblick stehen. Hier hatte sie also gewohnt, bis heute. Ich sah Blumen in den Kästen.
Dann ging ich nach Hause. Unterwegs rief ich noch einmal bei der Polizei an, daß ich am nächsten Morgen um acht Uhr wiederkommen würde und daß man mich verständigen sollte, wenn man etwas Neues über die Tote erführe.
Hanna stand unter der Haustür. Sie wußte es schon. Woher, weiß ich nicht. Sie sah mir an, daß ich sehr verstört war. Das war mir nicht recht. Ich wollte mich zusammennehmen. Ich wollte auch nicht mit ihr darüber sprechen. Sie fing immer wieder davon an. Sie sagte: »Du hast doch keine Schuld, Rudolf! Nimm es dir doch nicht so zu Herzen. Heute muß jeder auf sich selbst aufpassen! Du fährst doch immer so vorsichtig.« – Sie machte mir Butterbrote. Ingrid lag schon im Bett. Sie kam noch einmal in die Küche und stand mit neugierigen Augen an der Tür. Ich schickte sie in barschem Ton zu Bett. Gleich darauf tat sie mir leid. Ich ging in ihr Zimmer und sagte ihr gute Nacht. Sie schlang mir die Arme um den Hals und schluchzte. »Bist du nun ein Mörder, Vati?« – Ich strich ihr über das Haar und ging in unser Schlafzimmer.
Ich vermute, daß ich eingeschlafen bin, weil ich fürchtete, daß meine Frau mit mir wachen und mich die ganze Nacht trösten wollte.
Ich bemühte mich, mich genauso zu verhalten wie an allen anderen Tagen, darum wartete ich, bis der Wecker klingelte, und stand dann erst auf. Im Badezimmer sang ich beim Waschen, obwohl mir der Hals wie zugeschnürt war und ich mich gewaltsam an die Lieder erinnern mußte, die ich sonst zu singen pflege. Als ich in die Küche kam, brühte meine Frau den Tee auf und sah mich aus unsicheren Augen an. Ich sagte mit munterer Stimme: »Guten Morgen, Hanna! Wird wieder ein heißer Tag werden, na, für den Jungen freut es mich«, und rieb mir die Hände. Hanna ging in das Badezimmer, um sich zu kämmen, während der Zeit trug ich die Teekanne und die Brötchen auf den Balkon und griff nach der Zeitung. Als Hanna zurückkam, las ich gerade unter den Meldungen aus unserer Stadt:
»Wer kennt Gabriele Feldcamp?
In den Abendstunden des gestrigen Tages ereignete sich in der Uferstraße ein tragischer Verkehrsunfall. Ein Personenwagen streifte eine Fußgängerin, die unachtsam die Fahrbahn kreuzte. Der Tod trat sofort durch Hirnschlag ein. Den Fahrer des Autos trifft keine Schuld. Angehörige der Toten mögen sich umgehend bei der Unfallstelle der hiesigen Polizei, Am Markt 21, melden.«
Ich faltete die Zeitung zusammen, goß mir Tee ein, trank ihn hastig und stand auf, bevor Hanna sich gesetzt hatte. Sie schien etwas sagen zu wollen. Sie hatte sich gewiß auf die Frühstücksstunde gefreut. Wenn die Kinder nicht zur Schule müssen, trinken wir allein und in Ruhe unseren Tee, und ich fahre eine Viertelstunde später ab. Sie konnte gewiß nichts dafür, aber ihre ratlosen Augen machten alles nur noch schlimmer. Ich sagte:
»Entschuldige, aber der Wagen ist noch auf der Polizei, ich muß zu Fuß gehen, es wird zu spät.« Ich küßte sie diesmal nicht beim Weggehen, und obwohl ich wußte, daß sie mir vom Balkon aus nachsah, drehte ich mich nicht um. Ich mußte jetzt allein sein. In einer Ehe ist man nie allein.
Der Bäcker, bei dem meine Frau immer kauft, stand unter der Ladentür und grüßte mich in einer unangenehm teilnahmsvollen Art. An den Bordsteinen standen die übervollen Mülleimer, und von vorn kam der Müllwagen, der sie entleerte, und verbreitete einen widerlichen, kotigen Gestank. Am schlimmsten aber war das Geräusch, mit dem die Männer die Tonnen wieder und wieder in die Öffnungen des Wagens stießen, um den Unrat, der sich festgeklemmt hatte, loszurütteln. Dieses stinkende Geklapper bereitete mir ein derartiges Unbehagen, daß ich in eine Seitenstraße einbog und einen Umweg von fast zehn Minuten hatte.
Auf der Wache traf ich einen Jungen von etwa siebzehn Jahren an, blond, lang aufgeschossen, sehr braungebrannt, mit verzweifelten Augen in dem verweinten Gesicht. Ich wußte gleich, daß es mich anging. Der Beamte wies auf mich, da drehte er sich mir zu und starrte mich an; es sollte Haß sein, war aber nur unbeherrschte Trauer, und dann weinte er wieder.
Später hat er ausgesagt, daß sie in der Gärtnerei gearbeitet hat, wo er als Eleve ist. Sein Großvater ist der Gartenmeister. Wolfgang heißt er, Wolfgang Greve. Die Gärtnerei liegt in Lindenthal, ich hatte den Namen schon gehört. Bekannte meiner Frau hatten sich ihren Garten von der Firma anlegen lassen. Vielleicht hatte sie dabei mitgearbeitet? –
Man hatte sie bereits in die Leichenhalle auf den Friedhof gebracht. Sie sollte dort aufgebahrt werden. Ich hatte veranlaßt, daß die Beerdigung nicht vor Dienstag stattfände, bis dahin würden sich die Angehörigen gemeldet oder ich sie aufgefunden haben.
Der Leiter der Unfallstelle war ein ruhiger, verständiger Mann. Ich hatte ihm vorgeschlagen, daß ich für die Beerdigung aufkommen und den Nachlaß verwalten würde, solange niemand anderes dafür da war, weil ich mich verantwortlich fühlte. Ich war überrascht, daß das keinerlei juristische Schwierigkeiten machte. Geschäftsführung ohne Auftrag nennt man das. G. o. A. – Er ließ mir die Handtasche und das Netz aushändigen und beschaffte mir einen Schein, mit dem ich Zutritt zu ihrer Wohnung erhalten würde.
Wenn ich mich nicht lächerlich machen wollte, mußte ich den Wagen von der Polizei wegfahren, man würde dort sonst glauben, daß ich mich schuldig fühlte. Das tat ich auch. Ich fing an, an meiner Zurechnungsfähigkeit zu zweifeln. Wieso wußte ich nichts von den Minuten, in denen ich an der Uferstraße entlanggefahren war? Hatte mich der Schrei nicht aufgeweckt? Hatte ich denn geschlafen oder geträumt? War ich nicht schon am Nachmittag sehr müde? Hätte ich die Frau nicht bemerken müssen? Ich sah mich sonst doch um, wenn eine solche Frau über die Straße ging. Die Blumen hätten mir zumindest auffallen müssen.
Am Sonnabend haben wir keine Schalterstunden, aber es wird gearbeitet. Ich ging durch den hinteren Eingang. Die Handtasche hatte ich in meine Aktentasche getan, das Netz ließ ich im Wagen liegen.
Fräulein Junghans legte mir die Post hin. Sie druckste, sie wollte wohl sagen, wie leid ihr das tue. Wir stehen gut miteinander, hie und da fällt auch einmal ein privates Wort.
»Es ist gut«, sagte ich, »ich weiß schon, lassen Sie mich jetzt allein, ich möchte eine Stunde nicht gestört werden.«
In ihrem Notizbuch standen ein paar Adressen und auf der vorletzten Seite vier Telefonnummern. Bemerkungen standen kaum darin. Manchmal unter einem Datum eine Uhrzeit, die keinen Aufschluß gab, dreimal las ich Namen, vermutlich handelte es sich um Geburtstage, Klaus, Marianne, Karin. Unter dem 8. August stand: »Felix kommt zurück!« – Das war gestern.
Ich blätterte weiter zu den Telefonnummern. Es mußten Nummern der Stadt sein, ein Ort war nicht angegeben. Ich drückte auf den Summer und bat Fräulein Junghans, den Apparat umzustellen. Ich wählte die erste Nummer 53 71. Es meldeten sich die Städtischen Krankenanstalten. Ich nannte meinen Namen:
»Ist Ihnen ein Fräulein Gabriele Feldcamp bekannt?«
»Seit wann soll sie bei uns liegen? – Sie liegt nicht bei uns? Handelt es sich um eine Neuaufnahme? – Wie? Sie ist schon tot –?«
Ich hängte ein. So ging es nicht. Mir stand der Schweiß auf der Stirn. Vielleicht war sie krank gewesen und hatte sich gelegentlich untersuchen lassen? Oder kannte sie einen der Ärzte? Oder eine der Schwestern? Vielleicht auch nur einen Kranken, der vor langer Zeit im Krankenhaus gelegen hatte? – Das führte zu nichts. Ich wählte die Nummer 46 12. Es dauerte diesmal länger.
»Städtische Sparkasse, Wagner.«
Peinlich! Ich hatte unsere Nummer nicht erkannt! Was sollte ich sagen? Ich murmelte »falsch verbunden«, ärgerte mich, legte den Hörer auf und wischte mir mit dem Taschentuch die Stirn ab. Es war entsetzlich drückend. Ich rief Fräulein Junghans und fragte, warum der Ventilator nicht in Betrieb sei, sie sagte: »Sofort, Herr Direktor!«, gleich darauf summte er. Natürlich spürte man keinerlei Abkühlung.
Wieso stand in dem Notizbuch unsere Nummer? Wieso hatte da eine Verbindung bestanden, von der ich nichts wußte? Hatte sie ein Konto bei uns gehabt? Natürlich kannte ich nicht alle Namen unserer Kunden. Vielleicht war sie in jeder Woche in der Kasse gewesen? Hatte ich sie etwa schon gesehen und nur nicht beachtet? Ich zögerte, ob ich mir ihre Kontokarte suchen lassen sollte. Aber dann ließ ich es, sicher sprachen sie draußen sowieso darüber und hatten sich schon verständigt, daß der Chef gereizt sei.
Ich wählte die dritte Nummer. Diesmal hielt ich den Hörer so, daß ich ihn sofort wieder auflegen konnte. Es meldete sich eine Frauenstimme. Ich glaube, daß sie »Seiffert« sagte. Ich nannte meinen Namen und fragte sie, ob sie Fräulein Feldcamp gekannt habe.
»Aber ja! Sie meinen Gabriele Feldcamp? Sie ist meine Freundin. Warum fragen Sie? – Wie? Tot? –«
Sie schrie schrill auf. »Überfahren? O Gott, wer sind Sie denn?«
Ich sagte, daß ich das Auto gefahren hätte. Sie schrie wieder ganz hoch: »Iiiih«, dann war es still. Ich dachte schon, sie hätte eingehängt, aber es tutete nicht. Nach einer Weile fragte ich mit möglichst gelassener Stimme, ob sie etwas über die Angehörigen wisse, bisher hätte sich niemand gemeldet.
»Angehörige?« Sie schien sich zu besinnen. »Sie hatte einen Bruder, der ist gefallen. Er war verheiratet, ich glaube, daß er Kinder hatte. Wo? Oh, das weiß ich nicht. Sie sprach nie davon. Wir kannten uns noch nicht lange. Ein Onkel von ihr lebt in – Brasilien, oder irgendwo in Südamerika, das muß ein Bruder ihrer Mutter sein. Sie kriegte Pakete von ihm, vielleicht können Sie seine Adresse am Zollamt erfahren. Sie hat auch einmal von einem Vetter gesprochen. Aber wie der heißt? – Ob sie Freunde hatte in der Stadt? Ich wüßte nicht. Sie wohnte noch nicht lange hier. Haben Sie einmal in der Gärtnerei angerufen?«
Ich habe ihr gesagt, daß die Beerdigung am Dienstag sein würde. Sie versprach zu kommen.
Auf der vierten Nummer meldete sich niemand. Ich versuchte es in Abständen von einer Viertelstunde dreimal. Ich hätte die Auskunft anrufen können, wer die Nummer hat. Aber ich wollte es lieber am nächsten Tag noch einmal versuchen. – Später habe ich es dann vergessen.
Fräulein Junghans wollte wissen, ob ich noch Post mitzugeben hätte, der Bote ginge jetzt. Ich schob hastig die Notizen, die ich mir gemacht hatte, unter den Briefordner. Sie entschuldigte sich, und ich sagte, daß ich sie nicht mehr brauche. Den Brief an den Verwalter des Hauses, in dem sie bis zum Vorjahr gewohnt hatte, wollte ich nachher selbst zum Kasten bringen. Eilboten. Vielleicht erhielt ich vor der Beerdigung eine Nachricht von dort. Anschließend habe ich meinen Autohändler angerufen und gebeten, daß er meinen Wagen abholen und nachsehen läßt. Er sollte ihn sofort holen lassen. »Eilig? Nein, vorläufig brauche ich den Wagen nicht.« Er fragte, was nicht in Ordnung sei. Ich sagte, »die Bremsen«, dann fiel mir ein, daß man daraus schließen könnte, meine Bremsen hätten bei dem Unfall versagt. Ich verbesserte mich hastig, daß es viel eher die Kupplung sein könnte, und war verärgert, weil mir schien, daß sein »selbstverständlich, Herr Direktor!« nachsichtig und verwundert klang.
Ich war nervös. Ich mußte mich zusammennehmen. Ich griff nach dem Fall Siebert, mit dem ich am Vortag nicht fertig geworden war, und machte mir ein paar Auszüge. Es klopfte. Herr Stickels vom Giro bat, sich verabschieden zu dürfen. Ich ärgerte mich schon wieder. Warum entschuldigte er sich denn dreimal? Ich wünsche, daß sich meine Herren verabschieden, bevor sie in Urlaub gehen, sonst nichts.
Ich zwang mich zu einigen interessierten Fragen. Wohin es gehen sollte, ob die Kinder mitkämen, wie alt der Älteste jetzt sei. »In der Abteilung alles in Ordnung? Fräulein Claudius wird es schaffen? Also gut! Erholen Sie sich, kommen Sie mit frischen Kräften zurück!«
Ich brachte ihn zur Tür. Was über das übliche Maß an Verbindlichkeit hinausging.
Um halb eins rief meine Frau an. Ob ich pünktlich zu Tisch käme? Ich fragte gereizt: »Warum denn nicht? Ingrid will ins Strandbad? Seit wann richten sich die Tischzeiten nach den Kindern?«
Noch einmal nahm ich mir den Fall Siebert vor. Dann klopfte es, und Fräulein Junghans sah zur Tür herein. War ich denn ein Tyrann? Warum blieb sie eingeschüchtert an der Tür stehen? »Was gibt’s denn schon wieder! Ich habe zu arbeiten!«
»Der Monteur ist da, der den Wagen abholen will. Würden Sie mir bitte den Autoschlüssel geben?«
Ich machte ihn vom Schlüsselbund los und brach mir dabei den Daumennagel ab.
Nach drei Minuten klopfte es wieder. Fräulein Junghans stand da und hatte das Netz in der Hand: »Soll ich das Netz …?«
»Geben Sie’s her.« Sie legte es auf die Schreibtischkante und sagte noch: »Auf Wiedersehn, Herr Direktor, ich kann wohl gehen?« Ich antwortete gereizt: »Bitte, bitte!« Dann besann ich mich und lächelte verkrampft: »Entschuldigen Sie, ich bin ein wenig abgespannt. Schönen Sonntag!«
»Danke schön, Herr Direktor, gleichfalls!«
Draußen war es jetzt still. Sie geht immer als letzte. Ich bin sehr zufrieden mit ihr. Sie ist entgegenkommend und diskret, fleißig und begreift schnell. Vor allem erwartet sie keine Zudringlichkeiten von mir wie ihre Vorgängerin.
Auf meinem Schreibtisch lag das Netz. Aus der Pfirsichtüte tropfte es, das Bündel Küchenkräuter – übrigens waren es Vogelmieren, die ich bisher nicht kannte – hing welk durch die Maschen, und aus dem Cellophanpapier stieg ein scharfer, übler Geruch. Ich legte das Netz auf die Fensterbank. Es war mir unangenehm, es anzufassen.
Ich ging in den Schalterraum, der halbdunkel war, weil übers Wochenende die Jalousien heruntergelassen werden; nur durch die Glastür am Eingang fiel ein breiter Streifen Sonnenlicht. Wir haben zwei Karteien, die eine ist namentlich angelegt, die andere nach Kontonummern. Ich fand ihre Karte schnell. Feldcamp, Gabriele, Gärtnerin. Die Adresse. Sie hat die Kontonummer 5252, sie muß eine frei gewordene Nummer bekommen haben, wir haben wesentlich mehr Kunden, als es der Nummer nach scheinen könnte. Sie hatte nur ein laufendes Konto. Spareinlagen hatte sie nicht bei uns. Ihr Gehalt betrug 346,12 DM netto, es wurde an jedem 15. zu uns überwiesen. Sie hatte einen ständigen Überweisungsauftrag über 12,50 DM für Konto 3618 und einen Auftrag über 150,- DM auf ein Postscheckkonto laufen. Es standen im Augenblick 75,08 DM. 3618 war das Konto einer privaten Krankenkasse. Ich machte mir eine Notiz, ich mußte dort anrufen, vielleicht hatte sie eine Sterbeversicherung abgeschlossen. Den Inhaber des anderen Kontos konnte ich so schnell nicht feststellen. Eine sehr hohe Summe, 150,- DM, bei einem so niedrigen Einkommen. Ich hatte angenommen, Gärtnerinnen verdienten mehr. So jung war sie nicht mehr. Aber ich hatte noch nie mit einer Gärtnerin zu tun gehabt.
Ich ordnete die Kontokarte wieder ein und ging zurück in mein Zimmer. Es war jetzt halb zwei. Dann bin ich sonst schon zu Hause. Ich steckte die Handtasche wieder in meine Aktentasche. Was sollte ich mit dem Netz tun? Wenn ich es mit nach Hause nahm, mußte ich Hanna alles erklären und am nächsten Mittag diese Paprikaschoten essen. Das war mir unmöglich. Ich konnte das Netz aber auch nicht in den Papierkorb werfen. Am Montag würde es wieder auf meinem Schreibtisch liegen. Außerdem kann man Lebensmittel nicht fortwerfen.
Das Telefon klingelte. Ich hob den Hörer nicht ab. Es war Hanna. Wenn sie keinen Anschluß bekam, würde sie denken, daß ich schon unterwegs sei. Ich nahm den Hut, die Aktentasche und das Netz und ging. Als ich den Schlüssel beim Pförtner abgab, sah ich seine Frau, die das Treppenhaus wischte.
»Ach«, sagte ich, »Frau Regensburg. Ich habe da ein Netz mit ein paar Eßwaren. Sehen Sie mal nach, ob Sie Verwendung dafür haben. Und schönen Sonntag.«
»Aber, Herr Direktor!« Ich winkte ab und ging, ohne mich weiter um sie zu kümmern. Ich nahm den Omnibus, um nicht noch später nach Hause zu kommen.
Meine Frau winkte mir vom Balkon aus zu. Ich erzählte ihr, bevor sie noch fragen konnte, daß etwas an der Kupplung nicht gestimmt hätte und der Wagen in der Werkstatt sei. Sie war enttäuscht. Sie hatte gedacht, daß wir am Sonntag ein Stück hinausführen. Ich fragte zerstreut: »Am Sonntag? Wieso? Ach ja, morgen ist Sonntag.« Ob ich etwas anderes vorhätte? »Nein, oder doch. Ich weiß noch nicht.«
Hanna ging in die Küche, um das Essen anzurichten. Ingrid war im Badezimmer und packte die Badesachen zusammen. Als ich die Tür aufmachte, um mir die Hände zu waschen, hängte sie sich gleich an meinen Hals: »Vati? Vati, weißt du schon, wer es war? Alle sagen, sie wäre so schön gewesen! War sie das? Bist du nun sehr traurig, Vati?«
»Ja, ich bin sehr traurig, mein Kleines.« Merkwürdig, daß ich es dem Kind gegenüber eingestehen konnte: ich war sehr traurig. Ich wußte nicht, ob ich jemals im Leben so traurig gewesen war. Sie drängte sich an mich, und ihre Nähe tat mir gut. Wir setzten uns an den Tisch. Meine Frau kam mit dem Tablett; ich steckte mir die Serviette in den Westenausschnitt, da erst sah ich auf. Mein Blick fiel auf die Fleischplatte: gefüllte Paprikaschoten mit geschmorten Tomaten.
Mir wurde heiß, ich merkte, wie sich auf meiner Stirn Schweiß ansammelte: »Entschuldigt«, sagte ich und stand auf, »ich kann nichts essen, mir ist nicht gut.«
Ich verließ das Zimmer und trank im Badezimmer einen Schluck Wasser. Hanna kam mir nach. Sie sah bestürzt aus: »Aber Rudolf! Was ist denn mit dir? Bist du krank?«
Ich winkte ab.
»Nimm eine von meinen Tabletten, leg dich aufs Bett. Ich wollte dir eine Freude machen, ich weiß doch, daß du Paprika so gerne ißt. Ich hebe dir welche auf. Heute abend ist dir gewiß schon besser. Das macht die Hitze. Du mußt bald Ferien machen. Wir müssen einmal überlegen, wohin wir fahren.«
Sie sprach sehr schnell und strich dabei fortwährend mit der Hand über meinen Jackenärmel. Ich bemühte mich, ihren Augen nicht zu begegnen. Ich wußte selbst nicht, warum ich ihre Nähe so schwer ertragen konnte.
Sie folgte mir, als ich ins Schlafzimmer ging und mich aufs Bett warf. Sie redete noch immer mit rascher, begütigender Stimme auf mich ein. Dann ging sie. Aber nur, um mit einer Tasse kaltem Tee wiederzukommen. Sie setzte sich auf den Bettrand. Ich fuhr hoch.
»Ich bin nicht krank, und ich bin auch nicht schwachsinnig! Ist es denn nicht möglich, daß ihr mich fünf Minuten in Ruhe laßt? Das kann ich doch wohl verlangen!«
Ich warf mich auf die Seite, aber ich sah doch noch, daß sie nasse Augen hatte, als sie aufstand. Daß Frauen immer weinen müssen.
Ich zog Rock und Weste aus, knöpfte den Kragen auf und zog die Gardinen vor. Meine Frau sorgt immer dafür, daß die Wohnung kühl bleibt und keine Fliegen da sind. Ich trank von dem Tee, den sie aus dem Kühlschrank geholt hatte, und es tat mir leid, daß ich nicht einmal danke gesagt hatte. Sicher saßen die beiden jetzt drüben und würgten schweigend an ihrem Essen. Die Kleine war schon genauso empfindlich wie meine Frau. –
Jetzt war sie bald vierundzwanzig Stunden tot. Ich war noch nie in einer Leichenhalle. Als mein Vater gestorben ist, hat meine Mutter alles erledigt. Wir haben ihn nur noch einmal gesehen; er lag im Wohnzimmer, und der Mann von der Beerdigungsgesellschaft war schon da, der den Sarg zunageln sollte. – Ich würde eine Beerdigungsgesellschaft verständigen müssen. Und bei der Krankenkasse anrufen, besser noch, gleich den Totenschein hinschicken. Ich wußte gar nicht, was man in einem Sterbefall zu tun hat. Man müßte sich darüber unterrichten, vorher. Jetzt war das sehr schwierig. Ich glaubte mich zu entsinnen, daß auf meinem Weg zur Kasse ein solches Institut liegt. »Heimkehr« mußte es heißen oder »Heimweh«. Aber vermutlich »Heimkehr«. Dummes Wort. Ob sie katholisch war? Die meisten waren hier katholisch, aber sie war ja nicht von hier. Im Reisepaß steht das nicht. Man müßte am Kirchensteueramt anrufen. Aber es war Samstag, dann war dort keiner. Bis Montag warten? Dienstag sollte die Beerdigung sein. Wie lange brauchte ein Pfarrer für eine Predigt? Ich mußte einen Platz auf dem Friedhof kaufen. Wieso ich? – Aber wer sonst? –
Was sollte ich sagen, in welcher Eigenschaft ich käme? Die meisten würden mich kennen. Aber wer war ich für sie? Wieso gab es kein Wort dafür? Wenn man jemanden tötet, ist man ein Töter. Töten, tot, Tod –. Bei Mord war das ganz klar. Wer mordet, der ist ein Mörder. Die Sprache machte keinen Unterschied. Wenn man jemanden tötet, war man ein Mörder. – Ich hörte ganz deutlich Ingrids ängstliche, kleine Stimme: Bist du nun ein Mörder, Vati –?
Aus der Küche kam das Klappern von Geschirr. Ich stand leise auf und holte mir die Aktentasche ins Schlafzimmer und sah in dem Paß nach. Nein, über die Konfession stand nichts darin. Aber das Geburtsdatum: 12. Dezember 1920, ich dachte, sie sei noch jünger gewesen. Haarfarbe braun, Augen schwarz, Größe 1,68. Besondere Kennzeichen keine.
Ich hörte Schritte auf der Diele und steckte den Paß rasch in die Tasche und beides in meine Aktentasche. Die Korridortür klappte, das mußte Ingrid sein.
Wenn ich alle die Wege noch erledigen wollte, konnte ich nicht länger liegenbleiben. Ich zog mir den dunkelgrauen Anzug an und eine einfarbig graue Krawatte und hoffte, daß Hanna mich nicht nach der Ursache fragen würde. Sie steckte den Kopf durch den Türspalt, weil sie mich gehört hatte, und fragte: »Besser?«
Ich sagte: »Ja, es geht wieder, koch uns einen ordentlichen Kaffee. Ich muß nachher noch einmal weg.« Als ich ins Wohnzimmer kam, hatte sie den Tisch schon gedeckt und einen Strauß Wicken hingestellt und den Sonntagskuchen angeschnitten. Einen Kirschstrudel, den ich besonders gern esse. Sie schneidet den Kuchen sonst nie vor Sonntag an. Sie wollte es mir so gerne recht machen. Ich bin immer ganz bestürzt, wenn sie meine Unfreundlichkeit so beantwortet; sie tut es nicht, um mich zu beschämen, das weiß ich. Sie leidet unter jedem Mißklang. Ich legte darum den Arm um sie und sagte ihr, wie schön das sei, daß wir nun ein Stündchen für uns hätten. Sie stellte meine Zigarillos auf das Rauchtischchen und holte einen Aschenbecher herbei, und dann sprachen wir davon, daß der Junge diesmal schönes Wetter bei der Ankunft hatte und daß sein Asthma vermutlich besser würde, wenn er aus dem Wachstum heraus sei. Sie meinte, daß Ingrid zwei oder drei Wochen zu Tante Lilly aufs Gut fahren könnte, dort würde sie etwas zunehmen. Sie wächst jetzt sehr. Sogar mir war schon aufgefallen, wie spitz ihr Gesicht geworden war.
Damit war alles über die Kinder gesagt. Jetzt gab es nur noch ein Thema. Aber ich konnte nicht harmlos bei einer Tasse Kaffee darüber plaudern. Es wäre nur natürlich gewesen, wenn ich es mit Hanna besprochen hätte. Meine Frau ist in vielen Dingen praktischer als ich, obwohl ich fast zehn Jahre älter bin. Aber sie hatte fünf jüngere Geschwister und nie viel Geld. Sie würde das wissen mit dem Beerdigungsinstitut und dem Pfarrer, dem Friedhof, der Krankenkasse, den Blumen. –
Sie griff nach der Illustrierten, die sie samstags immer mitbringt, wenn sie zum Markt geht. Sie wollte mich nicht stören. Ich blies Ringe. Sie gelangen mir ungewöhnlich gut, aber es freute mich nicht. Sie sah auf:
»Hör mal, dein Horoskop: Sie stehen vor einer großen Entscheidung. Hüten Sie sich vor unüberlegten Entschlüssen. Sie sollten darüber Ihr Privatleben nicht vergessen. Sie haben auch noch eine Familie!« Sie lachte und sah mich mit ihren blassen Augen freundlich an.
Ich nahm ihr die Zeitung ab. Ich lese sonst nie Horoskope, aber Hanna liest sie mir manchmal am Sonnabend vor, und dann lachen wir beide darüber. Ich sah unter dem 12. Dezember nach. Sternbild Schütze. »Das seelische Hoch hält an. Lassen Sie sich durch nichts beirren, das Glück ist stärker als die Widerstände. Aber achten Sie auf Ihre Gesundheit!«
Ich lachte auf. Hanna fragte: »Was gibt’s?« Ich sagte: »Oh, nichts.« Ich stand auf und sagte: »Entschuldige, ich muß noch eine Reihe von Wegen erledigen, es kann spät werden, warte nicht mit dem Essen.«
Wir sagen sonst genau, wohin wir gehen. Ich schätze keine Geheimnistuerei und keine Ungenauigkeit. Wenn man weiß, wohin man geht, weiß man auch, wann man wiederkommt. In der Tür drehte ich mich noch einmal um: »Es hängt mit dem – Unfall gestern zusammen. Ich muß mich drum kümmern.«
Zuerst ging ich zu diesem Institut. Es hieß tatsächlich »Heimkehr«. Ich wunderte mich, daß dort gearbeitet wurde. Aber natürlich sterben auch am Wochenende Menschen. – Ich mußte alles ganz genau angeben: Welches Holz der Sarg haben sollte, welche Beschläge, wie die Innenausstattung sein sollte, ob Sterbehemd gewünscht würde, Papier oder Stoff, mit Blumen, Träger – man fragte sehr diskret, man tat alles, um meine Gefühle nicht zu verletzen. Sachlicher wäre es mir lieber gewesen. Man stellte die Kosten zusammen. Wer sie trägt? Ich gab meinen Namen an. »Jawohl, Herr Direktor. Es wird alles zu Ihrer Zufriedenheit erledigt.«
Natürlich war es lästig, daß ich meinen Wagen nicht hatte. Alle diese Wege kosteten mich viel Zeit. Ich wußte, daß es unsinnig war, aber ich fühlte mich dauernd teilnehmend beobachtet. Schließlich rief ich meinen Autohändler an und forderte ein Taxi. Ich wollte nicht selbst fahren, er sollte den Monteur schicken. Man kannte dort meine Abneigung gegen fremde Wagen. Natürlich hieß es nun, daß man mein Auto doch sofort hätte nachsehen können, wenn ich es gewünscht hätte. Diese Beflissenheit ist mir zuwider!
Ich ließ mich zu der Friedhofsverwaltung fahren. Dort saß ein älterer Beamter in Hemdsärmeln. Ich sagte ihm, daß das junge Mädchen, das gestern überfahren – er wußte schon Bescheid –, am Dienstag beerdigt werden sollte und daß ich einen Platz aussuchen wollte. Er fragte nach meinen Wünschen und wie hoch der Platzpreis sein dürfte. Ich hatte nicht gedacht, daß Sterben so teuer ist. Er gab mir einen Gehilfen mit, und wir gingen eine Weile durch die Gräberreihen. Wir haben niemanden auf dem Friedhof liegen, ich war deshalb auch noch nie dort. Man sollte öfter über einen Friedhof gehen. Ich werde es wohl auch tun. Ich konnte nur hie und da im Vorübergehen einen Grabspruch lesen und einen Namen. Der Mann ging schnell. Ich würde einen Grabspruch aussuchen und einen Stein – aber das hatte noch Zeit.
Ganz am Ende des Friedhofes, in der Reihe an der Hecke, habe ich ihr einen Platz ausgesucht. Ich hätte gern den Eckplatz gehabt, aber der war noch nicht dran. Es war wie damals, als ich mit Hanna den Bauplatz aussuchte. Ich mag nicht in einer Reihe wohnen. Die Grabstelle lag im Schatten einer Silberbuche. Ich glaubte, daß ihr das gefallen würde. Merkwürdiger Gedanke: das wird ihr gefallen. Ich fange an, darüber nachzudenken, was sie mag, und was zu ihr paßt.
Der Mann ging, und ich setzte mich eine Weile auf die Bank, die rund um den dicken Baumstamm läuft. Es war lange niemand in unserer Stadt gestorben. Die Kränze auf dem letzten Grab waren welk und die Schleifen verregnet. Ich wollte eine Reihe Kränze bestellen. Ich wollte nicht, daß ihr Grab kahl aussähe. Wer wohl einen Kranz schicken würde? Die Gärtnerei? Die Freundin, die Frau aus dem Haus – vielleicht auch nicht. Ich könnte anregen, daß die Sparkasse einen besorgt. Überhaupt wäre zu überlegen, ob wir das nicht immer bei unseren Kunden tun sollten. Das wäre eine Aufmerksamkeit gegenüber dem Toten und außerdem – aber ich wollte jetzt nicht daran denken, daß man damit eine gewisse dezente Reklame verbinden könnte.
Der Regen hatte die Schrift auf den Schleifen noch nicht ausgelöscht: »In unvergänglicher Liebe von Deinen Kindern«. Was sollte ich auf eine Schleife schreiben lassen? Etwa: in großer Bestürzung und tiefer Trauer – dabei fiel mir ein, daß ihr Tod in der Zeitung angezeigt werden mußte.
Möchten Sie gerne weiterlesen? Dann laden Sie jetzt das E-Book.