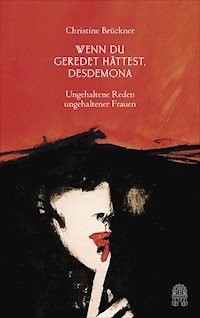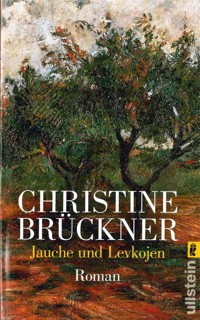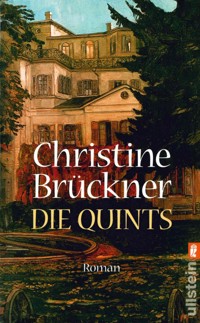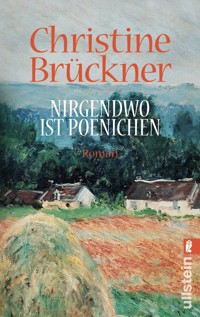6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Refinery
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Glücksmomente. Augenblicke des Glücks. Wann entstehen sie? Wenn sich ein Augenblick der Vergangenheit mit einem Augenblick der Gegenwart deckt? Wenn man wahrnimmt, dass dies schon einmal gewesen ist - eine Verdopplung?" Eine kleine Kostbarkeit für alle Christine-Brückner-Freunde: ein Lesebuch mit fünfundzwanzig Beiträgen aus ihrem reichen literarischen Schaffen. Um persönliche Erlebnisse geht es, aber auch um fremde Schicksale. Mal heiter, mal nachdenklich und immer voller Verständnis für ihre Mitmenschen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 263
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Die Autorin / Das Buch
Titelseite
Impressum
»… und mein Leben ein Ziel hat«
Umgang mit Christine Brückner
Mein Vater: Der Pfarrer
Das wenige, das ich von meiner Mutter weiß
Frühling 1945
Ständiger Wohnsitz Kassel
Im Schatten des Birnbaums
In meiner Küche
Wenn du nicht lachst
» … und mein Leben ein Ziel hat«
Traum
Erfahren und erwandert
Bücher sind Treffpunkte
Mit Rucksack und Meßtischblatt
Inseln
Griechische Kardiogramme
Die Küche der Margherita
Auf der Suche nach Poenichen (Pomorze, 1978)
Die Reise nach Jerusalem
Die Lebenskilometer
Der Zauberberg
Überlebensgeschichten
Dr. med. Anna K., Alle Kassen
Bella Vista
Meinleo und Franziska
Batschka – wo liegt das überhaupt?
»Wir wollen einen anderen Lehrer!«
Frau Marcellus prüft die Marktlage
Geboren am 24. Dezember 1945
Quellenhinweise
Von Christine Brückner sind bei Refinery erschienen:
Die AutorinChristine Brückner (1921 - 1996) zählt zu den renommiertesten Schriftstellerinnen Deutschlands. Sie verfasste Romane, Erzählungen, Kommentare, Essays, Schauspiele, auch Jugend- und Bilderbücher. Besonders mit der Poenichen-Trilogie wurde sie einem großen Publikum bekannt. Mehr über Christine Brückner erfahren Sie über die Stiftung Brückner-Kühner unter http://www.brueckner-kuehner.de/.
Das Buch
»Glücksmomente. Augenblicke des Glücks. Wann entstehen sie? Wenn sich ein Augenblick der Vergangenheit mit einem Augenblick der Gegenwart deckt? Wenn man wahrnimmt, dass dies schon einmal gewesen ist - eine Verdopplung?«
Eine kleine Kostbarkeit für alle Christine-Brückner-Freunde: ein Lesebuch mit fünfundzwanzig Beiträgen aus ihrem reichen literarischen Schaffen. Um persönliche Erlebnisse geht es, aber auch um fremde Schicksale. Mal heiter, mal nachdenklich und immer voller Verständnis für ihre Mitmenschen.
Christine Brückner
Lachen, um nicht zu weinen
Ein Lesebuch
…
Refinery by Ullsteinwww.ullteinbucherlage.de/verlage/refinery
Neuausgabe bei Refinery Refinery ist ein Digitalverlag der Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin Oktober 2017 (1) © Econ Ullstein List Verlag GmbH & Co. KG, München 2001 © Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 1984 Covergestaltung: © Sabine Wimmer, Berlin ISBN 978-3-96048-087-7 Hinweis zu Urheberrechten Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben. In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
»… und mein Leben ein Ziel hat«
Umgang mit Christine Brückner
»Was blühen will, wird blühen«, sagt sie und vertraut die Blumen dem Himmel an. Sie geht lobend und tadelnd durch den Garten; eine Hacke nimmt sie selten in die Hand.
Oder: Sie sagt zu sich selbst: »Du hast die Wahl. Entweder, du bleibst jetzt ruhig am Schreibtisch sitzen und schreibst dieses Kapitel zu Ende, oder du räumst den Keller auf.« Nach dieser Methode werden Kapitel fertiggeschrieben und wird der Keller aufgeräumt.
Manchmal deckt sie ärgerlich die Schreibmaschine zu und sagt: »Dann eben nicht!« Und geht in die Küche und backt einen Kuchen. »In der Küche habe ich meine raschesten Erfolge.« Sie verwendet ihre Phantasie am Schreibtisch und am Herd.
Christine Brückner stammt aus einem Pfarrhaus in Waldeck. Sie war die jüngste Tochter des Kirchenrates Carl Emde. In Kassel besuchte sie das Oberlyzeum. Sie dankt es der Großzügigkeit des Direktors Friedrich, daß sie – die vorzeitig die Schule verlassen hatte – nach sechsjähriger Unterbrechung rasch und bevorzugt ihr Abitur machen konnte. Drei Jahre lang war sie kriegsdienstverpflichtet am Generalkommando in Kassel. Sie verließ die Stadt, nachdem das Haus, das ihre Eltern sich im Auefeld gebaut hatten, zerstört war. Sie hat in einer Flugzeugfabrik gearbeitet, in einer Hotelküche; sie hat ein Examen als Bibliothekarin abgelegt, hat Kunstgeschichte und Literatur studiert, hat eine Mensa geleitet, war Redakteurin und lange Zeit Assistentin an einem Kunstinstitut. Alles das durcheinander und nebeneinander. Sie erwarb sich frühzeitig Milieu- und Menschenkenntnisse, wie es in normalen Zeiten, bei einem regulären Studienablauf, unmöglich gewesen wäre. Sie kamen ihr später zugute. Aus den Kenntnissen wurden Erkenntnisse. Halle – Stuttgart – Marburg – Nürnberg – Krefeld – Düsseldorf – Kassel. Immer neue Situationen, neue Menschen. Zehn Jahre lang war sie mit dem Keramiker und Industriegestalter Werner Brückner verheiratet. Ein unruhiger Lebenslauf, bedingt durch Kriegs- und Nachkriegszeit, aber auch durch ihr Temperament. Ihre Begabung zeigte sich nicht so bald; trotz der Eins im Deutschunterricht und obwohl sie schon in der Schule ein kleines Theaterstück geschrieben hatte.
»Not lehrt schreiben«, so pflegt sie einen Ausspruch von Ernst Bloch abzuwandeln (»Not lehrt denken«). Sie war im Jahr 1953 monatelang krank und zur Ruhe gezwungen: damals schrieb sie ihren ersten Roman, der in einem Wettbewerb den ersten Preis bekam und in die Bestseller-Liste unseres Jahrhunderts rückte. Der Roman wurde in viele Sprachen übersetzt, er hieß »Ehe die Spuren verwehen«.
Im Herbst 1954 fand in Bad Godesberg eine Tagung statt: »Verleger stellen junge Autoren vor«. Heinrich Böll las aus »Und sagte kein einziges Wort«, Rolf Schroers las, Otto Heinrich Kühner las und auch die junge, ganz unbekannte Christine Brückner. Ich ging mit ihr an der Ruine der Godesburg spazieren; ich am Stock, ein Globetrotter damals noch, der auf Island in die kochende Lava geraten war. Ich erzählte ihr von meinen schwierigen privaten Verhältnissen und fragte sie um Rat. Sie gab ihn mir. Das ist typisch für Christine Brückner. Manchmal rufen Leser von weit her an: »Was soll ich tun? Ich bin in der gleichen Situation wie Ihre Hanna (die Heldin aus dem Roman ›Die Zeit danach‹), wie Ihre Wiepe (die Heldin aus dem Roman ›Der Kokon‹).« Sie bekommt viele Zuschriften von Lesern, die ihre Aufsätze gelesen haben, von Hörern, die ihre Hörspiele hörten. Sie beantwortet alle Briefe. Sie ist dankbar für Zustimmung und Lob.
Sie ist eine Briefschreiberin! Der Tag am Schreibtisch beginnt mit Briefen, mit »Fingerübungen«, wie sie sagt. Blaues Luftpostpapier seit vielen Jahren. »Ihre c.b.« schreibt sie unter die Briefe. Das »c.b.« ist zum Firmenzeichen geworden.
Als sie im Herbst 1958 aus Griechenland zurückkehrte, schrieb sie mir: »Ich nähre eine neue Sehnsucht im Herzen und muß nun wohl immer zurückkehren nach Hellas, jetzt, wo ich weiß, wo es am schönsten ist. Ich habe im kastalischen Quell gebadet und nicht von der Lethe getrunken, damit ich nicht das Falsche behalte und das Rechte vergesse – ich war vier Wochen lang sehr glücklich. Ich habe versucht zu leben, als ob das ein Geschenk der Götter sei und ich nichts zurückzahlen müßte in der kleinen mühsamen Münze der Worte. Im nächsten Jahr reite ich auf einem grauen Esel über den Helikon …«
Ein andermal schrieb sie mir: »Im Süden gelingt es mir, noch einmal ein paar Jahre von den Schultern abzuschütteln.« Sie lebte, oft monatelang, auf Ischia. Sie floh vor dem langen deutschen Winter ins Tessin. Natur und Jahreszeiten spielen in ihren Büchern eine große Rolle, manchmal, wie im Tessin- oder im Ischia-Buch, die Hauptrolle. Sie unternahm 1964 eine ausgedehnte Amerikareise. Sie wollte ein Buch darüber schreiben und tat es nie. Der Kontinent war zu groß und zu fremd für sie. Sie liebt Inseln, sammelt Inseln: Patmos, Ischia, Bornholm, Catalina im Pazifik.
»Wer rasch schreiben will, muß lange nachgedacht haben«, steht in einem ihrer Briefe. »Ich habe die Schreibdauer für einen Roman unterboten: drei Monate.«
Sie unterscheidet zwischen Leb-Zeiten und Schreib-Zeiten. Sie ist darauf aus, so zu leben, daß das Schreiben nicht zu kurz kommt, und so zu schreiben, daß darüber das Leben nicht zu kurz kommt. »Primum vivere!« sagt sie, zuerst das Leben, aber sie sagt auch: »Schreiben, das ist wie atmen, man hat keine Wahl.«
Vor vielen Jahren schrieb sie mir: »Ich habe in der Gartenstadt Auefeld in Kassel ein kleines Haus gekauft. Seit gestern gehören mir 300 qm unseres Planeten; ich öffne das Fenster und blicke in den Weltraum. Wozu noch Raumschiffe!«
Ihr Temperament wechselt. Sie knüpft leicht und schnell Beziehungen an, scheint ganz dem Augenblick verhaftet und – zieht sich genauso rasch in sich selbst zurück und verstummt. Sie gibt sich heiter, aber sie zweifelt oft. Sie ist nicht selbstsicher. »Ich brauche mein tägliches Blättchen Lorbeer«, sagt sie, »das kaue ich dann durch.« Eine Leserin hat ihr einen Lorbeerstrauch aus Delphi mitgebracht, seitdem spendiert sie den Freunden jeweils ein Blatt, wenn sie sich Lorbeer verdient haben. Genauso selbstverständlich pflückt sie ein Blatt und tut es in den Gulasch.
Sie hat ein reales Verhältnis zum Leben, zum Altern, zum Tod. Sie hat, was so selten ist, Talent zum Leben und Talent zum Glück. Für ihren Partner ist es ein Gewinn, mit ihr zusammen alt zu werden. Für mich.
Otto Heinrich Kühner
Mein Vater: Der Pfarrer
Am zweiten Weihnachtstag des Jahres 1921 taufte der Pfarrer Carl Gottfried Emde in der Kirche eines kleinen waldeckschen Dorfes ein Kind. Weil es das Christfest war, taufte man es auf den Namen Christine. Der Winter war kalt, die Kirche ohne Heizung; dem Täufling stand ein Rauchfähnlein vorm Mund. Es wurden wenig Kinder in jenem Winter geboren, man sah das später deutlich, als der Jahrgang eingeschult wurde. Die Kinder hatten auf einer einzigen Schulbank Platz, eine Zwergschule, einklassig. Der Pfarrer predigte über ein Wort aus dem Matthäusevangelium (Kap. 18, Vers 5): »Wer ein solches Kind aufnimmt in meinem Namen, der nimmt mich auf.« Er nahm den Predigttext als Taufspruch für das Kind.
Der Pfarrer war nicht mehr jung. Am Weltkrieg, der damals noch kein Zahlwort trug, hatte er nicht aktiv teilgenommen, sondern passiv. Er hatte die Trauergottesdienste gehalten und die Todesbotschaften in die Häuser gebracht. Seine Gemeinde horchte auf den Spruch, den er einem Kind mit auf den Lebensweg gab, einem Brautpaar mit in die Ehe, dem Toten mit ins Grab. Sie nahm den Spruch als Losungswort.
Ein solches Kind war ich. Die Leute im Dorf haben das nicht vergessen, sie erinnern mich daran, wenn ich zurückkehre. Unser alter Pastor, sagen sie.
Dieser Pastor war mein Vater. Nicht Pfarrer: Pastor. Hirte. Er trug einen graumelierten Bart, war viel zu alt für so ein kleines Kind, ein Mittfünfziger bei meiner Geburt, hoch über mir, 1 Meter 80 oder mehr. Ich mußte anklopfen, wenn ich ihn zum Essen rufen sollte. Patriarchalische Verhältnisse im Pfarrhaus. Aber: Der Vater klopfte ebenfalls an die Tür des Kinderzimmers, bevor er eintrat. Ein Erwachsener ist in seine Arbeit vertieft, ein Kind in sein Spiel. Respekt wurde erwartet. Respekt verdient auch ein Kind. Bei Tisch: Kinder reden nur, wenn sie gefragt werden! Das Kind sagt: Fragt mich bitte mal was! Der Vater zur Mutter: Laß das Kind reden! Gleiches Recht.
Dieser Pfarrer, der mein Vater war, wurde als Sohn des Lehrers geboren, in demselben Dorf. Man hat mir Ohrläppchen gezeigt, die schlecht angewachsen waren, nachdem er sie halb abgerissen hatte im Zorn. Aber: Wer bei dem Lehrer Heinrich Emde in die Schule gegangen war – und 40 Jahrgänge waren es –, der konnte einen Brief aufsetzen, dessen Handschrift war wie gestochen, der konnte bis ins hohe Alter die wichtigsten Choräle auswendig, der deklamierte Schillers »Glocke«, ohne zu stocken, der konnte kopfrechnen, der konnte auch singen. Er sprach Platt mit ihnen, wenn er zufrieden war, Hochdeutsch, wenn er zornig war. Höcher, Henner, höcher! pflegte er in der Gesangstunde zu sagen, das sagt man im Dorf noch heute. Er züchtigte die Schulkinder und gewiß auch die eigenen. Der älteste Sohn, der mein Vater wurde, schlug nie, nicht seine Konfirmanden, auch nicht die Gymnasiasten, denen er im Weltkrieg Latein- und Religionsunterricht erteilte, auch nicht die Schulkinder, als er zwölf Jahre lang Kreisschulaufseher war, nicht die eigenen Töchter. Er verließ sich auf die Überzeugungskraft seiner Worte, seines Beispiels.
Mit zehn Jahren verließ er sein Heimatdorf, kam auf ein Alumnat, studierte dann Theologie, wurde Einjähriger, dann Vikar, dann Prinzenerzieher im fürstlichen Schloß. Fürstin-Mama fuhr später oft mit der Kutsche am Pfarrhaus vor, und wir knicksten ehrerbietig. Keine Rede davon, daß man auf gleicher Stufe stünde, nicht einmal der Tod macht alle gleich, für die fürstliche Familie ein Erbbegräbnis. So habe ich es gelernt. Wenn ich in das Residenzschloß gehe, das heute von den Erbprinzen bewohnt wird, um es Freunden zu zeigen, bin ich befangen und lache darüber, halte mit Filzpantoffeln den Waldeckschen Stern blank.
Als mein Vater dreißig Jahre alt war und schon andernorts ein Pfarramt versehen hatte, schickte ihn seine Kirchenbehörde in sein Dorf zurück. Nun nicht mehr der Carl, der älteste Sohn des Lehrers, sondern der Pastor, der Diener Gottes. Das Du hörte auf, das schien ihm notwendig. Die Leute im Dorf gewöhnten sich daran. Er hörte auf, Platt mit ihnen zu sprechen, verlernte es sogar, sprach ein Hochdeutsch ohne jeden mundartlichen Anklang. Der Talar trennte ihn ebenfalls. Kein Vorname mehr, auch kein Familienname mehr, nur noch Titel, nur noch Amt. Der Herr Pastor.
Drei Dörfer gehörten zum Kirchspiel. Ein Berg trennte das Kirchdorf von den Filialdörfern; er fuhr mit dem Fahrrad über die Landstraße, ging den Fußweg über den Berg. Zwei Gottesdienste an jedem Sonntag, einmal im Monat ein dritter in dem kleinsten Dorf, um den Alten den mühsamen Weg über den Berg zu ersparen. Seine Spaziergänge machte er erst, wenn es dämmerte, wenn kein Bauer mehr auf dem Feld arbeitete. Solange noch jemand in Stellmacherei oder Schmiede hämmerte, setzte er sich nicht in den Garten. Er lebte in seinem Studierzimmer in freiwilliger Absonderung.
Pfarrer sein, das hieß für ihn, ein Predigtamt zu haben, seiner Gemeinde Gottes Wort zu verkünden. Das an erster Stelle. In den frühen Morgenstunden des Freitag suchte er nach dem Textwort, in der darauf folgenden Nacht wurde die Predigt fertig; jede handschriftlich ausgearbeitet, auf kleinen, sparsam beschnittenen Zetteln, in einer zierlichen, leserlichen Handschrift. Nie griff er auf eine alte Predigt zurück. Zweiundfünfzig Sonntage im Jahr, dazu Karfreitag, Himmelfahrt und Buß- und Bettag, sechzig Predigten im Jahr, von 1890–1934, mehr als zweitausendsechshundert Predigten, alle in Schubladen aufbewahrt und dann im Zweiten Weltkrieg verbrannt. Er war zunächst ein liberaler Christ des ausgehenden 19. Jahrhunderts gewesen. Am Ende seiner langen Amtszeit wurde er ein Anhänger der Bekennenden Kirche. Er hat mit den theologischen Studien nicht aufgehört, in seinem Nachlaß fanden sich die frühen Bücher Karl Barths, Paul Tillichs, Rudolf Bultmanns; sie waren sorgfältig durchgearbeitet und mit Randbemerkungen versehen. Ferien und Urlaub waren fremde Worte für ihn. Er war der Ansicht, daß ein Pfarrer seine Gemeinde nicht verlassen dürfe. Anspruch auf Anwesenheit. Die Leute im Dorf kannten Ferien ebenfalls nicht, er gehörte zu ihnen. Als er sich bei Glatteis das Bein gebrochen hatte, trugen ihn einige Männer im Korbstuhl in die Kirche, er predigte im Sitzen, vom Altar aus.
Am Sonnabend lernte er seine Predigt auswendig. Sein Konzept war mit Lineal und Farbstift rot und grün unterstrichen, forte und fortissimo. Er mußte die Bauern wachhalten, die müde wurden, sobald sie zum Sitzen kamen. Er lernte laut, er lernte im Gehen, er folgte dem Rosenmuster seines Teppichs, bis die Rosen verschwunden waren, er ging im Oval, nicht auf und ab. Der Lebensweg meines Vaters. Wir hörten seine Stimme, wenn wir wach wurden und wenn wir einschliefen. Manchmal schwoll sie zu Donner an, dann klopfte meine Mutter an seine Tür: Carl! Die Kinder!
Von Freitag früh bis zum Gottesdienst am Sonntag herrschte unbedingte Stille im Pfarrhaus. Vater macht die Predigt! Er verlor das Kanzelfieber nie. Kein Frühstück am Sonntag, nicht einmal einen Schluck Kaffee. Er wurde erst ruhig, wenn der Höhepunkt der Predigt erreicht war. Beim Mittagessen war er erleichtert und entspannt, heiter, gesprächig.
Er predigte, er taufte, er konfirmierte, er segnete die Brautpaare ein. Er hielt auf Tugend. Eine Braut, die schwanger war, traute er nicht in Kranz und Schleier. Er brachte den Sterbenden das Abendmahl, er beerdigte die Toten. Das waren seine Amtspflichten. Aber er ging selten ins Dorf. Seine Besuche bei Kindtaufen und Hochzeitsfeiern währten nur kurz. Die sozialen Aufgaben übernahm die Pfarrfrau. Sie wußte, wo jemand krank lag, sie versorgte die Verletzten; einen Arzt gab es nicht. Sie besuchte die Alten. Sie war der verlängerte Arm des Pfarrers, sie, die Ortsfremde, schwarzhaarig unter den Blonden, die Großstädterin. Sie veranstaltete Gemeindeabende, führte Regie, wenn Turnverein und Jungmädchenbund Theater spielten, leitete den Frauenverein, gab Kurse in Säuglingspflege. Für alles Soziale war die Pfarrfrau zuständig.
Der Pfarrer, der mein Vater war, ging ungern aus dem Haus. Er war scheu. Er fühlte sich sicherer in seinem Studierzimmer. Bücherwände, Kachelofen, hochstämmige Rosen und Bienenhaus. Idylle. Die Männer, die zu ihm kamen, um die Pacht für das Kirchenland zu zahlen oder um Stundung zu bitten, zogen im Flur die Schuhe aus, stiegen in Strümpfen die Treppe hinauf, gingen den Flur entlang; ans äußerste Ende des Hauses hatte er sich verzogen. Abstand. Er setzte sich mit seinem Amt gleich, er war das Amt. Er gehörte zu seiner Gemeinde, aber er stand über uns. Das mag auch an der Kanzel überm Altar gelegen haben, zu der eine hohe Treppe führte. Eine alte Kirche, die Innenausstattung barock. Wir blickten zu ihm auf. Vertrauen, nicht Vertraulichkeit. Ehrfurcht, aber nicht Furcht. Aber auch Fälle, wo es hieß: Darüber kann man mit dem Herrn Pastor nicht reden. Über vieles ließ er nicht mit sich reden.
1934, im Herbst, ließ die Gemeinde ihren Pfarrer ziehen. Ungern, aber erleichtert. Er paßte nicht mehr in das Dorf, in dem ein paar junge Erbhofbauern, Mitglieder der SS-Reiterstandarte, nun den Ton angaben; sie versuchten, den alten Pastor zu ihrem »Fördernden Mitglied« zu machen, sie wollten seine Stimme, die ihnen recht gab, er gab sie nicht, gab seine Stimme für nichts. Man nahm ihm das Amt des Kirchenrates; eines Nachts fand eine Hausdurchsuchung statt.
Sie wollten sicher vor ihm sein, und sie wollten ihn in Sicherheit wissen, beides. Der Kirchenvorstand stellte sich nicht hinter ihn, erst recht nicht vor ihn. Er mußte gehen. Er war gehorsam gegenüber der Kirchenbehörde, gegenüber jeglicher Obrigkeit. Sein Widerspruch ging nach innen, nicht nach außen. Er litt. Er wurde leidend. »Wenn Erziehung und Ermahnung irgend etwas fruchteten, wie könnte dann Senecas Zögling ein Nero sein.« Das Dorf, in dem mein Großvater vier Jahrzehnte als Lehrer gewirkt hatte, in dem mein Vater mehr als drei Jahrzehnte Pfarrer gewesen war, geriet unter den Einfluß einiger SS-Männer.
Er kehrte nie mehr in sein Dorf zurück, obwohl es nur 50 km von seinem späteren Wohnort entfernt lag. Er hat nie wieder eine Kanzel betreten. Er ist wenige Jahre später gestorben. Es war sein Wunsch, in der Heimat begraben zu werden. Es war Krieg, eisiger Dezember. Die SS-Männer standen als Soldaten an den Fronten. Alte Männer trugen den Sarg aus der Kirche bis zum Friedhof am Waldrand. Dort liegt er zwischen denen, die er getauft und konfirmiert und begraben hat. Auf seinem Grabstein stehen der Name und die Lebensdaten. Nicht Titel und nicht Amt, so hat er es gewünscht. Er ist heimgekehrt in das Dorf, in dem er geboren wurde. Vor seinen Gott tritt er nicht als Pfarrer. Er war demütig und ein wenig einsam. »Psalm 119,76« steht unter seinem Namen. »Deine Gnade müsse mein Trost sein, wie du deinem Knecht zugesagt hast.« Die Gemeinde nahm ein zweites Mal von ihrem Pastor Abschied. Die Tränen galten nicht nur ihm. Es gab vieles, das zum Weinen war.
In den letzten Lebensjahren hat er seine Erinnerungen niedergeschrieben. Fünfzig Seiten über den Kirchenstreit zwischen Deutschen Christen und Bekennender Kirche, dreißig Seiten über die Theologen, die seine Lehrer waren, zwanzig Seiten über den Kirchenvorstand. Was er über die eigenen Kinder zu sagen hatte, ging auf fünf Seiten.
Manchmal durfte ich auf seinem Fuß sitzen, und er ließ mich wippen, manchmal sang er Bellman-Lieder, Lieder von Heinrich Heine.
»In meinem Elternhaus hingen keine Gainsboroughs«, es war wie im Pfarrhaus, in dem Gottfried Benn aufwuchs, aber bei uns wurde Chopin gespielt. Gab es Schwierigkeiten in der Schule, erkundigte er sich: Kannst du dem Unterricht nicht folgen? Wenn deine Begabung nicht ausreicht, dann mußt du das Gymnasium verlassen. Fehlt es dir aber an Fleiß, dann hat es keinen Zweck, dann wird nichts aus dir. Er erwartete Einsicht. Die Folgen des Tuns oder Nichttuns wurden den Kindern deutlich gemacht. Alles hat seine Ursache und seine Folgen. Keine Strafe, keine Strafandrohung. Keine Nachhilfe. Du kannst oder du kannst nicht. Er behandelte seine Töchter wie zwar kleine, aber doch zurechnungsfähige Erwachsene, nur eben noch unerfahren, man mußte ihnen einiges erklären, aber sie waren voll verantwortlich.
Der Vater, der Pfarrer, Gott Vater, Lieber Vater, Unser Vater, der du bist im Himmel, das war eine Einheit, das mußte nicht unterschieden werden, alle waren sie zuständig für mich, allen war ich verantwortlich, ich gehörte ihnen, sie sahen, was ich tat. Erst viel später trennten sie sich voneinander, aber ich habe meinen Vater nie völlig von dem Pfarrer, der er war, trennen können. Er blieb der Mittler und Fürsprecher; erst recht, seit er tot ist. Da ist vieles unkontrolliert und unkritisch. So soll es bleiben.
Er steht nicht mehr über mir, er steht am Rande meines Lebens, Beobachter und Kritiker meines Tuns. Ich weiß, was ihm mißfällt. Er ist mir von Jahr zu Jahr näher gerückt, ich erkenne den Antrieb seines Lebens: zu predigen, was er glaubte; zu leben, was er predigte. Noch einige Jahre, dann bin ich so alt, wie er war, als ich geboren wurde. Etwas wie Gleichaltrigkeit und Partnerschaft entsteht.
Der Satz »Die Kunst darf alles und muß nichts« kann für mich nicht gelten: Ich stehe unter Kontrolle. Die Kontrollaufgabe hat dieses Dorf, das ich mein Dorf nenne und in dem mein Vater Pfarrer war, übernommen. Nichts tun, nichts schreiben, was in den Augen dieser Menschen falsch oder unrecht ist. Sie sind unbestechlich in ihrem Urteil. Da gilt nicht Ansehen und nicht Erfolg. Sie sind bereit anzuerkennen, was ihnen unverständlich ist, nicht weil es von mir kommt, sondern weil ich die Tochter ihres Pastors bin. Sie erheben Anspruch auf mich, ich bin eine der Ihren, sie sagen du zu mir. Sie haben ein Recht auf mich, ich erkenne sie als Gericht an.
Dieses Dorf ist mein Nährboden, dort ist mir Urvertrauen zugewachsen, das nur ein anderes Wort ist für Gottvertrauen.
[aus: »Überlebensgeschichten«]
Das wenige, das ich von meiner Mutter weiß
Immer wieder habe ich mir vorgenommen, das wenige, das ich von meiner Mutter weiß, aufzuschreiben. Ich verdanke ihr jeden Atemzug, jeden Lebenstag, aber gedankt habe ich es ihr erst lange nach ihrem Tod, als ich alles besser übersehen konnte. Nie hat sie selbst den Versuch unternommen, sich schriftlich über ihr Leben zu äußern, einen kurzgefaßten Lebenslauf zu schreiben – wozu auch, sie hat sich niemals irgendwo um einen Posten bewerben müssen. Schreiben ist ein Vorgang des Vergessens; ich entleere mein Gedächtnis.
Sie hat die letzten fünf Jahre ihres Lebens bei mir gewohnt, oft krank, fast immer leidend, selten klagend. Einige Monate vor ihrem Tod verwirrte sich ihr Geist. Dämonen umlagerten ihr Bett. Sie rief meinen Namen, auch wenn ich neben ihr saß und ihre Hand hielt. Bis ich mit dem gleichen Entsetzen in die Zimmerecke starrte, in die meine Mutter starrte. Aber in den letzten Wochen war ihr Geist wieder ganz klar. Ich saß bei ihr, sang Choräle. Wir lebten in Todesnähe. Wir waren nicht mehr allein in diesem Haus in Düsseldorf, nahe beim Flughafen. Damals habe ich einen kleinen Roman geschrieben. Man merkt ihm nichts an, er ist beinahe heiter geraten. Schreiben, um zu überleben …
Das Wiedersehen eines Toten im Traum trifft uns unvorbereitet, bestürzend. Ich stieg eine Treppe hinauf, ging durch eine Tür, trat in ein Zimmer, das ich nicht kannte. Meine Mutter saß auf dem Boden, gegen einen Sessel gelehnt, war klein geworden, zart und zierlich. Sie erkannte mich nicht, sie schien heiter und zufrieden zu sein in ihrer eigenen, mir nicht zugänglichen Welt. Ich wollte ihr mein Fernbleiben erklären, spürte aber, daß sie mir nicht zuhörte. Ich wachte betroffen auf: Ich war nicht mehr wichtig …
Ich habe in den letzten Briefen meiner Mutter gelesen, sie war keine geübte Briefeschreiberin; Briefe hatte meist mein Vater geschrieben, erst nach seinem Tod übernahm sie die Korrespondenz. Ihre Hände zitterten, eine Folge der schweren Bombenangriffe auf Kassel. An manchen Tagen fiel ihr das Schreiben besonders schwer, dann brach ein Brief ab, dann stand unvermittelt unten auf der Seite ›Mutti‹. Wir nannten sie ›Mutti‹, was mir als Briefunterschrift ungeeignet erschien. Der Vater schrieb ›Dein Vater C.Emde‹ unter seine Briefe, von denen keiner gerettet werden konnte.
Ihr häufiges Kranksein und die sich anschließenden Schonzeiten verschafften mir als Kind einen Freiraum, den ich nutzte: Ich verschwand in aller Frühe, wenn es noch still im Haus war, ins Dorf. Der Schweinehirt blies von ferne sein Horn, die Stalltüren öffneten sich, und die Schweine machten sich auf den Weg zu ihrem Hirten, der mit ihnen auf ›die Drift‹ zog. Ich lief zum Stellmacher, zum Schmied, sah in die Schuster-Werkstatt, durfte beim Nachbarn im Stall die Häckselmaschine drehen und kehrte so unbemerkt zurück, wie ich verschwunden war. Ich hatte ein Talent zum Unsichtbarmachen entwickelt. Brachte ich aus dem Dorf ›Wörter‹ mit nach Hause, hieß es: »Da spricht man nicht von.« Auch über Geld sprach man nicht, es stand unter Tabu. Ich habe später weder das Geld, das ich nicht hatte, noch das Geld, das ich hatte, für wichtig genug gehalten, um darüber zu sprechen, habe mich untergründig für beides, Haben und Nichthaben, geschämt. Zur Genußfähigkeit hat man mich nicht erzogen.
Keine Bekenntnisse, keine Geständnisse. Fragte meine Mutter mich – als ich erwachsen war – nach irgend etwas, worüber ich nicht reden wollte, sagte ich lachend: »Da spricht man nicht von!«, benutzte ihre eigenen Waffen. Von der Scheidung meiner Ehe habe ich sie erst viel später unterrichtet. Kein Vertrauensverhältnis, aber unser Verhältnis war auch nicht lieblos. Vertrauen und Schonung kann man nicht gleichzeitig haben …
»Blamier mich nicht!« war ihre Erziehungsdevise. Keine aufgeklärte Mutter würde das heute zu ihrem Kind sagen, aber alle Eltern hätten es wohl gern, wenn ihre Kinder sie nicht blamierten. Ich galt als wohlerzogen, als ›liebes Kind‹. Es ist nicht überliefert, daß ich irgendwann ›bockig‹ gewesen wäre …
Meine Mutter war eine fortschrittliche Frau; sie hätte gewiß Bücher über Kinderpsychologie und Pädagogik gelesen, wenn sie ihr zur Verfügung gestanden hätten.
In ihrem ›roten Zimmer‹ stand ein eleganter kleiner Bücherschrank mit Romanen von Thomas Mann und Joseph Roth, auch ein Buch, das »Disteln und Dornen am Wege des Kindes« hieß, Richtlinien zur Kindererziehung. Später zitierten wir bei Mißgeschicken und bei Fehlern, die wir gemacht hatten, den Titel in jenem ironischen Tonfall, den wir uns im Umgang mit ihr angewöhnt hatten, gegen den sie machtlos war. Ungezogenheit wurde von ihr mit Liebesentzug bestraft; so nennt man das heute. Ich zweifle nicht daran, daß sie ihre Erziehungsmethode für richtig hielt. Ich habe nie an ihren guten Absichten gezweifelt, tue es auch heute nicht. Sie drohte nicht mit Strafe, sondern führte sie sofort und eigenhändig aus. Einmal erschien mein Vater auf der Treppe und rief: »Tilla, vergiß dich nicht!« Sie strafte im biblischen Sinne: Wer seine Kinder liebt, der züchtigt sie …
Meine Mutter, die mich zur Ordnung ermahnte und anhielt und Unordnung bestrafte – wollte sie eine ordnungsliebende Tochter heranziehen, weil sie selbst gar nicht so ordentlich war, wie ich jahrzehntelang angenommen habe? ›Halte Ordnung, übe sie, Ordnung spart viel Zeit und Müh‹, stand blau auf weiß gestickt überm Küchenherd. In diesem Elternhaus ließen sich häufig Schubladen nicht aufziehen, weil Gegenstände, Küchengeräte oder Bürsten, sich verklemmt hatten. Das kommt in meinem Haushalt nicht vor, was daran liegen mag, daß meine Schubladen nicht so voll sind …
Woher meine Angst, sie würde mich beim Haarwaschen in der Badewanne ertränken? Sie drückte meinen Kopf weit zurück, ich mußte einen Schwamm vor die Augen pressen, konnte mich daher nicht mit beiden Händen am Rand der Wanne festhalten …
Der ersten Frau meines Vaters wurde das Kindbett zum Sterbebett, sie nahm das Söhnchen mit ins Grab. Als mein Vater nach langen Jahren sich ein zweites Mal verheiratete, schien sich das Unheil zu wiederholen, wieder starb das erste Kind, aber meine Mutter wurde gerettet. Das zweite Kind wurde mit größerer Freude, aber auch in größerer Sorge erwartet; es wurde in einer Klinik geboren, ein Mädchen. Als ich – drei Jahre später – ohne viel Aufhebens geboren wurde, teilten meine Eltern auf Visitenkarten mit, daß ihr Töchterchen eine Schwester bekommen habe, mein Name wurde auf der Anzeige nicht genannt. Ich bin als Schwester meiner Schwester aufgewachsen. Meine Mutter war vierundvierzig, mein Vater fünfundfünfzig Jahre alt, ich hatte Großeltern als Eltern. Ich habe das nie bedauert …
Meine Mutter sah aus wie eine Frau, die geliebt wurde. Blieb sie – geliebt – deshalb so lange schön? Ihr Gesicht zeigte im Alter keine Fältchen, sondern wenige tiefe Falten, ein geprägtes Gesicht. Kurz vor ihrem Tod hatte man ihr das lange schwere Haar abgeschnitten; wer sie besuchte, stellte ihre Ähnlichkeit mit Beethovens Totenmaske fest …
Sie wusch sich mit einem roten Gummischwamm, vor dem ich Abscheu empfand. Wir Kinder hatten unsere Waschläppchen, der Vater wusch sich mit den Händen. Sie benutzte keine Schönheitsmittel. Palmolive-Seife für Körper und Gesicht, Kaloderma-Gelee für die Hände. Das Fläschchen Uralt Lavendel reichte von einem Geburtstag zum anderen …
Ich habe als Kind und auch später, als ich erwachsen war, unter ihrem Schweigen, das sie erzieherisch einsetzte, gelitten. Aber sie selbst wird mehr darunter gelitten haben als ich, die dieses Schweigen jederzeit beenden konnte. Sie war gezwungen zu schweigen, sie war darauf angewiesen, daß das Kind kam und sagte: »Ich will wieder lieb sein«, »Hab mich bitte wieder lieb!« Das erlösende Wort! Dann konnte auch sie wieder ›lieb sein‹, konnte wieder reden. Es ging etwas Dunkles von ihr aus, das lag nicht am tiefschwarzen Haar, dem dunklen Teint, den dunklen Augen. Sie breitete in der Karwoche die schwarzen Samtdecken über Altar und Kanzel und legte ihr schwarzes Samtkleid an. Da erstarb alles Lachen …
Immer habe ich sie bewundert, weil sie schön war und weil sie immer wußte, was richtig war und was man tat. Nie, auch heute nicht, zweifle ich daran, daß sie die gebratene Geflügelleber bekommen mußte, die Spargelköpfe, zum zweiten Frühstück das mit Rotwein und Traubenzucker geschlagene Ei. Sie aß die Spargelköpfe und die Geflügelleber aus Pflichtgefühl, nicht um des Genusses willen. Es geriet ihr alles zur Pflicht. Sie war zart, sie mußte geschont werden, weil sie sich selbst nicht schonte und nie gelernt hatte, mit ihren geringen Kräften hauszuhalten. In unregelmäßigen Abständen brachte der Vater sie ins Krankenhaus oder in ein Sanatorium. Jeder Psychologe würde mir nachweisen, daß sie sich in Krankheiten geflüchtet habe. Aber kann man sich in Mittelohrvereiterungen flüchten? Lebensgefährliche Operationen bei Nacht? Typhus, Scharlach, Rheuma, Tuberkulose, Gallenkoliken? Und immer wieder Gastritis und Gemüsebrei und Toast und ein wenig Rauchfleisch. Sie mußte ihr Leben lang Diät essen, Schonkost. Monatelang kam täglich der Arzt und spritzte Bienengift. Alle ihre Hexenschüsse! Zwei Herzinfarkte und jahrelange Angina pectoris …
Morgens, wenn man besorgt fragte: »Wie hast du geschlafen?« oder die Frage abwandelte in »Konntest du ein wenig schlafen?«, antwortete sie mit: »Ach, Kind!« Hat sie mir ihre Schlaflosigkeit vererbt? Schlief ich vor ihrem Tod schon schlecht? Auch ich werde, mit Besorgnis und Anteilnahme, gefragt, wie ich geschlafen habe; man kennt meine Schlafschwierigkeiten, ruft mir in der Frühe bereits zu: »Ach, Kind?!« Wiederholungen. Ähnlichkeiten. Manchmal verstumme ich wie sie …
Üblich ist, daß Mütter am Bett ihres Kindes sitzen, bei uns war es umgekehrt. Ich hatte keine zärtliche Mutter, aber ich hatte eine liebebedürftige Mutter. Sie war dankbar, wenn man sie in den Arm nahm, wenn man sie küßte; sie ließ sich küssen …