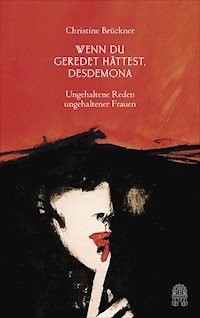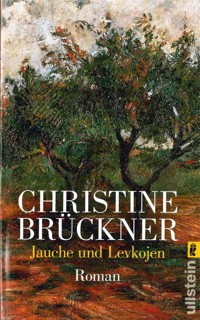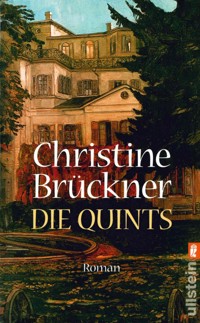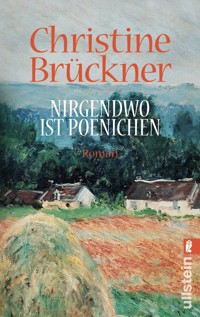6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Refinery
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Das ist ein kleines Mädchen, das legt die Strecke vom Rocksaum der Mutter zum Knie des Vaters zurück: ein Lebensweg beginnt. Christine Brückner erzählt von den Lebenskilometern, die sie wandernd, radfahrend, tanzend, schwimmend zurückgelegt hat.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 378
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Die Autorin / Das Buch
Titelseite
Impressum
Die Lebenskilometer
Mit Rucksack und Meßtischblatt
Mein amerikanischer Traum
Mein Sommertheater
Die Küche der Margherita
Im Wettlauf mit dem Frühling
Ein Sonntag in der Schweiz
Datierte Träume: 17. November, Positano
Heimweh nach der Romantik
Mit Wander-, Wetter- und Weinkarte durch den Kaiserstuhl
Meine Insel im Norden – Juist
Genugtuung und Träumerei
Wo der Rhein noch jung ist
Das Abgründige im Pinzgau
Im Schatten des Birnbaums
Die Inseln vor der Insel
Des Dichters Bergfahrt oder Kleiner Grenzverkehr 1978
Auf der Suche nach Poenichen
Eine Landschaft verweigert sich
Bußgang zwischen Gräbern
Halbschatten und Halbtrauer über der Provence
Der Zug hat voraussichtlich 40 Minuten Verspätung oder Bücher sind Treffpunkte
O Schwarzwald!
Gewaltige Ausfälle an Sonne
Jerusalem, du hochgebaute Stadt
Bis an der Welt Ende
Der Mai bewirkt Wunder
Und dann die festlichen Kastanien
Bei günstiger Witterung kann man die Wartburg sehen
Grüne Tage am Lech
Der Leuchtturm als Lebenszeichen
Ein Park der Vergänglichkeit
The blue church
Sappho – Klytämnestra – Megara
Paroles de femmes
Im Tal der Jagst
Die Pappel verläßt sich auf dein Gedicht
Am Rande der Wüste
Von Christine Brückner sind bei Refinery erschienen:
Die AutorinChristine Brückner (1921 - 1996) zählt zu den renommiertesten Schriftstellerinnen Deutschlands. Sie verfasste Romane, Erzählungen, Kommentare, Essays, Schauspiele, auch Jugend- und Bilderbücher. Besonders mit der Poenichen-Trilogie wurde sie einem großen Publikum bekannt. Mehr über Christine Brückner erfahren Sie über die Stiftung Brückner-Kühner unter http://www.brueckner-kuehner.de/.
Das Buch
Das ist ein kleines Mädchen, das legt die Strecke vom Rocksaum der Mutter zum Knie des Vaters zurück: ein Lebensweg beginnt. Christine Brückner erzählt von den Lebenskilometern, die sie wandernd, radfahrend, tanzend, schwimmend zurückgelegt hat.
Christine Brückner
Unterwegs
Reisen in nicht allzu ferne Länder
Refinery by Ullsteinwww.ullteinbucherlage.de/verlage/refinery
Neuausgabe bei Refinery Refinery ist ein Digitalverlag der Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin Oktober 2017 (1) © Verlag Ullstein GmbH, Frankfurt/M - Berlin 1995 Covergestaltung: © Sabine Wimmer, Berlin ISBN 978-3-96048-091-4 Hinweis zu Urheberrechten Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben. In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Die Lebenskilometer
Manchmal überlege ich, wie viele Kilometer ich zurückgelegt habe, seit ich mich vom Schoß der Mutter getrennt habe und zum ersten Mal durchs Zimmer zu Vaters Hosenbein gekrochen bin.
Nicht, daß ich meine, man müsse einen Kilometerzähler bei sich tragen, das wäre zu einfach. Aber von Zeit zu Zeit müßte man doch einmal ausrechnen, wie weit man denn nun auf seinem Lebensweg vorangekommen ist und wie weit man hätte gelangen können, wenn man nicht immer wieder einen Haken geschlagen hätte, zurückgeworfen worden oder zurückgelaufen wäre, ja, und auch an jene muß man denken, mit denen man ein langes Wegstück gemeinsam gegangen ist.
Ich sage gegangen – und dabei sind wir doch unsere Lebenskilometer gekrochen, gelaufen, mit dem Roller und mit dem Fahrrad gefahren, mit der Straßenbahn, mit dem Auto, der Eisenbahn, mit dem Flugzeug geflogen – schneller, immer schneller. Man kann sie längst nicht mehr zählen, so rasen die Kilometer vorbei. Am Ende haben wir schon ein paarmal die Erde umrundet und wissen es nur nicht.
Genau muß man sein, wenn man sich ans Zählen der Kilometer begibt, sonst vergißt man die schönsten Strekken, und über den großen Reisen vergißt man den Gang am Abend durchs Viertel, wenn man noch Post zum Briefkasten gebracht hat und dann heimgeht. Über den frohen Wegen vergißt man den mühsamen Weg über den langen Korridor im Krankenhaus bis zum Korbstuhl am Fenster und vergißt die Wege mit dem Rucksack, an nebligen Herbstabenden, 1945, über die Zonengrenze bei Friedland. Und dann dieses Gehen nach Zentimetern in den Fluren der Ämter! Dieses langsame Nachrücken, als man für einen Schuhbezugsschein Schlange stand. In jenen Jahren kam man langsam vorwärts und war doch soviel unterwegs, weil man kein Zuhause hatte. Und wenn man es hatte, dann war es ungeheizt. Hunger und Kälte trieben uns auf die Kartoffelfelder, zu den Bucheckern in die Wälder und zu den Kohlenwaggons auf dem Güterbahnhof.
Aber ich sehe, ich muß planmäßiger vorgehen. Mit den ersten Metern im Studierzimmer meines Vaters muß ich anfangen. Auf seinem Teppich, dessen Rosenmuster ein großes kahles Oval aufwies: der Lebensweg meines Vaters. Ich weiß nicht, wie viele Kilometer er darauf zurückgelegt hat, aber vorm Einschlafen hörte ich seine Schritte, und manchmal hörte ich sie noch, wenn ich aufwachte.
Weg von Mutters Rockzipfel, weg von der Hand des Vaters! Ich lernte radfahren, kaum daß ich laufen konnte. Und weil ich nichts von den Geheimnissen einer Rücktrittbremse wußte und weil es dort, wo ich herstamme, bergig ist, gab es ein blutiges Ende und lebenslängliche Narben an Knien und Ellenbogen. Dann wurde es ernst. Ich fuhr mit dem Rad zum Gymnasium, sechs Kilometer hin, sechs Kilometer zurück, und wenn ich Vaters Zigarren einzukaufen vergessen hatte, am Nachmittag ein weiteres Mal. Schulwege.
Genügt es, wenn ich fünfzig gerodelte Kilometer ansetze? Dreißig per Schlittschuh zurückgelegte, ohne die mißlungenen Pirouetten? Wie oft dreht sich ein Karussell für zwanzig Pfennig? Eines Tages war ich ein Stadtkind, das mit der Straßenbahn zum Lyzeum fuhr, abends auf die Königstraße zum Bummel ging und zweimal in der Woche zur Tanzstunde. Alle die vertanzten Lebenskilometer! Alle Dreharten ausprobiert, Foxtrott, Tango, Swing und Twist; beim Walzer wird mir’s noch immer schwindlig.
Mit den Skiern wäre ich wohl vom Habichtswald bis nach Cortina gekommen, hätte nicht der Berufsweg angefangen, dieses Hin und Her von einem Kriegseinsatz zum anderen. Unzählige Kilometer quer durch Deutschland. Bahnsteige, auf denen ich in Regen und Schnee und Hitze auf und ab ging, manchmal in Tränen und manchmal glücklich. Wie viele Kilometer! Doppelt zu zählen, weil meist zu zweien.
Und dann das erste Stück Straße, als wir aus den Bunkern auftauchten. Die Stadt war dem Feind übergeben, und draußen war noch immer der alte Frühling. Im Garten blühten die Mandelbäumchen wie nie zuvor, wie nie danach. Drei Jahre später der Weg unterm Regenschirm zu jener Stelle, an der wir die ersten vierzig Deutsche Mark bekamen …
Wann hat es eigentlich aufgehört, ein Lebenslauf zu sein? Seit wann halte ich es mit meiner Großmutter, der waldeckischen Bauerntochter, die zu sagen pflegte: »Sächtelken! Sächtelken!«, und gehe langsamer, nehme die nächste Straßenbahn?
Eines Tages hoben sich für uns die Schlagbäume. Lebenskilometer jenseits der Grenzen. Reisefieber packte uns, und wie die kleinen Häwelmänner riefen wir: Mehr! Mehr! Mehr! Frankreich, Österreich, Schweiz, Italien, Schweden. Segelpartien auf der Ostsee; Schwimmen im Mittelmeer; mit dem Flugzeug über die Alpen; Flüsse, Berge, Städte, was für ein Reichtum! Man fängt an zusammenzuzählen, denkt, es seien Zahlen, Kilometer, nichts weiter, und ist doch unser Leben.
Noch ist mein Teppich nicht der Kilometerzähler meines Lebenswegs. Aber später soll man einmal auf ihm ablesen können, ob ich ein Stück weitergekommen bin auf jenem Weg, den man nicht mit dem Auto und nicht mit dem Flugzeug zurücklegen kann, dem Weg, den sich der Geist und das Herz suchen müssen.
(1956)
Mit Rucksack und Meßtischblatt
Vom Wandern ist die Rede, nicht vom Spazierengehen. Von Meßtischblättern, Höhenwegen und Rucksäcken.
Will man auf Wanderschaft gehen, dann ist die Wahl des geeigneten Schuhwerks ebenso wichtig wie die Wahl des geeigneten Wandergefährten. Mit beiden muß man sich erst einlaufen, sonst gibt es Blasen an den Füßen oder Blasen an der Seele. Ein Langschläfer sollte sich keinen Frühaufsteher wählen, ein Kilometerfresser keinen Bummler. Die Schrittlänge muß übereinstimmen.
Man kann zu zweit, zu dritt, zu viert wandern; darüber hinaus würde es sich um einen Verein handeln. Jeder Fuß mehr bedeutet die Gefahr einer weiteren Blase an fünf weiteren Zehen, an der dann das Gelingen eines ganzen Wandertages scheitern kann. Es sollte jemand sein, mit dem man singen kann, womöglich zweistimmig. Jemand, der zur selben Stunde hungrig wird, zur selben Stunde Lust verspürt, unterm Holunderstrauch zu rasten, der lieber den Libellen am Bach zusieht als dem Fernsehprogramm im Gasthof. Aber vor allem jemand, dem man es nicht verübelt, wenn er die Gefährtin fünfundzwanzig Kilometer im Kreis herumführt, nach sorgsamem Studium des Meßtischblattes, nachdem er mehrfach den Kompaß zu Rate gezogen und dabei dessen Benutzung eingehend erklärt hat; der zeigt, welche anderen untrüglichen Orientierungszeichen einem noch zur Verfügung stehen, wenn Wanderkarte, Kompaß, Uhrzeiger und Sonne ausfallen, wie man am Wuchs der Bäume und der Bemoosung des Stammes die Himmelsrichtung jederzeit ausmachen kann; einer, der nach Westen geht, in der Annahme, es sei Süden, und deshalb das beim Frühstück verheißene Schlafdorf abends nicht erreicht. Wenn man, erschöpft und verschwitzt, mit schmerzenden Füßen, zu diesem Mann nicht sagt: ›Siehst du!‹, dann ist man die richtige Wandergefährtin.
Als Wanderer müssen Frauen sich noch bewähren, da gilt es, sich zu emanzipieren; vorerst hat der Müller des Wandems Lust für sich allein in Anspruch genommen, die schöne Müllerin ist zuständig für die Forelle nach Müllerin Art, die der Wanderer am Abend verspeist, während ihn die Gefährtin heiter und geistvoll unterhält. ›Kinderwiegen – Sorgen – Last und Not um Brot‹, das hängt den Frauen noch heute an, davon müssen sie sich erst befreien. Eichendorffs Taugenichts war männlichen Geschlechts; auch Don Quichotte dachte nicht daran, seine Dulcinea mit auf die Reise zu nehmen. Die Blumen- und Hippie-Mädchen scheinen lieber zu lagern als zu laufen, auf Wanderwegen trifft man sie nicht.
Es darf nicht jede Wegegablung zu Auseinandersetzungen führen! Zumal dieser Mann gewiß im Krieg bei einer Aufklärungsabteilung oder als Artillerie-Beobachter eingesetzt war, weglose russische Sümpfe durchquert hat und schon als Knabe ein ›Wandervogel‹ war, was ihn noch heute zum Aufspüren von zugewachsenen Waldwegen befähigt. Vertrauen ist unerläßlich!
Beim Frühstück, noch bevor man sein Ei löffeln konnte, breitet er die Generalstabskarte aus, räumt Wurstplatte und Honigtopf beiseite. Er markiert mit einem Bleistift den Weg, den wir vor uns haben, gibt an, welche Höhen es zu überwinden gilt, auf welchen Serpentinen man wandern wird, nur sachte ansteigend, die Anstrengungen des Vortages, mit Rücksicht auf die Gefährtin, meidend. Mittags wird man in der bewirtschafteten Schutzhütte Rast machen, die er jetzt bereits vorsorglich ankreuzt. Für den Abend verheißt er eine größere Ortschaft; er geht, vom Kaffee belebt, so weit, ein Zimmer mit Bad und eigener Toilette zu prophezeien. Keinesfalls mehr als 25 Kilometer an diesem Tag, eher weniger, falls man die möglichen Streckwege wählt… Dann wirft er noch ein Stück Würfelzucker in die gefüllte Kaffeetasse und sagt nach Art und Weise, wie die Luftblasen aufsteigen, das Wetter voraus: ein wolkenloser Tag, wenn die Perlen sich in der Mitte sammeln, bedeckter Himmel, wenn sie auseinanderstreben – es hängt, wie er erklärt, mit Luftdruck und Oberflächenspannung der Flüssigkeit zusammen; einige kleine gewittrige Schauer hält er für möglich. Man nickt zu allem und mißt derweil mit dem Zeigefinger – pro Zeigefinger eine reichliche Wanderstunde – des Tages Mühsal unauffällig aus.
Man hilft einander beim Umhängen der Rucksäcke, und bei der ersten Serpentine sagt unser Feldmarschall nach einem prüfenden, bergaufwärts gerichteten Blick: Hier können wir erheblich abkürzen! Von nun an geht es querfeldein. Das weiße Kreuz, das der zuständige örtliche Wanderverein alle hundert Meter sorglich an einen Baumstamm gepinselt hat, sehen wir nie wieder. Es geht durch Fichtenschonungen, durch Brombeergesträuch und Brennesseln. Und über Viehkoppeln: morgendliches Rodeo mit ein paar jungen Rindern, über Gatter hinweg, unter Stacheldrähten hindurch, Bäche müssen übersprungen oder durchwatet werden, die Schutzhütte erreicht man nie und das für den Abend zugesagte Zimmer mit Bad und Toilette ebenfalls nicht.
Wann Mittag ist, bestimmt unser Feldherr. Die Quelle, die man für diese Stunde herbeisehnt, findet sich nur selten. Das Aufsuchen geeigneter Picknickplätze erweist sich als eine Krisensituation, nicht nur bei Autofahrern, auch bei Fußwanderem. Man ist hungrig und müde, und die Gefahr, bei der ersten Ameise, die auf dem Knie auftaucht, empört: ›Siehst du!‹ zu sagen, ist gegeben. Wegen dieses ›Siehst du!‹ nehmen Männer uns nicht gern mit.
An glücklichen Tagen findet man am sonnendurchschienenen Waldrand eine hohe Buche mit weitem Blick ins Tal. Halbschatten. Man streckt sich, dehnt die von den Rucksackriemen befreiten Schultern, betrachtet den geliebten Schläfer, der sich den Hut aufs Gesicht gelegt hat und bereits friedlich vor sich hin schnarcht, die Hände auf dem Bauch gefaltet. Man selbst blinzelt in die Höhe, wo der Wind in den Bäumen blättert, sieht noch eine Weile den Ameisen zu, die allerlei Baumaterial zu einer unbekannten Arbeitsstelle schleppen. Die Vögel sind zu dieser Stunde einsilbig wie man selbst. Langeweile der allerschönsten Sorte breitet sich aus, und man schläft ebenfalls ein.
Wenn unser Wandersmann sich ausgeruht hat, die Mittagswärme vorüber ist, die Hauptmarschleistung getan, dann hat er seine beste Stunde. Er schnitzt der Gefährtin einen Wanderstock, an dem sie den Rest des Weges zu tragen hat und den sie unbemerkt, ohne den Freund zu kränken, irgendwo stehenläßt. Er schnitzt ihr außerdem noch eine Flöte aus Holunderholz, und sie bläst darauf so recht und schlecht, wie er’s sie lehrt. Kindheitserinnerungen steigen in ihm auf, an eine Zeit, als er acht Jahre alt war und ein Mädchen liebte, das Augen wie Schlehen hatte. Die braunäugige Wandergefährtin erinnert sich an den Jungen, der ihr die ersten Flötentöne beigebracht hat, als sie ebenfalls acht Jahre alt war; sie lächelt und schweigt. Eintracht herrscht.
Jetzt gilt es nur noch, das Nachtquartier auszumachen. Vorausblickende, umsichtige Wanderer rufen unterwegs aus einer Telefonzelle im einzigen Gasthof des Zielortes an und lassen sich zwei Betten reservieren, damit man sich, nörglig und müde, sieben zusätzliche Kilometer erspart. Wer hält sich schon abends an das morgens unbekümmert gesungene ›Und find ich keine Herberg, so lieg ich zur Nacht / Wohl unter blauem Himmel, die Sterne halten Wacht‹? Nur fanatische Fußgänger rufen in Notfällen kein Taxi herbei. Der idealen Wandergefährtin ist jedes Bett recht, wenn sie nur erst einmal auf dem Bettrand sitzen und die Beine ausruhen kann.
Sie muß gut zu Fuß sein, kräftig genug, einen Rucksack zu tragen. Außerdem sollte sie hübsch anzusehen sein, anmutig, wenn sie den Felspfad hinuntereilt. Ein Mann darf in der Mittagshitze das Taschentuch in den Bach tauchen, die Zipfel knoten und sich als Sonnenschutz auf den schwitzenden Kopf legen; seinem Aus- und Ansehen kann das nichts anhaben, das weiß er.
»Was schleppst du alles mit dir herum!« sagt er morgens, aber abends betrachtet er mit Wohlgefallen die frische Bluse und hat gegen die Anwendung eines Lippenstiftes nichts einzuwenden. Nach dem dritten Glas Wein wird er grundsätzlich, sagt: »Wandern! Das ist die menschlichste Art der Fortbewegung! Aus eigener Kraft bewegt der Mensch sich mit einer Stundengeschwindigkeit von vier bis fünf Kilometern vorwärts, wenn es hochkommt, sind es sechs Kilometer. Das entspricht seinem Körpergewicht, seiner Antriebskraft und seiner Aufnahmefähigkeit. Hätte es schneller mit ihm vorangehen sollen, wäre er mit Flügeln ausgestattet worden, oder er hätte vier Beine mit auf den Lebensweg bekommen. Man sieht nicht mehr, als man mit Augen, Ohren, Füßen und Händen wahrnehmen und als Erinnerung in sich bewahren kann! Man lernt eine Landschaft wirklich kennen und lernt sie zu lieben!«
Und dann, wenn auch er der Richtige für sie ist, wird er das Glas heben, seine Gefährtin ansehen und hinzufügen: »Und erst recht den, mit dem man sie durchwandert hat!«
(1963)
Mein amerikanischer Traum
Das Jahr der Weltausstellung in New York, 1964. Der erste Kennedy im Jahr zuvor ermordet, seine Büste in unterschiedlicher Größe, aus Aluminium, Kupfer, Kunststoff und vergoldet in den gift shops zu kaufen; bereits zu herabgesetztem Preis. Aber noch wallfahren die Farbigen zum Arlington-Friedhof bei Washington, gehen in Zweierreihen an Kennedys Grab vorbei; kleine Gräber rund um das seine: die toten Babys der Jacqueline, damals noch eine Jahrhundertwitwe. In einem der Off Broadway-Theater spielt man Albees ›American Dream‹; an der Bovery Genets ›Blacks‹. Von women’s lib ist noch nicht die Rede, an den Universitäten herrscht noch Ruhe. Auch in Berkeley wird unter den hohen Bäumen des Campus noch diskutiert und ernst und gewissenhaft geküßt, ein Sex-Pensum wird erledigt. Sie liegen zu zweien auf dem kurzgeschorenen Rasen, aber die Parole make love not war habe ich nicht gehört. Studenten aus den Nordstaaten reisen bereits zu den Universitäten des Südens, um sich mit farbigen Studenten solidarisch zu erklären; Martin Luther King lebt noch, aber black ist noch nicht beautiful Der Dollar steht noch zur Deutschen Mark im Verhältnis 1:4; die Armutslinie verläuft bei 3000 Dollar im Jahr. Joan Baez singt noch folk-songs und keine protest-songs.
Auf der Überfahrt hatte ich zu lange in Kafkas Amerika-Buch gelesen. Ich kam an und stellte fest, daß ich alle meine Reiseschecks verloren hatte. Was als Alptraum begann, endete wie im Märchen: Innerhalb einer Stunde stellte mir eine New Yorker Bank neue Dollarschecks aus, Reisepaß und Aussehen als einzige Legitimation; die Nachricht, daß die Schecks in meiner Schiffskabine gefunden worden seien, erreichte mich nach zwei Monaten. Ich fuhr mit einer Fahrkarte, die nicht gültig war, von New York nach Cleveland; meine troubles wurden von Aufsichtspersonal, Fahrdienstleiter und Mitreisenden gelöst. Als in North Dakota unser Auto einen Motorschaden hatte und wir ratlos vorm geöffneten Kühler die Betriebsanleitung studierten, hielt der erste und in Stunden einzige Autofahrer an, fragte: »Troubles?«, stieg aus, reparierte den Schaden, sagte: »Hi!« und fuhr weiter.
Wo ihr nutzt, seid ihr zu Hause, heißt es in Goethes Auswanderergesprächen. Auf amerikanisch heißt das: Can I help you? Ich habe den Amerikanern oft Gelegenheit gegeben, mir zu helfen.
Juni in New York! Ich war allein, aber ich fühlte mich nicht in der Fremde. Ich kannte ›Manhattan Transfer‹, und ich kannte den ›Guten Gott von Manhattan‹; im Guggenheim-Museum sah ich eine Van-Gogh-Ausstellung; im Museum of Modem Art ›entartete Kunst‹ des ›Dritten Reichs‹. Ich saß unterm gotischen Gewölbe eines aus Südfrankreich Stein für Stein importierten, sorgsam wieder aufgebauten Kreuzganges und hörte dort gotische Musik. Auf dem Empire State Building entsprachen meine Gefühle meinen Erwartungen. Aber: nach einem Gewitterregen stiegen von den Wolkenkratzern dicke weiße Wolken auf! Das Staunen begann in New York, das Fremdsein begann später.
Ich erinnere mich an den ersten Apfelstrudel, apple-pie genannt, den ich in New York aß; er schmeckte köstlich! Ich bestellte mir in Oregon, in Arizona und Arkansas apple-pie, und er schmeckte jedesmal genauso köstlich, kam aus den verschiedensten Kühltruhen, aber immer von derselben Firma. Ich habe keine anderen als amerikanische Rundfunksender gehört, ich habe keine anderen als amerikanische Zeitungen gelesen. Man reist 800 Meilen täglich und ist immer noch auf demselben Kontinent, spricht immer noch dieselbe Sprache. Die amerikanische Vereinfachung hat eine ungeheure Prägekraft, sie reicht bis ins westliche Europa. Zwei Salatsoßen genügen für einen Kontinent. Man liest ›Reader’s Digest‹ in Virginia und in Idaho. Mir schien, als sprächen die Leute in den drugstores wie die Leute in den TV-Familiensendungen. Die Kinder verhielten sich im Swimming-pool des Motels genau wie die TV-Kinder. Der beste aller daddies begegnete uns jeden Tag mehrmals auf Parkplätzen. Überall ging es TV-nah zu; nie hatte ich den Eindruck, als ginge es auf dem Bildschirm lebensnah zu.
Wir fuhren von Ost nach West, from coast to coast, dann von Nord nach Süd und von West nach Ost und schließlich von Süd nach Nord. Ein großes Quadrat. Ich hatte neue Ausmaße und neue Maße zu lernen, Meilen statt Kilometer, Fahrenheit statt Celsius, Fuß statt Meter, die Gallonen Benzin zahlten wir in Dollar und Cent. Ich hatte vier Monate an Zeit, 10 000 Mark an Geld zur Verfügung, von denen ich 3000 übrigbehielt. Überfahrt, Theater, Kino, Musical, Museen, Nationalparks, Fotomaterial, Benzin, alles ist in der Summe enthalten, nur nicht die Gastfreundschaft. In Europa wird der Fremde nur in armen Ländern als ein Gast angesehen. In den Vereinigten Staaten von Amerika lernten wir die Gastlichkeit eines reichen Landes kennen. Dinners und Cocktailparties zu unseren Ehren. Man nahm uns mit zu Freunden von Freunden von Freunden, bis wir nicht mehr wußten, wieso wir mit wem und wo zu Gast waren. Meet people ist eine Leidenschaft der Amerikaner, wie das Lösen von troubles. Nie zuvor und nie wieder habe ich an Plätzen, die für Picknicks so ungeeignet waren, so vorzügliche Steaks und Hamburgers vorgesetzt bekommen. Barbecue am windigen Ufer des Michigansees, Barbecue unter zweihundertjährigen Zedern auf dem Mount Palomar in Kalifornien; Barbecue unter einem Wasserfall in den Wäldern Tennessees. Für ein Picknick sind 200 Meilen Anfahrt nicht zuviel. Kein Gastgeber erwartet einen Blumenstrauß. Ich schrieb in die Gästebücher Datum und Namen und ›Germany‹ und: ›I like America!‹ Es gibt ein Foto aus Arizona, auf dem ich einen dreimannhohen Kandelaber-Kaktus umarme. Die Stacheln zehn Zentimeter lang, trotzdem nisteten die Vögel darin. ›How I like America‹, schrieb ich darunter. So zwiespältig.
Von New York nach Cleveland (Ohio) nordwärts, mit der Bahn am Hudson entlang; ich blickte aus dem Fenster und gewöhnte mich an ein Land ohne menschliche Ansiedlungen. Mittags sah ich dann einen alten Mann mit weißen Bartstoppeln; er lehnte an einem Oberleitungsmast und spielte die Geige. Und nirgendwo eine Menschenseele, nur der D-Zug, der zweimal täglich in beiden Richtungen vorüberfuhr. Für alle Ewigkeit lehnt der alte Mann in meinem Gedächtnis an dem Mast und geigt. Buffalo! Und ich stieg nicht aus und fuhr nicht an die Niagarafälle, die falls; ich wollte nicht dort sein, wo alle waren. Ich fuhr am Eriesee entlang und dachte an ›John Maynard‹ und an Fontane. ›Noch zehn Minuten bis Buffalo.‹
Der Volkswagen, Exportausstattung, reiste inzwischen auf einem Frachtdampfer durch den Sankt-Lorenz-Strom und traf gleichzeitig mit mir in Cleveland ein. Als ich in Oberlin die Autoversicherung abschloß, studierte der junge Agent meinen Paß und sagte: »Hello, Chris! How are you?« Ich korrigierte ihn. »I’m Mrs. Brückner!« Er sah mich an und grinste. »Yes, Chris!« Unter ›Chris‹ habe ich meine Schuhe zur Reparatur gegeben, als ›Chris‹ wurde ich auf Parties vorgestellt. Ab Cleveland reisten wir zu zweit, also sagte man: »Hi, girls!« Eine junge Professorin für deutsche Literatur am College in Oberlin/Ohio wollte ihrer ehemaligen Autorin beweisen, warum sie Amerika liebte. Wo ich auch stand, atemlos und überwältigt, auf den größten Dünen der Welt am Michigansee, vor den Geysiren im Yellowstone Park, am Crater Lake in Oregon, den die Entdecker den ›sehr blauen See‹ nannten, immer sagte sie: »Es kommt noch schöner, Chris!« Bis wir dann am Grand Canyon standen, da sagte sie: »Ich glaube, jetzt wird es nicht mehr schöner.«
Je weiter wir nach Westen gelangten, um so jünger wurden wir; oft waren wir die Jüngsten. Das lag an den anderen. Das gesellschaftliche, kirchliche und kulturelle Leben spielt sich unter Frauen ab, die jenseits der Sechzig sind, pensioniert und verwitwet, meist beides. Alle priesen sich glücklich, mir begegnet zu sein, aber eine Journalistin statt einer Schriftstellerin hätte sie noch glücklicher gemacht. Fiction war ihnen nicht geheuer, non-fiction lieber. Immer wieder wurde ich gefragt, ob die ›Blechtrommel‹ ein typisch deutsches Buch sei, es war wichtig, daß man das Typische las. Kleine Gespräche, keine Diskussionen. Man sprach ungeniert über sex, aber nicht über Gefühle. ›I like him‹, hieß es, aber das heißt es von jedem. Neue Tabus. Niemand wünschte mit mir über den Tod Kennedys oder das Rassenproblem zu sprechen. Aber es hat mich auch niemand nach Auschwitz gefragt.
Wenn man durch Nordamerika reist, kann man sicher sein, daß man irgendwo in einen Blizzard, einen Tornado oder Hurrikan gerät. Den Hurrikan bekam ich auf der Rückreise. ›Elise‹ hieß er, und die ›Bremen‹ wich ihm bis zu den Neufundland-Inseln aus; unseren Tornado bekamen wir im Staate Michigan. ›Gefährliche Wirbelstürme in Nordamerika, örtlich und zeitlich begrenzt‹, meine Erfahrungen bestätigen diese Angaben. Wir saßen beim Dinner in einem kleinen Cottage unter riesigen Bäumen am Green Lake, verängstigt, aber lächelnd, wie unsere Gastgeberin. Der Tag wurde plötzlich zur Nacht, der Wind zerriß Blätter, zerbrach Äste, peitschte das Wasser des Sees auf, entwurzelte einen Baum, der das benachbarte Cottage in zwei Teile zerlegte. Es war unbewohnt. Heiliger Sankt Florian! Eine halbe Stunde später badeten wir bei Sonnenschein im See, sahen dem Kolibri zu, der flügelschwirrend am Honigtopf nippte. Tornados, aber auch Kolibris. Übertreibungen und Widersprüche.
Was für reizende Nachbarn aus Detroit und Cleveland lernten wir kennen; alle hatten sich Ferienhäuser an den Seen gebaut. Sie fällten ihre Bäume eigenhändig, hackten das Holz selbst, malten die Bilder selbst, ein einfaches, ein Do-it-yourself-Leben. Sie hatten sich gerade zu einem Club zusammengetan, der verhindern sollte, daß Juden und Farbige in ihr schönes Reservat eindrangen und die Harmonie störten. Sie waren einsichtig in der Neger-Frage, wie alle Amerikaner der Nordstaaten, aber sie besaßen Haus und Grundstück. Zögen Juden zu, so sagten sie, würden diese spekulieren und die Grundstückspreise hochtreiben, zögen Neger zu, entständen Slums. Die Vorurteile sind alt, die Erkenntnisse erst neu.
Die schwarzen Vögel heißen blackbirds, die blauen Vögel bluebirds, die hochbeinigen Vögel, die im Süden über die Straßen rennen, road-runners; das lernt sich leicht, das behält sich leicht. Man erkennt Schwalben und Rotkehlchen und Stare wieder, aber alle Vögel um das Eineinhalbfache größer, die Schmetterlinge sogar doppelt so groß, jedes Ahornblatt größer, dem größeren Kontinent entsprechend. Michigan, Wisconsin, Minnesota: eine Vergrößerung Skandinaviens ins Endlose. Wälder, Seen, Weiden, die braunroten Häuser der Farmer: alles wie in Schweden. North Dakota. Dieser erste Tag in der Prärie! Überwältigende Weite. Überwältigende Einsamkeit. Man ist unterwegs, on the road, Mittlerer Westen. Eroberergefühle noch im Volkswagen. Schnurgerade, kaum befahrene Asphaltstraßen, von denen manchmal ein markierter Indianerpfad abzweigt. Steine, schütteres Gras, graublaues Salbeigesträuch. Am Horizont schon die Rocky Mountains, die sich immer weiter entfernen, je mehr man sich ihnen nähert. Alle paar Stunden eine verstreute Rinderherde, struppige Hereforder, wenig empfindlich gegen Hitze und Kälte. Ein verendetes Pferd am Straßenrand und hie und da am Himmel ein einmotoriges Flugzeug: der Cowboy beaufsichtigt seine Herde. In angemessener Entfernung von der Straße ein Atommeiler. Pelikane um einen Wassertümpel; Antilopen, die in großen Sprüngen vor uns davonjagen.
›Enjoy beaf every day‹ stand an den Stacheldrahtzäunen, hinter denen die Rinder grasten. Wenn ich mein Steak aß und wenn ich dem Stierkampf in Tijuana in Mexiko zusah, hatte ich das Schild vor Augen: Enjoy beaf every day! Nie habe ich frühstücken müssen, ohne daß man mich gefragt hätte, wie ich mich heute fühlte, und ich fühlte mich an jedem Morgen fine, und wenn ich mich vergewissert hatte, daß sich auch die Miss hinter der Frühstücksbar fine fühlte, bekam ich meinen Kaffee eingegossen. Frühstück zwischen Fernfahrern, deren Spezialfrühstück zwei Dollar fünfzig kostete. Ein halbes Pfund Schinken, fünf Spiegeleier, ein Pfund Kartoffelchips, ein Viertel-Pfund-Brot, zwei heiße Kuchen und zwei Liter Kaffee. Ich habe die Wohltat der Motel-Ketten erfahren. Best western motels! Die gleichen Zahnputzbecher an der gleichen Stelle, der gleiche hygienisch versiegelte Toilettensitz. Man findet sich, schlaftrunken, leichter zurecht, kennt die Schalter am Fernsehgerät und die Mechanik der Betten, in denen wir uns für einen halben Dollar aufrütteln lassen. Morgens hört man als erstes aus dem Radiogerät, daß dies eine ›wonderful wonderful world‹ sei – Reklame für Salem-Zigaretten.
500 Meilen am Tag, 800 Meilen am Tag, und die Traummeilen nicht gezählt, Weiterfahren im Schlaf, Alptraumkilometer auf zwölfspurigen Highways. Süd-Dakota, die Bad Lands, das Jagdrevier Roosevelts; einer der halbtrockenen Staaten, nicht einmal ein Bier zum Essen. Das junge Mädchen, das uns bedient, schaut uns unausgesetzt zu, sie hat noch nie einen Ausländer gesehen, nie eine fremde Sprache gehört. Wir erkundigen uns bei ihr, ob wir als Frauen nebenan in der Bar wohl einen Whiskey trinken könnten, und sie sagt: »Ifyou have the age.« – Falls wir das nötige Alter haben. Es liegt bei zwanzig. Die Sitzbänke der Bar waren mit Rinderfellen bespannt – enjoy beaf every day –, an der Bar lehnten Cowboys, den breitkrempigen Hut im Nacken, die Linke am Colt und in der Rechten das Whiskeyglas. Die Realität hielt sich an die Western-Filme. In der Feme schlugen Blitze in die roten Felswände und sprengten Teile davon ab. Wolkenbrüche. Das Auto bis zu den Achsen im Schlamm. Wieder einmal konnte man uns helfen. Hilfe ja, Flirt nein. Frauen zahlen dort nicht mit einem Lächeln. Einer der Unterschiede zu Europa.
Die blühenden Fliederhecken! Nichts sonst aus Montana. Aber Karl-May-Erinnerungen. Der Yellowstone River führt Hochwasser; der Weg zum Staat Washington ist versperrt. Wir ändern die Route, fahren zum Yellowstone-Nationalpark, ein Island auf kleinstem Raum. Die Erdoberfläche glasiert durch die Ausscheidungen der Geysire, die gefährlich brodeln und sich pünktlich in zischenden Fontänen entladen. Die Natur bewacht und gegen Eintrittspreise zu besichtigen. Jahrhundertelang hat sich der Mensch gegen die Natur zu schützen gesucht, jetzt muß die Natur vor ihm geschützt werden. Er genießt ihre Gefahren, füttert vom Auto aus die Grizzlybären, deren Junge hoch in den Bäumen herumturnen. Wir könnten mit dem Schlauchboot sechs Tage lang im Grand Canyon durch die Strudel des Colorado River fahren. Organisierte Abenteuer. Reise gefährlich!
Wir stiegen durch die Mondkrater in Idaho: schwarze Lavaschollen, als hätte ein Herkules hier gepflügt. Erste, noch blattlose Vegetation, gelbe und weiße Blüten ohne Stiele. So muß es im Frühling auf dem Mond aussehen; noch wußten wir es nicht besser. Neben dem Adlernest stand weiß auf schwarzem Felsen: ›Jesus liebt dich! Und du?‹ Das tat seine Wirkung, wurde oft genug und an aufschreckenden Plätzen wiederholt. In einer Stadt im Staat Oregon wollten wir sonntags zur Kirche gehen; es gab 93 verschiedene Sekten, da ließen wir es sein.
Juni-Sonne und Juni-Schnee in der Sierra Nevada! Wir sahen Lachse von einer Staustufe zur nächsthöheren springen. Wir fuhren durch einen der Mammutbäume in Nordkalifornien, wir erreichten bei Eureka das Meer. Der Kontinent durchquert: Eureka! Von nun an südwärts, nach San Francisco, Los Angeles, San Diego, auf der Straße 101; von den Amerikanern One-O-One, von Hans Dominik ›die Traumstraße der Welt‹ genannt. Eine Woche San Francisco! Bei Sonnenuntergang im ›San Francis‹ gesessen, hoch über den 29 Hügeln, auf denen die Stadt erbaut wurde. Das erste Bad im Pazifik bei Malibu, nicht weit von Los Angeles. Die Wellen trafen mich mit ozeanischer Kraft, warfen mich um; bevor ich den Kopf wieder über Wasser hatte, faßte mich schon die nächste Welle, bis mich die übernächste dann an Land warf, wie Strandgut. Wir suchten in Pacific Palisades den San Remo Drive auf, standen vor dem Haus, in dem Thomas Mann von 1941 bis 1952 lebte; ein junger Mann mähte den Rasen, den Namen Thomas Mann hatte er nie gehört. Big Sur, auf der waldigen Steilküste des Pazifik gelegen, aber Henry Miller weilte gerade in Europa. In Sun Valley/Idaho am Grabe Hemingways …
Auf Catalina Island machten wir Ferien von den Ferien. Ich zog die erste Bilanz. Nord-Amerika: ein Land ohne Zäune, ohne Mauern, ohne besitzanzeigende Hecken; eingezäunt einzig das Vieh auf den unermeßlichen Weiden der Prärie. Keine Begrenzungen für den Menschen, für sein Haus und seinen Garten. Das Gefühl für ›mein‹ und ›dein‹ schwächer ausgebildet. Man ist noch nicht seßhaft geworden, alles ist noch austauschbar. Man benötigt ein Haus nur zum Wohnen, nicht, um sich zu Hause zu fühlen. Das Gartentor stellt kein Symbol dar. Ein Stuhl ist ein Stuhl, es gibt am neuen Ort ebenfalls Stühle, vielleicht sogar neuere und bequemere; man läßt den alten zurück, zieht weiter, wenn ein neuer Job neue Chancen bietet. Bis man dann in Kalifornien das Lebensziel erreicht hat. Der Weg nach oben ist der Weg in den Westen. In Kalifornien wird der amerikanische Traum erfüllt. Ein Cadillac- und Swimming-pool-Glück unter Palmen, überall ist Disneyland. Das ganze Jahr Sonne. Die Wüste auf der einen, das Meer auf der anderen Seite. Mehr als Wasser braucht es nicht, um aus der Wüste ein Paradies zu machen, in dem die Rosen ohne Unterlaß blühen und die Zitronen das ganze Jahr reifen. Die Rasensprenger sprühen ohne Unterlaß. Schon im August wirkten die Geranien erschöpft.
Kein Gitter auf dem Friedhof, kein Erbbegräbnis, statt dessen Nummern oder Namensschilder im Rasen. Der Mensch stirbt, wird präpariert und geschminkt, bis er zum letzten Mal dem Idealbild des erfolgreichen Amerikaners entspricht. Dann begräbt man ihn, dann ist alles vorbei. Laßt die Toten ihre Toten begraben, der Blick geht in die Zukunft, das Paradies liegt nicht hinter einem, sondern vor einem; man ist nicht verstoßen, sondern nur noch nicht angelangt, aber bereits auf dem besten Wege. Es wird immer noch schöner! Die Vorfahren sind eingewandert, um ihr Glück zu machen. Mit diesem Anspruch auf Glück sind sie alle gekommen, die ersten und die letzten, nicht nur die Goldsucher. Sie kamen mit Erwartungen und mit Vorsätzen, halb Kreuzritter und halb Glücksritter. Der amerikanische Traum, tausendfach auf Einwandererschiffen und in Flugzeugen geträumt, heißt happiness, und Glück bedeutet Reichtum. Auf dem Silberdollar steht: ln Gold we trust…
Nein, das steht natürlich nicht darauf, sondern In God we trust. Ein Land, in dem für den Reisenden gebetet wird. Bei den Mormonen, den ›Heiligen der letzten Tage‹, in Idaho Falls, schloß man uns, die sisters, in die Arme und ins Gebet ein. In der lutherischen Kirche von San Diego wurde ich im Gottesdienst namentlich der Fürbitte der Gemeinde empfohlen. Auf dem Altar stand das Abendmahlgerät: ein flacher silberner Kelch, in dem kleine Kunststoffbecher standen, jeder mit Wein gefüllt. ›Nehmet hin und trinket alle daraus‹, ein hygienisches amerikanisches Abendmahl. Das ›Selig sind …‹ der Bergpredigt wird mit happy übersetzt. Die himmlische Seligkeit scheint vom irdischen Glück nicht allzuweit entfernt; kein eigenes Wort für selig, immer nur happy, immer nur fun, immer nur enjoy it! Aufforderung zum Genuß. Nichts wird verkauft ohne einen zugehörigen aufmunternden, glückverheißenden Werbespruch; daran waren wir noch nicht gewöhnt. Man hat mich niemals allein gelassen, in keinem Livingroom, in keiner Hotelhalle, immer kam jemand und hat gefragt, ob ich denn auch nicht krank sei, so ganz ohne Fernsehen oder Radio …
›Menschen, die das Tragische des Lebens derart verdrängen – welche Neurosen mögen sich in ihnen bilden bei der Frage nach dem tieferen Sinn des Lebens? Psychoanalyse ist kein Stoff für Lustspiele, sondern für Tragödien.‹ Bedacht und notiert, lange vor Watergate …
Auf einem der schönsten Hügel San Franciscos steht Christoph Columbus, überlebensgroß, aus Aluminium, den Arm ausgestreckt, ein neuer Polykrates: Dies alles ist mir untertänig. Ein Kontinent ist entdeckt, erobert, ausgebeutet; die Wälder gerodet, die Büffelherden vernichtet, das Gold geschürft, die letzten Indianer in reservations zusammengepfercht. Was nun? Worauf richtet sich der Blick des Columbus? Auf den Mars, auf den Mond oder zurück auf den Kontinent, auf jene Gebiete, die man anfängt die unterentwickelten zu nennen? Die Amerikaner haben die Grenzen ihres Kontinents erreicht, sie werden lernen, daß auch der menschlichen Natur Grenzen gesetzt sind. Vielleicht werden sie aufhören zu verschwenden, vielleicht werden sie Bäume pflanzen und Zäune ziehen; sie werden seßhaft werden und lernen, daß man pflegen muß, was man erobert hat. Und in einer fernen Zukunft wird dann in God’s own country jeder vor dem Gesetz und vor dem Leben gleich sein, die Reichen und die Armen, die Weißen und die Schwarzen, wie es die vorbildliche Verfassung will, dieses Musterstück für die Schulbücher Europas. Ohne Optimismus kann man an die Zukunft nicht denken, sonst bleibt alles ein amerikanischer Traum.
Wir sind in Hollywood über den Sunset Boulevard gefahren, wir haben in der südkalifornischen Wüste im Salton Sea gebadet, bei einer Lufttemperatur von 45 Grad und einer Wassertemperatur von 36 Grad, und wir haben um Mitternacht im gekühlten Swimming-pool gesessen, wenn die Sterne tief herunterhingen und die Wüstennacht illuminierten. Wir sind mit Hilfe von Strickleitern auf Palmen geklettert, um uns Datteln zu pflücken; wir haben in den Rocky Mountains an Hand einer Autokarte einen 3500 Meter hohen Berg bestiegen, den Chalks River als Wegweiser zum Grizzly Lake benutzend, in Turnschuhen und ohne Proviant; wir trafen dort zwei Lachsfischer an, sie bestaunten die Leistung unserer Beine und wir die Leistung ihres Jeeps. Wir sind in die heißen Quellen am Mount Princeton getaucht… Die Natur übertreibt maßlos, und man selbst überschätzt sich ständig, ist drauf und dran, ein Pferd zu besteigen und sich einer Reitergruppe anzuschließen, die, weglos, die Wildwasser und Wildwälder der Rockies durchquert. Wir fahren in die von den Menschen verlassenen Goldgräberstädte und sehen die berühmten Saloons. High noon und großer Bluff an Ort und Stelle. Eines Nachts sitzen wir im Auto-Kino und sehen die West-Side Story, trinken Cola dazu, essen Popcorn, auf dem Rücksitz schlummert das Baby von Freunden von Freunden …
Wir durchqueren Oklahoma, alle Wagenfenster geöffnet, und singen: »Oh, what a beautiful mornin’, oh, what a beautiful day.« Warum nicht nach Texas? Ein Abstecher von 800 Meilen schreckt uns nicht mehr, unsere Reiseroute gleicht einer Fieberkurve. Ein Basketball-Spiel unter Palmen, bei Flutlicht nach Mitternacht, wenn es kühler wird; ein Rodeo in Colorado Springs, ein Reitturnier in Del Mar. Indianer-Reservationen, Indianer-Shops zum Einkaufen von Indianerkunst und -kunsthandwerk. Ein Sandsturm bei Santa Fé. Die Palette der Painted Desert…
Auf einer Ansichtskarte, die ich nach Hause schrieb, steht: ›Tage in der Wüste oder in der Prärie, da schrumpfe ich auf die Ausmaße einer Ameise zusammen. Nachts liege ich in meinem Motelbett und zähle die Staaten zusammen, in denen ich schon gewesen bin, Ohio, Michigan, Wisconsin, Oregon, Idaho … Jetzt sind wir in Arizona. Und dann zähle ich die Staaten zusammen, durch die wir noch reisen wollen, von New Mexico bis Virginia, und zuletzt die Staaten, die wir nicht sehen werden, Hawaii beispielsweise, aber warum nicht Hawaii? Das eine Mal errechne ich 47 Staaten, das andere Mal 53, nie aber fünfzig. Jede Meile führt uns jetzt wieder ostwärts-heimwärts. Noch nie war ich so weit fort! Bei allem, was ich sehe, habe ich das Gefühl: Hier komme ich nie wieder hin.‹
Ich erwarb für 35 Cents im Drugstore ein Puzzle-Spiel, das, zusammengesetzt, die Vereinigten Staaten von Amerika ergab, ich warf die Staaten durcheinander: Alabama, Oklahoma, Tennessee und vereinigte sie aufs neue auf meiner Bettdecke. Die Sonne ging überm Grand Canyon unter, und der volle Mond stieg überm Grand Canyon auf. Ich war überwältigt. Beethoven! Immerwährende Pathétique! Ich gab mich geschlagen, dieses Land war zu großartig für mich. Ich glaubte nicht mehr, was ich sah. Ich notierte: ›Was für ein unermeßlich reiches Land! Nicht nur an Gold und Uran, an Weizen, Erdöl, an Mais, Rindern und allem, was sonst noch Dollars bringt, sondern auch reich an Schönheit und Einsamkeit.‹ Wir glaubten noch den Erdölpumpen auf den Weiden in Oklahoma und Texas, die neben den friedlich grasenden Rindern friedlich und unermüdlich Öl stampften. Am Hooverdamm haben die reichen Amerikaner den armen Mexikanern das Wasser abgegraben. Auf einem Truppenübungsplatz der Navy Air Force starteten und landeten Düsenkampfflugzeuge auf Flugzeugträgern, deren Oberdecks im Sand der Wüste aufgebaut waren. Wir saßen auf einem Raddampfer und fuhren auf dem Mississippi, und in der Hotelhalle in Memphis sang abends ein schwarzhäutiger Musikprofessor Spirituals, als letztes: ›Ol’ man river‹. In einem Atomzentrum in Tennessee besichtigten wir auf der Tierversuchsstation die Strahlenschäden an Ratten und Mäusen und Meerschweinchen.
Little Rock und Chattanooga!
Trockene Hitze, feuchte Hitze. Im Dunkel einer Nacht sahen wir die weißen Kapuzenmänner des Ku-Klux-Klan, irgendwo in Tennessee. Diese grüne Wildnis von Tennessee, die alles mit Geißblatt, Teufelszwirn und Hopfen einspinnt. In den Bayous moderten die Bäume im Brackwasser. Die Smoky Mountains, die Blue Mountains. Immer wieder Höhepunkte. Dann die Rückkehr in den Osten, auf historischen Boden. In Williamsburg, einem Museumsstädtchen nahe der atlantischen Küste, sagte der Besitzer eines Lokals zu uns, daß in sein Restaurant jeder kommen könnte, auch Juden, sogar Deutsche! Aber keine Farbigen! Ich habe mich auf dieser Reise selten gefürchtet, aber oft geschämt, wegen meiner Hautfarbe und meiner Nationalität.
Nirgends war der Boden so heiß wie in Washington. Weißes Haus, Kennedys Grab und Library of Congress, die größte Bibliothek der Welt! Ich suchte in den Karteikästen nach meinem Namen und fand mich wieder. Sehnsucht nach dem Schreibtisch mischte sich mit Reisemüdigkeit.
Ich brachte einen Tonkrug aus Mexiko mit, ein Indianer-Armband aus Arizona, eine Handvoll Pecan-Nüsse aus Tennessee, ein Büschel selbstgepflückter Baumwolle aus Alabama, Muscheln vom Pazifik: rund und flach und wie ein Dollar gezeichnet.
Mehr als zwanzigtausend Meilen in drei Monaten; ein Amerikaner braucht dafür zwei Wochen, allenfalls. Ich hatte am Ende nicht mehr ›I like America‹ in die Gästebücher geschrieben, sondern ›1 love America!‹. Ich war ausgezogen, um einen Kontinent zu erobern, ein Kontinent hatte mich erobert. Ich hatte beabsichtigt, ein Amerika-Buch zu schreiben, ich habe es nicht geschrieben. Ich brachte viele hundert Bilder von Amerika mit, die kein Amerika-Bild ergaben.
Was eine Reise wert gewesen ist, erfährt man erst lange nach der Rückkehr. Ihre Erinnerungsträchtigkeit. Wie oft bin ich im Traum zurückgekehrt! In den Büchern, die ich seither geschrieben habe, taucht Amerika immer wieder als Schauplatz auf. Nie war ich seitdem so sehr ›auf Reisen‹, nie wieder bin ich so unbekümmert, so selbstverloren der Verlockung der Fernstraßen gefolgt, nie wieder habe ich so zeitlos gelebt, habe die Jahreszeiten in wenigen Tagen gewechselt, aus dem Schnee in die Sonne der Sierra Nevada und in die Wüstensonne von Arizona. Ich war eine Reisende ohne anderen Beruf, ich hörte auf zu schreiben, kein Wort mehr. Ich nahm nur noch auf, jeder Augenblick, jeder Atemzug: Amerika. Bis zur Erschöpfung.
(1964)
Mein Sommertheater
Hier kommt es auf Pünktlichkeit nicht an. In meinem Sommertheater wird nonstop gespielt. Die Mitspieler kommen und gehen, und auch die Zuschauer kommen und gehen. Man spielt ohne Vorhang, bei offener Bühne; an der linken Seite wird sie von einem rosafarbenen Hauswürfel begrenzt, die Türöffnung ist mit bunten Kunststoffbändern verhängt. Die Hälfte des Schauplatzes liegt im Schatten eines Maisstrohdaches. Im Vordergrund bildet eine Gasse den Orchestergraben zwischen Zuschauerraum und Spielraum. Rechts befindet sich ebenfalls eine Gasse, zu der eine schmale Steintreppe hinunterführt. Für überraschende und wirkungsvolle Auftritte und Abgänge ist gesorgt. Im Hintergrund ergibt das flache Dach eines blaugetünchten Hauses eine weitere, um zwei Meter erhöhte Spielebene. Die beiden Spielflächen sind durch eine Treppe miteinander verbunden. Den Prospekt bildet das blaue Meer, den Rundhorizont der wolkenlose Himmel.
Ich bin abonniert auf einen Logenplatz, sitze ein wenig erhöht und bin von der Hauptbühne durch die Gasse und noch ein Höfchen getrennt, aus dem der Geruch von Hühnerstall und Oleanderblüten aufsteigt. Ich rücke mir je nach Gefallen meinen Stuhl in die Sonne oder in den Schatten. Eine Lautsprecheranlage erübrigt sich, die Stimmen der Spieler sind tragfähig. Man spricht ›con voce forte‹; die lebhafte Gestik trägt zur Verständlichkeit des Stückes bei. Man spielt neoveristisch, ohne Verfremdung, kein Understatement. Happening auf italienisch, gelegentliches Mitspiel der Zuschauer ist durchaus erwünscht.
Während der Morgenvorstellung frühstücke ich, rauche eine Zigarette, lese die Zeitung von vorgestern. In früheren Zeiten hat das Publikum im italienischen Theater ebenfalls gevespert, gelesen, sich unterhalten.
Über die gesamte Bühne sind zu dieser Stunde gelbe Plastikleinen gespannt, an denen Hosen beiderlei Geschlechts in unterschiedlichen Größen und Farben zum Trocknen aufgehängt sind. Zunächst flattern sie noch im Morgenwind, später, wenn der Wind sich legt, hängen sie schlaff herunter. Über dem Strohdach bildet eine pompöse Fernsehantenne einen empfindlichen Kontrast zur zeitlosen Einfachheit des Bühnenbildes.
Den ersten Auftritt hat Angela, auf allen vieren, in hellblaues Perlon gekleidet, die Pumphöschen bis ans Knie hinuntergerutscht. Angela heißt sie, aber auf diesen Namen hört sie nicht, sie hört auf keinerlei Zuruf, krabbelt unbeirrt weiter, auch wenn ein mehrstimmiges »Angela! Angela!« aus dem Inneren des Hauses ertönt. Unter Schwierigkeiten richtet sie sich an der niedrigen Mauer auf. Die Geheimnisse ihrer weiblichen, kaum mehr als einjährigen Existenz werden sichtbar. Hier wird nicht schwedisch, sondern italienisch gewindelt. Man befindet sich in einem Land, wo Wäschewaschen noch zu den Tugenden der Frauen zählt. Hier gibt es täglich, nahezu stündlich irgend etwas auszuwaschen. Angela ist wie alle kleinen italienischen Mädchen bereits eine fix und fertige Frau, in winziger Ausfertigung. Sie hat das Zeug zu einer Sophia Loren, man sieht das an der Art, wie sie ihr kleines Hinterteil mit dem Windelpaket schwenkt. Aber man erkennt ebenfalls schon die Nonna in ihr, die künftige Großmutter.
Die derzeitige Nonna bezieht in diesem Augenblick ihren Platz an der Hauswand. Dort wird sie für die Dauer des Stückes sitzen bleiben, gelegentlich den Perlmuttfächer in Bewegung setzen, dann und wann eine der Katzen verscheuchen, die aus Angelas Futternapf naschen wollen, oder auf Gigi weisen, den vierjährigen Star des Ensembles. Die Nonna ist beleibt, schwarz gekleidet, und zwar, im Gegensatz zu allen anderen Mitspielern, vollständig; sie sitzt auf einem unbequemen Strohstuhl und rückt im Laufe des Tages dem Schatten nach, wie eine Schattenuhr. Von der jungen Mamma wird vorerst nur ein runder gebräunter Arm sichtbar, der eine blaue Plastikschüssel mit Waschwasser schwenkt und in hohem Bogen über die Mauer entleert; zwei Katzen stieben davon. Da nur eine einzige Schüssel entleert wird, ist anzunehmen, daß sich die ganze Familie darin gewaschen hat. Peppino, er muß bereits fünf Jahre alt sein, kommt bar- und leichtfüßig über die Terrasse gelaufen und erreicht die Treppe zur Gasse, ohne daß die Nonna ihn bemerkt. Er kehrt schon bald mit einem Eistütchen zurück, von dem es weiß und rosa über seine dünnen Arme rinnt. Limoneneis und Erdbeereis. Für ein ›gelato‹ ist es nie zu früh am Tag.
Jetzt tritt die Mamma auf. Das Auffallendste an ihr ist der verheißungsvoll gewölbte Bauch. Sie trägt einen Napf in der linken Hand und fängt mit der rechten die kleine Angela ein, klemmt sie sich zwischen Hüfte und Unterarm, damit sie ihr nicht entwischt, und setzt sie auf die Mauer, um sie abzufüttern. Peppino stellt sich daneben. Die Mamma löffelt abwechselnd den Brei in den einen und in den anderen Mund.