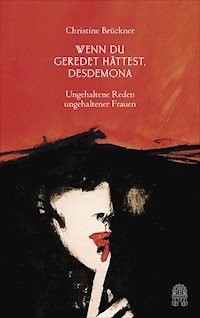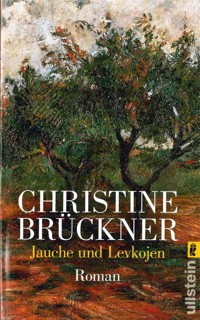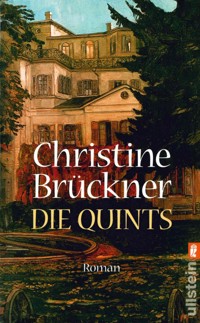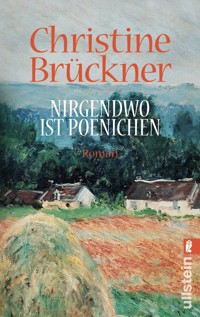6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Refinery
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Was ist schon ein Jahr!" Wie eine Zauberformel wiederholt das junge Mädchen, das für ein Jahr nach Amerika verschwindet, ihrem Liebsten gegenüber diesen Satz. Er soll ihn trösten, ihrer Liebe versichern und ihm den Abschied etwas leichter machen. Aber nach einem Jahr ist nicht nur für sie alles anders gekommen als damals gedacht. Alltägliche Begegnungen zwischen Menschen, in denen sich Zeitgeschehen aufs Exemplarische reduziert, werden in diesen frühen Erzählungen von Christine Brückner geschildert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 236
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Die Autorin / Das Buch
Titelseite
Impressum
Was ist schon ein Jahr
Bella Vista
Frau Marcellus prüft die Marktlage
Eine Krankengeschichte
Ein Mann ohne Phantasie
Am Neuen Wall 81
Eine Liebesgeschichte
Die Untat des Jochen Fauling
Frau Zanders seriöse Lebensberatung
Death is so permanent
Blaue Hyazinthen
Das Begräbnis der Filomena
Begegnung am Fünfundzwanzigsten
Geburtsort Kassel
Heinrich Grebe, Immobilien
Theaterleidenschaft
Geboren am 24. Dezember 1945
Von Christine Brückner sind bei Refinery erschienen:
Die AutorinChristine Brückner (1921 - 1996) zählt zu den renommiertesten Schriftstellerinnen Deutschlands. Sie verfasste Romane, Erzählungen, Kommentare, Essays, Schauspiele, auch Jugend- und Bilderbücher. Besonders mit der Poenichen-Trilogie wurde sie einem großen Publikum bekannt. Mehr über Christine Brückner erfahren Sie über die Stiftung Brückner-Kühner unter http://www.brueckner-kuehner.de/.
Das Buch
»Was ist schon ein Jahr!« Wie eine Zauberformel wiederholt das junge Mädchen, das für ein Jahr nach Amerika verschwindet, ihrem Liebsten gegenüber diesen Satz. Er soll ihn trösten, ihrer Liebe versichern und ihm den Abschied etwas leichter machen. Aber nach einem Jahr ist nicht nur für sie alles anders gekommen als damals gedacht. Alltägliche Begegnungen zwischen Menschen, in denen sich Zeitgeschehen aufs Exemplarische reduziert, werden in diesen frühen Erzählungen von Christine Brückner geschildert.
Christine Brückner
Was ist schon ein Jahr
Refinery by Ullsteinwww.ullteinbucherlage.de/verlage/refinery
Neuausgabe bei Refinery Refinery ist ein Digitalverlag der Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin Oktober 2017 (1) © Ullstein Heyne List GmbH & Co. KG 2003 © Verlag Ullstein GmbH, Frankfurt/M - Berlin 1984 Covergestaltung: © Sabine Wimmer, Berlin ISBN 978-3-96048-090-7 Hinweis zu Urheberrechten Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben. In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Was ist schon ein Jahr
Ich trat meine zweite Amerikareise im Spätsommer an. Nie sei New York und New England so strahlend wie im Herbst, sagten meine Freunde. Im Oktober vor allem, wenn der erste Nachtfrost das Laub des Ahorn verbrannt hat. Wenn die Temperaturen sinken und das Temperament der New Yorker steigt. Alle sind aus den Ferien zurück, verjüngt, verschönt. Alles beginnt neu: die Schulen, die Colleges, die Universitäten, Theater, Konzerte. Ich freute mich. Zumindest überwog die Freude den Schmerz des Abschieds.
Ich brachte die Prozedur der Einschiffung in Bremerhaven diesmal ohne den Beistand von Freunden oder Verwandten hinter mich. Das stundenlange heitere Herumstehen macht mich nervös, verdirbt alles. Ich hatte den Abschied hinter mir.
Am Morgen der Abfahrt kam ich so spät wie möglich am Hindenburgkai an. Ich gehörte zu den letzten Passagieren, die eintrafen, und wurde höflich getadelt. Trotzdem dauerte es bis zur Abfahrt noch annähernd drei Stunden.
Der Tag war strahlend. Die Menge festlich. Das Schiff war ausgebucht. Über tausend Passagiere und gut und gern noch einmal tausend, die Abschied nahmen. Gelächter und Tränen. Umarmen und Küssen, wohin man nur sah. Tücher wurden vorgezeigt, Hüte geschwenkt, mit denen man von Land und Bord aus winken würde, sobald das Schiff abgelegt hatte und man sich unweigerlich voneinander entfernte. Nervosität und krampfhafte Heiterkeit und hundertfache Wiederholungen. Kaum einer, der allein war wie ich. Fast bereute ich es. Es war provozierend. Mitleidige Blicke streiften mich. Kein ruhiger Platz auf dem Schiff, wo man ein Buch hätte lesen, ein paar Zeilen hätte schreiben können. Die Liegestühle auf den Decks hatten noch keine Auflagen. Man konnte sich allenfalls aufs blanke Holz setzen, was einige taten, um das erste Sonnenbad zu nehmen.
Sehr bald schon fiel mir ein junges Paar auf. Beide vermutlich Anfang Zwanzig. Ihre Hände ließen sich nicht los. Ob sie nun hin und her gingen oder voreinander stehen blieben, immer Hand in Hand. Sie redeten atemlos aufeinander ein. Kleine törichte Sätze. Zunächst war mir das Mädchen aufgefallen. Knabenhaft schmal, leichtfüßig, das Haar kurz geschoren, tiefbraun. Zwei, drei Locken fielen ihr manchmal in die Stirn, dann blies sie sie unwillig zurück. Große, ein wenig zu weit vorgewölbte Augen mit schön gebogenen Wimpern. Sobald sie den Mund auftat, blieb sie stehen, als könnte sie nicht zugleich gehen und sprechen. Bei Schauspielschülern beobachtet man das oft. Sie überqueren die Bühne, nehmen ihre Position ein und sagen ihren Text auf. Dasselbe bei diesem jungen Mädchen zu sehen erheiterte mich.
Der junge Mann gefiel mir nicht. Er war zu robust für das Mädchen. Er sprach hessische Mundart, Offenbach vermutlich. Ich dachte darüber nach, wie dieser Mann sein mochte, wenn er nicht unter dem besänftigenden Einfluß des Mädchens stand. Krawatte und Haarschnitt, Schuhe, alles schien mir zu auffällig, schien mir ein wenig vulgär, war aber wohl nur betont modisch. Nach einer Stunde wußte ich über die beiden ziemlich Bescheid. Er nannte sie »Rehlein«, was gut zu diesem braunäugigen Mädchen paßte. Demnach hieß sie Renate. Ihre Eltern waren gegen diese Verbindung, er war ohne deren Wissen zum Abschied nach Bremerhaven gekommen. Das Mädchen ging für zwei Semester nach USA. Sie hatte ein Stipendium. Madison. Ich erinnerte mich, den Namen bei meiner ersten Amerikareise schon gehört zu haben. Im Staate Wisconsin. Mittlerer Westen also. Ein kleiner Ort in der Nähe des Michigansees. Der Mann schien so etwas wie ein Programmierer zu sein, es war von Elektronik die Rede. Kein Mathematiker, vermutlich eher ein Techniker.
Gegen elf Uhr ging eine Welle freudiger Erregung über das Schiff. Ausrufe hier und da. Tausende von Marienkäferchen ließen sich auf uns nieder, saßen auf bloßen Schultern, setzten sich ins Haar. Einer las sie vom anderen ab, zeigte sie vor, zählte die schwarzen Tupfer. Alle hielten es für ein glückliches Omen für die Überfahrt. Der junge Mann pflückte ein Glückskäferchen nach dem anderen von seinem Mädchen ab, setzte sie ihr auf die Fingerkuppe. Sie spreizten die Flügel und flogen davon.
Die beiden standen wieder dicht neben mir. »Was ist schon ein Jahr!« sagte das Mädchen und pustete den letzten Käfer davon. Der Mann wollte Einwände machen, sagen, was er vermutlich schon zwanzigmal gesagt hatte, wollte wieder etwas gegen ihre Eltern sagen, war bereits bis zu »dein Vater will ja nur einen …« gekommen. Sie hob sich auf die Fußspitzen, legte ihm den Zeigefinger auf den Mund, er schnappte danach, biß hinein, beide lachten.
Der Mann sah auf seine Armbanduhr, sah auf ihre Armbanduhr, verglich seine Zeit mit ihrer Zeit und dann mit der Uhr am Kai. »Immer noch eine Stunde!« sagte er, und sie verbesserte ihn, lehnte sich enger an ihn: »Nur noch eine Stunde.« Und dann wiederholte sie, was alle rundum immer wieder wiederholten: »Ich schreibe jede Woche! Luftpost, das dauert zwei oder höchstens drei Tage.« Wieder war von den Eltern die Rede. Wieder bekam sie Vorwürfe. »Du mußt wissen, zu wem du gehörst! Du bist schließlich mündig!« Sie bettelte, lächelte, sagte ohne Überzeugungskraft zum wievielten Male: »Es sind doch meine Eltern! Versuch doch, sie zu verstehen. Sie verlangen doch nichts Ungeheuerliches. Wenn sie dich erst richtig kennen, werden sie dich auch mögen. Wir werden ihnen beweisen, daß uns ein Jahr Trennung nichts ausmachen kann.« Und wieder und diesmal zweistimmig: »Was ist schon ein Jahr?!« Beide lachten hell auf, erfreut über den Gleichklang und auch erregt. Er faßte sie bei den Ellenbogen, drehte sich mit ihr im Kreis, lehnte sein Gesicht an ihren Körper, trug sie zur Reling. Sie tauchten in der Menge unter. Vermutlich zeigte sie ihm jetzt das Schiff, Sonnendeck und Promenadendeck, Bibliothek und Schreibzimmer. Sie hatte ein Bett in einer Viererkabine, innen, das wußte ich bereits.
Ich verlor die beiden für längere Zeit aus den Augen und wurde erst wieder aufmerksam, als neben mir eine Stimme hell und freudig: »Robert!« rief. Es war dieses junge Mädchen. Es hielt ihren jungen Mann noch immer fest bei der Hand, aber es rief einen fremden Namen. Und da kam auch schon jemand auf sie zu, drängte sich an anderen vorbei und rief ebenso erfreut: »Renate! Wo kommst du her? Fährst du etwa auch rüber?« Hundert Fragen. Wohin und woher und wo studierst du jetzt? Wie geht es deinen Eltern? Ihr junger Mann stand daneben. Hände in den Taschen. Er blickte von einem zum anderen, prüfend, lauernd, verstimmt. Das dauerte Minuten, bis Renate sich besann und die Männer miteinander bekannt machte. Sie tat es auf anmutige Weise, legte ihr Gesicht an das Gesicht ihres jungen Mannes, war ja kleiner, mußte sich dazu recken, und sagte zu diesem Robert: »Das ist er! Das ist Klaus! Von dem muß ich weg! Wie findest du ihn?«
Die Männer begrüßten sich. Dieser Robert, ganz ahnungslos und ganz arglos, sagte: »Hi – Klaus!« auf gut amerikanisch, und Klaus, steif und diesmal fast ohne hessischen Beiklang: »Entschuldigen Sie, ich spreche nicht englisch!«
Robert hielt das für einen Witz, lachte laut. »Der ist in Ordnung, Renatchen!« und versicherte diesem Klaus, daß er sie unter seine Fittiche nehmen würde, es sei ihm ein Vergnügen. Er wollte das gleich beweisen, erkundigte sich, ob sie schon einen Deckstuhl habe, den müsse man rechtzeitig besorgen, nachher seien die guten Plätze weg. »Ich werde dir einen neben meinem reservieren lassen! Du willst doch auch an die Südseite? Bist du noch so eine Sonnenanbeterin wie früher?«
Er lieferte die nötigen Erläuterungen, höflich und bereitwillig und noch immer arglos. »Wir waren im vorigen Sommersemester zusammen in Tübingen. Die meiste Zeit haben wir allerdings am Neckar verbracht. Ich studiere mittlerweile in Bonn.« Dann summte er: »Bald gras’ ich am Neckar, bald gras’ ich am Rhein.« Anlaß zu neuer Heiterkeit.
Er hatte ebenfalls ein Stipendium. In Bozeman, einer kleinen Universitätsstadt am Fuße der Rocky Mountains. »Wie in einem Wildwestfilm. Man kommt sich vor wie zu Hause im Kino.« Dann rechnete er aus, wie weit es von Montana nach Wisconsin sein könnte. Keine tausend Kilometer. Thanksgiving wird er sie besuchen, bis dahin hat er einen Wagen organisiert. Ein Katzensprung für einen alten Amerikafahrer. Er geht bereits das zweite Mal rüber, war während der Ferien zu Hause, hat in der elterlichen Firma gearbeitet.
»Du frierst ja!« sagte er plötzlich zu dem Mädchen. »Rehlein! Weißt du noch, daß wir dich immer Rehlein genannt haben? Du zitterst! Willst du meine Jacke haben?« Sie wehrte ab, gab ihm mit den Augen einen Wink. Da erst merkte er etwas. »Ich lasse euch jetzt allein, kids! Genießt den Abschied, wer weiß, wann ihr euch wiederhabt. Bis nachher, Rehlein!« Er ging, drehte sich nach wenigen Schritten aber noch einmal um, winkte diesem Klaus zu, sagte wieder »Hi!«, verbesserte sich und rief korrekt und im Tonfall eines Texaners, vielfach durchgekaut, »auf Wiedersehn!«
Es ging etwas Leichtes, Unbekümmertes, auch Übermütiges von ihm aus. Das beruhte mehr auf einer geistigen als auf einer körperlichen Beweglichkeit. Er tauchte in der Menge unter, und bis zur Abfahrt der »Bremen« sah ich ihn nicht wieder.
Renate versuchte weiterhin, ahnungslos zu tun, ignorierte den Schatten, der auf den Abschied gefallen war, und fragte leichthin: »Was hast du? Ist dir zu warm in der Sonne? Wollen wir nach unten gehen? Oder hast du Hunger?« Sie versuchte, ihre Hand wieder in seine zu schieben, aber er hielt sie geballt, öffnete sie nicht, und jetzt begriff sie, begriff auf einmal alles: »Klaus!« rief sie, und dann noch einmal ganz laut, als müßte sie ihn aus einem bösen Traum aufwecken: »Klaus! Das kannst du doch nicht denken? Es ist nichts zwischen ihm und mir! Es ist nie etwas gewesen, nie!«
Kein Muskel in seinem Gesicht rührte sich. Er sah an ihrem Kopf vorbei, übers Wasser, in irgendeine Ferne. Sie flüsterte jetzt, redete rasch und atemlos auf ihn ein, Tränen stürzten ihr aus den Augen, sie wischte sie nicht einmal weg, schüttelte nur heftig den Kopf, die Tränen sprangen aus ihren langen Wimpern, das hatte ich noch nie beobachtet. Sie ließ jetzt die Arme hängen, machte keinen Versuch mehr, ihn mit den Händen zu erreichen. Er sagte laut, ganz unmißverständlich, auch für mich, die etwa drei Meter entfernt auf einer Bank saß: »Gewesen? Gewesen! Das kann sein. Aber das kommt. Das sehe ich doch! Ich habe doch Augen im Kopf. Meinst du, ich hätte keine Phantasie? Der paßt doch besser zu dir. Der studiert doch. Der paßt deinen Eltern. Nimm den doch! Du hast ja acht Tage lang Zeit. Ich bleibe hier. Ich bin dir dabei nicht im Wege.«
Sie sagte und benutzte den Satz wie eine Zauberformel, die ihre Wirksamkeit bereits verloren hat: »Was ist denn ein Jahr. Robert geht mich nichts an. Du gehst mich an. Ich liebe dich! Wenn du es willst, bleibe ich. Sag, daß du es willst! Ich gehe mit dir, ohne mich umzusehen! Hörst du mich überhaupt?«
Sein Lachen ging unter im Aufheulen der Schiffssirenen. Durch die Lautsprecher wurde angesagt, daß die Besucher das Schiff jetzt zu verlassen hätten. Die Bordkapelle spielte lauter, oder der Wind hatte gedreht, ich konnte nicht hören, ob die beiden noch miteinander sprachen oder nicht.
Er war einer der ersten gewesen, der von Bord ging. Er war groß und fiel durch sein weißes Jackett auf. Ich erkannte ihn nach einigem Suchen wieder, er stand etwa in gleicher Höhe zum Sonnendeck auf einer der Terrassen des Empfangsgebäudes. Die Kleine war nach oben gegangen, und ich war ihr gefolgt. Sie stand unmittelbar neben mir, direkt an der Reling. Sie schlang sich ihr rotes Seidentuch um die Handgelenke, weinte, ohne aufzuhören. Ich war versucht, den Arm um sie zu legen, unterließ es aber. Man konnte ihren Schmerz schwer mit ansehen. Das Rufen und Winken von den Terrassen und Fenstern herüber zu den Decks hatte eingesetzt. Die Lautsprecher. Die Bordkapelle. Noch immer waren Besucher an Deck. Die Sirenen heulten ein letztes Mal, schließlich wurden die Ankerketten eingeholt, die Brücken für Gepäck und für Menschen waren inzwischen verschwunden, Schiff und Land trennten sich voneinander. Die Kapelle spielte »Muß i denn, muß i denn zum Städtele hinaus …«
Das Mädchen hob den Arm, ließ ihr rotes Tuch wehen, hielt den Arm steif wie einen Fahnenmast. Der Wind fing sich in dem Tuch, ließ es flattern. Tränen hingen in ihren dichten Wimpern. Ein Vorhang von Tränen, der ihr hoffentlich verbarg, daß ihr Freund unbeweglich dastand, die Hände in den Jakkentaschen.
Die Menge schob und drängte uns dicht aneinander, ich entschuldigte mich, sie sah mich wohl zum erstenmal, versuchte zu lächeln. Jemand schob mich beiseite, es war dieser unbekümmerte Robert. Er legte den Arm kameradschaftlich um Renates Schultern, auch das unbekümmert. »Du hast ihn doch bald wieder, Rehlein! Wein doch nicht! Was ist denn schon ein Jahr.«
Sie schlüpfte unter seinem Arm weg, holte ihre rote Fahne ein, nahm sie in die linke Hand, hob die rechte und schlug mit aller Kraft in sein Gesicht und ging weinend davon.
Ich sah die beiden während der einwöchigen Überfahrt nur selten. Einmal traf ich das Mädchen im Schwimmbad. Sie grüßte mich, sah blaß aus, ihr Gesicht hatte sich zusammengezogen, war klein und spitz geworden. Sie war auch am Körper mager. Die Schlüsselbeine stachen hervor, faustgroße Kuhlen neben ihrem Hals. Ein anderes Mal traf ich sie im Schreibzimmer an, als ich dort meine Korrespondenz erledigte. Sie saß an einem der Schreibtische und bedeckte viele Briefbogen mit viel zu großen Schriftzügen. Körpergröße und Größe der Schrift sollten in angemessenem Verhältnis zueinander stehen. Sie war zu klein für ihre Schrift. Sie las Seite für Seite durch und zerknüllte Bogen für Bogen und steckte die Papierknäuel in ihre Handtasche. Vermutlich hat sie sie ins Meer geworfen.
Nie sah ich sie bei den Tanztees oder den Bordspielen. Robert sah ich um so häufiger. Er war meist mit einer Gruppe von Studenten und Studentinnen zusammen. Sie spielten Pingpong, spielten Shuffleboard. Ich sah ihn mit vielen anderen Mädchen tanzen. Er hatte es aufgegeben, sich um diese Renate zu kümmern. Der Liegestuhl auf dem oberen Sonnendeck blieb unbenutzt.
Ich führte während dieser Amerikareise eine Art Tagebuch. Ich notierte mir die drei Namen. Klaus – Renate – Robert und schrieb dazu: ›Vertrauen erwächst nur aus Selbstvertrauen.‹ Ich vermutete, daß dieser Klaus seine eigene Unsicherheit auf das Mädchen übertragen hatte.
Einige Male sah ich sie auf einem der weniger belebten Decks, dort, wo ich regelmäßig meine Spaziergänge unternahm. Sie stand in einem der balkonähnlichen Vorbauten, im Schutz der Rettungsboote. Sie erschrak, wenn sie Schritte hinter sich hörte. Dorthin verzog sie sich zu keinem anderen Zweck als dem zu weinen. Sie konnte auf dem großen Schiff ja nirgends mit ihrem Kummer allein sein. Sie hatte etwas Scheues und Unsicheres bekommen. Ich beobachtete einmal einen älteren, freundlichen Amerikaner, der es gewiß gut mit ihr meinte, er schlug ihr vor, mit ihm einen Drink zu nehmen, er wollte ihr väterlich den Arm tätscheln, ich hörte, daß er sich erkundigte, ob sie ›homesick‹ sei, heimwehkrank. Sie schüttelte seine Hand ab und lief weg. Sie schien sich zu fürchten. Vor den Passagieren und deren neugierigen Blicken, vor dem fremden Kontinent, den wir ansteuerten. Vor allem.
Ich hielt es für richtig, mich am letzten Tag der Überfahrt doch noch einzumischen. Ich sagte ihr, daß ich einige Amerikakenntnisse hätte, daß ich bereits zum zweitenmal hinüberführe und daß sie sich an mich wenden könnte, wenn sie Rat oder Hilfe brauchen sollte. Ich gab ihr sowohl meine Adresse in New York als auch die in Massachusetts. Sie dankte artig, tat gehorsam den Zettel in ihre Brieftasche, blieb aber unzugänglich. Wir sprachen übrigens englisch. Etwa vierundzwanzig Stunden vor Ankunft in New York bemühten sich alle, englisch zu sprechen. Die Sprachgrenze deckt sich ja nicht mit der Landesgrenze. Der Geist eilt voraus. Auf der Rückreise beobachtete ich Ähnliches. Ab Southampton sprachen die Deutschen wieder deutsch und die Deutschamerikaner, die zu Besuch in die alte Heimat fuhren, plötzlich schwäbisch, fränkisch, alemannisch.
Wir sagten denn auch: »Have a good time!« und »good luck!« Mein »Can I help you?« war nicht nur konventionell. Sie zwang sich zu einem Lächeln. Ihr kleines Gesicht hatte sich verändert. Als sie an Land ging, mußte man bereits keine Sorge mehr um sie haben. Sie hatte es hinter sich gebracht. Mit jeder Meile, die das Schiff zurücklegte.
Ich hörte denn auch nichts von dem Mädchen. Neue Menschen, neue Eindrücke drängten auf mich ein. Monate später, auf einer Party, die ein Club literarisch interessierter Frauen veranstaltete, wurde ich ersucht, etwas zu Goethes »Wahlverwandtschaften« zu sagen. Ein Buch, das dort wenig bekannt ist. Ich zitierte einen der Schlüsselsätze: »Nichts ist bedeutender in jedem Zustand als die Dazwischenkunft eines Dritten.« Während ich noch sprach, fielen mir die drei jungen Leute vom Schiff wieder ein. Später, als wir unseren Cocktail tranken und den üblichen »small talk« machten, erzählte ich den Damen von ihnen. Sie beteiligten sich bereitwillig an den Mutmaßungen, wie das ausgegangen sein könnte. Sie einigten sich bald, daß das Mädchen einen boyfriend gefunden und den Freund, der so offensichtlich nicht zu ihr gepaßt hatte, vergessen haben würde. Eine Wahlverwandtschaft, so meinte eine der jugendlichen Sechzigerinnen lächelnd, habe doch wohl nicht bestanden.
Erst im Frühsommer des folgenden Jahres kehrte ich nach Deutschland zurück. Ich reiste auch diesmal mit der »Bremen«. Meine Freunde in New York hatten sich vervielfacht. Das Schiff lief in der Nacht von Samstag zu Sonntag aus. Alle bestanden darauf, mich an Bord zu begleiten. Friends of my friends of my friends … Die meisten kannte ich nicht einmal mit Namen. Man steckte mir eine Orchidee an den Aufschlag meiner Kostümjacke, überhäufte mich mit Blumen und Geschenken. An Bord war Karneval und Thanksgiving auf einmal. Die Damen in Cocktailkleidern. Mehr Whisky als Tränen. Der Juniabend war ungewöhnlich kühl.
Diese Stunden vor der Abfahrt waren dazu angetan, mir den Abschied leichtzumachen. Ich versicherte unzählige Male, wie sehr ich alles genossen hätte, lobte und dankte und hatte dazu allen Grund. Ich ließ mich küssen und küßte alle Wangen, die man mir hinhielt. Die Verbrüderung nahm keine Ende.
Schließlich, es mochte bereits auf Mitternacht gehen, tönten dann die Sirenen. Die Besucher wurden aufgefordert, von Bord zu gehen. Einmal, zweimal, dreimal. Man drängte zu den Gangways, trank die letzten Gläser leer, schwankte, obwohl das Schiff noch ruhig lag. Man verlor sich, irrte umher, rief Namen, fand sich wieder, und in diesem Tohuwabohu plötzlich neben mir eine helle Stimme, die ich erkannte, die »Robert« rief. Und nun wiederholte sich die Szene von damals. Robert bahnte sich einen Weg durch die Menge, rief: »Renate!« Sie redeten aufeinander ein, lachten, faßten sich bei den Armen. Es waren viele Studenten an Bord. Die Ferien hatten gerade begonnen.
Ich verlor die beiden wieder aus den Augen, hatte Mühe, meine Gäste loszuwerden. Einer von ihnen hatte beschlossen, endlich seine Europa-Reise zu machen, und hatte sich auf meinem Bett ausgestreckt. Zwei Stewards bemühten sich lange vergeblich um ihn. Als endlich Ruhe eintrt, legte ich mich erschöpft zu Bett.
Die »Bremen« geriet während dieser Überfahrt in die Ausläufer eines Hurrikans. Tagelang stand auf der Wetterkarte ›Windstärke 7‹ und ›Windstärke 8‹ und schließlich der lakonische Vermerk: ›very rough sea‹. Rauhe See.
Wir näherten uns bereits Southampton, als ich endlich wieder soweit war, daß ich abends in den Gesellschaftsräumen sitzen und mit Genuß meinen Cocktail trinken konnte. Am letzten Abend beobachtete ich die beiden Studenten. Sie tanzten, er blies ihr die Locken aus der Stirn, sie reckte sich und schnappte mit dem Mund nach seinem Ohrläppchen. Man sah ihnen mit Vergnügen zu, sie tanzten leicht und anmutig, ihre Verliebtheit war spielerisch, aber nicht ohne Ernst.
Sie erkannte mich nicht wieder. Erkannte keinen wieder. Diese Tarnkappe der Glücklichen.
Als wir die Zollabfertigung in Bremerhaven hinter uns hatten und zu den Zügen gingen, die auf den Bahnsteigen bereits warteten, sah ich die beiden ein letztes Mal. Das Mädchen stand mit den Eltern zusammen, der Freund hielt sich noch abseits, aber dann streckte sie den Arm nach ihm aus, zog ihn herbei und sagte: »Das ist er!« Als wäre damit alles gesagt. Sie hatte vergessen, daß sie mit den gleichen Worten einen anderen schon einmal vorgestellt hatte, jenen, den sie in Amerika vergessen sollte. Und vergessen hatte.
Ich beobachtete die Szene und sagte halblaut: »Was ist schon ein Jahr.« »Was sagst du da?« fragte der, dessentwegen ich weggefahren war und dessentwegen ich wiedergekommen war. Ich wiederholte und sah ihm dabei in die Augen: »Was ist schon ein Jahr.«
Bella Vista
Sie reisen zum erstenmal zusammen. Und dann gleich in den Süden und gleich in den Frühling! Beide älter als sechzig und mehr als dreißig Jahre verheiratet, und immer miteinander gelebt und mit den Kindern und mit den Enkelkindern und jetzt auf einmal allein, in einer Fremde, die sie spüren läßt, wie sehr sie aufeinander angewiesen sind. Kein Reiseleiter, der hilft, nur ein Taschenwörterbuch und eine Handvoll Prospekte, deren Nutzlosigkeit doch jeder schon feststellt, bevor der Zielbahnhof erreicht ist, spätestens aber, wenn er den Koffer in das Zimmer der Pension stellt und ans Fenster geht und nach der angekündigten schönen Aussicht sucht.
Das Glück der Ahnungslosen ist mit den beiden: Ein Omnibus nimmt eine dieser Haarnadelkurven am Berg zu rasch und zu knapp, bremst unmittelbar neben ihnen, so daß der Schreck sie direkt in so ein Bella Vista treibt, gleich am ersten Nachmittag. Der Omnibusfahrer ist ein Sohn der Wirtin, daran muß es liegen, er liefert seiner Mutter bei jeder Talfahrt ein paar Gäste. Wer findet sonst am ersten Tag gleich sein Belvedere, sein Bella Vista oder einfach sein Restaurant Zur schönen Aussicht? Mit der Veranda nach hintenheraus, verglast oder unverglast, mit dem Blick auf die Berge, das Meer oder ins Tal, mit den fünf kleinen Tischen, an denen man seine Ansichtskarten schreibt und seinen Kaffee trinkt, seinen vino, seine Coca-Cola.
Die Bremsen quietschen, und irgendwer schreit, die Tür steht gerade offen, und schon sind die beiden drinnen, unversehens, vorbei an dem weißen Eiskasten, über dem ein Fähnchen weht, Gelati steht darauf, die Frau denkt an Gelatine, an rote Gelatine. Er vorweg, an der Theke vorbei, in der plötzlichen Dämmerung fast blind, aber mit der richtigen Witterung: Er stößt die Glastür auf, die zur Veranda führt. Und sie hinterher, lächelnd, kopfnickend zu den Männern hin, die über dem Fußballautomaten lehnen, und nach der anderen Seite zu der Wirtin hin und dem Mädchen, zehn Jahre höchstens, aber gleich mit dem karierten Tischtuch bei der Hand, und die Wirtin auch noch hinterher, die Stühle gerückt und über den See und über die Berge gezeigt. »Bella! Bella vista!« Und dann diese Litanei von: Aranciata! Birra! Aperitivi! Vino nostrano! Caffè! Caffè latte? Espresso – und da gibt der neue Gast ein Zeichen. »Stop«, sagt er und hebt zwei Finger der linken Hand. Die Wirtin wiederholt: »Espresso, due espressi« und verschwindet, das Mädchen hinterher. Der Gast schiebt sich einen Stuhl zurecht, läßt sich drauffallen, seine Frau setzt sich auf den Stuhl gegenüber. Er mit dem Blick auf die Berge, sie mit dem Blick über den See. Für heute und die nächsten drei Wochen wird das in diesem Augenblick von ihm entschieden. Bevor er den Stock an den nächsten Stuhl hängt, zeigt er mit ihm, die Eisenspitze ins Blaue gebohrt, nach Norden und sagt: »Neuschnee.« Seine Frau wendet den Kopf und erschrickt beim unverhofften Blick übers Geländer. Der Berg stürzt jäh in die Tiefe, sie hängen in einem offenen Käfig überm Abgrund. Sie lehnt sich zurück. Das Gitter ist kaum so hoch wie der Tisch, an dem sie sitzen, sie hält sich mit der Hand dran fest, bekommt Herzklopfen, der Weg war steil, die ungewohnte Wärme. Sie knöpft den obersten Knopf ihrer Bluse auf, die Jacke hat sie schon aufgemacht, ihr wird eng, sie schließt die Augen. Sie sitzen beide still da, er sieht an ihrem Kopf vorbei auf die Berge, sie sieht, als sie sich etwas beruhigt hat, rund um seinen Kopf den blauen See; links von seinem Ohr erhebt sich der höchste und letzte der Berge einer langen Kette.
Als die Wirtin kommt und das Tablettchen mit den zwei Tassen, den Zuckertütchen und zwei kleinen Gläsern mit Wasser auf den Tisch setzt und anfängt es abzuräumen, erhebt der neue Gast sich, um sich im Windschatten der Verandatür seine Nachmittagszigarre anzuzünden. Er beißt ein Ende ab, spuckt es über das Gitter, im hohen Bogen, worüber seine Frau aufs neue erschrickt. Er pafft und spuckt, bis die Zigarre brennt, und kehrt zurück. Nun steigt über seinen Kopf und über den See bläulicher Qualm und wird zur Wolke, die der Wind in eines der Täler an der anderen Seeseite weht, von dem seine Frau gern wissen möchte, wie es heißt, aber der Prospekt ist in der Jackentasche ihres Mannes, und sie bittet ihn nicht darum, er würde nicht begreifen, warum sie wissen will, wie etwas heißt. Blumen und Vögel und Berge. Er behauptet, sie vergäße die Namen doch gleich wieder. Aber das stimmt nicht, sie vergißt sie nicht, sie verwechselt sie nur immer, ändert sie ein wenig ab. Sie kann ihm nicht klarmachen, daß der Name nicht der richtige, der offizielle zu sein braucht, nur irgendeinen Namen muß alles haben, damit man sich erinnern kann. Das Gedächtnis braucht Namen.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: