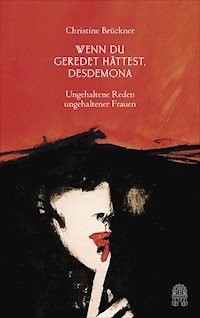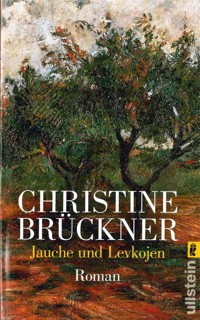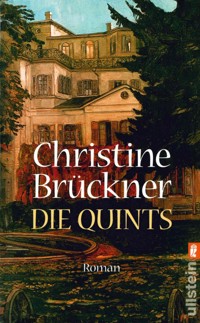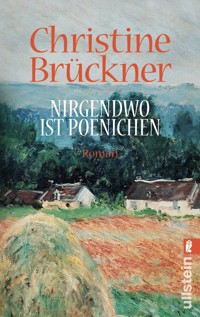3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Refinery
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der angesehene Scheidungsanwalt Albrecht soll auf Anraten seiner klugen Frau zehn Tage im Tessin ausspannen und dort von seiner Schwäche für seine Sekretärin Lotte kuriert werden. Damit diese Kur für Susanne nicht zu anstrengend wird, hat sie sich ihren Jugendfreund eingeladen. "Ein heiterer, pikanter, mit viel Witz, Menschenkenntnis und geistreichen Einfällen gewürzter Eheroman, dessen Autorin es versteht, die Probleme und Konflikte ohne Sentimentalität, mit liebenswürdigem Humor zu schildern und zu lösen." - Das Bücherblatt
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 260
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Die AutorinChristine Brückner (1921 - 1996) zählt zu den renommiertesten Schriftstellerinnen Deutschlands. Sie verfasste Romane, Erzählungen, Kommentare, Essays, Schauspiele, auch Jugend- und Bilderbücher. Besonders mit der Poenichen-Trilogie wurde sie einem großen Publikum bekannt. Mehr über Christine Brückner erfahren Sie über die Stiftung Brückner-Kühner unter http://www.brueckner-kuehner.de/.
Das Buch
Der angesehene Scheidungsanwalt Albrecht soll auf Anraten seiner klugen Frau zehn Tage im Tessin ausspannen und dort von seiner Schwäche für seine Sekretärin Lotte kuriert werden. Damit diese Kur für Susanne nicht zu anstrengend wird, hat sie sich ihren Jugendfreund eingeladen.
»Ein heiterer, pikanter, mit viel Witz, Menschenkenntnis und geistreichen Einfällen gewürzter Eheroman, dessen Autorin es versteht, die Probleme und Konflikte ohne Sentimentalität, mit liebenswürdigem Humor zu schildern und zu lösen.« - Das Bücherblatt
Christine Brückner
Ein Frühling im Tessin
Refinery by Ullsteinwww.ullteinbucherlage.de/verlage/refinery
Neuausgabe bei Refinery Refinery ist ein Digitalverlag der Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin Oktober 2017 (1) © Econ Ullstein List Verlag GmbH & Co. KG, München 2001 © Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 1960, 2008 Covergestaltung: © Sabine Wimmer, Berlin ISBN 978-3-96048-086-0 Hinweis zu Urheberrechten Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben. In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Wenn es vorbei ist, weiß man nie, wann so eine Geschichte eigentlich angefangen hat. Mein Mann behauptet, alles habe seine Ursache in dem Regen gehabt. Bei gutem Wetter wäre das nicht passiert. Wie überhaupt die meisten Ereignisse und vor allem die Ungeheuerlichkeiten unter dem Einfluß der Witterung geschähen. Wenn er mit seinen Ausführungen so weit gekommen ist, pflege ich wegzuhören. Wir sind sechs Jahre verheiratet, ich kenne seine Argumentation. In diesem Falle wird er sie statistisch unterbauen, und er wird seine Beispiele aus dem Bereich der Verbrechen wählen, denn er ist Jurist; er wird sie aus dem › allgemein menschlichen Bereich‹ wählen, denn er ist Scheidungsanwalt. Der kommende Mann in unserer Stadt, sagen seine Kollegen. Ein Frauentyp und jetzt gerade im gefährdeten Alter, ein gutaussehender Endvierziger, eben im Begriff, leicht zu ergrauen.
Lotte, die ebenfalls den Dingen nicht allzusehr auf den Grund zu gehen pflegt, dafür aber ein wenig romantisch veranlagt ist, sagt: Es ist diese Landschaft. Rechts eine Felswand, links eine Felswand, in der Mitte ein Wasserfall, schäumendes Brausen und tiefhängende Wolken; ein wenig Tessiner Vegetation mit Kastanien und Nußbäumen und blühenden wilden Kirschen; der Waldboden beschneit mit weißen Anemonen – das genügt schon, um sie anfällig zu machen. Noch anfälliger macht sie der Barbera, und wenn man ihr gar den schwerfließenden, kaum vergorenen Nostrano aus dem vorigen Jahr vorsetzt, dann behauptet sie immer noch: Es ist diese Landschaft! Lotte ist die Sekretärin meines Mannes. Sie hat tiefen Einblick in das Leben genommen, sagt sie. Ich nenne sie gelegentlich ›das einfache Lottchen‹, weil sie vor ein paar Wochen, als sie wieder einmal anfällig war, fand, ich sollte sie doch ›einfach Lotte‹ nennen.
Der Vorschlag, sie in unser Ferienhaus mitzunehmen, stammt von mir. Ich vermutete damals, daß mein Mann mir in etwa zwei Monaten, vielleicht auch schon früher, so genau weiß man das ja nie, sagen würde, er habe einen dringenden Termin in London, und Lotte käme der Einfachheit halber und für alle diese Formalitäten am besten mit. Auch meine Phantasie reicht aus, mir vorzustellen, wie englische Parks auf Lotte wirken. Und mein Mann – nun, der sagt zwar, daß er genügend Gelegenheit habe, aus den Fehlern anderer zu lernen, aber warum, warum macht er dann so viele? Wer garantiert mir, daß er vor dem mit seiner Sekretärin zurückschreckt? Er ist auch sonst in seinen Einfällen nicht immer originell. Als ich vorschlug, die Praxis für zehn Tage zu schließen, dann könnten wir Lotte mitnehmen, und sie könnten unten – unten heißt im Tessin, in unserem Haus – das Nötigste arbeiten, wußte er allerdings sofort Bescheid. Er sah mich anerkennend an und sagte: »Ich habe doch nicht etwa eine kluge Frau geheiratet?«
»Aber keine raffinierte«, sagte ich. Das gab er zu.
Mir schien, daß uns allen eine Woche Ferien im Frühling guttun würde. Vorgeführtes Eheglück kann man das natürlich auch nennen. Ich hoffte, daß es ernüchternd wirken würde auf das einfache Lottchen.
Weil man Dreiecksverhältnisse nicht gewaltsam konstruieren soll, rief ich Friedrich Georg an, der seine Unabhängigkeit gern in raschen Entschlüssen dartut. »Es wird nicht einfach sein«, sagte er, »es gibt da allerlei zu regeln.« Ich zog sofort zurück und bedauerte sehr und verstand die Wichtigkeit seiner Vorhaben augenblicklich, und deshalb mußte nun wiederum er die Taktik ändern. »Man darf sich nicht von Bagatellen abhängig machen, und es ist alles Bagatelle, was nicht –.« Hier unterbrach ich ihn, wir führten auf meine Kosten ein Ferngespräch: »Wem sagst du das, Friedrich Georg!« Was eine Bagatelle ist, das ändert sich bei ihm so oft wie bei mir. Wir haben uns darüber nie verständigen können; nur in den Details, so nennt er das, sind wir immer derselben Ansicht. Woran das liegt, weiß ich nicht. Wir kennen uns schon zehn Jahre. Friedrich Georg ist Junggeselle. Außerdem ist er ein Dichter. In erster Linie aber ist er Junggeselle, und um das zu bleiben, tut er viel und vieles nicht und kommt darüber nicht recht zum Dichten, scheint mir. Ohne das Nachtprogramm im Rundfunk ginge es ihm sicher ziemlich schlecht.
Friedrich Georg sagt – als Dichter hat er eine Vorliebe für die Metaphysik, die bei ihm ziemlich unmittelbar über der Sphäre von Lottes Wasserfall und der felsigen Schlucht beginnt –, er sagt: ›Alles ist Anfang.‹ Dann sinnt er lange und sagt: ›Alles ist Ende. Die Anemonen duften nach Moder, das welke Laub, diese Krume über unserem Planeten, was ist sie anderes als: Rosen – Tränen – Staub.‹ Wenn er so weit ist, geht man am besten. Er merkt es sowieso nicht. Er greift nach dem Stift, und man tut gut daran, ihm schnell noch eine Papierserviette zuzuschieben, damit er nicht das Tischtuch beschreibt.
Einmal, das liegt Jahre zurück, habe ich ihn gefragt, woher er das kann. Was? Was – kann? Er war irritiert, er mag direkte Fragen nicht übermäßig gern. Ich erklärte es ihm, sagte: »Nun, das Dichter-Sein. Du mußt es doch irgendwo gelernt oder jemandem abgeguckt haben.«
Er war gekränkt. Aber das hält nie lange vor. Unser Verhältnis ist jenseits von Gut und Böse. Das glaubte ich wenigstens, bevor wir auf diese Reise gingen. Nicht einmal das gesteht mir mein Mann zu. Das Fatale, so behauptet er, sei, daß ich selbst an meine Unbefangenheit glaube, und darum sei sie auf gewisse Weise eben doch existent. Mein Mann hat einen Freund, der Existenzphilosoph ist, vermutlich verdanken wir ihm, daß bei uns so vieles ›existent‹ oder ›existentiell‹ ist.
Friedrich Georg, um auf ihn noch einmal zurückzukommen, legt die Hand auf meine Schulter, wie er sie auf den ersten besten Fensterrahmen oder – wie er es noch lieber tut, weil es dekorativer ist – an den Stamm eines wilden Kirschbaums lehnt. Er lehnt sich überhaupt gern an, und das ist mehr als eine Pose. Außerdem hat er eine Vorliebe für unveredelte Bäume, für das Echte also, und darum stiegen wir aus der Promenadenzone am Lago Maggiore, weg von Palmen, Agaven, blühenden Kamelien, Rhododendronhecken und Mimosenbüschen, dorthin, wo eben erst die Wiesen grün wurden, wo Primeln an den Quellen blühten und Veilchen die moosigen Felsen überwucherten. Es war April. Aber es regnete.
Friedrich Georg erkennt Zusammenhänge, die keiner von uns wahrnehmen kann. Alles gerät bei ihm sehr bald in eine Zone, an der unsichtbar, aber keineswegs unauffällig ein Schild hängt: Zutritt nur für Befugte.
Tante Be, die in unserer Geschichte eine viel größere Rolle gespielt hat, als ich zunächst vermutet habe, Tante Be ist imstande zu sagen: »Kindchen, das ist Schicksal, Ich bin in einem Alter, in dem man wieder an das Schicksal glaubt und drüber reden kann, ohne Angst zu haben, daß man sich lächerlich macht. Alles, die Situation, die Geschehnisse oder die Dinge, oder wie ihr das nun nennt, hatte sich zugespitzt, verdichtet – daran allerdings wart ihr schuld und ich natürlich auch, aber dann haben sie sich selbständig gemacht, die Fäden glitten uns aus der Hand, und was dann kam, das war Schicksal, Suschen.« Und wie sie das sagt, gar nicht etwa bedeutungsvoll und ernst, sondern heiter und beiläufig; wie andere Frauen in ihrem Alter ein Strickmuster erklären – am Rand mußt du Knötchen stricken, Kind, dann wird die Naht glatter –, so redet Tante Be über das Schicksal.
Übrigens finde ich, daß ein gut Teil schuld an alldem das Haus hat. Es gibt da so etwas, das ich die übernommene Hypothek nenne. Simonetti, unser Vorgänger, hatte viel mehr zurückgelassen als einen Teil des Inventars, mehr als alte Regenmäntel und Schaukelstühle, aber davon wird noch oft die Rede sein.
Das Haus gehört mir. Mein Mann versäumt keine Gelegenheit, das zu betonen. Es ist das Hochzeitsgeschenk einer großzügigen Tante, jener Tante Be, die seit mehr als zwei Jahrzehnten in der Schweiz lebt und nie wieder nach Deutschland zurückgekehrt ist. Sie bedauert jeden, der dort zu leben gezwungen ist. Ihr Geschenk entstammt dem Mitleid; sie denkt, daß ich – wie sie – eines Tages meine Zuflucht ins Tessin nehmen werde, nicht zuletzt, weil es in Deutschland kalt in jeder Hinsicht sei und weil man dort zu tüchtig sei und niemals etwas von der Kunst zu leben lernen werde. Außerdem richtete sich dieses Geschenk unmißverständlich gegen Albrecht. Das Haus soll meine Zuflucht sein, wenn es mit meiner Ehe schlecht ausgeht, wovon sie offensichtlich vom ersten Tage an überzeugt war. Sie hat eine Abneigung gegen Juristen, sie mag ja auch meinen Vater nicht. Es sei denn, es handelt sich um Notare, mit denen sie viel zu tun hat, da sie sich auf dem Schweizer Immobilienmarkt betätigt. Vielleicht hatte sie wirklich für dieses Haus keinen Käufer finden können, wie Albrecht behauptet, und in uns hatte sie wenigstens jemanden, der die Unkosten trug. Und wenn schon! Man darf hier so wenig nach den Motiven forschen wie bei anderen Geschenken.
Auf dem Immobilienmarkt ist sie heimlich tätig. Offiziell malt sie. Sie bezeichnet sich als Malerin; sie hat uns damit überrascht, daß sie das Haus ausgemalt hatte, bevor wir es zum erstenmal sahen. Das war auf unserer Hochzeitsreise. Sie hat eine sanfte Palette, die Farben tun einem nicht weh, ihr Strich ist behutsam, und das ist schon etwas Positives für einen Maler, mit dem man verwandt ist. In ihren Motiven hat sie sich beschränkt – auf Naturalien, wie mein Mann das zu nennen beliebt. Drei blühende Magnolienzweige an der Kaminwand. Ein Stückchen Lago mit zwei Palmen in der Diele. Die gemalten bunten Poccalinos und Bastflaschen an der weißgekalkten Wand in der kleinen Küche sind sogar sehr hübsch. Albrecht kann die Kuh nicht leiden, die über die Herdwand spaziert. Sie heißt die Nestle-Kuh. Jedesmal, wenn wir in unserem Haus sind, droht Albrecht damit, sie zu schlachten und in den Topf zu tun, und alle meine Einwände, daß wir dann auch noch die Milch von Locarno heraufholen müßten und nie mehr Schokolade hätten, quittiert er mit einem dürftigen Lächeln. Was diese Kuh bisher vor der Vernichtung gerettet hat, war Albrechts Mißtrauen; ein rein juristisches Mißtrauen. Er war der Ansicht, daß dieses Haus noch irgendeinen Haken habe. Er konnte sich einfach nicht vorstellen, wieso eine Tante ihrer Nichte derartige Geschenke machte. Darum behandelte er Tante Benedikte mit höflichem Mißtrauen. Den Namen Benedikte hat sie sich erst später zugelegt. Ich kannte sie als Kind nur unter dem Namen Tante Berta, und Berta paßt sehr viel schlechter zu ihr als Benedikte. Wir nennen sie Tante Be. Auf ihre Weise hat sie Stil. Friedrich Georg erkannte das sofort. Allerdings hat Tante Be, als sie ihn zum erstenmal sah, mit allen Anzeichen des Entzückens ausgerufen: »Was für ein Kopf! Diese Nackenpartie! Susanne, darauf mußt du achten bei einem Mann. Glaub mir, sie haben alle Ursache, ihren Nacken hinter Kragen und Schlips zu verbergen, die meisten wenigstens. Wie sie den Kopf tragen, der Haaransatz, die Beweglichkeit des Halses – ach, was sage ich denn! Eine ganze Charakterologie ist das!«
Albrecht fing bereits an, unruhig den Kopf hin und her zu drehen, und Lotte sah interessiert von einem Männernacken zum anderen, und auch weniger eitle Männer als Friedrich Georg hätten sich geschmeichelt gefühlt. Bereits in den ersten zehn Minuten war zwischen Tante Be und ihm dieses Einverständnis der ›Künstler unter sich‹ hergestellt. Meine Tante wurde mehr und mehr zu einem Gebilde seiner dichterischen Phantasie, und er verwandelte sich unter unseren Augen in das Porträt eines Dichters.
Wir sind an einem Montagmorgen von zu Hause weggefahren. Am Sonntag hatte Albrecht alles an Akten zusammengesucht, was zehn Anwälte in drei bis vier Wochen mit der Hilfe von mehreren guten Sekretärinnen hätten erledigen können. Die gebündelten Akten verstaute er im Kofferraum des Autos und überlegte, ob er nicht den Reservereifen zu Hause lassen sollte, um noch mehr Akten unterbringen zu können. Uns hatte er strenge Anweisungen erteilt, so wenig an Gepäck mitzunehmen wie möglich, was gar nicht nötig gewesen wäre, denn es ließ sich sowieso kaum noch etwas verstauen.
Friedrich Georg war gegen Abend bei uns eingetroffen ; er war aus einem mir unersichtlichen Grunde verstimmt. Vermutlich fürchtete er, in häusliche oder menschliche Abhängigkeit zu geraten, dachte vielleicht auch, daß ich kupplerische Absichten hätte, was natürlich sehr schlecht beobachtet ist, denn jede Ehefrau hat schließlich gern einen gutaussehenden Junggesellen zum Freund und Verehrer. Ich will damit durchaus nicht etwa andeuten, daß ich ihn als Spekulationsobjekt betrachtet hätte oder gar als eine Art von Ersatz. Ein Jugendfreund tut einem in deprimierten Stunden gut, das ist alles, und diese Stunden sind gar nicht so selten, wenn man mit einem vielbeschäftigten Mann verheiratet ist, der einem gelegentlich zu verstehen gibt, daß die meisten Dinge dieser Welt wichtiger sind als man selbst, der einem das Hohelied der Arbeit gerade in dem Augenblick vorsingt, wenn –. Aber das führt jetzt zu weit ab.
Es war windig, und kalt war es auch, und die Regenschauer fehlten ebenfalls nicht. Wir fuhren bei Lotte vorbei und luden sie und ihren Koffer ein.
Die Männer lösten sich am Steuer ab. Albrecht fährt im ganzen ruhig, aber hart, mit einer gewissen Skrupellosigkeit, die, wenn man sie erst einmal kennt, nicht wirklich beunruhigend ist. In Italien fährt man so. Albrecht war während des Krieges längere Zeit in Florenz.
Friedrich Georg ist ein sensibler Fahrer. Er reagiert schreckhaft und nervös, raucht viel und hat jene zerstreute Konzentration, die jedes Gespräch der Mitreisenden verstummen läßt. Man fährt. Ausschließlich. Man ist unterwegs. Gelegentlich macht er einem das Ungeheuerliche des Nicht-mehr-hier- und Noch-nicht-dort-Seins in ein paar Sätzen deutlich. Die Einheit von Raum und Zeit ist für eine Weile aufgehoben, allerdings nur auf eine gewisse, schwer definierbare Weise. Wir dachten pflichtschuldigst darüber nach, starrten auf die Fahrbahn und nahmen uns zusammen, damit wir nicht bei jedem Huhn, das über die Straße rannte, und bei jedem Radfahrer, der sein Leben vor unserem Wagen aufs Spiel setzte, aufschrien.
Nach zwei Stunden erklärte ich, daß wir einen Augenblick halten müßten. Bevor wir wieder einstiegen, fragte ich so harmlos wie möglich meinen Mann, ob er nicht wieder ans Steuer wolle. Ich bat sogar Lotte, sich neben ihn zu setzen, weil ich doch so manches mit Friedrich Georg zu besprechen hätte.
Wir hatten uns über ein Jahr lang nicht gesehen. Er lebt in Hamburg, weil das – nach seinen Worten – die einzige Stadt sei, in der ein schöpferisch tätiger Mensch in Deutschland leben könne. Ihre nüchterne Strenge, verbunden mit der raschen Mentalität der Handelsstadt und der Kultur und Tradition von Jahrhunderten, legt der eigenen Phantasie jenes Maß an, dessen sie bedarf, um in Disziplin zu arbeiten. So ähnlich. Einen guten Teil des Jahres verbringt er in den gepflegten Eigenheimen von Industriellengattinnen, am Kamin von enthusiastischen Frauen, die ihn als eine Art von geistigem Ausgleich brauchen, die das Geld ihrer Männer zwar ausgeben, aber seine Herkunft aus Schrott und Buntmetall oder, dezenter und mit ihren Worten gesagt, aus Stahl und Eisen in diesen Gesprächen am Kamin vergessen wollen. Sie pflegen ein heimliches Mäzenatentum und versammeln Maler und Dichter und Musiker um sich. Diese wiederum sind geschmeichelt, weil man sie in Kreisen bewundert und, mehr noch, respektiert, zu denen sie sonst keinen Zugang haben; wie alle Künstler haben sie außerdem eine Vorliebe für einen gutgedeckten Tisch und gepflegte Weine und von Zeit zu Zeit das Bedürfnis nach einer Frau, die ihnen zuhört. Natürlich sind das alles nur Milieustudien.
Auch Friedrich Georg braucht diese Abende. Er ist dann so ›dicht an unserer Zeit‹. Es ist ein paritätisches Verhältnis, er revanchiert sich. Er liest ein paar Gedichte vor, nie mehr als zwei oder drei, und umhüllt sie mit Schweigen, in dem sich dann seine Worte entfalten. Er sieht lange verstummt ins Feuer und schreibt wahrscheinlich sogar, wenn er jenes Stadium der Lebensdichte und -nähe erreicht, das ihn allein dazu befähigt, einen seiner wirklich hübschen Vierzeiler in das Gästebuch. Und wenn man ihn bittet, ein Bild von sich hineinzulegen, dann hat er in der Regel eines in der Brieftasche bereit. Im letzten Jahr habe ich ein sehr eindrucksvolles Foto von ihm in den Literaturbeilagen der Wochenzeitungen gesehen: Er steht auf einer Landstraße, die rechts und links von Meilensteinen markiert ist. Die Straße ist völlig leer. Er steht. Er geht nicht etwa. Die Hände in den Hosentaschen, auf legere, aber keineswegs nachlässige Weise. Ein Zeichen für sein ›Unterwegssein‹. Nirgends verhaftet. Dieses Suchen und doch den Weg bereits kennen. Irgendwo ein Ziel. – Ich habe das alles begriffen, ohne daß er es mir hat erklären müssen. Obwohl er es sicher gern getan hätte.
Lotte plauderte mit Albrecht. Sie redeten über irgendwelche ›Fälle‹. Manchmal hörte ich Bruchstücke eines Satzes. Ich habe Mühe, mich damit abzufinden, daß sie mehr mit ihm zu bereden hat als ich. Einmal habe ich das ihm gegenüber geäußert, und er hat gesagt: »Huschi, das Reden tut’s doch nicht!« – Aber das Schweigen tut’s auch nicht.
Lotte hatte natürlich Schokoladentäfelchen in der Tasche. Sie weiß natürlich auch, daß es zartbittere sein müssen, während ich mir nie vorstellen kann, daß andere Leute andere Sorten mögen als ich. Immer bringe ich Nußschokolade mit und esse sie nachher selbst. – Sie schob ihm dann und wann ein Täfelchen in den Mund, und beim ersten fragte sie über die Schulter und lächelte, mit dieser Naivität, die nur bei einer Achtzehnjährigen überzeugend ist: »Das darf ich doch?« Das Lächeln, mit dem ich zustimmte, war nicht um einen Grad echter oder besser als ihres und trug mir einen fragenden Blick von Friedrich Georg ein und ein leises: »Ist da etwas?«
Ich bemühte mich, ein überlegenes Gesicht zu machen, und sagte: »Präsens? Nein, ich glaube nicht. Aber Futurum oder Konditional oder einfach: Es könnte etwas draus werden.«
»Ah, deshalb also.«
Ich fragte leise zurück: »Deshalb, wieso: deshalb?«
»Die Einladung an mich.«
Warum das leugnen? Er sah auf einmal so jung aus. Es tat so gut, daß er mich sofort verstand und nicht gekränkt war. Alles Preziöse war auf einmal weg, wir waren alte Freunde, denen es nicht einmal schwerfallen würde, für eine Woche, notfalls auch aus demonstrativen Gründen, etwas mehr zu sein.
Die Alpenpässe waren noch nicht freigegeben; wir fuhren in Göschenen zum Autotunnel und hofften, daß uns auf der anderen Seite des Gotthard bereits Frühling und Sonnenschein erwarten würden. Statt dessen war es auch in Airolo noch kahl und braun. Wir kurbelten die Fenster schleunigst wieder hoch, und Albrecht drehte die Heizung weit auf. Der Wind war kalt, er schien aus dem oberen Tal des Ticino zu kommen. Die Berge waren noch bis weit hinunter in die Täler verschneit, und der erste blühende Mimosenbaum in Bellinzona war so unglaubwürdig wie die Kamelienbäume, die rechts und links der Straße im Schutz der Hausmauern blühten. Rainer hätte gesagt: »So schön, wie’s gar nicht gibt.« Mit seinen fünf Jahren hat er es bereits begriffen. Friedrich Georg fing an, uns zu erklären, daß am Frühling nicht die Farbe der Blüten das Wesentliche sei, sondern das Grün der Wiesen und Sträucher. Wir stritten uns zum erstenmal, nur weil wir uns nicht einigen konnten, welche denn nun die Farbe des Frühlings sei. Friedrich Georg behauptete wie einer, der es schließlich wissen mußte, weil er der Natur, der Schöpfung schlechthin, doch wohl näher sei als unsereins, der Frühling ist grün. Lotte versteifte sich auf Rosa. Albrecht enthielt sich der Stimme. Erst als wir länger auf ihn eindrangen, sagte er ärgerlich, der Frühling sei bunt. Ich hatte mich für Blau entschieden. Was mir eine Rüge des Dichters eintrug; er behauptete, das sei ›second hand‹, ich hätte das aus einem Gedicht von Mörike: ›Frühling läßt sein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte…‹ Ich verteidigte mich. Wenn schon – mußte ich denn immer originell sein? Außerdem sei es nur ein Beweis, welche Bedeutung Dichterworte für mich hätten, und nicht nur für mich; sie seien meinungsbildend schlechthin.
Es wurde schon dämmrig, als wir den See erreichten. Wir hatten noch gesehen, wie die Sonne hinter dem Monte Bré unterging, klar und sehr rot, wie es sich für einen Sonnenuntergang am Lago Maggiore gehört. Es war kalt, aber die Sicht war gut. An den Promenadenwegen standen die weißen Bänke, als ob die Saison schon begonnen hätte. Magnolien, Kamelien, Pfirsichbäume, Mimosen, alles blühte wie im buntesten Reiseprospekt. Lotte hatte bereits mehrfach Ah und Oh gesagt; Friedrich Georg nahm den Frühlingsüberschwang hin, als könnte das alles mit dem, was er unter Frühling verstand, nicht annähernd konkurrieren. Ich war begeistert und tat, als sei alles mein Verdienst und gehöre einfach mit zu dem, was ich hier zehn Tage lang zu verschenken hätte.
Und Albrecht sang: »Mi casa,su casa – dein Haus ist mein Haus«, ein Lied, das wir vor ein paar Jahren einmal unten bei Picelli gehört haben und das seitdem unsere Nationalhymne ist, sobald wir in der ›Casa Susanna‹ sind.
Damit keinerlei Zweifel über die Besitzverhältnisse aufkommen können, hat Tante Be ›Casa Susanna‹ schwungvoll an die rosafarbene Hauswand gemalt.
Albrecht parkte den Wagen auf der Piazza. Wir waren ganz steif geworden von der langen Fahrt, seit zehn Uhr morgens waren wir unterwegs; wir hatten kurz hinter Freiburg in einem kleinen Hotel übernachtet. In zwei Doppelzimmern. Vermutlich hatte es den Männern nicht mehr behagt als Lotte und mir. Ich teile mein Zimmer nicht gern mit Frauen, ich finde es auch immer irgendwie unanständig.
Die Männer kauften die besseren Sachen ein, ›die guten Dinge des Lebens‹, Wein, Zigaretten, Schokolade, und wir Frauen sorgten für das Solide. Ich prahlte vor Lotte mit meinem Italienisch, antwortete mit »’giorno«, wenn man »Guten Tag« zu mir sagte, und verwendete bei jeder Gelegenheit: »grazie« und »prego« und »va bene«.
Merkwürdig ist das: Wenn das Licht über der Haustür brennt und Albrecht die Tür aufschließt, merke ich, wie sehr ich mich hier zu Hause fühle, daß es tatsächlich mein Haus ist und daß es beruhigend ist, das zu wissen. Es ist ein Trumpf, den ich ganz gern in der Hand habe. Tante Be hat das sehr weise vorausgesehen. Ob es allerdings gut ist für Albrecht und mich, ist sehr die Frage. Er merkt es natürlich. Hier bin ich die Stärkere. Aber da wir niemals länger als vier Wochen im Jahr hier sein können, kann es so schlimm mit meiner Überlegenheit nicht werden.
Seit unserem ersten Aufenthalt im Tessin gehört es zu meinen Privilegien, von einem Raum in den anderen zu gehen und die Fensterläden aufzustoßen. Das ist von symbolischer Bedeutung. Es ist, als gähne das Haus aus allen Fenstern und Türen die Müdigkeit und den Winter aus. Wir sind da, heißt es außerdem. Wir haben Ferien, heißt es.
Aber natürlich wollte Lotte helfen. Es gehört zu den lästigen Angewohnheiten von Frauen, sich überall nützlich machen zu wollen. – Albrecht fing, wie sonst auch, damit an, Holz herbeizutragen und Feuer im Kamin zu machen. Ich lief rasch einmal durchs Haus, um festzustellen, ob alles in Ordnung sei, und als ich beruhigt zurückkehrte, hatte Friedrich Georg bereits eine dekorative Pose am Kamin gefunden, die er in den folgenden Tagen oft eingenommen hat: den rechten Arm auf den Kaminsims gestützt, die Beine locker übereinandergeschlagen – ein entspannter Mensch.
Es gibt nur diesen einen Wohnraum, in dem auch gegessen wird. Ich hantierte herum, stellte die Tulpen, die Albrecht an der Piazza gekauft hatte, in einen Krug und hörte dabei, wie Friedrich Georg meinem Mann das Wesen des Feuers erklärte: als die älteste, symbolträchtigste Form von Sein und Sichverzehren. Holz und Asche. Glut und Kälte. Er führte das Thema dann weiter zum einfachen Leben hin und war gerade ›den Dingen ganz nahe gekommen‹, als Albrecht aufblickte und erklärte, daß ihm bei ›einfachem Leben‹ immer gleich die Ölheizung einfiele. Er setzte Friedrich Georg auseinander, welche Vorzüge eine solche Anlage für das Haus haben würde, redete von Thermostaten und Öltanks. Er hat sein Thema zehn Tage lang mit großer Eindringlichkeit weiterverfolgt. Je mehr Friedrich Georg das offene Feuer pries – und er hat es an keinem der Abende am Kamin versäumt –, desto interessanter wurde für Albrecht die Anschaffung einer Ölheizung. Wenn die beiden Männer zusammen sind, bezieht jeder sehr rasch seine Stellung und versteift sich mehr und mehr. Friedrich Georg wird zum reinen Ästheten, Albrecht zum reinen Materialisten. Ich glaube nicht, daß die beiden überhaupt wahrnehmen, wie sehr sie sich verändern. Sie mögen sich ganz gern, soweit das bei so verschiedenen Naturen möglich ist, aber ein wenig gereizt sind sie immer.
Ich hatte während der ganzen Zeit das Gefühl, daß die Konfrontierung mit Lotte für mich durchaus vorteilhaft war. Bei Frauen ist das meist so; die Reize der einen lassen die Reize der anderen erst richtig zur Geltung kommen. Männer wirken immer nur einzeln oder eben in der Masse. Vergleicht man einen mit dem anderen, ist es für keinen vorteilhaft. Albrecht ist im letzten Winter ein wenig dick geworden. Er hat so etwas ›Stattliches‹ bekommen. Mir ist das erst aufgefallen, nachdem ich ihn neben Friedrich Georg gesehen habe. Natürlich hat er aus lauter Opposition zu jeder Mahlzeit die doppelte Portion gegessen, nur um seine Freude an den ›Annehmlichkeiten des Lebens‹, den einzig beständigen Annehmlichkeiten, so weit ging er dabei, zu demonstrieren.
Dafür ist dann Friedrich Georg auch fast verhungert. Ich kann nur hoffen, daß er auf seinen einsamen Gängen irgendwo in einer Trattoria Käse und Brot zu sich genommen hat.
An diesem ersten Abend blieben wir nicht mehr lange auf. Ich ließ Lotte die Butterbrote gleich in der Küche fertigmachen und richtete währenddessen die Betten. Im oberen Stockwerk liegen vier Schlafräume nebeneinander. Jeder hat eine Tür zum Gang und eine Tür, die auf die Holzveranda führt. Es war sehr kalt in den Zimmern, und ich dachte genau wie Albrecht darüber nach, ob es nicht zweckmäßig sei, eine Ölheizung einzubauen. Es würde eine Wertsteigerung für das Haus bedeuten, und daran lag mir durchaus. Schließlich war nicht einzusehen, warum wir in den Ferien frieren mußten, wenn wir es das Jahr über zu Hause warm hatten. Natürlich hat das Haus elektrisches Licht und eine Wasserleitung; Friedrich Georgs Reden über das einfache Leben waren nicht ernst zu nehmen.
Wir hockten noch eine Weile auf den Ziegelstufen vor dem Kamin. Wir waren übermüdet, mochten nicht einmal essen, tranken aber doch so viel, daß uns warm wurde. Albrecht hatte einen Rosatello mitgebracht, einen dieser hellroten leichten italienischen Weine, der an den provençalischen Vin rosé erinnert. Lotte bestand darauf, aus einem Poccalino zu trinken, den sie in der Küche entdeckt hatte, und dann stocherte sie so lange im Feuer herum, bis es qualmte.
Friedrich Georg ging noch eine Weile unter der Pergola hinter dem Haus auf und ab. Man hat einen sehr hübschen Blick von dort auf Locarno und Menusio. Die Kette der Laternen am See schimmerte hell und kalt; man sah die Lichter am gegenüberliegenden Ufer. Die Sterne standen ungewöhnlich klar am Himmel.
Als er wieder hereinkam, belehrte er uns, wie wichtig es sei, sich über die Lage eines Hauses zu orientieren, bevor man ein erstes Mal unter seinem Dach schläft. ›Den Stand der Sterne wissen‹ und auch, wo am nächsten Morgen die Sonne aufgehen werde. Alle seine Sätze enden im Konjunktiv, also im Ungewissen.
Albrecht hat sein Zimmer an dem einen Ende des Ganges, meines liegt an dem anderen, so ist das von jeher; seines hat Morgensonne, meines Abendsonne. Zum Gute-Nacht-Sagen wird der Balkonweg benutzt, für den Rückweg der Flur. Die beiden mittleren Zimmer hatte ich für unsere Gäste gerichtet. Lottes Zimmer grenzt an das von Albrecht. Das hätte nicht sein müssen, aber ich arrangierte es so, damit keiner denken sollte, ich sei etwa mißtrauisch. Es ist Rainers Zimmer, der schon ein paarmal mit hier war. In dem Wandregal steht sein Spielzeug, und an den Wänden hängen Fotos. Babybilder von ihm und natürlich auch ein paar Bilder von Albrecht und mir, zusammen mit unserem Kind. Ich fand, auch das könne nicht schaden.
Als ich mein Zimmer betrat, war es angenehm durchwärmt. Albrecht hatte den Heizventilator aufgestellt. In diesen äußeren Dingen ist er noch genauso aufmerksam wie früher.
Vom Balkon aus klopfte ich noch einmal an alle Türen, fragte, ob alle gut versorgt seien, und wünschte eine gute Nacht. Und dann lag ich lange wach und bemühte mich, nicht auf die Geräusche im Haus zu horchen, und versuchte, nicht zu warten, ob Albrecht noch zu mir käme. Er hatte unmißverständlich gesagt, daß er müde sei von der langen Fahrt.
Ich war an diesem ersten Abend keineswegs davon überzeugt, ein kluges Arrangement getroffen zu haben.
Als ich aufwachte, war es bereits ganz hell. Ein strahlender Tag, wie mir schien. Ich horchte, ob sich schon etwas im Haus regte, aber alles war still. Ich stand auf, zog die Vorhänge zurück und war entschlossen, diesen ersten Morgen in meinem Haus zu genießen. Und dann sah ich, woher die Helligkeit rührte: Es lag tiefer Schnee. Das Haus war noch im Schatten, erst gegen neun Uhr erreicht die Sonne den Platz unter der Pergola; jetzt eben schien sie blendend und silbern auf den See.
In diesem Augenblick, als ich fröstelnd hinuntersah auf Locarno, wurde mir zum ersten Male klar, daß ich zehn Tage lang mehr Hausarbeit haben würde als im ganzen übrigen Jahr. Zu Hause habe ich eine ständige Hilfe, und seit Rainer vormittags im Kindergarten ist, führe ich ein nahezu beschauliches Leben. Früher habe ich geglaubt, ich würde mich langweilen, ich würde mir unausgefüllt vorkommen, aber das passiert nur sehr selten. Hier hatte ich auf einmal für vier Personen zu sorgen, unter ungleich schwierigeren, zumindest unbequemeren Umständen. Friedrich Georg konnte nicht einmal zum Einkaufen nach Locarno geschickt werden, da Albrecht ihm den Wagen nicht geben würde, und die fünfhundert Stufen von der Piazza bis zu unserem Haus sind eine Strapaze, auch wenn man nicht rechts und links Einkaufstaschen an den Armen hängen hat. Lotte – nun, sie war die Sekretärin meines Mannes, ihr oblag der geistige Teil, und viel mehr als den guten Willen schien sie zur Hausarbeit sowieso nicht mitzubringen.
Mein Vater hat mir bereits sehr früh beigebracht, daß es unsinnig sei, vor dem Frühstück grundsätzliche Betrachtungen über das Leben und die fernere Zukunft anzustellen. Ich nahm mir den alten grünen Bademantel von Herrn Simonetti, der immer hinter der Tür hängt, und ging zum Duschen.