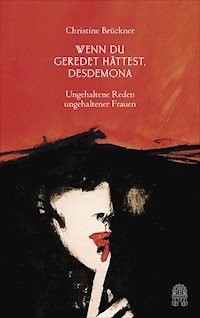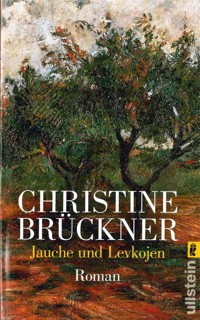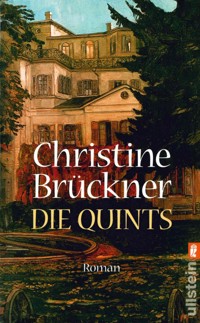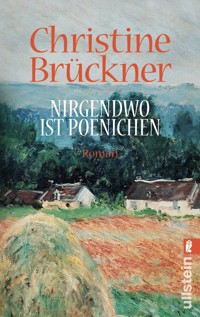6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Refinery
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wenn heute behauptet wird, dass die Schriftsteller in den fünfziger Jahren sich nicht oder zuwenig mit der Vergangenheit auseinandergesetzt hätten, dann beweist dieser zweite Roman von Christine Brückner, nach ihrem preisgekrönten Erstling "Ehe die Spuren verwehen" 1957 erschienen, das Gegenteil. Katharina und Bastian, zwei grundverschiedene Charaktere, glauben jeder auf seine Art die Wirklichkeit meistern zu können: das Mädchen, indem es sich engagiert, sich in dem Wunsch zu helfen, dem Leben stellt, der Archäologe, indem er seine Erfüllung darin sucht, das Leben beobachtend zu registrieren. Kataharina verstrickt sich in ein Netz von Schuld, aber auch Bastians Rolle als "Zaungast" des Lebens erweist sich als fragwürdig. Am Ende vieler Umwege wagen beide den Versuch, einen neuen Weg gemeinsam zu beginnen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 337
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Die AutorinChristine Brückner (1921 - 1996) zählt zu den renommiertesten Schriftstellerinnen Deutschlands. Sie verfasste Romane, Erzählungen, Kommentare, Essays, Schauspiele, auch Jugend- und Bilderbücher. Besonders mit der Poenichen-Trilogie wurde sie einem großen Publikum bekannt. Mehr über Christine Brückner erfahren Sie über die Stiftung Brückner-Kühner unter http://www.brueckner-kuehner.de/.
Das Buch
Wenn heute behauptet wird, dass die Schriftsteller in den fünfziger Jahren sich nicht oder zuwenig mit der Vergangenheit auseinandergesetzt hätten, dann beweist dieser zweite Roman von Christine Brückner, nach ihrem preisgekrönten Erstling Ehe die Spuren verwehen 1957 erschienen, das Gegenteil.
Katharina und Bastian, zwei grundverschiedene Charaktere, glauben jeder auf seine Art die Wirklichkeit meistern zu können: das Mädchen, indem es sich engagiert, sich in dem Wunsch zu helfen, dem Leben stellt, der Archäologe, indem er seine Erfüllung darin sucht, das Leben beobachtend zu registrieren. Kataharina verstrickt sich in ein Netz von Schuld, aber auch Bastians Rolle als »Zaungast« des Lebens erweist sich als fragwürdig. Am Ende vieler Umwege wagen beide den Versuch, einen neuen Weg gemeinsam zu beginnen.
Christine Brückner
Katharina und der Zaungast
Refinery by Ullsteinwww.ullteinbucherlage.de/verlage/refinery
Neuausgabe bei Refinery Refinery ist ein Digitalverlag der Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin Oktober 2017 (1) © Verlag Ullstein GmbH, Frankfurt/M - Berlin 1995 Covergestaltung: © Sabine Wimmer, Berlin ISBN 978-3-96048-092-1 Hinweis zu Urheberrechten Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben. In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
… das Licht des Lichts Erkennt den Antrieb, nicht die Tat, Der Schatten Schatten sieht die Tat allein.
Yeats: Die Gräfin Cathleen
Sie werden sich nicht an diesen Tag erinnern können, den 12. März 1938.
Es war kein ungewöhnlicher Tag. Erst einen Tag später zogen Fackelzüge durch die Straße, in der das Haus des Doktors stand. Man feierte den Anschluß Österreichs an das Reich. Man muß das Stichwort haben, um heute, von dem Sessel aus, in dem Sie sitzen, auch nur das Gespräch verstehen zu können, das hinter dem Fenster im zweiten Stock zwischen dem Doktor und dem Mädchen Katharina geführt wurde.
Das Haus war alt wie das Jahrhundert, und noch stand es, als ob es ein nächstes Jahrhundert Bestand haben könnte. Man mußte die feinen Nerven des Doktors haben, um wahrzunehmen, daß alles Unheil von dem Marschtritt ausgehen würde, der an manchen Tagen die Häuser auch dieser scheinbar ruhigen Straße erbeben ließ.
»Nun, Katharina – sind Sie glücklich?« Er wandte nicht einmal den Kopf nach ihr um.
Katharina blieb am Fenster und sah auf die Straße, ohne etwas wahrzunehmen. »Glücklich, Doktor? Hat man Sie danach gefragt, ob Sie glücklich sind? Als ob es darauf ankäme!«
»Wenn man achtzehn ist, doch, dann kommt es darauf an.«
»Was heißt es, wenn Sie ›achtzehn‹ sagen? Heißt das: so jung? Sie wissen genau, daß ich nicht jung bin, und wenn Sie jetzt noch ›jung und glücklich‹ sagen, kann ich gleich wieder gehen.«
Beide schwiegen. Der Doktor schaltete die Lampe ein, schaltete sie wieder aus, sah dann eine Weile zu Katharina hinüber, deren Umriß sich undeutlich im Fensterrahmen abhob. Er blieb auch jetzt in seinem Sessel, obwohl es ihn trieb, aufzustehen und zu ihr zu gehen.
Niemals einem Impuls gehorchen war eines der Lebensgesetze, die er sich aufgestellt hatte, als er im gleichen Alter war wie Katharina. Einen kühlen Kopf behalten; sich nicht nachgeben; es sich nicht leichtmachen.
Es wäre leicht gewesen, sich jetzt neben Katharina zu stellen und den Lichtern zuzusehen, die in den Straßenzügen aufflammten. Er wußte, wie ihr Trotz müde wurde in dieser Stunde, in der auch ihr Aufbegehren einschlief. Einmal hatte sie sogar den Kopf an seine Schulter gelehnt, an diesem Fenster hier. Aber er liebte dieses Mädchen, weil es stark war. Wie hätte er einen Augenblick der Schwäche ausnutzen dürfen, in der sie so wenig sie selbst war?
Also blieb er in seinem Sessel und wartete. Vielleicht würde sie heute sprechen. Vielleicht würde sie gehen, ohne daß er erführe, warum sie gekommen war. Um ihm zu sagen, daß sie die Reifeprüfung bestanden hatte? Das war kein Grund, nicht für Katharina. Er glaubte nicht einmal, daß ihre gelegentlichen Besuche seiner Person galten. Ihre Zuneigung galt eher diesem Raum und dem Fenster, aus dem man hinuntersah auf die Stadt, den Fluß und die breite Autostraße, die die Stadt nach Westen verließ. Einmal hatte sie gesagt: »Meine Augen müssen manchmal die Straße entlanglaufen, die Beine sind ihnen nicht schnell genug, die sind schon müde, bis ich am Stadtrand bin.« Alles ging ihr nicht schnell genug.
Er versuchte, das Gespräch wieder in Gang zu bringen. »Warum wollen Sie das tun, Katharina?«
Sie drehte sich heftig um, als hätte sie die ganze Zeit auf dieses Stichwort gewartet. »Jetzt fragen auch Sie, Doktor! Warum tut man so etwas? Warum? Warum vergraben Sie sich hinter Ihren Büchern? Warum tun Sie etwas, das keinem Menschen nutzt? Keinem Menschen! Ob diese Figur da nun den rechten oder den linken Fuß anhebt, ob sie ein kurzes Gewand anhat oder ein langes – mein Gott! Wen kümmert das schon! Und Sie hängen Ihr ganzes Leben dran, das Ihnen Gott nur dieses eine Mal gegeben hat und doch bestimmt nicht, damit Sie nach Steinen suchen, die er vor tausend Jahren gestürzt hat. Alle zehn Jahre schreiben Sie …«
»Höchstens alle fünfzehn Jahre, Katharina.«
»Also gut! Alle fünfzehn Jahre schreiben Sie ein Buch, und das lesen dann hundert Leute, die auch einen Narren an Steinen und so etwas gefressen haben, und – und – meinen Sie denn, ich könnte begreifen, warum Sie das tun? Als ich Sie zum ersten Mal sah, da habe ich geglaubt, Sie wären ein richtiger Mensch. Von dem man lernen kann, wie man es anfangen muß. Und als ich herkam, gab es nur Bücher und Steine. Nichts, was lebt. Nur wenn man an Ihrem Fenster steht und hinuntersieht, da ist das Leben. Auf den Straßen, hinter den Gardinen. Richtige Menschen! Kinder, alte Leute, Kranke, vielleicht sogar ein paar Glückliche – aber es sind Menschen! Und hier bei Ihnen sind Bücher, Bücher und Steine, und dazwischen leben Sie. Und Sie wollen mich fragen, warum ich das tun will!«
»Katharina, Sie setzen mich ins Unrecht. Wenn Sie es so sagen, hier Bücher – dort Menschen, ziehe ich den kürzeren, ich weiß das. Ich habe mich beschieden. Vielleicht zu früh. Einmal werden auch Sie es tun – widersprechen Sie doch nicht gleich! Sie werden es müssen, und der Gedanke daran schmerzt mich.«
Katharina lachte auf. »Ach, Doktor, immer die großen Worte! Es schmerzt Sie! Ich glaube, Sie können eine ganze Menge Schmerzen ertragen, die andere erleiden. Verzeihung! Das hätte ich nicht sagen dürfen, aber warum reden Sie auch so.«
»Sie haben recht. Ihnen gehört das ganze Leben. Nehmen Sie es nicht ernst, wenn ich sage, daß Sie froh sein werden, später einmal, wenn Sie die Hälfte bekommen.« Er lenkte ein: »Wollen Sie mit mir zu Abend essen, oder werden Sie erwartet?«
»Erwartet? Nein, ich werde nicht erwartet! Ich bin noch nie im Leben erwartet worden.«
»Doch, ich warte sehr oft am Abend, ob ich Sie auf der Treppe höre. Ich warte gern auf Sie, auch wenn Sie nicht kommen.«
»Soll das …?«
Der Doktor lachte. »Ja, Katharina, das sollte ein Kompliment werden, aber Sie machen es mir nicht leicht.«
»Warum auch!«
»Sehen Sie, nun fragen auch Sie ›warum‹. Wenn wir miteinander reden, beginnt jeder zweite Satz mit ›warum‹. Woran liegt das?«
»Sagen Sie doch gleich: Warum, warum fragen wir immer warum? Ich meine, ich müßte von Ihnen lernen können, aber alles, was Sie sagen, ist voll Skepsis, ist müde und resigniert. Eines Tages werde ich zu Ihnen kommen, und dann sitzen Sie am Schreibtisch und sind aus Stein. Dann hole ich mir einen Hammer und klopfe an Ihren Kopf und sage …«
»Granit!«
Katharina lachte. »Meinetwegen, Granit. Eigentlich wollte ich sagen, sitzender Mann aus einem Kammergrab in Cerveteri, etruskisch. Siebentes Jahrhundert, Kalkstein.«
»Sie halten mich für sehr alt, Katharina?«
»Nein! Manchmal sind Sie jünger als ich, aber Sie möchten gern alt sein, weise und abgeklärt, nichts soll Ihnen mehr etwas anhaben können. Alles kennen Sie schon, über alles haben Sie ein Urteil, nichts erstaunt Sie mehr, aber im Grunde Ihres Herzens verwundern Sie sich über sich selbst, daß Sie das sind, der so klug daherredet. Sie lassen Ihren Kopf reden, und Ihr Herz hört ihm verwundert zu. Wenn Sie das meinten, vorhin – ja, ich lasse mein Herz reden, und wehe, wenn mein Kopf was anderes denken will, und wehe, wenn er es hindern will, zu reden und danach zu handeln.«
Sie klappte das Buch zu, das sie noch immer in der Hand hielt. »So, das war so etwas wie ein Bekenntnis, Doktor.«
Der Doktor liebte es nicht, ›grundsätzlich‹ zu werden, wie er es nannte. Wenn man die Vierzig erreicht hatte, wußte man, wie fragwürdig alle Erkenntnisse werden konnten. Dennoch antwortete er ihr: »Ich bin ganz froh, daß mein Kopf dem Herzen dann und wann in die Parade fährt. Es hat mir genug Ungelegenheiten gemacht, zuzeiten.«
Katharina wickelte die Gardinenschnur um die Finger und biß sich auf die Lippen, aber sie hielt seinen Augen stand. »Doktor, sehen Sie mich nicht so an, als wollten Sie hingehen und mir Ihr Herz wie – wie einen Teller Kompott vor die Füße stellen!« Sie ließ die Gardinenschnur los, rutschte von der Fensterbank und griff nach der Schulmappe. »Ich muß überhaupt gehen!«
Der Doktor stand gleichfalls auf. »Sie sind inkonsequent, Katharina! Eben noch haben Sie mir vorgeworfen, daß ich mein Herz nicht reden lasse, und wenn ich es tue, ersticken Sie schon den Versuch. Und merken Sie sich: Vergleichen Sie möglichst nie wieder das Herz eines Mannes mit einem ›Teller Kompott‹!«
Er schien zum ersten Mal wirklich gekränkt. Sie war bestürzt; das hatte sie nicht gewollt. Sie ging zu ihm. »Bitte, verzeihen Sie! Ich wollte nur nicht, daß Sie etwas sagen, was vielleicht Ihr Kopf, ich meine Ihr Herz …« Sie verwirrte sich vollends, errötete und hatte plötzlich Tränen in den Augen.
Als er sie in die Arme nahm, verhielt sie sich still. Er mußte sie behutsam von sich schieben und sagen: »Jetzt wollen wir etwas essen. Sie müssen mir in der Küche helfen, eine Haushälterin kann man sich als Privatmann nicht leisten, wenn man von Büchern und Steinen lebt.«
Nach dem Essen kauerte sich Katharina in ihren Sessel, den, der am weitesten von der Lampe entfernt stand. Sie war unruhiger als sonst, fing immer wieder an, etwas zu erzählen, brach aber bald darauf wieder ab. Der Doktor rauchte und ließ ihr Zeit.
»Kennen Sie das, Doktor? Man spürt, daß etwas anders wird. Ein Abschnitt ist zu Ende, eine neue Stufe. Wenn Sie es kennen, wissen Sie auch das richtige Wort dafür, ich kann’s nicht ausdrücken, das klingt alles so pathetisch. Als ich heute aus der Schule wegging und die andern das Abitur feiern wollten, ging ich zu Ihnen, und hier an Ihrem Fenster ist es mir klargeworden. Heute beginnt mein Leben. Von heute an nehme ich es in die Hand. In eigene Regie. Da unten, in diesen Straßen ist von nun an meine Welt.«
Sie schwieg eine Weile, dann sah sie ihn voll an. »Es ist gut, daß ich weiß, daß Sie manchmal am Fenster stehen und in die Straßen blicken, ich weiß mich dann von Ihren Gedanken umgeben und beschützt.«
»Schön, daß Sie das sagen, Katharina!«
»Wissen Sie, ich wollte, Sie wären mein Vater. Ich brauche manchmal jemanden, der mir rät. Jemanden, der mich gern hat und mein Bestes will, aber nur das und nichts anderes.«
»Wenn ich Ihr Vater wäre, Katharina, ich glaube, ich ließe Sie nicht gehen. Ich wäre ein altmodischer Vater, der seine Tochter so lange wie möglich vor dem Leben bewahren möchte. Ich bin aber nicht Ihr Vater und habe kein Recht dazu, Sie zu halten, und will es auch nicht. Wahrscheinlich ist es der richtige Weg. Jeder Weg erweist sich am Ende als richtig, es gibt keine falschen. Kommen Sie zu mir, wenn Sie meinen, daß es Ihnen hilft. Auch wenn Sie nicht mehr brauchen als eine Stunde hier am Fenster und einen, der mit Ihnen schweigt.«
Ein Nachtfalter hatte sich im Netz der Gardine gefangen. Katharina stand auf, um ihn zu befreien, schloß das Fenster und blieb dort stehen, den Rücken an das Fensterkreuz gelehnt.
»Als meine Mutter starb – damals habe ich es auch gespürt, daß etwas zu Ende ging, dabei war ich doch noch nicht elf! Darf ich, ich meine, soll ich es Ihnen erzählen, Doktor, oder stört Sie das?«
Er nickte zustimmend, hob die Hand ein wenig und ließ sie zurück auf die Sessellehne fallen und sah das Mädchen nicht an, weil er wußte, daß sie das irritierte.
»Meine ersten Erinnerungen an sie – an Mutter – – verbinden sich mit Tränen und Blumen. Ich glaube, sie war schön. Wenn ich weinte, weil ich mir weh getán hatte, dann schloß sie mich in die Arme und weinte mit mir. Ich hörte sofort auf. Ich glaube, ich habe nicht mehr geweint, wenn sie in der Nähe war, nachdem ich sechs Jahre alt war. Ich hockte mich auf die Treppe zum Speicher und kam erst wieder herunter, wenn es vorbei war. Ich bewunderte sie, so wie man ein Bild bewundert und schön findet, das man nicht versteht und nicht einmal deutlich sehen kann. Sie sah aus wie Genoveva. Erinnern Sie sich an die Legende vom Pfalzgrafen Siegfried, der seine Frau des Ehebruchs beschuldigte und sie und ihren kleinen Sohn in ein verlassenes Waldtal verbannte? Dort lebte sie in einer Felsenhöhle. Mutter hat mir diese Geschichte oft vorgelesen. Sie sah genauso aus wie Genoveva: zart und schmal, dunkelhaarig, große umschattete Augen, und sie wollte aus mir solch einen kleinen ›Schmerzenreich‹ machen, aber ich wehrte mich! Ich wollte nicht, daß sie ›mein Armes‹ sagte oder ›wir beiden Armen‹.
Damals, ich war etwa fünf Jahre alt, verließ uns mein Vater. Wenn ich in Mutters Armen ganz steif wurde und mich sträubte gegen ihre Tränen und ihr Parfüm, das ich nicht leiden konnte, dann ließ sie ihren Kopf, überwältigt von Schmerz, auf die Sofalehne sinken und flüsterte: ›Oh, du hast kein Herz, genau wie dein Vater.‹ Oder: ›Du bist nicht mein Kind, du kannst meine Tränen mit ansehen, kannst mich quälen, genau wie er.‹
Ein Jahr darauf tauchen in meiner Erinnerung diese Blumen auf. Vorher hatte ich noch nie Lilien gesehen. Dann standen sie wochenlang in Mutters Wintergarten, und sie beschäftigte sich damit; beschnitt ihre Stengel, gab ihnen frisches Wasser, und immer, wenn dieser Mann kam und neue brachte, lächelte sie unter Tränen und schickte mich aus dem Zimmer. Ich wußte nicht, was ich mehr haßte, diesen Mann oder die Lilien. Zweimal warf ich den Krug um; ich tat, als ob ich gestolpert wäre. Mutter schlug mich, weil ich so ungeschickt war. Sie kam gar nicht darauf, daß ich unglücklich sein könnte.
Alles, was sie erreichte, erreichte sie durch ihr Nichts-Tun, ich meine, durch ihr Nichts-dagegen-Tun, sie ließ alles an sich geschehen, lenkte es höchstens durch ihr Lächeln und durch Tränen. Kurz nachdem sie diesen Mann geheiratet hatte, habe ich sie gefragt: ›Warum weinst du denn jetzt schon wieder?‹ Da schlug sie die Augen groß auf und sagte zu ihm: ›O dieses Kind! Wie ich immer spüren muß, daß es seines ist.‹
Ich wurde wieder ohne Abendbrot ins Bett geschickt.
Damals fing das schon an, daß ich mich auflehnte. Wenn Mutter sagte, ich sei gar nicht ihr Kind, wollte ich es auch nicht sein. Ich wollte nicht jemand sein, der immer weint, immer Mitleid erwartet und umsorgt werden will. Ich fing an, ohne allen Grund zu lachen; ich lief, um dem neuen Vater, der sich gar nichts aus mir machte, gefällig zu sein. Ich half dem Mädchen in der Küche beim Abtrocknen, ich war fleißig in der Schule, ich wollte etwas lernen. Ich wollte später einmal nicht dasitzen wie meine Mutter, mit einem Buch in der Hand, oder Blumen gießen und handarbeiten. Ich wollte nicht sein wie sie. Ich verachtete sie, aber ich bewunderte sie auch. Wahrscheinlich weil ich wußte, daß ich gar nicht so werden konnte wie sie, so schön und anmutig und hilfsbedürftig. Ihre Schwäche war zugleich ihre Stärke. Ich wußte von klein auf, daß ich mir immer selbst helfen muß. Alle hatten für Mutter eine Schwäche! Ich will, daß man für mich eine Stärke hat!«
Sie ließ sich durch ein Lächeln des Doktors nicht irritieren, den die Vorstellung, er selbst könne eine Stärke für Katharina haben, erheiterte.
»Seit ich einmal gesehen hatte, daß sie diesen Mann küßte, entzog ich mich ihr, wenn sie mich in die Arme nehmen wollte. Ich war darum ein kaltes Kind, nüchtern, ohne Anmut, wie sie allen Leuten sagte. Ich war das genaue Gegenteil von dem kleinen Mädchen, das sie sich gewünscht hätte. Sie zog mich an wie eine von den Zelluloidpuppen in den Spielzeugläden. Ich verschmierte die Batistschürze und riß die Volants von den Kleidern, weil ich nicht aussehen wollte wie eine Puppe. Ich war unglücklich und allein. Trotzdem tat ich, als ob ich mich vor Übermut nicht zu lassen wüßte. Sobald man mich beobachtete, tobte ich durch die Wohnung oder den Garten.
Alle zwei Monate holte mich mein richtiger Vater für einen Nachmittag mit dem Auto ab, das war bei der Scheidung so ausgemacht. Ich war ein Gegenstand, den man sich ausleihen konnte. Er fuhr mit mir spazieren. Auch ihm gegenüber war ich dreist und trotzig. Ich glaubte, er hätte Mutter verlassen, weil er ihre Tränen leid war, darum mußte ich fröhlich sein, damit er mich nicht auch leid wurde. So ähnlich muß ich wohl gedacht haben. Ich fuhr gerne Auto. Der neue Vater hatte keines, und ich hatte von klein auf Sinn fürs Reale: Ich genoß den Ausflug. Wenn meine Fröhlichkeit zu Beginn der Fahrt erzwungen war, nachher war sie echt. Wir fuhren fast immer an den Fluß. Er warf Steinchen mit mir und schnitt Wasserspritzen aus Holunderzweigen; er hatte mir ein kleines Segelschiff gekauft, das er jedesmal hinten im Wagen mitbrachte. Er spielte bereitwillig mit mir, aber lieb hatte auch er mich nicht. Ich glaube, er suchte immer in mir die Mutter zu erkennen und war enttäuscht, daß ich ihr so wenig glich.
Ich war neun Jahre alt, als sie krank wurde. Der neue Vater nahm es nicht ernst. Kranksein gehörte zu ihr. Sie lag auf der Chaiselongue im Wintergarten. Ihre alberne Sofapuppe saß im Sessel mit schwarzen Seidenhosen und der roten Mütze auf den blonden Locken; und wenn im Radio gespielt wurde – das war damals so ein Schlager – ›und im Herzen Sägespäne, genau wie du‹, dann lachte Mutter und warf dem neuen Vater die Sofapuppe zu.
Zu den Blumen kamen Kissen und Arzneiflaschen, Mutters Stimme wurde müder, die Ringe unter ihren Augen wurden immer dunkler, noch häufiger standen Tränen in ihren Augen. Manchmal zog sie mich an sich und sagte: ›Wenn ich dich nun bald allein lassen muß, Püppchen …‹ So nannte sie mich meist. Und ich stand da wie ein Klotz, unfähig, etwas zu sagen, und würgte an meinen Tränen. Aber ich weinte erst, wenn ich in meinem Bett lag. Sie war so schön, so wie die Frauen in den Romanen, Frauen, die sterben mußten, weil niemand sie verstand. Ich wollte, daß sie sich wehrte. Ich sagte: ›Schluck doch die Arznei! Du mußt viel essen!‹ Ich wollte ihr immer noch mehr Kissen unter den Kopf schieben, ihr Wein holen, Tropfen ins Glas zählen. Ich zitterte vor Eifer und vor Verzweiflung, daß sie nur litt und sich nicht wehrte. Der neue Vater saß selten bei ihr. Der Reiz, eine zarte, leidende Frau zu haben, war schon vorbei. Sie hätte vielleicht länger gelebt, vielleicht wäre sie sogar gesund geworden, wenn sie nicht Angst gehabt hätte, daß auch er sie verlassen könnte. Sie hatte ja keinen anderen Lebensinhalt als diesen Mann. Von mir glaubte sie, daß ich sie nicht brauchte.
Sie starb. Ich war noch nicht elf Jahre alt. Ich hatte zwei Väter und keine Mutter. Ich weiß nicht mehr, ob der richtige Vater zu der Beerdigung kam, aber ein paar Tage später holte er mich zu sich. Jetzt sollte ich plötzlich eine neue Mutter haben. Bis dahin hatte ich gar nicht gewußt, daß er wieder geheiratet hatte. Ich war wie benommen. Ich bin weggelaufen; die Polizei hat mich zurückgebracht. Ich aß nicht, ich redete kein Wort. Am Ende kam ich in eine Art Internat, ein besseres Waisenhaus.
Dort habe ich mich wohl gefühlt – wenn das schon Wohlfühlen ist, wenn man nicht mehr unglücklich ist. Ich kam gar nicht mehr dazu nachzudenken. Es geschah etwas Eigentümliches: Die Kinder in meiner Gruppe taten, was ich wollte. Ob wir nun Spielstunde hatten oder ob wir im Garten arbeiten mußten. Die Schwestern hatten mich gem. Sie schubsten mich nicht hierhin und dahin, sie lobten mich, wenn ich fleißig war, machten mit, wenn wir lachten und Unfug trieben. Auf einmal waren das, was bisher nichts als Fehler an mir gewesen waren, Vorzüge! Wir waren ein Frauenstaat. Auch die Gartenarbeit wurde von den Schwestern und den größeren Mädchen getan. Die Luft, in die ich geraten war, war männerfeindlich. Mir war das nur recht. Ich haßte Männer, weil sie die Frauen so schwach machen, so abhängig von sich und dem, was sie Liebe nennen. Niemals wollte ich so unterwürfig sein wie meine Mutter! Ich wollte auf eigenen Füßen stehen, ich wollte etwas leisten im Leben, mindestens soviel wie ein Mann!
Ich hatte Autorität bei meinen Kameradinnen, was aber mehr war, wahrscheinlich viel zuviel für mich: sie hatten Vertrauen zu mir. Sie kamen, auch die älteren, und schütteten mir ihr Herz aus, mir, einem Kind von dreizehn Jahren. Sie hatten viel mehr vom Leben gesehen als ich, denn ich war, trotz allem, behütet aufgewachsen. Sie rissen Abgründe, so nennt man das ja wohl, vor mir auf. Aber ich stürzte erst hinein, wenn Anne – die kam am häufigsten – weg war. Solange sie sprach, war ich still und hörte zu, und dann sagte ich ihr – irgend etwas, daß wir anders sein wollten als die Großen. Daß wir Zusammenhalten müßten, um uns später behaupten zu können.
Kennen Sie das rote Backsteinhaus rechts vorm Nordfriedhof, Doktor? Nein? Das dachte ich mir. Ich war gestern da. Es ist die Leichenhalle. Man kann dort hineingehen und herausgehen, ohne daß sich einer darum kümmert. Wo der Wärter sich aufhält, weiß ich auch nicht. In jedem Milchladen wird man gefragt, was man will, dort nicht. Das wollte ich nur einmal ausprobieren. Das Mädchen, das im Bett neben mir schlief, das ist wochenlang, jeden Morgen vor der Schule, hingegangen und hat die weißen Leinentücher aufgeschlagen und sich die Toten angeguckt. Sie hat keine Mutter mehr, genau wie ich. Sie hat nicht zu ihr gedurft, als sie gestorben war, die Großmutter wollte das nicht, sie wollte das Kind schonen. Der Erfolg war, daß sie hinging und sich die anderen Toten im Leichenhaus ansah. Jeden Morgen! Begreifen Sie das? Sie war damals neun oder zehn Jahre alt. Als sie in eine andere Wohnung zogen, weit weg, konnte sie nicht mehr hin, aber noch jetzt sehe ich manchmal, wie sie die Leute anstarrt, die Schwestern, aber auch uns Mädchen. Dadurch wurde ich erst darauf aufmerksam. Ich habe sie gefragt, weil sie einen so lüsternen Ausdruck im Gesicht hat dabei. ›Was ist denn, Anne?‹ habe ich gefragt. Und da hat sie gesagt: ›Ich stell’ mir nur vor, wie die mal aussieht, wenn sie tot ist. Tust du das nie?‹ – ›Nein‹, habe ich gesagt, ›ich würde mich schämen. Ich gucke ja nicht einmal jemanden an, der schläft. Meinst du, ich wüßte, wie du aussiehst, wenn du schläfst?‹ Da fuhr sie mich an: ›Das kannst du auch gar nicht, weil ich das nicht will! Ich werde immer vorher wach. Ich bin bestimmt wach, wenn du nur die Augen aufschlägst.‹ Am Abend hat sie mir dann von der Leichenhalle erzählt. Zuerst hat sie sich gefürchtet, aber später blieb sie ganz kalt dabei. Sie hat die Toten angefaßt, die Haare und das Kinn und die Hände, und dann hat sie sie wieder zugedeckt und ist in die Schule gegangen. Als sie zwölf war, hat ihr Vater sie zu uns in das Heim getan, weil sie schwer erziehbar ist. Keiner weiß, was mit ihr in Wahrheit los ist. Sehen Sie, Doktor, da müßte man helfen können! Und man muß den Vater sehen und die Großmutter, man muß die Ursachen erkennen!
So ist das Leben unten in den Straßen. Von hier sieht alles aus wie Kulissen für den Herrn Archäologen. Die Silhouette der Häuser überm Fluß und ein bißchen Musik dazu von Autos und Straßenbahnen und Radio; selbst die Fabrikschlote sehen aus wie Dekorationen, von hier aus. Hier oben sitzt man wie in einer Gondel überm Jahrmarkt und besieht sich das Treiben, ein bißchen hochmütig, ein bißchen mitleidig. Man fühlt sich zwar isoliert und manchmal allein, aber man gehört – Gott sei Dank! – nicht dazu.«
Sie machte eine Pause und fing von neuem an.
»Ich habe das nie gekonnt, zu jemandem hingehen und ihm aufladen, was mich bedrückt. Ich glaube, dies ist das erste Mal, daß ich jemandem von mir erzähle. Eine Zeitlang schrieb ich alles in ein Tagebuch, aber dann kam mir das albern vor, Backfische tun so etwas. Manchmal gehe ich jetzt morgens in die Kapelle, die zur Anstalt gehört, aber ich weiß nicht, wie man das macht, zu einem reden, den man nicht sieht. Mich wirft ja auch nichts um; ich habe genug Kraft, genug für mich und andere.
Mein Vater kümmert sich nicht mehr um mich. Man hat ihm wohl berichtet, daß ich mich gut eingefügt habe, fleißig und selbständig sei. Er hat inzwischen aus seiner zweiten Ehe zwei Jungen. Als es ihm wirtschaftlich schlecht ging und er kein Geld mehr für mich zahlen konnte, bekam ich eine Freistelle im Lyzeum. Morgens saß ich in der Schule, nachmittags half ich im Kinderhort, der zur Anstalt gehörte, abends machte ich Schulaufgaben, und nachts hielt ich Sprechstunde.
Bitte, verstehen Sie das richtig! Es war mir ganz ernst und den Mädchen auch. Ich lernte, wie man die einen und wie man die anderen behandeln muß; solche, die nur reden wollen, und solche, die sich ausweinen wollen, und andere, die einen handfesten Rat brauchen.
Ich hörte durch sie von einer Welt, von der ich nur einen kleinen Ausschnitt kannte. Ich war neugierig, ob sie so war, wie die Mädchen sie kennengelernt hatten, bevor sie zu uns kamen, oder ob sie war wie in den Büchern, die ich las – oder ganz anders. Ich war neugierig, aber ich war auch bereit, den Kampf mit ihr aufzunehmen. Insgeheim suchte ich immer nach einem Menschen, der eine Welt verkörperte, wie sie auch sein kann: in Ordnung! Wissen Sie, wie ich das meine, Doktor? Ich hatte nie eine wirkliche Freundin. Als ich Sie damals sah, in der Ausstellung, dachte ich, das ist er, ein richtiger Mensch. Aber gleichzeitig war ich traurig, oder besser: Ich wunderte mich, daß dieser Mensch ausgerechnet ein Mann sein sollte.
Ich war vorher noch nie in einer Gemäldegalerie gewesen, ich hielt Bilder für etwas Totes. Gemaltes Leben, was war das im Vergleich zur Wirklichkeit! Dann sah ich dieses Bild und mußte an mich halten, daß ich nicht weinte, und es waren doch nur Farben auf einer Leinwand, fünfhundert Jahre alt. ›Verkündigung‹ und ›unbekannter Meister‹ stand auf dem Messingschild. Ich glaube, damals begriff ich zum ersten Mal, daß es Wunder gibt. Etwas, das nichts mit Erfahrungen und mit Wissen zu tun hat. Eine Welt voller Geheimnisse war hinter dem golddurchwirkten Vorhang; gleich würde er wieder fallen und mich aus dieser Welt ausschließen. Als ich mich umwandte, standen Sie neben mir. Ich wußte, auch Sie hatten einen Blick hinter den Vorhang getan, vielleicht nicht nur auf diesem Bild, vielleicht hatten Sie im Leben etwas gesehen, was gut war und in Ordnung.
Das ist es, Doktor. Ich bin am Ende. Begreifen Sie nun, warum ich das tun will? Öffentliche Fürsorge. Das klingt nicht romantisch. Ich weiß! Ich will aber auch gar keine Romantik. Ich will nicht wohltätig sein, wie es meine Mutter war, mit Kollekten und Missionsblättern; ich will helfen. Richtig helfen, dort, wo kein anderer hilft. Aber ich kann es nicht leiden, wenn man von ›dienen‹ spricht. Vielleicht habe ich kein Herz, wie Mutter immer gesagt hat, aber ich habe Verstand, und ich habe Hände, die zufassen können, und ich habe Mut. Das muß genügen.«
»Kein Herz, Katharina? Was treibt Sie denn dazu, wenn nicht das Herz?«
»Ach, Doktor – Herz! Wenn Sie wüßten, was ich davon halte! Nichts als Mißbrauch wird damit getrieben. Das ist wie Liebe. Liebe sagen sie und meinen immer nur sich selber. Die Mütter lieben sich in ihren Kindern, geben Liebe, um geliebt zu werden, um sich die Kinder zu verpflichten. Ach und Männer! Was erwarten sie denn von der Frau? Daß sie kocht für sie und die Hemden in Ordnung hält und daß …« Sie stockte. »… nun ja, was noch so zur Liebe gehört, zu Ihnen kann man das nicht sagen, Sie sind so – nun, anders.«
Sie schwieg. Es blieb still zwischen ihnen. Der Doktor versuchte, seine Erschütterung zu verbergen. Dieses Mädchen! Was alles verbarg sich hinter ihrem klaren Gesicht. Durfte er ihr den Mut nehmen, die Sicherheit, die sie meinte gefunden zu haben? Hatte sie ihn nicht eben erst einen Skeptiker genannt? Wie vermischten sich in dem Kind, das sie ja noch war, Idealismus und Realismus! Wenn er sie doch einen Blick hätte tun lassen können in jenes Leben, das sie das Wunderland nannte. Aber er war ein alter Mann neben ihr, er fühlte sich müde. Er war niemand, der mittragen konnte. Er wollte nicht derjenige sein, der diesem Mädchen die erste Enttäuschung brachte. Und daß er sie enttäuschen würde, schien ihm unausbleiblich.
Er beugte sich vor. »Katharina, hören Sie. Sie verachten die Menschen, nicht wahr? Sie wollen ihnen helfen – ohne Liebe, ohne Erbarmen.«
Sie fiel ihm ins Wort: »Was brauchen sie denn? Arbeitsplätze, Essen, heile Schuhe, einen Platz, wo sie alt werden können, reden können, alles vom Herzen reden können, bei einem, der nichts damit zu tun hat. Liebe! Glauben Sie denn etwa, daß man damit jemandem helfen könnte, Doktor?«
»Ja! Ja, ich glaube sogar, daß man ihnen ohne Liebe gar nicht helfen kann.«
Einer weiteren Stellungnahme wich er aus, stand auf und holte die Flasche Wein und die Gläser, um mit ihr anzustoßen, auf das Erreichte und das, was nun kommen sollte. Katharina leerte ihr Glas. Ein Gespräch kam nicht mehr zustande. Sie war wieder das guterzogene Schulmädchen, das konventionelle Fragen stellte nach seiner Arbeit, die sie, wie er wußte, für völlig unnütz ansah. Eine unfrohe Stimmung breitete sich zwischen ihnen aus. Auch Katharina schien es zu spüren.
»Ich will das nicht, Doktor! Ich will nichts trinken, ich will einen klaren Kopf haben, ich spüre, wie mich jeder Schluck von dem Zeug ändert, und ich will Ich sein, verstehen Sie das denn nicht? Wein und all so was« – sie unterstrich ›so was‹ mit einer raschen Bewegung über den Tisch hin, mit der Flasche, den Gläsern, den Zigaretten –, »das gehört zu einem Leben, das ich verachte!«
Der Doktor trank einen Schluck und stellte das Glas auf den Tisch, ruhig wie alles, was er tat; auch seine Stimme klang nicht anders als sonst.
»Aber es gehört zum Leben, gut, daß Sie das wenigstens gelten lassen. Sie nehmen ihm seine Schönheiten, seine paar heiteren Seiten; nur mit Realität läßt es sich kaum ertragen. Sie sind ein richtiges Kind Ihrer Zeit, nichts als Härte gegen sich und gegen die anderen.«
Er verstummte. Warum sagte er das? Sie war ja nicht so, sie war anders, das fühlte er, anders als die Worte, mit denen sie redete, aber an sie mußte man sich schließlich halten.
Sie verteidigte sich sofort. »Jawohl, ich bin ein Kind dieser Zeit. Was sollte ich auch anderes sein? Ich verachte alles, was einen schwach macht, was reaktionär ist, was …«
Er hörte nicht mehr hin. Das war nicht das Mädchen, um das es ihm ging, das waren angelernte Phrasen. Schrecklich dumme Phrasen, die er nicht mehr ertragen konnte, am wenigsten von ihr.
Der Abend endete in diesem Mißklang.
Sie wollte nicht, daß er sie weiter als zu seiner Haustür begleitete.
Als er in sein Zimmer zurückkam, stellte er die Bronzeplastik, eine Tänzerin aus Tarquinia, vor sich hin und betrachtete sie lange und mußte feststellen, daß sie durch Katharinas Worte einen Teil ihrer strengen Schönheit eingebüßt hatte.
Er trank die Flasche leer, holte sich eine zweite und schrieb, bevor er schlafen ging, in sein Notizbuch unter dem 12. März 1938:
»Katharina kam – und ging. Vielleicht für immer. Ich…«
Nichts weiter.
Das Haus des Doktors steht noch immer. Das ist nicht selbstverständlich nach diesen zehn Jahren. Der Blick aus dem Eckfenster im zweiten Stock ist freier geworden, aber man fragt sich, wen das freut. Die Fenster sind wieder verglast. Das Dach ist dicht, auch wenn es nur mit Teerpappe geflickt ist. Der Putz ist durch Tieffliegerbeschuß gesiebt; aus einigen Fenstern krümmen sich kleine schwarze Rohre. Manchmal steigt Rauch heraus.
Wieder wird es Abend.
Der Doktor setzte sich zurecht, um auf Katharina zu warten. Er legte die Brille griffbereit, mit der sie ihn zu sehen gewohnt war. Seine Hände kontrollierten die Gegenstände auf seinem Schreibtisch.
Die erste Unruhe war vorbei; er versuchte sich Klarheit zu verschaffen, was dieser Brief zu bedeuten hatte und warum sie heute kommen wollte. Es war jetzt bald fünf Jahre her, daß sie zum letzten Mal an diesem Fenster gestanden hatte. Ohne ein Wort der Erklärung war sie fortgeblieben, wie er geglaubt hatte, für immer.
Demnach war sie wieder in der Stadt. Wo war sie vorher gewesen, warum hatte sie nicht geantwortet, warum …
Er fragte: ›warum‹, und als ihm das auffiel, ging ein schwaches Lächeln über sein Gesicht. So hatte es angefangen, daß jeder den anderen fragte: ›Warum?‹ Er dachte an den Märzabend, als Katharina auszog, um ihren eigenen Weg zu gehen, der sie ihm wieder zugeführt hatte und ihm weggenommen, sie einander nähergebracht hatte, einmal sogar ganz nahe, um sie dann – Jahre später – für immer zu trennen. Er hatte sich daran gewöhnt, daß es für immer sein würde. Das hatte seinem Leben eine neue Stetigkeit gegeben. Er brauchte nicht mehr auf sie zu warten und konnte doch an sie denken, sooft er wollte. Er brauchte nicht mehr mit ihr zu streiten, konnte sie liebhaben, wie man eine Erinnerung liebt.
Ihm fiel die abgebrochene Notiz ein, die er in seinem Kalender gemacht hatte, nachdem sie fort war, und auch das fiel ihm ein, was er damals nicht geschrieben hatte: »Ich – ich möchte niemals sehen, wie das Leben auch dieses Gesicht zerstören wird.«
Er würde es nicht zu sehen brauchen. Gut so! Manche Wünsche erfüllte das Leben auf grausame Weise. Aber er würde sie nicht hindern können zu reden. Er würde es spüren, alles. Alles, was anders war an ihr. Und sie würde in der kurzen Zeit, die sie für ihn übrig hatte, wieder alle Wunden aufreißen, die eben erst verheilten.
Einen Augenblick zog er in Erwägung, sich verleugnen zu lassen. Man konnte sie wegschicken. »Er ist ausgegangen.« Sie wußte nichts von ihm, auch nicht, daß er das Haus nur noch zu den Vorlesungen verließ. Warum sollte er schließlich nicht ausgehen? Selbst wenn sie es nicht glaubte, wie konnte sie noch damit rechnen, daß ihn danach verlangte, daß das Mädchen hier am Fenster stand.
Als sie zum letzten Mal dort gestanden hatte – es war der Morgen nach einem der ersten schweren Luftangriffe auf die Stadt –, lag schwarzer Rauch über den Häusern. Es roch nach Brand. Katharina war auf dem Weg vom Nachtdienst in der Bahnhofsbaracke bei ihm vorbeigekommen. Vielleicht hatte sie die Sorge um ihn hergetrieben, gesagt hatte sie es nicht. Sie standen nebeneinander, Katharina in dem graugestreiften Kleid, das sie damals trug, die Brosche mit dem Roten Kreuz am Kragen. Er war übernächtigt, er hatte seinen Kaffee noch nicht getrunken und hoffte, daß sie bei ihm bleiben würde. Er wollte ihr eine Freude machen mit einer Tasse gutem Kaffee, doch sie wehrte ab.
»Ach was! Ich brauche das nicht! Wenn ich das da unten sehe, daraus wächst mir Kraft genug!«
»Daraus, Katharina? Aus Zerstörung? Aus dem Chaos? Das wird weitergehen, immer weiter, bis alles kaputt ist, bis auch der letzte Stein …«
»Ach hören Sie doch auf, Doktor! Es wird nicht weitergehen! Wir müssen uns wehren. Wehren, hören Sie! Wenn man hier oben steht und nichts tut und nur zusieht, glauben Sie, davon wird es anders? Chaos! Ich hasse solche Worte!«
Das Mißverstehen zwischen ihnen ging tiefer als sonst. Katharina hatte gesagt: »Ich begreife, daß man dagegen ist. Aber das ist doch keine Lebenshaltung! Und wenn sie es ist, muß sie Folgen haben, dann muß man die Konsequenz ziehen. Will oder kann man das nicht, weil man seine Machtlosigkeit erkennt, weil man feige ist – mein Gott, ja, Doktor! Machen wir uns doch nichts vor. Feigheit ist doch auch dabei! Ich wenigstens, ich kann nicht in Untätigkeit leben, immer nur nein sagen. Gut, Sie sagen, ich mache das alles mit. Aber ich würde ja ersticken, lebte ich wie Sie! Ich muß mitmachen! Und wenn meine Kraft nicht ausreicht, etwas dagegen zu tun, dann tue ich da, wo ich hingestellt bin, meine Pflicht. So ordentlich, wie ich nur kann. Bei meiner Arbeit, ist es denn dabei nicht ganz gleich, unter welcher Fahne sie getan wird? Was kümmern mich denn Plakate und Sprüche. Nichts, gar nichts! Sie wissen, daß ich kein guter Christ bin, aber soviel habe ich mit fünf Jahren schon vom barmherzigen Samariter gelernt: Man sieht nicht nach der Weltanschauung, nach der Rasse, nach der Partei, man hilft zuerst. Ein anderes Gesetz habe ich nicht. Noch hat mich keiner deshalb angezeigt, und ich glaube nicht, daß man es tun wird. Daß ich den Mund halte – ach, Doktor! Was tun Sie denn anderes! Dann müßten Sie auf die Straßen gehen und laut herausschreien, was Sie denken!
Aber: Sie bleiben hier in Ihrer Stube. Ich versuche ja, Sie zu begreifen, aber ich kann es nicht! Wenn ich Ihrer Ansicht wäre – und ich bin froh, daß ich es nicht bin! –, ich könnte nicht hier sitzen und warten, daß es vorbeigeht wie eine – eine Seuche, die sich schließlich selbst auffrißt. Ich weiß, Sie halten mich für nüchtern. Ich habe auch nicht oft Gelegenheit gehabt, was anderes zu sein. Wahrscheinlich vergessen Sie hier oben, wie nüchtern es zugeht. Was hat sich denn geändert? Es gibt noch immer Gesunde und Kranke, Arme und Reiche, Junge und Alte, nur daß jetzt auch noch Krieg ist. Und wenn heute das Kranke und Schwache keinen Wert mehr hat, vernachlässigt wird und ausgemerzt werden soll, dann ist es doch erst recht ein Grund, daß einer da ist und hilft, soweit er kann.
Das ist doch der blanke Egoismus, sich hierher zu setzen und zu tun, als ob kein Krieg wäre! Für Sie hat er ja nur historischen Wert. Wegen der vernichteten Kunstschätze. Wenn ich das schon höre! Ihnen sind die punischen Kriege wichtiger als dieser hier. Wenn Sie dieses dumme Ding da nur haben!«
Einen Augenblick sah es aus, als ob sie die Bronzetänzerin aus dem Fenster schleudern wollte.
Er hätte sie nicht daran gehindert. Daß er es nicht tat, daß er ihr nicht in den Arm fiel, obwohl die kleine Figur ihm das wertvollste und liebste Stück seiner Sammlung war, ernüchterte sie. Sie stellte die Tänzerin zurück auf den Schreibtisch und sah ihn zum ersten Mal voll an.
»Warum lassen Sie sich alles von mir gefallen, Doktor? Warum wehren Sie sich nicht?«
»Wehren? Ich wehre mich ja, von früh bis in die Nacht, seit Jahren. Aber es hat keinen Zweck, Katharina, je schneller es jetzt geht, desto besser.«
»Es gibt nichts Zweckloses, alles hat irgendeinen Sinn.«
Sie sagte es ohne Überzeugung, wie etwas, das man aus Gewohnheit ausspricht. »Ich bin müde, Doktor. Ich kann arbeiten wie ein Pferd, aber ich kann mich nicht noch rechtfertigen, warum ich das tue. Ich kann es nicht, vielleicht weiß ich es auch nicht. Aber so ist es jedesmal, ich freue mich auf dieses Zimmer, weil man sich hier geborgen fühlt, ich weiß selbst nicht, woran das liegt. Ich freue mich auch auf Sie, ich bin voller Erwartung, wenn ich die Treppe hinauflaufe; und wenn ich weggehe, bin ich niedergeschlagen und verzweifelt. Sie saugen einem alle Kraft aus, Doktor.«