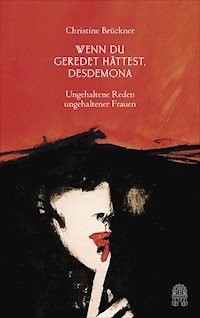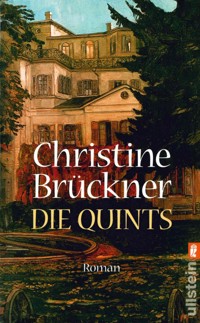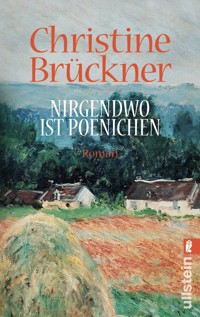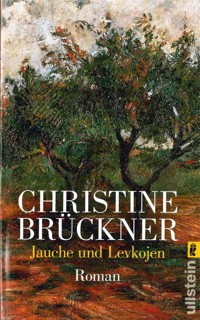
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das ungeschönte, lebendige Bild einer nicht wiederkehrenden Welt: die Geschichte der Maximiliane von Quindt, 1918 auf Gut Poenichen in Hinterpommern geboren. Der Vater stirbt vor ihrer Taufe, die Mutter verlässt Poenichen. Maximiliane, das Einzelkind, wird von Fräuleins und ihrem Großvater erzogen. Achtzehnjährig heiratet sie Viktor, einen Nazi, der sein Parteibuch schützend über Poenichen hält. Als Maximiliane im Februar 1945 das Gut verlassen muss, nimmt sie ihre vier Kinder mit auf die Flucht. Eine Mutter Courage der Nachkriegszeit macht sich auf den Weg in den Westen. Mehr über Christine Brückner erfahren Sie über die Stiftung Brückner-Kühner unter http://www.brueckner-kuehner.de/.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 491
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Das Buch
Hinterpommern, August 1918. Auf Poenichen wird ein Kind geboren. Freiherr von Quindt, dessen einziger Sohn an der Somme kämpft, läßt die Fahne aufziehen, obwohl es nur ein Mädchen ist, von dem das Vaterland seiner Ansicht nach weniger wissen will. Der natürliche Tod der Quindts war jahrhundertelang der Heldentod oder der Jagdunfall. Der alte Quindt gedenkt der erste zu sein, der in seinem Bett stirbt; aber 1945 wird er die Waffe gegen sich selbst richten, um Poenichen nicht verlassen zu müssen. Sein Sohn hingegen hat sich an die Tradition gehalten und ist in den letzten Tagen des Ersten Weltkriegs gefallen. Maximiliane wächst als Erbin von Poenichen heran, eine pommersche Dorfprinzessin. Mit achtzehn heiratet sie Viktor Quint, einen entfernten bürgerlichen Verwandten, einen Nationalsozialisten, der von Berlin aus sein Parteibuch schützend über Poenichen hält. Er nimmt es mit seiner Erzeugerpflicht ernst: ein Kind, ein zweites, ein drittes – und am Ende nichts mehr zu vererben …
Die Autorin
Christine Brückner, am 10.12.1921 in einem waldeckischen Pfarrhaus geboren, am 21.12.1996 in Kassel gestorben. Nach Abitur, Kriegseinsatz, Studium, häufigem Berufs- und Ortswechsel wurde sie in Kassel seßhaft. 1954 erhielt sie für ihren ersten Roman einen ersten Preis und war seitdem eine hauptberufliche Schriftstellerin, schrieb Romane, Erzählungen, Kommentare, Essays, Schauspiele, auch Jugend- und Bilderbücher. Von 1980-1984 war sie Vizepräsidentin des deutschen PEN; 1982 wurde sie mit der Goethe-Plakette des Landes Hessen ausgezeichnet, 1990 mit dem Hessischen Verdienstorden, 1991 mit dem Bundesverdienstkreuz 1. Klasse. Christine Brückner war Ehrenbürgerin der Stadt Kassel und stiftete 1984, zusammen mit ihrem Ehemann Otto Heinrich Kühner, den »Kasseler Literaturpreis für grotesken Humor«.
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein-taschenbuch.de
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
Ungekürzte Ausgabe im Ullstein Taschenbuch32. Auflage 2012© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2005© 2000 by Econ Ullstein List Verlag GmbH & Co. KG, MünchenUmschlaggestaltung: Büro HamburgTitelabbildung: Paul Gauguin, Blühende ApfelbäumeArchiv für Kunst und Geschichte, BerlinE-Book-Konvertierung: CPI – Ebner & Spiegel, UlmPrinted in GermanyISBN 978-3-8437-1012-1
›Durch mein offenstehendes Fenster strömt der hier, und auch wo anders, ständige Mischgeruch von Jauche und Levkojen ein, erstrer prävalirend, und giebt ein Bild aller Dinge. Das Leben ist nicht blos ein Levkojengarten.‹
Theodor Fontane am 18. Juli 1887 aus Seebad Rüdersdorf an seine Frau.
1
›Ich möchte was darum geben, genau zu wissen, für wen eigentlich die Taten getan worden sind, von denen man öffentlich sagt, sie wären für das Vaterland getan worden.‹
Lichtenberg
Vor wenigen Minuten wurde auf Poenichen ein Kind geboren. Es kniff die Augen fest zu, als wäre ihm das Licht der Morgensonne zu grell, und war nicht einmal durch leichte Schläge auf das Hinterteil zum Schreien zu bringen. Aber: Es bewegte sich, atmete, lebte. Die Hebamme hatte die Länge: 42 Zentimeter, mit Hilfe der Küchenwaage auch das Gewicht: 2450 Gramm, festgestellt und zusammen mit dem Datum, dem 8. August 1918, und der Uhrzeit: 7 Uhr 30, auf dem Formular eingetragen, und nun lag das Kind gewindelt und mit blauem Jäckchen und Mützchen bekleidet in den blaugestickten Kissen der Quindtschen Familienwiege und schlief.
Die Mutter des Kindes, Vera von Quindt geborene von Jadow, für zwei Wochen eine Wöchnerin und dann nie wieder, hatte darauf bestanden, daß ihr Kind – zum Zeitpunkt dieser Abmachung allerdings nicht einmal gezeugt – in der Charité zur Welt kommen sollte, wo ein junger unterschenkelamputierter Arzt in der Entbindungsstation arbeitete, einer ihrer Bewunderer, aber als Ehemann nicht geeignet: bürgerlich und ohne Aussicht auf eine baldige Niederlassung in einer guten Wohngegend des Berliner Westens. Aus begreiflichen Gründen war von ihm nicht die Rede gewesen, als diese Abmachung getroffen wurde. Die Erinnerung an den Steckrübenwinter und eine erneute Herabsetzung der Lebensmittelrationen hatten die junge Berlinerin ein pommersches Rittergut mit anderen Augen sehen lassen. Sie war 24 Jahre alt, dunkelhaarig, hübsch, aber unvermögend, und ihre Tänzer waren an der Somme und Marne gefallen, ›reihenweise‹, wie ihre Mutter zu sagen pflegte. Vera von Jadow hatte unter diesen Umständen und einer Reihe von Bedingungen dem zwanzigjährigen Leutnant Achim von Quindt, einziger Erbe von Poenichen, ihr Jawort gegeben. Die Hochzeit war zwar standesgemäß im ›Adlon‹, aber auch kriegsgemäß gefeiert worden. Der Brautvater fehlte, da er als Armeepostdirektor unabkömmlich war; es fehlte an Brautführern, die Brautjungfern folgten dem Brautpaar paarweise, sie trugen, ebenso wie die Braut, ihre Rote-Kreuz-Tracht; der Bräutigam in Feldgrau, die ganze Hochzeit feldgrau. Die Eltern des Bräutigams waren für fünf Tage nach Berlin gekommen. Freiherr von Quindt, noch nicht volle fünfzig Jahre alt, hieß vom Tag der Hochzeit seines Sohnes an ›der alte Quindt‹. Er trug die Uniform seines Regiments, in der er noch immer eine gute, wenn auch etwas untersetzte Figur machte, im Rang eines Rittmeisters.
Als sein Sohn und Erbe 1915 Soldat geworden war, hatte er dafür gesorgt, daß dieser zu jenem Regiment kam, bei dem seit jeher die Quindts gestanden hatten: Kürassiere, schwere Reiterei. Er selbst war unmittelbar darauf um seinen Abschied eingekommen, der ihm bewilligt wurde, zumal er sich bei den Kämpfen in Masuren einen Rheumatismus zugezogen hatte, der sich als lebenslängliches Übel herausstellen wird.
In seiner Tischrede, die er diesmal gleich nach der falschen, aber klaren Ochsenschwanzsuppe hielt, sagte er unter anderem: »Die Quindts sind rar geworden, mehr als einen Soldaten können sie dem Vaterland nicht stellen.« Sein Sohn Achim sei die letzte Kriegsanleihe, die er gezeichnet habe, die beiden ersten noch in Goldmark, auch das sei ihm schwer genug gefallen. Er seinerseits habe sich um die Ostfront gekümmert – er erinnerte an dieser Stelle an die Schlacht von Tannenberg, an der er teilgenommen hatte, und brachte einen Toast auf den Generalfeldmarschall von Hindenburg aus, was er bei keiner Rede versäumte – und sagte, daß sein Sohn sich nun um die Westfront kümmern werde, die von Poenichen allerdings weit entfernt sei. Seine Frau warf ihm einen Blick zu, der besagte: Mach ein Ende davon, Quindt!
»Ich tue alles, was du willst, Sophie Charlotte, sogar, was du nicht willst! Ich komme jetzt sowieso zum Schluß. Liebe neue Schwiegertochter! Du stammst aus Berlin, und ihr Berliner, ihr habt so eine Art, über die pommerschen Landjunker zu denken, darum will ich dir und den übrigen Berlinern dieser Tischrunde jetzt sagen, was ein Bismarck einmal gesagt hat: ›Ein echter Landjunker ist so ziemlich das Beste, was Preußen‹ – ob er nun Brandenburg oder Hinterpommern gemeint hat, sei dahingestellt – ›hervorgebracht hat!‹« Während Quindt den Applaus abwartete, zog er ein Couvert aus der Tasche, nahm einen Brief heraus und entfaltete ihn. »Mit dem heutigen Tage geht ein Brief Bismarcks in deinen Besitz über, lieber Achim, dessen Inhalt du kennst und den auch deine Mutter kennt; zur Genüge, würde sie sagen, wenn sie nicht aus Königsberg stammte. Ich lese! ›Mein lieber Quindt!‹ – gemeint ist damit mein Vater – ›Es ist hierzulande nicht immer leicht, ein Patriot zu sein. Der eine denkt an Pommern, und es fällt ihm leichter, der andere an Preußen, und wieder andere denken allgemein Deutsches Reich, und ein jeder fühlt sich als ein Patriot. Auf Poenichen drückt einen das Patriotische weniger. Wer landwirtschaftet, liebt das Land, das er bewirtschaftet, und das genügt ihm.‹ – Du, liebe Schwiegertochter, wirst dich damit vertraut machen müssen, daß auf Poenichen gelandwirtschaftet wird! Um den Brief noch zu Ende zu lesen. ›Meine Frau bittet die Ihrige um das Rezept für die Poenicher Wildpastete. Küchengeheimnisse! Ganz der Ihrige.‹ Gezeichnet mit dem Bismarckschen ›Bk‹. Diesen Brief werde ich bis zu deiner Heimkehr für dich aufbewahren!« Er wandte sich wieder an seine Schwiegertochter: »Du heiratest einen sehr jungen Mann, aber wer alt genug ist, im Krieg sein Leben für das Vaterland, ich sage ausdrücklich nicht ›Kaiser und Vaterland‹, einzusetzen, der ist auch alt genug, Leben zu zeugen!«
Seine Frau versuchte ihn daran zu hindern, noch deutlicher zu werden, aber Quindt winkte ab. »Ich weiß, was ich sage, und alle hier am Tisch wissen, was ich meine!« Er hob sein Glas und trank der Braut zu, richtete dann den Blick auf seine Frau und sagte: »Die angeheirateten Quindts waren nie die schlechtesten. Sie wurden aus freien Stücken, was ihre Männer unfreiwillig wurden, Quindts auf Poenichen. Auf die Damen! Mein Großvater wurde in den Napoleonischen Kriegen gezeugt und ist in der Schlacht von Vionville gefallen, im III. preußischen Korps. Mein Vater hat mich im 66er Krieg gezeugt …«
Falls die Braut noch im unklaren über ihre Aufgabe gewesen sein sollte, so wußte sie am Ende dieser Tischrede Bescheid.
Der junge Quindt kehrte nach viertägiger Hotel-Ehe zu seinem Regiment an die Westfront zurück, und die alten Quindts nahmen seine junge Frau mit nach Poenichen. Schnellzug Berlin-Stettin-Stargard, dann Lokalbahn und schließlich Riepe, der die drei mit dem geschlossenen Coupé – nach dem Innenpolster ›Der Karierte‹ genannt – an der Bahnstation abholte. Die junge Frau führte nicht mehr als eine Reihe von Schließkörben und Reisetaschen mit sich. Fürs erste blieb ihre Aussteuer in Berlin, Möbel, Wäsche, Porzellan und Silber für die spätere Berliner Stadtwohnung. Sie würde fürs erste zwei der Gästezimmer im Herrenhaus bewohnen, die sogenannten ›grünen Zimmer‹. Fürs erste, das hieß: bis der junge Baron heimkehrte, bis der Krieg zu Ende war.
Als die Pferde in die kahle Lindenallee einbogen, dämmerte es bereits. Vera sagte, als sie das Herrenhaus am Ende der Allee auftauchen sah: »Das sieht ja direkt antik aus! War denn mal einer von euch Quindts in Griechenland?« Der alte Quindt bestätigte es. »Ja, aber nicht lange genug. Pommersche Antike.«
Wo dieses Poenichen liegt?
Wenn Sie sich die Mühe machen wollen, schlagen Sie im Atlas die Deutschlandkarte auf. Je nach Erscheinungsjahr finden Sie das Gebiet von Hinterpommern rot oder schwarz überdruckt mit ›z. Z. poln. Besatzungsgebiet‹ oder ›unter poln. Verwaltung‹, die Ortsnamen ausschließlich in deutscher Sprache oder die polnischen Namen in Klammern unter den deutschen oder auch nur polnisch. Daraus sollten Sie kein Politikum machen; im Augenblick steht zwar schon fest, daß der Erste Weltkrieg im günstigsten Falle noch durch einen ehrenvollen Waffenstillstand beendet werden kann, aber: Noch ist Pommern nicht verloren!
Suchen Sie Dramburg, immerhin eine Kreisstadt (poln. Drawsko), an der Drage gelegen, die Einwohnerzahl unter zehntausend. Etwa 30 Kilometer südwestlich von Dramburg liegt Arnswalde (poln. Choszczno), kaum größer als Dramburg, ebenfalls eine Kreisstadt; südöstlich in etwa derselben Entfernung dann Deutsch Krone (poln. Wałcz), nicht mehr Hinterpommern, sondern bereits Westpreußen, Teil des ehemaligen Königreiches Polen, gleichfalls eine Kreisstadt. Wenn Sie nun diese drei Städtchen durch drei Geraden miteinander verbinden, entsteht ein leidlich rechtwinkliges Dreieck. Wenn Sie die geometrische Mitte dieses Städte-Dreiecks ausmachen, stoßen Sie auf Poenichen. Gut Poenichen und gleichnamiges Dorf Poenichen, 187 Seelen, davon 22 zur Zeit im Krieg. Die beiden Seen, von einem einfallslosen Vorfahren ›großer Poenichen‹ und ›Blaupfuhl‹ genannt, nördlich davon die Poenicher Heide. Ein Areal von reichlich zehntausend Morgen. ›Pommersche Streubüchse‹ von den einen, ›Pommersche Seenplatte‹ von den anderen genannt, beides zutreffend; seit fast dreihundert Jahren im Besitz der Quindts.
Die Geburt des Kindes war, wie bei allen diesen Fronturlauberkindern, nahezu auf den Tag genau festgelegt. Man starrte der jungen Baronin vom ersten Tage an ungeniert auf den Bauch, sobald sie das Haus verließ. Wenn sie ausreiten wollte, sagte Riepe: »Die Frau Baronin sollten aber vorsichtig sein und nur einen leichten Trab einschlagen.« Daraufhin warf sie ihm einen ihrer hellen, zornigen Blicke zu und gab dem Pferd die Sporen.
Zum zweiten Frühstück kochte ihr Anna Riepe eine große Tasse Bouillon. »Das wird der Frau Baronin in ihrem Zustand guttun!« Jede Suppe kostete einer Taube das Leben. Der Taubenschlag leerte sich zusehends. Es wurde Frühling, dann Frühsommer: Im Schafstall blökten die neugeborenen Lämmer, auf dem Dorfanger führten die Gänse ihre Gösseln aus, auf dem Gutshof suhlten sich neben der dampfenden Dungstätte die Sauen in der Sonne, an ihren Zitzen hingen schmatzend die Ferkel in Zweierreihen, auf der Koppel standen die Fohlen am Euter der Stuten, und auf dem Rondell vorm Haus lag Dinah, die Hündin, und säugte ihre fünf Jungen. Vera kam sich in ihrem Zustand wie ein Muttertier vor. Sie verbrachte den größten Teil des Tages in einem Schaukelstuhl, den sie sich in die Vorhalle hatte bringen lassen. Im Schatten der Kübelpalmen blätterte sie in der ›Berliner Illustrirten‹, die ihre Mutter von Zeit zu Zeit schickte. Sie las in den Briefen der Freundinnen von Bahnhofsdienst, Truppenbetreuung und Lazarettzügen. Hin und wieder kam auch ein Kartengruß von der Front, nicht an sie persönlich adressiert, sondern an die Quindts auf Poenichen. Knappe Mitteilungen, kurze Fragen. Im Vergleich zu dem eintönigen Leben in Pommern erschien ihr das Leben in Berlin abwechslungsreich und verlockend. Mit der Taubenbrühe in der Hand, verblaßte die Erinnerung an die Steckrübengerichte; den warmen Kachelofen im Rücken, vergaß sie die schlechtgeheizten Zimmer der Charlottenburger Etage; von Riepe und seiner Frau sowie zwei Hausmädchen bedient, verlor der Rote-Kreuz-Dienst seine Anstrengungen. Sie neigte, wie die meisten Frauen, dazu, das zu entbehren, was sie nicht besaß, anstatt zu genießen, was sie hatte. Sie träumte von staubfreien Reitwegen im Grunewald, flankiert von jungen Leutnants.
Sie stieß sich mit dem Absatz ihrer kleinen Stiefel ab und schaukelte ohne Unterlaß. Bis der alte Quindt schließlich sagte: »Na, der Junge wird wohl seekrank werden, falls er sich nicht jetzt bereits entschließt, zur Marine zu gehen.«
Frauen mußten sein, er ließ es ihnen gegenüber auch nicht an Höflichkeit fehlen; Kinder mußten ebenfalls sein, aber er machte sich weder viel aus Kindern noch aus Frauen, im Gegensatz zu seiner Frau übrigens auch nichts aus Tieren. Er trug sich seit Jahren mit dem Gedanken, aus Poenichen ein Waldgut zu machen. Er hielt es mit den Bäumen. »Bäume haben immer recht«, sagte er zuweilen. Vorerst wurden allerdings die Wälder abgeholzt wegen des erhöhten Holzbedarfs im Kriege. Von Aufforstung konnte keine Rede sein, es fehlte an Arbeitskräften. Er gedachte, aus den Kahlschlägen ›Wälder des Friedens‹ zu machen, keine Holzfabriken mit rasch wachsenden, minderwertigen Nadelhölzern, sondern Mischwald mit gutem Unterholz. Deutscher Wald! Sein Nationalismus und sein Patriotismus sprachen sich am deutlichsten aus, wenn es um den Wald ging, um Grund und Boden. Dann wurde der sonst eher nüchterne, der Ironie nicht abgeneigte Quindt feierlich. In einer seiner Reden vor dem preußischen Landtag soll er einmal gesagt haben: »Wir Deutschen, und zumal wir Preußen, müssen endlich lernen, daß auch ein Kornfeld ein Feld der Ehre ist! Dafür muß man allerdings sein Leben lang arbeiten und nicht sein Leben lassen!« Dieser Satz brachte ihm 1914, bald nach Kriegsausbruch, begreiflicherweise nur Beifall von der falschen, der sozialdemokratischen Seite ein. Da er in Uniform erschienen war, trug er ihm allerdings auch keine Rüge von allerhöchster Stelle ein. Er zog trotzdem die Konsequenz und bat, seinen Abgeordnetenposten verlassen zu dürfen.
Jener Satz wird nach dem Krieg häufiger zitiert und von einem Journalisten als eine ›Quindt-Essenz‹ bezeichnet werden. Man hätte leicht eine ganze Sammlung solcher ›Quindt-Essenzen‹ anlegen können, aber daran war wohl nie jemand interessiert. Diese ›Felder der Ehre‹ waren der Anlaß, daß man Quindt auffordern wird, wenn auch zunächst nur für den Landtag, wieder zu kandidieren. Davon später. Zurück in die Vorhalle, wo die Schwiegertochter heftig schaukelt.
Von vornherein stand fest, daß dieses Kind, das auf Poenichen nicht nur von Mutter und Großeltern erwartet wurde, ein Junge werden würde. In jedem Krieg werden, einem geheimnisvollen Naturgesetz zufolge, mehr Jungen als Mädchen geboren. Außerdem sagt man in Pommern: ›Je jünger der Vater, desto sicherer ein Junge.‹
Nach den großen Frühjahrsoffensiven des Jahres 1918 war die Charité von Verwundeten überfüllt. Veras Mutter schrieb, daß die Zustände in Berlin immer schlimmer würden. ›Ka-ta-stro-phal‹, schrieb sie. Man traue sich kaum noch auf die Straße. Sie riet ihrer Tochter dringend davon ab, in ihrem Zustand die beschwerliche Bahnreise nach Berlin anzutreten. Daraufhin ordnete Vera an, daß sie das Kind im größten Stettiner Krankenhaus zur Welt bringen wolle. Alles wurde bis in die Einzelheiten neu besprochen. Riepe würde sie im ›Karierten‹ bis Stargard bringen, und der alte Quindt würde sie persönlich begleiten, damit es ihr nicht an männlichem Schutz fehlte, falls es bis dahin auch in Stettin zu Unruhen käme.
Dr. Wittkow, seit zwei Jahrzehnten Hausarzt mit Familienanschluß auf Poenichen, stattete der Schwangeren in jeder Woche einen Besuch ab. Er durfte ihren Puls fühlen, bekam ihre Zunge zu sehen, aber das war auch alles. Auf seine Frage, ob das Kind sich bewege, antwortete Vera: »Sie bringen es sowieso nicht auf die Welt, dann kann es Ihnen auch egal sein, ob es sich bewegt.«
Sehr liebenswürdig war sie in ihrem Zustand nicht, aber man übte Nachsicht, schließlich trug sie den Quindtschen Erben aus.
Ab Mitte Juli ließ sich dann Frau Schmaltz, die Hebamme, in immer kürzeren Abständen im Herrenhaus sehen; vorerst allerdings nur im Souterrain, wo sie die Figur der jungen Baronin auf ihre Gebärtauglichkeit ausführlich mit Anna Riepe besprach. »In Stettin kriegt man die Kinder nicht anders als in Poenichen«, sagte sie, als sie den letzten Schluck Holundersaft trank, dem Anna Riepe mit einem Schuß Klaren auf die Sprünge half.
Als die Wehen fünf Tage vor dem errechneten Zeitpunkt einsetzten, war man völlig sicher: Nur ein Junge konnte es so eilig haben, auf die Welt zu kommen. Weder von Charité noch von Stettin und nicht einmal mehr vom Krankenhaus in Dramburg war die Rede. Riepe spannte an, um schleunigst Dr. Wittkow zu holen, und seine Frau schickte Dorchen ins Dorf, um auf alle Fälle die Hebamme Schmaltz zu rufen. Die Baronin saß währenddessen beunruhigt am Bett ihrer Schwiegertochter und versuchte vergeblich, sich an die einzige Geburt, bei der sie zugegen gewesen war, die ihres Sohnes, zu erinnern. Der alte Quindt, der auf dem Korridor vor den grünen Zimmern auf und ab ging, erinnerte sich notgedrungen ebenfalls an die Geburt seines Sohnes, was er im allgemeinen vermied. Im Souterrain ließ Anna Riepe das Herdfeuer in Gang bringen und Wasserkessel aufsetzen, dann traf auch schon Dorchen mit der hochatmenden und unternehmungsfreudigen Hebamme Schmaltz ein. Die Baronin überließ ihr den Platz am Bett der Gebärenden und setzte sich mit ihrem Mann in die Vorhalle. Der Morgen zog auf, er graute nicht, sondern kam rötlich, versprach wieder einen heißen Sommertag. Nach einer weiteren Stunde wurde die Sonne hinter dem Akazienwäldchen sichtbar. Auf dem Gutshof wurde die Lokomobile in Betrieb gesetzt: Man war beim Dreschen. Riepe kehrte allein zurück, kündigte aber die baldige Ankunft Dr. Wittkows an, der erklärt habe, daß es bei einer Erstgebärenden noch eine Weile dauern würde. So kam es, daß die Hebamme Schmaltz die Entbindung vornahm. Wie bei jedem anderen Kind im Umkreis von Poenichen.
›Der kleine Baron ist da!‹ Das wußte man in Minutenschnelle in den Ställen, in den Leutehäusern und auf dem Dreschplatz.
Die Freude an dem männlichen Erben währte allerdings nicht länger als zwei Stunden, dann fuhr Dr. Wittkow mit seinem Einspänner vor. Oben am Fenster erschien der Kopf der Hebamme Schmaltz. Sie winkte ihm triumphierend mit dem Formular zu. Wieder war es ihr gelungen, ihm einen Säugling abspenstig zu machen. Sie unterschied zwischen ihren und seinen Kindern und behielt die Unterscheidung bei, bis aus den Säuglingen Konfirmanden und dann Brautleute geworden waren.
Dr. Wittkow fühlte den Puls der Wöchnerin, bekam ihre Zunge zu sehen, sagte: »Sehr schön, sehr schön! Nun schlafen Sie sich erst mal aus, Frau Baronin! Sie haben die erste Schlacht auf Poenichen geschlagen. Kurze Attacke, alle Achtung!« Er bediente sich gern militärischer Ausdrücke, wenn er schon nicht an der Front stehen durfte. Er wandte seine Aufmerksamkeit dem schlafenden Säugling zu, begutachtete den strammgewickelten Nabel des Kindes und stellte bei dieser Gelegenheit fest, daß das Kind weiblichen Geschlechts war. Die Hebamme wurde rot bis unter die grauen Haare. »Kind is schließlich Kind!« sagte sie, aber es ist sicher, daß sie dem Arzt diese Entdeckung nie verzeihen wird. Dr. Wittkow setzte nachträglich ›weiblich‹ auf dem Formular ein, ging in die Vorhalle und erklärte: »Der Junge ist ein Mädchen!«
Gegen zehn Uhr ordnete der alte Quindt an, daß geflaggt würde, und Riepe holte die Fahnen aus dem Hundezwinger. »Dann gratulier ich auch, Herr Baron, wenn es auch nur ein Mädchen geworden is Der junge Herr Baron is ja noch jung, und wenn der Krieg um is, dann können ja noch viele Kinder kommen.«
»Kann sein, Riepe, kann aber auch nicht sein. Aber: kann auch sein. Obwohl bei den Quindts – ich denke manchmal, mit denen is es vorbei, ebenso wie es mit dem Kaiserreich vorbei is, und was mit Preußen wird, wenn den Alliierten der Durchbruch gelingt – dann is kein Halten mehr, und bis wir das in Poenichen erfahren … Was Neues vom Willem?«
»Nee, das nich, Herr Baron, seit zwei Monaten nich.«
»Wenn man einen Leutnant zum Sohn hat, und der hat auch noch einen Schwiegervater bei der Feldpost, dann hört man öfter mal was. Das dürfte alles nich sein, Riepe. Diese Unterschiede, mein ich, Sohn is schließlich Sohn!«
»Aber zwischen dem jungen Herrn Baron und meinem Willem, da is ein großer Unterschied!«
»So? Meinst du? Du redest wie ein Konservativer!«
»Und der Herr Baron reden manchmal wie ’n Sozi!«
»Dann is es ja gut, Riepe, jeder tut einen Schritt, und am Ende is das sogar auch noch christlich. Aber christlich meinen es die Roten nich, und so meinen es die Schwarzen auch nich. Wir beide, wir kämen schon miteinander aus. Wir sind nun beide fünfzig, wir leben beide unser Leben lang auf Poenichen. Mehr als satt essen können wir uns beide nich. Du kriegst im November Schwarzsauer, und ich kriege Gänsebrust. Aber ich esse lieber Schwarzsauer, und das weiß deine Anna und macht es mir, und ob sie dir nich mal eine Gänsebrust gibt, das weiß ich nich, und das will ich auch nich wissen. Man muß nich alles wissen wollen. Wir haben beide nur den einen Jungen, und ob wir den behalten, wissen wir auch noch nich, und Rheuma haben wir auch beide. Mir verpaßt Wittkow eine Spritze, und dich reibt deine Anna ein. Fürs Einreiben ist deine Anna besser, meine Frau hält es mehr mit den Hunden. Es gleicht sich eben alles wieder aus. Und nun zieh endlich die Fahne auf, Riepe. Neues Leben auf Poenichen!«
»Welche wollen wir denn nehmen, Herr Baron? Die schwarz-weiß-rote oder die schwarz-weiße?«
»Nimm die Quindtsche, die stimmt auf alle Fälle. Von einem Mädchen will das Vaterland weniger wissen. Ob nun männlich oder weiblich – aufs Blut kommt’s an.«
Am Fahnenmast weht die Fahne der Quindts im leichten Ostwind. Von Stunde zu Stunde wird es heißer. August. Hinterpommern. Vom Gutshof hört man das gleichförmige Summen der Dreschmaschine. Der alte Quindt hat die Fahrt über die Felder, die er sonst in den frühen Vormittagsstunden unternimmt, des freudigen Ereignisses wegen auf den Nachmittag verschoben. Er hat auf dem Dreschplatz mit Herrn Glinicke, seinem Inspektor, gesprochen. Er ist der erste Quindt, der die Verwaltung des Gutes selbst, ohne Administrator, besorgt.
Und nun geht er ins Haus, um seinem Sohn zu schreiben. Er tut es im sogenannten ›Büro‹, dem Herrenzimmer. Seine Frau schreibt zur gleichen Zeit ebenfalls an ihren Sohn; sie sitzt im ›Separaten‹, das nach Norden geht und kühler ist als die übrigen Räume. Und auch die Wöchnerin hat sich von Dorchen Tinte und Papier bringen lassen.
Der letzte Satz des alten Quindt kann so nicht stehenbleiben: ›Aufs Blut kommt’s an.‹ Meint er das ironisch? Schwingt nicht immer ein wenig Ironie mit, wenn er von ›den Quindts‹ spricht? Wenn von dem ›Erben‹, dem »Stammhalter‹ die Rede ist? Was weiß er überhaupt von den Vorfällen in Zoppot? Was ahnt er?
2
›Es ist sicher eine schöne Sache, aus gutem Haus zu sein. Aber das Verdienst gebührt den Vorfahren.‹
Plutarch
Hätte Joachim Quindt nicht schon in jungen Jahren Poenichen übernehmen müssen – sein Vater war 1891 bei einem Jagdunfall ums Leben gekommen –, hätte er noch einige Jahrzehnte seinen Neigungen leben können: ein Philologe aus Liebhaberei. Vielleicht wäre sogar ein Schriftsteller aus ihm geworden, ein Reiseschriftsteller nach Art, wenn auch nicht vom Rang eines Alexander von Humboldt. Später, als Gutsbesitzer, kam er selten zum Schreiben, aber er las noch immer viel, was für einen pommerschen Landjunker ungewöhnlich war. Wenn er auszufahren wünschte, sagte er zu Riepe: ›Dann soll er die Fanfare blasen lassen!‹ Der Kutscher verstand ihn, dazu brauchte er nicht den ›Prinzen von Homburg‹ zu kennen, es genügte, daß er seinen Herrn kannte.
Die junge Sophie Charlotte, eine geborene Malo aus Königsberg, besaß zunächst eine gewisse Ähnlichkeit mit der jungen Effi Briest, die sich später verloren hat. Das Aufschlußreichste über ihre Ehe mit Joachim Quindt findet sich in dem Roman ›Effi Briest‹, richtiger: in den Anstreichungen und Randbemerkungen. Zu welchem Zeitpunkt sie angebracht wurden, ist schwer festzustellen. Der Roman erschien 1895. Es ist zu vermuten, daß der Stettiner Buchhändler ihn schon bald darauf, zusammen mit anderen Neuerscheinungen, nach Poenichen geschickt hat. Das wäre dann bald nach der Geburt des einzigen Sohnes gewesen, in jedem Falle aber nach Sophie Charlottes Aufenthalt in Zoppot. In den Jahren zuvor war sie nach Bad Pyrmont und Bad Schwalbach gereist, immer mit der Auflage, daß die Ehe nicht kinderlos bleiben dürfe. Im Sommer 1896 weigerte sie sich, in eines dieser Frauenbäder zu reisen, und fuhr statt dessen nach Zoppot. Ihr Mann verbrachte jene Wochen auf der Krim, vor der Ernte, also muß es sich um Mai und Juni gehandelt haben. In jedem Jahr unternahm er mit seinem Vetter Max eine große Auslandsreise. Zum vereinbarten Zeitpunkt kehrte Sophie Charlotte zurück, und in den ersten Märztagen des folgenden Jahres kam sie mit einem gesunden Knaben nieder. In Zoppot wurde erreicht, was in Bad Schwalbach und Bad Pyrmont nicht erreicht worden war. Wurden da Gebete erhört? Brunnen getrunken? In späteren Jahren fuhr sie weder nach Zoppot noch nach Pyrmont. Wiederholbar war Zoppot nicht, dieser eine Sohn und nichts weiter.
Zoppot, heute Sopot, zwischen Danzig und Gdingen gelegen, damals preußisch, elegant, beliebt, ein Seebad, wo man sich gern und wiederholt in den Sommermonaten traf. Waldige Berghügel und dann die Küste, von der alle, die sie kennen, heute noch schwärmen.
Die damals dreiundzwanzigjährige Sophie Charlotte, seit vier Jahren kinderlos verheiratet, lernte bei einer Reunion oder auf der Strandpromenade, beim Kurkonzert – man kann da nur Vermutungen anstellen –, einen jungen polnischen Offizier kennen, wie es hieß, ein Nachkomme jenes Josef Wybicki, der in der polnischen Legion gegen Napoleon gekämpft und die Hymne ›Noch ist Polen nicht verloren‹, den sogenannten Dombrowski-Marsch, gedichtet hatte. Sophie Charlotte sprach später gelegentlich von ›dem guten Bier aus Putzig‹. Bei jedem Glas Bier zog sie es zum Vergleich heran: ›Besser als das Bier aus Putzig‹ oder ›nicht so frisch wie damals das Bier aus Putzig‹. Irgend etwas mußte sie schließlich von jenem Zoppoter Sommer erzählen. Sie war eine leidenschaftlich verschwiegene Frau. Wenn sie den Dombrowski-Marsch hörte, erinnerte sie sich an ihren polnischen Leutnant, aber das kam in den folgenden fünfzig Lebensjahren allenfalls drei- oder viermal vor. Man verstand sich auf Poenichen darauf, eine Aussprache zu umgehen, was bei der Geräumigkeit des Hauses und der Ausdehnung der Ländereien nicht schwer war.
Zoppot also. Ein internationaler Badeort schon damals, in dem der deutsche Kaiser gern weilte, vermutlich auch in jenem Sommer 1896; später dann Hitler, Gomulka, Castro, jeder zu seiner Zeit.
Abende in Zoppot! Da genügt ein Stichwort, und schon ist die Weltanschauung vergessen. Nahebei die Westernplatte, wo der erste Schuß des Zweiten Weltkrieges fiel. Historischer Boden. Der junge polnische Leutnant und die noch jüngere pommersche Baronin, auf der Strandpromenade, im Strandcafé. Man trank in Gesellschaft eine Limonade oder jenes gute Bier aus Putzig. ›Krug um Krug das frische Bier aus Putzig.‹ Das Paar wird seine Spaziergänge bis in die Dünen ausgedehnt haben; vielleicht ist es auch ausgeritten, es reitet sich gut am Saum der Ostsee, und es gibt ausreichend Bäume, an denen man die Pferde für längere Zeit anbinden kann.
Alles Weitere läßt sich dann bei Fontane nachlesen, obwohl einiges im dunkeln bleiben wird und bleiben muß. Es steht nicht einmal fest, ob die beiden Quindts das Geheimnis, das über der Geburt ihres Sohnes lag, miteinander teilten, oder ob es jeder für sich besaß, hütete und später vergaß.
Folgende Stellen des Romans ›Effi Briest‹ tragen am Rand einen Strich, ein Ausrufungszeichen oder eine Anmerkung. Schon bei dem ersten angestrichenen Satz wird man stutzig: ›Ich bin nicht so sehr für das, was man eine Musterehe nennt‹, sagt Effi zu ihrer Mutter. Kann das Quindt angestrichen haben, oder sollten die Anstreichungen von Sophie Charlotte stammen? Die Handschriften des Ehepaares zeigen Ähnlichkeiten. Da beide fast zur gleichen Zeit die Schulen besucht haben, derselben Gesellschaftsschicht angehören, ist das kein Wunder, zumal Sophie Charlotte nicht nur im Äußeren, in ihrer Art zu gehen, sondern auch in der Handschrift männliche Züge zeigt.
Stammen diese Anmerkungen von ihrer Hand, dann wäre das in hohem Maße leichtsinnig gewesen. Daß ihr Mann die literarischen Neuerscheinungen zu lesen pflegte, spätestens im Winter, mußte sie wissen. Oder wollte sie ihn auf diese mittelbare Weise zum Mitwisser machen?
Denkbar wäre auch folgendes: Sophie Charlotte bekommt den Roman bereits in Zoppot zu lesen. Das müßte dann allerdings eines der allerersten Exemplare gewesen sein. Ihre Affäre mit dem jungen polnischen Leutnant (er kam übrigens aus Kongreß-Polen, dem Rest-Königreich, nach der letzten Teilung Polens Rußland untergeordnet) währte zehn Tage, keinen Tag länger. Wenn man an jedem Abend eine Stunde liest, braucht man für die Lektüre ebenfalls zehn Tage. Tagsüber der Leutnant, abends Effi Briest. Als am letzten Tag der junge Pole ihr ein Billett überreicht und feurig verspricht, daß er ihr immer und ewig schreiben werde, weist sie dieses Versprechen mit Entsetzen zurück: Kein Wort, mein Freund – und: Adieu! Möglich wäre das, wenn auch nicht sehr wahrscheinlich.
Die nächste Stelle: ›Für die stündliche kleine Zerstreuung und Anregung, für alles, was die Langeweile bekämpft, diese Todfeindin –.‹ Später besaß Sophie Charlotte ihre Hunde, aber damals, als sie so jung nach Poenichen kam, immerhin aus Königsberg, war sie ohne Freundinnen, ohne den Rückhalt der Schwestern, hatte nur diesen Freiherrn mit seinen politischen und literarischen Interessen, der ohne sie auf Reisen ging und sie in Frauenbäder schickte. Gewisse Ähnlichkeiten mit dem Landrat von Innstetten aus ›Effi Briest‹ mögen tatsächlich vorhanden gewesen sein.
›Ich habe dich eigentlich nur aus Ehrgeiz geheiratet.‹ Kein Strich, statt dessen ein Fragezeichen. Von seiner Hand? Von ihrer Hand? ›Sie sind hier so streng und selbstgerecht. Ich glaube, das ist pommersch.‹ Zwei Ausrufungszeichen! ›Aber hüte dich vor dem Aparten oder was man so das Aparte nennt, das bezahlt man am Ende mit seinem Glück.‹ Noch ist im Roman zu diesem Zeitpunkt nichts passiert, aber alles liegt schon in der Luft. Was ist überhaupt ›passiert‹? Die Tochter war ja bereits geboren, und an der Vaterschaft des Barons von Innstetten kann nicht gezweifelt werden. Kessin ist nicht Poenichen, auch wenn beides in Pommern liegt – Kessin übrigens an der Küste –, und Sophie Charlotte mußte erst nach Zoppot reisen. Der Landrat war anwesend, Quindt hingegen befand sich auf der Krim. Und dann bestand in unserem Falle ja auch der ausdrückliche Wunsch nach einem Erben und Namensträger.
›Es ist so schwer, was man tun und lassen soll.‹ Nicht angestrichen, sondern unterstrichen. ›Wir müssen verführerisch sein, sonst sind wir gar nichts.‹ Hat das die junge Sophie Charlotte wirklich unterstrichen, bestätigt, gedacht? Sie ist im Jahre 1918 längst keine verführerische Frau mehr, das Verführerische hat sie abgelegt, vielleicht schon damals in den Dünen. Als sie dann wiederkam, paßte sie besser nach Poenichen, war ruhiger, brachte das Kind zur Welt, sorgte dafür, daß immer ein zuverlässiges Kinderfräulein im Haus war; mit zehn Jahren wurde der Knabe dann nach Potsdam ins Internat geschickt, und sie selbst widmete sich der Hundezucht. Da Quindt ein Morgenmensch war, sie aber ein Abendmensch, war der Vorwand gegeben, daß man getrennt liegende Schlafzimmer bezog.
›Ohne Leichtsinn ist das ganze Leben keinen Schuß Pulver wert‹, sagt Major Crampas, Effis Liebhaber, und war dann sechs Jahre später doch einen Schuß Pulver wert, wieder in den Dünen. Ein paar Seiten später sagt Innstetten über Crampas, daß er ihn nicht für schlecht halte, ›… eher im Gegenteil, jedenfalls hat er gute Seiten. Aber er ist so ’n halber Pole, kein rechter Verlaß, eigentlich in nichts, am wenigsten mit Frauen.‹ Ein halber Pole! Und dieser Leutnant in Zoppot ein ganzer Pole! Im Hintergrund die ganze polnische Legion. Noch ist Polen nicht verloren! Patriotismus kam ins Spiel. Dabei hatte einer der Quindtschen Vorfahren unter einem polnischen König gekämpft, aber das lag geraume Zeit zurück.
Innstetten wird nach Berlin versetzt, macht Karriere. Man verläßt Pommern, den Schauplatz des Fehltritts, alles scheint gut auszugehen. Doch dann passiert diese Geschichte mit der kleinen Annie, die hingefallen ist und die verbunden werden muß; der Nähkasten wird aufgebrochen, weil die Mutter in Bad Ems zur Kur (!) weilt. Die verräterischen Briefe werden gefunden. Der Roman wird zum Drama!
Aber wann hätte auf Poenichen ein Drama stattgefunden?
Hat vielleicht Sophie Charlotte den Roman erst Jahre später gelesen? Hat Quindt ihn ihr mit Vorbedacht hingelegt? Hat sie das Buch bis zu dieser Stelle in der Hoffnung gelesen, daß die Sache für Effi gut ausgehen würde? Ist sie zu ihrem Sekretär geeilt, hat die Schubladen aufgerissen, nach den verräterischen Billetts gesucht, sie gefunden, und im selben Augenblick betrat Quindt das Zimmer? Was für Konsequenzen hätte ein Quindt gezogen? Wäre er auf Satisfaktion bedacht gewesen? Oder hätte er gesagt: ›Störe ich?‹, wäre aus dem Zimmer gegangen, und seine Frau hätte, noch bevor sie vom tödlichen Ausgang des Duells wußte, die Briefe im Kaminfeuer verbrannt? Sie hätte dann beruhigt über die verbannte Effi weiterlesen können, die in jungen Jahren an gebrochenem Herzen starb.
Oder: Sie liest hastig die kurzen, in französischer Sprache abgefaßten Briefe. Unterm letzten Billett steht: ›A Dieu!‹ Kein Name, keine Adresse. Sie wirft die Briefe ins Feuer, zieht den Knaben, der damals dreijährig gewesen sein könnte, zwischen die Knie und forscht nach. Er ist ein Malo! Erst zwanzig Jahre später, genau am 11. November 1918, als das Enkelkind getauft wird, taucht der Pole aus der Versenkung auf, aber auch dann nur die Frage: Woher hat das Kind diese Augen?
So könnte es sich zugetragen haben. Dann würden an dieser Stelle die Anstreichungen aufhören; sie gehen aber weiter, und darum bleibt offen, ob sie von der Hand Quindts oder seiner Frau stammen. ›Man braucht nicht glücklich zu sein, am allerwenigsten hat man Anspruch darauf, und den, der einem das Glück genommen hat, den braucht man nicht notwendig aus der Welt zu schaffen. Man kann ihn, wenn man weitabgewandt weiterexistieren will, auch laufenlassen.‹
Dann folgt das tragische Duell. ›Überall zur Seite standen dichte Büschel von Strandhafer, um diesen herum aber Immortellen und ein paar blutrote Nelken. Innstetten bückte sich und steckte sich eine der Nelken ins Knopfloch. »Die Immortellen nachher.«‹ Wer hat auf Poenichen die Immortellen anpflanzen lassen? Auf dem leichten Sandboden gediehen sie natürlich gut. Quindt selbst? Zum Zeichen, daß er Bescheid wußte? Tatsächlich wachsen in den Dünen bei Zoppot ebenfalls Immortellen, aber Quindt ist nie dort gewesen. Und seine Frau hat sich nie um die Parkanlagen gekümmert.
›Ich mußte die Briefe verbrennen, und die Welt durfte nie davon erfahren … Es gibt so viele Leben, die keine sind, und so viele Ehen, die keine sind …‹ Gedanken Innstettens auf dem Rückweg vom Duell. Unterstrichen! Nie war im Quindtschen Falle von einem Duell die Rede gewesen, dabei galt Quindt als vortrefflicher Schütze. Auf wen hätte er schießen sollen? Wie hätte er den Namen des Liebhabers erfahren können? Von Sophie Charlotte, von der man weiß, daß sie leidenschaftlich verschwiegen war? Er selbst hat sie wiederholt so bezeichnet. Er hatte sich einen Erben und Namensträger gewünscht, schließlich ging es um Poenichen.
Dann nur noch wenig Anstreichungen. Eine Stelle aus dem Briefwechsel zweier befreundeter Damen: ›Es ist doch unglaublich – erst selber Zettel und Briefe schreiben und dann auch noch die des anderen aufbewahren! Wozu gibt es Öfen und Kamine? Solange wenigstens, wie dieser Duellunsinn noch existiert, darf dergleichen nicht vorkommen; einem kommenden Geschlechte kann diese Briefschreibepassion (weil dann gefahrlos geworden) vielleicht freigegeben werden. Aber soweit sind wir noch lange nicht.‹ Vielleicht sind diese Sätze wirklich vielen Frauen eine Lehre geworden? Vielleicht haben sie Ehen gerettet? Man weiß wenig über die Wirkung von Büchern. Hat sich die Prophezeiung jener Dame erfüllt? Keine Duelle mehr, aber auch keine Öfen und Kamine. Und keine Briefe mehr.
Ein einziger Satz ist mit Rotstift angestrichen worden, vermutlich viele Jahre später. Vielleicht vom altgewordenen Quindt, lange nach der Geburt des Enkelkindes. ›Das Glück, wenn mir recht ist, liegt in zweierlei: darin, daß man ganz da steht, wo man hingehört, und zum zweiten und besten in einem behaglichen Abwickeln des ganz Alltäglichen, also darin, daß man ausgeschlafen hat und daß einen die neuen Stiefel nicht drücken. Wenn einem die 720 Minuten eines zwölfstündigen Tages ohne besonderen Ärger vergehen, so läßt sich von einem glücklichen Tage sprechen.‹ Bezeichnend für den alten Fontane! Aber auch für den alten Quindt. Zu Riepe sagte er wohl einmal: ›Hauptsache, man schläft, und die Verdauung ist in Ordnung. Davon hängt das ganze Wohlbefinden ab.‹ Beides war bei ihm nicht recht in Ordnung, daher die große Bedeutung, die er ihm beimaß.
Eine weitere Eintragung scheint besonders aufschlußreich zu sein. Zwischen dem alten Briest und seiner Frau findet eine Unterredung über das Glück statt. Briest sagt: ›Nun, ich meine, was ich meine, und du weißt auch was. Ist sie glücklich? Oder ist da doch irgendwas im Wege? Von Anfang an war mir’s so, als ob sie ihn mehr schätze als liebe. Und das ist in meinen Augen ein schlimm Ding. Liebe hält auch nicht immer vor, aber Schätzung gewiß nicht. Eigentlich ärgern sich die Weiber, wenn sie wen schätzen müssen; erst ärgern sie und dann langweilen sie sich, und zuletzt lachen sie.‹ Hier steht nun ein deutliches ›Nein!‹ am Rand des Buches. Demnach war Sophie Charlotte in diesem Punkt anderer Ansicht. Und sie hat recht! Hier irrt Fontane, zumindest der alte Briest. In unserem Falle wuchs die Achtung zwischen den Eheleuten zugleich mit der Distanz, in der sie miteinander lebten. Sehr viel später, wenn das Enkelkind herangewachsen sein wird, verringert sich die Entfernung, sie kommen einander näher, und bei ihrem tragischen Ende sind sie sich so nahe, wie zwei Menschen einander nur kommen können.
Das alles mußte gesagt beziehungsweise vermutet werden, damit man gewisse Anspielungen verstehen kann. Wie sonst wäre die eigentümliche Betonung zu erklären, mit der Quindt äußerte: ›Ja, die Quindts!‹ – ›Das Quindtsche Blut!‹
Auch bei den später mit Nachdruck und Genauigkeit betriebenen Ahnenforschungen eines gewissen Viktor Quint (ohne d) aus der schlesischen Linie taucht der polnische Großvater der Heldin nicht auf. Bei den Genealogen spielt die väterliche Linie eine ungleich größere Rolle als die mütterliche, obwohl die Vaterschaft, im Gegensatz zur Mutterschaft, oft als zumindest ungewiß bezeichnet werden muß.
Und nun kein Wort weiter über die Zoppoter Dünen! Von jener Affäre hing aber alles Weitere ab, auch der Säugling, der soeben geboren worden war. Dieses Kind wird, ebenso wie sein Vater, auf Poenichen heranwachsen und erzogen werden wie alle Quindts. Obwohl der Vater des Kindes weder mit seinem biologischen noch mit seinem Namens-Vater die geringste Ähnlichkeit besaß, hieß es bei diesem Kind immer wieder: Es kommt ganz auf den alten Quindt heraus! Ein lebender Beweis für die prägende Kraft der Umwelt. Im Verlauf dieses Buches wird allerdings auch ein Gegenbeweis geliefert werden: Es kommt ganz auf die Erbmasse an.
Aber ›das ist ein zu weites Feld‹, sagt der alte Briest.
3
›Seht ihr drei Rosse vor dem Wagen und diesen jungen Postillion?
Von weitem höret man ihn klagen und seines Glöckleins dumpfen Ton.‹
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!