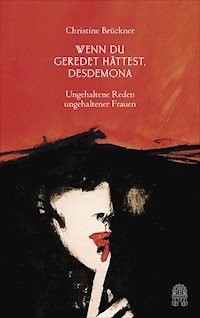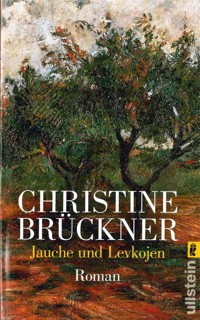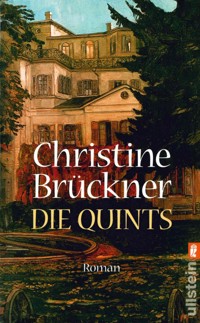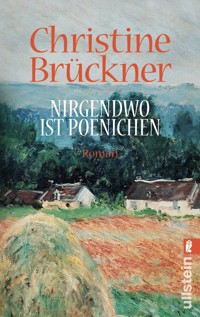6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Refinery
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Der Schriftsteller, das Gedächtnis der Nation, hat das Amt des Chronisten; dabei ist es sein Recht, sich seinen Gegenstand auszuwählen, hier: den Menschen vor dem Menschen in Schutz zu nehmen, mildernde Umstände geltend zu machen. Es wäre unmenschlich, sachlich über Menschen zu schreiben." In einundzwanzig Geschichten stellt Christine Brückner Menschen vor, denen es gelang, Schweres zu überleben: den Krieg, das Nachkriegselend, einen Autounfall - und vor allem die Zeit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 221
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Die Autorin / Das Buch
Titelseite
Impressum
Widmung
1
2
Dr. med. Anna K., Alle Kassen
Lewan, sieh zu!
›Deutscbe Ballade‹
Ein Pferd ist ein Pferd, und ein Trecker ist ein Trecker
Schwierigkeiten beim Ausfüllen eines Meldezettels
In stillem Gedenken
Jeanette und ihre Väter
Batschka – wo liegt das überhaupt
»Machen Sie doch Ihren eigenen Laden auf!«
Wann – wenn nicht jetzt
Die Doppelrolle
Die Zuflucht
»Nicht einer zuviel!«
Jahrgang 1921
Totalschaden
Meinleo und Franziska
Ein Fest für die Augen
Alles geht gut!
Das Ereignis fand in aller Stille statt
»Wir wollen einen anderen Lehrer!«
Mein Vater: der Pfarrer
Nachwort
Von Christine Brückner sind bei Refinery erschienen:
Die AutorinChristine Brückner (1921 - 1996) zählt zu den renommiertesten Schriftstellerinnen Deutschlands. Sie verfasste Romane, Erzählungen, Kommentare, Essays, Schauspiele, auch Jugend- und Bilderbücher. Besonders mit der Poenichen-Trilogie wurde sie einem großen Publikum bekannt. Mehr über Christine Brückner erfahren Sie über die Stiftung Brückner-Kühner unter http://www.brueckner-kuehner.de/.
Das Buch
»Der Schriftsteller, das Gedächtnis der Nation, hat das Amt des Chronisten; dabei ist es sein Recht, sich seinen Gegenstand auszuwählen, hier: den Menschen vor dem Menschen in Schutz zu nehmen, mildernde Umstände geltend zu machen. Es wäre unmenschlich, sachlich über Menschen zu schreiben.«
In einundzwanzig Geschichten stellt Christine Brückner Menschen vor, denen es gelang, Schweres zu überleben: den Krieg, das Nachkriegselend, einen Autounfall - und vor allem die Zeit.
Christine Brückner
Überlebensgeschichten
Refinery by Ullsteinwww.ullteinbucherlage.de/verlage/refinery
Neuausgabe bei Refinery Refinery ist ein Digitalverlag der Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin Oktober 2017 (1) © Verlag Ullstein GmbH, Frankfurt/Main-Berlin 1973/1986 Covergestaltung: © Sabine Wimmer, Berlin ISBN 978-3-96048-089-1 Hinweis zu Urheberrechten Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben. In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Den Freunden gewidmet
» Grundsatz: zuerst nach dem suchen,
was jeder Mensch an Wertvollem in sich trägt«
Albert Camus: Tagebücher
Zeitgeschichte wird zur Lebensgeschichte des Einzelnen. Lebensgeschichte im Dritten Reich, das hieß: Überlebensgeschichte. Hitler, der Weichensteller unzähliger Schicksale; seine Hinterlassenschaft: Emigranten, Vertriebene, Witwen, Heimkehrer, Waisen, Ausgebombte, alle mit dem besonderen Kennzeichen ›deutsch‹, alle aus ihrer Bahn geworfen.
Der Schriftsteller, das Gedächtnis der Nation, hat das Amt des Chronisten; dabei ist es sein Recht, sich seinen Gegenstand auszuwählen, hier: den Menschen vor dem Menschen in Schutz zu nehmen, mildernde Umstände geltend zu machen; subjektiv, auch wenn die Berichte authentisch sind. Es wäre unmenschlich, sachlich über Menschen zu schreiben.
Es ist immer auch das Schicksal derer gemeint, die nicht überlebten, die nichts verwirklichen konnten.
c.b. 1973
Ein Dutzend Jahre sind vergangen, seit ich diese Überlebensgeschichten geschrieben habe. Wahre Geschichten. Zwischen den Seiten meines Buchexemplars liegt eine Todesanzeige. Der Unternehmer-Freund ist tot, aber sein Unternehmen lebt weiter. Jeanette ist erwachsen, sie hat geheiratet, sie lebt mit Büchern, ihre Träume haben sich erfüllt. Weiterhin führen wir Sonntagsgespräche mit dem Maler-Freund am Telefon, er schickt noch immer seine Weihnachtsbotschaften in Form kleiner farbiger Radierungen in die Welt: ein Fest für die Augen! Der Briefwechsel mit ›Lewan‹ ist nicht abgerissen; er wird nun neunzig Jahre alt, und sein Werk ›Genie und Eros‹ erreicht in Japan hohe Auflagen: Wiedergutmachung. Der Pfarrer des Jahrgangs 1921 wird jetzt pensioniert, ein Pfarrer i. R., in Ruf- und in Reichweite. Die Witwe des Lehrers hat sich wieder verheiratet. Die Praxis von Dr. med. Anna K. hat sich verkleinert, das Repertoire der Sängerin Elisabeth Christine hat sich geändert, sie sitzt jetzt oft im Konzertsaal, und der Sohn spielt die Geige. Als ich Karim, den Deutsch-Palästinenser, kürzlich traf, hat er nicht gesagt: Alles geht gut.
Das Leben geht weiter, Sprichwörter haben recht. Das Ende von wahren Geschichten ist offen. Für jemanden, der seine Geschichten zu erfinden pflegt, ist das eine neue Erfahrung.
c.b. 1986
Dr. med. Anna K., Alle Kassen
Wir haben musiziert, wir haben miteinander gegessen und getrunken, waren heiter. Wir: langjährige Freunde, die den Heiligen Abend zusammen verbringen, darunter auch Anna K., unsere Ärztin, natürlich sagen wir ›unsere‹, bei Hausärzten ist das üblich, besitzergreifend. Wir stellen Ansprüche an sie, bei Tag und bei Nacht, die Heilige Nacht nicht ausgenommen. Neben ihrem Sessel steht ein tragbares Funkgerät mit Sprechverkehr zur Zentrale des ärztlichen Bereitschaftsdienstes; fünf Kilometer Reichweite im Umkreis, aus dem sie sich nicht entfernen darf. Die jungen Kollegen laufen Ski in den Bergen, den Familienvätern kann ärztlicher Bereitschaftsdienst an Weihnachtstagen nicht zugemutet werden.
Es wird noch eine Telemann-Sonate gespielt. Dann hebt der Cellist das Glas, richtet das Wort an Anna K.: »Sie müßten heute abend ohne mich Weihnachten feiern, das Cello wäre unbesetzt, hätte es vor fünfzig Jahren schon die Pille gegeben, ich war das fünfte Kind, ein Inflationskind, eine Katastrophe!« Der, der die Geige spielt, sagt: »Wir waren zu Hause vier Söhne, ich stelle den letzten Versuch zu einer Tochter dar, meine Existenz wäre bei heutigen Möglichkeiten zumindest fraglich.« Ich sage: »Meine Mutter war bei meiner Geburt bereits fünfundvierzig Jahre alt, außerdem leidend, der Hausarzt war entsetzt, als er von der späten Schwangerschaft erfuhr.« Anna K., die das Cembalo gespielt hat, sagt: »Wir waren zwölf Kinder. Ich war das elfte!«
Anna K., Jahrgang 1910, das elfte von zwölf Kindern. Der Vater mittlerer Beamter, Oberinspektor am Ende seiner Laufbahn, gewissenhaft, fleißig, auch ehrgeizig. Die Mutter ebenfalls fleißig und praktisch; sie kann haushalten, aber sie altert vorzeitig. Jedes Kind zehrt an ihren Kräften, die, die am Leben bleiben, mehr noch die, die früh sterben, das sind zwei. Die Mutter sorgt für Essen und Kleidung, der Vater besorgt die Erziehung. Er bringt den Kindern Tischsitten bei, er bestimmt, was sie lesen. Bei jeder Mondfinsternis holt er sie aus den Betten, gleichgültig, wie alt sie sind, Jungen und Mädchen. Jeder Spaziergang wird zum Naturkundeunterricht. Eines vor allem bringt er seinen Kindern bei: im Leben bleiben die meisten Wünsche unerfüllt.
Jedes Kind erlernt ein Musikinstrument; vom siebten Lebensjahr an spielt Anna Klavier. Zunächst, weil man es von ihr verlangt, später aus eigenem Verlangen. Sie besucht eine Mädchenschule bis zur mittleren Reife, wird als Kindergärtnerin ausgebildet, dann auf eine Haushaltungsschule geschickt. Für ein Mädchen ist das genug an Ausbildung: sie führt den elterlichen Haushalt. Zur Vorbereitung auf ihre späteren Aufgaben als Hausfrau und Mutter gehört auch, daß sie eine Weile von zu Hause weg sein muß. Sie übernimmt auf einem mecklenburgischen Gut die Betreuung und Erziehung von vier Kindern. Dort lernt sie ihren späteren Mann kennen: Felix K., der Eleve, der einmal den elterlichen Hof in Holstein übernehmen wird. Bis dahin ein Lebenslauf wie aus dem 19. Jahrhundert: Der Eleve verliebt sich in die Kindergärtnerin. Als ihre Mutter erkrankt, muß Anna nach Hause zurückkehren. Die beiden sehen sich selten, von gemeinsamen Ferien ist nicht einmal die Rede, sie schreiben sich Briefe. Wartezeit. Sie verloben sich 1937, aber die Hochzeit wird hinausgeschoben, weil die Erbfolge noch nicht geregelt ist.
1939: Der Verlobte nimmt am Polenfeldzug teil. Weihnachten ist der Krieg nicht zu Ende, wie Hitler es versprochen hat. Es ist besser, wenn man nun nicht länger mit der Heirat wartet. Felix reicht Heiratsurlaub ein, der Hochzeitstag wird festgesetzt, die Gäste werden geladen. Es ist Januar, jener erste strenge Kriegswinter. Standesamtliche Trauung. Am nächsten Tag soll die kirchliche Trauung vollzogen werden. Die Gäste treffen ein, das Hochzeitsessen ist gerichtet, Brautkleid und Schleier liegen bereit, der Brautstrauß wird ins Haus geliefert. Da kommt das Telegramm: Zurück zur Truppe, unverzüglich. Der Pfarrer traut das Paar um Mitternacht in seinem Amtszimmer, anschließend bringt Anna ihren Mann zur Bahn. Sie packt Brautkleid und Schleier unbenutzt in eine Schachtel.
Feldpostbriefe an Feldpostnummern, Feldpostpäckchen zu 500 Gramm. Anna K. wird kriegsdienstverpflichtet. Felix kommt auf Urlaub, einmal aus dem Westen, später noch einmal aus dem Osten. Er gehört zur Heeresgruppe Süd, Infanterie, inzwischen Leutnant der Reserve, zuletzt liegt er vor Sewastopol. In seinen Briefen schreibt er vom Frühling und von der Schönheit der Krim. An den Abenden besetzt Anna nach den Angaben des Wehrmachtsberichtes Rußland mit bunten Stecknadeln. Der Feldzug der Frauen. Im Mai tritt sie eine Dienstreise nach München an. Als sie ihren Koffer aus dem Gepäcknetz holt, fällt ein Sonnenstrahl auf ihre rechte Hand, trifft den Ring und verdoppelt ihn. Das erste Zeichen. Bis jetzt hat sie jeden Gedanken daran, daß ihr Mann fallen könnte, mit der Eigensucht der Liebenden abgewiesen. Als sie nach Hause zurückkehrt, drei Tage später, und ihren Koffer durch die verdunkelte Bahnhofshalle trägt, denkt sie: Du wirst ein Leben lang deinen Koffer allein tragen müssen, nie wird dir jemand helfen. Aber zu Hause hält ihr die Mutter zwei Briefe hin, sie sind mehrere Wochen alt, und Anna traut ihren Augen, es ist Felix’ Handschrift, wieder schreibt er vom Frühling auf der Krim. Dann wird sie eines Nachts wach: Wenn er nicht wiederkommt, was wird dann aus ihr? Soll sie zu Hause bleiben? Soll sie auf das Gut der Schwiegereltern ziehen? Als Witwe? Was hat sie gelernt? Kindergärtnerin. Jugendleiterin? Oder Lehrerin? Keine eigenen Kinder, statt dessen fremde? Klavierlehrerin? Dahms Klavierschule ein Leben lang…
Am Morgen ist der Entschluß gefaßt: Ärztin, sie muß Ärztin werden! Das bedeutet, daß sie Abitur machen muß, großes Latinum, scribo, scribis, scribere, scripsi, scriptum, fünf Brüder haben vor ihren Ohren lateinische Verben gepaukt. Niemals bis zu dieser Nacht hat es ein Anzeichen dafür gegeben, daß sie sich für Medizin interessierte, eher eine Abneigung gegen Krankheiten.
1. Juni – 4. Juli 1942
Der 1941 stehengebliebene Brückenkopf Sewastopol wird von Deutschen und Rumänen unter Führung des Generaloberst (späteren Generalfeldmarschall) Manstein eingedrückt und die Festung Sewastopol in stark zerstörtem Zustand eingenommen. Damit ist die ganze Krim in deutscher Hand, doch halten sich im Jalta-Gebiet Partisanen.
Fünf Zeilen im Ploetz ›Auszug aus der Geschichte‹. Jener Abschnitt Weltgeschichte, der die Lebensgeschichte der Anna K. bestimmt hat. Der nächste Brief trägt eine fremde Handschrift.
Der Pfarrer, der sie getraut hat, macht einen Besuch. Auch zu ihm sagt sie: Ich muß das Abitur machen, ich muß studieren, ich muß Ärztin werden. Nicht von Wollen ist die Rede, nur von Müssen. Kein Aufschub, keine Familienberatung. Von nun an entscheidet sie selbst; das Ziel fest im Auge und auch den Weg, auf dem sie es erreichen wird. Niemals ein Zweifel daran, daß beides für sie nun festgelegt ist.
Anna K. war 33 Jahre alt, als sie wieder zur Schule ging. Seitdem kenne ich sie. Ein Augenzeuge dieses Lebens. In dem gemeinsamen Schuljahr habe ich sie niemals lachen sehen, auch nicht weinen. Hätte sie das eine getan, wäre das andere unausbleiblich gewesen. Sie trug Schwarz, eine Tarnfarbe, so stand sie auf dem Schulhof zwischen den uniformierten Schülerinnen, wenn die Hakenkreuzfahne gehißt wurde. Mit ihr drang der Krieg in diese Mädchenschule, in der man großdeutsche Geschichte lehrte. Die Kriegerwitwe Anna K. war eine Zumutung für die Klasse und für die Lehrkräfte. Wir machten oft zusammen Schularbeiten; wirklich wahrgenommen hat sie mich nicht.
In den Weihnachtsferien fuhr sie zu den Schwiegereltern, ihr Mann war damals seit einem halben Jahr tot. Der Schwager im Krieg, die Knechte im Krieg. Der Unterschied zwischen Fortsein an der Front und Fortsein im Tod war kaum wahrnehmbar, einer ist endgültig fort, gültig, endgültig. Erst sehr viel später hat sie geweint, als sie nicht mehr um sich selbst, sondern um ihn weint.
Nachhilfeunterricht in Mathematik, Latein, Englisch, Französisch, sie hat keine Zeit zu verlieren, immer ein Vokabelheft in der Tasche, auf dem Schulweg, im Luftschutzkeller. Bombenangriffe, nachts, tags, dann einer, bei dem unsere Stadt zu 70 Prozent zerstört wurde. Das Schulgebäude nicht mehr aufzufinden, Annas Elternhaus zerbombt, die Hälfte der Hausbewohner getötet, die alten Eltern verwundet, von nun an ohne Besitz. Evakuierung in eine Kleinstadt, die Eltern sterben rasch nacheinander, dann wird sie selbst krank, todkrank. Zwischen Ohnmacht und Narkose hört sie die Stimme des Arztes: Schade um die Frau! Blinddarmdurchbruch, Vereiterung der Bauchhöhle. Aber sie überlebt. In einer anderen Stadt, an einem fremden Gymnasium treffen wir uns zur Reifeprüfung wieder. Das Pensum von drei Schuljahren hat sie in einem einzigen Jahr geschafft.
Der Krieg geht zu Ende. Ein Jahr später kann sie mit dem Studium beginnen, in der Zwischenzeit hat sie als Helferin in einem Lazarett gearbeitet. Universität: sie greift ihre Ersparnisse an, wohnt bei Freunden, die Schwiegereltern schicken Lebensmittelpakete. Sie trägt immer noch Schwarz, weil sie keine anderen Kleider besitzt. Physiologie, Histologie, Anatomie, mit zwanzig lernt manleichter als mit siebenunddreißig. Präpariersaal.
Währungsreform, kein eigenes Geld mehr. Sie wird abhängig von den Brüdern, die sie mit Fünfzigmarkscheinen unterstützen. Sie muß lernen zu danken. Die Brüder sehen in ihr noch immer die kleine Schwester, die den Haushalt führt und hübsch Klavier spielt. Die Veränderungen haben sie noch nicht wahrgenommen.
Staatsexamen. Wieder ist eine Hürde genommen. Die Brüder stellen die Zuschüsse ein, aber noch ist die Doktorarbeit nicht abgeschlossen. Pflichtassistentenzeit an einer großen städtischen Klinik. Anna K. lebt von der Rente, die sie als Kriegerwitwe erhält, monatlich vierzig Mark. Davon bezahlt sie ihr neun Quadratmeter großes Leerzimmer, Heizung, Schuhsohlen, Straßenbahnfahrkarten; das Essen erhält sie in der Klinik. Ein namhafter Internist erklärt sich bereit, sie als Gastärztin auf seiner Station arbeiten zu lassen, ohne Vergütung. Sie braucht Erfahrungen an Krankenbetten, einzig darauf kommt es an, weiterhin vierzig Mark im Monat, Essen aus der Diätküche, salzfrei – hinter verschlossener Tür, es ist nicht gestattet, daß eine Gastärztin in der Klinik Essen erhält.
Arztvertretungen auf dem Land. Bei jedem Wetter ist sie mit dem Fahrrad unterwegs, die Gegend ist bergig, die Dörfer liegen weit auseinander. Sie erhält zehn Mark Honorar für den Tag. Man holt sie sonntags, oft nur wegen Nichtigkeiten. Eines Abends ruft man sie bei Regen und böigem Herbstwind auf einen abgelegenen Bauernhof. Die Bäuerin hat ›manchmal so ein Ziehen in der Schulter‹ und muß aufstoßen, wenn sie fett gegessen hat. Dr. med. Anna K. verschreibt ein Einreibemittel und eine Verdauungshilfe. Als sie gehen will, sagt die Bäuerin befriedigt: ›Nun hon’ ich Sä doch auch als mol gesehn.‹ Ärzte haben einen Dienstleistungsberuf.
Sie übernimmt die Vertretung eines erkrankten Landarztes, wohnt im Haus, wird dort auch verpflegt. Die Praxis ist groß, ohne Auto ist sie nicht zu versorgen. Ein Fahrlehrer begleitet sie bei den Hausbesuchen in den Nachbardörfern. Schnee, Glatteis, keine Winterreifen. Unter erschwerten Bedingungen erwirbt sie den Führerschein. Nach dem Tod des Arztes könnte sie seine Praxis übernehmen, aber sie hat erkannt, daß eine Landpraxis besser von einem Mann besorgt wird, den eine Ehefrau mit Glühwein erwartet, wenn er von einem Nachtbesuch zurückkehrt.
Sie ist 45 Jahre alt, als sie in ihrer Heimatstadt die Zulassung erhält. Dr. med. Anna K., praktische Ärztin. Sie trägt das Schild uneingewickelt unterm Arm nach Hause, einer der großen Augenblicke dieses Lebens.
Die Geschwister geben kleine Kredite und Ratschläge, Freunde helfen mit Möbeln aus, sie mietet eine Parterrewohnung. Das Wartezimmer ist zugleich auch Wohnzimmer. Sie kauft eine Leinendecke und Garn, um zu sticken, während sie auf Patienten wartet. Die Decke ist bis heute nicht fertig geworden. Sie kauft ein Auto aus dritter, wenn nicht vierter Hand.
Fünfzehn Jahre sind seither vergangen. Inzwischen versorgt sie eine große Praxis, bewohnt eine große Wohnung, fährt einen großen Wagen. Sie macht viele Hausbesuche, da viele ihrer Patienten alt sind. Sie kommt auch nachts, wenn man sie ruft. Nur selten wird ihr Telefon auf den automatischen Auftragsdienst umgestellt. Sie erwartet, daß man sie nur in Notfällen bittet. Sie ißt und trinkt mäßig, kleidet sich der Jahreszeit entsprechend, trainiert ihr Herz durch tägliches Treppensteigen bei den Hausbesuchen. Sie lebt vernünftig und erwartet Vernunft, viele Krankheiten sind selbstverschuldete Krankheiten. Bei einem Raucherkatarrh, bei Gallenkoliken nach unmäßigem Essen, bei Alkoholmißbrauch kann man mit ihrer Hilfe, aber nicht mit ihrem Verständnis rechnen. Sie muß sich oft zu Geduld und Nachsicht zwingen. Sie war nie nachsichtig mit sich selbst.
Sie verdient gut, obwohl sie sich an die untere Grenze der Gebührenordnung hält. Die erste Anschaffung war ein Konzertflügel, später kam noch ein Cembalo hinzu. Anna K. hat Freude an schönen Dingen, an Teppichen, Bildern. Sie hat etwas vorzuweisen, wenn Brüder und Schwägerinnen sie besuchen. Sie erzählt gern von jenen schlechten Jahren nach dem Krieg, wenn sich die Freunde zusammenfanden, um zu musizieren. Sie kamen von weit her und brachten ein Brikett mit und Lebensmittel, die man allesamt in einen großen Kochtopf tat. Dann wurde musiziert, und ab und zu hat einer umgerührt. Nach Stunden war der Eintopf fertig und der Mozart einstudiert. Große Zeiten für Mozart! Bei den Hauskonzerten, die sie veranstaltet, wird auch heute noch zuerst musiziert und erst dann gegessen und getrunken.
Abends spät oder sonntags geht sie manchmal in die Küche und kocht Marmelade oder Gelees nach Gutsherrinnenart. Relikte aus einem Leben, das sie nie hat führen können. Die beiden Sprechstundenhilfen, der Lehrling und die Frau, die den Haushalt besorgt, essen mit bei Tisch, auch das nach Gutsherrinnenart. Sie hat ihr Leben durch Arbeit abgesichert, durch Freunde, durch Musik. Aber abends, wenn sie erschöpft zurückkommt, ist die Wohnung leer. Zwei Ringe am Finger und niemand neben ihr, der ihr den Koffer trägt, so, wie sie es vorausgesehen hatte.
Sie nimmt an medizinischen Kongressen und Wochenendtagungen teil; ihr Labor ist modern und gut eingerichtet, aber dort wird wenig entdeckt, was sie nicht zuvor schon wahrgenommen hätte. Sie kennt nicht nur ihre Patienten, sie kennt auch die Familien: eine Hausärztin, die spürt, was einen Menschen krank machen kann.
Vor kurzem haben wir ihren 60. Geburtstag gefeiert. Ich habe sie nie vorher so jung, heiter und hell gesehen. Andere Frauen denken dann an Pensionierung und Ruhestand, bei Anna K. ist davon nicht die Rede. Sie lebt gern und arbeitet gern. So oft wie möglich fährt sie auf das Gut der Schwiegereltern, das längst von einer neuen Generation bewirtschaftet wird. Die Bindung zur Familie ihres Mannes ist nicht abgerissen. Sie hat den Platz, der für sie bestimmt schien, immer vor Augen, er wird von ihrer Schwägerin eingenommen. Die Frauen mögen sich, eine erkennt die andere an. Wenn eine Nichte oder ein Großneffe heiratet, dann fragt man sie manchmal, ob sie nie an eine neue Heirat gedacht habe. Sie sagt dann immer: Ich bin gut verheiratet, mit meinem Beruf.
Mit Vorliebe spielt sie Bach. Seine Fugen vor allem. Eigene Spannungen und Probleme lösen sich dabei, sie fügt sich der Logik des Kontrapunkts. Fuge – sich fügen. Mit Musik-hören ist es nicht getan, selber muß sie spielen.
Wir kennen uns nun fast 30 Jahre, wir stehen uns nahe. Sie spricht jetzt häufiger als früher von ihrem Mann. Mein Mann, sagt sie, nie mein gefallener oder mein verstorbener Mann. Sie läßt ihn weiterleben. Sie hat ihm ein Stück Unsterblichkeit verschafft.
Lewan, sieh zu!
Er sucht den jüdischen Friedhof in K. auf; die Gräber sind eingesät, der Friedhof wird von der Stadt in Ordnung gehalten. Blumen wären ihm lieber, aber er kann sich die Kosten für den Gärtner nicht leisten. Das Postscheckkonto, das er noch lange Zeit in der Bundesrepublik unterhielt, wurde inzwischen wegen Geringfügigkeit aufgelöst. Der Regen hat die Grabinschrift ausgewaschen. Mit Pinsel und Farbe zieht er Namen und Daten nach. Jacob L., 1860 – 1936, sein Vater; gestorben und begraben in K. Sieben weitere Gräber und eine Gedenktafel für Lina L.-Mecca, geb. 2.2.1875, und Hans L., geb. 10.2.1911; beide umgekommen in Polen: die Mutter und der jüngere Bruder. Die hebräischen Inschriften auf der Rückseite der Grabsteine kann er nicht lesen.
Louis L. (siehe auch Großer Brockhaus, 1932: L., Louis, Komponist, geb. in Wreschen bei Posen, 3. April 1821, gest. in Berlin, 4. Febr. 1894, daselbst seit 1840 Dirigent des Synagogenchores, seit 1866 Dirigent der Neuen Synagoge, erneuerte den jüd. Tempelgesang durch Zurückgreifen auf die altjüdisch synagogalen Melodien. Er komponierte Orchester-, Kammermusik- und Chorwerke und vor allem Musik für den Gottesdienst), Louis L. war 1840 aus Polen aufgebrochen und nach Westen gezogen in das liberale Preußen. Hundert Jahre später endet die Geschichte der Familie L. in einem Vernichtungslager in Polen.
Am 12. Nov. 1944 schrieb er aus einem Internierungslager an Hermann Hesse: »Es ist eines der Hindernisse in meinem religiösen Fühlen, daß ich nicht über die Tatsache hinwegkomme, daß die Gottheit die Menschen hätte glücklich machen können und daß sie es nicht getan hat. Einen Hund könnte dieser Weltzustand rühren – und einen Gott rührt er nicht?« Kurz bevor er das schrieb, hatte er einem lungenkranken Missionar, der nicht in Afrika wirken konnte, erlaubt, ihn zu missionieren. In einem Spital im unbesetzten Frankreich. Nutzen konnte es ihm zu diesem Zeitpunkt nicht mehr, ein Katholik zu werden.
Sein Vater hatte in den Gründerjahren eine Wollwäscherei gegründet. Er lebte in K., besaß aber einen Paß der freien Hansestadt Hamburg, worauf er sein Leben lang stolz war. Ein wohlhabender, freiheitlich denkender Mann, der auf Anpassung bedacht war. Er ließ seinen Sohn am christlichen Religionsunterricht teilnehmen, man lebte in einem christlichen Land. L. liebt vor allem die Auswirkungen des christlichen Glaubens: in der Musik, in der Baukunst, der Malerei, der Dichtung.
Er reist ohne Gepäck. Pantoffeln, Waschzeug, mehr ist nicht nötig. Bedürfnislos, nicht arm. Ein Gast mit der Fähigkeit, sich unsichtbar zu machen. Er wird zur Buchmesse nach Frankfurt weiterreisen. Da werden sie sagen: Der alte Lewan! Lebt der denn noch?
K. ist seine Geburtsstadt; er hat einst hier das humanistische Gymnasium bis zum Abitur besucht. Dort, wo sein Elternhaus stand, befindet sich heute eine Tankstelle. Schule, Theater, nichts steht mehr dort, wo es einmal stand. Die Stadt hat bei Luftangriffen schwer gelitten. Man hat ihm nach Kriegsende angeboten, das ererbte Grundstück gegen lebenslängliches Wohnrecht in einer Wohnsiedlung einzutauschen, aber er wollte nicht nach Deutschland zurückkehren.
Wiedergutmachung im Verhältnis 10:1.
»Musique à Grandpapa«, sagen die Enkel, wenn er Opern von Wagner oder Strauß hört. In seiner Familie spricht keiner mehr deutsch.
Wir sehen im Fernsehen ein Stück von Arthur Schnitzler. Er sagt anschließend: »Warum bringen sie nicht das ›Abschiedssouper‹ von Schnitzler? Dasselbe Thema! Aber heiter abgehandelt!«
Nach seiner Ansicht kann man Kriege nur noch aus der Sicht eines Schwejk, eines Jacobowsky darstellen.
Einer der Schauplätze seines Lebens: Soprano bei Solgio im Bergell. Das Vale Bergella zieht sich von Ost nach West durch die schweizerischen Alpen. Monatelang erreicht die Sonne die Talsohle nicht. Die Internierten steigen von Oktober bis März an jedem Tag so weit den Berg hinauf, bis sie die Sonne erreicht haben. Schneegrenze, Baumgrenze, Sonnengrenze.
Er lobt die Schweizer, sie waren seine Gastgeber; seit 1966 besitzt er einen schweizerischen Paß. Man läßt ihn in Frieden leben, etwas anderes erwartet er nicht. An geistigen Fähigkeiten ist man weniger interessiert; wichtig ist, daß er dem Staat nicht zur Last fällt. Sein Geld bekommt er aus der Bundesrepublik. Eine ›Rente für Schaden im Beruf‹, die ihm ein Dokument verschafft hat, das die Unterschrift des Josef Goebbels trägt; es besagt, daß der Verlag, den Dr. L. in den dreißiger Jahren von Holland aus leitete, im Handelsregister gelöscht sei. Sechshundert Mark monatlich zuerst, jetzt etwas mehr als tausend Mark; davon können zwei alte Leute leben, wenn sie bescheiden sind, auch in Genf. Kleine Beträge aus seinen Buchveröffentlichungen kommen hinzu. Nachmittags helfen er und seine Frau dem Sohn im Briefmarkengeschäft. Keine Schulbildung, kein Studium für die Kinder; sie sind im Untergrund aufgewachsen, in Armut. Auch die Enkel konnten nicht studieren. Tausendjährig ist das Dritte Reich in seinen Auswirkungen. Die Schäden verwachsen sich nicht in einer Generation.
Er hat niemals eine Zeile gegen das Land geschrieben, aus dem er stammt, zu dem er eine unerwiderte Liebe hegt. Er hat 1000 Jahre geschwiegen. Auf einem PEN-Kongreß in den fünfziger Jahren sagt der Verleger Peter Suhrkamp zu ihm: »Sie glauben doch nicht, daß ich einen sechzigjährigen Autor durchsetzen kann? Es ist zu spät, man muß heute viel früher beginnen.« Viel früher: da flüchtete er durch Europa, überwinterte in Lagern. Erst als das Ende des Krieges abzusehen war, fing er an, mit Balzacscher Wut zu schreiben, zog Schleusen auf, schrieb, was sich in zwei Jahrzehnten angestaut hatte.
»Kein Mann gedeiht ohne Vaterland!« Er zitiert Storm.
Als er endlich hätte reisen können, ist er schon zu alt zum Reisen, da staunt er nicht mehr, da registriert er nur noch. Der Marcusdom. Der Capitolinische Hügel. Er kennt das alles längst von Bildern. Er ermüdet leicht, möchte mittags eine Stunde ruhen, er ist fünfundsechzig Jahre alt. Rentenalter.
Er hört keine Nachrichten im Rundfunk, sieht keine Tagesschau im Fernsehen, liest in den Zeitungen nur das Feuilleton. Er lebt in einem Land, das geringes politisches Interesse von ihm erwartet. Er trinkt nicht. Er raucht nicht. In seinem 75. Lebensjahr stellte er keine Ersatzansprüche an die Krankenkasse.
Er lobt die Schweizer: Der Dichter Arnold Krieger besaß im Krieg lediglich einen Tagesschein für die Schweiz. Immer, wenn er seine Ausweisung erhielt, erwartete seine Frau gerade ein Kind; also durfte er aus humanen Gründen bleiben; er blieb fünf Jahre.
Er lobt auch die Franzosen: Die Polizeistreife, die man auf die Deutschen angesetzt hatte, suchte zunächst einmal ein Bistro auf. Trinken wir einen Wein! Essen wir! Das gab den flüchtenden Deutschen einen Vorsprung. Er verdankt der Laxheit der Franzosen seine Rettung; unter den Deutschen hätte er kein Nadelöhr gefunden. Bis zum Einmarsch der deutschen Truppen hatte er in Paris gelebt. Briefmarkenhandel.
Seine Ähnlichkeit mit Charlie Chaplin!
Im Ersten Weltkrieg war er ein begehrter Briefeschreiber für seine Kameraden. Da hat sich ein schriftstellerisches Talent noch bezahlt gemacht, sagt er, als noch nicht alle Leute lesen und schreiben konnten! Unter die Briefe schrieb er: Schicke bitte auch für meinen Kameraden, der Dir diesen Brief geschrieben hat, eine Wurst mit!
Von 1914 – 1918 kämpfte er für das Deutsche Reich. In Serbien, Mazedonien, Rußland und auch in Polen, dem Land seiner Herkunft. Von 1933 – 1945 kämpfte das Deutsche Reich gegen ihn. In seiner ironisch-satirischen ›Lebensbeichte‹ steht: »Stoß deinen Gegner mit dem Bajonette/ Sonst stößt er seins in deinen werten Bauch!« Ein Pazifist zwischen Enthusiasten.
In der Zeit des Stummfilms schreibt er Filmszenarios, ist Chefredakteur einer Filmzeitschrift, Dramaturg einer Berliner Filmgesellschaft. Auf Wunsch des Vaters studiert er Germanistik, promoviert zum Dr. phil. in Bonn und übernimmt Vertretungen, vertritt zwanzig Firmen in Holland, darunter eine für Straußenfedern. Aber die Zeiten für Straußenfedern waren vorbei, sogar auf der Bühne. Ein Buchhändler in Utrecht stellt ihn gegen Kost und Logis ein, dann macht er sich selbständig: Buchhandlung und Verlag, Sitz in Holland; aber die Kunden leben in Deutschland. Er bezieht eine Wohnung, und seine Frau klebt Zeitungen vor die Fensterscheiben, damit die Nachbarn nicht sehen, daß sie keine Möbel besitzen. Kinder.