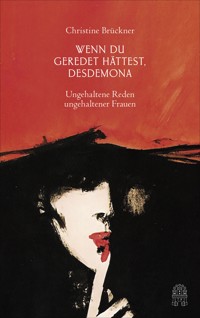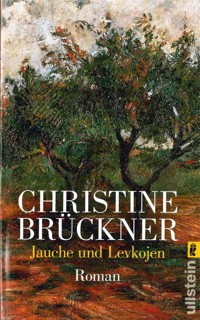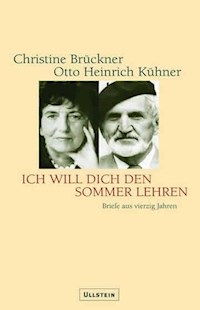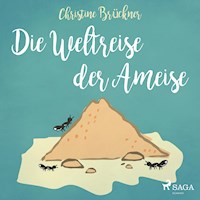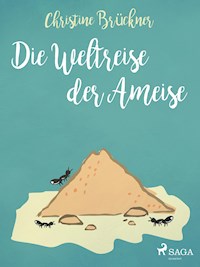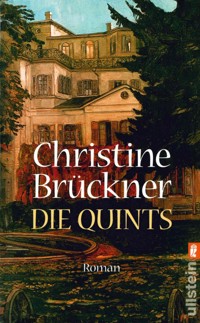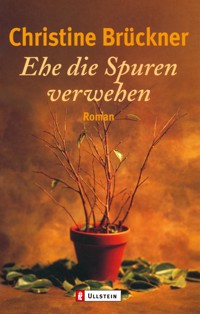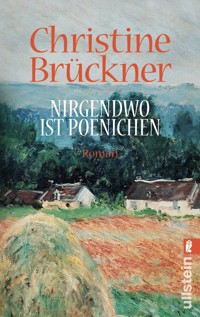
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
'Wer kein Zuhause mehr hat, kann überallhin', erklärt Maximiliane von Quindt aus Poeninchen in Hinterpommern und macht sich mit ihren viereinhalb Kindern auf den Weg in den Westen, eine unter Millionen Vertriebenen. Aus einer Kriegswaise des Ersten Weltkriegs ist eine Kriegerwitwe des Zweiten Weltkriegs geworden. Doch im Gegensatz zu anderen Flüchtlingen wird Maximiliane nicht wieder sesshaft. Allen Prophezeiungen zum Trotz vergeht ihr das Lachen nicht und nicht das Singen. Sie sucht und findet, vorübergehend, Wärme in Männerarmen. Als ihre Kinder erwachsen sind, sagt sie: 'Lauft!' Um sie zu besuchen, muss sie den Globus zur Orientierung nehmen. Denn die Quindts, jahrhundertelang auf jenem fernen Poeninchen zu Hause, sind nun in alle Winde verstreut. Fast sechzigjährig fährt Maximiliane ins polnische Pommern, sitzt im verwilderten Park des einstigen Herrenhauses auf einem Säulenstumpf und 'vollzieht nachträglich und ihrerseits die Unterzeichnung der Polenverträge'. Die Speisekammer Poeninchen, aus der sie sich nährte, ist leer. Wenn sie zurückkehrt, wird auch sie sesshaft werden können. Mehr über Christine Brückner erfahren Sie über die Stiftung Brückner-Kühner unter http://www.brueckner-kuehner.de/.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Das Buch
»Wer kein Zuhause hat, kann überall hin«, erklärt Maximiliane von Quindt aus Poenichen in Hinterpommern, den Lesern aus dem ersten der Poenichen-Romane, Jauche und Levkojen, bekannt, und macht sich mit viereinhalb Kindern auf den langen Weg in den Westen, eine unter Millionen Vertriebenen. Aus einer Kriegswaise des Ersten Weltkriegs ist eine Kriegerwitwe des Zweiten Weltkriegs geworden. Doch im Gegensatz zu anderen Flüchtlingen wird Maximiliane nicht wieder seßhaft. Allen Prophezeiungen zum Trotz vergeht ihr das Lachen nicht und auch nicht das Singen. Sie sucht und findet, vorübergehend, Wärme in Männerarmen. Als ihre Kinder erwachsen sind, sagt sie »Lauft!«. Um sie zu besuchen, muß sie den Globus zur Orientierung nehmen. Denn die Quindts, jahrhundertelang auf jenem Poenichen zu Hause, sind nun in alle Winde verstreut. Fast sechzigjährig fährt Maximiliane ins polnische Pommern, sitzt im verwilderten Park des einstigen Herrenhauses auf einem Säulenstumpf und ›vollzieht nachträglich und ihrerseits die Unterzeichnung der Polenverträge‹. Die Speisekammer Poenichen, aus der sie sich heimlich nährte, ist leer. Wenn sie zurückkehrt, wird auch sie seßhaft werden können.
Die Autorin
Christine Brückner, am 10. 12. 1921 in einem waldeckischen Pfarrhaus geboren, am 21. 12. 1996 in Kassel gestorben. Nach Abitur, Kriegseinsatz, Studium, häufigem Berufs- und Ortswechsel wurde sie in Kassel seßhaft. 1954 erhielt sie für ihren ersten Roman einen ersten Preis und war seitdem eine hauptberufliche Schriftstellerin, schrieb Romane, Erzählungen, Kommentare, Essays, Schauspiele, auch Jugend- und Bilderbücher. Von 1980–1984 war sie Vizepräsidentin des deutschen PEN; 1982 wurde sie mit der Goethe-Plakette des Landes Hessen ausgezeichnet, 1990 mit dem hessischen Verdienstorden, 1991 mit dem Bundesverdienstkreuz 1. Klasse. Christine Brückner war Ehrenbürgerin der Stadt Kassel und stiftete 1984, zusammen mit ihrem Ehemann Otto Heinrich Kühner, den »Kasseler Literaturpreis für grotesken Humor«.
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein-taschenbuch.de
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen,wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung,Speicherung oder Übertragungkönnen zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
Ungekürzte Ausgabe im Ullstein Taschenbuch26. Auflage 2008© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2006© 2003 by Ullstein Heyne List GmbH & Co. KG© 2000 by Econ Ullstein List Verlag GmbH & Co. KG, MünchenUmschlaggestaltung: Büro Hamburg(nach einer Vorlage von Morian & Bayer-Eynck, Coesfeld)Titelabbildung: Archiv für Kunst und Geschichte, BerlinE-Book-Konvertierung: CPI – Ebner & Spiegel, UlmPrinted in GermanyISBN 978-3-8437-1011-4
Meinem Mann, dem SchriftstellerOtto Heinrich Kühner,der das Leben der Quindtsfünf Jahre lang ratend und helfendmit mir geteilt hat.
1
›»Ja, der Friede! Was wird aus dem Loch, wenn der Käs gefressen ist?«‹
Bert Brecht
Maximiliane Quint schläft, an jeder Seite zwei ihrer Kinder. Sie ist am Ziel. Sie hat ihre Ziele nie weit gesteckt. Dieses hieß Westen. Damit die Kinder Platz neben ihr haben, hat sie die angewinkelten Arme neben den Kopf gelegt; sie ist im siebenten Monat schwanger.
Nie wieder Kranichzüge. Nie wieder Wildgänse.
Eine unter 13 Millionen, die die deutschen Ostgebiete vor den anrückenden sowjetischen Truppen verlassen haben und jetzt, im Herbst 1945, in Schüben zu drei- und viertausend von den russischen Posten jeden Abend über die Grenze in die englisch besetzte Zone durchgelassen werden. Bei Dunkelheit waren sie mit ihren Bündeln durch die Wälder gezogen, hatten sich vor allen uniformierten Männern versteckt und die ›grüne Grenze‹ überschritten, auf die sich schon bald der ›Eiserne Vorhang‹ niederlassen wird.
Maximiliane liegt auf einem Notbett im ungeheizten Maststall des Gutshofs Besenhausen. Es fehlte nicht viel, dann hätte sie ihr fünftes Kind in einem Stall zur Welt gebracht und in einen Schweinetrog gelegt.
Der alte Baron Quindt, ihr Großvater, hatte im November 1918 der Dorfkirche, deren Patronatsherr er war, aus Anlaß ihrer Geburt eine Heizung gestiftet, und schon damals wurde behauptet, daß das Neugeborene die Welt ein wenig wärmer gemacht habe. Später wird einmal der Vater ihres Schwiegersohns sagen, daß es um einige Grade wärmer in einem Raum werde, wenn sie ihn betrete. Der erste Toast, der ihr, dem Täufling, galt, hatte gelautet: ›Vor Gott und dem Gesetz sind alle Kinder gleich.‹ Der Großvater hatte ihn ausgebracht, und er hatte, weiter vorausblickend, als er ahnte – und er ahnte viel –, gesagt, daß man ihn sich werde merken müssen.
Von ihrem Vater, Achim von Quindt, ist kaum mehr überliefert als jenes telegrafierte dreifache ›Hurra, Hurra, Hurra‹, mit dem er auf die Geburt seines ersten und einzigen Kindes reagierte, bevor er in den letzten Tagen des Ersten Weltkriegs fiel. Dieses Telegramm befindet sich in dem Kästchen, das ihr ältestes Kind, Joachim, im Schlaf an sich preßt. Was man liebt, legt man neben sich, das Kind die Puppe, der Mann die Frau; Maximiliane hat ihre Kinder neben sich gelegt. Von ihrer Mutter weiß man kaum mehr als von ihrem Vater, nur, daß sie sich 1935 in Sicherheit gebracht hat, zusammen mit ihrem zweiten Mann, dem jüdischen Arzt Dr. Grün.
Fünfjährig hatte Maximiliane in breitem pommerschen Platt zu ihrem Großvater gesagt: ›Ich will vel Kinner, Grautvoader!‹ Und er hatte mit ›später‹ geantwortet. Viel später ist es darüber nicht geworden. Siebenundzwanzig Jahre alt ist sie zu diesem Zeitpunkt und Mutter von viereinhalb Kindern, drei davon mit demselben Vater, Viktor Quint, der im April als treuer Anhänger seines Führers Adolf Hitler gefallen ist, was sie aber noch nicht weiß. Joachim, der Erstgeborene, siebenjährig, von ihr ›Mosche‹ genannt, der seine Ängstlichkeit tapfer bekämpft, ein zartes und zärtliches Kind; dann Golo, furchtlos und ungebärdig, vorerst noch das hübscheste ihrer Kinder, braunlockig und mit den runden, lebhaften Augen seiner Mutter, ›Kulleraugen‹, die ein polnischer Leutnant nun schon in vierter Generation auf geheimnisvolle Weise vererbt hat. Golo hat in Ermanglung eines Gewehrs einen Stock neben sich liegen. Als nächste Edda, ein Sonntagskind, das ihren großdeutschen Namen der Tochter des ehemaligen Reichsmarschalls verdankt. Edda hat Viktor Quint zum Vater, aber nicht Maximiliane zur Mutter, ist aber von ihr akzeptiert und adoptiert worden, ein Kind der Liebe, richtiger ein Kind der Liebe zum Führer; neben ihr liegt die Puppe, die auf der Flucht einen Teil der Haare und einen Arm eingebüßt hat. Schließlich Viktoria, drei Jahre alt, trotz ihres siegreichen Namens ein schwieriges Kind, von Krankheiten und Unheil bedroht, an einer handgesäumten Batistwindel lutschend, die zum vorgesehenen Zweck endlich nicht mehr benötigt wird. Und das ›halbe‹ Kind: die Folge einer Vergewaltigung durch einen Kirgisen vom Balchasch-See.
Bis zur Flucht aus Pommern hatte Maximiliane vom Krieg kaum mehr wahrgenommen als die Abwesenheit ihres Mannes, unter der sie jedoch nicht litt. Bis sie dann im letzten Kriegswinter mit den Gutsleuten Poenichen verlassen mußte; mit Pferd und Wagen, aber auch mit Ochsen, Treckern, Kindern und Frauen, ein paar Hunden und Katzen. Die Katzen kehrten am Dorfausgang wieder um.
Ihre Großeltern, die alten Quindts, waren mit wenigen anderen zurückgeblieben. Eines Morgens hatte sie den Aufbruch des Trecks verschlafen, war allein, mit einem Handwagen und den Kindern, weiter nach Westen gezogen, bis sie von der anrückenden Front überrollt wurde.
Sie ist keine Quindt auf Poenichen mehr; sie hat mit allem anderen auch ihren Namen verloren. Man redet sie mit ›liebe Frau‹ an.
»Sie müssen doch die Geburtsurkunden Ihrer Kinder gerettet haben, liebe Frau!«
»Ich habe die Kinder gerettet«, antwortet sie.
Der Lagerpfarrer spricht ihr Trost zu. »Der Mensch lebt nicht von Brot allein, liebe Frau!«
Und sie sagt: »Aber ohne Brot überhaupt nicht, Herr Pastor!«
»Sie werden Ihre Einstellung ändern müssen, liebe Frau!«
»Später, Herr Pastor!«
Dort, wo sie herstammt, sagt man ›Pastor‹ und betont die letzte Silbe.
Hinterpommern! Früher gab dieses Wort Anlaß zur Heiterkeit, eine Gegend hinterm Mond. Jetzt erfährt sie, daß sie ›jenseits von Oder und Neiße‹ gelebt hat, und niemand lacht mehr darüber. Ein Anlaß zum Mitleid. Wo fließt die Neiße? Noch ist Maximiliane Quint wie die anderen Flüchtlinge davon überzeugt, daß sie zurückkehren wird. ›Das ist allens nur’n Övergang‹, wie Bräsig zu sagen pflegte. Man hat sie zur Erbin von Poenichen erzogen. Eine Neunzehnjährige, die Mutter wurde, bevor sie eine Geliebte und eine Frau hätte werden können, von ihrem Mann wie ein Nährboden für seine Kinder behandelt, mit denen er den deutschen Ostraum zu bevölkern gedachte. Über Jahre werden sie und ihre Kinder als ›Kriegshinterbliebene‹ und ›Heimatvertriebene‹ in den Sammelbecken der Statistiken auftauchen.
Laute Befehle. Sie werden geweckt. Sie müssen jenen Flüchtlingen Platz machen, die in der vergangenen Nacht über die Grenze gekommen sind. Ein Durchgangslager, dessen Namen jahrzehntelang für viele zur ersten Zuflucht wird: Friedland.
Die anderen Flüchtlinge ziehen ihre Schuhe an und suchen hastig ihre Gepäckstücke zusammen; schon hängen sie sich die Rucksäcke und Bündel um. Die Kinder rütteln an ihrer Mutter, aber wie immer fällt es schwer, sie zu wecken. Joachims Stimme dringt dann doch an ihr Ohr und an ihr Herz.
»Mama! Wir müssen weiter!«
Maximiliane knotet das Kopftuch unterm Kinn zusammen wie alle Frauen aus dem Osten; nichts unterscheidet sie mehr.
In einer Baracke werden sie entlaust, in einer anderen Baracke erhalten sie Lebensmittelmarken: 75 Gramm Fleisch und 100 Gramm Fett für die laufende Woche; für werdende und stillende Mütter ein Liter Vollmilch und 500 Gramm Nährmittel – auf dem Papier. Statt Bescheinigungen gibt es erstmals Reisemarken.
»Wir gehn auf Reise!« ruft Golo begeistert. Die Flucht scheint beendet, ebenfalls auf dem Papier. Die Heilsarmee schenkt Kakao aus. Wie immer stellt sich Maximiliane mit den Kindern als letzte an. ›Sie hat de Rauhe weg‹, hatte schon die Hebamme Schmaltz, die sie auf die Welt holte, gesagt. Trotzdem gehört sie nicht zu den letzten, die abgefertigt werden.
Bei den Amerikanern gibt es am meisten zu essen, heißt es, aber sie halten jeden Jungvolkführer für einen Nazi! Die Engländer sind genauso arm dran wie die Deutschen, aber sie behandeln die Besiegten anständig! Gerüchte. Die Flüchtlinge tun sich nach ihren Herkunftsländern zusammen: Ostpreußen, Schlesier, Sudetendeutsche, Pommern, zusammengehalten durch ihre Sprache. Die pommerschen Trecks sollen von Mecklenburg aus nach Holstein weitergezogen sein, heißt es. Also nach Holstein! Das bedeutet: englische Besatzungszone, Hunger. ›Wat sin mut, mut sin.‹ Ein Pommer tut, was man ihm sagt.
Joachim liest am Ausgang des Lagers die Aufschrift eines Schildes vor, das die Engländer zur Warnung aufgestellt haben. Er liest jetzt schon ohne zu stocken, obwohl er bisher auf keiner Schulbank gesessen, wohl aber auf den Fußböden von Schulen geschlafen hat. »›Wer nicht im Besitz einer Zuzugsgenehmigung ist, erhält keine Wohnung, keine Lebensmittelmarken, keine Fürsorgeunterstützung in Niedersachsen!‹« Er zittert. »Mama!«
Seine Mutter tröstet ihn. »Wir suchen unseren Treck! Martha Riepe hat alles gerettet, unsere Pferde und die Betten und Mäntel und Schuhe und …«
»Versprichst du uns das?«
»Nein, Mosche! Versprechen kann ich das nicht!«
Joachim schließt die Augen, sammelt sich, strafft sich, geht an seinen Platz und nimmt die kleine Viktoria an die Hand.
Als der Zug der Flüchtlinge das Lager verläßt, können die fünf Quints nicht Schritt halten, sie geraten in den Zustrom neuer Flüchtlinge, werden zurückgedrängt und bekommen ein weiteres Mal Kakao. Eine Welle aus Kakao ergießt sich über das hungernde Westdeutschland. Maximiliane leckt Viktoria die Kakaoreste vom Mund, die einfachste Form der Säuberung, ein Taschentuch müßte gewaschen werden. Die übrigen Kinder benutzen den Handrücken.
Die Viehwaggons, von der englischen Besatzungsmacht auf dem Bahnhof Friedland zum Weitertransport der Flüchtlinge bereitgestellt, werden gestürmt. Menschentrauben hängen an den Wagen, selbst die Dächer werden besetzt.
Wieder müssen die fünf Quints zurückbleiben. Viele Jahre später wird Maximiliane manchmal, wenn sie auf Bahnsteigen steht, nachdenklich die neuen Eisenbahnwagen betrachten, die durch Faltenbälge miteinander verbunden sind, keine Trittbretter haben, keine Außenplattform, dazu die elektrisch geladenen Oberleitungen, und wird denken: nirgendwo Platz für flüchtende Menschenmengen …
Sie machen sich zu Fuß auf den Weg. Zum erstenmal Richtung Norden, nachdem sie bisher immer nur nach Westen gezogen sind. Noch ist das Wetter freundlich, die Herbstregen haben noch nicht eingesetzt. Mittags wärmt sie noch die Sonne. Weit kommen sie nicht, aber sie erreichen einen Bach. Dort machen sie halt, um sich zu waschen. Seit Monaten werden die Kinder nur noch nach Bedarf und Gelegenheit gewaschen, wobei die Gelegenheiten seltener sind als der Bedarf, Äpfel und Rüben dienen als Zahnbürste.
Maximiliane steckt die Nase in Golos Haar. »Du stinkst!« sagt sie. »Wir stinken alle nach Schweiß und Läusepulver. Gib die Seife heraus, Golo!« Aber Golo hat das Stück Seife eben erst im Lager eingehandelt. Er sträubt sich, er braucht es zum weiteren Tauschen.
»Jetzt brauchen wir Seife!« bestimmt die Mutter.
›Brauchen‹ heißt das Wort, das alles regelt. ›Das brauchen wir.‹ ›Das brauchen wir nicht‹, ein Satz, der auch von Golo anerkannt wird.
Maximiliane kniet am Bachufer nieder und wäscht nacheinander die Kinder. Viktorias Gewicht ist so gering, daß die Mutter das Kind durch das Wasser ziehen kann wie ein Wäschestück, wobei Viktoria, was selten vorkommt, auflacht. Die handgesäumten, mit Krone und Quindtschem Wappen bestickten Windeln, die 1919 bereits in Gefahr waren, zu Batistblusen verarbeitet zu werden, dienen als Handtücher. »Lauft«, befiehlt die Mutter den Kindern, »damit ihr warm werdet!« Dann wäscht sie den eigenen, nun schon schwerfälligen Leib.
An der Uferböschung, vom Gebüsch halb verborgen, sitzt ein Mann im Gras, keine dreißig Meter von ihr entfernt, und sieht ihr zu. »Da sitzt jemand!« ruft Edda. Aber Maximiliane wendet nicht einmal den Kopf; sie kann sich nicht auch noch um andere kümmern und um das, was die Leute sagen oder denken könnten. Dieser Mann sagt zunächst gar nichts und denkt viel. Maximiliane geht und breitet die feuchten Windeln zum Trocknen über einen Strauch, wie es die Frauen seit Jahrtausenden tun.
Als sie damit fertig ist, erhebt sich der Mann, geht auf sie zu und streckt die Hand hin. Doch sie reicht ihm die Seife und nicht die Hand. Sie ist eine praktische Frau, keine vernünftige, wie man annehmen könnte.
Der Mann sieht sie an, nimmt dazu die Brille ab, eine Gasmaskenbrille mit Stoffband, wie sie Wolfgang Borcherts Heimkehrer Beckmann zwei oder drei Jahre später auf der Bühne tragen wird. Er sieht ihr in die Augen, bedeckt sogleich die eigenen mit der Hand, nimmt die Hand dann wieder weg, sieht noch einmal in ihre Augen, mit denen sie schon so viel erreicht hat und noch erreichen muß, und sagt: »Oh!« Dann läßt er sich ins Gras fallen, zieht die Stiefel aus, wickelt die Lappen ab und steckt die Füße in den Bach, taucht die Arme tief ins Wasser, wirft sich Hände voll Wasser ins Gesicht, wischt es nicht ab, läßt es unter die wattierte Tarnjacke rinnen.
»Blut und Boden«, sagt er, »aber mehr Blut. Den Krieg kann man nicht mit Seife abwaschen, so viel Seife gibt es gar nicht.«
Golo steht an der anderen Seite des Baches und sieht ihm zu. »Sie müssen den Hut beim Waschen absetzen, Mann!« ruft er.
»Das ist ein Wunschhut, Junge! Den setz ich nicht ab, den hab ich mir gewünscht. Einen Hut trägt man im Frieden. Und jetzt ist Frieden. Kein Stahlhelm mehr und keine Feldmütze mehr!«
Er zieht die Füße aus dem Bach, erhebt sich, steht, barfuß, vor Maximiliane stramm und kommandiert sich selbst: »Rechts um! Links um! Rührt euch! Abteilung Halt! Im Gleichschritt marsch!« Er führt alle seine Befehle aus, bleibt dann stehen und wendet sich Maximiliane zu. »Man hat mich vor sechs Jahren in Marsch gesetzt, und jetzt muß ich irgendwo zum Halten kommen. Man hat mich entlassen. Der Krieg ist unbrauchbar geworden. Aber ich bin noch brauchbar, ich weiß nur nicht, wozu.« Er hält den leeren Brotbeutel hoch, kehrt die Hosentaschen nach außen, klopft an die hohlklingende Feldflasche. »Das habe ich in sechs Jahren eingebracht. Ein Kriegsverlierer! Aber ich habe einen Stempel. Ich bin entlassen. Ich kann einen Nachweis erbringen. Ich habe gelernt, wie man sich eingräbt. Ich habe gelernt, wie man auf Menschen schießt. Ich habe immerhin denselben Rang erreicht wie unser Führer. Gefreiter!«
Die Kinder stehen schweigend in einiger Entfernung. Golo springt, von Stein zu Stein, über den Bach, stellt sich vor den Fremden und fragt: »Wer bist du denn?«
Der Mann sieht den Jungen an und blickt in die Augen der Mutter. Dann läßt er sich auf die angehockten Beine nieder. »Ich habe nichts, ich bin nichts, ich bin der Herr Niemand!« Er streckt ein Bein vor, macht auf dem anderen ein paar Sprünge und singt dazu: »›Ach, wie gut, daß niemand weiß, daß ich …‹ Na, wie heiß ich –?«
Die Kinder weichen einen Schritt zurück. Viktoria fängt an zu weinen, und Joachim sagt vorsichtig: »Rumpelstilzchen.«
Der Mann springt auf, lacht, wirft seinen Hut hoch und fängt ihn auf.
»Lauft!« sagt Maximiliane. »Sucht Brombeeren!«
Sie legt sich ins Gras, schiebt eines der Bündel unter den Kopf. Der Mann läßt sich neben ihr ins Gras fallen. Die Stimmen der Kinder entfernen sich. Wasserplanschen, Vogelruf. Maximiliane schließt die Augen und begibt sich an den Blaupfuhl in Poenichen. Nach einer Weile legt der Mann seine Hand auf ihren Leib, spürt den doppelten Herzschlag.
»Ich träume«, sagt er. »Ich tue so, als ob ich träume.«
Eine Idylle, wie sie nur am Rande der Katastrophen entstehen kann. Die Stunde Null. Rückkehr ins Paradies. Maria aber war schwanger. War is over, over war. Sie sind davongekommen, und noch verlangt keiner, daß sie Trauerarbeit leisten, daß sie Vergangenheit bewältigen, eine Existenz aufbauen und neue Werte schaffen.
Sie wenden sich einander zu und blicken sich an.
Maximiliane versteht alle Worte, die er sagt, auch die, die er nicht sagt. Die Frage nach dem Woher wird mit einer Handbewegung nach Osten beantwortet, die Antwort auf die Frage nach dem Wohin umfaßt die westliche Hälfte der Erdkugel.
Es wird kühler, schon fällt Tau. Die Kinder kommen frierend herbeigelaufen, Golo und Edda mit Mohrrüben und Äpfeln. Sie haben sie in einem Garten gestohlen und werden dafür von der Mutter gelobt. Die Beute wird verteilt, die größeren Äpfel für die größeren Kinder, die kleineren für die kleineren Kinder. »Und was sollen wir morgen essen?« fragt Edda, einen Apfel in der Hand, eine Mohrrübe zwischen den Zähnen.
»Darum müssen wir uns morgen kümmern«, antwortet die Mutter, zieht aus den Bündeln die Schafwolljacken, die von der Baronin Quindt in den Notjahren nach dem Ersten Weltkrieg gewebt worden waren, und zieht sie den Kindern als Mäntel über. Die größte Jacke nimmt sie für sich, aber sie umschließt ihren dick gewordenen Bauch nicht mehr. Der Mann führt ihr vor, wie die Tarnjacke um seinen abgemagerten Körper schlottert, zieht sie aus und reicht sie ihr. Sie reicht ihm die ihrige. Beide Jacken sind noch warm vom Körper des anderen.
Maximiliane rückt die Schultern zurecht und richtet sich für lange Zeit in der Jacke ein und tarnt darunter ihr ungeborenes Kind.
»Nun gehöre ich zu euch!« sagt der Mann zu den Kindern, und zu Maximiliane gewandt: »Gibt es einen Vater für die kleinen Schafe?«
»Ja.«
»Wo?«
»Vermißt.«
»Von dir?«
»Nein«, sagt Maximiliane, ohne zu zögern. Mit sechzehn Jahren hatte sie ihre Mutter verraten.
Dieses ›nein‹ genügt ihm. Damit ist beschlossen, daß er mitkommt. Er sagt zu den Kindern: »Ihr braucht ein Haus! Ich werde euch ein Haus bauen, für jeden eines!« und zaubert Papier und Bleistift aus seinen Taschen. Er wendet sich an Joachim. »Was für ein Haus willst du haben?«
»Eines mit fünf Säulen davor!« antwortet Joachim, ohne überlegen zu müssen.
»Gut. Das bekommst du!«
Zehn Minuten benötigt er, dann besitzt jedes der vier Kinder ein Haus je nach Wunsch, Golo eine Burg mit beflaggten Zinnen und Türmen, Edda ein Mietshaus mit acht Etagen, wo alle Leute Miete zahlen müssen.
»Und ein Haus aus Glas für dieses kleine Mädchen aus Glas«, sagt der Erbauer und verteilt die Bilder. Joachim legt sein Blatt sorgsam in das Kästchen, der einzige, der sein Haus aufbewahren wird.
Währenddessen hat Maximiliane sich mühsam ihre Stiefel wieder angezogen, Knobelbecher, die Golo vor einem halben Jahr einem toten deutschen Soldaten ausgezogen hatte. Der Mann hilft ihr beim Aufstehen.
»›Wir müssen weitermarschieren‹«, sagt er, »›bis alles in Scherben fällt‹, alte Lieder, traute Weisen, wir werden die Scherben kitten!«
»Wir brauchen vor allem einen Platz zum Brüten«, sagt Maximiliane, geht zu den Hagebuttensträuchern und sammelt die noch feuchten Windeln ein.
»Du kannst dich auf mich verlassen!« ruft er hinter ihr her. Der ewige Ruf der Männer.
Wieder schließt sich den Quints ein Heimkehrer an und begibt sich in den Schutz von Frauen und Kindern, will überleben, will kein Held mehr sein. Er hebt Viktoria hoch und setzt sie sich auf die Schultern. Das Kind schließt schaudernd und selig zugleich die Augen, wie früher, als es auf den Schultern des Vaters zum Blaupfuhl ritt.
Sie brechen in neuer Marschordnung auf. Aber diese Kinder wissen bereits aus Erfahrung: Männer kommen und gehen, Verlaß ist nur auf die Mutter.
Eine Weile ziehen sie auf der Landstraße dahin. Bei jedem Fahrzeug, das in ihrer Richtung fährt, winkt der Mann mit seinem Hut, bis ein Lastkraftwagen mit Holzvergaser anhält.
»Was habe ich gesagt! Ein Wunschhut!« ruft der Mann und setzt seinen Hut wieder auf.
Sie dürfen im Laderaum des offenen Wagens mitfahren. Der Boden ist mit Schweinemist bedeckt. Es riecht vertraut wie auf Poenichen. Maximiliane sieht für Augenblicke den Gutshof vor sich, die Stallungen, das Herrenhaus, die Vorhalle mit den fünf weißen Säulen und die Großeltern, die dem Flüchtlingstreck nachblicken, hört wieder die drei Schüsse und schwankt. Der Mann meint, daß sie Halt brauche in dem schwankenden Fahrzeug, und legt den Arm um ihre Schultern. Sie sieht ihn an und lehnt sich gegen ihn.
Der Wagen gewinnt an Fahrt, Funken stieben aus dem Rohr des Holzvergasers. In einer Kurve weht ein Windstoß den Wunschhut vom Kopf des Mannes. Er läßt Maximilianes Schulter los, hämmert mit der Faust gegen das Fenster des Fahrerhauses, gestikuliert und ruft dem Fahrer zu, er wolle absteigen. Dann springt er, als das Fahrzeug anhält, ab und läuft hinter seinem Hut her. Aber der Fahrer wartet nicht, bis der Mann zurückgekehrt ist, sondern gibt Gas und fährt weiter. Maximiliane klopft ans Fenster, der Fahrer bedeutet ihr mit Handbewegungen, er könne nicht warten, es werde bald dunkel werden, und die Scheinwerfer seien nicht in Ordnung.
Die Kinder singen: »›Weh, weh, Windchen, nimm Kürdchen sein Hütchen und laß’n sich mit jagen …‹«
Sie werden den Mann rasch vergessen. Nur wenn die Mutter ihnen später von Rumpelstilzchen vorliest, wird Rumpelstilzchen aussehen wie dieser Heimkehrer, wird eine Gasmaskenbrille tragen und auf einem Bein am Bach entlanghüpfen, in der Nähe von Friedland, und wird seinen Hut hoch in die Luft werfen. Die Kinder siedeln die Märchen dort wieder an, wo die Brüder Grimm sie vor 150 Jahren gesammelt haben.
Maximiliane lehnt an der Rückwand des Fahrerhauses, hält sich mit einer Hand am Gitter fest, drückt mit der anderen die kleine Viktoria an sich und beobachtet, wie der Mann winkt, kleiner wird und verschwindet.
2
›Ein Geduldiger ist besser denn ein Starker.‹
Sprüche Salomos
Der Lastkraftwagen hält vor dem Bahnhofsgebäude in Göttingen. Der Fahrer hebt die kleine Viktoria aus dem Schweinekäfig, hilft der Mutter beim Aussteigen, die anderen Kinder springen allein herunter. Er tippt an den Mützenschirm, sagt: »Na dann!« und fährt davon. Er hat von seiner schicksalhaften Rolle im Leben der Maximiliane Quint nichts wahrgenommen.
Maximiliane faßt in die Innen- und Außentaschen der Jacke, sucht nach einem Hinweis auf den früheren Besitzer und findet nichts weiter als eine Tüte. Sie schüttet einen Teil des Inhalts in ihre Hand: Feuerzeugsteine, Hunderte von Feuerzeugsteinen. Golo stößt einen Freudenschrei aus. Er ist der einzige, der den Wert sofort erkennt, ein Sechsjähriger im Außendienst. Man wird von der Hinterlassenschaft des Unbekannten mehrere Wochen lang leben können.
Die Eisenbahnzüge kamen in Göttingen bereits überfüllt an und durchfuhren mit verminderter Geschwindigkeit den Bahnhof. Einige der am Bahnsteig wartenden Flüchtlinge versuchten, wenigstens ein Trittbrett zu erreichen. Für die Quints gab es kein Weiterkommen.
Im Schutz der Dunkelheit ging Maximiliane mit den Kindern über die Schienen zu einem Personenzug, der auf einem Abstellgleis stand. Eine der Waggontüren war unverschlossen. Sie stiegen ein, fanden ein Abteil mit unversehrten Fensterscheiben und mit einer Tür, die sich schließen ließ. Die Kinder kletterten in die Gepäcknetze und rollten sich zu zweien nebeneinander zusammen.
Kurz darauf unternahm ein Mann der Bahnpolizei einen Kontrollgang durch den Zug und leuchtete mit der Stablampe in jedes Abteil, riß Türen auf, schlug Türen zu.
Der Lichtstrahl seiner Lampe trifft einen Soldaten, der die Kapuze seiner Tarnjacke über den Kopf gezogen hat und die Knobelbecher gegen die Holzbank stemmt. Er rüttelt ihn an der Schulter. »Mann, raus hier, der Krieg ist aus!« Die letzten Worte gehen bereits im Kindergeschrei unter, erst einstimmig, dann vierstimmig, ohrenbetäubend. Seit sie unterwegs sind, haben diese Kinder ihre Mutter durch Geschrei geweckt und beschützt. Der Lichtstrahl richtet sich auf die Gepäcknetze, aus denen verstörte Kindergesichter auftauchen.
Der Soldat streift Kapuze und Kopftuch zurück. Ein Frauengesicht kommt zum Vorschein, von Anstrengungen gezeichnet. Als Maximiliane die müden Lider hebt, glänzen die Augäpfel von Tränen.
»Raus hier!« sagt der Hilfspolizist, wie immer, wenn er jemanden in einem abgestellten Zug entdeckt. Das dritte »Raus hier!« klingt schon nicht mehr überzeugend. »Liebe Frau! Ist das alles ein Wurf?« Der Lichtstrahl streift über die Kinderköpfe; dann schaltet er die Taschenlampe aus und zieht die Tür hinter sich zu.
»Was soll ich denn nun mit euch machen?«
Noch wirken die Parolen der nationalsozialistischen Ära zum Schutz von Mutter und Kind weiter. Für einige Jahre wird Maximiliane daraus noch ihren Nutzen ziehen. Außerdem ist das Mitteilungsbedürfnis des Polizisten größer als sein Pflichtgefühl. »Wir hatten nur eines«, sagt er. »Wir dachten, wir könnten uns nicht mehr Kinder leisten. Und nun haben wir gar keines. Bei Brazlaw. Da war ein Brückenkopf. Haben Sie mal davon gehört?«
Maximiliane schüttelt den Kopf.
»Liegt am Bug. Kein Mensch kennt das. Vielleicht bringen Sie ja ein paar von denen durch.«
»Brauchen Sie vielleicht Feuerzeugsteine?« erkundigt sich Golo aus dem Gepäcknetz. Aber er gerät an einen Nichtraucher.
»Auch nicht einen einzigen?«
»Meinetwegen, Junge, einen!«
Er schaltet die Lampe wieder an, zieht eine flache Flasche aus der Jackentasche und reicht sie der Frau. »Nehmen Sie mal ’nen Schluck, das wärmt einen auf.«
Maximiliane trinkt, reicht die Flasche an Joachim und der an Golo weiter.
»Sie ziehen ja Trinker ran, liebe Frau!«
»So rasch wird aus einem Pommern kein Trinker.«
»Pommern! Wo die Menschen überall wohnen! Ich komme aus Weende. Ich war immer beim Gleisbau. Jetzt mach ich Polizei, weil ich nicht belastet bin, und die von der früheren Polizei arbeiten jetzt im Gleisbau. Aber zum Polizisten bin ich nicht geboren. Die Leute …«
Doch Maximiliane hört von seinen Ansichten über die Polizei nichts mehr. Sie schläft schon wieder. Der Mann steckt die Flasche ein, sagt, daß der Zug gegen sechs Uhr in der Frühe abfahren wird, und fragt die Kinder: »Wo wollt ihr denn überhaupt hin?«
»Nach Holstein! Da ist unser Treck!« antwortet Joachim.
»Dann seht zu, daß ihr rechtzeitig hier rauskommt. Der Zug fährt in die Gegenrichtung. Nach Süden.«
Er wendet sich zum Gehen.
»Ihr Feuerstein, Mann!« ruft Golo ihm nach.
»Laß man, Junge!«
Doch Golo hat sich die Ehre der Schwarzhändler bereits zu eigen gemacht. »Geschäft ist Geschäft!« erklärt er, holt einen Feuerstein aus der Tüte und reicht ihn dem Mann. Dieser nimmt ihn und entfernt sich leise, um die schlafende Frau nicht zu wecken.
Um sechs Uhr in der Frühe setzte sich der leere Zug in Bewegung, ohne auf dem Bahnhof von Göttingen zu halten, Richtung Süden. Ein Bahnsignal entschied über das weitere Schicksal der Quints. Sie schliefen fest und merkten nichts.
Als Maximiliane feststellte, daß der Zug nach Süden und nicht nach Norden fuhr, sagte sie: »Dann fahren wir eben auf den Eyckel. Wir können überall hin.«
Das hatte sie schon einmal gesagt.
»Wann fahren wir denn endlich wieder nach Hause?« fragt Edda.
»Später!«
»Aber bei der Urma in Poenichen …«
»Von Poenichen wollen wir jetzt nicht sprechen!« befiehlt die Mutter.
In Friedland wird der Zug von Flüchtlingen gestürmt. Koffer und Bündel, Kartons und Kinder müssen verstaut werden. Jemand fordert Maximiliane auf, wenigstens eines ihrer Kinder auf den Schoß zu nehmen. Sie zieht Viktoria zwischen ihre Knie. »Du leiwer Gott«, sagt die Frau neben ihr, »Sie kriegen ja noch eins!« und nimmt das Kind auf ihren Schoß. »Preußisch Eylau!« sagt sie. Maximiliane antwortet mit »Poenichen bei Dramburg«. Keiner nennt seinen Namen, statt dessen den Ort, aus dem er kommt.
Der Zug fährt weiter. Die Kinder bekommen Hunger. Viktoria klagt, ihre Füße täten ihr weh; alle vier Kinder haben schmerzende Füße, weil die Schuhe nicht mehr passen. Maximiliane holt das Märchenbuch hervor. Wieder einmal liest sie von hungernden und frierenden Märchenkindern, vom Hans im Glück und vom Sterntaler-Mädchen, und als Golo, der eine Abneigung gegen Bücher hat, das Buch zuschlägt, erzählt sie von der Burg Eyckel, vom Verlies und vom Burgfried und vom tiefen, tiefen Brunnen, vom Nachtvogel Schuhuhu und von der alten Burgfrau Maximiliane, die weit über achtzig Jahre alt sein muß. Sie schließt aufatmend auch diese Geschichte mit: »Und wenn sie nicht gestorben ist, dann lebt sie heute noch.«
Eine Frau, die im Gang auf ihrem Koffer sitzt, sagt: »Sie hätten lieber Brot mitnehmen sollen! Von Geschichten werden die Kinder nicht satt!«
Maximiliane läßt das Buch sinken, hebt den Blick. »Das Brot hätten wir längst aufgegessen. Ein Buch reicht lange!«
»Sie werden sich noch umgucken!« sagt die Stimme.
»Ich gucke mich nicht mehr um.«
»Ist das eine böse Fee?« flüstert Joachim.
»Ja.«
Sie sind von verwunschenen Prinzen und bösen Feen umgeben, es wird ihnen Gutes und Böses geweissagt, und beides erfüllt sich.
Hundert Kilometer mit der Eisenbahn, zu jener Zeit eine Tagesreise. Irgendwo müssen sie aussteigen und mit ihrem Gepäck ein langes Stück zu Fuß gehen, weil eine Eisenbahnbrücke zerstört ist. Es heißt, sie führe über die Fulda oder Werra. Was die feindlichen Bomber und die feindliche Artillerie nicht zerstört hatten, ließen blindwütende Parteileiter sprengen. Sie haben die Brücken hinter sich zerstört, ein Volk, das ›nicht wert war zu überleben‹, das ›seinen Führer nicht wert‹ war, wie dieser testamentarisch die Nachwelt wissen ließ.
Im Sackbahnhof von Kassel enden alle Züge. Kein Dach mehr über den Bahnhofshallen, die rauchgeschwärzten Mauern in Trümmer, schwarzes Eisengestänge vorm Himmel. Die untergehende Sonne beleuchtet die Reste der Stadt, über die jetzt der Blick weit ins Land geht. Joachim, dessen Tapferkeit nur selten bis zum Abend ausreicht, greift nach dem Arm der Mutter. »Mama! Warum …?«
Was hat er überhaupt fragen wollen? Warum sie so lange unterwegs sind, wo doch alle Städte, durch die sie kommen, zerstört sind? Warum sie Poenichen verlassen haben, wo doch dort der Großvater und die Urma sind? Er faßt alle Fragen in einem einzigen verzweifelten ›Warum?‹ zusammen.
»Frag deinen Vater!« sagt seine Mutter und faßt in ihrer Antwort ihr eigenes Entsetzen und ihre Ratlosigkeit zusammen.
Vielleicht trägt dieser Satz schuld daran, daß Joachim sein Leben lang nach dem Vater fragen wird und sich mit der Schuld der Väter auseinandersetzen muß. Es nutzt nur wenig, daß die Mutter seinen Kopf an sich zieht und »Mosche« sagt, in der Geheimsprache, die sie nur mit ihrem Erstgeborenen führt.
Die fünf Quints werden zum nahe gelegenen Ständeplatz geschickt, wo ein Notaufnahmelager für Flüchtlinge eingerichtet worden war, Zelte für 1000 Personen, mit einer Betreuungsstelle für Mütter und Kleinkinder und einer Krankenstation, in der Rotkreuzschwestern und Helferinnen der Bahnhofsmission Dienst taten.
Die Männer hatten pünktlich bei Kriegsende mit ihrem Krieg aufgehört, die Frauen nicht. In den Jahren des Krieges hatten sie die Straßenbahnen durch die verdunkelten Städte gefahren, hatten nach den Luftangriffen die Brände gelöscht, hatten in Munitionsfabriken gearbeitet. Man hatte die ›tapferen kleinen Soldatenfrauen gelobt und besungen, und jetzt klopften sie den Mörtel von den Steinen der Kriegstrümmer ab. Trümmerfrauen, für Notzeiten besonders geeignet. Sie streikten nicht im Krieg und streiken nicht im Frieden, diese großen Dulderinnen von alters her, zu denen auch Maximiliane gehörte.
Wieder gibt es für jeden einen Becher Kakao, dazu ein Stück Brot, weiß und weich wie Watte, eine Spende der amerikanischen Besatzungsmacht. Golo drückt es zusammen und fragt: »Was soll das denn sein?«
»Das ist etwas sehr Gutes«, erklärt Maximiliane, »das kommt aus Amerika!«
»Aber ich habe Hunger auf Wurst.« Im Gegensatz zu den anderen, die nur einfach Hunger haben, hat er immer Hunger auf etwas Bestimmtes. Jetzt also hat er Hunger auf Wurst.
»Ich probier’s mal!« sagt er und geht mit der Tüte Feuersteine davon, zurück in das Bahnhofsgelände.
Den Quints werden zwei Luftschutzbetten zugewiesen. Eine alte Frau muß der schwangeren Maximiliane Platz machen. Die Frau hockt sich ans Fußende des Bettes und zieht die kleine Viktoria auf den Schoß. »So kleine Krabuttkes!« sagt sie, wiegt das Kind und wickelt einen Strang seiner dünnen Haare um den Finger. »Wie die Haare, so der ganze Mensch«, sagt sie und greift in Maximilianes kräftiges Haar. »Sprunghaare«, stellt sie fest. »Sie halten schon mal was aus. Sie wickelt so leicht keiner um den Finger.« – »Nein!« antwortet Maximiliane.
»Flippau!« Die alte Frau stellt sich vor. »Zwölf Kilometer hinter Pasewalk.«
»Poenichen«, sagt Maximiliane, »Kreis Dramburg.«
»Meine Kinder sind geblieben. Die wollten nich weg. Aber mein Mann hat ’nen Bruder in Stuttgart. Da wolln wir hin. Haben Sie auch jemanden im Westen?«
»Ich hoffe es!«
»Wenn sie nicht gestorben sind!« fügt Edda hinzu.
Die Frau setzt zu einem neuen Gespräch an. »Die Kinder! Die machen schon zu viel mit. Sie müssen ihnen Kartoffelwasser zum Trinken geben. Von rohen Kartoffeln. In Kartoffeln is alles drin, was ein Mensch braucht. Kartoffeln hat’s für uns immer gegeben, Milch nich, die mußten wir an die Herrschaft abliefern. Sie haben wohl zu den Herrschaften gehört?«
»Ja«, antwortet Maximiliane.
»Dafür können Sie nichts«, fährt die Frau fort. »Wir hatten zwei Kühe und die Ziegen. Vier Stück. Und jedes Jahr haben wir zwei Schweine fettgemacht. Dreieinhalb Zentner schwer!«
Nach einer halben Stunde kehrt Golo zurück und hält triumphierend zwei Dosen hoch. »Fleisch«, ruft er, »lauter Fleisch! Für zehn Feuersteine!«
Maximiliane öffnet mit dem angeschweißten Schlüssel eine der Dosen, reicht sie den Kindern, öffnet die andere und reicht sie der Frau aus Flippau.
»Sie haben uns Ihr Bett abgetreten!«
Edda begehrt auf. »Und was sollen wir morgen essen?«
»Heute werden wir satt, und morgen sehen wir weiter.«
Selbst der Pfarrer in Hermannswerder, dem für einige Jahre die geistliche Erziehung Maximilianes oblag, hätte vermutlich soviel Sorglosigkeit gegenüber dem kommenden Tag für leichtfertig gehalten. Als die Dosen geleert sind, säubert Edda sie unter einem Wasserhahn und verwahrt sie in ihrem Gepäck. Dann legen sie sich schlafen. Maximiliane deckt Joachim und Viktoria mit der Filzdecke des Soldaten vom Balchasch-See zu. »Gott behütet uns!« sagt sie statt eines langen Gebetes.
»Wenn man nur schlafen könnte«, sagt die Frau aus Flippau. »Wenn nur nich immer die Gedanken wären.«
Maximiliane kann schlafen.
In der Frühe rüttelte die Frau sie an der Schulter.
»Sie setzen einen Zug ein nach Süden!«
Als die Quints aus dem Zelt heraustraten, war es noch dunkel. Sie hasteten mit den anderen zum Bahnhof. Die Halle war bereits von wartenden Menschen überfüllt, die alle mit dem angekündigten Zug fahren wollten. Die Kinder drängten sich schlaftrunken und frierend an die Mutter, die an einem Mauerrest der Halle Schutz vor den Nachdrängenden suchte. Noch war der Zug nicht eingefahren, die Sperren wurden von amerikanischen Militärpolizisten bewacht, deren weiße Helme durch die aufziehende Morgendämmerung leuchteten.
Ein Mann stieß Maximiliane an und zeigte auflachend auf die Mauer hinter ihr. Sie wandte sich um und schaute in die Augen des Führers. Für Bruchteile von Sekunden spürte sie wieder diesen Blick, der sie ein einziges Mal aus unmittelbarer Nähe getroffen hatte, kurz bevor ihr Mann sein letztes Kind zeugte: Viktoria. Sie betrachtete eingehend dieses letzte, halb abgerissene Durchhalteplakat. Hitler, den Blick fordernd auf den Beschauer gerichtet. ›Unablässig wacht der Führer und arbeitet nur für dich. Und was tust du?‹ Jemand hatte mit Kreide die Antwort daruntergeschrieben: ›Zittern‹.
»Jetzt zittern wir immer noch«, sagte der Mann.
Maximiliane wandte sich ihm zu und entgegnete: »Aber nicht mehr vor Furcht, sondern vor Kälte.«
»Egal, wovor man zittert.«
Dann war der Mann wieder in der Menge verschwunden.
Als der Zug einläuft, stürmen die Wartenden vor, drängen und schieben; einige stürzen schreiend zu Boden. Einer der Soldaten, ein Neger, springt auf den Sockel der zerstörten Bahnsteigsperre und schreit: »Zurrück!« Keiner achtet darauf. Der Soldat reißt seine Maschinenpistole hoch. Einige werfen sich zu Boden, andere rennen weiter. Der Soldat schießt über die Köpfe hinweg und schreit wieder: »Zurrück!« Sein Versuch, Ordnung in das Chaos zu bringen, scheitert, da die Leute annehmen, er wolle ihnen den Zugang zum Zug verwehren. Golo läßt die Hand der Mutter los, springt über die Liegenden, macht unter dem Podest des Soldaten halt und ruft begeistert: »Ein Mohr! Ein kohlpechrabenschwarzer Mohr!«
Der Arm, der die Maschinenpistole hält, senkt sich, die Mündung richtet sich auf das Kind. Nie war Golo in größerer Lebensgefahr, aber sein Sinn für Gefahren ist unterentwickelt. Er lacht. Bis der farbige Soldat ebenfalls lacht, die Maschinenpistole wieder hebt und »Zurrück!« schreit.
Maximiliane rührt sich vor Entsetzen nicht vom Fleck. Joachim weint laut auf. »Sie schießen wieder!« Sie beobachten, wie Golo über einen Koffer springt, stürzt und liegen bleibt.
Wieder steht einer seiner Füße schräg, derselbe, den er unmittelbar nach Viktorias Geburt gebrochen hatte.
Und wieder fuhr ein Zug ohne die fünf Quints ab. Eine neue Mutter Courage – hat das wirklich einmal jemand von Maximiliane gesagt? In diesem Augenblick ist sie eine werdende Mutter ohne Courage.
Bisher waren die Quints Flüchtlinge unter Tausenden von Flüchtlingen, zurückreisenden Evakuierten und Displaced Persons gewesen, die Hinterlassenschaft des Krieges, ein Ameisenvolk, das durcheinandergeraten war und hin und her irrte. Jetzt aber lenkte Golos Unfall die Aufmerksamkeit auf das weinende Kind, auf seine kleinen Geschwister und auf die schwangere Mutter. Was für ein armer kleiner Junge, der da so herzerweichend schluchzte! Was für ein hübsches Kind! Braunlockig, mit Grübchen und schwarzbewimperten Kulleraugen!
Von einem amerikanischen Soldaten erhält er den ersten Kaugummi. Er schiebt ihn in den Mund und kaut lernbegierig.
Mit einem Krankenwagen werden alle fünf Quints in ein ehemaliges Lazarett gebracht, in dem man eine Unfallstation eingerichtet hat. Der Krankenpfleger, der den Unfall aufnimmt, fragt nach Name und Anschrift.
»Ich bin eine von Quindt und befinde mich auf dem Weg zu unserem Stammsitz im Fränkischen«, sagt Maximiliane im Tonfall, mit dem sie den Kindern Märchen erzählt, und erhofft sich, durch die Angabe von Herkunft und Ziel Aufmerksamkeit zu erwecken.
Der Krankenpfleger blickt nicht einmal hoch, sagt: »Na und? Jedenfalls können Sie bei uns Ihr Kind nicht bekommen. Wir müssen uns um Unfälle kümmern. Wir sind hier ein Lazarett!«
Golos Fußgelenk wird geröntgt und gerenkt. Dabei wird die alte Bruchstelle entdeckt und die Mutter auf diesen Befund angesprochen. Sie schließt einen Augenblick lang die Lider, sieht Golo, der von Poenichen nicht weggehen wollte, hoch über sich in der Blutbuche hängen, sich fest an einen Ast klammernd.
Sie legt die Arme um den Aktenschrank, drückt das Gesicht dagegen wie damals an den Baumstamm.
»Ist Ihnen nicht gut?« fragt man, schiebt ihr einen Stuhl hin.
Da man nicht weiß, wo man die Angehörigen des verunglückten Jungen für die Dauer der Behandlung unterbringen soll, dürfen die Mutter und die Geschwister im Lazarett bleiben. Nachts schlafen sie in Betten, die gerade leerstehen. Wenn es regnet, halten sie sich in den Gängen des Lazaretts auf, wo Golo, dem man inzwischen einen Gehgips angelegt hat, mit den verwundeten ehemaligen Soldaten Schwarzmarktgeschäfte betreibt. Bei schönem Wetter geht Maximiliane mit den Kindern in die Karlsaue, ein verwüstetes Gelände, wo in den Bombenkratern Wasser steht. Holzstücke, die man wie Schiffe schwimmen lassen kann, finden sich. Zum erstenmal spielen die Kinder wieder. Zweimal am Tag bekommen sie alle einen Teller Suppe.
Golos Beinbruch gehörte zu den Glücksfällen.
Bei der abschließenden Visite betrachtet der diensttuende Arzt Golos verkrümmte Zehen und sagt zu der Mutter: »Das Kind trägt offensichtlich zu kleine Schuhe!«
»Alle meine Kinder tragen zu kleine Schuhe. Wir sind seit Februar unterwegs. Kinderfüße wachsen auch auf der Flucht.«
Der Arzt blickt Maximiliane an, schaut dann auf der Karteikarte nach dem Namen.
»Ich habe in Königsberg einen von Quindt kennengelernt«, sagt er. »Wenn ich nicht irre, einen Baron Quindt. Wir saßen im Schloßkeller, im ›Blutgericht‹. Er verschaffte uns einen ausgezeichneten weißen Chablis, dazu Muscheln in Weinsoße. Das war damals immerhin schon im dritten Kriegsjahr.«
»Onkel Max!« sagt Maximiliane. »Der Vetter meines Großvaters!«
Ihre Augen füllen sich mit Tränen.
»Ein geistreicher Herr, aber etwas resistent«, fährt der Arzt fort. »Er tat ein paar Äußerungen, die ihm hätten gefährlich werden können. Aber man wollte dem alten Mann ja nicht schaden.«
Der letzte Satz war gedehnt gesprochen und daher aufschlußreich.
»Übrigens: Sautter, Oberstabsarzt!«
Maximiliane stellt fest, daß an seinem Hals über dem weißen Kittel noch der Kragen der Wehrmachtsuniform sichtbar ist, sogar mit dem silbergestickten Spiegel.
»Sie stammen ebenfalls aus Königsberg?« fragt er.
»Nein«, antwortet Maximiliane. »Aus Pommern. Kreis Dramburg. Rittergut Poenichen.«
»Ihr Mann ist demnach Landwirt?«
»Nein«, sagt Maximiliane und blickt den Arzt bedeutungsvoll an, was dieser für vertrauensvoll hält. »Mein Mann war in der Parteiführung tätig, Reichssippenamt, unmittelbar dem Reichsführer SS unterstellt.«
»Sehr tapfer, das so offen einzugestehen! Wo war er zuletzt im Einsatz?«
»Er hatte an der Invasionsfront den rechten Arm verloren, aber er schrieb mir damals, daß er seinem Führer auch mit dem linken Arm dienen könne. Ordonnanzoffizier im Führerhauptquartier! Wilhelmstraße!«
»Es gab großartige Männer darunter«, sagt Dr. Sautter. »Und gibt es noch immer.«
Maximiliane lächelt ihm zu. »Auch Frauen!«
»Famose Frauen! Ohne sie wäre es gar nicht gegangen. Man muß jetzt zusammenhalten. Jenes ›Geselle dich zur kleinsten Schar‹ gilt wieder. Getreue gibt es noch genug, es gilt nur, sie aufzuspüren. Einer muß jetzt für den anderen einstehen.«
»Mit Kinderschuhen!« sagt Maximiliane.
»Richtig!« sagt der Arzt, blickt auf Golos Fuß, den er noch immer auf dem Schoß hält. »Davon gingen wir aus. Frauen haben diesen bewundernswert praktischen Sinn für das Nächstliegende. Gerade die Frauen aus dem Osten zeigen Haltung. Fest zur Rückkehr entschlossen. Ich schreibe Ihnen eine Adresse auf.« Er greift zum Rezeptblock, bringt ein kleines Lachen zustande.
»Schuhe für die Rückkehr! Ein unbedingt zuverlässiger Mann. Gudbrod, Marställer Platz, ehemaliger Platz der SA. Er hat ausreichend Schuhe auf Lager, offiziell ist er ausgebombt. Nicht bei Dunkelheit, das könnte auffallen. Im übrigen brauchen wir das Licht nicht zu scheuen! Über Geldmittel verfügen Sie?«
Maximiliane nickt.
»Was haben Sie für ein vorläufiges Ziel?«
»Den Stammsitz meiner Familie im Fränkischen. Seit sechshundert Jahren im Besitz der Quindts.«
Bisher hatten sich Maximilianes Kinder ruhig verhalten, aber jetzt sagt Edda: »Wenn sie nicht gestorben sind.«
Die Aufmerksamkeit des Arztes wird auf die Kinder gelenkt.
»Kinder dürfen in diesen Zeiten nicht verwildern. Sie brauchen eine starke Hand. Nachwuchs. Es gibt gute Leute unter dem Adel. Leider nicht alle, sonst wäre der 20. Juli nicht möglich gewesen.«
Maximiliane spielt ihren letzten Trumpf aus. »Mein Mann schrieb mir damals, übrigens aus dem Lazarett: ›Wenn auch nur ein Quindt unter den Verrätern ist, gilt die erste Kugel ihm und die zweite mir.‹«
Die neuen Schuhe erhielt dann Joachim. Golo bekam die abgelegten seines Bruders, der jüngere jeweils die des nächstälteren. Viktorias Schuhe blieben übrig. Edda packte sie ein.»Die brauchen wir für den Mirko.« Immer noch hieß das ungeborene Kind ›Mirko‹, wie jener polnische Junge aus den Geschichten der Mutter, der während der Flucht die Quints durch Hinter- und Vorderpommern und durch die Mark Brandenburg begleitet hatte.
Dieser Dr. Sautter, ehemaliger Oberstabsarzt, hat den Kindern nicht nur passende Schuhe verschafft, sondern der Mutter auch eine entscheidende Lebenserkenntnis. Von nun an wird sie sich, je nach Erfordernis, als die Frau eines Nationalsozialisten oder als die Tochter eines jüdischen Stiefvaters ausgeben, als Adlige oder als bürgerlich Verheiratete. ›Eine Gesinnung muß man sich leisten können‹, hatte ihr Großvater früher oft gesagt, eine seiner Quindt-Essenzen, von seiner Enkelin in die Tat umgesetzt.
Bevor es weiterging, holte Edda eine jener leeren Fleischdosen hervor, die Golo am Bahnhof gegen zehn Feuersteine eingehandelt hatte. Sie betrachtete das Etikett und fragte ihre Mutter: »Was steht denn da eigentlich drauf?«
Maximiliane nahm die Dose in die Hand und las vor: »›Only for army dogs‹. Nur für Hunde, für amerikanische Hunde.«
3
›Eine Kalorie ist die Wärmemenge, die nötig ist, um ein Gramm Wasser um ein Grad zu erwärmen.‹
Handlexikon
Dem Strom der Flüchtlinge, der sich seit dem Frühjahr über das restliche Deutschland ergoß, folgte seit Ende des Sommers der Strom der Vertriebenen. Er benutzte dasselbe Strombett und dieselben Schleusen.
Ein halbes Jahr zuvor hatte Stalin erklärt, die alten polnischen Gebiete Ostpreußen, Pommern und Schlesien müßten an Polen zurückgegeben werden. Dieser Satz machte sechshundert Jahre deutscher Geschichte null und nichtig; ein Lehrsatz für den Geschichtsunterricht, schwer zu begreifen, schwer zu lernen, aber von vielen doch bereitwillig hingenommen, um des lieben Friedens willen. Es hätte ein Sprengsatz werden können, aber er hat nicht einmal in späteren Wahlreden gezündet. Preußische Tugenden, Fügsamkeit, Vernunft, Duldensfähigkeit und Lebenswille, vereinten sich mit östlicher Wesensart. Flüchtlinge und Vertriebene suchten sich anzupassen und ihre Eigenart zu leugnen.
Etwa zur gleichen Zeit hatte der englische Ministerpräsident Churchill geäußert, daß die Vertreibung die befriedigendste und dauerhafteste Methode sei, da es auf diese Weise keine Vermischung fremder Bevölkerungen gebe, aus denen doch nur endlose Unruhen entstünden. Er sehe auch nicht, sagte er, weshalb es für die Bevölkerung Ostpreußens und der anderen abgetretenen Gebiete in Deutschland keinen Platz geben sollte, schließlich seien im Krieg sechs oder sieben Millionen Deutsche getötet worden. Eine nüchterne Berechnung, die aber stimmte. Die Deutschen aus dem Osten haben die Kriegsausfälle im Westen ersetzt, die polnischen Umsiedler aus dem zur Sowjetunion geschlagenen östlichen Teil Polens haben die abgezogenen Ostdeutschen ersetzt, Russen sind in die östlichen Teile Polens eingezogen. Die Austauschbarkeit des Menschen schien wieder einmal bewiesen. Sollte der alte Quindt recht gehabt haben, als er in der Taufrede zu Ehren seiner Enkelin Maximiliane gesagt hatte: ›Hauptsache ist das Pommersche, und das hat sich noch immer als das Stärkere erwiesen. Am Ende sind aus Goten, Slawen, Wenden und Schweden, die alle einmal hier gesessen haben, gute Pommern geworden.‹ Noch fehlt für diese Behauptung der Beweis.
›Flüchtlingsstrom‹, das klang nach Naturkatastrophe, und als solche haben ihn die Bewohner des restlichen Deutschlands empfunden und sich entsprechend dagegen zu schützen versucht. Man errichtete Dämme, um sich gegen diesen Strom zu wehren, schleuste ihn in abgelegene, wenig besiedelte Gegenden, in holsteinische Dörfer und in bayrische Kleinstädte, die von dem Strom überschwemmt wurden.
Das Bild vom Strom und von der Überschwemmung war besser gewählt, als die Urheber damals ahnten. Menschen-Dung. Wie fruchtbar dieser war, würde sich in den Jahren des Wiederaufbaus erweisen.
Aber noch fing man den Strom der Flüchtlinge in leerstehenden Baracken des ehemaligen Reichsarbeitsdienstes, in Luftschutzbunkern und stillgelegten Schulen auf, vor denen Maximiliane jedesmal entschlossen kehrtmachte, da man rasch hinein und schwer herauskam.
Wieder einmal hieß es: »Wie wollen Sie denn weiterkommen in Ihrem Zustand, liebe Frau? Mit den vielen Kindern?«
»Vier!« verbesserte Edda, die es genau nahm mit allem, die immer zählte und abzählte und nachzählte.
Der Beamte, der die Personalien der Quints für einen Registrierschein der amerikanisch besetzten Zone aufgenommen hat, greift nach Maximilianes Daumen, drückt ihn zuerst auf ein Stempelkissen, dann in die linke untere Ecke des Registrierscheins. »Als ob wir alle Verbrecher wären! Fingerabdrücke! Vielleicht will man uns nicht fotografieren, damit später keiner weiß, wie wir ausgesehen haben.«
Er hebt den Blick und sieht Maximiliane an. Was er sieht, veranlaßt ihn zu der Frage: »Glauben Sie denn an Wunder, liebe Frau?«
Maximiliane erwidert den Blick und sagt: »Ja.«
Ihr Glaube hat ihr geholfen. Der Beamte Karl Schmidt wird zum Vollzugsbeamten eines Wunders. Er verschafft Maximiliane und ihren Kindern eine Mitfahrgelegenheit nach Nürnberg, diesmal in einem geschlossenen Lastwagen, der nicht Schweine transportiert, sondern Zuckerrüben. Für die Dauer der Fahrt ernähren sie sich davon. Für Viktorias kleine Zähne erweisen sie sich allerdings als zu hart. Wieder füttert Maximiliane ihr Sorgenkind nach Vogelart von Mund zu Mund. Edda spuckt die durchgekauten Rübenschnitzel aus und sagt: »Schweinefutter!«
»Unsere Gefangenen haben auch Rüben gegessen, wenn sie Hunger hatten«, sagt Joachim und würgt den Brei hinunter.
»Aber das waren Russen!« sagt Edda, wie sie es in Poenichen von der Mamsell gehört hat. »Halbe Tiere.«
»Das sind auch Menschen!« belehrt die Mutter sie. »Jetzt geht es uns so schlecht, wie es den russischen Gefangenen damals ging.«
Im Alleinunterricht versucht sie, ein Geschichtsbild zu korrigieren.
Der Lastwagen fährt über Landstraßen und nicht mehr auf Chausseen. Die Berge der Rhön, das Tal des Mains. Maximiliane achtet mehr auf den Nutzwert der Natur als auf ihre Schönheit. Unter den Laubbäumen sind die Buchen die wichtigsten, weil sie Bucheckern liefern: Öl. Nadelwälder bedeuten Reisig sowie Kienäpfel zum Heizen und Kochen. Umgepflügte Äcker verheißen Korn- und Kartoffelfelder, auf denen nun Menschen die Nachlese halten, nicht mehr Gänse und Wildschweine. Hamsterer sind auf den Straßen unterwegs mit leeren und gefüllten Taschen, mit Handwagen voll Holz.
Die Quints kommen zu spät, längst sind die Felder zum zweitenmal abgeerntet, die Kienäpfel aufgelesen. Es ist Anfang Dezember.
Sie fahren durch das Land, von dem Jean Paul behauptet, die Wege verliefen von einem Paradies ins andere. Aber jeder Mensch trägt sein eigenes Paradies mit sich. Maximiliane ist aus ihrem Paradies vertrieben, und Jean Pauls Paradies ist von Menschen überfüllt.
Pommersche Schweiz, Fränkische Schweiz: was für ein Unterschied! Kleine, nach römischem Erbrecht immer wieder geteilte Felder. Jemandem, der aus dem Osten kam, eher wie Gärten erscheinend, die Berge unvermittelt aufsteigend und den Blick verstellend, die Täler eng und felsig. Maximiliane fühlt sich von den schmalbrüstigen, mehrgeschossigen Häusern der kleinen, meist unzerstörten Städte bedrängt. Sie greift sich an den Hals, knöpft die Jacke auf, um sich Luft zu schaffen.
Die letzten zweihundert Meter des Fluchtwegs werden ihr so schwer wie die ersten, als der Treck durch die kahle Lindenallee zog, an deren Ende das Herrenhaus lag. Im Osten war der Himmel gerötet vom Feuerschein der anrückenden Front. Dreht euch nicht um!
Wieder eine dünne Schneedecke überm Land.
Und jetzt stand sie am Fuße des Burgbergs, den Eyckel vor Augen. Mit siebzehn Jahren war sie zum Sippentag hier gewesen, eine pommersche Eichel am Stammbaum der Quindts. Nicht einmal ein Jahrzehnt war seither vergangen, und sie warteten zu fünft vor dem Tor.
›Man sieht der Burg nun doch an, daß die Wogen einer großen Zeit daran geschlagen haben.‹ So ähnlich hatte es die Eigentümerin Maximiliane Hedwig an ihren Bruder in Poenichen geschrieben, und dieser war der Ansicht gewesen, daß der Eyckel schon viel ausgehalten hätte. Drei Jahre lang hatten die Gebäude als Jugendherberge gedient und ›der deutschen Jugend eine Vorstellung von deutscher ritterlicher Vergangenheit vermittelt‹, wie es Viktor Quint, das tausendjährige Reich fest im Blick, geweissagt hatte. In jenem Sommer 1936, als sich die Quindts mit und ohne ›d‹, mit und ohne Adelsprädikat zu jenem Sippentag auf dem Eyckel trafen. Die Fahnen des Dritten Reiches wehten, unter denen man, stehend und mit erhobenem Arm, einstimmig, wenn auch nicht immer eines Geistes, ›Die Reihen fest geschlossen sang. Die Reihen der Quindts hatten sich seither gelichtet.
Der große Saal und das Jagdzimmer, die zu Schlafsälen ausgebaut worden waren, hatten inzwischen als Auffanglager für ausgebombte und evakuierte Einwohner Nürnbergs gedient und waren mit Hilfe von Decken in Wohneinheiten aufgeteilt worden, keine größer als neun Quadratmeter. Nach und nach waren die Nürnberger in ihre Stadt zurückgekehrt und hatten den in Schüben eintreffenden Quindts aus Ostpreußen, aus der Lausitz, Mecklenburg und Schlesien Platz gemacht. Noch einmal war der Eyckel zur Fliehburg geworden. Aus dem festlichen Sippentag werden böse Sippenwochen und Monate werden, für die Alten unter ihnen sogar Jahre.
Derselbe Name, das gleiche Schicksal – wie mußte man sich einander verbunden fühlen! Aber schon wieder gab es Unterschiede. Wenn Menschen noch so eng zusammengehören, es gibt innerhalb ihres gemeinsamen Horizontes doch noch alle vier Himmelsrichtungen, sagt Nietzsche. Für die einen hatte das Kriegsende den Zusammenbruch des Großdeutschen Reiches bedeutet, für die anderen den Tag der Befreiung von der Diktatur. Schmach und Segen, für manche unter ihnen beides zugleich.
Der nationalsozialistische Geist der alten Maximiliane Hedwig von Quindt hatte sich rechtzeitig verdunkelt und hatte sie das Ende jener Neuen Zeit, an die sie geglaubt hatte, nicht mehr wahrnehmen lassen. Sie war verstummt und versteinert, vergreist und unzurechnungsfähig. Manchmal tauchte sie, einem Schloßgespenst beängstigend ähnlich, auf der Treppe auf, die in den Hof führte, eine Decke um die Schultern geworfen. Wer ihr begegnete, wich ihr aus.
Aus den Fenstern, deren Scheiben vielfach durch Bretter oder Pappe ersetzt worden waren, ragten schwarze Ofenrohre. Der Garten war in Gemüsebeete parzelliert; die letzten Kohlköpfe standen unter Bewachung ihrer Eigentümer. Die Lebensmittelrationen lagen niedriger, als es dem von alliierter Seite festgesetzten Mindestmaß von 1150 Kalorien entsprach. Für den Hausbrand wurden in diesem Winter keine Kohlen bewilligt. Kein Strauch wuchs mehr an der Burgmauer, die Bäume waren bis zu Mannshöhe entästet. Alles Brennbare war verheizt worden.
›Arbeit adelt‹ lautete eine der großen Parolen des Dritten Reiches. Auf dem Eyckel hätte es jetzt heißen können ›Adel arbeitet‹, aber diese ersten Nachkriegsjahre waren arm an Parolen. Wer den Krieg überlebt hatte, wollte nicht im Frieden verhungern oder erfrieren. Der Hunger drängte die einen zur Nahrungssuche und die anderen zum Nachdenken; zu den letzteren gehörte Roswitha von Quindt. Maximiliane war damals auf dem Sippentag freudig umarmt und geküßt worden, von alten und von jungen Quindts. Jetzt, wo sie unförmig, mit vier kleinen Kindern und den armseligen Bündeln im Hof stand, mischte sich unter die Wiedersehensfreude die Befürchtung, daß man noch enger zusammenrücken müsse und daß der eigene Lebensraum noch mehr beschnitten würde. Eine geborene Baronesse Quindt, eine angeheiratete Quint, ihr Anspruch war doppelt gesichert, niemand machte ihn ihr streitig.
»Wartet!« sagte Roswitha von Quindt, die im Februar 45 als ostpreußischer Flüchtling für eine Woche auf Poenichen geweilt hatte. »Ich sage meiner Mutter Bescheid.«
Elisabeth von Quindt, genannt ›die Generalin‹, hatte auf dem Eyckel das Zepter in die Hand genommen, aus keiner anderen Berechtigung heraus als der, daß sie mit ihren Töchtern als erster Flüchtling, und zwar bereits im April, eingetroffen war. Eine Ostpreußin von Haltung und Gesinnung, ihr Mann, Generalleutnant, befand sich, wie sie aus sicherer Quelle wußte, in russischer Gefangenschaft. Sie strahlte Zuversicht aus. Der alte Quindt hätte allerdings wohl gesagt, die eine Hälfte sei Zuversicht und die andere Anmaßung. Sobald sie den Mund auftat, tauchte hinter ihr der ganze Deutschritterorden auf mit Schild und Schwert. Sie forderte von den Bewohnern des Eyckel auch in der jetzigen Lage, Hunger und Kälte durch Haltung zu bekämpfen. Von ihrem Besitz hatte sie so gut wie nichts retten können, aber von ihren Überzeugungen hatte sie auf der Flucht nichts verloren. Sie wußte auch im Dezember 45, was ein junger Mensch sowohl im Hinblick auf die Vergangenheit als auch im Hinblick auf die Zukunft zu tun hatte. Jetzt schritt sie die breite Treppe hinunter und ging auf Maximiliane zu, die an einer Mauer lehnte, die Kette der Kinder an der Hand. Wieder war ein Ziel erreicht. Unterkunft. Niederkunft. Die Bilder verschwammen vor ihren Augen. Warum erinnerte alles an Ingo Brandes aus Bamberg, einen Oberprimaner, der ihr beim Festgottesdienst ›Quindt und Quint vereint zusammen‹ ins Ohr sang, der ihr Kornblumen pflückte, der unter ihrem Fenster wie der Rauhfußkauz rief, als ›Mondlicht das Tal der Pegnitz überflutete‹. Wieder schwankt sie unter dem Anprall der Bilder und stützt sich auf die Schulter ihres Ältesten, der sich stark macht.
Auf die erste Frage der Generalin, die ihrem Mann galt, hätte sie beinahe, indem sie ihn mit Ingo Brandes verwechselte, geantwortet, er sei mit dem Flugzeug abgestürzt, wo er doch bei der Infanterie gewesen war. Den einen hatte sie geheiratet, den anderen geliebt, einen Jagdflieger, beim Feindflug abgestürzt. Ihr Körper rettet sich in eine Narkose der Erinnerungen.
Mit Umsicht und Zuversicht trifft die Generalin ihre Anordnungen. Die Kinder werden zunächst einmal in die Küche geschickt; eine Kammer unterm Dach wird als Wochenstube eingerichtet: Bettstelle, Tücher, Wasserschüsseln und Lampe.