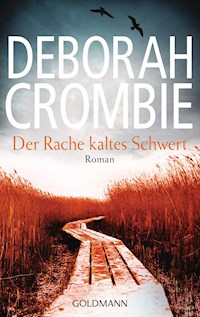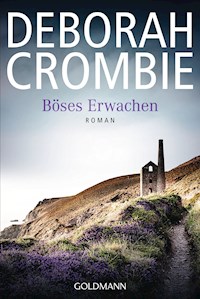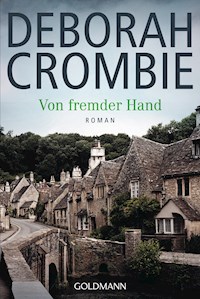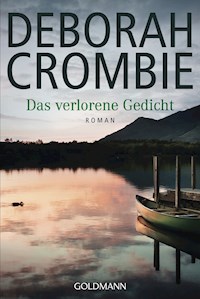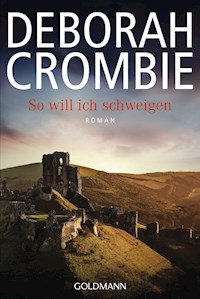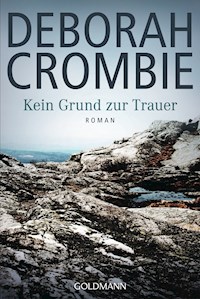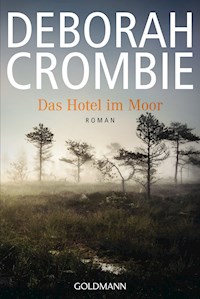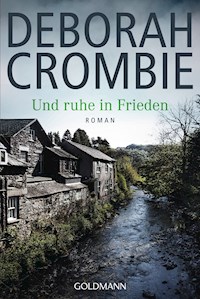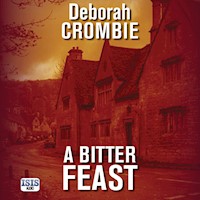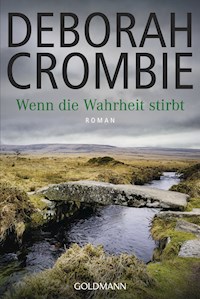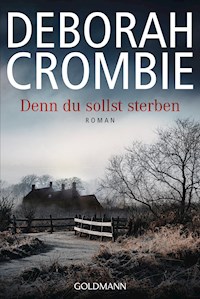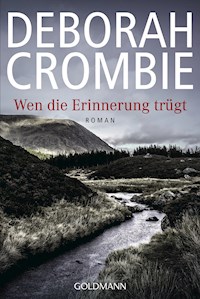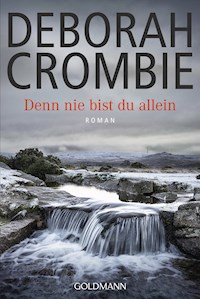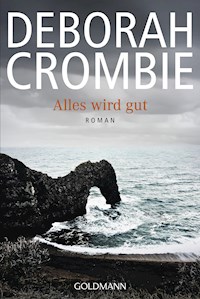
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Kincaid-James-Romane
- Sprache: Deutsch
Als die schwerkranke Jasmine Dent stirbt, wundert sich niemand über ihren Tod – bis auf ihren Nachbarn, Superintendent Duncan Kincaid. Er ordnet eine Obduktion an, die eine Überdosis Morphium als Todesursache ergibt. Selbstmord, Sterbehilfe oder gar Mord? Zusammen mit seiner Assistentin Sergeant Gemma James nimmt Kincaid die Ermittlungen auf und stößt schnell auf eine ganze Reihe von Verdächtigen ...
Der zweite Roman um Superintendent Duncan Kincaid und Inspector Gemma James.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 407
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Buch
Jasmine Dent wird ihren fünfzigsten Geburtstag wohl nicht mehr erleben. Sie hat Lungenkrebs und wartet in ihrer Londoner Wohnung auf den Tod. Als sie stirbt, scheint alles auf ein natürliches Ende hinzudeuten. Doch Superintendent Duncan Kincaid, Nachbar und Freund der Toten, ist nicht davon überzeugt. Er ordnet eine Obduktion an, die eine Überdosis Morphium als Todesursache ergibt. Selbstmord, Sterbehilfe oder gar Mord? Zusammen mit seiner temperamentvollen Assistentin Gemma James nimmt Kincaid die Ermittlungen auf, und schnell zeigt sich, dass der Kreis der Tatverdächtigen gar nicht so klein ist. Da ist Jasmines Bruder Theo, ein willensschwacher Versager und Nutznießer ihrer. Oder Meg, Jasmines beste Freundin, mit der sie häufig über Selbstmord gesprochen hat. Vor allem aber Megs Freund Roger, ein bildhübscher Nichtstuer, der genau wusste, dass die todkranke Meg praktisch ihr gesamtes Vermögen hinterlassen wollte. Und sogar Jasmines Nachbar, der alte Major, und die untadelige Krankenpflegerin Felicity scheinen etwas zu verbergen. Mit jeder neuen Information verdichtet sich das Rätsel um die Verstorbene, und schließlich führen dunkle Spuren aus der Vergangenheit zu einem grausamen Verbrechen der Gegenwart ...
Autorin
Deborah Crombies höchst erfolgreiche Romane um Superintendent Duncan Kincaid und Inspector Gemma James wurden für den »Agatha Award«, den »Macavity Award« und den »Edgar Award« nominiert. Die Autorin lebt mit ihrer Familie im Norden von Texas. Weitere Informationen zur Autorin unter: www.deborahcrombie.com.
Deborah Crombie
Alles wird gut
Roman
Aus dem Englischenvon Mechtild Sandberg-Ciletti
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »All Shall Be Well« bei Charles Scribner’s Sons, New York.
Copyright © der Originalausgabe 1994 by Deborah Darden Crombie
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 1995 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Published by Arrangement with Deborah Crombie
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30827 Garbsen.
Covergestaltung: UNO Werbeagentur GmbH
ISBN 978-3-641-10747-5V004
www.goldmann-verlag.de
Fürwahr es ist die Sünde Quell all dieses Schmerzes.
Aber alles wird gut werden und alles wird gut werden und alle Dinge jeglicher Art werden gut werden.
Juliana von Norwich, 15. Jahrhundert
Danksagung
Wie immer gilt mein besonderer Dank den Every-Other-Tuesday-Night-Writers: Diane Sullivan, Dale Denton, Jim Evans, Viqui Litman, John Hardie und Aaron Goldblatt. Ein besonderes Dankeschön an Terry Mayeux, die für die sehr nötige Ermutigung bei den letzten Kapiteln dieses Buches sorgte.
Danken möchte ich auch meiner Lektorin, Susanne Kirk, und meiner Agentin, Nancy Yost, sowohl für ihre Freundschaft als auch für ihre professionelle Hilfe. Und zu guter Letzt meinen Eltern, Mary und Charlie Darden, für ihre unerschütterliche Unterstützung.
1
Jasmine Dent ließ sich in die Kissen zurücksinken und schloß die Augen. Morphium umhüllt das Bewußtsein wie der Flaum einen Pfirsich, dachte sie schläfrig und lächelte ein wenig über ihre Metapher. Eine Weile schwebte sie zwischen Wachen und Schlafen, nahm die gedämpften Geräusche wahr, die durch das offene Fenster hereindrangen, und das Sonnenlicht, das auf dem Fußende ihres Betts lag, war jedoch unfähig, sich aus der Benommenheit zu befreien.
Ihre frühesten Erinnerungen hatten mit Hitze und Staub zu tun, und der ungewöhnlich warme Aprilnachmittag beschwor Gerüche und Geräusche herauf, die ihr durch das Gedächtnis spukten wie die Geister lang vergessener Verstorbener. Jasmine fragte sich, ob die Erinnerung an die langen, sich träge dahinschleppenden Stunden ihrer Kindheit irgendwo in den Zellen ihres Gehirns eingeschlossen war und nur darauf wartete, in ihr Bewußtsein einzubrechen, mit dieser besonderen Luzidität, die den Erinnerungen Sterbender zugeschrieben wird.
Sie war in Indien geboren, in Mayapore, in einer Zeit, als die britische Herrschaft über Indien ihr Ende fand. Ihr Vater, ein kleiner Beamter, hatte den Krieg in irgendeiner obskuren Behörde ausgesessen. 1947 hatte er sich dafür entschieden, in Indien zu bleiben und sich mit seiner Pension recht kümmerlich durchgeschlagen.
An ihre Mutter hatte sie kaum Erinnerungen. Fünf Jahre nachdem sie Jasmine zur Welt gebracht hatte, war sie bei Theos Geburt gestorben, im Sterben so zurückhaltend und bescheiden wie im Leben. Hinterlassen hatte sie nichts als einen schwachen Duft nach englischen Rosen, der sich in Jasmines Bewußtsein mit dem Klappern geschlossener Fensterläden und dem Summen von Insekten vermischte.
Eine leichte Erschütterung des Betts riß Jasmine aus ihren Fantasien. Sie hob ihre Hand und schob ihre Finger in Sidhis flauschiges Fell. Einen Moment öffnete sie die Augen und starrte auf ihre Finger, deren geschwollene Gelenke von fragilen Brücken aus Haut und Muskeln zusammengehalten wurden. Der Körper der Katze, ein schwarzer Farbklecks auf dem Orangerot der Bettdecke, schmiegte sich pulsierend an ihre Hüfte.
Nach einer Weile strich sie der Katze ein letztes Mal über den seidenglatten Kopf, dann richtete sie sich mühsam auf, um sich auf die Bettkante zu setzen. Automatisch griff sie prüfend an den Katheter in ihrer Brust. Seit sie das Krankenhausbett in ihr Wohnzimmer hatte stellen lassen, war sie den klaustrophobischen Gefühlen entronnen, die sich ihrer bemächtigt hatten, als sie über immer längere Zeiträume an ihr kleines Schlafzimmer gefesselt wurde. So, von ihren persönlichen Dingen umgeben und mit den zum Garten geöffneten Fenstern, durch die das Sonnenlicht herein konnte, erschien ihr das Schrumpfen ihrer Welt erträglicher.
Zuerst eine Tasse Tee, dann ein paar Bissen von dem Abendessen, das Meg ihr gebracht hatte, soviel sie eben hinunterbringen konnte, und danach konnte sie es sich für den Abend vor dem Fernsehapparat bequem machen. In kleinen Schritten planen, jedem Vorgang den gleichen Stellenwert geben – das war die Technik, die sie sich angeeignet hatte, um jeden neuen Tag zu meistern.
Sie stemmte sich vom Bett in die Höhe und schlurfte, in einen indischen Seidenkaftan in leuchtenden Farben gehüllt, in die Küche. Gedeckter britischer Flanell war nie ihre Sache gewesen; jetzt allerdings hing der Kaftan so lose an ihr wie ein Stück Wäsche auf der Leine. Einem genetischen Zufall hatte sie es zu verdanken, daß sie exotischer aussah, als bei ihrer rein englischen Herkunft zu erwarten gewesen wäre – zierlich und dunkel, mit schwarzen Augen und schwarzem Haar. Den in Kalkutta verbliebenen englischen Schulkameradinnen war sie eine Zielscheibe des Spotts gewesen. Jetzt, mit dem knabenhaft kurzen dunklen Haar und den übergroß wirkenden Augen in dem mageren Gesicht, wirkte sie ätherisch und trotz ihrer Krankheit jünger als sie war.
Sie setzte den Wasserkessel auf und stieß, an die Küchenspüle gelehnt, das Fenster auf, um in den Garten hinauszublicken.
Sie wurde nicht enttäuscht. Der Major patrouillierte in seiner Uniform – ausgeleierte graue Wolljacke und alte Flanellhose – mit der Gartenschere in der Hand durch das kleine Hintergärtchen, bereit, jedem aufmüpfigen Zweiglein sofort den Garaus zu machen. Er sah zu ihr hinauf und hob grüßend die Schere. Jasmine rief: »Tee?«, und als er zustimmend nickte, kehrte sie an den Herd zurück und widmete sich mit ganzer Aufmerksamkeit dem Ritual der Teezubereitung.
Sie trug die Tassen zur Treppe, die von ihrer Wohnung in den Garten hinunterführte. Der Major hatte die Souterrainwohnung und betrachtete den Garten als seine Domäne. Sie und Duncan, der über ihr wohnte, waren nur privilegierte Außenseiter. Die Holzdielen der obersten Stufe drückten hart gegen ihre Knochen, als sie sich vorsichtig niedersetzte.
Der Major kam die Stufen herauf und setzte sich neben sie. Mit einem Brummen nahm er seine Tasse in Empfang.
»Herrlicher Tag«, sagte er anstelle eines Dankesworts. »Wäre schön, wenn es eine Weile so bliebe.« Er trank von seinem Tee. »Geht’s Ihnen gut heute?« Er sah sie nur eine Sekunde lang an, ehe er seine Aufmerksamkeit wieder auf Narzissen und Tulpen richtete.
»Ja«, antwortete Jasmine lächelnd.
Der Major war nun einmal kein gesprächiger Mensch. Diese lakonischen Bemerkungen waren seine Art des Monologs, und diese immer gleiche Frage war die einzige Anspielung, die er je auf ihre Krankheit machte.
Sie tranken schweigend. Der Tee und die Spätnachmittagssonne wärmten sie beide. Schließlich sagte Jasmine: »Ich glaube, ich habe den Garten nie so schön gesehen wie in diesem Frühjahr, Major. Kommt das daher, daß ich jetzt alles bewußter wahrnehme, oder ist er dieses Jahr wirklich schöner?«
»Hm«, brummte er in seine Tasse und räusperte sich dann in Vorbereitung auf das schwierige Geschäft des Antwortgebens. »Könnte sein. Das Wetter war ja wirklich gut.« Stirnrunzelnd zog er seine Finger über die Spitzen der Gartenschere, um zu prüfen, ob sich irgendwo Rost festgesetzt hatte. »Aber die Tulpen sind fast verblüht.« Und die Tulpen durften auch nicht über die Hochzeit ihrer Blüte hinaus verweilen. Beim ersten gefallenen Blütenblatt würde ihnen der Major mit einem schnellen gnädigen Schnitt den Kopf vom Stengel trennen.
Jasmines Mund zuckte bei dem Gedanken – zu schade, daß ihr niemand einen solchen Dienst erweisen konnte. Sie selbst war vor ihrem letzten Entschluß zurückgeschreckt – ob aus Kleinmütigkeit oder Mut hätte sie nicht sagen können. Und Meg – es war zuviel verlangt gewesen, sie hatte nicht das Recht gehabt, sie darum zu bitten. Jasmine verstand jetzt nicht mehr, wie sie überhaupt auf einen solchen Gedanken hatte kommen können.
Als Meg heute gekommen war, hatte sie noch verhuschter ausgesehen als sonst, und ihre breite Stirn war von Sorgenfalten durchfurcht gewesen. Jasmine hatte ihre ganze Kraft gebraucht, um Meg davon zu überzeugen, daß sie es sich anders überlegt hatte, und dabei hatte sie ständig das Ironische der Situation gesehen. Sie war diejenige, die sterben mußte; aber Meg brauchte den Trost.
Sie konnte Meg nicht erklären, was in der Nacht mit ihr vorgegangen war. Sie wußte nur, daß sie bei ihrer schnellen Annäherung an den Tod einen Meridian überschritten hatte. Die Schmerzen machten ihr keine Angst mehr. Mit dem Annehmen ging die Fähigkeit einher, jeden Moment bewußt zu erleben und auszukosten, und eine ganz neue innere Zufriedenheit.
Die Sonne ging hinter dem behäbigen viktorianischen Haus jenseits des Gärtchens unter, und innerhalb eines Augenblicks wurde der goldene Schimmer seiner Mauern von kaltem Grau verdrängt. Die Luft lag plötzlich kühl auf Jasmines Haus, und sie hörte gedämpft den Verkehrslärm vom Rosslyn Hill, Zeugnis, daß noch immer betriebsames Leben sie umgab.
Der Major stand ächzend auf. »Ich mache besser weiter. Es wird bald dunkel sein.« Er neigte sich zu Jasmine herunter und half ihr so mühelos auf die Beine, als hätte sie überhaupt kein Gewicht. »Hinein mit Ihnen. Nicht daß Sie sich eine Erkältung holen.«
Jasmine hätte beinahe gelacht über die Absurdität der Vorstellung, daß sie an einer Erkältung erkranken könnte; als ließe sich irgendein äußerer Umstand mit den Verwüstungen vergleichen, die sich von innen in ihrem Körper ausbreiteten. Doch sie gestattete ihm, sie ins Haus zu führen und die Tassen abzuspülen.
Als er gegangen war, sperrte sie die Tür zum Garten ab und schloß die Fenster, zögerte jedoch einige Minuten, ehe sie die Jalousien herunterließ. Das Licht über den Dächern begann zu schwinden, und die Blätter der Birke im Garten fröstelten im Abendwind. Von Duncans Terrasse aus hätte sie sehen können, wie die Sonne hinter West-London unterging. Er zahlte einen hohen Preis für dieses Privileg und war so nett gewesen, sie einige Male daran teilhaben zu lassen, ehe ihr das Treppensteigen zuviel geworden war.
Duncan – hm, das war auch so etwas, das sie Meg nicht erklären konnte, zumindest nicht, ohne sie zu verletzen. Sie hatte nicht gewollt, daß Meg ihn kennenlernte; sie hatte ihn von ihrem übrigen Leben, von ihrer Krankheit getrennt halten wollen. Meg kümmerte sich mit solchem Eifer um sie, verfolgte die Entwicklung eines jeden Symptoms, überwachte ihre Pflege und die Verabreichung der Medikamente mit solcher Gewissenhaftigkeit, als sei Jasmines Krankheit ihre ganz persönliche Verantwortung. Duncan brachte ihr die Außenwelt, scharf und beißend, und wenn er auch mit dem Tod zu tun hatte, so war dieser Tod doch weit entfernt von ihrem eigenen.
Seufzend zog sie die Jalousie herunter. Sidhi strich ihr schnurrend um die Beine. Diese Unterscheidung zwischen Duncan und Meg war blanker Unsinn; Meg hatte sich gewissermaßen in ihre Krankheit hineingestürzt, und eben diese Krankheit machte sie – Jasmine – zu einer ungefährlichen Freundin Duncans. Eine Beziehung ältere Frau – jüngerer Mann war ausgeschlossen. Als Sterbende war man akzeptabel und so gar nicht bedrohlich.
Sie fand ihn widersprüchlich in seinem Wesen, zurückhaltend und entgegenkommend zugleich, und sie wußte niemals so recht, was sie gerade zu erwarten hatte. »Wie wär’s mit einem Eis heute abend?« konnte er in einer seiner lockeren Stimmungen fragen, und dann joggte er den Rosslyn Hill zum Häagen-Dazs hinauf und kehrte keuchend und strahlend wie ein Sechsjähriger mit dem Eis zurück. An solchen Abenden pflegte er sie mit Spielen und Gesprächen aufzumuntern und eine Energie in ihr freizusetzen, die sie längst nicht mehr zu besitzen geglaubt hatte.
An anderen Abenden schien er sich in sich selbst zurückzuziehen und begnügte sich damit, im blaugrau zuckenden Lichtschein des Fernsehapparats ruhig neben ihr zu sitzen. Sie wagte dann keinen Versuch, die Barriere zu durchbrechen. Und sie wagte auch nicht, sich von seiner Gesellschaft allzu abhängig zu machen, jedenfalls sagte sie sich das immer wieder. Es überraschte sie, daß er soviel Zeit mit ihr verbrachte, doch ehe ihr Verstand sich auf den Weg begeben konnte, seine Motive zu analysieren, nahm sie ihn, aus Furcht, auf Mitleid zu stoßen, fest an die Leine.
Sie richtete sich so energisch auf, wie es ihr noch möglich war, und öffnete den Kühlschrank. Margaret hatte ihr ein Gemüsecurry dagelassen – Megs Vorstellung von gesunder Ernährung. Jasmine schaffte es, ein paar Bissen zu essen, obwohl ihr das Schlucken schwerfiel. Geruch und Geschmack des Currygerichts erinnerten sie so lebhaft an ihre Kindheit wie die Wachträume dieses Nachmittags. Zufall, sagte sie sich, merkwürdig, aber bedeutungslos.
Sie döste vor dem Fernsehapparat, mit einem Ohr in ständiger Erwartung von Duncans Klopfen. Sidhi kniff die Augen zusammen wegen des grellen Lichts, und machte es sich auf ihrem Schoß bequem. Was würde aus Sidhi werden? Sie hatte keine Vorsorge für ihn getroffen; sie war nicht imstande gewesen, über ihn zu verfügen wie über ein Möbelstück. Ihr Bruder Theo mochte keine Katzen. Der Major beschwerte sich, wenn Sidhi in seinen Blumenbeeten scharrte. Duncan behandelte den Kater mit höflicher Gleichgültigkeit, Felicity fand ihn unhygienisch, und Meg wohnte in einem möblierten Zimmer in Kilburn bei einer Wirtin, die sie als äußerst grimmig zu schildern pflegte. Also insgesamt keine guten Aussichten. Vielleicht würde Sidhi mit seinem nächsten Leben ohne ihr Eingreifen zurechtkommen. In diesem Leben jedenfalls hatte er großes Glück gehabt – sie hatte ihn, ein struppiges, sechs Wochen altes Kätzchen, aus einer Mülltonne gerettet.
Während langsam die Nacht heraufzog, fragte sich Jasmine, ob sie wirklich die richtige Entscheidung getroffen hatte, doch irgendwie wußte sie, daß es kein Zurück mehr geben konnte, wenn man einmal diese unsichtbare Linie überschritten hatte.
Duncan Kincaid trat aus den Tiefen des Untergrundbahnhofs Hampstead ans Tageslicht und blinzelte geblendet. Er bog in die High Street ein, und ein Meer wogender Farben brandete ihm entgegen. Ganz Hampstead schien sich voll frühsommerlicher Heiterkeit aufgemacht zu haben, diesen Frühlingsmorgen zu begrüßen. Passanten, die miteinander zusammenstießen, lächelten, anstatt zu schimpfen, vor den Restaurants wurden eilig ein paar Tische auf den Bürgersteig gestellt, und der Duft frischen Kaffees mischte sich mit den Auspuffgasen.
Kincaid eilte gänzlich immun gegen die überschwengliche Stimmung den Hügel hinunter. Kaffee lockte ihn nicht – er hatte von den zahllosen Tassen abgestandenen Kaffees, die er getrunken hatte, einen Geschmack von Spülwasser auf der Zunge; die Augen brannten ihm vom Zigarettenqualm anderer Leute; und die Tatsache, daß der Fall nun geklärt war, war ein schwacher Trost für die harte Arbeit einer langen, bedrückenden Nacht. Auf einer Wiese hatte man die Leiche eines Kindes gefunden. Die Spuren des Verbrechens hatten zu einem Nachbarn geführt, der, als man ihn damit konfrontierte, schluchzend gestanden hatte, er habe nicht anders gekonnt, er habe der Kleinen nichts antun wollen.
Kincaid hatte nur noch den Wunsch, sich zu waschen und in sein Bett fallen zu lassen.
Als er den Rosslyn Hill erreichte, hatte ihn die Frühlingsstimmung ein wenig angesteckt, und als er den Blumenhändler an der Ecke der Pilgrim’s Lane sah, fiel ihm Jasmine ein. Er hatte sie eigentlich gestern abend auf einen Sprung besuchen wollen – das tat er meistens, wenn es ihm irgend möglich war –, aber ihre Beziehung war so lose, daß ein Anruf, um abzusagen, übertrieben gewirkt hätte, und sie selbst würde niemals ein Wort darüber verlieren, daß er nicht gekommen war.
Er kaufte einen Strauß Freesien, weil er sich erinnerte, daß Jasmine den Duft dieser Blumen besonders liebte.
Die Stille der Carlingford Road erschien ihm nach dem Lärm in den Hauptstraßen besonders intensiv. In der Luft im Schatten des Hauses, in dem er seine Wohnung hatte, hing noch die Kühle der Nacht. Kincaid begegnete dem Major, der eben die Treppe von seiner Souterrainwohnung heraufkam, und erhielt das erwartete »Hm-rm. Morgen« und ein abgehacktes Nicken in Erwiderung seines Grußes.
Sobald er ins Treppenhaus trat, hörte er das Klopfen. Erst ein sachtes Pochen, dann dringlicheres Hämmern. Eine Frau – groß, mit rotblondem Haar, das an den Schläfen leicht ergraut und offensichtlich von einem teuren Friseur geschnitten war – drehte sich nach ihm um, als er den Treppenabsatz vor Jasmines Wohnung erreichte. Er hätte sie für eine Rechtsanwältin gehalten, wäre nicht das Köfferchen gewesen, das sie bei sich trug.
»Ist sie nicht da?« fragte er.
»Sie muß da sein. Sie ist viel zu schwach, um allein auszugehen.« Die Frau musterte Kincaid und schien zu dem Schluß zu kommen, er sähe aus, als könnte er ihr nützlich sein. Sie bot ihm die Hand. »Ich bin Felicity Howarth, die Pflegerin vom Heimpflegedienst. Ich komme jeden Tag um diese Zeit. Sind Sie ein Nachbar?«
Kincaid nickte. »Ich wohne oben. Kann es sein, daß sie ein Bad nimmt?«
»Nein. Dabei helfe ich ihr immer.«
Einen Moment lang sahen sie einander schweigend an, und ein Funke der Furcht glimmte zwischen ihnen auf. Kincaid drehte sich um und schlug an die Tür.
»Jasmine!« rief er. »Machen Sie auf.« Er horchte, das Ohr an die Tür gedrückt, ehe er sich wieder Felicity zuwandte. »Haben Sie einen Schlüssel?«
»Nein. Sie steht morgens immer allein auf und läßt mich herein. Haben Sie einen?«
Kincaid schüttelte den Kopf. Er überlegte. Das Schnappschloß war ein einfaches Ding, Standardausführung, aber er wußte, daß Jasmine eine Kette und ein Sicherheitsschloß hatte.
»Haben Sie vielleicht eine Haarnadel?« fragte er Felicity. »Oder eine Büroklammer?«
Felicity kramte in ihrer Tasche, brachte ein Bündel Papiere zum Vorschein, das mit einer Büroklammer zusammengehalten war. »Geht die?«
Er drückte ihr den Blumenstrauß in die Hand, nahm die Klammer und bog sie auseinander. Dann nahm er sich die Tür vor. Schon nach wenigen Sekunden vorsichtigen Herumstocherns sprang das Schloß auf, ein Traum jedes Einbrechers. Kincaid drehte versuchsweise den Knauf, und die Tür ging auf.
Das einzige Licht im Zimmer fiel durch die Sonnenjalousien aus weißem Reispapier, die heruntergelassen waren. Es war still in der Wohnung. Nur von einer Stelle, die sich irgendwo in der Nähe von Jasmines Bett befand, war ein schwaches summendes Geräusch zu hören. Kincaid und Felicity Howarth traten in beinahe synchroner Bewegung zum Fußende des Betts. Sie sprachen nicht. Es war etwas im Raum, das ihnen den Mund verschloß.
Von der Frau, die in die Farbenpracht der Decken eingebettet war, ging keine Bewegung aus; kein Atemzug hob die Brust, auf der schnurrend die schwarze Katze kauerte.
Die Freesien sanken vergessen herab und fielen auf der Bettdecke wie Mikadostäbchen auseinander.
2
»Diese blöde Kuh!« Rogers Stimme wurde laut und hallte in dem kleinen Zimmer wider. In der Fantasie hörte Margaret schon den schweren Schritt ihrer Zimmerwirtin auf der Treppe, und sie streckte den Arm nach ihm aus, als könne sie ihn mit einer Geste zum Schweigen bringen. Mrs. Wilson hatte mehr als einmal gedroht, Margaret augenblicklich an die Luft zu setzen, wenn sie dahinterkommen sollte, daß Roger über Nacht blieb, und wenn sie sie jetzt, morgens um halb acht, streiten hörte, wüßte sie, wie die Dinge lagen.
»Roger, bitte! Um Gottes willen, sei still. Wenn Mrs. Wilson dich hört! Du weißt doch, wie sie ist ...«
»Gott hat damit überhaupt nichts zu tun, Meg, außer daß deine Freundin Jasmine ihm deinetwegen heute nicht näher ist als gestern.«
Da sich hier eine Gelegenheit zum Sarkasmus bot, war es nicht nötig, die Stimme zu erheben. Es traf Margaret auch so.
»Roger, was redest du da – bist du völlig verrückt geworden? Ich habe dir gesagt, sie hat es sich anders überlegt. Und ich bin froh darüber...«
»Ja, klar, damit du jede freie Minute um sie herumschwirren kannst wie eine gottverdammte Florence Nightingale, was? Ich finde das zum Kotzen. Was soll ich hier eigentlich noch? Hm? Kannst du mir das mal sagen, Meg, meine Liebste ...«
»Bitte, sei doch still, Roger. Ich habe dir gesagt, du sollst mich ...«
»... nicht so nennen. Das ist ihr Kosename für dich. Wie reizend.«
Er trat einen Schritt näher an sie heran und packte sie beim Ellbogen, quetschte ihren Arm zwischen seinen Fingern zusammen. Margaret roch den Duft der Seife auf seiner Haut und des Kräutershampoos, mit dem er sich die Haare gewaschen hatte. Sie sah, wie das Licht auf dem Fleckchen rotbrauner Stoppeln glänzte, das er beim Rasieren am Kinn übersehen hatte.
»Na los, sag mir endlich, was ich hier noch soll, Margaret.« Er sprach jetzt leise. Es war beinahe ein Flüstern. »Wo du doch sowieso nie Zeit für mich hast, und sie vielleicht noch Monate lebt.«
Margaret riß sich von ihm los. »Dann geh doch!« zischte sie und war überrascht, als sie die Worte hörte, die gar nicht von ihr selbst zu kommen schienen. »Hau doch ab, wenn du willst.«
Lange Zeit standen sie einander gegenüber, ohne ein Wort zu sagen, und ihr keuchender Atem übertönte die Hintergrundgeräusche von Radiomusik. Dann begann Roger plötzlich zu lachen. Er hob eine Hand, schob sie Margaret unters Kinn und drückte ihr Gesicht hoch.
»Willst du das wirklich, Süße?« fragte er und neigte sich so tief über sie, daß sein Mund nur Zentimeter von ihrem entfernt war. »Du wirst es aber nicht bekommen. Ich gehe nämlich, wenn es mir paßt, und keine Minute früher. Und bilde dir bloß nicht ein, du kannst mich abservieren.«
Der Bus Nummer 89 ratterte schwankend den Hang durch Camden Town hinauf. Margaret Bellamy saß im Oberdeck auf der vordersten Bank. Ihre prall gefüllte Einkaufstasche hatte sie zur Abschreckung von Störenfrieden neben sich abgestellt.
Aber sie hätte sich gar keine Sorgen zu machen brauchen. Der einzige andere Fahrgast, der sich die Mühe gemacht hatte, zum Oberdeck hinaufzusteigen, war ein zahnloser alter Mann, der in eine Pferderennzeitung vertieft war. Die rissigen Kunstlederbezüge der Sitze stanken nach kaltem Zigarettenrauch und Autoabgasen, aber Margaret fand den vertrauten Geruch tröstlich. Sie knabberte an ihrem Handknöchel, eine Unsitte, die sie sich angewöhnt hatte, um sich am Fingernägelkauen zu hindern. Eine infantile Angewohnheit, hatte Jasmine es genannt. Jasmine...
Margarets Gedanken schweiften ab, sprangen in eine andere Spur wie die Nadel eines alten Grammophons. Sie hatte einfach nicht länger im Büro bleiben können. Sie hatte gehen müssen, auch wenn Mrs. Washburn sie mit diesem kalten Fischblick fixierte und gesagt hatte: »Schon wieder ein Zahnarzttermin?«
»Dieses Biest«, sagte Margaret laut vor sich hin und drehte sich sofort um, um zu sehen, ob der zahnlose Alte sie gehört hatte. Und wenn schon? fragte sie sich sogleich. Es kam ihr vor, als hätte sie sich ihr ganzes Leben lang immer nur bemüht, nur ja niemanden vor den Kopf zu stoßen, es nur ja allen recht zu machen. Und was hatte sie damit erreicht? Daß sie jetzt ganz fürchterlich in der Patsche saß.
Sie hätte Jasmine von Roger erzählen sollen. Daß sie es nicht getan hatte, war ihr erster Fehler gewesen. Bei seinen ersten Einladungen hatte sie selbst nicht recht an ihr Glück glauben können und nicht die Blamage riskieren wollen, die es für sie gewesen wäre, wenn er sie genauso schnell wieder fallen gelassen hätte, wie er sie erobert hatte. Später hatte sich irgendwie nie die richtige Gelegenheit ergeben, und ihr schlechtes Gewissen darüber, daß sie es geheimhielt, machte alles noch peinlicher. Sie probte alle möglichen »Ach, übrigens, ich wollte Ihnen schon lange etwas sagen«-Szenarien und schwieg am Ende doch.
Genaugenommen hatte Roger sie nie eingeladen. Rückblickend erkannte sie, daß er sie nur mit seiner Anwesenheit und seinen Aufmerksamkeiten beglückt hatte, während sie fast immer bezahlt hatte. Der Preis war ihr damals gering erschienen dafür, daß sie sich im Glanz seines blendenden Aussehens, seiner Verbindungen, seines gewandten Auftretens sonnen konnte.
Aber das war nur eine kleine Dummheit aus Eitelkeit gewesen, ein verzeihlicher Fehler. Die Fehler, die sie seither begangen hatte, waren nicht so leicht abzutun. Niemals hätte sie Roger erzählen dürfen, worum Jasmine sie gebeten hatte. Und niemals hätte sie ihm von dem Geld erzählen dürfen.
Der Bus hielt am South End Green an. Ihre Tasche auf der Hüfte tragend, stieg Margaret aus und trat blinzelnd in den Sonnenschein hinaus. Die mächtigen alten Platanen und Weiden der South Heath begleiteten rechter Hand ihren Weg, als sie den Hügel hinaufging. Die Sonne glitzerte auf den Teichen, und rundherum tummelten sich Menschen in Festtagsstimmung, wie sie ein unerwartet warmer Frühlingstag stets bei den Engländern hervorruft.
Das Gefühl nagender Unruhe, das sie seit dem vergangenen Abend quälte, verstärkte sich. Von der Willow Road bog sie, der Heide den Rücken kehrend, in die Pilgrim’s Lane ein. Als sie die Carlingford Road erreichte, blickte sie auf und sah das Heck eines Krankenwagens, der gerade nach links zum Rosslyn Hill abbog. Eisiger Schrecken durchzuckte sie, und ihre Knie drohten nachzugeben.
Felicity zog das Bett ab, breitete die Tagesdecke über die Matratze und strich sie sorgfältig glatt. Kincaid, der die Jalousien hochgezogen hatte, starrte in den kleinen Garten hinaus. Dann riß er sich aus seiner Lethargie, fuhr sich mit den Fingern durchs Haar und drehte sich herum.
»Wer sind die nächsten Verwandten? Wissen Sie das?«
»Ein Bruder, glaube ich. Er heißt Theo«, antwortete Felicity, während sie in Höhe des Kopfkissens ein letztes Mal glättend über die Tagesdecke strich. Sie musterte das Bett einen Moment, nickte befriedigt und trat zum Spülbecken. »Ich bin allerdings nicht sicher, ob die beiden gut miteinander ausgekommen sind«, fuhr sie fort, während sie sich die Hände wusch und dann den Kupferkessel mit Wasser füllte. »Sie hat verschiedentlich von ihm gesprochen. Er lebt in Surrey oder Sussex, aber ich habe ihn nie kennengelernt.« Felicity wies mit dem Kopf zu dem Sekretär, in dem Jasmine ihre Papiere aufbewahrt hatte. »Seine Telefonnummer und seine Adresse sind sicher da bei den Papieren.«
Kincaid war etwas schockiert darüber, mit welcher Selbstverständlichkeit sie annahm, daß er für die Benachrichtigung von Jasmines Angehörigen zuständig sei, aber er hatte andererseits keine Ahnung, wer sonst die unerfreuliche Aufgabe übernehmen sollte. Er fand die Aussicht nicht besonders verlockend.
»Das kommt manchmal vor, daß es so plötzlich geht.« Felicity drehte sich um und sah ihn teilnahmsvoll an. Kincaid konnte sich nur darüber wundern, wie schnell sie ihre Gelassenheit wiedergefunden hatte. Ein paar Sekunden des Schocks – Augen geschlossen, Gesicht leer –, dann war sie professionell und kompetent in Aktion getreten. Für sie wahrscheinlich ein relativ alltägliches Ereignis, der Verlust eines Patienten.
»Aber sie schien doch gar nicht ...«
»Nein. Ich hätte ihr mindestens noch ein, zwei Monate gegeben. Aber wir sind eben nicht Gott – unsere Prophezeiungen sind nicht unfehlbar.«
Der Kessel pfiff, und Felicity wandte sich ab. Sie nahm Tassen von einem Bord und goß kochendes Wasser über die Teebeutel. Ihr dunkles Schneiderkostüm paßte nicht zu solch häuslicher Tätigkeit, und Felicity selbst, nüchtern und präzise inmitten des kunterbunten Allerleis von Jasmines exotischen Besitztümern, erinnerte Kincaid an einen Habicht unter Pfauen.
»Sie hat nie darüber gesprochen – über ihre Krankheit, meine ich«, sagte Kincaid. »Ich hatte keine Ahnung, daß sie so weit ...«
Die Wohnungstür flog krachend auf. Kincaid und Felicity Howarth fuhren erschrocken herum. Eine Frau stand in der Tür. Sie hielt eine Einkaufstasche an ihre Brust gedrückt.
»Wo ist sie? Wohin haben sie sie gebracht?« Sie sah das ordentlich gerichtete Bett und die Gesichter Kincaids und Felicitys und schwankte. Die Einkaufstasche geriet ins Rutschen.
Felicity reagierte schneller als Kincaid. Sie hatte die Tasche schon sicher zu Boden gestellt und der Frau die Hand unter den Ellbogen geschoben, ehe Kincaid sie überhaupt erreichte.
Sie führten sie zu einem Sessel, und sie ließ sich widerstandslos hineinfallen. Noch keine Dreißig schätzte Kincaid, eine Spur rundlich, mit widerspenstigem braunem Haar und sehr heller Haut und einem runden Gesicht, das jetzt tiefen Kummer ausdrückte.
»Margaret? Sie sind doch Margaret, nicht?« fragte Felicity behutsam. Sie warf Kincaid einen Blick zu und sagte erklärend: »Sie ist eine Freundin von Jasmine.«
»Sagen Sie mir, wohin man sie gebracht hat. Sie möchte bestimmt nicht allein sein. Ach, ich wußte ja, ich hätte gestern abend nicht gehen sollen.« Sie drehte den Kopf von einer Seite zur anderen, als suchte sie nach Jasmine, und rang dabei die Hände in ihrem Schoß. Kincaid und Felicity sahen einander über Margarets Kopf hinweg an.
Felicity kniete nieder und nahm Margarets Hände in die ihren. »Margaret, sehen Sie mich an. Jasmine ist tot. Sie ist gestern nacht im Schlaf gestorben. Es tut mir leid.«
»Nein.« Margaret starrte Felicity flehend an. »Sie kann nicht tot sein. Sie hat es mir versprochen.«
Seltsam, diese Worte. Kincaid horchte auf. Er neigte sich zu Margaret hinunter. »Sie hat es versprochen? Was hat Jasmine versprochen, Margaret?«
Zum erstenmal richtete Margaret ihren Blick bewußt auf Kincaid. »Sie hatte es sich anders überlegt. Ich war so erleichtert. Ich glaubte nicht, daß ich es wirklich tun ...« Ein Schluckauf unterbrach sie, und sie fröstelte. »Jasmine hat ihr Versprechen nicht gebrochen. Sie hat immer Wort gehalten.«
Felicity ließ Margarets Hände los, die sich sogleich wieder rastlos zu bewegen begannen.
»Margaret«, sagte Kincaid eindringlich. »Was wollte Jasmine, daß Sie tun?«
Sie wurde plötzlich still und starrte ihn verwundert an. »Sie wollte, daß ich ihr helfe, sich das Leben zu nehmen.« Sie zwinkerte einmal, und dann rollten ihr die Tränen aus den Augen. Danach sprach sie so leise, daß Kincaid sich anstrengen mußte, um ihre Worte zu verstehen. »Was soll ich denn jetzt tun?«
Felicity stand auf, holte eine Tasse lauwarmen Tee aus der Küche, gab etwas Zucker hinein und drückte Margaret die Tasse in beide Hände. »Trinken Sie, Kind. Dann wird Ihnen besser.«
Margaret trank gierig, ohne auf die Tränen zu achten, die ihr über das Gesicht liefen, bis die Tasse leer war.
Kincaid zog sich einen Stuhl heran und setzte sich ihr gegenüber. Er wartete, während sie ein zerknülltes Taschentuch aus ihrer Rocktasche zog und sich die Augen wischte. Die hellen Wimpern verliehen ihr etwas Schutzloses, das ihn an ein im Scheinwerferlicht gebanntes Kaninchen erinnerte.
»Erzählen Sie mir genau, was geschehen ist, bitte, Margaret. Ich möchte es gern wissen.«
»Ich weiß, wer Sie sind«, sagte sie schniefend, während sie ihn aufmerksam ansah. »Duncan. Sie sehen viel besser ...« Rote Flecken brannten plötzlich auf ihrer hellen Haut, und sie blickte zu ihren Händen hinunter. »Ich meine ...«
»Dann hat Jasmine Ihnen also von mir erzählt?« Jasmine war eine Meisterin darin gewesen, die einzelnen Bereiche ihres Lebens voneinander getrennt zu halten, dachte Kincaid. Sie hatte ihm nie etwas von Margaret erzählt.
»Nur, daß Sie über ihr wohnen und sie manchmal besucht haben. Ich habe immer zu ihr gesagt, sie hätte Sie erfunden wie sich kleine Kinder oft einen Freund erfinden, weil ich Sie ja nie .. «, sie schluchzte auf, und die Papiertücher traten wieder in Aktion, »... gesehen habe.«
»Margaret.« Kincaid beugte sich vor und berührte ihren Arm, um ihre Aufmerksamkeit wiederzugewinnen. »Sind Sie sicher, daß Jasmine die Absicht hatte, sich das Leben zu nehmen? Vielleicht wollte sie sich nur Mut machen und hat nur davon gesprochen, um sich das Gefühl zu geben, sie hätte eine Wahl.«
»O nein.« Margaret schüttelte energisch den Kopf. »Sobald Sie erfuhr, daß die Therapie bei ihr nicht anschlug, hat sie an Exit geschrieben. Sie sagte, die Vorstellung, künstlich ernährt zu werden, all die Schläuche und Röhrchen, hat sie immer gesagt, sei ihr grauenvoll. Sie sagte, sie würde sich überhaupt nicht mehr als Mensch fühlen und ...« Margaret verzog das Gesicht und drückte, in dem Bemühen, die Tränen zurückzuhalten, eine Hand auf den Mund.
Kincaid nickte ihr aufmunternd zu. »Es ist schon in Ordnung. Erzählen Sie weiter.«
»Exit hat dann alle Unterlagen geschickt, und wir haben es genau geplant – wieviel sie nehmen müßte und so. Gestern abend. Sie wollte es gestern abend tun.«
»Aber dann hat sie es sich anders überlegt?« hakte Kincaid nach, als sie schwieg.
»Ich bin gekommen, sobald ich aus dem Büro weg konnte. Ich war fest entschlossen, ihr zu sagen, daß ich es nicht tun könnte, aber sie hat mich nicht mal ausreden lassen. ›Laß nur, Meg‹, sagte sie. ›Mach dir keine Kopfzerbrechen. Ich habe es mir auch anders überlegt.‹ Und sie sah auch irgendwie anders aus ... Sie sah glücklich aus.« Margaret sah ihn mit flehender Miene an. »Ich habe ihr geglaubt. Ich hätte sie niemals allein gelassen, wenn ich es nicht geglaubt hätte.«
Kincaid wandte sich Felicity zu. »Ist es möglich? Hätte sie es allein tun können?«
»O ja, bei den Patienten, die sich ihre Medikamente selbst verabreichen, ist das natürlich immer eine Möglichkeit«, antwortete sie sachlich. »Das ist eines der Risiken, die man bei der Heimpflege eingeht.«
Einen Moment lang sagte keiner etwas. Margaret saß zusammengesunken da, verweint und erschöpft. Kincaid seufzte und rieb sich das Gesicht, während er überlegt. Wenn er allein Margarets Enthüllung gehört hätte, hätte er vielleicht nichts unternommen, und Jasmine ihren Tod gelassen, ohne Fragen zu stellen. Die Anwesenheit Felicity Howarths jedoch komplizierte die Angelegenheit. Sie kannte das korrekte Verfahren zweifellos so gut wie er, und mögliche Anzeichen eines unnatürlichen Todes zu ignorieren, das roch nach Kollusion. Und schließlich bedrückte ihn, auch wenn er in seinem Schmerz und seiner Erschöpfung nicht in der Lage war, dieses Gefühl zu isolieren, immer noch ein diffuses Unbehagen.
Als er aufsah, bemerkte er, daß Felicity ihn nicht aus den Augen gelassen hatte. »Tja«, sagte er widerstrebend, »da werde ich wohl eine Obduktion anordnen müssen.«
»Sie?« fragte Felicity mit zusammengezogenen Brauen, und Kincaid wurde sich bewußt, daß sie ja nicht wußte, wer er war.
»Entschuldigen Sie. Ich bin Polizeibeamter. Detective Superintendent, Scotland Yard.«
Angesichts Felicitys Reaktion hatte Kincaid den gleichen Eindruck wie zuvor, als sie die tote Jasmine gefunden hatten. Ihr Gesicht wurde leer und ausdruckslos, wie von allen Gefühlsregungen leergefegt.
»Oder möchten Sie das lieber übernehmen?« fragte er in der Befürchtung, sie gekränkt zu haben, indem er sich über ihre Autorität hinweggesetzt hatte.
Felicitys Aufmerksamkeit kehrte zu ihm zurück. Sie schüttelte den Kopf. »Nein. Ich denke es ist am besten, wenn Sie sich darum kümmern.« Sie wies mit einer Kopfbewegung zu Margaret, die immer noch wie betäubt dasaß. »Ich muß mich um andere Dinge kümmern.« Sie ging zu Margaret und berührte behutsam ihre Schulter. »Kommen Sie, ich bringe Sie nach Hause, Kind. Mein Wagen steht vor der Tür.«
Margaret folgte ihr widerstandslos. Die Einkaufstasche, die Felicity vom Boden aufgehoben hatte, hielt sie fest an ihre Brust gedrückt. An der Tür drehte sie sich noch einmal nach Kincaid um. »Sie hätte nicht allein gelassen werden dürfen«, flüsterte sie, und die Worte schienen beinahe eine Anklage zu sein, als wäre auch er irgendwie für das Geschehen verantwortlich.
Die Tür fiel hinter den beiden Frauen zu. Kincaid blieb in der stillen Wohnung zurück und wurde sich plötzlich bewußt, daß er seit fast achtundvierzig Stunden nicht geschlafen hatte. Ein dünner Schrei durchbrach die Stille, und er wirbelte mit klopfendem Herzen herum.
Der Kater. Natürlich. Den Kater hatte er ganz vergessen. Er kniete neben dem Bett nieder und spähte darunter. Grüne Augen funkelten in der Dunkelheit.
»Komm, Mieze. Miez-miez-miez«, rief er in schmeichelndem Ton. Der Kater zwinkerte, und Kincaid nahm eine flinke Bewegung wahr, vielleicht das Zucken des Schweifs. »Komm, Mieze. Komm, du Braver.«
Keine Reaktion. Kincaid kam sich wie ein Idiot vor. Er stand auf, klopfte sich den Staub von der Hose und suchte in der Küche, bis er eine Dose Katzenfutter und einen Dosenöffner entdeckte. Er löffelte das widerliche Zeug in eine Schale, die er auf den Boden stellte.
»Okay, Katze. Fressen mußt du selbst. Ich geh jetzt nach Hause schlafen.«
Fast drohte ihn die Erschöpfung zu überwältigen, aber er hatte noch ein paar Dinge zu erledigen. Er warf einen Blick in den Kühlschrank und fand dort zwei noch nahezu volle Ampullen Morphium. Dann zog er den Mülleimer unter der Spüle heraus und durchsuchte die Abfälle. Keine leeren Ampullen.
Jasmines Adreßbuch hatte er schnell gefunden. Es lag ordentlich aufgeräumt in einem Fach ihres Sekretärs. Unter dem Vornamen ihres Bruders waren eine Adresse und eine Telefonnummer in Surrey eingetragen. Er hatte das Büchlein eingesteckt und die Hand schon auf den Türknauf gelegt, als ihm unversehens ein Gedanke kam, der ihn innehalten ließ.
Jasmine war eine sehr methodische Person gewesen. Immer wenn er nach einem seiner Besuche von ihr weggegangen war, hatte er gehört, wie sie hinter ihm das Sicherheitsschloß abgesperrt und die Sicherheitskette vorgelegt hatte. Hätte sie sich ruhig und gelassen zum Sterben niedergelegt, ohne ihre Tür abzusperren? Aus Aufmerksamkeit gegenüber denen vielleicht, die am nächsten Tag kommen würden? Er schüttelte den Kopf. Es wäre ein Leichtes gewesen, durch die Gartentür in die Wohnung zu gelangen. Aber wenn sie eines natürlichen Todes im Schlaf gestorben wäre, so hätte sie am Abend, ehe sie sich zum Schlafen legte, gewiß wie immer abgesperrt.
Die Zweifel ließen ihm keine Ruhe. Er trat in den Hausflur hinaus und zog die Tür heftiger als beabsichtigt hinter sich zu. Und da fiel ihm ein, daß er vergessen hatte, nach einem Schlüssel zu suchen.
3
Die Mittagssonne schien durch die Südfenster von Kincaids Wohnung und machte das Zimmer beinahe unerträglich heiß. Als erstes öffnete er Fenster und Balkontür und legte sein Jackett ab. Er spürte, wie ihm unter den Armen der Schweiß ausbrach und seine Oberlippe feucht wurde. Der Telefonhörer in seiner Hand fühlte sich glitschig an, als er die Nummer des Coroner wählte.
Nachdem er seinen Namen genannte hatte, brachte er sein Anliegen vor und erläuterte die Situation. Ja, die Tote war ins Krankenhaus gebracht worden, da kein Arzt dagewesen sei, der den Totenschein hätte ausstellen können. Nein, zunächst habe er an der Todesursache keine Zweifel gehabt, habe jedoch in der Zwischenzeit etwas erfahren, das seine Zweifel geweckt habe. Ob der Coroner veranlassen könnte, daß eine Obduktion vorgenommen werde? Ja, gewiß, dies sei ein amtlicher Auftrag. Und würde man ihn bitte den Befund sobald wie möglich wissen lassen?
Er dankte und legte auf, befriedigt, daß er die Dinge nun wenigstens ins Rollen gebracht hatte. Der Papierkram konnte bis morgen warten. Unschlüssig stand er da und sah sich wie hilfesuchend in seiner Wohnung um. Ihm graute vor dem Anruf bei Jasmines Bruder.
Das Geschirr mehrerer Tage stapelte sich unordentlich im Spülbecken, Tassen mit verkrusteten Kaffeeresten standen auf dem staubigen Couchtisch, Bücher und Kleider lagen überall herum. Seufzend ließ Kincaid sich in einen Sessel fallen und rieb sich geistesabwesend das Gesicht. Selbst seine Haut fühlte sich schlaff und gummiartig an vor Erschöpfung. Als er sich mit geschlossenen Augen zurücklehnte, spürte er unter seinem Schulterblatt einen harten Druck – Jasmines Adreßbuch, in der Brusttasche seines Jacketts, das er vorhin über die Sessellehne geworfen hatte. Er zog das schmale Buch heraus und sah es sich an. Es paßte zu Jasmine, fand er – smaragdgrünes Leder, in das kleine goldene Drachen geprägt waren, elegant und ein wenig exotisch. Ich muß sie fragen, wo sie das gekauft hat, dachte er und schüttelte den Kopf. Er würde wohl noch eine ganze Weile brauchen, um es zu begreifen.
Die goldgeränderten Seiten des Büchleins flatterten wie Schmetterlingsflügel unter seinen Fingern. Namen, in Jasmines zierlicher Hand geschrieben, sprangen ihm entgegen: Margaret Bellamy, mit einer Adresse in Kilburn; Felicity Howarth, Highgate. Theo fand er unter »T«, nur Vornamen und Telefonnummer.
Er tippte die Nummer ein, langsam, beinahe zögernd. Das wiederholte Summen des Telefons klang fern und dünn, und er war nahe daran aufzugeben, als eine Männerstimme sich meldete. »Kinkerlitzchen.«
»Wie bitte?« sagte Kincaid verblüfft.
»Kinkerlitzchen. Was kann ich für Sie tun?« Diesmal klang die Stimme leicht ungeduldig.
Kincaid faßte sich. »Mr. Dent?«
»Ja. Was kann ich für Sie tun?« Aus der leichten Ungeduld wurde massive Gereiztheit.
»Mr. Dent, mein Name ist Duncan Kincaid. Ich wohne mit Ihrer Schwester Jasmine in einem Haus. Es tut mir leid, Ihnen mitteilen zu müssen, daß sie in der vergangenen Nacht gestorben ist.« Das Schweigen am anderen Ende der Leitung dauerte so lange an, daß Kincaid Zweifel bekam, ob der Mann überhaupt noch am Apparat war. »Mr. Dent?«
»Jasmine? Sind Sie sicher?« Theo Dents Stimme klang verwirrt. »Aber ja, natürlich sind Sie sicher«, fuhr er in etwas festerem Ton fort. »Was für eine idiotische Frage! Aber ich ... ich habe überhaupt nicht damit gerechnet ...«
»Nein, ich glaube, keiner ...«
»War sie ... ich meine, sie hat doch nicht ...«
»Sie wirkte sehr friedlich, Mr. Dent«, sagte Kincaid behutsam. »Aber Sie werden wohl herkommen und sich um die Formalitäten kümmern müssen.«
»Oh, selbstverständlich.« Die Aussicht, tätig werden zu müssen, schien einen Ausbruch zielloser Energie bei ihm auszulösen. »Wo hat man sie ... wo ist sie jetzt? Ich kann erst heute abend weg. Ich muß den Laden zumachen. Ich kann nämlich nicht Auto fahren, wissen Sie. Ich muß den Zug nehmen ...«
Kincaid unterbrach. »Ich kann Sie hier in der Wohnung erwarten, wenn Sie möchten, und Ihnen dann die Einzelheiten berichten.« Er wollte nicht am Telefon erklären, weshalb sich die Beerdigung möglicherweise verzögern würde.
Theo stieß einen hörbaren Seufzer der Erleichterung aus. »Wäre das möglich? Das ist sehr freundlich von Ihnen. Ich nehme den Zug um fünf. Wohnen Sie oben oder unten? Jasmine hat mir nie ...«
»Oben.« Theos Unwissenheit überraschte Kincaid nicht – er selbst hatte schließlich nicht einmal gewußt, daß Jasmine einen Bruder hatte.
Sie legten auf, und Kincaid schloß einen Moment aufatmend die Augen. Das Schlimmste war geschafft. Es war nicht so arg gewesen, wie er erwartet hatte. Jasmines Bruder hatte eher verwirrt gewirkt, als von Schmerz überwältigt. Vielleicht hatten die beiden einander nicht besonders nahegestanden, wenn auch, wie er allmählich herausfand, Jasmines Schweigen zu einem Thema keineswegs als Indikator ihrer Einstellung dazu genommen werden konnte. Zu wirr im Kopf, um klar zu überlegen, trottete er in die Küche und öffnete den Kühlschrank – Eier, eine verschrumpelte Tomate, ein verdächtig aussehendes Stück Käse, einige Dosen Bier. Er öffnete eine der Dosen, trank einen Schluck, verzog das Gesicht, stellte die Dose wieder weg.
Er hatte sein Hemd zur Hälfte aufgeknöpft und stand schon vor der Schlafzimmertür, als es klopfte – scharf, amtlich, zweimal. Kincaid öffnete die Wohnungstür und kniff verdutzt die Augen zusammen. Er sah Major Keith selten in etwas anderem als seiner Gartenmontur, und heute sah er ganz besonders korrekt aus – Tweedanzug mit Regimentskrawatte, blitzblank gewichste Schuhe, einen weichen Filzhut in der Hand. Ein Ausdruck ängstlicher Besorgnis lag auf dem runden Gesicht.
»Major?«
»Ich habe eben mit dem Briefträger gesprochen. Er sagte, er habe heute morgen, als er hier vorbeikam, einen Krankenwagen wegfahren sehen, und ich wollte wissen – als ich eben unten geklopft habe, rührte sich nichts. Es ist ihr doch nichts passiert?«
Ach, du lieber Gott! Kincaid ließ sich schlaff an den Türpfosten fallen. Wie hatte er vergessen können, daß der Major nichts wußte? Und dabei waren die beiden Freunde gewesen, nicht nur oberflächliche Bekannte. Über die gemütlichen Teestunden mit dem Major wenigstens hatte Jasmine gesprochen. »Ich weiß nicht, ob man von ›Unterhaltung‹ sprechen kann«, hatte sie lachend gesagt. »Eigentlich sitzen wir nur in der Sonne wie zwei alte Hunde.« Kincaid riß sich zusammen. »Bitte, kommen Sie doch herein, Major.«
Er führte den Major ins Zimmer und wies vage zu einem Sessel, doch der Mann blieb stehen, blickte ihn an und wartete schweigend. Seine Augen blitzten in einem überraschend intensiven hellen Blau.
»Wollen Sie es mir nicht sagen?« fragte er schließlich.
Kincaid seufzte. »Als heute morgen die Pflegerin kam, machte Jasmine nicht auf. Ich kam zufällig vorbei und habe dann das Schloß mit einer Büroklammer geknackt. Wir fanden sie in ihrem Bett. Sie schien ganz friedlich im Schlaf gestorben zu sein.«
Der Major nickte stumm, und ein Ausdruck flog über sein Gesicht, den Kincaid nicht recht deuten konnte. »Eine gute Frau, trotz ...« Er brach ab und sah Kincaid an. »Aber das spielt jetzt keine Rolle mehr.« Das rollende schottische »R«, das man sonst kaum noch wahrnahm, machte sich stärker bemerkbar. »Dann kümmern Sie sich um alles?«
Wieder, dachte Kincaid seltsam berührt, wurde ihm da eine Vertrautheit mit Jasmine unterstellt, die gar nicht bestanden hatte. »Vorläufig zumindest, ja. Heute abend kommt ihr Bruder.«
Der Major nickte nur und wandte sich wieder zur Tür. »Dann will ich Sie jetzt nicht länger stören.«
»Major?« hielt Kincaid ihn auf, als er schon an der Tür war. »Hat Jasmine Ihnen je von einem Bruder erzählt?«
Der Major, der gerade dabei war, seinen Hut auf das schüttere Haar zu setzen, das sorgsam seitlich gebürstet seinen Schädel bedeckte, drehte sich herum. Nachdenklich zupfte er an seinem grauen Schnauzer. »Äh ... nein, ich kann mich nicht erinnern. Sie hat überhaupt nicht viel geredet. Höchst bemerkenswert für eine Frau.«
Nachdem der Major gegangen war, schloß Kincaid die Tür und lehnte sich an das glatte Holz. Nicht einmal sein übernächtigter Zustand und die Arbeit an einem besonders abscheulichen Fall konnten diese Bleischwere in seinen Gliedern und die Benommenheit in seinem Kopf erklären. Schock, vermutete er, Abwehr von Schmerz.
Er legte die Sicherheitskette vor und nahm im Vorbeigehen den Telefonhörer von der Gabel. Seine Kleider abwerfend, taumelte er ins Schlafzimmer. Fliegen flogen tief brummend zum offenen Fenster herein und wieder hinaus. Ein Sonnenstrahl lag über dem Bett, so greifbar wie ein Stein. Kincaid ließ sich hineinfallen und schlief, noch ehe sein Gesicht das zerknitterte Laken berührte.
Als die Sonne unterging, fiel die Temperatur rasch, und Kincaid erwachte vom kühlen Luftzug auf seiner Haut. Das Stück südlichen Himmels, das er durch das immer noch geöffnete Fenster sehen konnte, war dunkelgrau, mit einem rosaroten Schimmer an den Rändern. Er wälzte sich auf die Seite und sah auf den Wecker, fluchte und sprang aus dem Bett, um zu duschen.
Fünfzehn Minuten später, er war in Jeans und Pullover und kämmte sich gerade das feuchte Haar, klingelte es an der Tür. Alle seine Erwartungen, sich einer männlichen Ausgabe Jasmine Dents gegenüberzusehen, wurden auf einen Schlag zunichte gemacht, als er die Tür öffnete.
»Mr. Kincaid?« Der Mann sprach zögernd, als fürchtete er, zurückgewiesen zu werden.
Kincaid musterte ihn. Er hatte ein ovales, fein gemeißeltes Gesicht, aber hier endete auch schon die Ähnlichkeit mit Jasmine. Theo Dents zierlicher Körper war mit einer extra Schicht Fett gepolstert, das lockige braune Haar umgab seinen Kopf wie ein Heiligenschein, und die Augen hinter den runden Brillengläsern, die an John Lennon erinnerten, waren nicht braun, sondern blau.
»Mr. Dent.« Kincaid bot ihm die Hand, und Theo schüttelte sie einmal kurz. Seine Hand war feucht, und Kincaid hatte den Eindruck, daß sie zitterte. »Haben Sie einen Schlüssel zur Wohnung Ihrer Schwester, Mr. Dent?«
Theo schüttelte den Kopf. »Nein.«
Kincaid überlegte einen Moment. »Dann kommen Sie doch einen Moment herein, während ich mir etwas überlege.« Er ließ Theo Dent auf den Fersen wippend im Flur stehen, während er die Kommodenschublade im Schlafzimmer durchwühlte. Als er noch beim Einbruchsdezernat gearbeitet hatte, hatte einer seiner Stammkunden ihm ein Werkzeug geschenkt, das zu gebrauchen er bisher keine Gelegenheit gehabt hatte.
Er hielt den Ring mit den feinen Drähten hoch, als er ins Wohnzimmer zurückkehrte, und Theo Dent zog fragend die Augenbrauen in die Höhe.
»Ich habe vergessen, nach einem Schlüssel zu sehen, als ich heute mittag ging«, erklärte Kincaid. »Aber damit müßten wir eigentlich hineinkommen.«
»Aber wie ... ich meine, Sie haben sie doch gefunden ...«
»Ja. Ich habe das Schloß heute morgen schon einmal auf weniger elegante Weise geknackt. Mit einer Büroklammer.« Theo Dent fragte nicht, wie Kincaid zu dem Einbrecherwerkzeug kam.
Sie stiegen die Treppe hinunter, und Kincaid hatte das billige Schloß im Nu geöffnet. Als er die Tür aufstieß und zur Seite trat, streifte sein Arm Theos, und er spürte das Zittern des anderen. Er hielt einen Moment inne und legte Theo die Hand auf die Schulter.
»Beruhigen Sie sich. Es ist nicht schlimm. Es gibt nichts zu sehen. Sie müssen nicht einmal hineingehen, wenn Sie nicht möchten. Ich dachte nur, Sie wollten vielleicht ihre Papiere durchsehen.«
Theo sah ihn mit seinen blauen Augen ernsthaft an. »Doch, ich möchte hineingehen. Ich muß. Verzeihen Sie, daß ich so töricht bin.«
Er ging an Kincaid vorbei in die Wohnung seiner Schwester. In der Mitte des Wohnzimmers blieb er mit hängenden Armen stehen. Sein Blick wanderte über die Besitztümer seiner Schwester, die Dinge aus Jade und Messing, die farbenfrohen Seidenteppiche und das ordentlich gerichtete Krankenhausbett, das den meisten Platz in dem Raum beanspruchte.
Zu Kincaids Verwirrung liefen Theo Dent plötzlich die Tränen aus den Augen und rollten unter den runden Brillengläsern hervor ungehindert seine Wangen hinab. Wie er da so inmitten der Besitztümer seiner Schwester stand, wirkte er sowohl mitleiderregend als auch fehl am Platz – das sportlich robuste Jackett, das Hemd mit dem Nadelstreifen, die roten Hosenträger wirkten beinahe wie eine Parodie alles Englischen. Er erinnerte Kincaid an die herausgeputzten Teddybären in den Schaufenstern.