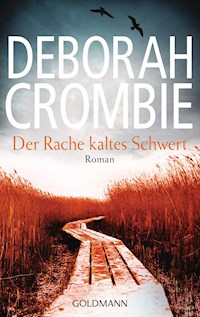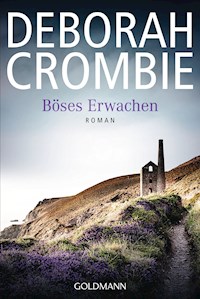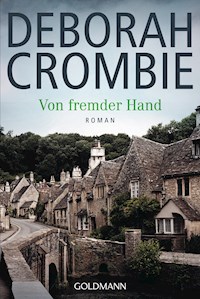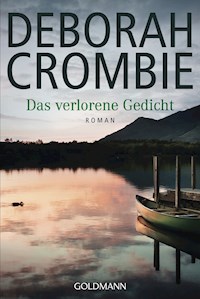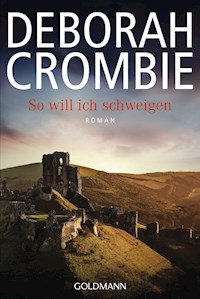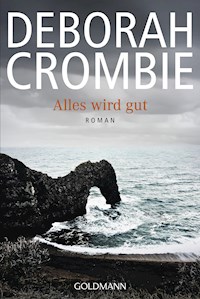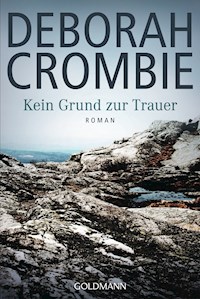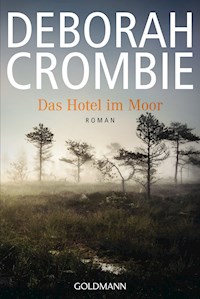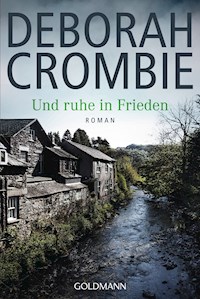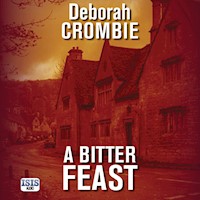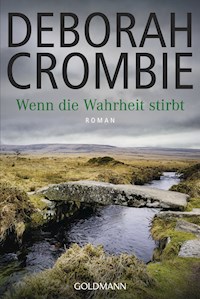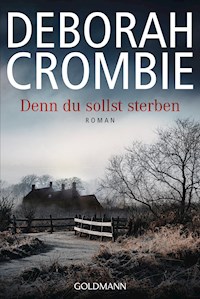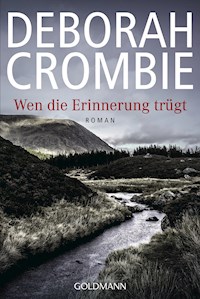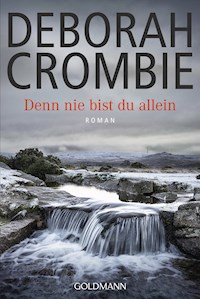10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Kincaid-James-Romane
- Sprache: Deutsch
Manche Geheimnisse können tödlich sein ...
An einem regnerischen Novemberabend wird die junge Ärztin Sasha Johnson mitten auf einem belebten Londoner Platz erstochen. Detective Superintendent Duncan Kincaid übernimmt den Fall und erhält dabei inoffizielle Unterstützung von seiner Frau Inspector Gemma James. Schnell wird klar, dass Sasha nicht in das übliche Opferprofil passt: Die Tochter einer bildungsbürgerlichen Familie hatte keine Missbrauchsvorgeschichte oder Verbindungen zu Gangs. Aber sie hatte gefährliche Geheimnisse. Während Kincaid eine beunruhigende Verbindung zu seinen Freunden Wesley und Betty Howard aus Notting Hill entdeckt, geschieht ein weiterer Messermord. Und Gemma, die undercover ermittelt, gerät in tödliche Gefahr ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 539
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Buch
An einem regnerischen Novemberabend wird die junge Ärztin Sasha Johnson mitten auf einem belebten Londoner Platz erstochen. Detective Superintendent Duncan Kincaid übernimmt den Fall und erhält dabei inoffizielle Unterstützung von seiner Frau Inspector Gemma James. Schnell wird klar, dass Sasha nicht in das übliche Opferprofil passt: Die Tochter einer bildungsbürgerlichen Familie hatte keine Missbrauchsvorgeschichte oder Verbindungen zu Gangs. Aber sie hatte gefährliche Geheimnisse. Während Kincaid eine beunruhigende Verbindung zu seinen Freunden Wesley und Betty Howard aus Notting Hill entdeckt, geschieht ein weiterer Messermord. Und Gemma, die undercover ermittelt, gerät in tödliche Gefahr …
Autorin
Informationen zu Deborah Crombie und den lieferbaren Titeln der Autorin finden Sie am Ende des Buches
Deborah Crombie
Der Unschuldigen Blut
Roman
Aus dem Englischen von Andreas Jäger
Die Originalausgabe erschien 2023 unter dem Titel »A Killing of Innocents« bei William Morrow & Company
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Deutsche Erstveröffentlichung August 2023
Copyright © der Originalausgabe 2023 by Deborah Crombie
Published by arrangement with Deborah Crombie
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur
Thomas Schlück GmbH, 30827 Garbsen.
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2023
by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Covergestaltung: UNO Werbeagentur, München
Covermotiv: FinePic®, München
Gestaltung der Karte: © Laura Hartman Maestro
Redaktion: Eva Wagner
BH · Herstellung: ik
Satz und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN: 978-3-641-22092-1V001
www.goldmann-verlag.de
Für Caroline Todd, Mentorin und liebe Freundin.
Du fehlst so sehr.
Karte
1
Sie stand da und sah auf ihre schlafende Tochter hinunter, auf die feuchten, zerzausten Haarsträhnen, die halb weggestrampelte Bettdecke. Das Kind hatte immer schon einen unruhigen Schlaf gehabt. Aber diese Nächte, verbracht mit Auf-und-ab-Gehen und In-den-Schlaf-Wiegen, waren jetzt zu weit weg – eine Erinnerung, die ihr mehr und mehr entglitt, wie auch die an die warme Last des Babys in ihren Armen. Jetzt verwandelte das schwache Licht, das durch die offene Zimmertür fiel, die Einhörner auf dem zerknitterten Pyjama des Mädchens in Hieroglyphen – als ob die Fabelwesen im diffusen Mondlicht tanzten.
Wie konnte sie es ertragen, ihre kleine Tochter zurückzulassen, und gar für Monate? Aber sie musste es tun, das war ihr klar. Sie musste sie selbst sein, brauchte Platz zum Atmen, Platz zum Nachdenken, um Entscheidungen treffen zu können, frei vom andauernden Druck seines Missfallens.
Sie spürte seine Anwesenheit, noch ehe sie die Schritte auf dem Flur hörte und sein Schatten das Licht in ihrem Rücken verdrängte. Er packte ihre Schultern. »Du gehst nicht.«
Sie drehte sich nicht um, versuchte nicht zusammenzuzucken. »Ich muss. Das weißt du doch. Ich kann helfen …«
»Das ist dein Gottkomplex, mein Schatz«, sagte er leise. »Dein Platz ist hier. Als Mutter. Als Ehefrau.«
»Ja, aber …« Ihr Protest erstarb, als sich seine Finger in das weiche Fleisch ihrer Oberarme bohrten.
Seine Stimme war jetzt ein Flüstern, ein Hauch in ihrem Ohr. »Wenn du das tust, wird es dir noch leidtun. Das garantiere ich dir.«
Duncan Kincaid dehnte seinen von der Schreibtischarbeit verspannten Nacken und trank genüsslich einen Schluck Bier. Das viktorianische Pub in der Lamb’s Conduit Street füllte sich allmählich mit Gästen, angelockt von der Happy Hour am frühen Freitagabend – offenbar überwiegend Krankenhauspersonal, das sich aus dem Great Ormond Street Hospital auf der anderen Straßenseite hierher geflüchtet hatte. Kincaid selbst war auf dem Heimweg vom Polizeirevier Holborn, hatte sich aber mit seinem Detective Sergeant Doug Cullen im Pub verabredet, um sich von der Vernehmung berichten zu lassen, die Doug am Nachmittag in der Theobalds Road durchgeführt hatte. Das Team war noch mit ein paar abschließenden Arbeiten zu einem Fall beschäftigt, einem Raubüberfall auf einen Nachbarschaftsladen, bei dem der Inhaber, ein älterer Asiate, niedergestochen worden war. Die Täter waren bei all ihrer Brutalität offenbar nicht besonders helle – ihre Gesichter hatten sie mit Sturmhauben verdeckt, aber das auffällige Tattoo auf dem Handrücken des Messerstechers vergessen, das auf dem Überwachungsvideo des Ladens zu sehen war. Die beiden hatten ihre magere Beute in Sixpacks Lagerbier investiert, das sie in einem Laden um die Ecke gekauft hatten – diesmal unmaskiert.
Idioten. Es war eines dieser sinnlosen Verbrechen, die Kincaid so satthatte. Er nahm noch einen Schluck aus seinem Pintglas und sah auf die Uhr. Doug verspätete sich. Die junge Frau, die allein am Nebentisch saß, schien Kincaid zu imitieren – mit irritierter Miene sah sie zuerst auf ihre Uhr, dann auf ihr Handy. Trotz des windigen Novemberabends war der Raum warm vom Kaminfeuer, und sie hatte ihren pelzbesetzten Anorak ausgezogen, unter dem OP-Kleidung zum Vorschein kam. Die hellgrüne Farbe des Kittels hob sich von ihrer dunklen Haut und ihrem krausen schwarzen Haar ab. Eine Ärztin, dachte er, da das Pflegepersonal in der Regel Uniform trug, und er korrigierte seine Schätzung ihres Alters um ein paar Jahre nach oben. Als sie ihr Handy wieder in ihrer Handtasche verschwinden ließ, wandte er rasch den Blick ab, weil er merkte, dass er sie angestarrt hatte.
Die Tür in der Nähe des Kamins schwang auf und ließ einen kalten, feuchten Windstoß herein, begleitet von einem Schwall brauner Blätter. Die junge Frau blickte mit erwartungsvoller Miene auf, doch es war Doug Cullen, sein Anorak und die hellen Haare feucht glänzend, die Wangen rosig von der Kälte. Ohne sie eines Blickes zu würdigen, ließ Doug sich auf den Stuhl gegenüber von Kincaid sinken und nahm seine mit Tropfen gesprenkelte Brille ab.
»Was für ein Tag«, stöhnte er, während er die Brillengläser mit einem Taschentuch abtrocknete. Er deutete mit einem Nicken auf Kincaids Glas. »Was immer du da trinkst, so eins könnte ich auch gebrauchen.«
»Bloomsbury IPA. Die Runde geht auf mich«, erwiderte Kincaid und stand auf. Während er sich einen Weg durch das Gedränge zum Tresen bahnte, sah er, wie die junge Frau ihre Sachen zusammenzusuchen begann. Als er sich wenige Minuten später mit den Biergläsern in der Hand umdrehte, war sie verschwunden.
Sie hielt inne, die einladende Wärme des Pubs im Rücken. Noch einmal sah sie auf ihr Handy, dann schrieb sie eine kurze Textnachricht.
Sie drehte sich um und warf einen letzten Blick hinein. Der gut aussehende Weiße, der sie so interessiert gemustert hatte, stand am Tresen. Auch ohne das blaue Umhängeband, das aus seiner Anzugjacke hervorschaute, hätte sie ihm den Polizisten angesehen. Und verheiratet war er auch – sie hatte den Ring an seiner linken Hand aufblitzen sehen. War ja klar, dachte sie und verzog das Gesicht. Dann drehte sie sich von dem erleuchteten Fenster weg, überquerte die Straße, hüllte sich fest in ihre Jacke und ging nach Norden.
Als sie in die Guilford Street einbog, signalisierte ihr Handy eine Antwort. Treffpunkt wie immer? Gib mir 15 Min, OK?
Nachdem sie mit einem Daumen-hoch-Emoji geantwortet hatte, steckte sie ihr Handy wieder ein und beschleunigte ihre Schritte. Sie könnte gerade rechtzeitig im Café sein, wenn sie die Abkürzung über den Russell Square nahm. Am Fitzroy Hotel angekommen, lief sie um die Ecke und betrat die Grünanlage von der Nordecke.
Inzwischen war es völlig dunkel, die Illumination des Springbrunnens verdeckt von den Scharen von Menschen, die mit gesenkten Köpfen von der Arbeit nach Hause eilten. Ein Frösteln überlief sie, und sie dachte an die Sommerabende zurück, an denen sie sich im Gras ausgestreckt oder auf der Terrasse des Caffè Tropea einen Wein genossen hatte. Wie um sie zu verhöhnen, schleuderte ihr eine Windbö Wassertropfen von den Bäumen am Wegrand ins Gesicht.
Ein Radfahrer raste an ihr vorbei, so dicht, dass sie den Luftzug spürte. Sie fuhr herum und wollte ihn anschreien, doch er war bereits verschwunden. Alles rücksichtslose Spinner, diese Radfahrer – und sie hatte weiß Gott schon genug von dieser Sorte in der Notaufnahme zusammenflicken müssen.
Als sie weitergehen wollte, rammte jemand sie heftig von vorne und packte sie an der Schulter, als sie von der Wucht des Zusammenstoßes wankte. Ehe sie protestieren konnte, war die dunkle, schattenhafte Gestalt schon wieder verschwunden, ebenso schnell in der Menge untergetaucht wie der Radfahrer.
Ihr Herz machte einen eigenartigen kleinen Hüpfer. »Was zum …«, flüsterte sie, doch die Worte erstarben in ihrer Kehle. Dann verschwammen die Ränder ihres Gesichtsfelds, und sie brach zusammen.
»Mummy.« Trevor zupfte am Saum ihrer Jacke.
Lesley Banks seufzte genervt und fixierte weiter das Display ihres Handys. »Also wirklich, Trev«, fuhr sie ihn an, »kannst du dich nicht mal eine Minute lang mit dir selbst beschäftigen? Du bist doch jetzt ein großer Junge.« Eine Angestellte des Hotels hatte ihr gerade eine Nachricht geschickt, dass sie nicht zur Abendschicht kommen könne, und Lesley musste das sofort regeln. Der Weg quer durch die Grünanlage war das einzige Stück, wo sie ihren fünfjährigen Sohn nicht permanent im Blick – und an der Hand – behalten musste.
»Aber Mummy …«
»Trev, schau dir doch einfach den hübschen Brunnen an, okay?«, unterbrach sie ihn, während sie sich durch ihre Kontakte scrollte auf der Suche nach jemandem, der bereit wäre, kurzfristig einzuspringen.
»Mummy.« Trevor zerrte jetzt noch hartnäckiger an ihrer Jacke. Etwas in seiner Stimme veranlasste sie, den Blick vom Display zu wenden. »Mummy, ich glaub, die Frau da ist krank.«
»Welche Frau meinst du, Schatz?«
Trevor zeigte darauf. »Die Frau da drüben, bei dem Baum.«
Lesley konnte eine dunkle Silhouette unter den Bäumen ausmachen, gerade außerhalb des Bereichs, der von der Brunnenillumination erhellt wurde. Sie schüttelte den Kopf. »Das geht uns nichts an, Schatz.«
»Aber Mummy.« Trevor scharrte mit den Füßen im Laub. »Sie ist so komisch gegangen. Und dann ist sie hingefallen.«
»Hör mal, Liebling, die Frau hat wahrscheinlich einfach nur ein bisschen zu viel …« Lesley brach ab. Warum brachte man den Kindern bei, freundlich und hilfsbereit zu sein, wenn man dann selbst nicht dazu bereit war? Mit einem Seufzer steckte sie ihr Handy ein und ergriff Trevors Hand. »Okay, dann lass uns mal nachsehen.« Sie trat ein paar Schritte näher und rief: »Miss? Ist alles in Ordnung, Miss?«
Die Gestalt rührte sich nicht. Lesleys Augen hatten sich inzwischen an die Dunkelheit gewöhnt, und sie konnte Beine erkennen, die Umrisse eines Stiefels. Sie zögerte. Diese Reglosigkeit hatte etwas an sich, das ihr ungut vorkam. Selbst Betrunkene waren normalerweise noch irgendwie ansprechbar. Sie blickte sich um in der jähen Hoffnung auf Unterstützung durch andere hilfsbereite Passanten, doch die Menge hatte sich zerstreut, während sie gezaudert hatte.
Sie könnte natürlich den Notruf wählen, aber sie würde ganz schön dumm dastehen, wenn sich herausstellte, dass es nur eine Obdachlose war, die hier ihren Vollrausch ausschlief. Und wenn die Frau wirklich krank war – nun, Lesley hatte einen Erste-Hilfe-Kurs absolviert, das war ja heutzutage im Hotelgeschäft unabdingbar.
Sie ließ Trevors Hand los, schob ihn hinter sich und sagte: »Du bleibst schön da, Schatz, während Mummy nach der Frau sieht.« Sie holte noch einmal tief Luft, ging die letzten Schritte auf die Liegende zu und ließ sich in die Hocke fallen. »Miss«, sagte sie.
Als keine Antwort kam, legte Lesley vorsichtig eine Hand auf die Schulter der Frau und schüttelte sie sanft. Der Körper, schlaff wie eine Stoffpuppe, rollte auf den Rücken, ein Arm streifte im Fallen Lesleys Knie.
Lesley prallte zurück und hielt sich die Hand vor den Mund. »O Gott«, keuchte sie. Hinter ihr fing Trevor an zu weinen.
2
Lesley registrierte, dass ihr Sohn weinte und die ersten Passanten stehen blieben, doch sie konnte den Blick nicht vom Gesicht der jungen Frau wenden. Ihre Züge waren völlig entspannt, die Augen starrten blicklos in den Himmel. Lesley streckte zögernd die Hand aus und tastete am Hals der Frau nach einem Puls. Nichts. Aber es waren keine fünf Minuten vergangen, seit sie zusammengebrochen war. Vielleicht war es noch nicht zu spät. Lesley schluckte, um gegen das Pochen des Bluts in ihren Ohren anzukämpfen, und sah sich um. »Erste Hilfe«, sagte sie, aber es kam nur ein heiseres Flüstern heraus. Sie versuchte es noch einmal. »Kann jemand Erste Hilfe?«
Hinter Lesley stand ein Paar unschlüssig herum. Beide schüttelten den Kopf, und die Frau wich einen Schritt zurück, ihre Miene verängstigt.
Trevor hatte sich inzwischen wieder beruhigt und kam zögernd auf sie zu. »Trev«, sagte Lesley so ruhig, wie sie nur konnte. »Bleib hinter Mummy, okay? Ich helfe der Frau.« An das Paar gewandt, fügte sie hinzu: »Rufen Sie einen Rettungswagen. Sie sollen sich beeilen.«
Der Anruf kam, als Kincaid und Doug gerade ihre Jacken anzogen und sich für den kurzen Fußmarsch durch Wind und Regen zurück zum Revier Holborn wappneten. Kincaid ahnte nichts Gutes, als er den Namen auf dem Display sah – Simon Gikas, der fähige Fallmanager seines Teams. Hoffentlich ging es nur um Papierkram. Er hatte Gemma versprochen, dass er noch das Ende von Tobys Ballettprobe mitbekommen würde.
»Simon, was gibt’s?«, fragte er, während er, gefolgt von Doug, hinaus auf den Gehsteig trat.
»Chef, ich war mir nicht sicher, ob Sie für heute schon weg sind. Aber wir haben was reingekriegt – eine Messerattacke am Russell Square. Ich dachte, das würden Sie vielleicht gerne selbst übernehmen.«
»Gibt es Todesopfer?«
»Ja. Eine junge Frau, in der Nähe des Cafés. Eine Passantin dachte, sie wäre vielleicht krank, und versuchte zu helfen.«
»Verdammt«, murmelte Kincaid. Doug sah ihn fragend an.
»Chef, ich kann es auch weiterleiten …«
»Nein, nein, das haben Sie ganz richtig gemacht, Simon. Wo ist Sidana?« Detective Inspector Jasmine Sidana war seine Stellvertreterin.
»Ist unterwegs. Sie war schon auf dem Heimweg, also wird sie vielleicht ein paar Minuten brauchen. Ich rufe gleich noch Cullen …«
»Nicht nötig. Er ist bei mir. Wir sind ganz in der Nähe, in der Lamb’s Conduit.«
»Soll ich einen Wagen schicken?«
Kincaid überlegte. Es war nur ein kurzer Fußweg, aber mit dem Auto wären sie dennoch schneller. »Ja. Sie sollen am Revier auf uns warten. Sorgen Sie dafür, dass die Uniformierten beide Eingänge der Grünanlage abriegeln, ja?« Nachdem er aufgelegt hatte, fing er Doug Cullens fragenden Blick auf. »Sieht aus, als hätten wir einen Mord am Hals.«
Der Wagen setzte sie an der Nordecke des Platzes ab, die dem Caffè Tropea am nächsten war. Das flackernde Blaulicht der Einsatzfahrzeuge erhellte die reich verzierte Fassade des Fitzroy Hotels und tauchte die feucht glänzenden Blätter der Bäume am Rand der Grünanlage in einen unheimlichen Schein. Nachdem Kincaid dem Fahrer gedankt hatte und ausgestiegen war, betrachtete er einen Augenblick lang die Szenerie. Die beiden Constables, die das eilig gespannte Absperrband am Eingang bewachten, hatten alle Hände voll zu tun, um die abendlichen Pendler abzuwimmeln. Kincaid zeigte einer der Beamtinnen seinen Dienstausweis.
»Sir«, sagte sie, augenscheinlich erleichtert, ihn zu sehen.
»Haben die Leute Ihnen Ärger gemacht?«, fragte er.
»Nicht mehr als üblich. Manche sind neugierig, und manche wollen nur nach Hause, und das hier ist ihre gewohnte Strecke.«
»Verstärkung?«
»Ist unterwegs, Sir.«
»Gut. Falls irgendjemand etwas beobachtet hat, notieren Sie sich Namen und Adressen. Und geben Sie die Anweisungen an den anderen Eingang weiter, ja?«
»Ja, Sir.« Sie trat zur Seite und drückte die Sprechtaste ihres Schultermikrofons, während Kincaid und Cullen unter dem Absperrband hindurchschlüpften.
Sie folgten dem zentralen Weg, vorbei am Tropea, dessen große Fenster immer noch hell erleuchtet waren. Die Terrasse war allerdings leer, die Stühle nach vorne gekippt und gegen die regennassen Tische gelehnt. Ein einsamer Raucher stand mit hochgezogenen Schultern unter der Markise, das Handy am Ohr.
Als sie am Springbrunnen ankamen, erblickte Kincaid einen kleinen Menschenauflauf am Wegrand. Zwei uniformierte Beamte hielten die Schaulustigen von der Besatzung des Rettungswagens in ihren gelb-grünen Warnjacken fern. Hinter den Sanitätern konnte Kincaid eine dunkle Silhouette am Fuß eines Baums ausmachen.
Nachdem sie sich gegenüber den Constables ausgewiesen hatten, ging Kincaid auf die Sanitäter zu. »Ich bin Detective Superintendent Kincaid«, sagte er, »und das ist Detective Sergeant Cullen, CID Holborn.«
»Chris Burns.« Der ältere der beiden Männer begrüßte sie mit einem Nicken. »Das ist mein Partner, John Ho.«
»Könnten Sie mich kurz aufklären, womit wir es hier zu tun haben?«, fragte Kincaid.
»Weibliche Person, schätzungsweise Mitte bis Ende zwanzig. Eine Stichwunde in der Brust. Ich vermute, dass die Aorta verletzt wurde. Aber das wird der Rechtsmediziner Ihnen sagen können. Eine Passantin« – er deutete mit dem Kopf auf eine Frau, die etwas abseits der anderen Schaulustigen stand, mit einem kleinen Jungen an ihrer Seite – »hat sie fallen sehen und sie zu reanimieren versucht, aber ohne Erfolg. Und wir konnten auch nur noch den Tod feststellen.«
»Sie trägt übrigens OP-Kleidung«, warf Ho ein. »Und sie hat einen Coram-Dienstausweis bei sich.« Das Coram war das kleine Krankenhaus in der Guilford Street, ganz in der Nähe des Great Ormond Street Hospital.
Kincaid beschlich ein ungutes Gefühl. Stirnrunzelnd schaltete er die Taschenlampe seines Handys ein und trat zu der Toten. Sie lag auf dem Rücken, die Jacke, die sie über dem hellgrünen OP-Kittel trug, war offen. Ihr Gesicht war leicht abgewandt, doch er erkannte sie sofort wieder.
»O Mann«, murmelte er und trat zurück, wobei er beinahe Doug auf die Zehen gestiegen wäre.
»Was ist?« Doug trat näher an die Leiche, und Kincaid hörte, wie er die Luft zwischen den Zähnen ausstieß. »Scheiße. Ist das nicht die junge Frau aus dem Pub?«
»Ich fürchte, sie ist es.« Kincaid hockte sich in das feuchte Gras und musterte die Tote. »Und es kann doch höchstens eine Viertelstunde nach ihrem Aufbruch passiert sein, nicht wahr? Sie muss direkt hierhergegangen sein.« Es wollte ihm nicht in den Kopf, dass diese junge Frau hier im Sterben gelegen hatte, während sie noch bei ihrem Bier gesessen hatten.
»Wer macht so etwas? Nach Bandenkriminalität sieht es ja nicht aus, oder?«
Kincaid zog ein paar Nitrilhandschuhe aus der Jackentasche und streifte sie über. Der Ausweis der Frau war zur Seite geschoben worden, als die Sanitäter ihren Kittel aufgeschnitten hatten. Vorsichtig hob er ihn an einer Ecke hoch und studierte ihn. Ihr Gesicht blickte ihn von dem Foto an, die Mundwinkel zu einem freundlichen Lächeln hochgezogen. »Sasha«, sagte er leise. »Ihr Name ist Sasha Johnson. SpR.« Er blickte zu Chris Burns auf, dem Sanitäter, der inzwischen zu ihnen getreten war. »Was heißt das?«
»Speciality registrar. Das heißt, dass sie Assistenzärztin in der Facharztausbildung war.«
Dann habe ich also richtig geraten, dachte Kincaid, ohne darüber Befriedigung zu empfinden. Er richtete den Strahl seiner Taschenlampe auf den Brustkorb der Frau. Die Wunde war kaum zu erkennen. »Viel Blut sehe ich nicht.«
»Nein«, bestätigte Burns. »Die Blutung dürfte hauptsächlich innerlich gewesen sein.«
Als Kincaid sich mit einem Seufzer wieder aufrichtete, meldete sein Handy den Eingang einer Textnachricht von Simon Gikas.
Rashid Kaleem ist unterwegs.
»Wir haben Glück«, sagte Kincaid an Doug gewandt. »Simon hat Rashid erwischt.« Der junge Rechtsmediziner war nach Kincaids Ansicht der beste in ganz London, nachdem Kincaids Freundin Kate Ling aus dem Dienst ausgeschieden war. Kincaid hatte Kaleem vor etwa über einem Jahr bei einer Ermittlung im East End kennengelernt. Das war der Fall gewesen, durch den Kincaid und Gemma zu ihrer Pflegetochter Charlotte gekommen waren.
Kincaid dankte den Sanitätern und wandte sich dann an Doug. »Frag nach, ob die Spurensicherung schon unterwegs ist, und lass den Tatort absperren. Ich will mich noch kurz mit unserer barmherzigen Samariterin unterhalten, damit wir sie gehen lassen können.« Der kleine Junge hatte angefangen zu quengeln und an der Hand seiner Mutter zu ziehen. »Und wo zum Teufel bleibt Sidana? Kümmer dich drum, ja?«, warf er Doug im Weggehen zu.
Die Zeugin blickte auf und drückte ihren Sohn an sich. Sie war weiß, von schlanker Gestalt, mit mausblonden, aus der hohen Stirn zurückgebundenen Haaren. »Ich bin Detective Superintendent Kincaid«, stellte er sich vor und streckte die Hand aus. Ihre Finger fühlten sich eiskalt an, ihr Gesicht war blass und vor Kälte verkniffen.
»Lesley Banks«, erwiderte sie. »Und das ist Trevor.« Die Haare des Jungen waren glatt und weißblond wie die von Toby, aber er schien eher in Charlottes Alter zu sein.
Kincaid beugte sich zu dem Kind hinunter. »Hallo, Trevor. Das ist ja ganz toll, wie du auf deine Mum aufpasst. Du bist bestimmt schon« – Kincaid tat so, als ob er überlegte – »sechs.«
»Nein, ich bin fünf!«, rief Trevor. Er reckte die Brust und musterte Kincaid interessiert. »Also eigentlich fünfeinhalb. Bist du Polizist?«
»Genau. Und ich möchte, dass du und deine Mum mir erzählt, was mit der Frau dort passiert ist.«
»Mummy sagt, sie ist tot«, antwortete Trevor. »Unser Wellensittich ist auch gestorben. Der ist in seinem Käfig umgefallen. Die Frau ist auch umgefallen.«
»Hast du gesehen, wie sie umgefallen ist?«, fragte Kincaid mit einem raschen Blick zur Mutter des Jungen.
Trevor nickte. »Sie ist so komisch gegangen. Und dann ist sie hingefallen. Ich hab’s Mummy gesagt.«
»Du bist sehr aufmerksam, Trevor. Hast …«
»Ich hab Mummy gesagt, dass die Frau krank aussieht. Aber Mummy hat gemeint, sie hätte bloß zu viel …«
»Sei still, Trev«, unterbrach ihn Lesley Banks. Sie wirkte verlegen und zuckte entschuldigend mit den Schultern. »Na ja, das ist doch das Erste, woran man denkt. Aber Trev sagte, sie sei plötzlich zusammengebrochen, und da dachte ich, ich sehe besser mal nach.« Sie schauderte. »Aber sie war nicht mehr ansprechbar. Ich konnte keinen Puls fühlen.«
»Und da haben Sie mit der Wiederbelebung begonnen?«
Lesley nickte. »Ich habe eine Erste-Hilfe-Ausbildung absolviert. Ich führe ein Hotel, da muss man auf so etwas vorbereitet sein.«
»Wer hat den Notruf abgesetzt?«
»Ich weiß es nicht genau. Ich habe einfach nur geschrien, dass jemand anrufen soll. Es kam mir wie eine Ewigkeit vor, bis sie endlich da waren, aber ich habe mit der Herzdruckmassage weitergemacht.«
»Du hast gezählt, Mummy«, warf Trevor eifrig ein.
»Ja, das habe ich.« Sie drückte ihn an sich. »Und du warst sehr tapfer.«
Kincaid beugte sich wieder zu dem Jungen hinunter. »Trevor, ich möchte, dass du jetzt ganz doll nachdenkst, okay? Du hast gesagt, die Frau wäre ganz plötzlich hingefallen. Hast du davor irgendjemanden bei ihr gesehen?«
Trevor zog die Stirn in Falten. »Da waren ganz viele Leute. Die sind alle ganz schnell gegangen. Ich glaub, da war ein Mann, der sie angerempelt hat.«
»Und danach ist sie hingefallen?«
Trevor nickte.
»Kannst du mir sagen, wie der Mann ausgesehen hat?«
Der Junge sah zu seiner Mutter auf.
»Na los, Schatz«, forderte sie ihn auf. »Erzähl Mr Kincaid, was du mir erzählt hast.«
»Er hatte eine Kapuze.«
»Du meinst so was wie ein Hoodie?«, fragte Kincaid. »Ein Sweatshirt?«
Trevor schüttelte den Kopf, und die blonden Strähnen fielen ihm in die Stirn. »Nein. Es war eine dicke Jacke. So wie meine, aber größer.« Er deutete auf seinen gewöhnlichen Winter-Anorak.
»War der blau, so wie deiner?«
»Nein … Ich weiß nicht. Es war zu dunkel.« Trevors Stimme zitterte ein wenig.
»Noch eine letzte Frage, okay, Trevor? Hast du gesehen, in welche Richtung der Mann gegangen ist, nachdem er die Frau angerempelt hat?«
»Da lang.« Ohne zu zögern deutete Trevor zum Nordeingang der Grünanlage.
»Danke, mein Junge. Du hast uns sehr geholfen.« Kincaid wandte sich wieder an Lesley Banks. »Haben Sie den Mann auch gesehen?«
Lesley seufzte. »Nein, ich war mit meinem Handy beschäftigt. Ein Problem in der Arbeit. Trev hat sich gelangweilt, und er beobachtet viel, wenn ihm langweilig ist. Und« – sie hielt inne, dann zuckte sie mit den Schultern – »er hat eine lebhafte Fantasie. Deswegen habe ich zuerst nicht geglaubt, dass etwas nicht in Ordnung ist. Wenn ich schneller gewesen wäre …«
»Ich glaube nicht, dass Sie irgendetwas hätten tun können«, versicherte Kincaid ihr.
Mit einem Seitenblick zu ihrem Sohn sagte sie leise: »Ich habe die Sanitäter sagen hören, sie sei« – sie formte das Wort tonlos mit den Lippen – »erstochen worden. Stimmt das?« Sie drückte Trevor fester an sich, während sie sich in der inzwischen fast menschenleeren Grünanlage umblickte. »Ich hätte nie gedacht, dass man hier nicht sicher ist.«
»Ich verspreche Ihnen, wir werden unser Bestes tun, um herauszufinden, was passiert ist. Wenn Sie meinem Sergeant Ihre Kontaktdaten geben, wird sich jemand bei Ihnen melden, um Ihre Aussage zu Protokoll zu nehmen. Und sollte Ihnen noch irgendetwas einfallen, zögern Sie nicht, mich anzurufen.« Er drückte ihr seine Karte in die Hand. Bevor er sich abwandte, berührte er sie noch leicht am Arm. »Und danke, dass Sie versucht haben, zu helfen. Nicht jeder wäre stehen geblieben.«
Gemma James hockte auf dem Fußboden im Tabernacle Community Centre in Notting Hill und sah zu, wie ein halbes Dutzend Kinder mit überdimensionalen Mäuseköpfen auf der Tanzfläche umherhüpften. Die Jungs trugen allesamt identische weiße T-Shirts und schwarze Leggings, aber obwohl sein Gesicht von dem ein wenig mottenzerfressenen Mäusekopf verdeckt war, hätte sie ihren siebenjährigen Sohn Toby auch unter hundert kleinen Tänzern erkannt. Seine Bewegungen waren einfach einen Deut präziser, sein ganzes Auftreten einfach unverwechselbar.
Die Ballettschule hatte schon vor einem Monat mit den Proben für die Weihnachtsproduktion des Nussknackers begonnen, aber an diesem Abend probierten die Kinder die Szene mit der Schlacht zwischen der Mäusearmee und den Spielzeugsoldaten zum ersten Mal in ihren sperrigen Kostümen. Es hatte verpasste Einsätze gegeben, Tränen waren geflossen, und etliche der kleinen Mäuse waren ineinandergerannt.
Gemma war schon vor langer Zeit zu dem Schluss gekommen, dass Mr Charles, der Ballettmeister, mit der Geduld eines Heiligen gesegnet war. Er tanzte die Rolle des Herrn Drosselmeier und führte zugleich Regie, und dennoch schien ihn nichts aus der Ruhe zu bringen. Sie wünschte, sie hätte nur etwas von seiner Gelassenheit, während sie ihren schmerzenden Rücken an der Wand des Probenraums streckte. Ihre Beine waren eingeschlafen, und wenn sie nicht bald aufstand, würde sie sie gar nicht mehr bewegen können. Die wenigen anderen Eltern, die vom Rand aus zuschauten, wirkten genauso unruhig. Und wo zum Teufel blieb eigentlich Duncan?
Er hatte versprochen, zu kommen, um Tobys ersten Auftritt mit dem Mäusekopf mitzuerleben. Toby tanzte auch in der Weihnachtsfeier-Szene, die das Ballett eröffnete, aber in seinen Augen war das bei Weitem nicht so spannend, wie im Mäusekostüm mit einem Plastikschwert herumfuchteln zu können. Er war die jüngste Maus und verdankte die Rolle nur den rapiden Fortschritten, die er in der kurzen Zeit seit seinem Eintritt in die Ballettschule gemacht hatte. Mr Charles sagte, Toby sei ein Naturtalent, und Gemmas Gefühle angesichts des potenziellen Talents ihres Sohnes schwankten heftig zwischen Stolz und Besorgnis. Sie hatte eine Vorstellung davon, welche Opfer es verlangte, sich ernsthaft dem Tanzen zu widmen, denn sie sah es an Tobys Mitschüler Jess Cusick. Jess war ein paar Jahre älter als Toby und tanzte die Rolle des Fritz, des ungezogenen Sohns der Stahlbaums, aber Gemma wusste, dass er sich in den Kopf gesetzt hatte, in der nächsten oder übernächsten Saison den Nussknacker-Prinzen zu tanzen.
Die Tür des Probenraums öffnete sich einen Spaltbreit, das Knarren übertönt von den wuchtigen Klängen des Klaviers, und Gemmas Freundin MacKenzie Williams schlüpfte herein. Sie trug Ballett-Leggings und ein XXL-T-Shirt und wirkte wesentlich gelenkiger, als Gemma sich fühlte, als sie sich neben ihr auf den Boden sinken ließ.
»Wie läuft es?«, flüsterte sie.
»Schier endlos«, antwortete Gemma und rollte die Augen, doch sie grinste dabei. MacKenzies gute Laune war ansteckend. Und sie besaß auch mehr Überredungskunst als irgendein Mensch, den Gemma kannte, aber nicht einmal MacKenzie in Hochform hatte Gemma dazu bringen können, eine der erwachsenen Gäste in der Eröffnungsszene zu tanzen. MacKenzie selbst war niemand anderes als Frau Stahlbaum, Klaras und Fritz’ elegante Mutter, und sie hatte ihren Mann Bill dazu überredet, die Rolle des Herrn Stahlbaum zu übernehmen.
»Hast du Kit und Charlotte gesehen?«, fragte Gemma.
»Im Café. Kit hilft Stephanie mit den Hausaufgaben.«
»Aber natürlich.« Dass Kit neuerdings ganz freiwillig zu den Proben kam, hatte wenig mit seinem Interesse an der Inszenierung zu tun, dafür umso mehr mit der hübschen fünfzehnjährigen Ballerina, die die Klara tanzte.
Auf der Tanzfläche näherte sich die Szene dem Ende. Die von den Spielzeugsoldaten besiegten Mäuse fielen dramatisch zu Boden und strampelten mit den Füßen in der Luft, während sie den Geist aufgaben. Gemma sah noch einmal auf ihr Handy – immer noch nichts von Duncan. Nun ja. Nur gut, dass wenigstens sie es geschafft hatte, sich früher loszueisen.
Ihr neuer Job, bei dem es um die Erfassung und Analyse von Messerkriminalität im Großraum London ging, hatte sich anfangs noch spannend angehört, doch bald schon hatte sie feststellen müssen, dass er hauptsächlich in langen, geisttötenden Stunden an einem Computerterminal im neuen Präsidium der Met bestand, verbracht mit dem Studium von Polizeiberichten.
Gemma vermisste das CID-Team in Brixton und die konkrete Ermittlungsarbeit vor Ort. Aber am meisten fehlte ihr die unkomplizierte Kameradschaftlichkeit, die sie erlebt hatte, wenn sie mit ihrer Freundin Melody an einem Fall arbeitete. Neuerdings redete Melody kaum noch mit ihr, und es war auffällig, wie sie immer gerade dann verschwand, wenn es Zeit für die Mittags- oder Teepause war. Gemma vermutete, dass es mit der spektakulären Trennung von ihrem Freund während eines Kurzurlaubs im September zu tun hatte. Jedes Mal, wenn Gemma glaubte, sie könnte vielleicht einmal nachfragen, fand Melody wieder irgendeine Ausrede.
Gemma musste laut geseufzt haben, denn MacKenzie warf ihr einen besorgten Blick zu. »Ist alles in Ordnung?«
»Ich denke bloß über die Arbeit nach.«
MacKenzie schüttelte den Kopf. »Wohl eher darüber, wie du Duncan den Kopf waschen wirst, vermute ich mal. Ob Toby wohl sehr enttäuscht sein wird?«
»Ach was.« Gemma zuckte mit den Schultern. »Er ist ein Polizistenkind, die sind so etwas gewohnt. Außerdem habe ich ein Video gemacht.«
Gerade als Mr Charles in die Hände klatschte und rief: »Noch einmal alle auf ihre Plätze, bitte!«, vibrierte Gemmas Handy und zeigte den Eingang einer Textnachricht an. Es war Duncan, aber er entschuldigte sich nicht für die Verspätung.
Ich hab was für dich. Russell Square, falls du es einrichten kannst.
Als Melody Talbot die Kühlschranktür öffnete und in die gähnende Leere starrte, fragte sie sich, wie sie es geschafft hatte, ihr Leben derart zu verpfuschen. Ein Bild des Jammers bot sich ihr: ein vertrocknetes Stück Käse, ein Becher Karottensalat von Marks & Spencer, auf dem anscheinend schon Schimmel wuchs, ein Ei sowie ein Glas kristallisierte Orangenmarmelade. Es war armselig. Nicht einmal Jamie Oliver könnte daraus eine Mahlzeit zaubern.
Und sie selbst war auch armselig. Allein zu Hause – wieder mal – an einem Freitagabend, dessen einziger Höhepunkt ein Date mit Deliveroo sein würde.
Noch vor zwei Monaten hatte sie einen Freund gehabt, ein akzeptables Sozialleben und einen Job, der ihr Spaß machte. Auch wenn ihr Freund wieder mal mit seiner Gitarre auf Tournee war, hatte sie sich auf Telefonate und Videochats freuen können. Heute aber lockte nichts außer einer ungeöffneten Flasche Billigwein auf der Arbeitsplatte, und sie wusste jetzt schon, dass sie es bereuen würde, den Abend in dieser Gesellschaft zu verbringen.
Melody wusste, dass sie selbst für den Bruch mit Andy Monahan verantwortlich war. Sie war grundlos eifersüchtig gewesen, und, was noch schlimmer war, unehrlich. Dass es sich um eine Unterlassungssünde handelte, machte es nicht weniger fatal. Als sie Andy kennengelernt hatte, war es ihr nicht wichtig erschienen, ihm zu sagen, wer ihre Eltern waren. Dass ihr Vater der Herausgeber einer großen überregionalen Tageszeitung war – die zudem ihrer Mutter gehörte –, hatte sie schließlich noch nie freiwillig hinausposaunt. Doch je länger sie das Geständnis vor sich herschob, desto schwieriger wurde es, und als Andy endlich die Wahrheit erfahren hatte, war er ausgerastet.
Sie trat ans Erkerfenster und blickte auf die Portobello Road hinunter. Ihre Wohnung war an der Rückseite eines Apartmentblocks mit der Front zur Kensington Park Road, die parallel zur Portobello Road verlief. An Markttagen, wenn der Lärm der Menschenmengen schon bei Tagesanbruch einsetzte, wurden die Nachteile der Lage unangenehm deutlich, aber an diesem Abend war die Straße menschenleer und still, der Schein der Straßenlaternen vom dichten Nebel gedämpft. Sie sollte ihre Jacke anziehen und rausgehen. Zum Sun in Splendour waren es nur ein paar Schritte. Fish and Chips, ein Glas spritziger Weißwein – schon würde es ihr besser gehen. Aber der Gedanke, sich als offensichtliche Außenseiterin mit den Grüppchen und Pärchen um einen Einzeltisch zu rangeln, schreckte sie ab.
Plötzlich hatte sie eine bessere Idee.
Sie schnappte ihr Handy vom Couchtisch, wählte Doug Cullens Nummer aus und tippte auf den Anrufbutton. Es läutete und läutete. Als sie schon dachte, der Anruf würde auf die Mailbox gehen, meldete sich Doug endlich. Er klang außer Atem.
»Hallo? Melody? Geht’s dir gut?«
»Klar geht’s mir gut. Was sollte mir denn fehlen?«
»Ich habe seit Wochen nichts von dir gehört, und du hast meine Anrufe ignoriert. Deswegen frage ich.« Doug klang ziemlich gereizt.
»Ich war beschäftigt«, sagte sie. Aber er musste wissen, dass das gelogen war, denn Duncan hatte ihm bestimmt erzählt, dass sie und Gemma die ganze Zeit im Met-Präsidium hockten wie die Zombies und langweiligen Papierkram abarbeiteten. »Hör mal, es ist Freitagabend. Ich dachte, wir könnten vielleicht irgendwo zusammen was trinken. Wie wär’s mit dem Botanist am Sloane Square? Ich könnte einen Bramble vertragen. Wir könnten …«
Doug fiel ihr ins Wort. »Geht nicht.« Im Hintergrund war Stimmengewirr zu hören. »Wir sind gerade an einem Fall dran. Ich ruf dich später …«
Aber in diesem Moment leuchtete Gemmas Nummer auf Melodys Display auf. »Alles klar. Mach’s gut«, sagte sie, ein wenig heftiger als nötig, und wechselte zu dem anderen Anruf. »Chefin? Was gibt’s?«, meldete sie sich, als Gemmas Icon ihr Display ausfüllte.
»Lust, ein bisschen um die Häuser zu ziehen?«, fragte Gemma.
Doug Cullen schüttelte genervt den Kopf. Seit ein paar Wochen machte er sich zunehmend Sorgen um Melody. Er hatte geglaubt, dass sie ihre Differenzen nach seiner Einmischung in ihre Beziehung mit Andy Monahan wieder halbwegs überwunden hätten, aber dann war sie urplötzlich abgetaucht. Bis heute Abend. Aber heute Abend hatte er keine Zeit, sich Gedanken darüber zu machen.
Als er sich zu Kincaid umblickte, sah er, dass sein Chef immer noch mit der Frau und ihrem kleinen Sohn sprach. Gut, dann könnte er sich inzwischen schon einmal daranmachen, die Identität der Toten zweifelsfrei festzustellen.
Er zog ein Paar Handschuhe an und ließ sich vorsichtig neben ihr in die Hocke sinken, während er sich zu erinnern versuchte, ob er eine Handtasche gesehen hatte, als er im Pub an ihr vorbeigekommen war. Jetzt war jedenfalls keine zu sehen. Ihre linke Hand war unter dem Saum ihrer Jacke verborgen, und er zog sie behutsam hervor. Kein Ring. Die rechte Hand lag quer auf ihrem Bauch – es sah so natürlich und entspannt aus, als ob sie schliefe.
Ihr Körper schien auf der rechten Seite leicht erhöht zu liegen, und soweit Doug erkennen konnte, war der Boden unter ihr eben. Vorsichtig schob er die Hand unter ihren unteren Rücken und stieß tatsächlich mit den Fingern an einen Gegenstand. Er gab ein wenig nach, als Doug dagegen drückte. Als er ihn herausgezogen hatte, sah er, dass es eine kleine Tasche war, aus hellbraunem Leder oder Kunstleder, mit Schulterriemen. Hatte sie sie fallen lassen, bevor sie zusammengebrochen war? Er öffnete den Verschluss und griff hinein. Lippenstift. Eine Packung Taschentücher. Eine Brieftasche im Kreditkartenformat. Kein Handy. Er lehnte sich ein wenig zurück und leuchtete mit seinem Handy in die Brieftasche. Sie hatte einen Ausweis, eine Bankkarte und ihren Sozialversicherungsausweis dabei. Einen Führerschein gab es nicht, aber der Ausweis verriet ihm, dass sie in der Guilford Street wohnte, gleich hinter dem Great Ormond Street Hospital. Ihr voller Name lautete Sasha Elaine Johnson, und sie war achtundzwanzig Jahre alt.
Er fuhr zusammen, als ein Handy zu läuten begann. Instinktiv fasste er an seine eigene Tasche, ehe ihm klarwurde, dass es gar nicht sein Telefon war. Es war ihres. Er bemühte sich, die Leiche so wenig wie möglich zu bewegen, während er in der Innentasche ihres Anoraks umhertastete und nach einigen vergeblichen Versuchen ein schmales Mobiltelefon hervorzog – just in dem Moment, als es verstummte.
»Verdammt«, murmelte er, als er auf das Display tippte und nichts passierte. Natürlich war das Handy gesperrt. Sie würden es den IT-Technikern übergeben müssen.
Er hatte sich gerade aufgerichtet und wollte Kincaid seine Entdeckungen melden, als das Display des Handys unter seinen Fingern aufleuchtete und erneut einen eingehenden Anruf signalisierte.
3
Tully hatte so lange auf der Polsterbank in dem winzigen Buchladen-Café ausgeharrt, bis endlich auch der pummelige Typ in der grellpinken Strickjacke gegangen war. Er hatte am Nebentisch gesessen und seinen Freund mit boshaftem Klatsch über seine Kollegen unterhalten. In einem weichen Tragekorb neben ihm auf der Bank steckte ein kleiner Hund, der jedes Mal, wenn die Inhaberin an den Tisch kam, um die Teekanne des Mannes aufzufüllen, knurrte und nach ihr schnappte. Tully hatte dauernd aufpassen müssen, dass sie mit ihrer Jacke dem Hund nicht zu nahe kam – oder seinem Besitzer. Vielleicht war der ja auch bissig.
Jetzt war Tully mit der Inhaberin allein, einer freundlichen weißen Frau mit kurzem Männerhaarschnitt und über und über tätowierten Armen, die aus einem ärmellosen Top hervorschauten – trotz des kalten Luftzugs, der jedes Mal durch das Café fuhr, wenn die Tür aufging.
Tully sah wieder auf die Uhr ihres Handys. Das Café schloss jeden Moment, sie hatte zu viel Tee getrunken und den Rest ihres Karottenkuchens auf dem Teller hin und her geschoben, bis nur noch eine Masse von Krümeln übrig war.
»Alles in Ordnung?«, fragte die Inhaberin besorgt. »Du siehst heute ein bisschen blass aus, Schätzchen.« Tully war hier Stammgast, da das Café sowohl von ihrem Job im British Museum als auch von der Keramikgalerie, in der sie stundenweise aushalf, nur einen Katzensprung entfernt war.
Tully runzelte die Stirn. »Es ist nur so, dass meine Mitbewohnerin sich schon vor über einer Stunde hier mit mir treffen wollte, und sie kommt eigentlich nie zu spät. Und sie geht auch nicht an ihr Handy.«
»Na, du kannst gerne noch ein bisschen bleiben, Schätzchen, wenn es dir nichts ausmacht, dass ich um dich herum aufwische.« Die Inhaberin drehte das Schild an der Tür auf Geschlossen.
»Oh, danke, das ist wirklich nett von dir«, sagte Tully, »aber ich will dir nicht im Weg sein.« Doch während sie nach ihrer Jacke und ihrer Handtasche griff, fügte sie hinzu: »Vielleicht probiere ich noch mal, sie zu erreichen.« Sie stand auf und wählte wieder die Nummer.
Als sich ein Mann meldete, war sie im ersten Moment so verblüfft, dass es ihr die Sprache verschlug.
»Wenn ich Auto fahren könnte«, murrte Kit auf dem Rücksitz, »dann hätte ich mit den Kleinen heimfahren können, und Melody hätte dich hier abholen können.«
»Da wirst du dich noch eine Weile gedulden müssen«, erwiderte Gemma grinsend. Seit sie den neuen Land Rover hatten, war er ganz besessen von Autos. »Auch wenn du bestimmt mal ein sehr verantwortungsbewusster Fahrer wirst.«
Sie hoffte, dass die Vorstellung, am Steuer eines Autos zu sitzen, etwas von ihrem Zauber verloren haben würde, wenn er erst einmal achtzehn war und den Führerschein machen durfte. Autofahren in London war nichts für Leute mit schwachen Nerven oder wenig Fahrpraxis. Immerhin hatte Duncan es fertiggebracht, seinen alten MG bei seinem Vater oben in Cheshire einzumotten, sodass sie nicht befürchten mussten, dass Kit je diese Höllenmaschine fahren würde.
Notting Hill war an diesem Abend allerdings sehr ruhig, dachte sie, während sie den Umweg über die Westbourne Park Road fuhr und die geschlossenen Buden des Portobello Market passierte.
»Ich bin am Verhungern«, quengelte Toby auf dem Rücksitz.
»Ich auch. Ich bin auch am Verhungern«, fiel Charlotte ein, obwohl Gemma wusste, dass Kit ihr im Café einen Imbiss gekauft hatte.
»Ich weiß, meine Süßen. Kit, möchtest du uns Pizza bestellen?«
Er schüttelte den Kopf. »Ich kann uns was machen. Es gibt da ein Pastarezept, das ich gerne ausprobieren würde. Es ist mit Erbsen und Champignons und karamellisierten Zwiebeln.« Kit hatte immer schon gerne gekocht, aber seit dem Wochenende im September, als er in der Küche eines Pubs in Gloucestershire aushelfen hatte dürfen, war er noch versessener aufs Experimentieren.
»Macht es dir wirklich nichts aus?«, fragte Gemma. »Ich glaube nicht, dass es lange dauert, und du kannst mich ja anrufen, wenn du irgendetwas brauchst. Wo ist Wes heute Abend?«
Wes Howard, ein Freund der Familie, passte ab und zu auf die Kinder auf, aber in letzter Zeit war er mit seinen Kursen an der Handelsschule, seiner Fotografie und dem Teilzeitjob in Otto’s Café in der Elgin Crescent mehr als ausgelastet.
»Er hat die Abendschicht. Er meinte, sie wären morgen Mittag unterbesetzt, und wenn ich wollte, könnte ich aushelfen.«
»Okay, also, du kannst Wes anrufen, wenn …«
»Gemma, ich bin doch keine fünf Jahre alt.« Kit verdrehte genervt die Augen.
»Ich bin fast fünf«, meldete sich Charlotte vom Rücksitz.
»Du bist grade erst vier geworden, Baby. Du bist noch lange keine fünf«, stichelte Toby, als sie um die Kurve der Landsdowne Road fuhren.
»Bin kein Baby«, protestierte Charlotte empört.
»Das reicht, ihr zwei.« Gemma war froh, als sie vor ihrem Haus ankamen. »Wir sind da. Alles aussteigen, bitte.«
Die kirschrote Haustür wirkte selbst im Regen einladend, und sie konnte das aufgeregte Gebell der Hunde hören, als sie aufschloss. Einen Moment lang war sie versucht, zu bleiben und den Abend zu Hause zu verbringen. Sie könnte sich ein Glas Wein einschenken, Kit mit seiner Pasta helfen, vielleicht sogar mit den Jungs einen Film anschauen, wenn Charlotte im Bett war. Aber ihre Neugier war geweckt. Was war am Russell Square passiert, von dem Duncan glaubte, dass es sie interessieren würde?
Wenige Minuten später, nachdem die Kinder versorgt waren, erblickte sie Melody, die vor ihrem Wohnblock in der Kensington Park Road auf und ab ging. Melody trug eine knallrote Regenjacke, doch ihr Kopf war unbedeckt, und in ihren kurzen dunklen Haaren glitzerten Regentropfen. »Was machst du denn da?«, rief Gemma, als sie am Bordstein hielt und sich hinüberbeugte, um die Beifahrertür aufzustoßen. »Du wirst ja klatschnass.«
»Hab meinen Schirm vergessen«, erklärte Melody, während sie einstieg. »Und diese blöde Jacke hat keine Kapuze.«
»Tja, wer schick sein will, muss leiden«, meinte Gemma. »Ich hoffe, ich habe nicht deine Pläne für den Abend durchkreuzt.«
»Ganz und gar nicht.« Melody fuhr sich mit den Fingern durch die feuchten Haare, die daraufhin vom Kopf abstanden. »Ich dachte, Doug würde vielleicht mit mir einen trinken gehen, aber er sagte, er sei beschäftigt. Geschieht ihm ganz recht, wenn wir jetzt in seinem Revier aufkreuzen.«
Gemma warf ihr einen Seitenblick zu und sah den Anflug eines Lächelns. Immerhin redeten Melody und Doug wieder miteinander.
»Weißt du, worum es geht?«, fragte Melody.
»Ich habe keine Ahnung. Hat Doug dir auch nichts gesagt?«
Melody schüttelte den Kopf. »Nein. Er war nur auf nervtötende Art wichtigtuerisch. Welch eine Überraschung.«
Gemma war versucht, Melody zu fragen, ob sie etwas von Andy Monahan gehört hatte, aber das einvernehmliche Schweigen, das sich einstellte, als sie durch die dunklen Straßen fuhren, empfand sie als so angenehm, dass sie die Stimmung nicht verderben wollte.
Normalerweise wäre sie an einem Freitagabend nicht freiwillig mit dem Auto durch die Londoner Innenstadt gefahren, aber immerhin konnte sie die Oxford Street und den ärgsten Stau umgehen.
»Das reinste Labyrinth«, murmelte sie. »Er hätte ja vielleicht erwähnen können, zu welcher Seite des Russell Square wir kommen sollen.« Doch als sie in die Woburn Place einbog, wurde ihre Frage durch das flackernde Blaulicht in der Ferne beantwortet. Als sie den Square selbst erreichte, hielt sie auf dem Gehsteig hinter einem Streifenwagen und dem Transporter der Spurensicherung. Ein riesiger viktorianischer Palast ragte auf der anderen Straßenseite auf, dessen verzierte Fassade in auffallendem Kontrast zu den gewöhnlichen Gebäuden ringsum stand.
»Im Türfach steckt noch ein Schirm«, sagte sie zu Melody. Dann legte sie ein Polizeischild aufs Armaturenbrett, stieg aus und zeigte der uniformierten Beamtin, die auf sie zukam, ihren Dienstausweis. »Ich möchte zu Detective Superintendent Kincaid.«
»Oh, alles klar, Ma’am«, erwiderte die junge Frau. »Sie gehen einfach da durch den Eingang und am Café vorbei. Die Spurensicherung baut gerade die Beleuchtung auf. Sie können sie kaum übersehen.«
Das erwies sich noch als Untertreibung. Als sie den Park betraten, zog die strahlende Helligkeit der tragbaren Scheinwerfer sie an wie ein Leuchtfeuer. Das Tatortteam hatte noch kein Zelt aufgebaut, und als Gemma und Melody näher kamen, erblickten sie eine Gruppe, die wie ein illuminiertes Tableau wirkte. Duncan stand in der Mitte und hielt einen großen schwarzen Regenschirm in der Hand. Im grellen Licht sah er müde aus, dachte Gemma. Seit seinem Unfall im September kam das öfter vor.
Im Schutz seines Schirms kniete Dr. Rashid Kaleem, der gut aussehende junge Rechtsmediziner. Er trug einen weißen Overall, der, wie Gemma vermutete, eines seiner typischen T-Shirts mit Rechtsmediziner-Witzen verdeckte. Etwas abseits stand Jasmine Sidana, die Detective Inspector in Duncans Team, unter ihrem eigenen Schirm. Sie beobachtete Kaleem aufmerksam, aber ohne die grimme Miene, die sonst oft ihre Züge verunstaltete. Vor ihnen sah Gemma eine Gestalt am Boden liegen. Zwei Spurensicherer in weißen Schutzanzügen huschten wie Gespenster außerhalb des Lichtkreises umher.
Als Duncan den Kopf hob, erblickte er sie und lächelte. »Gemma. Und Melody. Schön, dass ihr es geschafft habt.«
Rashid blickte ebenfalls auf. »Ich denke, das wird Sie interessieren.«
»Hallo, Rashid«, sagte Gemma. »Inspector«, fügte sie mit einem Nicken in Sidanas Richtung hinzu. Als sie näher trat, sah sie, dass das Opfer eine junge schwarze Frau mit einem fein geschnittenen, auffallend hübschen Gesicht war. »Oh, wie furchtbar«, murmelte Gemma betroffen. Dieser Moment, wenn aus dem »Fall« ein Mensch aus Fleisch und Blut wurde, kam immer irgendwann, und sie empfand ihn immer noch so stark wie eh und je. »Was ist mit ihr passiert, Rashid?«
»Sie wurde erstochen.« Er leuchtete mit einer kleinen Taschenlampe auf eine Stelle unterhalb der linken Brust der Frau. »Sehen Sie das hier? Sieht nicht nach einer großen Wunde aus, aber die Waffe muss sehr scharf gewesen sein, und der Stich wurde mit großer Kraft geführt. Er hat ihre Jacke durchbohrt und hatte dann immer noch genug Wucht, um sie zu töten.«
»Sie wurde hier im Park erstochen?«, fragte Gemma und blickte sich um.
»Gleich dort drüben.« Duncan wies auf eine Stelle ein paar Meter weiter den Weg entlang, die von der Spurensicherung bereits abgeriegelt worden war. »Jedenfalls laut unserem einzigen Zeugen, der übrigens ganze fünf Jahre alt ist.«
»Sicher werde ich es erst sagen können, wenn ich sie auf dem Tisch habe, aber ich vermute, dass Ihr Zeuge recht hat«, meinte Rashid. »Wenn die Waffe ihre Aorta verletzt hat, muss sie fast auf der Stelle tot gewesen sein.«
Melody runzelte die Stirn. »Und niemand sonst hat irgendetwas gesehen?«
»Die Mutter des Jungen war mit ihrem Handy beschäftigt und hat deshalb nichts mitbekommen«, erklärte Duncan. »Der Junge glaubt gesehen zu haben, wie jemand die Frau angerempelt hat, aber es hat sich niemand bei uns gemeldet. Die anderen Zeugen sind nur zusammengelaufen, weil sie die Mutter des Jungen um Hilfe rufen hörten.«
Gemma schauderte. Ihr war plötzlich kalt, und trotz des Schirms empfand sie die Luft als unangenehm feucht. Hatte die junge Frau mitbekommen, was mit ihr geschah?
»Wir werden an die Öffentlichkeit appellieren«, warf Sidana ein und wandte sich ab, um mit einem Constable zu sprechen. Gemma stellte sich vor, dass sie bereits im Kopf die Pressemitteilung formulierte.
»Wissen wir schon, wer sie ist?«, fragte Gemma.
»Sasha Johnson. Sie war Assistenzärztin.« Duncan zögerte einen Moment. »Das Komische ist, Doug und ich haben sie kurz vorher gesehen. Sie war im Perseverance. Gleich nach Dougs Eintreffen ist sie gegangen.«
»Wo ist Doug eigentlich?«, fragte Melody und sah sich um, als ob sie damit rechnete, dass er plötzlich hinter einem Busch hervortreten würde.
»Er trifft sich mit der Mitbewohnerin des Opfers.«
Das Gespräch war eine Herausforderung gewesen, um es milde auszudrücken.
Als Doug den Anruf auf Sashas Handy angenommen hatte, war die Reaktion auf sein »Hallo?« ein Moment überraschten Schweigens.
Dann sagte eine weibliche Stimme zögerlich: »Sasha? Entschuldigung, habe ich mich vielleicht verwählt?«
»Das ist Sashas Mobiltelefon«, erwiderte Doug, dem erst jetzt bewusst wurde, in was für einer schwierigen Situation er steckte. »Ähm, mein Name ist Doug Cullen. Ich bin von der Met – der Polizei.«
»Polizei?« Die Frage endete mit einem Kiekser. »Was ist passiert? Ist Sasha okay?«
Doug wollte dieser Freundin – oder war sie eine Verwandte? – die Nachricht nicht am Telefon überbringen. »Verzeihen Sie, könnten Sie mir vielleicht sagen, wer Sie sind?«
»Ich bin Tully. Tully Gibbs. Ich bin Sashas Mitbewohnerin. Hören Sie mal, worum geht es hier eigentlich? Sasha wollte sich schon vor einer Ewigkeit mit mir treffen. Ist etwas …«
»Miss Gibbs, können Sie mir sagen, wo Sie sind? Es wäre besser, wenn ich Sie persönlich sprechen könnte.«
»Ich bin … Ich bin in einem Café, in der Nähe des Museums. Aber es macht gleich zu.« Tully Gibbs klang jetzt nicht mehr so überrascht, eher erschüttert. »Aber die Galerie, in der ich arbeite, ist gleich um die Ecke. Ich kann die Werkstatt nebenan aufschließen.« Sie nannte ihm eine Adresse in der Museum Street.
»Geben Sie mir zehn Minuten«, sagte er. »Ich treffe Sie dort.«
»Aber … Hören Sie, wenn Sasha in irgendwelchen Schwierigkeiten ist, will ich …«
»Miss Gibbs, es ist besser, wenn ich zu Ihnen komme.«
Doug studierte die Hausnummern an den Ladenfronten, während er sich überlegte, was er Tully Gibbs sagen sollte. Die Situation war ihm natürlich nicht neu. Er hatte oft genug schlechte Nachrichten überbringen müssen, als er noch Streife gefahren war, und auch später als Detective. Aber jeder Fall war anders, und sie hatte sich sehr jung angehört. Und aus dem, was sie gesagt hatte, schloss er, dass sie allein war.
Es war die Auslage in dem Schaufenster auf der anderen Straßenseite, die seine Aufmerksamkeit weckte. An der Tür hing ein Geschlossen-Schild, doch hinter der Scheibe konnte er einen langen Tisch mit verschiedenen Töpferwaren erkennen, deren Farben in dem gedämpften Licht leuchteten. Nachdem er die Straße überquert hatte, sah er, dass der Raum noch weitere Ausstellungstische enthielt – in den weißen Regalen an den Wänden standen Bücher und weitere beeindruckende Keramikarbeiten. Alles machte einen sauberen und lichten Eindruck.
Da in der Galerie niemand zu sein schien, überprüfte er noch einmal die Hausnummer und stellte dann fest, dass es an der Seite noch eine Tür gab. Sie war unbeschriftet und schien zu den Wohnungen in den oberen Stockwerken des Klinkerbaus zu führen. Er drückte die Klingel fürs Erdgeschoss und wartete. Kurz darauf wurde geöffnet, und er erblickte einen schlichten, mit Teppichboden ausgelegten Hausflur und eine Treppe. In einer Tür am Ende des Flurs erschien die Silhouette einer Frau.
»Sind Sie von der Polizei?« Es war die Stimme vom Telefon – leise, mit einem leichten West-Country-Akzent.
»Ja. Detective Sergeant Cullen.« Doug hielt seinen Dienstausweis hoch. »Miss Gibbs?«
Sie nickte. »Sie kommen besser rein«, sagte sie. Sie war jung, stellte er fest, wahrscheinlich in Sasha Johnsons Alter, weiß, mit kinnlangen hellbraunen Haaren und einer modischen Brille mit schwerem Rahmen.
Doug folgte ihr in das Atelier. Auf einem niedrigen dreieckigen Tisch stand eine Töpferscheibe, wenn er das richtig erkannte, daneben ein Schemel und ein Eimer mit trübem Wasser. Auf einem langen Arbeitstisch lagen Schwämme, Stofflappen und merkwürdige Utensilien, deren Funktion ihm ein Rätsel war. Alle waren über und über mit weißem Ton bekleckert. Wie auch der Fußboden. Er zögerte, während er überlegte, wo er seine Füße hinsetzen sollte.
Tully Gibbs musste sein Unbehagen bemerkt haben, denn sie sagte: »Ich nehme an, Sie waren noch nie in einer Töpferwerkstatt. Keine Sorge, die Sachen beißen nicht. Fassen Sie nur nichts an, was noch nicht trocken ist.« Er folgte ihrem Blick zu einem Metallregal an der einen Wand, das mit Objekten in verschiedenen Stadien der Fertigstellung bestückt war.
Doug fand es erstaunlich, dass die eleganten Stücke, die er in der Auslage nebenan gesehen hatte, aus diesem Raum kamen, der ihn eher an ein Schlammbad erinnerte. »Es ist ein bisschen chaotisch, nicht wahr?«, murmelte er. »Gehört das hier zur Galerie?«
»Ja. Hinten im Garten gibt es auch einen Brennofen – so was ist im Zentrum von London schwer zu finden. Aber sagen Sie, geht es Sasha gut?« Mit einem Zittern in der Stimme fügte sie hinzu: »Ich mache mir solche Sorgen.«
Doug zögerte. Dieser Moment war nie einfach, aber er wusste, dass es besser war, es schnell hinter sich zu bringen. »Miss Gibbs, ich bedaure, Ihnen sagen zu müssen, dass es einen … Zwischenfall gegeben hat. Es tut mir sehr leid, aber Ihre Freundin ist tot.«
Tully Gibbs starrte ihn an, und ihr Gesicht wurde noch blasser im Kontrast zu dem dunklen Brillengestell. »Nein«, flüsterte sie. »Das muss ein Irrtum sein.«
»Leider nicht. Sie hatte ihren Ausweis vom Krankenhaus dabei. Es tut mir wirklich sehr leid.«
Mit einem Wimmern hielt sich Gibbs eine Hand vor den Mund. Hinter den Brillengläsern füllten sich ihre Augen mit Tränen. »O nein.«
Sie schwankte, und Doug befürchtete plötzlich, sie könnte ohnmächtig werden. Er hätte sie auffordern sollen, sich zu setzen. Jetzt erspähte er einen Stuhl, der an das Regal geschoben war, zog ihn rasch heran und fasste Tully Gibbs sanft am Ellbogen, um sie hinzugeleiten. Sie ließ sich ohne Widerstand darauf niedersinken.
Sie schauderte, dann stieß sie mit heiserer Stimme hervor: »Was … Was ist passiert?«
Doug erblickte einen Wasserkocher und Tassen auf einem Regal nahe der Hintertür. »Ich mache Ihnen erst mal einen Tee, okay? Und dann können wir reden.«
In einer verbeulten Teedose neben dem Spülbecken fand er Teebeutel. Als das Wasser kochte, füllte er einen Becher, warf einen Teebeutel hinein und gab, ohne zu fragen, noch zwei gehäufte Esslöffel Zucker dazu. Er brachte Tully den heißen Becher und zuckte zusammen, als er ihn umdrehte, damit sie den Henkel ergreifen konnte.
»D… Danke.« Ihre Zähne klapperten. Falls es in der Werkstatt eine Heizung gab, hatte sie nicht daran gedacht, sie einzuschalten. Vorsichtig nippte sie an dem Tee, dann verzog sie das Gesicht. »Ich mag keinen Zucker.«
»Es wird Ihnen guttun. Trinken Sie, bitte.« Er fand noch einen zweiten Stuhl und setzte sich ihr gegenüber, die Hände auf den Knien.
Nachdem sie noch ein paarmal genippt hatte, schlang sie die Hände um den Becher, schluckte krampfhaft und sagte: »Sagen Sie mir jetzt bitte, was passiert ist. War es ein Unfall? Sash ist immer so konzentriert darauf, ihr Ziel zu erreichen, dass sie manchmal nicht richtig schaut …«
Aber Doug schüttelte den Kopf. »Es tut mir leid, aber so war es nicht. Sie war auf dem Weg durch die Grünanlage am Russell Square. Sie wurde … erstochen.«
»Was? Das ist doch verrückt. Warum sollte jemand Sasha erstechen?«
»Kennen Sie irgendjemanden, der vielleicht einen Grund gehabt hätte, Ihrer Freundin zu schaden?«
»Ich bitte Sie – Sasha war Assistenzärztin. Alle haben sie gemocht. Sie glauben doch hoffentlich nicht, dass es jemand war, der sie gekannt hat … Es muss irgendein Verrückter gewesen sein, der …«
»Das ist denkbar«, sagte Doug. »Aber solange wir nicht mehr wissen, müssen wir alle Möglichkeiten berücksichtigen«, fuhr er fort. »Hatte Sasha vielleicht Beziehungsstress?«
Gibbs schüttelte energisch den Kopf. »Sasha hatte nur ihre Arbeit im Kopf. Ihre Mutter hat ihr immer gesagt, sie würde ihre Chance verpassen, einen …« Sie schnappte erschrocken nach Luft und verschüttete etwas von ihrem Tee. »O Gott. Ihre Mum. Ihre Eltern. Sie werden am Boden zerstört sein. Jemand muss es ihnen sagen …«, setzte sie an, doch Doug unterbrach sie.
»Keine Sorge, das übernehmen wir. Könnten Sie mir wohl die Kontaktdaten der Eltern geben?«
Nach einer Weile nickte Gibbs. »Ihr Vater ist Schulleiter. Und ihre Mutter ist Psychologin beim Staatlichen Gesundheitsdienst. Ich war schon mal in ihrer Wohnung, aber ich weiß nicht mehr die genaue Adresse – ich war mit Sash dort. Es ist in der Westbourne Park, gegenüber der Union Tavern.«
»Ich bin sicher, dass wir sie finden werden«, sagte Doug. »Übrigens werden wir uns noch Sashas Sachen anschauen müssen, falls Sie uns dabei auch behilflich sein könnten?«
Tully Gibbs umklammerte ihre erkaltende Teetasse. »Könnten Sie … könnten wir das jetzt gleich machen? Es ist nur … ich weiß nicht, ob ich es ertragen würde, allein in die Wohnung zu gehen …«
»Aber natürlich«, versicherte ihr Doug. »Aber zuerst hätte ich noch ein paar Fragen, falls Sie sich dazu in der Lage fühlen.« Als sie nickte, fuhr er fort: »Sie sagten, Sasha hätte sich mit Ihnen im Café treffen sollen. Wäre sie da normalerweise über den Russell Square gegangen?«
»Von unserer Wohnung, ja – das ist der kürzeste Weg.«
»Und wo ist das?«
»In der Guilford Street, gleich bei Coram’s Fields.«
»Wusste jemand, dass Sie sich dort treffen wollten?«
Gibbs runzelte die Stirn und antwortete: »Na ja, mein Chef natürlich. Als ich die Nachricht von Sash bekam, musste ich es ihm überlassen, die Galerie abzuschließen. Er war ziemlich sauer. Und …« Sie zögerte. »Mein Bruder. Ich habe ihm eine Nachricht geschrieben und ihn geschimpft, weil er sich mit Sasha auf einen Drink treffen sollte und sie versetzt hat.«
Doug zog eine Augenbraue hoch. »Die beiden waren befreundet?«
Zum ersten Mal wich Tully Gibbs seinem Blick aus. »Also … nicht direkt. Sie meinte nur, sie müsse mit ihm reden. Und es sei dringend.«
4
»Ihr habt sie im Pub gesehen?«, fragte Gemma überrascht. »Wann?« Sie hatten sich ein paar Schritte von der Leiche entfernt, während Rashid seine Untersuchung abschloss.
»Doug und ich haben uns nach der Arbeit auf ein Bier getroffen …« Als er ihren Gesichtsausdruck sah, fügte Duncan rasch hinzu: »Ich wollte am Russell Square die U-Bahn nehmen – da wäre ich auf jeden Fall noch rechtzeitig zu Tobys Probe gekommen. Sie« – er deutete auf das Opfer – »war schon vor Doug dort. Allein. Sie hat immer wieder auf ihr Handy gesehen, und ich weiß noch, dass ich gedacht habe, sie ist sicher stinksauer auf denjenigen, der sie so lange warten lässt. Aber dann ist Doug reingekommen, und sie muss gegangen sein, während ich sein Bier bestellt habe.«
Gemma hielt ihren Schirm schräg, um das angesammelte Regenwasser ablaufen zu lassen, und bekam prompt ein paar Spritzer ins Gesicht. »Hattest du sie vorher schon mal gesehen?«
Er schüttelte den Kopf. »Ich glaube nicht, aber man sieht dort öfter mal Personal aus den umliegenden Krankenhäusern.«
Gemma musterte ihn eingehender und sah die Anspannung um seine Augen. Sie berührte seinen Arm. »Das muss ein furchtbarer Schock für dich gewesen sein, sie hier zu finden.«
Duncan sah weg, und als er antwortete, war seiner Stimme anzumerken, wie er sich beherrschen musste. »Jemand hat sie hier kaltblütig erstochen, während Doug und ich bei unserem Bier gesessen haben. Es kann höchstens zwanzig Minuten, nachdem sie das Pub verlassen hat, passiert sein.«
»Du hast niemanden draußen auf sie warten sehen? Oder mit ihr sprechen?«
Wieder schüttelte er den Kopf. »Ich habe nicht darauf geachtet. Wenn ich …«
Gemma unterbrach ihn energisch. »Du weißt genau, dass du nichts hättest tun können, Schatz.« In sanfterem Ton fügte sie hinzu: »Aber ich kann dir nicht verdenken, dass du ein … komisches Gefühl dabei hast. Schlimm genug, dass es in deinem Revier passiert ist. Hattet ihr schon mal ähnliche Fälle?«
»Von Messerkriminalität? Ein paar Fälle von häuslicher Gewalt und den einen oder anderen Streit unter Betrunkenen. Keine Todesfälle.«
»Aber der Fall, an dem du gearbeitet hast – der Raubüberfall auf den Laden …«
»Diese zwei kleinen Gangster sitzen in U-Haft. Und außerdem sind sie früher schon durch kleine Diebstähle aufgefallen, auch wenn sie vor diesem Raubüberfall immer nur Leute mit einem Messer bedroht haben. Der Ladeninhaber hatte sie mit einem Besenstiel attackiert und sich damit ein Messer in den Bauch eingehandelt – sonst wäre dieser Überfall wahrscheinlich genauso verlaufen wie ihre vorherigen Versuche. Das da« – sein Blick ging wieder zu der Toten – »muss mit voller Absicht geschehen sein.«
»Von jemandem, der genau wusste, wohin er zielen musste.« Gemma sah, dass Rashid inzwischen fertig war und telefonierte – wahrscheinlich informierte er das Bestattungsinstitut. »Sie wurde nicht ausgeraubt? Diese Handtaschenräuber können ganz schön skrupellos sein.«
»Ihr Handy und ihre kleine Tasche waren noch da. Und Trevor hat nichts von einem Handgemenge bemerkt.«
»Trevor?«
»Der kleine Junge, der gesehen hat, wie sie zusammenbrach. Und er war glaubwürdiger als so mancher erwachsene Zeuge.«
Gemma versuchte sich vorzustellen, dass Toby oder Charlotte mit ansehen müssten, wie jemand ermordet wurde, noch dazu auf diese Weise, und sie schauderte. Sie hoffte, dass Trevors Mutter sich heute Abend ganz besonders aufmerksam um ihn kümmern würde.
»Und außerdem«, fuhr Duncan fort, »schneiden die Handtaschenräuber eher, als dass sie stechen. Rashid sagt, es muss sich um eine Waffe mit schmaler Klinge handeln, also nichts, was man benutzen würde, um den Riemen einer Handtasche zu durchschneiden. Nach der Obduktion wird er uns mehr …« Duncans Handy klingelte. Er warf einen Blick aufs Display und formte mit den Lippen das Wort Doug, während er den Anruf annahm.
Dougs Stimme drang leise an ihr Ohr, während Duncan lauschte und nickte.