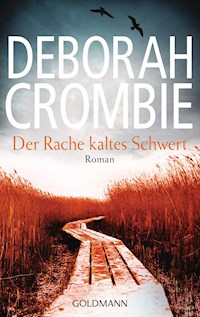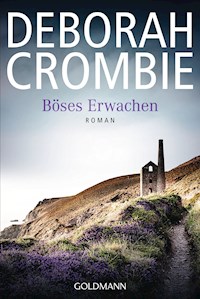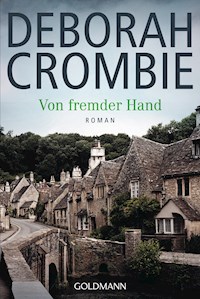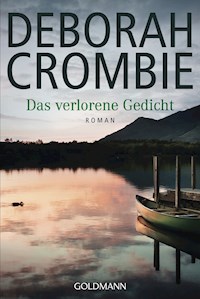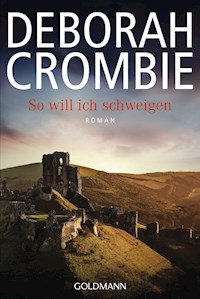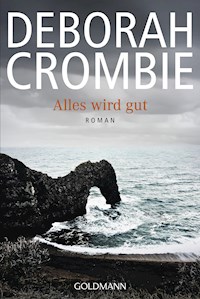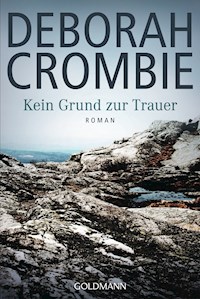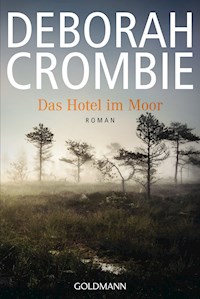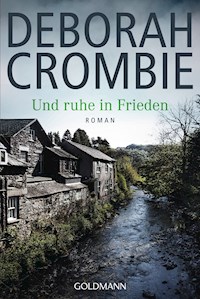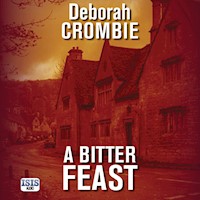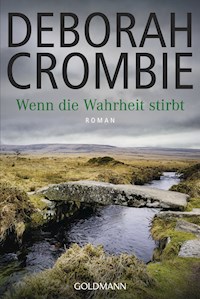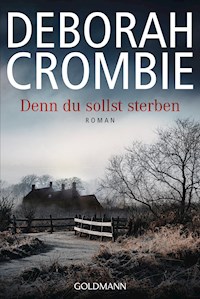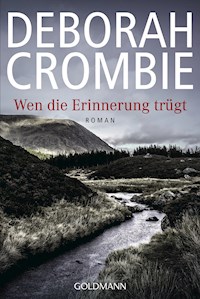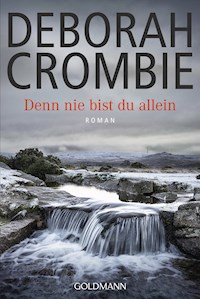9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Kincaid-James-Romane
- Sprache: Deutsch
Lügen, Korruption, Mord. Duncan Kincaid und Gemma James ermitteln wieder
Oktober in dem beschaulichen Städtchen Henley-on-Thames. Das Boot der Polizistin und Rudererin Patricia Meredith wird ans Ufer der Themse gespült. Kurz darauf findet der Hundeführer Seth Murray Patricias Leiche. Zunächst geht die Polizei von einem Unfall aus, doch dann wird Murray erschossen am Themseufer aufgefunden. Gibt es einen Zusammenhang zwischen beiden Todesfällen? Superintendent Duncan Kincaid und seine Frau Inspector Gemma James kommen einem Korruptionsfall auf die Spur, der immer größere Ausmaße annimmt und in die höchsten Ränge der Londoner Polizei führt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 699
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Buch
Oktober in dem beschaulichen Städtchen Henley-on-Thames in der Nähe von London. Das Boot der Polizistin und Ruderin Rebecca Meredith wird ans Ufer der Themse gespült. Kurz darauf findet der Hundeführer Kieran Connolly Rebeccas Leiche unterhalb eines Wehrs. Der Rechtsmediziner Rashid Kaleem kommt zu dem Schluss, dass Rebecca infolge eines Unfalls ertrunken ist. Doch dann wird Connolly Opfer eines Brandanschlags, den er nur knapp überlebt. Hatte er Beweise dafür, dass Rebeccas Tod kein Unfall war, und sollte nun zum Schweigen gebracht werden?
Superintendent Duncan Kincaid und seine Frau Inspector Gemma James sind gerade erst aus dem Urlaub zurückgekehrt, da beauftragt Chief Superintendent Childs Duncan mit der Ermittlung in beiden Fällen. Gemma ist noch in Elternzeit, aber sie verfolgt interessiert die Arbeit ihrer Untergebenen Constable Melody Talbot: Melody hat in Gemmas Abwesenheit eine Stelle bei einer Einheit der Londoner Polizei angetreten, die auf Sexualverbrechen spezialisiert ist. Schon bald wird deutlich, dass es einen Zusammenhang zwischen Melodys Nachforschungen zu Vergewaltigungen und Duncans Fällen gibt. Gemeinsam kommen Gemma und Duncan einem Korruptionsfall auf die Spur, der immer größere Ausmaße annimmt und in die höchsten Ränge der Londoner Polizei führt.
Autorin
Deborah Crombies höchst erfolgreiche Romane um Superintendent Duncan Kincaid und Inspector Gemma James wurden für den »Agatha Award« und den »Edgar Award« nominiert, für Wen die Erinnerung trügt hat sie den »Macavity Award« gewonnen. Die Autorin lebt mit ihrer Familie im Norden von Texas.
Weitere Informationen zur Autorin unter www.deborahcrombie.com.
Deborah Crombies Romane mit Duncan Kincaid und
Gemma James in chronologischer Reihenfolge:
Das Hotel im Moor (42618) · Alles wird gut (42666) · Und ruhe in Frieden (43209) · Kein Grund zur Trauer (43229) · Das verlorene Gedicht (44091) · Böses Erwachen (44199) · Von fremder Hand (44200) · Der Rache kaltes Schwert (45308) · Nur wenn du mir vertraust (45309) · Denn nie bist du allein (45870) · So will ich schweigen (45871) · Wen die Erinnerung trügt (46623) · Wenn die Wahrheit stirbt (46622) · Die stillen Wasser des Todes (47465)
Deborah Crombie
Die stillen Wasser des Todes
Roman
Die Originalausgabe erschien 2011 unter dem Titel
»No Mark Upon Her« bei Macmillan, London.
Der Abdruck der Zitate von Lewis Carroll erfolgt mit freundlicher Genehmigung des Insel Verlags.
Auszug aus: Lewis Carroll, Alice hinter den Spiegeln. Aus dem Englischen von Christian Enzensberger. © der deutschsprachigen Ausgabe Insel Verlag Frankfurt am Main 1974.
Auszug aus: Lewis Carroll, Alice im Wunderland. Aus dem Englischen von Christian Enzensberger. © der deutschsprachigen Ausgabe Insel Verlag Frankfurt am Main 1963.
1. Auflage
Deutsche Erstveröffentlichung Oktober 2011
Copyright © der Originalausgabe 2011
by Deborah Crombie
Published by Arrangement with Deborah Crombie
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische
Agentur Thomas Schlück GmbH, 30827 Garbsen.
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2011
by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur München
Umschlagfoto: © Getty Images/soulsurfing – Jason Swain
Redaktion: Claudia Fink
BH · Herstellung: Str.
Für David Thompson (1971–2010),
1
Die Kunst des Ruderns ist wie jede andere Kunst. Nur durch ständiges Üben lässt sie sich so vervollkommnen, dass jede Bewegung elegant wirkt und ohne Nachdenken korrekt ausgeführt wird.
George Pocock, Notes on the Sculling Stroke as Performed by Professional Scullers on the Thames River, England
Ein Blick hinauf zum Himmel entlockte ihr einen lauten Fluch. Es war später, als sie gedacht hatte, und sie hatte nicht damit gerechnet, dass es schon so dunkel war. Seit der Umstellung auf Winterzeit schien die Nacht schlagartig hereinzubrechen, und von Westen her schob sich eine dichte Wolkenwand heran, die ein Unwetter ankündigte.
Mit pochendem Herzen eilte sie durch den schattigen Garten ihres Cottage und zum Tor hinaus auf den Themsepfad. Schon stiegen erste feine Nebelschwaden vom Wasser auf. Am Abend strömte der Fluss einen ganz eigenartigen Geruch aus, feucht und lebendig und irgendwie urtümlich. Die blaugraue Fläche wirkte still wie ein Teich, aber Becca wusste, dass dies eine Illusion war. Hier, kurz vor dem tosenden Wehr unterhalb der Hambleden Mill, herrschte eine starke Strömung, die für unvorsichtige oder übermütige Ruderer zur tückischen Falle werden konnte.
Becca wandte sich flussaufwärts, in Richtung Henley, und verfiel in einen Trab, als sie sah, dass die Beleuchtung an der Henley Bridge bereits eingeschaltet war. Die Zeit lief ihr davon. »Mist«, stieß sie halblaut hervor und beschleunigte ihre Schritte.
Schwitzend erreichte sie das Gelände des Leander, des renommiertesten aller Ruderclubs, der sich auf der Remenham-Seite direkt an die Brücke anschloss. Im Speisesaal im Obergeschoss brannte schon Licht, doch der Bootsplatz lag verlassen im Halbdunkel, und die Türen der Halle waren geschlossen. Das Team absolvierte wohl gerade im Kraftraum unter den Augen der Trainer die letzte Übungseinheit des Tages, und das war Becca nur recht.
Sie öffnete das kleine Tor zum Bootsplatz, ging weiter zur Halle und schloss die Tür auf. Ihr Boot war zwar draußen aufgebockt, doch sie musste an ihre Skulls herankommen, die drinnen aufbewahrt wurden. Sie knipste das Licht an, und ihr Blick fiel auf die glänzenden gelben Empacher – die in Deutschland hergestellten Boote, die von den meisten Achtern benutzt wurden. Sie waren umgedreht übereinandergestapelt, lang, schlank und unglaublich grazil. Der Anblick gab ihr einen Stich ins Herz.
Aber das war nicht Beccas Welt. Teamrudern war noch nie ihre Stärke gewesen, auch nicht an der Universität, wo sie im Frauen-Achter gerudert war. Als hoch aufgeschossene Studienanfängerin war sie vom Ruderclub ihres College angeworben worden. Alle Clubs waren ständig auf der Jagd nach naiven Erstsemestern, aber ihr hatten sie ganz besonders hartnäckig zugesetzt. Sie hatten etwas in ihr gesehen, was über ihre große Statur und ihre langen Gliedmaßen hinausging – die offenkundigen Grundvoraussetzungen für einen Sportruderer. Vielleicht hatten sie damals schon die Besessenheit in ihren Augen aufblitzen sehen.
Heute würde kein Team mehr so verrückt sein, sie an Bord zu nehmen, ganz gleich, wie gut sie einmal gewesen war.
Aus dem angrenzenden Kraftraum kam das Stampfen von Gewichten, durchsetzt mit vereinzelten Gesprächsfetzen. Sie wollte mit niemandem reden – es würde ihr nur kostbare Zeit rauben. Rasch durchquerte sie die Halle und nahm ihre Skulls aus dem Ständer an der hinteren Wand. Die rechteckigen Blätter waren im traditionellen Leander-Pink gestrichen, die gleiche Farbe wie ihre Mütze.
»Becca.«
Erschrocken drehte sie sich um und stieß dabei mit den Skulls gegen den Ständer. »Milo – ich dachte, du wärst drin bei der Mannschaft.«
»Ich habe gesehen, wie in der Halle das Licht anging.« Milo Jachym war klein und fast kahl, bis auf ein paar ergraute Stoppeln über den Ohren. In seiner aktiven Zeit war er ein bekannter Steuermann gewesen, und er hatte früher auch Becca trainiert. »Du gehst aufs Wasser.« Es war mehr eine Feststellung als eine Frage, und der Ton, in dem er sie aussprach, passte zu seinem finsteren Blick. »Du kannst das nicht weiter durchziehen, jetzt, nachdem die Uhren umgestellt sind. Alle anderen sind schon seit einer Stunde drin.«
»Ich mag es, wenn ich das Wasser für mich habe.« Sie lächelte ihn an. »Mach dir keine Sorgen um mich, Milo. Hilf mir lieber, das Boot runterzuheben, ja?«
Er folgte ihr nach draußen und nahm dabei zwei stoffbespannte Klappständer mit, die gleich neben der Hallentür lehnten. Becca trug ihre Skulls durch das Tor und legte sie vorsichtig neben dem Steg ab. Dann ging sie zurück zum Bootsplatz, wo Milo die Klappständer neben einem der freistehenden Bootslager aufgestellt hatte.
Ihr weiß-blaues Filippi lag auf zwei Doppelzweiern, und Milo musste sich gewaltig strecken, um es loszuschnallen und den Bug zu greifen, während sie am Heck anpackte.
Zusammen hoben sie das Rennruderboot heraus, drehten es mit der Wasserseite nach unten und setzten es auf den vorbereiteten Klappständern ab. Während Becca die Einstellung überprüfte, sagte sie: »Du hast es Freddie erzählt.«
Milo zuckte mit den Achseln. »Ist es denn ein Staatsgeheimnis, dass du ruderst?«
»Wie ich sehe, hast du deine sarkastische Ader nicht verloren«, gab sie zurück. Für Milo, der als Trainer seinen Sarkasmus einsetzte wie einen Rammbock, war es allerdings noch eine relativ harmlose Bemerkung gewesen.
»Er hat sich Sorgen gemacht, und ich muss sagen, dass ich ihn gut verstehen kann. Du kannst so nicht weitermachen. Nicht«, fügte er hinzu, ehe sie Luft holen konnte, um vehement zu protestieren, »nicht, wenn du eine Chance haben willst, das Halbfinale zu erreichen, geschweige denn, zu gewinnen.«
»Was?« Sie blickte überrascht auf und stellte fest, dass die Miene, mit der er sie betrachtete, nicht mehr grimmig war, sondern eher nachdenklich.
»Egal, was die anderen sagen«, fuhr Milo fort, »ich halte es durchaus für möglich, dass du bei der Vorausscheidung gewinnen kannst und vielleicht sogar bei den Spielen. Du warst früher einmal eine der besten Ruderinnen, die ich je gekannt habe. Es wäre nicht das erste Mal, dass einem Ruderer in deinem Alter ein Comeback gelingt. Aber so halbherzig, wie du die Sache bisher angehst, wird das nichts. Immer nur nach Feierabend und am Wochenende rudern und in deinem Cottage Gewichte stemmen und am Ergometer trainieren – o ja, ich weiß Bescheid. Hast du etwa geglaubt, du könntest dir Schweigen erkaufen, indem du das eine oder andere Bier ausgibst, und das in einem so inzestuösen Laden wie diesem?« Er grinste, doch dann wurde er wieder ernst. »Du musst dich entscheiden, Becca. Wenn du das wirklich durchziehen willst, musst du alles andere aufgeben. Es wird das Schwerste sein, was du je getan hast, aber so, wie ich deinen Dickkopf kenne, könntest du es tatsächlich schaffen.«
Es war das erste Mal, dass irgendjemand sie auch nur ansatzweise in ihrem Vorhaben bestärkte, und aus Milos Mund bedeutete ihr das mehr als von jedem anderen. Sie hatte einen Frosch im Hals, als sie erwiderte: »Ich – ich werde darüber nachdenken.« Dann deutete sie mit einem Nicken auf das Boot, und gemeinsam hoben sie es über ihre Köpfe, manövrierten es durch das schmale Tor des Platzes und setzten es behutsam neben dem Steg aufs Wasser.
Becca zog ihre Schuhe aus und warf sie neben dem Steg auf die Erde. Dann hob sie ihre Skulls auf und legte sie in einer einzigen fließenden Bewegung quer über die Mitte des Boots, während sie sich auf dem Rollsitz niederließ.
Das Boot schaukelte bedenklich, als es ihr Gewicht aufnahm. Die Bewegung erinnerte sie – wie jedes Mal – daran, dass sie verkehrt herum auf einem dünnen Carbonfaser-Brett saß, das schmaler war als ihr Oberkörper, nur wenige Zentimeter über dem Wasser, und nur durch ihre Geschicklichkeit und ihre Entschlossenheit verhindern konnte, dass ihr zerbrechliches Fahrzeug von den dunklen Tiefen des Flusses verschlungen wurde.
Aber die Angst war etwas Positives. Sie machte sie stark und vorsichtig. Becca steckte die Skulls in die Dollen und schloss die Dollenbügel. Während das Steuerbord-Blatt auf dem Steg lag und das Backbord-Blatt flach auf dem Wasser ruhte, steckte sie die Füße in die Turnschuhe, die am Stemmbrett befestigt waren, und schnallte die Klettverschlüsse fest.
»Ich warte auf dich«, erbot sich Milo, »und helfe dir nachher, das Boot aufzubocken.«
Becca schüttelte den Kopf. »Ich komme schon zurecht. Ich habe meinen eigenen Schlüssel.« Sie spürte das leichte Gewicht der Kordel, an der er hing, auf ihrer Brust.
»Aber, Milo …« Sie zögerte. »Danke.«
»Dann lass ich das Licht an«, sagte er, als sie sich vom Steg abstieß. »Skull- und Dollenbruch!«
Aber sie glitt bereits davon, ließ ihr Skiff von der Strömung in die Flussmitte treiben, und seine Worte drangen kaum noch zu ihr durch.
Die Welt schien hinter ihr zurückzubleiben, als sie in ihren Aufwärmrhythmus verfiel, die verspannten Schultern und die steifen Oberschenkel lockerte. Der Wind, der stetig flussabwärts wehte, spielte um ihr Gesicht. Wind und Strömung waren beide auf ihrer Seite, was sich aber ändern würde, sobald sie Temple Island umrundet hatte; von da an würde sie gegen den Wind flussaufwärts rudern müssen.
Ihre Züge wurden länger und tiefer, während sie die goldenen Lichtbögen der Henley Bridge in der Ferne verschwinden sah. Sie fuhr rückwärts, wie alle Ruderer, und orientierte sich auf dem Fluss mit Hilfe ihres Instinkts. Und es war, als ob sie sich auch in der Zeit rückwärtsbewegte. Einen Augenblick lang war sie tatsächlich die junge Frau, für die eine olympische Goldmedaille greifbar nahe gewesen war. Die junge Frau, die ihre Chance gehabt und sie leichtfertig verschenkt hatte.
Mit einem Stirnrunzeln riss Becca sich in die Gegenwart zurück. Sie konzentrierte sich auf ihren Schlag, spürte den Schweiß, der sich in ihrem Nacken und zwischen den Brüsten bildete. Sie war nicht diese junge Frau. Das war mehr als vierzehn Jahre her, und es war eine andere Welt gewesen. Heute war sie ein anderer Mensch, mit jener jüngeren Rebecca nur durch das Muskelgedächtnis und das Gefühl der Skulls in ihren Händen verbunden. Jetzt wusste sie um den Preis des Scheiterns.
Und sie wusste, dass Milo recht hatte. Sie würde eine Entscheidung treffen müssen, und zwar bald. Sich ganz auf das Wettkampfrudern zu konzentrieren, würde bedeuten, dass sie sich vom Dienst freistellen lassen müsste, um ganztags zu trainieren. Sie könnte ganz aufhören. Oder sie könnte den unbezahlten Urlaub nehmen, den die Metropolitan Police ihr angeboten hatte.
Aber das würde bedeuten, eine offene Rechnung nicht zu begleichen.
Bei dem Gedanken wallte der Zorn in ihr auf, so heftig, dass sie instinktiv die Skulls mit aller Kraft durchzog und das Boot auf Wettkampfgeschwindigkeit beschleunigte. Die Ausleger knarrten, als der Druck auf das Boot sich verstärkte; Wassertropfen flogen von den Blättern, als sie in die Auslage ging, und spritzten ihr ins Gesicht.
Sie glitt jetzt über das Wasser, hörte nur das Rauschen und den dumpfen Schlag, mit dem die Blätter eintauchten, gefolgt von einem Moment absoluter Stille, wenn sie wieder auftauchten und das Boot einen Satz nach vorne machte wie ein lebendes Wesen. Das war Rhythmus in Perfektion, das war Musik. Das Boot surrte, und sie war ein Teil davon, wenn sie sich wie ein Vogel von der Wasserfläche aufschwang.
Henley schwand dahin, inzwischen nur noch ein schimmernder Lichtpunkt in der Ferne. Jetzt konnte sie den Himmel erst richtig sehen; ein rosiges Gold am Horizont, das allmählich zu Hellviolett verblasste. Die Wolken, die vor dem Hintergrund der dunklen Kuppel immer noch zu sehen waren, schienen dahinzujagen, Schlag um Schlag auf einer Höhe mit ihr. Am Berkshire-Ufer glitten vereinzelte Cottages – darunter irgendwo auch ihr eigenes – und Baumgruppen als verwaschene dunkle Flecken vorüber.
Zehn Schläge. Ihre Oberschenkel schmerzten.
Noch zehn, immer auf die Zählzeit konzentriert und darauf, die Blätter sauber aus dem Wasser zu ziehen.
Zehn weitere; ihre Schultern brannten jetzt wie Feuer.
Und noch einmal zehn, unter Aufbietung ihrer letzten Kraftreserven. Das Boot schoss über das Wasser, und ihre Kehle war wie ausgedörrt, als sie die Luft gierig in ihre Lunge sog.
Dann zog ein heller Fleck an ihr vorbei – der Zierpavillon auf Temple Island. Dieser schmale Streifen Land in der Mitte des Flusses, der einst zu Fawley Court gehört hatte, diente jetzt als Startpunkt für die Henley Royal Regatta. Nach der Insel würde sie umkehren müssen, sonst würde sie auch noch das letzte bisschen Licht verlieren und blind rudern müssen, um zum Leander-Club zurückzufinden.
Sie ließ in der Schlagzahl nach, sog ihre Lunge voll Luft und entspannte ihre verkrampften Muskeln. Als sie an der flussabwärts gelegenen Spitze der Insel vorbeikam, stabilisierte sie das Boot und ließ die Blätter leicht auf der Wasserfläche ruhen.
Plötzlich merkte sie, dass ihr Zorn verflogen war, und sie fühlte sich von einer tiefen, ruhigen Gewissheit erfüllt.
Sie würde antreten. Sie würde sich diese letzte Chance nicht entgehen lassen. Und wenn das bedeutete, dass sie den Dienst bei der Met quittieren müsste, dann würde sie ihn quittieren, aber sie würde sich nicht mit einer symbolischen goldenen Uhr und noch mehr leeren Versprechungen abspeisen lassen. Sie würde dafür sorgen, dass der Gerechtigkeit Genüge getan wurde, mit welchen Mitteln auch immer, für sich selbst und die anderen, denen Gleiches widerfahren war.
Die rasche Strömung trieb sie flussabwärts, auf die Schleuse und das Wehr zu. Ein Schwarm Krähen erhob sich mit lautem Flügelschlag vom Oxfordshire-Ufer. Während Becca ihnen bei ihrem abendlichen Ballett zusah, ließ sie das Boot herumschwingen. Als die Vögel aus ihrem Gesichtsfeld verschwunden waren, blickte sie bereits flussabwärts. Der Wind schien aufgefrischt zu haben. Er peitschte ihren Nacken, und als sie den ersten vollen Schlag durchzog, war der Widerstand der Strömung deutlich zu spüren.
Solange sie flussabwärts gerudert war, hatte sie sich mehr in der Mitte gehalten, um die schnelle Strömung auszunutzen. Jetzt ließ sie sich zum Buckinghamshire-Ufer treiben, wo die Strömung weniger heftig und das Flussaufwärtsrudern weniger anstrengend war. Jeder, der jemals beim Leander-Club gerudert war, kannte sämtliche Winkel und Biegungen, jeden Windschatten entlang des Buckinghamshire-Ufers, und die meisten hätten wie Becca die Strecke im Schlaf rudern können.
Doch die Dunkelheit wirkte noch undurchdringlicher, sobald man den Blick vom schwachen Lichtschein der Stadt abwandte, und es wurde zusehends kälter. Schon während der kurzen Pause war der Schweiß auf ihrer Haut merklich abgekühlt.
Becca schob sich nach vorne, drehte die Blätter auf und legte dann alle Kraft in ihren Schultern und Beinen in den Zug. Sie ruderte gleichmäßig, indem sie lautlos zählte – die Litanei des Ruderers –, während sie mit raschen Blicken zum Ufer hinüber abschätzte, wie sie vorankam.
Sie erreichte die flussaufwärts gelegene Spitze von Temple Island und erblickte wieder die bleiche Silhouette des Pavillons im Zuckerbäckerstil. Langsam, ganz langsam zogen die schwachen Umrisse vertrauter Landmarken vorüber. Hatte sie zuvor das Gefühl gehabt, in der Zeit rückwärtszugleiten, so kam es ihr nun vor, als stünde die Zeit still, als könne sie nur durch eigene Kraft die Uhrzeiger Millimeter für Millimeter vorwärtsbewegen.
Sie verstärkte ihre Anstrengungen, Zug um Zug, ging ganz auf im Rhythmus des Schlags. Erst in der momentanen Stille nach einem perfekten Zug hörte sie das Plätschern. Das Boot knarrte, als sie anhielt, als ob es sich dem abrupten Ende der Vorwärtsbewegung widersetzte.
Das Geräusch war sehr nahe gewesen und zu laut, um von einem untertauchenden Wasservogel zu kommen. Ein größeres Tier vielleicht, das vom Ufer ins Wasser geglitten war?
Sie schmeckte Salz und merkte, dass ihr von der Kälte und vom Wind die Nase lief. Rasch fasste sie beide Skulls mit einer Hand, um sich mit dem Ärmel des anderen Arms über die Lippe zu wischen. Das Boot schaukelte leicht, als sie sich umdrehte, um einen Blick flussaufwärts zu werfen, und hastig packte sie die Skulls wieder mit beiden Händen. Dann spähte sie angestrengt zum Ufer, doch das Halbdunkel unter den Bäumen war inzwischen undurchdringlicher Schwärze gewichen.
Achselzuckend drehte sie die Blätter, während sie das Geräusch ihrer zu regen Fantasie zuschrieb. Doch während sie in die Auslage rollte, vernahm sie einen Ruf. Kein Zweifel – es war eine menschliche Stimme, und sie klang merkwürdig vertraut. Und Becca hätte schwören können, dass sie ihren Namen rief.
2
Im Skiff fand ich mein Instrument …
Sara Hall, Drawn to the Rhythm
Freddie Atterton zog seine Mitgliedsmarke über den Scanner an der Einfahrt zum Parkplatz des Leander-Clubs und trommelte nervös mit den Fingern auf das Lenkrad, während er darauf wartete, dass die Schranke sich hob. Die Scheibenwischer des Audi vermochten kaum etwas auszurichten gegen die Wassermassen, die vom Himmel stürzten. Als die Schranke aufging, lehnte er sich nach vorne und spähte angestrengt durch die Windschutzscheibe, während er die Kupplung kommen ließ. Beim Anfahren spürte er, wie der Kies unter den Reifen wegjrutschte.
»Verfluchter Regen«, murmelte er, als er den Wagen auf den nächsten freien Platz lenkte. Der Parkplatz verwandelte sich rapide in einen Sumpf. Er könnte von Glück sagen, wenn er nachher überhaupt noch wegkäme. Und er würde es definitiv nicht vom Auto zum Clubhaus schaffen, ohne seine handgenähten italienischen Schuhe zu ruinieren oder auch nur den Regenschirm aufzuspannen, ehe sein Jackett klatschnass war.
Er stellte den Motor ab und sah auf seine Uhr – fünf vor acht. Keine Zeit, eine Regenpause abzuwarten. Er wollte nicht triefnass in den Club gerannt kommen, nur um festzustellen, dass sein potenzieller Investor schon da war. Dieser Frühstückstermin war zu wichtig, als dass er es sich leisten könnte, wie ein begossener – und gehetzter – Pudel aufzukreuzen.
Und er wäre gerne besser informiert gewesen. Der Teufel sollte Becca holen – wieso hatte sie ihn gestern Abend nicht zurückgerufen? Er hatte es an diesem Morgen erneut versucht, aber auch diesmal hatte er sie weder auf dem Festnetz noch auf dem Handy erreicht.
Nach über einem Jahrzehnt bei der Metropolitan Police kannte Becca so gut wie jeden, der bei der Londoner Polizei irgendetwas darstellte. Freddie hatte gehofft, sie könnte ihm ein paar Tipps bezüglich seines Interessenten geben, der erst vor kurzem aus dem Polizeidienst ausgeschieden war. Normalerweise würde man ja nicht erwarten, dass ein hundsgewöhnlicher Met-Beamter flüssig genug war, um Geld in ein Immobiliengeschäft zu stecken, das – wie Freddie selbst zugeben musste – immer noch reichlich vage war.
Aber dieser Typ, Angus Craig, war als Deputy Assistant Commissioner ein ziemlich hohes Tier gewesen, und er wohnte in einem Dorf ganz in der Nähe, das zweifellos zu den vornehmsten Lagen der Gegend zählte. Freddie war vorige Woche beim abendlichen Drink in seinem örtlichen Club mit ihm ins Gespräch gekommen. Dabei hatte Craig durchblicken lassen, dass ihm die Vorstellung, sein Geld in ein Projekt zu investieren, das er im Auge behalten konnte, sehr sympathisch sei. Freddie hatte gehofft, dass Becca ihm sagen könnte, ob Craig ein ernstzunehmender Geschäftspartner war.
Und wenn nicht, hätte Freddie ein echtes Problem. Er hatte den heruntergekommenen Bauernhof samt Wirtschaftsgebäuden am Themseufer unterhalb von Remenham gekauft, um ihn in Luxuswohnungen umzuwandeln – geschmackvolles Wohnen auf dem Lande mit allem City-Komfort und Flussblick. Aber dann war der Markt eingebrochen, und jetzt fehlte ihm das Geld, um die Sache durchzuziehen.
Er fischte sein Handy aus der Jackentasche und vergewisserte sich noch einmal, dass ihm kein Anruf entgangen war, doch die Anzeige war dunkel. Seine Verärgerung wich allmählich leiser Sorge. Becca war schon immer ein Dickkopf gewesen, doch es war ihnen gelungen, nach der Scheidung eine Art ganz spezieller Freundschaft aufrechtzuerhalten, und er hätte zumindest erwartet, dass sie ihn zurückrief, um ihm zu sagen, dass er sich um seinen eigenen Kram kümmern sollte.
Vielleicht war er zu weit gegangen, als er ihr wegen ihrer Ruderpläne den Kopf gewaschen hatte. Aber er konnte einfach nicht glauben, dass sie ihre Karriere als Detective Chief Inspector aufs Spiel setzen wollte, nur um dem Traum von einer olympischen Goldmedaille nachzujagen, den jeder vernünftige Mensch schon vor Jahren aufgegeben hätte. Er selbst hatte den Lockruf des Ruderns vernommen, und er war weiß Gott ehrgeizig gewesen, aber irgendwann kam doch der Punkt, wo einem klar wurde, dass man es gut sein lassen und sich auf das wirkliche Leben besinnen musste. Wie er es getan hatte.
Plötzlich befiel ihn ein leises Unbehagen, als er sich fragte, ob er es auch so leicht aufgegeben hätte, wenn er so gut gewesen wäre wie sie. Und wie erfolgreich war er denn gewesen im wirklichen Leben? Sogleich schob er diesen lästigen Gedanken beiseite. Es würde sich schon alles zum Guten wenden; so war es immer gewesen.
Vielleicht sollte er das, was er zu Becca gesagt hatte, noch einmal überdenken. Aber jetzt erst einmal zu Mr. Craig.
Doch wer nicht erschien, war Angus Craig.
Freddie war aus dem Audi gesprungen, hatte seinen Regenschirm mit der Behändigkeit eines Zauberkünstlers aufgespannt und war über den durchweichten Parkplatz gepatscht, um sich in der Lobby des Leander-Clubs in Sicherheit zu bringen. Lily, die Empfangschefin, hatte ihm aus dem Mannschaftsquartier ein Handtuch geholt und ihn dann an seinem Lieblingstisch in der Fensternische des Speisesaals im ersten Stock Platz nehmen lassen.
»Heute wird die Mannschaft wohl kaum aufs Wasser gehen«, meinte er mit einem Blick auf die dichten Regenschleier, die über den Fluss hinwegzogen. Es war wirklich ungemütlich da draußen, selbst für die Mannschaft von Leander, die sich einiges auf ihre Zähigkeit einbildete. Wobei jeder, der je beim Boat Race für Oxford oder Cambridge im »Blue Boat« gesessen hatte, von widrigen Wetterverhältnissen ein Lied zu singen wusste. Und vom Kampf gegen den inneren Schweinehund.
Einmal war Freddies Boot bei ähnlichen Wetterbedingungen während der berühmten Regatta auf der Themse vollgelaufen. Ein unerfreuliches Erlebnis, gelinde ausgedrückt, und auch nicht ungefährlich.
»Erwarten Sie noch jemanden?«, fragte Lily, während sie ihm Kaffee einschenkte.
»Ja.« Freddie schaute noch einmal auf seine Uhr. »Aber er hat sich verspätet.«
»Von den Mitarbeitern sind einige auch noch nicht gekommen«, erwiderte Lily. »Der Koch hat erzählt, es hätte auf der Marlow Road eine Massenkarambolage gegeben.«
»Das ist wahrscheinlich die Erklärung.« Freddie rang sich ihr zuliebe ein Lächeln ab. Sie war ein hübsches Mädchen, eine adrette Erscheinung in ihrer Leander-Uniform, bestehend aus marineblauem Rock und blassrosa Bluse, das honigbraune Haar in einem Knoten zurückgebunden. Noch vor ein paar Jahren hätte sie ihn durchaus interessiert, aber inzwischen hatte er aus seinen Fehlern gelernt. Heute war er klüger und auch nicht mehr so unternehmungslustig. »Danke, Lily. Ich gebe ihm noch ein paar Minuten, ehe ich bestelle.«
Sie ließ ihn allein, und er schlürfte seinen Kaffee, während er müßig den Blick über die anderen Gäste schweifen ließ. So früh in der Woche, und zumal zu dieser Jahreszeit, waren vermutlich nur wenige der zehn oder zwölf Zimmer des Clubs belegt. Und bei diesem Wetter waren die meisten der Mitglieder, die in der Nähe wohnten und gewöhnlich im Club frühstückten, wohl lieber zu Hause geblieben. Das Essen hier war allerdings außergewöhnlich gut und überraschend preiswert.
Aber auch wenn im Speisesaal nicht viel los war, hatte der Koch bestimmt alle Hände voll zu tun. Er war nämlich auch dafür zuständig, den gewaltigen Appetit der jungen Athleten zu stillen, die in ihren eigenen Räumen aßen. Ruderer waren immer kurz vor dem Verhungern – das war für sie so natürlich wie Atmen.
Um halb neun – Freddie hatte seine zweite Tasse Kaffee schon fast ausgetrunken und verspürte allmählich das dringende Bedürfnis nach einer Zigarette – wählte er noch einmal Craigs Nummer und wurde auf die Mailbox weitergeleitet.
Um Viertel vor neun bestellte er sein übliches Frühstück, Rührei mit Räucherlachs, doch er musste feststellen, dass ihm der Appetit vergangen war. Während er den Teller mit dem Rührei von sich schob und stattdessen eine Scheibe Toast mit Butter bestrich, fiel ihm auf, dass der Regen nachgelassen hatte. Er konnte jetzt über den Fluss hinwegsehen, wenngleich es sich bei der wässrig grauen Kulisse aus Ladenfronten und Dächern am gegenüberliegenden Ufer ebenso gut um Venedig hätte handeln können. Aber vielleicht war ja der Verkehr inzwischen wieder in Gang gekommen. Er würde Craig noch ein paar Minuten geben.
Als er am Empfang Stimmen hörte, drehte er sich um. Doch es war nicht der kräftige, strohblonde Craig, sondern Milo Jachym, der Trainer der Damenmannschaft, der sich mit Lily unterhielt. Er trug Regenkleidung, und seine kleine, stämmige Gestalt strahlte Entschlossenheit aus.
»Milo«, rief Freddie, indem er aufstand und durch den Speisesaal auf ihn zuging. »Geht ihr aufs Wasser?«
»Ich denke drüber nach. Wir haben vielleicht eine Stunde oder so, ehe der nächste Schauer durchzieht.« Milo zog den Reißverschluss seines Anoraks hoch und spähte zur Tür der Rezeption hinaus. Als Freddie seinem Blick folgte, entdeckte er in der grauen Wolkendecke im Westen tatsächlich hier und da ein Stückchen blauen Himmel. »Ich würde sie gerne von den Ergos runterholen und in die Boote setzen, auch wenn es nur für ein kurzes Training ist. Sonst werden sie mir den Rest des Tages die Ohren volljammern.«
»Kann’s ihnen nicht verdenken. Verdammte Ergos.« Alle Ruderer hassten die Ergometer – die Geräte, mit denen man die Ruderbewegungen simulieren und die Leistung des Sportlers messen konnte. Das Training an den Ergos war mörderisch anstrengend, nur ohne die Befriedigung, die man empfand, wenn man ein Boot aus eigener Kraft über das Wasser bewegte. Das einzig Gute am Ergo-Training war, dass es so stupide war – man konnte den Verstand einfach ausschalten, während man sich körperlich bis über die Schmerzgrenze hinaus anstrengte, ohne dabei befürchten zu müssen, dass man in irgendetwas hineinfuhr und so Leben und Gesundheit riskierte.
Milo grinste. »Das hab ich ja noch nie gehört.« Er wandte sich wieder zu den Mannschaftsräumen um. »Ich scheuch sie besser raus, ehe es zu spät ist.«
Freddie hielt ihn zurück, indem er ihn am Arm fasste. »Milo, hast du mal eine Gelegenheit gehabt, mit Becca zu sprechen? Ich hatte gehofft, du könntest sie vielleicht zur Vernunft bringen.«
»Na ja, gesprochen hab ich mit ihr, aber zur Vernunft bringen …« Er sah Freddie an und runzelte nachdenklich die Stirn. »Ich glaube, da rennst du gegen eine Wand. Vielleicht solltest du dich einfach in Würde geschlagen geben. Und wieso bist du eigentlich so sicher, dass sie nicht gewinnen kann?«
»Glaubst du denn, dass sie eine Chance hat?«, fragte Freddie erstaunt zurück.
»Weder in diesem Team« – er deutete mit dem Kopf zum Mannschaftsquartier – »noch in irgendeinem anderen, das ich im vergangenen Jahr gesehen habe, gibt es auch nur eine Frau, die einer Rebecca in Bestform davonfahren könnte.«
»Aber sie ist –«
»Fünfunddreißig. Na und?«
»Ja, ja, ich weiß. Und sie würde mich umbringen, wenn sie mich so reden hörte.« Er imitierte Becca, wenn sie ihre oberlehrerhafte Art herauskehrte: »Redgrave war achtunddreißig, Pinsent vierunddreißig, Williams zweiunddreißig … Und Katherine Grainger hat mit dreiunddreißig Silber gewonnen …« Freddie zuckte mit den Achseln. »Aber die hatten alle schon Medaillen im Schrank. Sie nicht.«
»Sie hat die gleiche Fähigkeit, sich bis aufs Blut zu quälen. Und das ist es, worauf es ankommt. Das weißt du selbst ganz genau.«
»Okay«, gab Freddie zu. »Vielleicht hast du recht. In dem Fall sollte ich mich vielleicht besser entschuldigen. Aber sie beantwortet meine Anrufe nicht. Wann hast du mit ihr gesprochen?«
»Gestern. So gegen halb fünf. Sie ist mit ihrem Skiff rausgefahren. Sie sagte, sie würde es selbst wieder aufbocken, wenn sie zurück ist.« Milo runzelte die Stirn. »Aber jetzt, wo du es sagst – ich kann mich nicht erinnern, es gesehen zu haben, als ich heute Morgen zum Fluss runtergegangen bin, um zu sehen, wie die Bedingungen sind. Vielleicht ist sie bei ihrem Cottage an Land gegangen.«
»Eher nicht. Sie hätte den Bootssteg der Nachbarn benutzen müssen.« Möglich war es allerdings, dachte Freddie. Aber auch dann hätte sie das Boot durch den Nachbargarten tragen müssen, um es in ihrem eigenen abzustellen, und sie hatte keine Möglichkeit, es bei sich zu lagern. Und warum sollte sie das tun, wenn sie ihr Filippi doch hier im Club liegen hatte?
Es sei denn, sie hätte sich plötzlich schlecht gefühlt und es nicht bis zum Club zurückgeschafft. Das sah Becca allerdings gar nicht ähnlich. Die Unruhe, die schon die ganze Zeit an ihm nagte, verstärkte sich noch. Er sah auf seine Uhr und beschloss, dass Angus Craig ihm den Buckel herunterrutschen konnte. »Ich sehe mal auf den Bootsständern nach.«
»Ich komme mit.« Milo hielt inne und beäugte kritisch Freddies marineblaues Jackett mit der blau-pink gestreiften Leander-Krawatte. »So wirst du doch klatschnass. An der Bar hängt noch ein Anorak, den du nehmen kannst.«
Aber Freddie war schon auf dem Weg nach draußen. Vom Empfangsbereich im ersten Stock gelangte man auf eine Terrasse, von der links und rechts Stufen hinunterführten. Freddie wandte sich nach links, in Richtung Fluss und Bootsplatz. Inzwischen nieselte es nur noch, doch als er an den Bootsständern anlangte, wischte er sich erst einmal ungeduldig die feuchten Haare aus der Stirn.
Der Ständer, auf dem Becca ihr Filippi aufbewahrte, war leer. »Es ist nicht hier«, sagte er, obwohl Milo das ebenso gut sehen konnte wie er selbst.
»Vielleicht hat sie es aus irgendeinem Grund in die Halle getragen. Sie hat einen Schlüssel.« Milo zog seine Kapuze hoch, um sich vor dem Regen zu schützen, und marschierte auf das Clubhaus zu. Die Bootshalle befand sich unter dem Speisesaal, und an schönen Tagen, wenn die Mannschaften auf dem Wasser trainierten, standen die großen Türen weit offen.
An diesem Morgen jedoch traten sie durch die kleinere Tür auf der rechten Seite ein, und Milo schaltete das Licht ein. Die Halle war ein riesiger, kahler Raum, dessen Ecken im Halbdunkel lagen. Es roch nach Holz und Lack, aber auch ein wenig nach Schweiß und Schimmel. Aus dem angrenzenden Kraftraum war das dumpfe Klacken der Gewichte zu hören.
Normalerweise empfand Freddie die Atmosphäre in der Halle als eigenartig beruhigend, aber jetzt krampfte sein Magen sich zusammen, da er nur die Ständer mit den leuchtend gelb gestrichenen Empacher-Booten sah. Das waren die Vierer und Achter, mit denen die Mannschaft ruderte. Die Skulls mit den rosa gestrichenen Blättern standen wie Flaggen in ihren Ständern am hinteren Ende des langen Raums. Von dem weißen Filippi mit seinem charakteristischen blauen Streifen war weit und breit nichts zu sehen.
»Okay«, sagte Milo, »es ist nicht hier. Fragen wir mal bei der Crew nach.« Er öffnete die Tür zum Kraftraum und rief: »Johnson!«
Der vielversprechende junge Bugmann des Vierers ohne Steuermann erschien in der Tür. Er war nur mit Unterhemd und Shorts bekleidet und wischte sich mit einem Handtuch den Schweiß aus dem Gesicht. »Gehen wir raus, Milo?« Er begrüßte Freddie mit einem Nicken.
»Noch nicht«, antwortete Milo. »Steve, hast du Becca Meredith gesehen?«
Johnson wirkte überrascht. »Becca? Nein. Nicht seit Sonntag, auf dem Fluss. Da hat sie ordentlich trainiert. Wieso?«
»Sie ist gestern Abend rausgefahren, und ihr Boot ist immer noch nicht da.«
»Haben Sie versucht, sie anzurufen?«, fragte Johnson in einem beiläufigen Ton, der Freddie plötzlich wütend machte.
»Natürlich hab ich versucht, sie anzurufen, Mann.« Er wandte sich zu Milo um. »Also, ich sehe jetzt mal im Cottage nach.«
»Freddie, ich finde, dass du überreagierst«, meinte Milo. »Du weißt, dass Becca ihren eigenen Kopf hat.«
»Das weiß niemand besser als ich. Aber die Sache gefällt mir nicht, Milo. Ruf mich an, wenn du etwas hörst.«
Er nahm denselben Weg zurück, den sie gekommen waren, nicht durch die Mannschaftsräume zum Club, sondern über den Rasen zum Parkplatz. An seine Schuhe oder sein nasses Jackett verschwendete er jetzt keinen Gedanken mehr.
Vielleicht war es eine Überreaktion, dachte er, als er wieder in den Audi stieg. Aber er versuchte es noch einmal auf ihrem Handy, und als der Anruf auf die Mailbox geleitet wurde, trennte er die Verbindung und ließ den Motor an. Mochte sie ihn in der Luft zerreißen, weil er seine Nase in ihre Angelegenheiten steckte – er war jedenfalls entschlossen, selbst nachzusehen.
Er musste zwar eine Weile hin und her manövrieren, um den Audi aus den tiefen, matschigen Furchen im Kies herauszubekommen, doch endlich gelang es ihm.
Ein Dialog, der sich wiederholt so abgespielt hatte, ging ihm durch den Kopf. Warum kannst du dir nicht ein Mal ein vernünftiges Auto zulegen?, hatte Becca gefragt.
Weil du keine teuren Immobilien verkaufen kannst, wenn die potenziellen Käufer glauben, du könntest dir nicht das Beste vom Besten leisten, hatte er stets erwidert, doch es gab Tage, da hätte er für einen Wagen mit Allradantrieb seine Großmutter verkauft, und heute war so ein Tag.
Vom Parkplatz fuhr er hinaus auf die Hauptstraße und bog gleich darauf links in die Remenham Lane ab. Während er der Straße in Richtung Norden folgte, sah er, wie sich im Westen schon wieder die Wolken auftürmten.
Das Cottage aus rotem Backstein lag zwischen der Straße und dem Fluss, inmitten eines überwucherten Gartens. Die Gartenarbeit war Freddies Job gewesen, den er regelmäßig, wenngleich mit bescheidenem Talent erledigt hatte. Becca hatte einfach alles sich selbst überlassen, bis der Garten an eine Dornröschenhecke erinnerte.
Ihr verbeulter Nissan-Geländewagen stand in der Einfahrt. Für Autos interessierte Becca sich ebenso wenig wie fürs Gärtnern; solange man damit ein Boot ziehen konnte, war ihr alles recht. Wenn der Nissan nicht über und über mit Schlamm bespritzt war, dann nur deshalb, weil der Regen alles abgewaschen hatte. Der Anhänger stand auf dem Rasenstück neben der Einfahrt, und ihr Filippi lag nicht darauf.
Im gleichen Moment, als Freddie die Tür des Audi öffnete, tat es einen Donnerschlag, und der Himmel öffnete seine Schleusen. Freddie sprintete auf das Cottage zu, schlitterte das letzte Stück bis unter das Vordach und schüttelte sich das Wasser aus den Haaren.
Durch die Buntglasscheibe in der Haustür war kein Licht zu sehen. Die Klingel funktionierte nicht – er war nie dazu gekommen, sie zu reparieren –, weshalb er mit der Faust an die hölzerne Einfassung hämmerte.
»Becca. Becca! Mach schon die verdammte Tür auf!«
Als keine Antwort kam, kramte er seinen Schlüsselbund aus der Tasche und steckte den schweren Haustürschlüssel ins Schloss.
»Becca, ich komm jetzt rein«, rief er, als er die Tür aufstieß.
Drinnen war es kalt, und kein Laut war zu hören.
Ihre Handtasche stand auf der Bank unter den Garderobenhaken, wo sie sie immer abstellte, wenn sie von der Arbeit nach Hause kam. Daneben lag eine achtlos hingeworfene graue Kostümjacke, doch abgesehen davon sah im Wohnzimmer alles so aus wie immer. Die gelbe Fleecejacke, die sie beim Rudern trug, hing nicht am Haken, und auch ihre pinkfarbene Leander-Mütze fehlte.
Er rief noch einmal ihren Namen und sah rasch in der Küche und im Esszimmer nach. Auf der Anrichte lag ein Stapel ungeöffneter Post, im Spülbecken standen eine abgespülte Tasse und ein Teller, auf der Arbeitsfläche eine Tüte Katzenfutter für die Nachbarskatze, die Becca manchmal fütterte.
Das ganze Haus fühlte sich irgendwie menschenleer und verlassen an, auch wenn er sich nicht recht erklären konnte, wieso. Dennoch stieg er die Treppe hinauf und warf einen Blick ins Schlafzimmer und ins Bad. Das Bett war gemacht; der Rock, der zu der Jacke gehörte, die er unten gesehen hatte, lag auf einem Stuhl, zusammen mit einer weißen Bluse und einer zusammengeknüllten Strumpfhose.
Die Badewanne war trocken, doch in der Luft hing ein leiser Hauch von Parfüm – Light Blue von Dolce & Gabbana, eines von Beccas wenigen Zugeständnissen an weibliche Eitelkeit.
Er öffnete die Tür des zweiten Zimmers, das ihm früher als Büro gedient hatte, und stieß einen überraschten Pfiff aus, als er die Gewichte und das Ergometer sah. Es war ihr also ernst mit dem Trainieren. Wirklich ernst.
Aber wo zum Teufel steckte sie nur?
Er trabte wieder nach unten, schnappte sich einen Anorak von der Garderobe und ging hinaus in den Garten, den Kopf eingezogen, um sich vor dem peitschenden Regen zu schützen. Nur der Garten von Beccas Nachbarn grenzte ans Ufer, aber er sah dennoch nach, ob sie vielleicht dort ihr Boot an Land gezogen hatte. Nachdem er sich vergewissert hatte, dass nur umgedrehte Gartenmöbel auf dem Rasen standen, eilte er ins Haus zurück und zog mit kalten, klammen Fingern sein Handy aus der Tasche. Donner grollte und ließ die Wände des Cottage erzittern.
Becca würde es ihm sicher übelnehmen, dass er ihren Chef, Superintendent Peter Gaskill, anrief, aber er wusste einfach nicht, was er sonst tun sollte. Er kannte Gaskill nicht besonders gut, da Becca erst kurz vor der Scheidung in sein Team versetzt worden war, doch sie waren sich schon bei verschiedenen Polizeiveranstaltungen und der einen oder anderen Dinnereinladung begegnet.
Freddies Anruf wurde von der Sekretärin des Dezernats durchgestellt. Als Gaskill abhob, nannte Freddie seinen Namen und sagte dann: »Bitte entschuldigen Sie die Störung, Peter, aber ich versuche seit gestern, Becca zu erreichen, und ich mache mir allmählich ein wenig Sorgen. Ich habe mich schon gefragt, ob es vielleicht einen dienstlichen Notfall gegeben hat …« Schon während er es sagte, kam es ihm unwahrscheinlich vor. Er erklärte die Sache mit dem Boot und fügte hinzu, dass Becca allem Anschein nach seit dem gestrigen Abend nicht zu Hause gewesen war und dass ihr Wagen noch in der Einfahrt stand.
»Wir hatten heute Morgen eine wichtige Dienstbesprechung«, sagte Gaskill. »Sie ist weder erschienen, noch hat sie mich zurückgerufen, und ich habe es noch nie erlebt, dass sie irgendeine Sitzung versäumt hätte. Sind Sie sicher, dass sie nicht zu Hause ist?«
»Ich bin gerade in ihrem Cottage.«
Am anderen Ende war es still, als ob Gaskill überlegte. Dann sagte er: »Sie erzählen mir hier also, dass Becca gestern Abend auf den Fluss hinausgerudert ist, im Dunkeln, ganz allein in einem Rennruderboot, und dass weder sie selbst noch das Boot seither gesehen worden sind.«
Die nüchterne Zusammenfassung der Fakten jagte Freddie einen kalten Schauer über den Rücken. Der Einwand, dass sie doch schließlich eine erfahrene, exzellente Ruderin sei, erstarb auf seinen Lippen. »Ja.«
»Sie bleiben dort«, wies Gaskill ihn an. »Ich alarmiere die Polizei vor Ort.«
Zwei Familien, deren Mitglieder einander größtenteils fremd waren, hatten ein langes Wochenende zusammen verbracht, eingeschlossen in den verschachtelten Räumen des Pfarrhauses im Herzen des Weilers Compton Grenville nahe Glastonbury in Somerset, während draußen Gewitter tobten und das Wasser ringsum anstieg. Ein Szenario mit allen Ingredienzien eines Agatha-Christie-Krimis, dachte Detective Inspector Gemma James.
»Oder vielleicht eines Horrorfilms«, sagte sie laut zu ihrer Freundin – und nunmehr angeheirateten Cousine – Winnie Montfort, die an der altmodischen Spüle der Pfarrhausküche stand, die Arme bis zu den Ellbogen im Spülwasser. Winnie, eine anglikanische Pfarrerin, war mit Duncan Kincaids Cousin Jack verheiratet.
Und Gemma war jetzt mit Detective Superintendent Duncan Kincaid verheiratet, eine Tatsache, die sie immer noch erstaunt innehalten ließ, wenn sie daran dachte. Verheiratet. Wirklich und wahrhaftig. Und gleich drei Mal, wie Duncan nicht müde wurde zu betonen, wenn er sie necken wollte. Sie berührte ihren Ring, froh um die greifbare Erinnerung.
Sie hatten als Partner im Dienst begonnen, nachdem Gemma als Detective Sergeant in Duncans Abteilung Schwerkriminalität bei Scotland Yard versetzt worden war. Nachdem sich daraus eine persönliche Beziehung entwickelt hatte – auf die Gemma sich zunächst nur wider besseres Wissen eingelassen hatte –, bewarb sie sich um die Stelle eines Detective Inspector. Die Beförderung brachte Vor- und Nachteile mit sich. Einerseits bedeutete sie das Ende ihrer dienstlichen Partnerschaft, andererseits waren sie nun nicht mehr gezwungen, ihre private Beziehung geheim zu halten.
Dennoch hatte Gemma weiterhin ernste Bedenken gegen eine feste Bindung gehegt. Beide hatten eine gescheiterte Ehe hinter sich; beide hatten Söhne, die schon mehr als genug unter Veränderungen undVerlusten gelitten hatten. Und Gemma hatte sich bisweilen geradezu verbissen dem Verlust ihrer Eigenständigkeit – wie sie es empfand – widersetzt.
Aber Duncan hatte Geduld bewiesen, und mit der Zeit hatte Gemma erkannt, dass die Bewahrung ihres gemeinsamen Glücks jedes Risiko wert war.
Und so hatten sie zunächst an einem herrlichen Tag im vergangenen August im Garten ihres Hauses im Londoner Stadtteil Notting Hill eine weltliche Segenszeremonie abgehalten. Wenige Wochen darauf hatten sie dann auf dem Standesamt von Chelsea ihre Verbindung offiziell gemacht.
Und jetzt, während der Schulferien Ende Oktober, hatten Winnie und Jack Duncan und Gemma samt ihren Familien nach Compton Grenville eingeladen, damit Winnie sie kirchlich trauen konnte – in einem feierlichen Rahmen, den ihre Ehe nach Winnies Meinung verdient hatte.
Die Zeremonie in Winnies Kirche am Samstagnachmittag war genau so gewesen, wie Gemma sie sich gewünscht hatte: schlicht, persönlich und innig; und sie hatte ihre Verbindung noch einmal auf ganz andere Weise feierlich besiegelt. Aller guten Dinge sind drei, wie Duncan ihr immer wieder versicherte. Und vielleicht hatte er recht, denn inzwischen hatte das Schicksal ein weiteres Kind in ihr Leben treten lassen – die kleine, noch nicht ganz drei Jahre alte Charlotte Malik.
Winnie wandte sich von dem Berg schmutzigen Geschirrs ab, den Hinterlassenschaften des üppigen Abschiedsfrühstücks, das sie für ihre Wochenendgäste bereitet hatte. »Ein Horrorfilm? Was?« Mit dem Schaumklecks, den sie sich irgendwie auf die Nasenspitze praktiziert hatte, und ihren fragend aufgerissenen Augen bot sie einen komischen Anblick.
Die in Grün und Tomatenrot gehaltene Küche war ein behaglicher Zufluchtsort, und Winnie war eine gute Freundin, die Gemma schon in schwierigen Zeiten zur Seite gestanden hatte.
An diesem Dienstagmorgen, kurz vor dem Ende des Besuchs, nachdem bis auf Duncans Eltern alle schon abgereist waren, hatten Gemma und Winnie sich endlich ein paar ungestörte Momente sichern können, in denen sie das Wochenende Revue passieren lassen konnten. Gemma hatte sich erboten, den Abwasch zu übernehmen, doch Winnie hatte darauf bestanden, dass Gemma die letzten paar Minuten mit Winnies und Jacks neugeborener Tochter genießen sollte.
Gemma bettete die kleine Constance etwas bequemer auf ihrem Schoß. »Na ja, ›Horrorfilm‹ ist vielleicht ein bisschen heftig«, verbesserte sie sich lächelnd. Doch ihre Ausgelassenheit verflog, als sie an den Wermutstropfen in einem ansonsten perfekten Wochenende zurückdachte. »Manchmal«, sagte sie, »kann meine Schwester ein richtiges Aas sein.«
Winnie streifte ihre Gummihandschuhe ab, setzte sich zu Gemma an den Tisch und griff nach Constance. »Komm, musst ja nicht gleich das Baby stellvertretend für sie erdrücken.«
»Tut mir leid«, erwiderte Gemma verlegen. Sie gab Constance einen Kuss auf das flaumige Köpfchen, bevor sie sie ihrer Mutter übergab. »Sie bringt mich einfach immer wieder auf die Palme. Ich meine Cyn, nicht Constance.«
»Nun ja, ich kann verstehen, dass Cyn sich an diesem Wochenende ein bisschen unbehaglich gefühlt hat. Sie und deine Eltern waren diejenigen, die irgendwie nicht richtig dazugehören –«
»Unbehaglich?« Gemma schüttelte den Kopf. »Du bist zu diplomatisch. Das ist eine sehr beschönigende Umschreibung dafür, dass sie sich wie eine richtige Xanthippe aufgeführt hat.« Ehe Winnie protestieren konnte, fuhr sie fort: »Aber es ist nicht nur das. Sie ist schon die ganze Zeit so ekelhaft, seit wir von Mutters Krankheit wissen.« Bei Gemmas und Cyns Mutter Vi war im vergangenen Frühjahr Leukämie diagnostiziert worden. »Mir ist schon klar, dass das Cyns Art ist, mit ihrer eigenen Angst umzugehen. Ich kann das verstehen, auch wenn ich sie am liebsten erwürgen würde. Aber für diese Sache mit Charlotte gibt es einfach keine Entschuldigung.«
»Was ist mit Charlotte?«, fragte Winnie, und ihr freundliches Gesicht nahm plötzlich einen besorgten Ausdruck an.
»Ich glaube, Cyn hat ihren Kindern gesagt, dass sie nicht mit ihr spielen sollen. Ist dir das nicht aufgefallen?«
»Nun, ich habe mir schon gedacht, dass sie ein bisschen … gehemmt wirkten –«
»Wie konnte sie nur? Sie werden schließlich bald Cousins und Cousinen sein, Herrgott noch mal.« Beim zornigen Klang von Gemmas Stimme zog Constance die kleine Stirn in Falten. Gemma holte tief Luft, um sich zu beruhigen, ehe sie die Hand ausstreckte und mit dem Finger über die Wange des Babys strich. »Entschuldige, Schätzchen.« Constance hatte die vornehme englische Blässe ihrer Mutter und die strahlenden blauen Augen von Jack geerbt, und nach ihrem blonden Flaum zu schließen, würde sie auch die gleiche Haarfarbe bekommen wie ihr Vater.
Doch mit ihren karamellfarbenen Löckchen und ihrem hellbraunen Teint war Charlotte mindestens ebenso hübsch, und die Vorstellung, dass irgendjemand allein wegen ihrer Hautfarbe anderer Meinung sein oder sie anders behandeln könnte, machte Gemma rasend vor Wut. »Ich habe gehört, wie Cyn über Charlotte geredet hat – mit einem Ausdruck, den man unmöglich wiederholen kann«, verriet sie. »Ich könnte sie umbringen.«
»Gemma, du musst doch damit gerechnet haben –«
»O ja, wir waren durchaus vorgewarnt. Die Frau vom Jugendamt war sehr gründlich. ›Es kommt manchmal vor, dass Kinder gemischter Herkunft von der Verwandtschaft der Adoptiveltern nicht akzeptiert werden‹«, zitierte Gemma. »Aber ich habe wohl zu viel We Are The World-Videos gesehen«, fügte sie seufzend hinzu. Während ihre Schwester einfach nur unverschämt war, hatten ihre Eltern sich dem Kind gegenüber sehr reserviert verhalten, was Gemma tief getroffen hatte. »Charlotte hat ohnehin schon genug durchgemacht.«
Sie und Duncan hatten das kleine Mädchen im August in Pflege genommen, nachdem sie gemeinsam wegen des Verschwindens ihrer Eltern ermittelt hatten.
»Wie geht es ihr denn eigentlich?«, fragte Winnie, während sie Constance, die allmählich unruhig wurde, auf dem Knie schaukelte. »Dieses Wochenende war so hektisch, dass ich gar nicht dazu gekommen bin, dich danach zu fragen oder dir zu sagen, wie entzückend sie ist.«
»Ja«, erwiderte Gemma, und ihre Stimme wurde weich. »Das ist sie, nicht wahr?« Ihre Arme fühlten sich plötzlich leer an ohne das Baby, und in die zärtliche Zuneigung, die sie empfand, wenn sie Winnie mit ihrer Tochter im Arm beobachtete, mischte sich ein klein wenig Neid. »Aber –« Sie zögerte, während sie auf das fröhliche Kindergeschrei lauschte, das aus dem Garten kam. Charlottes aufgeregtes Rufen hob sich unverkennbar von den Stimmen der Jungs ab. Vielleicht, dachte Gemma, reagierte sie tatsächlich zu heftig und maß ganz normalen Eingewöhnungsproblemen zu viel Bedeutung bei.
»Aber?«, fragte Winnie nach und legte sich Constance über die Schulter.
»Sie schläft schlecht«, gestand Gemma. »Ich glaube, sie hat Alpträume, und wenn sie aufwacht, ist sie oft untröstlich. Sie –« Gemma hielt inne; ihre Stimme drohte plötzlich zu versagen, und sie musste sich zusammenreißen, ehe sie weitersprach. »Sie ruft nach ihrer Mama und ihrem Papa. Und dann fühle ich mich immer so – so –« Sie zuckte mit den Achseln.
»Hilflos. Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber sie hängt schon sehr an dir. Das habe ich gesehen.«
»Manchmal ein bisschen zu sehr, fürchte ich. Sie klammert regelrecht.«
Sie war mit Duncan übereingekommen, dass sie so lange abwechselnd unbezahlten Elternurlaub nehmen würden, bis sie das Gefühl hatten, dass Charlotte sich in ihrer neuen Umgebung sicher genug fühlte, um in eine Tagesstätte gehen zu können.
Gemma hatte bereitwillig die erste »Schicht« übernommen, doch in der kommenden Woche sollte sie auf ihren Posten als Detective Inspector im Revier Notting Hill zurückkehren, und sie hatte fast ein schlechtes Gewissen, weil sie es kaum erwarten konnte, wieder zu arbeiten und in der Gesellschaft von Erwachsenen zu sein. Sie fragte sich, ob es wirklich die richtige Entscheidung war, wieder arbeiten zu gehen. »Ich hoffe bloß, dass Duncan allein zurechtkommt.«
»Nun trau deinem Mann doch mal was zu«, meinte Winnie grinsend und deutete mit dem Kopf zum Garten, wo Duncan und Jack mit den Kindern in den Pfützen herumtrampelten. »Er macht sich doch gar nicht schlecht. Es ist nicht zu übersehen, wie sehr er Charlotte liebt. Und wenn ihr beide diese Verpflichtung übernehmen wollt, dann muss sie zu ihm eine genauso enge Bindung entwickeln wie zu dir.« Sie warf Gemma einen forschenden Blick zu. »Hast du dir das auch wirklich gut überlegt? Es muss doch noch andere Pflegefamilien geben, bei denen sie auch vor den Nachstellungen ihrer Großmutter sicher wäre.«
Gemma beugte sich vor und verschränkte die Arme vor der Brust, als ein plötzlicher Schauder sie überlief. »Ich kann mir nicht vorstellen, von ihr getrennt zu sein«, sagte sie voller Gewissheit. »Und ich würde sie keinem anderen Menschen anvertrauen wollen, auch wenn ich es für unwahrscheinlich halte, dass Charlottes Familie in absehbarer Zukunft irgendetwas ausrichten kann.«
Charlottes Großmutter und ihre Onkel waren im August verhaftet worden, und wie es aussah, würden sie noch eine ganze Weile ihre Familientreffen im Gefängnis abhalten müssen.
»Wir sind vorläufig offiziell als Pflegeeltern eingesetzt«, fuhr Gemma fort. Zögernd fügte sie hinzu: »Aber ich habe einen Antrag auf dauerhaftes Sorgerecht gestellt mit anschließender Adoption. Ich hoffe nur, dass meine Familie ihre Meinung ändern wird und dass nichts dazwischen kommt, was Duncans Elternzeit –«
Ein lautes Krachen unterbrach sie, gefolgt von polternden Schritten in der Diele.
»Toby, Stiefel aus!«, hörte Gemma Duncan rufen, doch es war zu spät. Ihr sechsjähriger Sohn kam zur Tür hereingeplatzt, seine roten Gummistiefel mit Schlamm bespritzt, während das blonde Haar ihm in feuchten Stacheln vom Kopf abstand. Er sah wieder einmal wie ein durchtriebenes kleines Teufelchen aus.
Die Tür flog erneut auf, und diesmal erschien Charlotte, die brav ihre Stiefel ausgezogen hatte. Auf gestreiften Socken, noch in ihrem rosa Regenmäntelchen, rannte sie schnurstracks auf Gemma zu und kletterte auf ihren Schoß. Sie schlang die Arme um Gemmas Hals und drückte sie ganz fest wie jedes Mal, wenn sie länger als ein paar Minuten getrennt gewesen waren. Doch als sie den Kopf hob, strahlte sie übers ganze Gesicht, ihre Wangen glühten, und ihre Augen leuchteten. Gemma dachte, dass sie noch nie ein Kind gesehen hatte, das glücklicher aussah.
»Ich bin am besten gesprungen«, verkündete Charlotte.
»Gar nicht«, protestierte Toby. Als großer Junge, der er war, hielt er sich in allen Belangen für haushoch überlegen.
Duncan kam in die Küche. Groß gewachsen, die Haare zerzaust, die Wangen von der Kälte gerötet wie die der Kinder, sah er genauso durchnässt aus wie Toby, wenngleich ein klein wenig sauberer. Als Gemma einen Blick aus dem Fenster warf, sah sie, dass der Regen noch heftiger niederprasselte.
»Du bist wirklich unverbesserlich, Sportsfreund«, wandte Duncan sich streng an Toby. Er deutete auf die schmutzigen Schuhspuren auf dem Boden, riss ein paar Blätter von der Küchenrolle ab und drückte sie dem Jungen in die Hand. »Du entschuldigst dich jetzt bei Tante Winnie und wischst das auf. Und dann –« Er wandte sich zu Gemma und grinste beinahe so schelmisch wie Toby, während er seine strenge Polizistenstimme abstellte. »– hat Dad uns alle nach draußen beordert, Regen hin oder her. Er nervt mal wieder total mit seiner Geheimnistuerei, und er hat Jack und Kit in seine Pläne eingeweiht. Ich kenne doch meinen Dad – mir graut jetzt schon vor dem, was er da wieder ausgeheckt hat.« Er verdrehte die Augen, um seine Worte zu unterstreichen, und Gemma musste unwillkürlich lächeln. Sie hatte Duncans Vater vom ersten Moment an ins Herz geschlossen, doch Hugh Kincaid stand weiß Gott nicht immer mit beiden Beinen auf dem Boden der Realität.
ENDE DER LESEPROBE