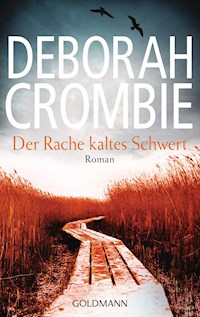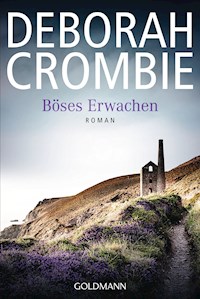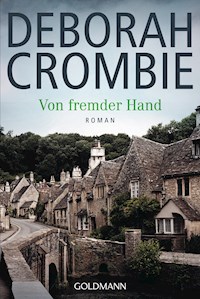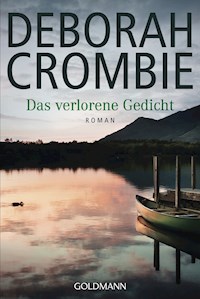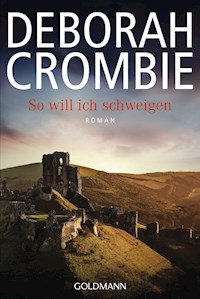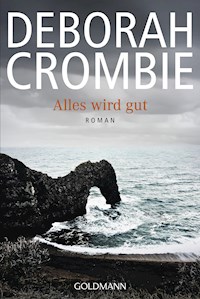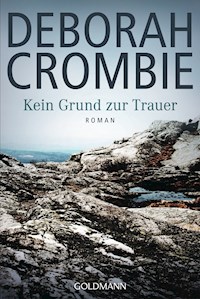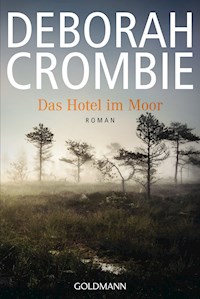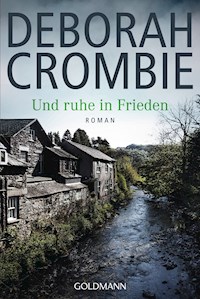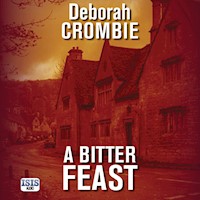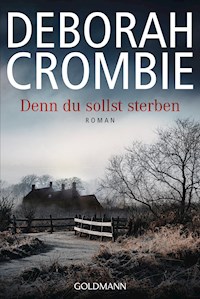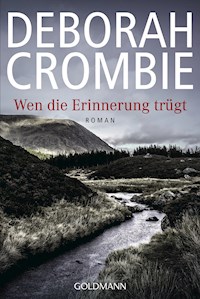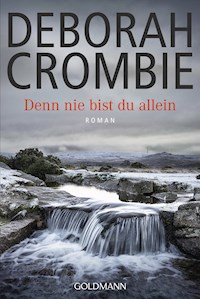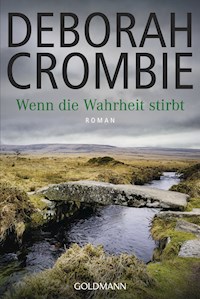
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Kincaid-James-Romane
- Sprache: Deutsch
Ein raffinierter, typisch englischer Krimi über Verrat und Betrug
London: Der Psychotherapeut Tim Cavendish ist besorgt, da sein Patient, der Rechtsanwalt Nazir Malik, nicht zur vereinbarten Sitzung erschienen ist. Vor einigen Wochen war Nazirs Frau spurlos verschwunden, und der Rechtsanwalt stand längere Zeit unter Verdacht, ihr etwas angetan zu haben. Als kurz darauf seine Leiche gefunden wird, übernimmt Superintendent Duncan Kincaid den Fall. Handelt es sich um Selbstmord? Oder wurde Nazir ermordet? Gemeinsam mit seiner Frau Inspector Gemma James kommt Duncan einem grausamen Geheimnis auf die Spur ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 675
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Buch
London: Tim Cavendish, Psychotherapeut und Nochehemann von Gemma James’ Freundin Hazel, wendet sich an Gemma, da sein Klient, der Rechtsanwalt Nasir Malik, nicht zur vereinbarten Sitzung erschienen ist. Gemma, Inspector bei der Metropolitan Police, erklärt Tim zwar, dass man nach einer solch kurzen Zeit noch keine Vermisstenanzeige aufgeben kann, nimmt Tims Sorge aber dennoch ernst, denn Nasirs Frau Sandra ist seit einigen Monaten spurlos verschwunden, und Nasir stand längere Zeit unter Verdacht, ihr etwas angetan zu haben.
Als kurz darauf Nasirs Leiche gefunden wird, übernimmt Gemmas Mann, Superintendent Duncan Kincaid von Scotland Yard, den Fall. Er findet heraus, dass der Rechtsanwalt die Verteidigung eines Restaurantbesitzers aus Bangladesch übernommen hatte, der angeklagt ist, Mitarbeiter unter menschenunwürdigen Bedingungen in seinem Restaurant zu beschäftigen. Liegt hier das Motiv für die Tat? Oder handelt es sich um Selbstmord, da Nasir seiner Frau tatsächlich etwas angetan hatte?Von Sandra fehlt weiterhin jede Spur.
Gemeinsam kommen Gemma und Duncan einem grausamen Geheimnis auf die Spur – und stellen entsetzt fest, dass es mehr Opfer gibt, als bisher bekannt war …
Autorin
Deborah Crombies höchst erfolgreiche Romane um Superintendent Duncan Kincaid und Inspector Gemma James wurden für den »Agatha Award« und den »Edgar Award« nominiert, für Wen die Erinnerung trügt hat sie den »Macavity Award« gewonnen. Die Autorin lebt mit ihrer Familie im Norden von Texas. Weitere Informationen zur Autorin unter www.deborahcrombie.com.
Deborah Crombie
Wenn dieWahrheit stirbt
Roman
Deutsch vonAndreas Jäger
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Die Originalausgabe erschien 2009 unter dem Titel »Necessary as Blood« bei William Morrow, New York, an imprint of Harper Collins Publishers.
Deutsche Erstveröffentlichung April 2010 Copyright © der Originalausgabe 2009 by Deborah Crombie Published by Arrangement with Deborah Crombie Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30827 Garbsen. Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2010 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München. Covergestaltung: UNO Werbeagentur GmbH Redaktion: Claudia Fink BH · Herstellung: Str.
Für Gigi
Prolog
Umbra sumus – »Wir sind Schatten«
Inschrift auf der Sonnenuhr der ehemaligen Hugenottenkirche in der Brick Lane, der heutigen Jamme-Masjid-Moschee
Der Sonntag begann wie jeder normale Sonntag, nur mit dem Unterschied, dass Sandras Mann Naz in seine Rechtsanwaltskanzlei gegangen war, um ein paar Stunden zu arbeiten – eine für ihn ungewöhnliche Abweichung von den ungeschriebenen Familiengesetzen.
Sandra war anfangs ein wenig verärgert gewesen, hatte dann aber beschlossen, die Zeit für eines ihrer eigenen Projekte zu nutzen. Nachdem sie gefrühstückt und die Hausarbeit erledigt hatte, war sie deshalb mit Charlotte in ihr Atelier im obersten Stock des Hauses hinaufgegangen.
Dort arbeitete sie zwei Stunden lang und trat dann mit kritischer Miene von den Textilmustern zurück, die sie an den mit Musselin bespannten Rahmen geheftet hatte. Die sorgfältig zugeschnittenen, einander überlappenden Stofffetzen setzten sich zu einem Kaleidoskop von Bildern zusammen, sodass auf den ersten Blick der Eindruck eines abstrakten Kunstwerks entstand. Erst bei genauerem Hinsehen traten die Umrisse von Straßen und Gebäuden zutage, von Menschen, von Vögeln und anderen Tieren – alle in irgendeiner Weise symbolisch für die Geschichte und Kultur des Londoner Viertels, in dem Sandra lebte: das East End, speziell die Brick Lane und die umliegenden Straßen.
Schon als Kind hatte Sandra ihre Vorliebe für schöne Stoffe entdeckt. Damals hatte sie an einer Marktbude in der Brick Lane eine zerschlissene Patchworkdecke erstanden. Zusammen mit ihrer Oma hatte sie die komplizierten Muster bewundert und gerätselt, welche Stücke wohl von der besten Schürze irgendeiner Tante Mary stammen mochten, welche vom Sonntagskleid eines kleinen Mädchens und welche vom ausrangierten Pyjama irgendeines Onkel George.
Diese Leidenschaft hatte sowohl die Kunsthochschule überlebt als auch den Druck, sich der Shock-Art-Welle anzuschließen. Sandra hatte Zeichnen und Malen gelernt, und nach und nach hatte sie diese Fertigkeiten auf ihre eigene Technik übertragen, die sie immer noch als ein »Malen mit Stoff« begriff. Doch anders als Farbe war Stoff ein greifbares, dreidimensionales Material, und die Arbeit damit faszinierte sie heute noch genauso wie damals, als sie noch sehr zögerlich ihr allererstes Werk geschaffen hatte.
Heute jedoch war irgendetwas nicht so, wie es sein sollte. Die Arbeit hatte nicht die emotionale Strahlkraft, die Sandra anstrebte, und sie kam einfach nicht dahinter, was daran nicht stimmte. Sie veränderte hier eine Farbe und dort ein Muster, trat wieder zurück, um das Ergebnis aus einer anderen Perspektive zu betrachten, und runzelte erneut die Stirn. Der dunkle Backstein der georgianischen Stadthäuser bildete den Rahmen für eine Kaskade aus Farbe – es mochte die Fournier Street sein, oder auch die Fashion Street, in der die Frauen in ihren langen Kleidern auf und ab spazierten und kunstvoll gearbeitete Eisenkäfige hoch hielten. Doch in den Drahtkäfigen saßen keine Vögel, sondern die Gesichter von Frauen und Kindern, manche dunkler, manche heller, das eine oder andere umrahmt vom traditionellen Hidschab der Muslimas.
Das Licht der Vormittagssonne strömte durch die großen Atelierfenster des Speichers herein. Im Winter war die Wärme ein Segen – wenn auch nicht unbedingt jetzt, Mitte Mai –, aber es war die Klarheit des Lichts, die sie an diesem Ort von Anfang an fasziniert hatte, und diese Faszination empfand sie noch heute, auch dann, wenn es mit der Arbeit einmal nicht so gut voranging.
Sie und Naz hatten das Haus in der Fournier Street vor über zehn Jahren gekauft, als sie gerade frisch verheiratet waren, und sie hatten die feuchten Wände, den bröckelnden Putz und die primitiven Sanitärinstallationen in Kauf genommen, weil Sandra sofort erkannt hatte, was sich aus dem Raum machen ließe, der jetzt ihr Atelier war. Und sie hatten es sich mit Naz’ Einkommen als Anwalt leisten können, zu einer Zeit, als Sandra noch an der Kunsthochschule studierte. Sie hatten viel Arbeit hineingesteckt und einen Großteil der Reparaturen selbst durchgeführt, um das Haus nach ihren Vorstellungen einzurichten, ohne zu ahnen, dass ihre Immobilie wenige Jahre später eine wahre Goldgrube sein würde.
Die Stadthäuser in der Fournier Street stammten nämlich aus der georgianischen Epoche. Im achtzehnten Jahrhundert waren sie von französischen Seidenwebern erbaut worden – Hugenotten, die im Londoner Stadtteil Spitalfields Zuflucht vor der Verfolgung im katholischen Frankreich gesucht hatten. Eine Zeitlang hatten die Geschäfte der Weber floriert; das Rattern ihrer Webstühle hatte die weitläufigen Dachböden erfüllt, während die Frauen in ihren Kleidern aus glänzendem Taft sich auf den Veranden versammelten. Ihre Kanarienvögel sangen dazu in den Käfigen, die die feinen Damen als Statussymbole bei sich trugen.
Aber dann bedrohte die billig aus Indien importierte Baumwolle die Existenz der Weber, und die Erfindung des mechanischen Webstuhls versetzte ihrem Gewerbe den Todesstoß. Neue Wellen von Einwanderern waren auf die Hugenotten gefolgt – Juden, Iren, Bangladeschis und Somalis –, doch an den wirtschaftlichen Erfolg der Hugenotten hatten sie alle nicht anknüpfen können. Und so waren deren Häuser langsam, aber sicher verfallen.
Bis heute. Trotz der Rezession wuchs die City unaufhörlich weiter nach Osten, streckte bereits ihre Finger nach Spitalfields aus und brachte eine neue Welle von Einwanderern mit sich. Nur dass es sich bei diesen Immigranten um Yuppies mit fetten Brieftaschen handelte, die sich die Wohn- und Lagerhäuser des alten East End unter den Nagel rissen und die einkommensschwächeren Bewohner verdrängten. Denn die Gegenwart ließ sich nicht ohne die Vergangenheit denken und die Vergangenheit nicht ohne die Gegenwart. So war es immer gewesen, und es kam Sandra vor, als gelte dies ganz besonders für das East End, wo die Jahre sich Schicht um Schicht übereinanderlegten wie die Stoffe auf ihrem Rahmen.
Sandra seufzte und rieb das Stück pfauenblauen Taft zwischen den Fingern, während sie überlegte, welchen Platz es im Gesamtentwurf ihrer Collage einnehmen sollte. Veränderungen waren unvermeidlich, dachte sie. Sie hatte inzwischen Freunde auf beiden Seiten der ökonomischen Kluft – und wenn sie es jemandem verdankte, dass sie als Künstlerin ihren Lebensunterhalt verdienen konnte, dann waren es diejenigen am oberen Ende der Einkommensskala.
Ihr Blick ging zu dem Berg von Stofffetzen unter dem Flügelfenster des Speichers. Charlotte hatte sich in den Haufen aus Seide und Tüll gekuschelt, angezogen von dem wärmenden Sonnenlicht wie eine Katze. Dorthin hatte sie sich verzogen, nachdem ihr die ausgedehnte, einseitige Unterhaltung mit ihrem Lieblings-Stoffelefanten irgendwann langweilig geworden war – mit Puppen konnte Charlotte nichts anfangen, genauso wenig wie damals ihre Mutter.
Und ihre kleine Tochter war auch anmutig wie eine Katze, dachte Sandra – selbst wenn sie so mit dem Daumen im Mund schlief. Mit ihren zweieinhalb Jahren war Charlotte eigentlich fast schon zu alt, um noch am Daumen zu lutschen, aber es widerstrebte Sandra, ihrem frühreifen Kind auch noch diese letzte beruhigende Angewohnheit aus ihren Babytagen zu nehmen.
Sandras Frust über die unvollendete Collage war für den Augenblick vergessen, als sie sich spontan einen Skizzenblock und einen Bleistift vom Werktisch griff und rasch die Umrisse des Stoffbergs skizzierte, die Scheiben des Speicherfensters, die geschwungene Linie von Charlottes kleinem Körper in Latzhose und T-Shirt, das zarte, leicht stupsnasige Gesichtchen, umrahmt von der üppigen karamellfarbenen Lockenpracht.
Die Skizze schrie geradezu nach Farbe, und Sandra tauschte ihren HB-Bleistift gegen eine Handvoll Buntstifte ein, die sie aus einem angestoßenen Becher fischte – ein Souvenir zum silbernen Thronjubiläum der Queen, das sie auf dem Flohmarkt ergattert und wegen des falsch geschriebenen Namens des Herzogs von Edinburgh als Kuriosität aufgehoben hatte.
Rot für die Latzhose, Rosa für das T-Shirt, leuchtende Blau- und Grüntöne für die wallenden Seidenstoffe, ein warmes Braun für das glänzende Parkett.
Gedankenverloren wandte sie sich wieder der Seide zu, versuchte die verschwommene Erinnerung an ein kompliziertes Seidenmuster, das sie irgendwo gesehen hatte, auf das Papier zu übertragen. Es war Sari-Seide gewesen – wie die, die den Boden ihres Ateliers bedeckte, jedoch mit einem ungewöhnlichen Muster: winzig kleine Vögel, von Hand in den apfelgrünen Stoff gewebt. Sie hatte das Mädchen, das den Sari trug, gefragt, woher sie ihn habe, und die Kleine hatte leise und in stockendem Englisch geantwortet, dass ihre Mutter ihn ihr geschenkt habe. Doch als Sandra sie gefragt hatte, ob ihre Mutter den Stoff hier in London gekauft habe, war das Mädchen verstummt und hatte verängstigt gewirkt, als fürchtete sie, etwas Verbotenes gesagt zu haben. Und bei Sandras nächstem Besuch war die Kleine verschwunden.
Sandra zog die Stirn in Falten, als sie sich an die Szene erinnerte, und Charlotte regte sich, als spürte sie die Unruhe ihrer Mutter. Sandra fürchtete, dass sie die Gelegenheit verpassen könnte, das Bild einzufangen, und so griff sie rasch nach ihrer Kamera und drückte auf den Auslöser. Dann ließ sie sich die Aufnahme anzeigen und nickte, als sie Charlottes schlafendes Gesicht sah, umrahmt von Seide, der Zeit enthoben.
Der Zeit enthoben wie die Gesichter in den Käfigen in ihrer Collage. Plötzlich hatte sie eine Eingebung, und ihr Blick ging zu dem unvollendeten Werk. Wie wäre es, wenn sie … Wie wäre es, wenn sie für die Gesichter der Frauen und Kinder anstelle von Stoff und Farbe Abzüge von Fotos verwendete? Sie könnte die Gesichter von Frauen und Kindern aus ihrem Bekanntenkreis nehmen, wenn diese damit einverstanden waren.
Charlotte streckte sich, schlug die Augen auf und lächelte verschlafen. Sie war ein fröhliches Kind, selten quengelig, außer wenn sie müde oder hungrig war – Sandra war sich sicher, dass sie selbst es ihrer Mutter längst nicht so leicht gemacht hatte. Sandra legte ihre Kamera weg, bückte sich und nahm ihre Tochter in den Arm. »Na, gut geschlafen, Süße?«, fragte sie, während Charlotte ihr die Arme um den Hals schlang und sich an sie schmiegte. Charlottes Haare waren noch feucht von ihrem Schlaf in der warmen Sonne, und ihre hellbraune Haut strömte noch einen leisen Hauch von Babyduft aus. Doch sie gab ihrer Mutter keine Gelegenheit, ausgiebig mit ihr zu kuscheln.
Stattdessen wand sie sich aus Sandras Armen los und lief zum Ateliertisch. »Entenstifte, Mami«, sagte sie und zeigte auf den leeren Becher. »Will auch malen.«
Sandra überlegte. Sie warf einen Blick auf die Uhr, auf die sonnenhellen Fenster und dann wieder auf die halb fertige Collage auf dem Ateliertisch. Sie wusste aus Erfahrung, dass sie an einem Punkt angelangt war, an dem sie endlos den Rahmen anstarren könnte, ohne einer Lösung näher zu kommen. Und außerdem wollte sie ihre Idee mit den Fotos ausprobieren. Eine Pause war durchaus angebracht.
Es war kurz vor zwölf. Charlotte war früh aufgewacht, und Sandra hatte sie einschlafen lassen, obwohl es für ihr Mittagsschläfchen noch zu früh war. Sie hatten ausgemacht, dass sie sich um zwei mit Naz zu einem späten Mittagessen treffen würden – falls er sich von der Arbeit losreißen könnte. Bei dem Gedanken schüttelte sie heftig den Kopf. Naz und Lou hatten viel zu hart an der Vorbereitung ihres anstehenden Prozesses gearbeitet, und Naz zeigte schon Anzeichen von Überlastung, was bei ihm selten vorkam. Sie hatten immer schon Wert darauf gelegt, den Sonntag für die Familie freizuhalten, und ganz besonders seit Charlottes Geburt. Sie waren fest entschlossen, ihr die Geborgenheit zugeben, die ihnen beiden in ihrer Kindheit versagt geblieben war.
Naz hatte seine Eltern früh verloren. Als pakistanische Christen waren sie bei den gewalttätigen Unruhen in den Siebzigerjahren von fundamentalistischen Muslimen ermordet worden. Naz war nach London geschickt worden, in die Obhut eines Onkels und einer Tante, die ihn jedoch bald als Belastung empfanden. Als er älter wurde, hatte er allmählich den Verlust seiner Kultur wie auch seiner Herkunftsfamilie nicht mehr ganz so schmerzlich empfunden.
Und was Sandra betraf – ihr war allein schon der Gedanke an ihre Familie unerträglich.
Aber dieser Fall jetzt, den Naz bearbeitete … die Schwierigkeiten irgendeines bengalischen Restaurantbesitzers mit der Justiz konnten ja wohl kaum so wichtig sein, dass man dafür aufs Spiel setzen durfte, was sie beide sich so sorgfältig aufgebaut hatten. Sie würde mit Naz reden müssen. Aber zunächst einmal war heute ein perfekter Maitag, und vorher blieb noch genug Zeit, um in der Columbia Road vorbeizuschauen.
»Ich hab ’ne bessere Idee«, sagte sie zu Charlotte und steckte die Buntstifte entschlossen zurück in den Becher. »Komm, wir besuchen Onkel Roy.«
Sandra hielt Charlottes Hand, als sie die Brick Lane hinaufgingen und sich ihren Weg durch das Gedränge um die Marktstände bahnten. »Alles vom Laster gefallen«, war Naz’ leicht missbilligender Standardkommentar zum Sonntagsmarkt. Und er hatte natürlich recht. Die Hälfte der Waren, die hier verhökert wurden, war entweder von einem Lastwagen gefallen oder in einem solchen über den Kanal ins Land geschmuggelt worden. Aber Sandra liebte es – das chaotische Treiben, das etwas heruntergekommene Ambiente, die Händler, die an ihren klapprigen Ständen alles Mögliche feilboten, von französischem Wein über Kisten voller Orangen (von denen die unterste Lage mit Sicherheit faul war) bis hin zu alten Autobatterien.
Als sie an der Old Truman Brewery vorbeikamen, zerrte Charlotte an ihrem Arm. »Bus, Mami«, sagte sie und zeigte in Richtung Ely Yard. Auf dem Parkplatz hinter der Brauerei war ein alter roter Routemaster-Doppeldeckerbus in ein veganes Restaurant namens Rootmaster umgewandelt worden. Charlotte verstand das Wortspiel nicht, aber sie fand es ganz toll, auf dem Oberdeck zu essen. Wenn der Wind und die Schritte der Bedienung auf der engen Wendeltreppe den Bus ins Schwanken brachten, dann kreischte Charlotte jedes Mal laut vor Begeisterung.
»Nicht jetzt, Süße.« Sandra packte ihre Hand noch fester. »Bald treffen wir uns dort mit Papi. Und wenn wir in der Columbia Road sind, kaufe ich dir einen Muffin für später als Nachspeise.«
Sie winkte ihren Freundinnen in dem Vintage-Kleiderladen zu, wo sie oft Material für ihre Collagen einkaufte, doch sie widerstand der Versuchung hineinzugehen. Im Schaufenster sah sie ein verzerrtes Spiegelbild ihres eigenen blonden Haarschopfs und von Charlottes Köpfchen – ein paar Nuancen dunkler, aber genauso lockig.
Erst als sie sich der Eisenbahnbrücke näherten, verlangsamte Sandra ihren Schritt und blieb schließlich stehen. Als Charlotte erneut an ihrer Hand zog, hob sie ihre Tochter hoch und setzte sie sich auf die Hüfte. In einer der Nischen unter den Bogen der alten Backsteinbrücke hatte ein anonymer Künstler eine Schwarzweißfotografie einer jungen Frau angeklebt. Er hatte sie von der Hüfte aufwärts abgebildet, ihr nackter Oberkörper beinahe knabenhaft schlank. Die Form des Backsteinbogens, der das Bild einrahmte, erinnerte an eine Ikone, und der Blick, mit dem das Modell den Betrachter ansah, war so anmutig und heiter, dass Sandra sie im Stillen »Die Madonna der Brick Lane« getauft hatte.
Aber sie verblasste schon, diese Madonna; das Papier war zerknittert, die Ecken lösten sich und rollten sich auf. Bald würde sie verschwinden und von der Vision eines anderen Künstlers oder einer anderen Künstlerin ersetzt werden, wie es das Schicksal aller Straßenkunst war. Sandra zückte ihre Kamera und machte ein Foto. Wenigstens in dieser Form würde die Madonna nun erhalten bleiben.
Die Inspiration, die sie im Atelier gehabt hatte, nahm plötzlich Gestalt an. Ja, sie würde mit Fotoabzügen arbeiten, aber sie würde künstlich verblasste verwenden. Sie würden verschwinden, so wie die Frauen und Kinder, die im Lauf der Zeit auf so viele Arten gefangen gehalten worden waren, würden verschwinden wie das kleine Mädchen mit dem Sari …
Aber nein, das konnte doch nicht sein … Sandra drückte Charlotte noch fester an sich. Sie hatte natürlich die Gerüchte gehört, hatte sie aber nie mit irgendjemandem aus ihrem Bekanntenkreis in Verbindung gebracht. Es war unmöglich. Undenkbar. Und doch …
Ich muss verrückt sein, sagte sie sich und schüttelte den Kopf. Aber nachdem der Gedanke sich einmal in ihrem Kopf festgesetzt hatte, begann er zu wachsen und zu wuchern und tausenderlei monströse Gestalten anzunehmen.
Charlotte wand sich. »Mami, du tust mir weh!«
»Entschuldige, Schätzchen.« Sandra lockerte ihren Griff und küsste Charlottes Lockenkopf.
»Ich will selber laufen, will zu Papi«, rief Charlotte und trat mit den Füßen, die in Turnschuhen steckten, gegen Sandras Bein.
»Wir treffen uns ja mit Papi. Aber –« Sandra warf noch einen Blick auf die Madonna, wandte sich dann ab und eilte mit Charlotte im Arm los. Es war vielleicht ein völlig abwegiger Verdacht, aber sie brauchte einen Beweis dafür, dass sie sich irrte. Mit ihrer freien Hand griff sie in die Tasche und tastete nach ihrer Kamera. Damit hatte sie einen Vorwand für einen Besuch. Sie würde fragen, ob sie ein Foto für ihre Collage machen dürfe. Es war nicht weit. Sie musste nur Roy bitten, eine Weile auf Charlotte aufzupassen.
Sie überquerte die Bethnal Green Road und ging weiter durch die ruhigen, von Sozialwohnungen gesäumten Straßen von Bethnal Green. Von Charlottes Gewicht tat ihr allmählich die Hüfte weh.
Als sie sich der Columbia Road näherte, kamen ihr schon die ersten Marktbesucher entgegen. Manche hatten Blumensträuße in der Hand, andere Topfpflanzen, und ein paar zogen sogar Handkarren mit Stauden oder kleinen Palmen hinter sich her.
Sie hörte das Marktgetümmel, bevor sie die Stände sah – ein stackatoartiges Stimmengewirr, das sich anfangs wie eine fremde Sprache anhörte. Doch als sie näher kamen, konnte sie die Worte ausmachen – es war tatsächlich Englisch, was die Händler da in ihrem eigenartigen Singsang riefen, allerdings mit deutlichem Cockney-Einschlag. »Schöne Margeriten, nur fünf Pfund der Strauß! Holen Sie sich jetzt Tulpen ins Haus, drei Sträuße nur zehn Pfund!«
Sandra bog um eine Ecke, ging an dem winzigen Park vorbei, und schon stand sie zwischen den Buden des Blumenmarkts am unteren Ende der Columbia Road. Jeden Sonntag bauten die Blumenhändler hier in aller Frühe ihre Stände auf. Von Paletten mit Setzlingen bis hin zu kleinen Bäumen war hier alles zu haben. Sandra hatte den Markt erst als erwachsene Frau aus dem Blickwinkel der Kundin kennengelernt – während ihrer Schul- und Studienzeit hatte sie hier jahrelang als Aushilfe an Roy Blakelys Blumenstand gejobbt.
Sandra drückte Charlotte fester an sich und schob sich durch die Menge. An einem Stand mit Kletterrosen musste sie sich ducken, um nicht mit den Haaren in den Ranken hängenzubleiben. Roy stand unter seiner grün-weiß gestreiften Markise und steckte gerade einen gefalteten Schein in den Geldbeutel, den er sich vor den Bauch geschnallt hatte. Als er Sandra und Charlotte erblickte, zwinkerte er ihnen zu. »Na, sind wir mal wieder gekommen, um Schnäppchen abzustauben, was?«
Die Händler verkauften ihre komplette Ware, ehe sie ihre Stände abbauten, und Roy überließ Sandra seine Restbestände immer zu einem Schleuderpreis. Ihr Speicher war vollgestopft mit Topfpflanzen, ihr kleiner Garten eine Blütenpracht, und fast jede Woche brachte sie mehrere Sträuße Schnittblumen mit nach Hause. Aber nicht heute.
»Muffins«, sagte Charlotte ernsthaft und warf begierige Blicke in Richtung des Treacle-Süßigkeitenladens neben Roys Stand. »Zitrone.«
»Noch nicht.« Sandra ließ sie herunter. »Roy, kann ich dich um einen Gefallen bitten? Ich habe etwas – Ich muss noch etwas erledigen. Würde es dir etwas ausmachen, kurz auf Charlotte aufzupassen? Es dauert nicht lange – wir sind um zwei mit Naz verabredet.« Sie warf einen Blick auf ihre Uhr und sah, dass die Zeit drängte.
Charlotte sprang über eine Palette mit Stiefmütterchen und schlang die Arme um Roys Knie. »Darf ich Blumen verkaufen, Onkel Roy?«
»Aber sicher, Schatz.« Roy bückte sich und drückte sie an sich. »Geh nur«, fügte er an Sandra gewandt hinzu. »Ich komm schon klar, ist ja nicht mehr viel los um diese Zeit.«
Sandra zögerte nur einen Moment – die Vertrautheit und Geborgenheit des Markts war eine Verlockung. Es wäre so leicht gewesen, sich einfach eine Schürze umzubinden und Roy zur Hand zu gehen. Aber sie hatte ihren Entschluss gefasst, und jetzt musste sie die Sache auch durchziehen.
1
So traurig es ist, ich habe in letzter Zeit akzeptieren gelernt, was ich mir so lange nicht eingestehen wollte: dass das Haus vielleicht nicht für die Ewigkeit ist.
Dennis Severs, 18 Folgate Street: The Tale of a House in Spitalfields
Die Straßen waren schmierig vor Nässe. Die Luft im Bus fühlte sich zäh an, beinahe wie eine feste Masse, und in der feuchten Augusthitze zeigte sich nur zu deutlich, dass einige der Fahrgäste es mit der Körperpflege nicht allzu genau nahmen.
Gemma James stand in der Nähe der mittleren Tür, als der 49er Bus über die Battersea Bridge rumpelte. Sie hielt die Haltestange umklammert und bemühte sich, nicht durch die Nase zu atmen. Der Mann auf dem Sitzplatz direkt neben ihr roch nicht nur ungewaschen – eine Alkoholfahne umwaberte ihn, und als der Bus mit einem Ruck anfuhr, fiel er mit seinem ganzen Gewicht gegen Gemma.
Wie hatte sie nur glauben können, dass es eine gute Idee wäre, den Bus zu nehmen? Und dazu an einem Samstag. Sie hatte ein paar Dinge in Kensington zu erledigen und wollte sich die Parkplatzsuche ersparen – das jedenfalls war ihre Ausrede gewesen. In Wirklichkeit hatte sie nur das Bedürfnis gehabt, vollkommen abzuschalten, einfach dazusitzen und dem geschäftigen Treiben in den Londoner Straßen zuzusehen, ohne selbst einen Finger rühren zu müssen. Dass sie solche Mühe haben würde, ihre Mitbürger auf Abstand zu halten, hatte sie dabei nicht bedacht.
Als der Bus gleich hinter der Brücke ächzend zum Stehen kam, war sie versucht, auszusteigen und den Rest zu Fuß zu gehen. Ein Blick auf den Stadtplan sagte ihr jedoch, dass es noch ein ganzes Ende war, und außerdem klatschten gerade ein paar träge Regentropfen an die ohnehin schon schmutzigen Fenster. Zu ihrer Linken konnte sie den höher gelegenen Battersea Park erkennen, der durch die verschmierte Scheibe zu einem impressionistischen grau-grünen Gemisch verschwamm. Die Türen öffneten und schlossen sich mit pneumatischem Zischen. Der Betrunkene machte keine Anstalten, seinen Platz zu räumen.
Gemma kannte diesen Teil Londons nicht besonders gut, und als der Bus von der relativ gediegenen Battersea Park Road in die Falcon Road einbog, verlor die Umgebung rapide an Glanz.
Hazel konnte doch nicht ernsthaft vorhaben, hier zu wohnen anstatt in Islington? Secondhandläden, Videotheken, Halal-Metzger, schäbige, namenlose Cafés – und jetzt konnte sie schon die Bahngleise sehen, die sich an der Clapham Junction vereinigten. Hatte sie ihre Haltestelle verpasst? Sie drückte fest auf den roten Knopf, und als die Bustüren sich an der nächsten Haltestelle öffneten, sprang sie geradezu hinaus.
Ihre Erleichterung, als sie endlich auf dem Gehsteig stand und sich umsah, war allerdings nur von kurzer Dauer. Sie sah noch einmal in ihren Straßenatlas, um ganz sicherzugehen, aber es gab keinen Zweifel – es war die richtige Straße. An der Ecke der kurzen Sackgasse stand ein klobiger Betonbau, den ein Schild auf Englisch und Bengali als Moschee auswies, und auf der Straße selbst kickten ein paar Jugendliche lustlos einen Fußball hin und her. Alle trugen Scheitelkäppchen und den Salwar Kamiz, die traditionelle Alltagskleidung der Südasiaten.
Gemma setzte sich langsam in Bewegung und hielt Ausschau nach der Hausnummer, die Hazel ihr genannt hatte. Ein Müllcontainer stand auf dem Gehsteig zu ihrer Linken, randvoll mit Abfall, bei dem es sich anscheinend um die komplette Inneneinrichtung des viktorianischen Reihenhauses dahinter handelte. Das war doch wohl ein gutes Zeichen, dachte sie – es ging offenbar aufwärts mit dem Viertel. Aber abgesehen von der kurzen Häuserreihe sah sie nur einen Block mit Mietwohnungen am Ende der Straße und zu ihrer Rechten eine hohe Mauer.
Die Jugendlichen ließen ihren Fußball liegen und sahen in Gemmas Richtung. Sie nickte ihnen unverbindlich zu, um dann mit gestrafften Schultern und entschlossener Miene ihre Umgebung in Augenschein zu nehmen. Die langjährige Polizeiarbeit hatte sie gelehrt, dass es nicht ratsam war, umherzuirren wie ein verlorenes Schaf – dadurch gab man sich nur als potenzielles Opfer zu erkennen.
In Anbetracht des schwülen Wetters hatte sie nur ein leichtes Sommerkleid aus pfirsichfarbener Baumwolle angezogen, und obwohl es ihre Beine bis zu den Knien bedeckte, fühlte sie sich plötzlich auf unangenehme Weise entblößt.
Hazel hatte von einem Bungalow gesprochen, mit einem entzückenden Garten und einer Terrasse. Die Vorstellung eines Bungalows mitten in London war Gemma von Anfang an seltsam vorgekommen, aber hier schien so etwas geradezu unvorstellbar. Sie fragte sich schon, ob sie nicht doch irgendetwas durcheinandergebracht hatte.
Sie spielte bereits mit dem Gedanken, die jungen Männer – die ihr Interesse nun kaum noch verhehlen konnten – nach dem Weg zu fragen, als sie die Hausnummer entdeckte, halb versteckt hinter den Ranken einer Kletterpflanze, die über die hohe Mauer wuchs. Unter der Nummer war eine Rundbogentür aus Holz, deren Anstrich zu einem stumpfen Blaugrau verblasst war.
Noch einmal kramte sie den Zettel aus ihrer Handtasche hervor, um die Adresse zu überprüfen, und sah, dass sie definitiv stimmte. Aber wo war der Bungalow? Nun, es hatte jedenfalls keinen Sinn, noch länger untätig in der Gegend herumzustehen, dachte sie. Sie trat auf die Tür zu und drückte auf den Klingelknopf an der Seite. Ihr Magen krampfte sich plötzlich zusammen.
Sie hatte ihre beste Freundin über ein Jahr nicht mehr gesehen, und in dieser Zeit hatte sich bei ihnen beiden so vieles verändert. Per E-Mail und Telefon hatten sie einander auf dem Laufenden gehalten, aber in den letzten Monaten hatte Hazel irgendwie distanziert gewirkt, und sie hatte nur wenig über die Gründe für ihre überraschende Rückkehr nach London gesagt. Gemma hatte schon befürchtet, dass ihr enges Verhältnis sich verändert haben könnte; und dann hatte Hazel Gemma gebeten, sie ohne die Kinder zu besuchen, was höchst ungewöhnlich war.
Toby hatte lautstark verlangt, Holly zu sehen, und einen Wutanfall bekommen, weil er nicht mitkommen durfte; Kit hatte sich in Schweigen gehüllt – ein untrügliches Zeichen, dass er sich Sorgen machte oder unglücklich war.
Als Gemma soeben noch einmal klingeln wollte, ging die kleine Tür auf, und da stand Hazel vor ihr und strahlte übers ganze Gesicht. Sie umarmte Gemma und drückte sie fest an sich.
»Ich freue mich so, dich zu sehen.« Hazel trat zurück, um Gemma genauer anzusehen, ehe sie sie über die Schwelle zog und die Tür hinter ihnen zumachte. »Und du siehst fantastisch aus«, sagte sie. »Die Verlobung bekommt dir offenbar gut.«
»Du auch. Ich meine, du siehst richtig gut aus«, erwiderte Gemma, krampfhaft bemüht, ihren Schock zu überspielen. Hazel sah alles andere als gut aus. Zwar war sie nie mollig gewesen, aber sie hatte sonst etwas Weiches in ihren Zügen gehabt, das sie ganz besonders attraktiv machte. Jetzt waren ihre Wangen eingefallen, und über dem Ausschnitt ihrer ärmellosen Baumwollbluse zeichneten sich deutlich ihre Schlüsselbeine ab. Die hellbraunen Trekkingshorts hingen ihr lose um die Hüften, als ob sie ihr mehrere Nummern zu groß wären, und mit ihren nackten Füßen wirkte sie merkwürdig schutzlos.
»Ich weiß, ich bin blass«, sagte Hazel, als hätte sie Gemmas Reaktion gespürt. »Das liegt an Schottland. Wir hatten dieses Jahr keinen Sommer. Ich sehe bestimmt aus, als hätte ich in einer Höhle gehaust. Aber lassen wir das – komm, ich zeig dir das Haus.«
Gemma sah sich um. Die Tür in der Mauer war tatsächlich ein Gartentor, und sie standen nun auf der mit Ziegeln gepflasterten und von Bäumen beschatteten Terrasse, die Hazel beschrieben hatte. Dahinter stand ein weiß verputzter Bungalow mit rotem Ziegeldach. Gelbe Rosen rankten sich an Spalieren an der Hauswand empor, und zu beiden Seiten der Haustür standen Zitronenbäume in Kübeln.
»Es ist tatsächlich ein Bungalow«, rief Gemma entzückt. »Ein bisschen exotisch für London, oder?«
»Mein verwunschenes Gartenhaus, so nenne ich es.« Hazel nahm Gemmas Arm. »Ich war sofort hin und weg, als ich das Foto im Internet gesehen habe. Ich weiß, es ist nicht Islington, aber mit der Zeit wird man mit der Gegend warm. Und ich konnte mir das Haus gerade so leisten.«
»Diese Jungs –«
»Tariq, Jamil und Ali«, präzisierte Hazel. »Sie haben es sich zur Aufgabe gemacht, ein bisschen auf mich aufzupassen. Tariq meinte, er würde nicht wollen, dass seine alte Mutter ganz allein lebt. Dazu ist mir fast nichts mehr eingefallen, ich sag’s dir. Dabei ist seine alte Mutter wahrscheinlich keinen Tag älter als fünfunddreißig.«
Hazels Munterkeit wirkte ein wenig erzwungen, und Gemma fragte sich, ob es ihrer Freundin wirklich so gut ging, wie sie vorgab. Aber sie spürte, dass es nicht der richtige Zeitpunkt war nachzuhaken, und so folgte sie Hazel gehorsam in das kleine Haus.
Durch die Haustür gelangte man direkt in ein Wohnzimmer, das die ganze Breite des Hauses einnahm. Die Wände waren weiß, der Boden gefliest, sodass das Zimmer fast wie eine Fortsetzung der Terrasse wirkte. Der gemauerte Kamin an der einen Seitenwand war von tiefen Bücherregalen flankiert, während das andere Ende von einem Essbereich mit einer kleinen, in eine Nische eingepassten Küchenzeile eingenommen wurde.
»Es ist noch ein bisschen spartanisch, aber ich habe mich bei IKEA eingedeckt, und ich habe Bücher in den Regalen – das ist ja immerhin ein Anfang«, sagte Hazel. »Und ich habe Tee da, und im Kühlschrank ist Wein. Für das Allernotwendigste ist also gesorgt.«
Gemma erinnerte sich, das Sofa mit dem pink-roten Blumenmuster und den rot karierten Sessel in einem der letzten IKEA-Kataloge gesehen zu haben. Hazel hatte die Einrichtung mit einem Polsterhocker, einem Beistelltisch mit Lampe und einem Flickenteppich vervollständigt. Als Gemma die vertrauten Körbe mit Zeitschriften und Strickzeug sah, fühlte sie sich gleich ein wenig zu Hause. Die Esszimmermöbel waren aus hellem Holz und angenehm schlicht. Auf dem Tisch stand eine Vase mit roten Tulpen, auch dies ein vertrautes Detail. Hazel hatte immer Blumen im Haus gehabt.
Es lag Gemma auf der Zunge, Hazel zu fragen, warum sie nichts aus Carnmore, ihrem Haus in Schottland, oder aus Islington mitgenommen hatte, als Hazel sagte: »Es ist eigentlich ein Puppenhaus. Erinnert mich an die Garagenwohnung. Weißt du noch?«
Gemma hörte den wehmütigen Ton in der Stimme ihrer Freundin und tätschelte ihren Arm. »Natürlich. Das ist doch gerade mal –« Sie brach ab. War es wirklich schon so lange her?
Gemma hatte die winzige Garagenwohnung hinter dem Haus in Islington gemietet, als Hazel dort mit ihrer Tochter Holly und ihrem Mann Tim Cavendish, von dem sie inzwischen getrennt war, gewohnt hatte. Für Gemma war es ein Zufluchtsort gewesen und zugleich eine Chance, neu anzufangen; hier hatte sie ihr Selbstwertgefühl, das durch ihre gescheiterte Ehe so schwer angeschlagen war, wieder aufbauen und sich persönlich und beruflich weiterentwickeln können. Hazel hatte sich um Gemmas Sohn Toby gekümmert, der in Hollys Alter war, und sie hatte Gemma eine Beständigkeit geboten, die sie selbst zu Hause nie erlebt hatte.
Dann hatte eine unerwartete Schwangerschaft Gemma in ein neues Leben an der Seite von Duncan Kincaid katapultiert, und wenige Monate später war Hazels Ehe zerbrochen, worauf sie in die schottischen Highlands gezogen war, um die Whiskybrennerei ihrer Familie zu übernehmen.
»An Weihnachten werden es zwei Jahre«, stellte Gemma verwundert fest. Zwei Jahre, seit sie und Duncan mit Toby und Duncans Sohn Kit in das Haus in Notting Hill gezogen waren; zwei Jahre, seit sie das Kind verloren hatte.
»Es gibt nur das eine Schlafzimmer«, sagte Hazel. »Aber wenn Holly über Nacht bleibt, kann sie bequem auf dem Sofa schlafen. Und natürlich gelingt es ihr meistens, zu mir unter die Decke zu kriechen.«
»Wenn Holly über Nacht bleibt?«, fragte Gemma. Die Bemerkung hatte sie schlagartig in die Gegenwart zurückgeholt. »Wie meinst du das – ›wenn Holly über Nacht bleibt‹ – wohnt sie denn nicht bei dir?«
2
Es war der Sommer, in dem wir Waisen wurden.
Emanuel Litvinoff, Journey Through a Small Planet
Er mühte sich verzweifelt, den Traum abzuschütteln, kämpfte sich an die Oberfläche des Bewusstseins wie ein Ertrinkender, der nach Luft ringt. Einen Moment schien es, als würde er aus der Tiefe auftauchen, und mit einer gewaltigen Willensanstrengung gelang es ihm, die Lippen zu bewegen.
»Sandra.« Er glaubte seine eigene Stimme zu hören, ein raues Flüstern. Doch dann lichtete sich der Nebel noch etwas mehr, und er begriff, dass er gar nicht gesprochen hatte, dass auch sein Stoßgebet ein Teil des Traums gewesen war. »Wa –«, brachte er hervor, und diesmal war er sich sicher, dass er gesprochen hatte; doch seine trockenen Lippen fühlten sich fremd an, als gehörten sie der Puppe eines Bauchredners.
»Wo –« Es war nur ein Wispern, kaum vernehmlich, doch er fasste neuen Mut und versuchte die Augen aufzuschlagen. Das plötzliche grelle Licht blendete ihn, und der aufflammende Schmerz, den es mit sich brachte, ließ ihn wieder in einen wohligen Dämmerzustand zurücksinken.
Hazel setzte sich in den Sessel, schmiegte sich in die Polster und zog die Beine an, als ob sie in der Bequemlichkeit Trost suchte. Aus der Küche hatte sie ein Tablett mit einer roten Teekanne und Tassen mitgebracht, dazu ein Kännchen Milch und einen Teller mit einer Plätzchenmischung aus dem Supermarkt. Gemma konnte sich nicht erinnern, dass Hazel ihr je irgendetwas angeboten hätte, was sie nicht selbst gebacken hatte. Allerdings wusste Hazel noch genau, wie viel Milch Gemma im Tee nahm, und schenkte ihr ein, bevor sie ihre eigene Tasse füllte und sie mit beiden Händen umschlang.
Gemma spürte den Hauch einer Brise von den Terrassenfenstern und glaubte den Duft von Zitronen zu riechen. Von jenseits der Mauer drangen schwach die Stimmen der Jungen auf der Straße an ihr Ohr.
Da Hazel schwieg, begann Gemma zögernd: »Als du sagtest, du kommst wieder nach Hause, dachte ich, dass du und Tim euch vielleicht wieder versöhnt hättet.«
»Nein.« Stockend fuhr Hazel fort: »Ich hatte geglaubt … Aber ich fürchte, es ist einfach zu kompliziert. Selbst wenn Tim mir verzeihen könnte, bin ich mir nicht sicher, ob ich mir selbst verzeihen kann.« Der Blick, den sie Gemma zuwarf, war eindringlich. »Ich hatte alles, Gem. Ehe, Familie, ein Zuhause, einen Beruf – und ich habe alles weggeworfen.«
»Aber du hast Donald Brodie doch geliebt. Wenn es nicht mit einer solchen Katastrophe geendet hätte –«
»Habe ich das?« Hazel rückte in ihrem Sessel vor und verschüttete etwas von ihrem Tee. Sie rieb mit dem Daumen über den nassen Rand ihrer Tasse. »Habe ich ihn wirklich geliebt? Oder war ich nur gelangweilt und habe nach Aufmerksamkeit gegiert? Es war eine Illusion. Es hätte nie funktioniert, selbst wenn –« Sie schluckte und schüttelte den Kopf. »Aber das spielt alles keine Rolle. Was zählt, ist, dass ich Holly und Tim bewusst wehgetan habe, und das kann ich nicht ungeschehen machen.«
»Und Tim – sieht er das genauso?«
»Ich weiß es nicht. Er sagt, er würde es gerne versuchen, aber ich fürchte, wenn der Alltag erst wieder eingekehrt wäre, würde es immer an ihm nagen. Wie könnte es anders sein? Wie kann er mir je wieder vertrauen?«
Gemma wollte ihre Freundin schon ermahnen, nicht so streng mit sich selbst zu sein, doch als sie Hazels verbissene Miene sah, wählte sie einen anderen Ansatz. »Wieso bist du dann zurückgekommen? Ich dachte, du liebst Carnmore.« Die Brennerei, versteckt in einem der entlegensten Winkel der schottischen Highlands, war Gemma furchtbar einsam und isoliert vorgekommen, doch sie hatte Hazel ihren Plan, sich dort niederzulassen, nicht ausreden können.
»Ich habe es geliebt, und ich liebe es noch. Und ich hatte eine Verpflichtung. Aber jetzt läuft die Brennerei wieder, und es gibt andere, die besser qualifiziert sind als ich, sie zu betreiben.« Hazel stellte ihre Tasse ab und beugte sich vor. Das Licht von den Terrassenfenstern fiel auf ihr Gesicht und ließ die dunklen Ringe unter ihren Augen erkennen. »Und ich musste feststellen, dass ich doch nicht aus so hartem Holz geschnitzt bin, wie ich dachte – den Gedanken an einen weiteren Winter dort oben fand ich einfach unerträglich. Es war nicht fair gegenüber Holly, ihr dieses Leben aufzuzwingen. Wir beide waren ja oft wochenlang allein. Sie braucht ihren Vater, eine vertraute Umgebung und eine gute Schule …«
Hazel schien zu zögern; dann sagte sie: »Holly wird während der Woche bei Tim in Islington wohnen, Gemma. Wir haben alles besprochen. Dort hat sie die Schule gleich um die Ecke, und Tim wird zu Hause arbeiten, sodass er leicht eine Nachmittagsbetreuung für sie organisieren kann.«
»Aber Hazel, du bist ihre Mutter –« Gemmas Einspruch erstarb ihr auf den Lippen. Sie wusste, dass die Entscheidung Hazel schwergefallen sein musste, und sie kannte Hazels Hartnäckigkeit, wenn sie einmal einen Entschluss gefasst hatte. So setzte sie neu an und versuchte etwas Positives an der Sache zu finden. »Holly wird also die Wochenenden bei dir verbringen?«
»Ja, und wir können immer kurzfristig umplanen, wenn es nötig ist. Ich habe Tim gebeten, sie heute zu behalten, damit wir zwei ein bisschen Zeit miteinander verbringen können.«
»Aber was hast du vor?«, fragte Gemma. Hazel hatte wie Tim als Familientherapeutin gearbeitet, doch nachdem ihre eigene Ehe in die Brüche gegangen war, hatte sie sich nicht mehr in der Lage gesehen, andere zu beraten. »Wirst du wieder praktizieren?«
»Nein. Ich werde in einem Café arbeiten.« Zum ersten Mal seit ihrer Begrüßung schien Hazels Lächeln auch ihre Augen zu erreichen. »Es ist ein neu eröffnetes Lokal in Kensington. Ich kenne die Küchenchefin, und sie braucht ein Mädchen für alles. Ich kann kochen, bedienen oder die Kasse machen. Im Moment mache ich nur die Schicht vom Frühstück bis zum Nachmittagstee, aber wenn wir auch Abendessen servieren, werde ich unter der Woche Abendschichten übernehmen können. Du musst mal zum Lunch vorbeikommen. Es ist gleich hinter der Kensington High Street. Und jetzt« – sie schenkte Gemma und sich selbst nach und erinnerte dabei in ihrer forschen Art schon wieder ein wenig an die alte Hazel – »erzähl mal von dir. Wie geht es deiner Mutter?«
Gemma blinzelte ärgerlich, als ihr urplötzlich Tränen in den Augen brannten. Bei ihrer scheinbar so unbezwingbaren Mutter war im Mai Leukämie diagnostiziert worden. Die Chemotherapie, die sie weiterhin bekam, schien eine gewisse Remission bewirkt zu haben; dennoch hatten sie alle das Gefühl, dass ein Damoklesschwert über ihnen schwebte. »Sie hält sich tapfer. Dad musste für die Bäckerei Aushilfen einstellen, aber am meisten Arbeit hat er damit, sie daran zu hindern, alles selbst zu machen.«
»Kann ich mir vorstellen.« Hazel lächelte. »Ich werde sie mal besuchen, okay? Irgendwann nächste Woche.« Sie musterte Gemma kritisch. »Und was ist mit dir? Du hast kein Wort über die Hochzeitspläne gesagt, und inzwischen ist der Sommer fast um.«
»Oh.« Gemmas Denkvermögen schien für einen Augenblick wie eingefroren, und dann spürte sie, wie die Panik, die sie in letzter Zeit immer öfter überfiel, ihr die Brust zusammenschnürte. Sie atmete bewusst durch und rang sich ein Lächeln ab. »Damals schien es eine gute Idee zu sein.«
»Gemma! Sag bloß, du bekommst plötzlich kalte Füße!« Hazel sah so alarmiert aus, dass Gemma unwillkürlich auflachte, doch es schien, als ob ihr das Lachen im Halse steckenblieb.
»Nein. Jedenfalls nicht, was Duncan betrifft.« Schließlich war der Heiratsantrag von ihr gekommen. Sie und Duncan waren Kollegen gewesen, dann ein Paar, sie waren Freunde und seit einiger Zeit auch Eltern in ihrer kleinen Patchworkfamilie, und die Entscheidung, sich fester an ihn zu binden, hatte sie noch keine Sekunde bereut. Sie beeilte sich, eine Erklärung nachzuschieben. »Es ist nur dieses verdammte Theater um die Hochzeit. Das raubt mir noch den Verstand. Ich dachte, wir könnten einfach so heiraten – das war natürlich ziemlich dämlich von mir, ich weiß«, sagte sie, um der Bemerkung zuvorzukommen, die Hazels hochgezogenen Augenbrauen mit Sicherheit auf dem Fuß gefolgt wäre. »Aber alle wollen sie uns reinreden – obwohl ich sagen muss, dass Duncans Eltern sich ganz toll verhalten haben. Meine dagegen …« Sie verdrehte die Augen. »Und es sind nicht nur Dad und Cynthia, die ständig dies und jenes fordern, alles angeblich Mum zuliebe. Sogar die Jungs mischen sich ein. Sie wollen einen Empfang im Museum für Naturgeschichte. Kannst du dir das vorstellen?«
»Ja«, erwiderte Hazel lachend. »Aber ich dachte, du wolltest, dass Winnie euch traut?«
Winnie – das war Reverend Winifred Montfort, anglikanische Pfarrerin und verheiratet mit Duncans Cousin Jack. Beide standen Duncan und Gemma sehr nahe, aber sie lebten in Glastonbury, und Winnie, die auf die vierzig zuging, erwartete ihr erstes Kind. »Ihr Arzt will nicht, dass sie reist, und Jack ist natürlich schon außer sich vor Sorge.« Jack Montforts erste Frau und ihr Baby waren bei der Geburt gestorben, und er hatte die Nachricht von Winnies Schwangerschaft mit gemischten Gefühlen aufgenommen. »Aber selbst wenn sie kommen könnte, kann sie uns ja schlecht in der Kirche einer anderen Pfarrei trauen.«
»Warum bittet ihr dann nicht den Pfarrer von St. John’s?« St. John’s war die anglikanische Kirche in der Nähe ihres Hauses in Notting Hill. »Das dürfte doch kein Problem sein.«
»Weil St. John’s Hochkirche ist. Meine Eltern stammen beide aus Dissenter-Familien, und in ihren Augen könnte St. John’s ebenso gut katholisch sein. Mein Vater sagt, es würde meine Mutter umbringen, was natürlich nicht stimmt, aber meine Mutter sagt, wir sollen ihm seinen Willen lassen –«
»Dann vielleicht an einem neutralen Ort –«
»Ist genauso kompliziert. Die Jungs wollen ein Wort mitreden, und wenn wir einen richtigen Empfang ausrichten, wird die Gästeliste der reinste Alptraum. Wir würden alle Leute einladen müssen, mit denen wir beide seit der Grundschule zu tun hatten.«
»Und eine standesamtliche Trauung –«
»Damit würden wir alle enttäuschen.« Gemma schüttelte den Kopf und blickte aus dem Fenster, um Hazel nicht in die Augen sehen zu müssen. »Ich weiß nicht. Ich habe das schon einmal gemacht – und heute kommt es mir so vor, als wäre die Hochzeit für Rob und mich der Anfang vom Ende gewesen. Das will ich nicht ein zweites Mal durchmachen müssen. Ich bin drauf und dran, die ganze Sache abzublasen.«
Das Haus hatte seine Seele verloren. Tim wusste es, und Holly spürte es, doch was er auch tat, er konnte den Verlust nicht wettmachen.
An den trübsten und dunkelsten Tagen des vergangenen Winters hatte er die Küche gestrichen. Er hatte zwar kein besonderes Talent fürs Streichen und Tapezieren, aber so hatte er wenigstens eine Beschäftigung, mit der er die scheinbar endlosen Abende und Wochenenden ausfüllen konnte, und am Ende war er sogar ziemlich stolz gewesen auf sein Werk.
Hazels zarte Grün- und Pfirsichtöne waren verschwunden. Die Schränke glänzten jetzt in strahlendem Weiß, die Wände in sattem Maisgelb. Ein Neuanfang, hatte er gedacht. Dann war Holly zu einem langerwarteten Besuch gekommen und bei dem Anblick in Tränen ausgebrochen. »Wo ist Mamis Küche?«, hatte sie gejammert, und er hatte nicht gewusst, wie er sie trösten sollte.
Irgendwann hatte sie sich natürlich daran gewöhnt, so wie sie sich an die neue Alltagsroutine gewöhnt hatte, aber er hatte immer noch das Gefühl, dass er sich sehr viel Mühe geben musste. Holly wurde in ein paar Wochen sechs, und er hatte mit seiner ganzen Überredungskunst dafür plädiert, sie hier bei sich in die Grundschule gehen zu lassen. Doch Hazel hatte schneller kapituliert, als er gedacht hatte, und nun begann er sich zu fragen, ob er überhaupt mit der Situation klarkommen würde.
»Wo ist Mami?«, fragte Holly wohl zum hundertsten Mal an diesem Nachmittag. Sie saß am Küchentisch und schlug mit den Fersen gegen die Sprossen ihres Stuhls. Er hatte ihr eine Limo gegeben, die sie bei Hazel nicht bekam, aber ihre Laune hatte sich damit nur weiter verschlechtert.
»Das hab ich dir doch gesagt, Mäuschen. Sie macht sich einen schönen Tag mit Tante Gemma. Mädchen unter sich.«
»Ich will mitgehen. Ich bin auch ein Mädchen«, erwiderte Holly mit unangreifbarer Logik.
»Diesmal geht das nicht. Das ist nur was für große Mädchen.«
»Das ist ungerecht!«
»Ja, da hast du wohl recht.« Tim seufzte. »Wir könnten uns Käsetoast machen«, schlug er vor.
»Ich will keinen Käsetoast. Ich will mit Toby spielen.« Hollys hübscher Mund, der so sehr dem ihrer Mutter glich, verzog sich zu einer finsteren Miene, die einem Kobold gut angestanden hätte.
»Da können wir sicher etwas machen.«
Gemma und Duncan hatten sich sehr bemüht, die Verbindung nicht abreißen zu lassen, und sie hatten Tim oft zu privaten Anlässen eingeladen. Das war sehr anständig von ihnen, aber ihm war sehr wohl bewusst, dass sie es auch aus Mitleid taten, und das war ihm unangenehm. Es gab nur noch wenige Gemeinsamkeiten in ihrem Leben, und es kostete ihn große Anstrengung, sich zusammenzunehmen und zwanglos über Hazel zu plaudern. Dennoch, es war einer der wenigen Fixpunkte in seinem Leben, die ihm geblieben waren, und er wollte ungern darauf verzichten.
»Na«, sagte er zu Holly, »jetzt haben wir aber lange genug den armen Stuhl getreten.« Warum, fragte sich Tim, als er sich selbst reden hörte, sprechen Erwachsene eigentlich mit Kindern immer im Plural? Schließlich war nicht er es, der gegen den blöden Stuhl trat.Vielleicht stand ja dahinter die Hoffnung, dass die Wir-Form überzeugender wirkte, aber das funktionierte offensichtlich nicht.
Holly trat weiter gegen die Stuhlsprossen. Er ignorierte es. »Wir könnten in den Park gehen, wenn Charlotte kommt.«
»Ich will nich’ mit Charlotte spielen«, sagte Holly, und Tim hörte den schottischen Akzent heraus, der immer wieder mal durchbrach, seit Holly wieder in London war. Er fand es zugleich rührend und ärgerlich, aber eigentlich wollte er nur, dass seine Tochter sich wieder wie sie selbst anhörte. »Charlotte ist ein Baby«, setzte sie verächtlich hinzu.
»Und du bist ein großes Mädchen, und deshalb kannst du ganz toll auf sie aufpassen, während ich mit ihrem Papa rede.«
Der Appell an die kleine Tyrannin in ihr schien Holly zu besänftigen, und ihre Züge entspannten sich. »Können wir trotzdem noch in den Park gehen?«
Tim sah auf die Küchenuhr. Naz und Charlotte hätten schon vor einer Stunde hier sein sollen, und eine solche Verspätung sah Naz gar nicht ähnlich. »Müssen wir sehen, Mäuschen«, sagte er zu Holly. Er versuchte es auf Naz’ Handy, doch der Anruf ging direkt auf die Mailbox.
Normalerweise empfing er samstags keine Klienten, und schon gar nicht, wenn Holly bei ihm war. Aber Naz, eigentlich Nasir Malik, war ein alter Freund – sie kannten sich noch von der Uni –, und angesichts seiner besonderen Situation hatte Tim sich bereiterklärt, seinen Terminplan an den seines Freundes anzupassen. Er hatte sich vorgestellt, dass sie sich im Garten unterhalten könnten, während die Mädchen spielten.
Und es hatte sich sehr dringend angehört, als Naz am Morgen angerufen hatte; er hatte fast verzweifelt geklungen. Wieso sollte sein Freund, der sonst geradezu zwanghaft pünktlich war, erst behaupten, er müsse unbedingt mit Tim sprechen, und dann zur vereinbarten Zeit nicht auftauchen?
»Komm, wir machen schon mal den Käsetoast«, schlug Tim vor. »Charlotte will bestimmt einen, wenn sie kommt.« Nervös fügte er hinzu: »Oder weißt du was? – Wir machen richtige Welsh Rarebits, wie Mami sie immer macht.« Er öffnete den Kühlschrank und nahm Cheddarkäse, Senf und Milch heraus. Dann kramte er im Schrank nach der Worcesterhire-Sauce und schnitt dicke Scheiben von einem etwas altbackenen Brotlaib ab.
»Die werden bestimmt nicht so gut«, erklärte Holly mit großer Gewissheit.
»Ich weiß.« Tim unterdrückte einen weiteren Seufzer, während er die Milch in einen Topf goss. »Aber wir machen sie trotzdem.«
Nachdem er die Käsesauce über das Brot gegossen, das Ganze in den Ofen gesteckt und gewartet hatte, bis der Käse Blasen schlug, begann er sich allmählich ernsthafte Sorgen um Naz zu machen. Wieder versuchte er es auf dem Handy seines Freundes, wieder ohne Erfolg. Er biss in seinen Toast und beobachtete erfreut, dass Holly sich mit Appetit über ihre Scheibe hermachte, doch er musste immer wieder nach der Uhr schielen. Es war eine altmodische Uhr mit großem Zifferblatt, und der Sekundenzeiger schien im Schneckentempo vorzurücken, während das Licht im Garten schon trüber wurde.
»Können wir jetzt in den Park gehen?« Holly rieb ihre fettigen Hände an ihrer Jeans, worauf Tim geistesabwesend aufstand und einen Lappen anfeuchtete, damit sie sich die Finger abwischen konnte.
»Noch nicht, Mäuschen.« Noch einmal probierte er es auf Naz’ Handy, dann suchte er die Nummer seines Festnetzanschlusses heraus und wählte erneut.
Schon beim ersten Läuten wurde am anderen Ende abgehoben. »Mr. Naz?« Die Stimme war jung und weiblich und zitterte vor Aufregung.
»Nein. Alia? Hier ist Dr. Cavendish.«
Alia war Naz’ Teilzeit-Kindermädchen, eine junge Bangladeschi, die tagsüber auf Charlotte aufpasste und abends Kurse am College besuchte. Naz hatte Tim erzählt, dass sie Rechtsanwältin werden wollte.
»Ist Mr. Naz denn bei Ihnen?«, fragte Alia. »Er wollte schon vor zwei Stunden zu Hause sein, und er geht nicht an sein Telefon. Meine Eltern erwarten mich, und ich kann Charlotte nicht allein lassen. Ich weiß nicht, was ich machen soll.«
»Hat er nicht gesagt, wo er hinwollte?«
»Nein. Und er kommt sonst nie zu spät. Sie kennen ihn ja. Wenn ich mit Char ein Eis essen gehe oder so, und wir kommen vielleicht fünf Minuten später zurück, dann flippt er echt aus.«
Mit gutem Grund, dachte Tim. »Gibt es sonst niemanden, den Sie anrufen könnten?«
»Ich hab’s in der Kanzlei versucht, aber da geht niemand ran. Von der Familie von Chars Mutter habe ich keine Telefonnummer. Mr. Naz will mit denen nichts am Hut haben.« Alia hatte sich schon die Ausdrucksweise und den Akzent der südenglischen Jugendlichen angewöhnt, wie viele der jungen Leute aus der zweiten Einwanderergeneration im Londoner East End.
»Er geht immer ans Telefon, wenn er sieht, dass ich es bin«, fuhr Alia fort. »Außer wenn er eine Verhandlung hat, und dann sagt er mir vorher rechtzeitig Bescheid. Er weiß, dass ich nur anrufe, wenn es wirklich wichtig ist. Und ich weiß nicht, wie ich Ms. Phillips zu Hause erreichen kann.«
Louise Phillips war Naz’ Partnerin in seiner Anwaltskanzlei. Ihre Privatnummer hatte Tim auch nicht.
»Ich könnte Char mit nach Hause nehmen«, sagte Alia, »aber ohne seine Erlaubnis möchte ich das nicht machen. Ich kann mir nicht vorstellen, wieso er mich nicht anruft, wenn er weiß, dass es später wird.« Sie klang, als sei sie den Tränen nahe.
Auch Tim konnte sich nicht vorstellen, was Naz Malik dazu bringen könnte, einen Termin verstreichen zu lassen, ohne vorher Bescheid zu geben, und die Anrufe seines Kindermädchens zu ignorieren. Aus seiner Beunruhigung wurde allmählich Angst. »Okay, Alia, lassen Sie mich nachdenken.«
3
Wir gingen weiter die Fournier Street hinunter. Die Rückseite von Hawksmoors Kirche ragte mächtig über den georgianischen Stadthäusern auf, erbaut von den Hugenotten zu einer Zeit, als Spitalfields als »Weberstadt« bekannt war.
Tarquin Hall, Salaam Brick Lane
Hazel saß am Steuer des gebrauchten VW Golf, den sie aus Schottland mitgebracht hatte.
»Wie ich sehe, hast du dich den Sloane Rangers angeschlossen«, frotzelte Gemma. Der Golf war neuerdings das Lieblingsgefährt der jungen Trendsetter aus dem Nobelviertel Chelsea. Gemma hatte sich erboten, Hazel zu dirigieren, und zog ihren Mini-Straßenatlas aus der Handtasche.
»Ein Golf gilt nur dann als Sloanie-Auto, wenn er neu ist und ein Geschenk von spendablen Eltern, die nicht wollen, dass ihr Nachwuchs zu elitär wirkt«, sagte Hazel. »Und der hier hat mit Sicherheit schon bessere Zeiten gesehen.« Sie tätschelte das Armaturenbrett, als wollte sie das Auto trösten. »Ich hatte eigentlich nicht vor, ihn mitzunehmen, aber dann habe ich gemerkt, wie umständlich es wäre, Holly von Battersea nach Islington und zurück zu bringen, zumal wir es in Battersea ziemlich weit zur nächsten U-Bahn-Station haben.«
Sie hatten die Battersea Bridge überquert und fuhren nun am Ufer der Themse in östlicher Richtung weiter. Gemma warf einen flüchtigen Blick in Richtung Cheyne Walk und schaute dann weg. Ihr London schien mehr und mehr von Geistern bevölkert, und manchen von ihnen mochte sie nicht zu viel Raum gewähren.
»Erzähl mir, was du von diesem Freund von Tim weißt«, forderte sie Hazel auf. Tim hatte angerufen, als Hazel gerade erklärt hatte, es sei jetzt an der Zeit, eine Flasche Wein aufzumachen – offenbar ein Fall von gelungenem Timing.
Hazel hatte ihn angehört, und nachdem sie aufgelegt hatte, stellte sie die Flasche in den Kühlschrank zurück und runzelte die Stirn. »Tim will, dass wir uns in einem Haus in der Nähe der Brick Lane mit ihm treffen«, erläuterte sie. »Das heißt, wenn du es einrichten kannst. Ein Freund von ihm, ein alleinerziehender Vater, ist nicht nach Hause gekommen, und Tim macht sich Sorgen um ihn und das Kind.«
Gemma hatte bereitwillig zugestimmt, aber jetzt fügte sie hinzu: »Meinst du nicht, dass Tim überreagiert? Da liegt doch sicher nur irgendein Missverständnis vor.«
»Ich habe immer gesagt, Tims Puls würde nicht mal bei einem Erdbeben schneller gehen. Ich habe mir gewünscht, er wäre ein bisschen emotionaler.« Die Art, wie Hazel das Wort betonte, machte deutlich, was sie davon hielt. »Was ich sagen will, ist: Wenn Tim sich Sorgen macht, dann hat er einen guten Grund.« Sie manövrierte das schwerfällige Getriebe des Golf mit einiger Mühe in einen tieferen Gang und trommelte dann mit den Fingern auf dem Lenkrad herum, während sie an einer roten Ampel hielten. »Über seinen Freund weiß ich nur, dass sie sich von der Uni kennen und vor kurzem den Kontakt wieder aufgenommen haben. Er ist Rechtsanwalt und heißt Naz Malik. Ein Pakistani. Ich bin ihm nie begegnet. Maliks Frau war in irgendeinen Skandal verwickelt, und ich nehme an, dass Tim in ihm einen Leidensgenossen sah.«
Gemma warf ihrer Freundin einen Seitenblick zu, aufgeschreckt durch den bitteren Ton, doch Hazel fuhr fort: »Ich weiß nicht genau, warum er mich angerufen hat – ich kann mir höchstens vorstellen, dass er deinen Rat einholen wollte, weil er ja von deinem Besuch bei mir wusste.«
Gemma fürchtete, dass jede weitere Bemerkung das Gespräch auf vermintes Gelände führen würde, und wandte sich deshalb wieder ihrem Straßenatlas zu. »In Whitechapel solltest du besser die Commercial Street nehmen. Soviel ich weiß, ist die Brick Lane in die andere Richtung eine Einbahnstraße.«
Der Samstagsverkehr war nicht allzu dicht, und sie kamen gut voran. Am Tower Hill bogen sie von der Uferstraße ab, und bald schon ragte der schmucklose Turm von Christ Church Spitalfields vor ihnen auf. Gegenüber erhob sich die dunkle Backsteinfassade des alten Spitalfield Market, gekrönt von der neuen glasüberdachten Einkaufspassage.
Als Kind war Gemma einige Male mit ihren Eltern in Spitalfields und in der Petticoat Lane auf dem Markt gewesen, und einmal hatte sie mit ihrem Exmann Rob die Brick Lane besucht. Damals war sie noch ganz frisch bei der Kriminalpolizei, und sie war sich sicher, dass die billigen Zigaretten und Spirituosen, die Rob auf dem Markt gekauft hatte, geschmuggelt oder gestohlen waren. Die Straße hatte nach verrottenden Abfällen gerochen, die Gebäude waren ihr schmutzig und verwahrlost vorgekommen, und selbst im Vergleich mit Leyton, wo sie aufgewachsen war, hatte sie die Atmosphäre als rau und unfreundlich empfunden. Dann hatten sie und Rob auch noch einen Streit angefangen; er hatte sie – nicht zum ersten Mal – eine selbstgerechte Zicke genannt, und sie hatte ihn – nun ja, daran wollte sie sich gar nicht so genau erinnern. Alles in allem war es eine Erfahrung gewesen, die sie lieber nicht hatte wiederholen wollen.
»Gleich nach der Kirche musst du rechts abbiegen«, wies sie Hazel an.
»Von Hawksmoor erbaut, nicht wahr?« Hazel spähte durch die Windschutzscheibe nach oben. »Eindrucksvoll – aber nicht gerade das einladende Kirchlein um die Ecke, in dem man gerne Zuflucht sucht.«
Gemma musste zugeben, dass die kantige Silhouette der Kirche ein wenig abweisend wirkte, und die Proportionen waren auch irgendwie merkwürdig, als müsse der Turm zu viel Gewicht tragen.
Als sie rechts abbogen, sah sie vor sich die kurze Fournier Street mit ihren düsteren, strengen Häusern. Das obere Ende der Straße wurde von der Kirche und der schäbigen Fassade eines Pubs dominiert, während das untere Ende den Blick auf den Bangla-City-Supermarkt auf der anderen Seite der Brick Lane freigab.
»Da ist Tims Auto«, sagte Hazel knapp, als ob ihre negativen Gefühle sich auch auf den verbeulten Volvo erstreckten. Sie fand eine kleine Parklücke in der Nähe, und nachdem sie ihren Golf hineinmanövriert hatte, stiegen sie und Gemma aus und suchten die Hausnummer, die Hazel sich auf einem Zettel notiert hatte.
»Das hier ist es.« Gemma blickte zu dem Haus auf, das zu der Reihe auf der Nordseite der Straße gehörte. Obwohl die Häuser aneinandergrenzten, setzten sie sich durch kleine architektonische Details und auch durch ihren Erhaltungszustand voneinander ab. Dieses Haus sah gepflegt aus; das Zartgrün der Fensterläden und des schmiedeeisernen Geländers kontrastierte mit dem braunen Backstein der Fassade.
Die Haustür war seitlich versetzt, sodass das Erdgeschoss nur zwei Fenster zur Straßenseite hatte, während es im ersten und zweiten Stock je drei waren. Das oberste Stockwerk war zurückgesetzt, sodass Gemma nur Lichtreflexe erkennen konnte, die von Loft- oder Atelierfenstern zu kommen schienen. Die Haustür war mit einem gewölbten Vordach versehen, das von reich verzierten, ebenfalls blassgrün gestrichenen Konsolen getragen wurde. Der Bogen des Vordachs fand sich in dem leicht geschwungenen Mauerwerk über den Fenstern wieder.
Bevor sie klingeln konnten, wurde die Tür geöffnet, und Tim sprang die Stufen herunter, um Gemmas Hand zu nehmen und ihr einen flüchtigen Kuss auf die Wange zu drücken. »Danke fürs Kommen.« Er war groß gewachsen, und mit seiner linkischen Art hatte er Gemma immer irgendwie an einen jungen Hund erinnert, ein Eindruck, der durch seinen wuscheligen Haarschopf und den Bart noch verstärkt wurde.Aber er strahlte auch eine sympathische Ernsthaftigkeit aus, und Gemma fragte sich, ob es diese Eigenschaft war, die seinen Klienten half, sich ihm anzuvertrauen.
»Hazel –« Etwas verspätet wandte er sich seiner Frau zu; sie hatte die Stufen bereits erklommen. »Danke. Ich –«
»Schon was von deinem Freund gehört?«, fragte Hazel.
»Nein. Ich habe Alia gesagt, sie soll bleiben, bis ihr da seid. Ich dachte, Gemma würde vielleicht gerne mit ihr reden. Alia ist Charlottes Kindermädchen«, beeilte er sich zu erklären, während er sie ins Haus führte.
Der Eingangsbereich wurde von einer Treppe aus poliertem Eichenholz dominiert, einer schwindelerregenden Konstruktion aus rechtwinklig angeordneten Absätzen. Einen deutlichen Kontrast zur Pracht des Treppenhauses bildete dagegen das eiserne Schuhregal hinter der Tür, vollgestellt mit gepunkteten Gummistiefeln in verschiedenen Größen und behängt mit einem Sammelsurium von Hüten und Mützen. Daneben stand ein Fahrrad, an dessen Lenkstange ein Helm am Kinnriemen aufgehängt war.
Die Wände waren im gleichen warmen Grünton gestrichen wie die Fensterrahmen und das Geländer. Durch eine offene Tür erhaschte Gemma einen Blick auf ein gemütlich wirkendes Wohnzimmer.
»Charlotte ist die kleine Tochter deines Freundes?«, fragte Gemma.
»Ja. Sie ist noch nicht ganz drei Jahre alt. Naz hatte gesagt, er würde vorbeikommen, und wir wollten die Mädchen miteinander