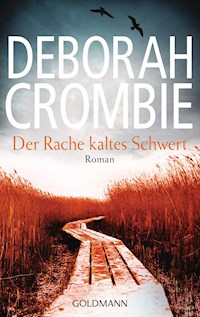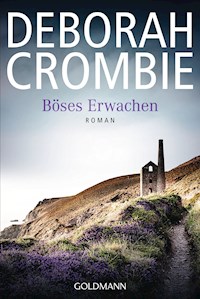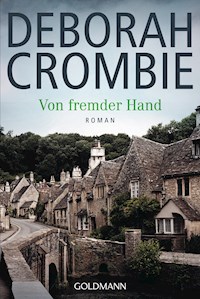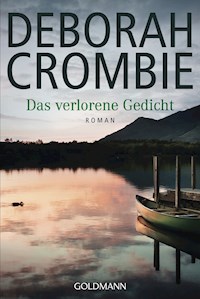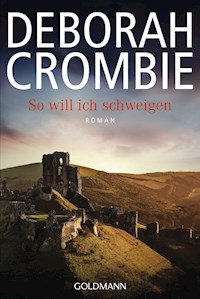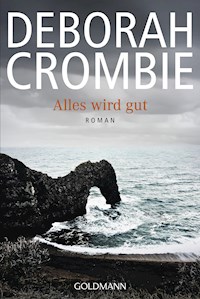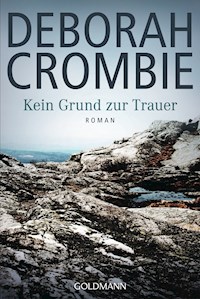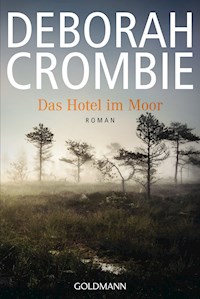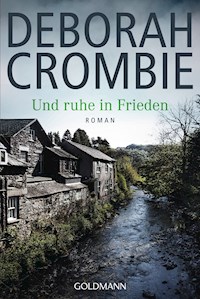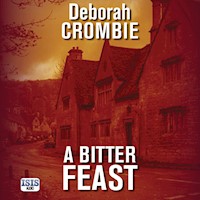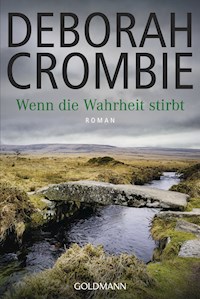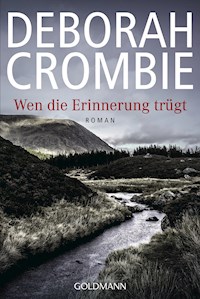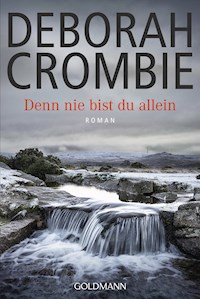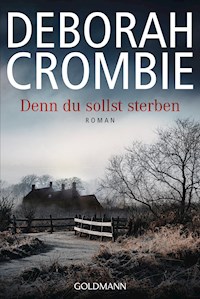
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Kincaid-James-Romane
- Sprache: Deutsch
Lower Slaughter ist ein malerisches Dorf in den Cotswolds. Dorthin ist Detective Superintendent Duncan Kincaid privat unterwegs, als er in einen schweren Unfall verwickelt wird: Kincaid wird verletzt, die Fahrerin des anderen Wagens, Nell Greene, und ihr Beifahrer Fergus O'Reilly überleben die Kollision nicht. Wie sich bald herausstellt, kannten sich Nell und O'Reilly gar nicht, hatten aber beide kurz vor dem Unglück im Pub von Viv Holland gegessen – der Chefköchin, zu deren Benefizessen am Wochenende Kincaid und James eingeladen sind. Der Fall wird immer rätselhafter, denn die Untersuchung ergibt, dass O'Reilly bereits vor dem Unfall tot war ...
Der neue Fall aus der Bestseller-Serie um Duncan Kincaid und Gemma James.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 598
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Buch
Lower Slaughter ist ein malerisches Dorf in den Cotswolds. Dorthin ist Detective Superintendent Duncan Kincaid privat unterwegs, als er in einen schweren Unfall verwickelt wird: Kincaid wird verletzt, die Fahrerin des anderen Wagens, Nell Greene, und ihr Beifahrer Fergus O’Reilly überleben die Kollision nicht. Wie sich bald herausstellt, kannten sich Nell und O’Reilly gar nicht, hatten aber beide kurz vor dem Unglück im Pub von Viv Holland gegessen – der Chefköchin, zu deren Benefizessen Kincaid und Gemma eingeladen sind. Der Fall wird immer rätselhafter, denn die Untersuchung ergibt, dass O’Reilly bereits vor dem Unfall tot war …
Autorin
Deborah Crombies höchst erfolgreiche Romane um Superintendent Duncan Kincaid und Inspector Gemma James von Scotland Yard wurden mit dem »Macavity Award« ausgezeichnet und für den »Agatha Award« und den »Edgar Award« nominiert. Die Autorin lebt mit ihrer Familie im Norden von Texas, verbringt aber viel Zeit in England, wo ihre Romane angesiedelt sind. Weitere Informationen zur Autorin unter www.deborahcrombie.com.
Deborah Crombie
Denn du sollst sterben
Roman
Aus dem Englischen von Andreas Jäger
Die Originalausgabe erschien 2019 unter dem Titel »A Bitter Feast« bei William Morrow & Company Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Deutsche Erstveröffentlichung Januar 2020 Copyright © der Originalausgabe 2019 by Deborah Crombie Published by arrangement with Deborah Crombie Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover. Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2020 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München Covergestaltung: UNO Werbeagentur GmbH Covermotive: © David Jilek / Arcangel, FinePic®, München Gestaltung der Karte: © Laura Hartman Maestro Redaktion: Eva Wagner BH · Herstellung: kw
Für meinen Bruder Steve
1942–2018
Wo immer er jetzt segeln mag
1
Sie hatte noch nie besonders viel geschlafen. Und das war gut so, dachte sie, denn eine Grundvoraussetzung für den Beruf der Köchin ist die Fähigkeit, mit wenig Schlaf auszukommen. An diesem Septembermorgen war sie lange vor Tagesanbruch aufgewacht. Sie hatte die Bauernhoftour absolviert und das tägliche frische Gemüse für das Pub besorgt. Wieder zu Hause, hatte sie das Frühstück für ihre elfjährige Tochter Grace bereitet und sie anschließend zur Schule gebracht. Diese ruhigen Morgenstunden mit ihrer Tochter waren ihr sehr kostbar. Oft war es die einzige Zeit, die sie außerhalb der Restaurantküche zusammen verbringen konnten.
Die knappe Stunde, die sie in der Pubküche für sich allein hatte, ehe das Personal für den Mittagsbetrieb eintraf, war ebenfalls unbezahlbar und heute umso mehr. Sie hatte den Kühlraum gewischt, die Vorräte organisiert und die Tageskarte von Hand geschrieben, die Bea, ihre Geschäftsführerin, später ausdrucken würde. Jetzt saß sie mit umgebundener Schürze auf den Stufen vor der rückwärtigen Küchentür und blickte über den kleinen Anlieferungsbereich zwischen dem Pub und dem Cottage, in dem sie als Küchenchefin wohnte. Während sie ihren ersten Espresso des Tages aus der Kaffeemaschine des Pubs trank, ging sie ihre Erledigungsliste für den morgigen Charity-Lunch in Beck House, dem Landsitz der Talbots, durch.
Plötzlich überkamen sie Zweifel. Was hatte sie sich dabei gedacht, sich auf so etwas einzulassen – das Catering für einen Freiluft-Lunch für vier Dutzend vermögende Bürgerinnen und Bürger aus der Region sowie diverse bekannte Foodblogger und Restaurantkritiker?
Als sie vor drei Jahren mit Grace hierhergekommen war, froh um den Job, der ihr ein Dach über dem Kopf und ein Auskommen für sie und ihre Tochter garantierte, da hatte sie sich geschworen, dass sie auf einfache Hausmannskost setzen würde. Gutes Pub-Food: Fleischpasteten, Fish and Chips, Suppen der Saison, ein Braten zum Sonntagslunch. Sie hatte sich daran gehalten, und sie machte es gut, denn schließlich hatten sie Tag für Tag ein volles Haus. Aber warum hatte sie sich dann zu etwas überreden lassen, das diese selbst gesetzten Grenzen weit überschritt? »Etwas Unvergessliches, Viv. Etwas, was nur Sie schaffen können«, hatte Addie gesagt, in ihrer forschen Art, die keinen Widerspruch duldete. Und Viv hatte angebissen.
Nun, jetzt steckte sie drin, und sie konnte das leise Kribbeln in ihren Adern nicht unterdrücken. Alles, von der Vorspeise bis zum Dessert, war aus regionalen Zutaten bereitet, und sie hatte wochenlang am Menü gefeilt.
Am Morgen hatte sie bereits den Barbecue-Smoker des Pubs – eine Art Kamado-Joe-Grill für Arme – vorbereitet und eine letzte Lammschulter hineingelegt. Im Lauf der letzten Wochen hatte sie sieben oder acht davon gegart und eingefroren, aber gestern Abend hatte sie in einem Anfall von Panik beschlossen, noch eine mehr zu machen. Die weißen Bohnen mit Fenchel, die zum Fleisch serviert werden sollten, hatte sie ebenfalls schon gekocht und eingefroren, und sie standen jetzt zum Auftauen in der Küche des Cottage. Ein paar Dinge musste sie noch an diesem Nachmittag erledigen, und das eine oder andere musste bis morgen Vormittag warten, aber im Großen und Ganzen fand sie, dass sie gut in der Zeit lag.
Während sie den letzten Schluck Kaffee trank, blickte sie abwesend an dem Lagerschuppen aus goldgelbem Cotswold-Stein und dem angrenzenden Cottage vorbei zu den Hügeln, die sich sanft über dem Tal des River Eye erhoben. Es war Frühherbst, schon immer ihre liebste Jahreszeit, seit ihrer Kindheit. Sie war in diesen Tälern von Gloucestershire aufgewachsen, und sie hätte nie gedacht, dass sie nach fünfzehn Jahren in London hierher zurückkehren würde. Aber vielleicht war es ja gut so. Und vielleicht war auch der Charity-Lunch eine gute Sache. In den letzten Jahren hatte sie sich weiß Gott genug abgerackert mit dem Pub und dem Catering-Service, und wenn sie ganz ehrlich war, musste sie zugeben, dass sie den Kick der mondänen Haute Cuisine vermisste. Vielleicht wurde es Zeit, dass sie wieder Fühlung mit dieser Welt aufnahm. Was konnte es schon schaden, nach dieser langen Zeit?
Sie kippte den Kaffeesatz in den Geranientopf neben der Hintertür. Nun denn, zurück an die Arbeit – egal, was der morgige Tag bringen mochte.
Sie hatte sich gerade von der Stufe erhoben, als sich ein Schatten über den Hof legte und eine groß gewachsene Gestalt die Morgensonne verdeckte. Und als sie aufblickte, blieb ihr fast das Herz stehen.
Nell Greene schob ein paar Happen Hähnchen-Estragon-Pastete auf ihrem Teller hin und her. Auf die hausgemachten Pasteten des Pubs war immer Verlass. Der Mürbeteig von Chefköchin Viv war göttlich, und der Kälteeinbruch Ende September hatte in Nell das Verlangen nach solchem Trostessen geweckt. Das offene Feuer im Pub war ebenso verlockend, und deshalb hatte sie einen Platz neben dem Kamin in der Bar gewählt und nicht in den förmlicheren Restaurantbereichen zu beiden Seiten der gemütlichen Bar in der Mitte.
Aber irgendwie war es ein komisches Gefühl, so ganz allein in dem regen Freitagabend-Betrieb, und sie hatte in ihrem Essen herumgestochert, während sie zusah, wie die Strahlen der Abendsonne durch die Sprossenfenster des Pubs fielen. Nach ihrer Scheidung hatte sie festgestellt, dass das Single-Dasein ihr durchaus zusagte, doch sie hatte sich noch nicht daran gewöhnt, allein auswärts zu essen. Der Anblick von Pärchen bereitete ihr stets besonderes Unbehagen, und wenn sie die zwei älteren und offensichtlich verheirateten Paare beobachtete, die sich bei Gin und Zeitungslektüre unterhielten, verspürte sie einen vertrauten Anflug von Neid. Heute Abend jedoch schoss das junge Pärchen am Nebentisch den Vogel ab. Sie saßen mit verschlungenen Beinen da, schnäbelnd und fummelnd. Als die blonde Frau ihre Hand in das Hosenbein der Fußballshorts des Mannes schob, wandte Nell peinlich berührt den Blick ab. Sie vermutete, dass die beiden verheiratet waren – allerdings nicht miteinander. Das war die einzige Erklärung für diese schamlose Zurschaustellung von – nun ja, man mochte es Verliebtheit nennen. Wenigstens war sie heute Abend nicht die Einzige ohne Begleitung, dachte sie mit einem Blick zu dem groß gewachsenen Mann mit dem weichen Filzhut, der es sich auf dem abgewetzten, aber gemütlichen Ledersofa in der Ecke bequem gemacht hatte.
Sie schätzte, dass er gut zehn Jahre jünger war als sie, vielleicht Mitte vierzig. Unter dem braunen Hut fiel ihm sein dunkelblondes lockiges Haar bis auf die Schultern. Sein sorgfältig gestutzter Vollbart war eine Nuance dunkler als das Haupthaar, doch er konnte die auffallend tiefen Grübchen nicht verdecken, die sichtbar wurden, als er der Kellnerin zulächelte. Anfangs hatte sie geglaubt, er sei mit jemandem verabredet, doch inzwischen war eine halbe Stunde verstrichen, und er war immer noch allein.
Als ob er gespürt hätte, dass sie ihn beobachtete, blickte er in diesem Moment auf. Mit einem Stirnrunzeln in Richtung des knutschenden Pärchens schenkte er ihr ein verschwörerisches Lächeln. Nell wurde rot und konnte nur stumm nicken. Worauf der Mann ihr demonstrativ zuzwinkerte, ehe er sich wieder seinem Essen zuwandte.
Nell wäre am liebsten im Boden versunken. Hatte er sich über sie lustig gemacht? Aber seine Geste schien nichts Boshaftes zu haben, und nachdem sie wieder ein paar Krümel vom Rest ihrer Pastete aufgepickt hatte, gewann die Neugier die Oberhand, und sie sah wieder in seine Richtung. Was tat ein so gutaussehender Mann an einem Freitagabend allein in einem Dorfpub? Nicht dass man hier keine Fremden zu Gesicht bekommen hätte – das Dorf war ein beliebtes Touristenziel –, doch ein unbekanntes Gesicht ohne Begleitung war eine Seltenheit.
Der Mann erhaschte die Aufmerksamkeit des Barkeepers und tippte an seine Kaffeetasse. Etwas an seiner Art ließ sie vermuten, dass er es gewohnt war zu bekommen, was er wollte, und zwar schnell. Nun ja, warum nicht? Zwar wirkten der Hut und die schulterlangen Haare etwas exzentrisch, doch seine Kleidung war offensichtlich teuer. Vielleicht war er in dem noblen Gutshaus-Hotel im Dorf abgestiegen.
Nell sah zu, wie Jack, der Barkeeper, einen neuen Kaffee aus der Küche brachte und die leere Tasse des Mannes flink abräumte. Warum trinkt er nur Kaffee?, fragte sie sich.
Nachdem sie in der ersten Zeit nach ihrer Scheidung Gefahr gelaufen war, dem allzu bequemen Trost des Alkohols zu erliegen, verzichtete sie inzwischen ganz darauf, bis auf das eine oder andere Glas Wein in Gesellschaft. Allein trank sie gar nicht mehr, und das machte ihr jemanden, der offenbar wie sie Abstinenzler war, gleich ein Stück sympathischer. Sie wollte ihm eben wieder zulächeln, als sie bemerkte, dass er nicht zu ihr schaute, sondern zur Küche.
Eine Frau mit lockigen, dunklen Haaren und randloser Brille trat aus der Tür hinter dem Tresen – Bea Abbott. Nach einer halblauten Bemerkung zu Jack ging sie um die Theke herum und steuerte auf den Ausgang zu, der zu dem kleinen Biergarten führte. Nell fand es seltsam, dass sie nicht stehen blieb, um mit einem der Gäste zu reden. Bea konnte normalerweise ganz routiniert Smalltalk machen. Nell hatte sich für sie gefreut, als sie Geschäftsführerin des Pubs geworden war.
In der Ecke sah der Mann mit dem Filzhut zu, wie sich die Tür hinter Bea schloss, dann entknotete er seine langen Beine und trommelte mit den Fingern auf den Tisch. Seine Miene war jetzt angespannt, er wirkte abwesend, und als sein Blick über Nell hinwegglitt, wusste sie, dass sie unsichtbar geworden war. Plötzlich stellte er seine Kaffeetasse mit einem Klirren ab und stand auf. Er durchmaß mit großen Schritten den Raum, ging um den Tresen herum und durch die Küchentür, wobei er Jack glattweg ignorierte.
Nell blieb vor Verblüffung der Mund offen stehen, doch Jack runzelte nur die Stirn und trocknete weiter Gläser ab, ein wenig heftiger als nötig.
Das knutschende Pärchen stand auf und verließ das Lokal, immer noch eng umschlungen, durch die Tür zum Parkplatz. Die Restaurantbereiche zu beiden Seiten der Bar füllten sich allmählich, und Sarah, eine der Kellnerinnen, wies den ankommenden Gästen ihre Tische zu. Doch trotz des anschwellenden Stimmengewirrs konnte Nell hören, wie in der Küche lautstark gestritten wurde.
Anfangs waren die Stimmen undeutlich. Dann sagte Viv Holland ganz deutlich: »Du kannst nicht einfach hier reinplatzen und Forderungen stellen. Verdammt, für wen hältst du dich eigentlich?« Nell war überrascht. Sie hatte Viv, die begnadete Pastetenköchin mit der blonden Igelfrisur, noch nie die Stimme erheben hören.
Die Erwiderung war ein unverständliches Gebrummel. Der Mann mit dem Hut, wie Nell vermutete.
»Nein, das kannst du nicht«, rief Viv, ihre Stimme nunmehr schrill vor Zorn. »Ich mach das nicht. Ich hab dir gesagt …«
»Ich bitte dich, Viv, nimm doch Vernunft an.« Wieder der Mann. Er war jetzt deutlicher zu verstehen, und sein Ton hatte etwas Einschmeichelndes. Nell bemerkte einen irischen Akzent.
Viv murmelte etwas.
»Also, wenn du schon so bockig sein musst«, erwiderte der Mann, der nun nicht mehr so geduldig klang, »dann bedenke wenigstens …«
»Nein.« Ein Scheppern war zu hören, als ob Viv etwas fallen gelassen hätte. Oder geworfen. »Du hast verdammt noch mal kein Recht, das zu verlangen«, sagte sie – fast schrie sie es. »Und jetzt raus hier. Das ist mein Ernst.«
Die Gespräche in der Bar waren verstummt, während die anderen Gäste sich mit großen Augen zur Küche umdrehten. Jack stand reglos da, die Hand am Zapfhahn.
Was zum Teufel ist da los?, fragte sich Nell. Sie fühlte sich furchtbar unbehaglich. Eigentlich hatte sie mit Viv über Lady Adelaides morgigen Erntedank-Lunch reden wollen, aber jetzt mochte sie sich nicht einmischen.
Der Mann platzte mit grimmiger Miene aus der Küchentür in die Bar. Ohne Nell eines Blickes zu würdigen, stürmte er an ihrem Tisch vorbei und stieß beim Hinausgehen die Tür zum Biergarten so heftig auf, dass sie hinter ihm mit einem Knall ins Schloss fiel. Zurück blieb sein Kamelhaarmantel, den er achtlos auf das Sofa geworfen hatte.
»Bist du sicher, dass deine Eltern Platz für uns alle haben?« Vom Beifahrersitz aus warf Gemma ihrer Begleiterin einen besorgten Blick zu.
Melody Talbot lachte und schüttelte den Kopf. »Gemma, ich hab dir doch gesagt, mach dir keine Gedanken. Das Haus hat acht Schlafzimmer.«
Das beruhigte Gemma ein wenig. Acht Schlafzimmer. Was um alles in der Welt fing jemand mit acht Schlafzimmern an? Gemma war in einer Dreizimmerwohnung über der Bäckerei ihrer Eltern im Londoner Norden aufgewachsen, wo sie sich – nicht immer friedlich – ein Zimmer mit ihrer Schwester geteilt hatte. Zwar wohnte sie inzwischen in einem sehr komfortablen Haus in Notting Hill, doch das hatte sie mehr den Umständen als ihren Einkommensverhältnissen zu verdanken, und wahrer Reichtum schüchterte sie immer noch ein. Sie verdiente ihr Geld bei der Polizei, als Detective Inspector zwar, aber mit einem normalen Polizistengehalt konnte man sich solche Extravaganz nicht leisten. Es sei denn, man hieß Melody Talbot.
Sie betrachtete ihre Freundin. Melody war eine zierliche, hübsche Frau mit dunklen Haaren, die aus dem jungenhaften Kurzhaarschnitt vom letzten Frühjahr schon wieder etwas herausgewachsen waren. Sie fuhr sicher, die Hände entspannt am Steuer ihres kleinen Renault Clio. Melody war Gemmas Detective Sergeant, aber über ihr Privatleben hatte Gemma erst Näheres erfahren, nachdem sie schon eine ganze Weile zusammengearbeitet hatten. Und wie Gemma inzwischen wusste, gab es gute Gründe für Melodys Zurückhaltung in dieser Hinsicht. Ihr Vater war der Herausgeber einer bedeutenden Londoner Tageszeitung, bekannt für ihren investigativen Journalismus und ihre nicht immer gnädige Berichterstattung über die Polizei. Melody hatte sich stets bedeckt gehalten, aus Furcht, von ihren Kollegen ausgegrenzt zu werden, wenn sie von der Verbindung erführen. Erst die Ereignisse der letzten Monate hatten sie gezwungen, sich ein wenig zu öffnen. Aber erst vor Kurzem war Gemma zum ersten Mal in Melodys Wohnung eingeladen worden, und ihren Eltern war sie noch nie begegnet.
Die Einladung an Gemma und ihre Familie sowie ihren gemeinsamen Freund Doug Cullen, das Wochenende auf dem Landsitz von Melodys Eltern zu verbringen, war überraschend gekommen. »Mum will eine Riesenfete zum Erntedank schmeißen«, hatte Melody gesagt. »Sie möchte dich und Duncan kennenlernen. Und Doug auch – weiß der Himmel, wieso. Ihr müsst unbedingt kommen.« Berührt von der unerwarteten Verletzlichkeit in Melodys Miene, hatte Gemma spontan zugesagt.
Jetzt fragte sie sich, was in aller Welt sie sich dabei gedacht hatte.
Sie hatten getrennt anreisen müssen. Gemma fuhr mit der fast vierjährigen Charlotte bei Melody mit, während Duncan später am Abend mit dem Familienauto nachkommen würde. Die Jungs, der siebenjährige Toby und der fünfzehnjährige Kit, würden morgen zusammen mit Doug den Zug nehmen. Duncan und Doug, die auf dem Revier Holborn in Central London im gleichen CID-Team arbeiteten, hatten am Nachmittag noch einen Fall abschließen müssen, während Toby seine Ballettstunde am Samstagvormittag nicht verpassen wollte.
»Mummy«, kam Charlottes schläfrige Stimme vom Rücksitz, »sind wir schon da?«
»Bald, Schätzchen«, antwortete Gemma, obwohl sie keine Ahnung hatte. Es war nach sechs, sie hatten Oxford schon vor über einer Stunde hinter sich gelassen und fuhren nun schon eine ganze Weile durch die Cotswold Hills. »Hast du gut geschlafen?«, fragte sie und streckte die Hand nach hinten aus, um Charlotte einen aufmunternden Klaps zu geben.
»Ich will Abendessen«, quengelte Charlotte.
»Bald, Schatz«, versicherte Melody ihr. »Und es gibt lauter total leckere Sachen. Wir sind wirklich so gut wie da. Es wird dir gefallen.«
Ja, Charlotte vielleicht – aber Gemma war sich alles andere als sicher, was diese Landpartie betraf. Sie war ein Stadtmensch durch und durch. In London fühlte sie sich wie ein Fisch im Wasser, sicher und geborgen. Außerhalb der Stadt wusste sie nie so recht, was sie mit sich anfangen sollte.
Aber es war schön hier, das musste sie zugeben, als sie die sanften Hügel und die grünen Schafweiden von Gloucestershire im Abendsonnenschein vorbeiziehen sah. Sie kamen an der Abzweigung nach Bourton-on-the-Water vorbei, und wenige Minuten darauf bog Melody scharf links in eine schmale Landstraße ein. Auf dem Wegweiser stand »THESLAUGHTERS«.
»Slaughters? Bringst du uns jetzt zum Schlachthof, oder was?«, fragte Gemma stirnrunzelnd.
Melody grinste. »Es bedeutet nicht das, was du meinst. Der Name ist die moderne Form des altenglischen Worts für einen Sumpf. Das ist jedenfalls eine Interpretation. Es gibt Lower Slaughter und Upper Slaughter, und wir sind irgendwo dazwischen.«
Die Straße war eng und anfangs von Hecken gesäumt, die weiter talwärts überhängenden Alleebäumen wichen. Gemma erblickte zunächst einige lange, niedrige Kalkstein-Cottages zu beiden Seiten der Straße und dann ein großes Herrenhaus, das etwas zurückgesetzt rechter Hand stand. »Ist das …«
Melody schüttelte bereits den Kopf. »O nein. Das ist das Gutshaus. Siebzehntes Jahrhundert. Viel zu vornehm für uns. Es ist jetzt ein ziemlich nobles Hotel.«
Sie erreichten das eigentliche Dorf. Gemma sah eine altehrwürdige Kirche und gegenüber ein Pub, ein langes, niedriges Haus, in dessen Fenstern die ersten Lichter brannten. Sie erhaschte einen Blick auf das Holzschild über dem Eingang, das ein Lamm auf einer grünen Wiese zeigte. Zu ihrer Linken floss ein malerisches Flüsschen unter einer geschwungenen Brücke hindurch. »Da ist das andere Hotel, der Gasthof«, erklärte Melody und deutete auf ein Haus am anderen Flussufer mit herbstlich rotem Wildem Wein an der Fassade. »Aber für gutes Essen in entspannter Atmosphäre ist das Pub eindeutig die richtige Adresse.«
Die Straße führte über die Brücke und weiter am Fluss entlang. Alle Häuser waren aus dem gleichen honigfarbenen Stein erbaut, bis auf eine Mühle aus rotem Backstein an der Biegung des Flusses.
»Was ist das, Mummy?«, fragte Charlotte und zeigte darauf. »Das runde Ding da.«
»Das ist ein Mühlrad, Schätzchen. Ist die Mühle noch in Betrieb?«, fügte Gemma an Melody gewandt hinzu.
»Da ist jetzt ein Museum drin. Mit Teestube. Vielleicht können wir morgen mal hingehen.« Melody warf einen Blick in den Innenspiegel. »Hättest du da Lust drauf, Char?«
»Ja!« Charlotte nickte so heftig, dass ihr karamellfarbener Lockenschopf wippte.
Sie hatten das Dorf hinter sich gelassen. Die Straße führte jetzt wieder bergauf, und der Fluss verschwand hinter grünen Weiden. Die goldenen Strahlen der Abendsonne strichen schräg über die Hügel, die sich zu beiden Seiten erhoben.
Während die Straße anstieg, rückten die Hecken immer näher, bis sie durch einen Tunnel aus Grün fuhren. An dessen Ende verlangsamte Melody die Fahrt und bog in eine schmale Zufahrt ein. Vor ihnen fiel eine offene Parklandschaft sanft zum Fluss hin ab, doch der Blick in die Ferne wurde durch die Alleebäume versperrt, die den Zufahrtsweg säumten.
Gemma bemerkte, dass Melodys Hände das Lenkrad fester umklammerten, als sie in einen dichteren Wald eintauchten. »Das Waldland«, sagte Melody. »Dann kommt der Wilde Garten und dann das Haus. Alles ganz im Stil der Arts and Crafts Movement.«
»Sind wir da? Sind wir da?« Charlotte wibbelte aufgeregt in ihrem Kindersitz hin und her. Gemma stellte fest, dass sie den Atem anhielt.
Die Bäume lichteten sich, der Weg fiel ab, und als sie in den Sonnenschein hinausfuhren, gingen Gemma die Augen über angesichts der Farbenpracht, die sich ihr präsentierte. Orange-, Gelb- und Lilatöne füllten den Garten, der in sanften Stufen zum Haus hin anstieg.
Und das Haus erst! Erbaut aus dem gleichen hellen Cotswold-Stein, den sie im Dorf gesehen hatte, leuchtete er im Abendlicht. Ein zentraler überdachter Vorbau erhob sich bis zum Schieferdach des zweistöckigen Hauses, eingefasst von zwei Flügeln. Bleiglas schimmerte in den Fenstern, und träge Rauchkringel stiegen aus dem Schornstein in der Mitte auf. Üppige rosa Rosen kletterten zu beiden Seiten des Portals empor.
»Oh, das ist ja wundervoll«, hauchte Gemma. »Ganz und gar nicht das herrschaftliche Haus, das ich erwartet hatte.«
»Danke – sollte ich wohl sagen«, fügte Melody mit einem ironischen Lächeln hinzu. Der Zufahrtsweg führte im Bogen links um den Garten herum, dann knirschten die Reifen, als Melody den Renault auf dem gekiesten Vorplatz zum Stehen brachte.
»Willkommen in Beck House.«
Von der A40 aus sah Duncan Kincaid die Sonne untergehen. Er hatte reichlich Zeit, das Naturschauspiel zu bewundern, da es nur im nervenaufreibenden Stop-and-go-Verkehr voranging. Er hatte Gemma angerufen, um Bescheid zu sagen, dass er sich verspäten würde. Im Radio hatten sie einen schweren Unfall kurz vor seiner Ausfahrt gemeldet. Er war jetzt doch ganz froh, dass sie nicht alle zusammen gereist waren, so wenig es ihm behagt hatte, die Jungs in London zurückzulassen.
Natürlich musste er sich keine Sorgen um sie machen. Wesley Howard, ein Freund der Familie, hatte sich bereit erklärt, heute bei ihnen zu übernachten. Am nächsten Morgen würde Kit Toby zu seiner Ballettstunde bringen, und danach würden sie sich am Bahnhof Paddington mit Doug Cullen treffen. Freilich hätten Kit und Toby auch allein reisen können, aber Kincaid hatte ein besseres Gefühl, wenn er wusste, dass sie unter der Aufsicht eines Erwachsenen waren.
Die Vorstellung von Doug Cullen als »erwachsener Aufsichtsperson« entlockte ihm ein Lächeln. Gewiss, Doug war inzwischen über dreißig, aber irgendwie konnte sich Kincaid seinen Sergeant nicht in einer Elternrolle vorstellen. Doug hatte gesagt, dass er am Vormittag noch eine Ruderveranstaltung habe, aber Kincaid vermutete eher, dass er nicht auf einen Samstagvormittag in seinem Garten verzichten mochte. Seit dem Frühjahr war der Garten Dougs neue Leidenschaft, und er redete davon mit der ermüdenden Ausführlichkeit des Konvertiten.
Kincaid fragte sich auch, wie wohl Doug beim Gedanken an den Besuch im Landhaus der Talbots war. Nach den Ereignissen des Frühjahrs hatten sie beide dienstlich mit Sir Ivan zu tun gehabt, aber dessen Frau hatten sie beide noch nicht kennengelernt, und nach Melodys Schilderungen zu urteilen war Lady Adelaide eine ziemlich respekteinflößende Erscheinung.
Die Sonne versank am Horizont, und er rutschte unruhig auf seinem Sitz hin und her. Er wünschte, er wäre so vorausschauend gewesen, ein Sandwich und eine Flasche Wasser mitzunehmen. Aber so hungrig er war, machte er sich doch mehr Gedanken wegen seines alten Autos als wegen seines Magens. Der Motor des Astra klang in letzter Zeit ein wenig rau. Er hoffte, dass er sich bei dem dauernden Leerlaufbetrieb nicht überhitzte.
Als sich der Verkehr endlich wieder in Bewegung setzte, seufzte er erleichtert auf. Wie es aussah, würde die alte Karre es doch schaffen. Und vielleicht würde er sogar rechtzeitig zum Abendessen bei den Talbots eintreffen.
Müßig nippte Nell an ihrem kalten Kaffee. Draußen schwand das letzte Tageslicht, und im Dorf gingen die Lichter an. Aber weder Viv noch Bea ließen sich in der Bar blicken, und auch der Mann mit dem Filzhut kehrte nicht zurück, um seinen Mantel zu holen. Die Gäste kamen und gingen, und Jack war am Ausschank zu beschäftigt, um sich mit ihr zu unterhalten. Widerstrebend beglich Nell bei ihm ihre Rechnung und trat hinaus in die frische Abendluft.
Der Parkplatz lag jetzt in völliger Dunkelheit, und die schneidende Luft roch nach Holzrauch und Äpfeln. Nell fragte sich, ob es in der Nacht sogar leichten Frost geben könnte und ob das Wetter bis zum morgigen Lunch halten würde. Sie nahm sich vor, ganz einfach nach Beck House zu fahren und zu tun, was getan werden musste. Vielleicht wusste Lady Addie etwas über den geheimnisvollen Fremden, auch wenn Nell vermutete, dass sie es eher nicht mit Klatsch und Tratsch hatte.
Aber jetzt wartete erst einmal Bella, Nells Border-Collie-Hündin, auf ihren Abendspaziergang, und die Sterne standen klar und hell am Nachthimmel. Nell atmete zufrieden durch, als sie ihren kleinen Peugeot aufschloss. Insgesamt war es doch ein gutes Leben, für das sie sich entschieden hatte.
Sie fuhr vorsichtig den Parkplatz herunter und auf die alte Steinbruchstraße, die aus dem Dorf hinausführte. Zu ihrem Cottage war es nicht sehr weit, und sie hätte ohne Weiteres zu Fuß gehen können, doch die Straße war schmal und konnte im Dunkeln gefährlich sein. Bei jeder Kurve und Senke leuchteten die Hecken im grellen Scheinwerferlicht auf.
Plötzlich war da eine Gestalt mitten auf der Fahrbahn. Nell stieg auf die Bremse und brachte den Wagen schlitternd zum Stehen. Der Mann mit dem Filzhut ging in der Mitte der Straße vor ihr her. Er drehte sich nicht um, schien den Wagen nicht einmal bemerkt zu haben, und sie sah, dass er leicht schwankte. War er vielleicht doch betrunken? Warum ging er vom Dorf weg, und das ohne seinen Mantel?
Sie ließ die Scheibe herunter und rief: »Hallo, Sie da!« Als er nicht reagierte, stieg sie aus, wobei sie den Motor laufen ließ, und ging auf ihn zu. »Verzeihung, kann ich Sie vielleicht mitnehmen? Es ist gefährlich, im Dunkeln auf diesen schmalen Straßen zu gehen.«
Er ging weiter, und erst als sie ihn einholte und ihm die Hand auf den Arm legte, blickte er sich um und sah sie erschrocken an. Sofort erkannte sie, dass er nicht betrunken war, sondern krank. Sein Gesicht war blass, schweißnass trotz der Kälte, und sein Blick ging ins Leere. Er wankte unter ihrer Berührung.
»Oje«, sagte sie. »Geht es Ihnen nicht gut? Ich glaube, Sie brauchen Hilfe.« Er leistete keinen Widerstand, als sie ihn am Ellbogen fasste und behutsam zum Auto führte. Sie spürte, wie er zitterte. Sollte sie ihn zurück ins Dorf fahren? Aber was dann? Nicht nur, dass sie nicht wusste, wo er wohnte – es gab dort auch keinen Arzt.
Der Mann taumelte und stieß gegen sie, dabei murmelte er etwas, das sie nicht verstand. Nell traf eine Entscheidung. Sie musste ihn nach Cheltenham bringen. Hier in der Nähe gab es nichts. »Okay«, sagte sie mit fester Stimme. »Ich kann sehen, dass Sie krank sind. Jetzt steigen Sie erst mal ein.« Sie legte ihm den Arm um die Schultern, um ihn zu stützen. »Ich bringe Sie auf dem schnellsten Weg ins Krankenhaus.«
Kincaids Vorhersagen erwiesen sich als allzu optimistisch. Es ging wieder langsamer voran, und als er endlich von der Umgehungsstraße um Oxford abfuhr, war die Dunkelheit vollends hereingebrochen. Der Wagen war zu alt, um mit einem Navi ausgestattet zu sein, und da Kincaid keine Lust hatte, extra anzuhalten, um sein Handy zu konsultieren, verließ er sich auf seine Erinnerung an die Karte, die er zuvor studiert hatte.
Nachdem er Burford hinter sich gelassen hatte, stieg das Gelände an. Das mussten die Cotswold Hills sein, soweit er das im Dunkeln beurteilen konnte. Dann konnte es nicht mehr weit sein – allerdings musste er lachen, wenn er daran dachte, dass die Talbots ihren Landsitz als ein »Wochenendhaus« bezeichneten. Vielleicht kannten sie irgendwelche Schleichwege, mit denen man die Staus auf der Autobahn umgehen konnte, oder sie nahmen den Zug und ließen sich am nächstgelegenen Bahnhof von ihrem Butler abholen. Oder vielleicht nahmen sie einfach den Hubschrauber, dachte er grinsend.
Ein Wegweiser tauchte im Scheinwerferlicht auf. Es war die Abzweigung nach Bourton-on-the-Water, der Kleinstadt, die dem Dorf der Talbots am nächsten lag. Fast geschafft, dachte er. Er fragte sich gerade, ob er irgendwo anhalten sollte, um auf seinem Smartphone die Karte zu konsultieren, als zur Linken plötzlich Scheinwerfer aus dem Dunkel auftauchten und ihn blendeten.
Bevor er eine Hand vor die Augen heben oder auf die Bremse treten konnte, spürte er einen heftigen Aufprall, und dann wurde alles schwarz.
2
Als Erstes waren die Geräusche wieder da. Allmählich registrierte Kincaid ein Knirschen und Ächzen wie von protestierendem Metall und dann eine Art rhythmisches Ticken.
Der Geruch kam als Nächstes. Brennender Gummi. Heißes Metall. Benzin.
Er riss die Augen auf. Im ersten Moment schien die Dunkelheit undurchdringlich. Als er dann die ersten Umrisse ausmachte, ergab nichts, was er sah, irgendeinen Sinn. Und als er sich zu bewegen versuchte, drehte sich alles um ihn, und eine Woge der Übelkeit überkam ihn.
Etwas Warmes rann ihm ins Auge. Er blinzelte und führte die Hand an sein Gesicht, um es zu betasten – nach unten, nicht nach oben.
Als ob jemand einen Schalter umgelegt hätte, war seine Orientierung schlagartig wieder da. Er stand kopf. Was zum Teufel war passiert?
Diesmal bewegte er sich vorsichtiger. Schmerzen in der Schulter, Stiche in den Rippen. Der Gurt. Er hing kopfüber im Sicherheitsgurt.
Eine Erinnerung blitzte auf. Grelle Lichter zu seiner Linken.
Scheiße. Jemand musste ihm reingefahren sein.
Schön ruhig bleiben, mahnte er sich, um die aufsteigende Panik zu unterdrücken. Erst mal die Lage erkunden.
Behutsam drehte er den Kopf nach links und versuchte den Blick zu fokussieren. Im Dämmerlicht konnte er einen Haufen Metall und Glas ausmachen, wo der Sitz hätte sein sollen. Die Beifahrertür.
»Scheiße.« Diesmal schaffte er es, das Wort zu flüstern. Er befühlte die Überreste seines zusammengefallenen Airbags, der ihm vermutlich das Leben gerettet hatte. Irgendwo hinter ihm flammte ein Lichtstrahl auf, und er hörte eine Autotür zuschlagen. Eine Stimme rief etwas.
Der Benzingeruch wurde stärker. Sein Herz hämmerte. Verdammt, der Motor. Er griff nach oben, tastete nach dem Zündschlüssel und drehte ihn um. Er musste raus aus dem Wrack.
Zentimeterweise schob er die rechte Hand nach oben, suchte nach dem Türgriff. Da. Als er daran zog, war ein befriedigendes Klacken zu hören. Gut. Sie klemmte nicht. Er schob die Tür ein Stück weit auf und atmete erleichtert auf, als er merkte, dass sie sich frei bewegen ließ. Noch zwei Handbreit, dann blieb sie stecken – offenbar war sie an einer leichten Bodenerhebung hängen geblieben. Egal, es reichte.
Er holte tief Luft, verzog das Gesicht, als der Schmerz seinen Brustkorb durchzuckte, und stützte sich mit der rechten Hand am Dach ab, während er mit der linken den Gurt löste. Dann schob er die Schultern durch die offene Tür und ließ sich abrollen, bis er ganz draußen war.
Keuchend vor Anstrengung stemmte er sich an der Tür hoch, bis er aufrecht vor der Front seines Wagens stand. Die Lichtkegel der Scheinwerfer strahlten in die undurchdringliche Schwärze und nahmen ihm die Orientierung. Ganz langsam, auf die Tür gestützt und gegen den Schwindel ankämpfend, drehte er sich um und musste blinzeln, als ihn abermals Scheinwerfer blendeten. Er brauchte eine Weile, um zu begreifen, dass er die Lichter von zwei Autos sah. Das erste steckte mit der Schnauze in der Hecke, die den Grünstreifen säumte. Als er die Augen zusammenkniff, um sich vor dem blendenden Licht zu schützen, konnte er erkennen, dass die Frontpartie des Wagens zerknautscht war wie bei einem kaputten Kinderspielzeug.
Hinter dem Auto stand ein zweites in einem leichten Winkel zur Straße. Seine Scheinwerfer strahlten den Unfallwagen an – das Auto, das mit seinem kollidiert war, wie ihm mit einem Schock bewusst wurde. Er klammerte sich noch fester an die Tür, als eine Gestalt sich in Bewegung setzte und für einen Moment das Scheinwerferlicht verdunkelte.
»Sir, sind Sie verletzt?« Es war die Frauenstimme, die er gehört hatte, bevor er aus dem Wrack geklettert war.
»Ich glaube nicht«, brachte er hervor, dann versagte seine Stimme. Er räusperte sich und setzte erneut an. »Nein, mir fehlt nichts.«
»Ist sonst noch jemand im Wagen?«
»Nein.« Gott sei Dank, dachte er.
»Okay, gut. Warten Sie, ich hole Hilfe.« Ihre Stimme klang ruhig und fest, dennoch hörte er die Anspannung hinter den Worten.
Aus dem anderen Auto war niemand ausgestiegen.
Er fuhr mit den Fingern an der Unterseite des Astra entlang, während er sich zum Heck vorarbeitete und dann mit tastenden Schritten über den unebenen Boden auf den anderen Wagen zuging. Die Frau, die auf der Fahrerseite des Wracks in die Hocke gegangen war, richtete sich auf.
»He«, rief sie. »Sie müssen bleiben, wo Sie sind.«
»Ich kann helfen.«
Als er näher kam, sah er, dass sie eine Strickjacke trug und darunter dem Anschein nach Krankenhauskleidung.
»Ich bin Polizeibeamter«, sagte er. »Ist jemand verletzt? Ich glaube, dieses Auto hat mich gerammt.«
Er blinzelte, als sie ihm mit einer Taschenlampe ins Gesicht leuchtete.
»Sie bluten.«
»Das ist nur eine oberflächliche Schnittwunde. Mir fehlt nichts.« Er versuchte, nicht zusammenzuzucken, als der Schmerz durch seine Rippen schoss.
Sie blickte sich zu dem Wagen um, der in der Hecke steckte, und schien zu zögern. »Also gut. Ich muss ein Stück die Straße raufgehen, um besseren Empfang zu haben. Können Sie so lange einfach mit der Dame hier reden?«
Kincaid nickte, und da ihm bewusst wurde, dass sie die Geste wahrscheinlich nicht sehen konnte, sagte er: »Kein Problem. Ich mach das schon.«
Nach einer kurzen Pause drehte die Frau sich um und ging in Richtung Straße. »In Ordnung«, rief sie über die Schulter zurück. »Sie wissen, was zu tun ist.«
Während er die letzten Schritte bis zur Fahrertür ging, wurde ihm bewusst, dass vom Motor des Wagens kein Geräusch kam. Hatte die Ersthelferin hineingegriffen und ihn abgestellt? Vorsichtig ließ Kincaid sich in die Hocke sinken und zuckte zusammen, als er einen jähen Schmerz im Knie verspürte. Er hielt sich mit einer Hand am Wagen fest und spähte durch das Fahrerfenster.
Mit einem Blick erfasste er, dass der Airbag ausgelöst hatte und zusammengefallen war. Und dass die Kollision mit seinem Wagen den Motorblock der kleinen Limousine in den Fahrgastraum geschoben hatte.
Die Fahrerin war eingeklemmt. Und sie war bei Bewusstsein.
Sie wandte ihm den Kopf zu und flüsterte etwas, das er nicht verstand.
»Hilfe ist unterwegs«, sagte er. »Es wird alles gut.«
Jetzt erst sah er, dass jemand auf dem Beifahrersitz saß. Ein Mann. Und er rührte sich nicht.
»Ich …« Ihre Stimme war jetzt nur noch ein Hauch. Sie hob die Hand, streckte sie ihm entgegen, und er ergriff sie behutsam. Ihre Finger fühlten sich klein an in den seinen und warm. Er glaubte zu sehen, dass ihr kurzes Haar hell war, aber mehr konnte er in dem schwachen Licht nicht erkennen. Sie bewegte sich, als ob sie gegen etwas ankämpfen wollte.
»Schhh.« Er drückte ihre Hand. »Halten Sie still. Haben Sie Schmerzen?«
Sie blinzelte, schien verwirrt. »Nein. Ich – ich weiß nicht. Bleiben Sie … bei mir?«
»Aber natürlich. Wir holen Sie ganz bald da raus, keine Sorge.« Sie würden die Feuerwehr brauchen, dachte er, und wahrscheinlich die Rettungsschere. Wie lange würde es dauern, bis sie eintrafen? Der metallische Geruch von Blut stieg ihm in die Nase. »Halten Sie noch ein bisschen durch«, sagte er mit aller Zuversicht, die er aufbringen konnte.
»Ich … « Ihre Finger regten sich in seinen. »Ich wollte nicht …« Ihre Stimme versagte, und trotz der schlechten Lichtverhältnisse glaubte er zu sehen, dass ihre Haut alle Farbe verloren hatte.
»Es ist schon in Ordnung«, versicherte er ihr. »Es war ein Unfall.« In der Ferne hörte er Sirenen.
»Nein.« Die Frau drehte den Kopf, bis sie ihm in die Augen sehen konnte. »Ich habe nicht … Er war …« Ihre Finger verkrampften sich in seinen. »Bitte«, flüsterte sie. »Sagen Sie ihnen, dass er …« Und dann erlosch das Licht in ihren Augen.
Viv kniete auf dem Küchenboden und klaubte mit zitternden Fingern die glitschigen Kartoffelstäbchen auf. Sie hatte den Topf mit handgeschnittenen Pommes fallen lassen, als sie ihn zur Fritteuse tragen wollte.
»Warte, ich helf dir«, sagte Angelica, indem sie sich neben sie hockte und nach dem Topf griff.
»Nein.« Viv schüttelte den Kopf. »Kannst du noch mal Pommes machen? Wir müssen sie jetzt aufsetzen, sonst geraten wir wirklich in Rückstand.« Die handgeschnittenen Pommes frites waren eine der Spezialitäten des Pubs, und die Bestellungen von Fish and Chips und Steak mit Pommes würden sich häufen. Es war Angelica, die Postenköchin, die sie normalerweise vor Beginn des Küchenbetriebs vorbereitete.
»Okay. Aber willst du nicht mal eine Zigarettenpause machen?« Es war ein Witz – kein besonders guter. Viv ließ grundsätzlich keine Raucher für sich arbeiten, weder in der Küche noch im Service, und auch das Rauchen im Hof während des Essensbetriebs war streng verboten.
Viv klaubte den letzten Kartoffelschnitz auf und stand auf, um alles in den Mülleimer zu kippen.
Ibby, ihr Sous-Chef, warf ihr einen kalten Blick zu, als er sich mit zwei Vorspeisentellern Graved Lachs mit Meerrettichcreme an ihr vorbeischob. »Wir sind jetzt schon im Rückstand. Wie konntest du dieses Arschloch in die Küche lassen?«
»Ich habe ihn nicht …« Viv brach ab und presste die Lippen aufeinander. Es war sinnlos, sich auf einen Streit mit Ibby einzulassen – Ibby, dessen ständiges Gefühl, benachteiligt zu werden, ihn daran hinderte, der Spitzenkoch zu werden, zu dem er das Zeug hatte. »Mach einfach deinen Job«, sagte sie.
Sein gemurmeltes »Ja, Boss«, während er die Teller auf die Ausgabe stellte, klang trotzig, und sie dachte, dass sie ihn am Ende vielleicht wirklich feuern würde. Aber er hatte recht. Was hatte sie sich dabei gedacht?
Sie hatte gerade durchgeatmet und sich wieder den Pies zugewandt, die im Ofen aufgingen, als Bea von der Bar hereinkam, die Wangen gerötet.
»Was zum Teufel war hier los?«, zischte sie. »Sarah sagt, ihr hättet euch gestritten, und zwar so, dass das halbe Restaurant es gehört hat. Und die Bestellungen stauen sich schon.«
Viv fing Beas Blick auf. »Wo ist er? Ist er noch da draußen?«
»Nein. Aber er hat seinen Mantel dagelassen.«
Panik erfasste Viv. »Grace. Wo ist Grace?«
Bea runzelte die Stirn. »Sie ist im Cottage und sieht fern. Ich habe eben nach ihr geschaut.«
Vivs Hände zitterten vor Erleichterung. »Okay, gut. Ich wollte nicht …« Sie brach ab, als Jack von der Bar hereinkam.
Die kleine Küche war plötzlich viel zu heiß und mit zu vielen Menschen angefüllt. »Was treibst du hier eigentlich, Viv?« Jack ließ sein Geschirrtuch schnalzen wie ein Torero, der den Stier reizen will. »Wer zum Teufel war dieser Typ mit dem affigen Hut, der hier den ganzen Tag rumgehangen hat?«
Alle starrten sie an, alle warteten aus unterschiedlichen Gründen gespannt auf ihre Antwort.
Endlich sagte Viv zu Jack: »Fergus. Fergus O’Reilly. Der Koch. Er war mal mein Chef, aber das ist lange her.«
Kincaid hatte die Fahrerin geschüttelt, zunächst behutsam, dann etwas kräftiger. Als sie keine Reaktion zeigte, hatte er die Frau mit dem Handy gerufen.
»Ich glaube, sie atmet nicht mehr«, sagte er, als sie bei ihm ankam.
Sie schob ihn entschlossen beiseite. Nachdem sie der Fahrerin am Hals den Puls gefühlt hatte, schüttelte sie den Kopf. »Verdammt. Ich komme nicht an sie ran, und ich habe keine Ausrüstung dabei.« Die Sirenen wurden lauter. »Wir werden auf den Krankenwagen warten müssen.«
»Aber sie – sie hat gerade noch mit mir geredet. Und was ist mit ihm?« Er deutete auf den Beifahrer.
Die Frau schüttelte wieder den Kopf. »Er war nicht angeschnallt. Ich vermute, er ist mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe geflogen.«
Kincaid sah wieder die Fahrerin an, und er wusste, dass sie zu still war, viel zu still. Wieder überkam ihn der Schwindel.
Er musste gewankt haben, denn unversehens saß er auf der Erde, und die Frau stützte ihn mit einer Hand, während sie ihm mit einer Taschenlampe in die Augen leuchtete.
»Sie haben wahrscheinlich eine Gehirnerschütterung«, sagte sie. »Die Beule da ist so groß wie ein Gänseei. Nicht bewegen.«
Das Heulen der Sirene war jetzt ohrenbetäubend. Scheinwerferlicht erhellte das Gesicht der Frau im Profil. Sie war ungefähr in Gemmas Alter, das dunkle Haar zum Pferdeschwanz gebunden. Dann brach das Sirenengeheul ab. Türen knallten, Stimmen riefen etwas. Die Frau verließ ihn. Kincaid blieb, wo er war, starr und reglos inmitten der hektischen Aktivität.
Ein Stein, dachte er benommen. Er könnte ebenso gut ein Stein in einem Bach sein. Das Wasser war so kalt. Nicht das Wasser, korrigierte er sich, sondern die Erde. Die Kälte drang durch den Stoff seiner Hose. Mit Einbruch der Dunkelheit war es merklich abgekühlt. Warum, fragte er sich, hatte die Frau in dem Auto das Fenster heruntergelassen? Er zitterte jetzt, seine Zähne begannen zu klappern.
Die Frau kam zu ihm zurück und warf ihm eine grobe Decke über die Schultern. »Können Sie aufstehen, wenn ich Ihnen helfe?«
Kincaid wollte nicken, besann sich aber rasch eines Besseren. Sie gab ihm Halt, als er sich hochstemmte, und stützte ihn dann, als sie über die unebene Bankette zu ihrem Wagen gingen. Sie öffnete die Tür und half ihm auf den Sitz, dann inspizierte sie seinen Kopf im Schein der Innenbeleuchtung. »Sie haben da oben eine ziemliche Platzwunde und noch eine an der Wange, aber die Blutung hat nachgelassen. Was tut Ihnen sonst noch weh?«
»Die Rippen«, brachte er mit schmerzverzerrtem Gesicht hervor. »Und meine Hand«, fügte er erstaunt hinzu und sah auf seine rechte Hand hinunter. Er sah, dass sie blau angelaufen war und anzuschwellen begann. »Warum hab ich das nicht gespürt?«
»Der Schock.« Sie griff in den Fußraum und nahm etwas aus einer Tasche. »Ich habe immer eine Thermosflasche im Auto für die Heimfahrt.« Sie schraubte den Becher ab und goss ein. »Da. Trinken Sie aus.«
Kincaid nahm den Becher mit der linken Hand. Seine Finger zitterten. Es war Kaffee, heiß und mit viel Milch. Ein paar Schlucke, und schon hörte das Zähneklappern auf. Er konnte sehen, wie die Sanitäter um den Unglückswagen herumgingen. Ihre gelben Warnwesten leuchteten im Schein der Signalfackeln, die sie aufgestellt hatten.
»Die Frau«, sagte er. »Die Fahrerin …«
Seine Helferin schüttelte den Kopf. »Es tut mir leid. Sie konnten nichts machen. Es wird schwierig genug sein, die beiden da rauszukriegen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das passiert sein soll. Sie schien mir immer so ein vorsichtiger Mensch zu sein.«
»Sie haben sie gekannt?«
»Oh, nicht besonders gut. Aber ich habe sie erkannt. Nell Greene. Sie hat in der Verwaltung des Krankenhauses gearbeitet, das wir in der Regel anfahren. In Cheltenham. Eine sympathische Frau, aber die Umstände ihrer Kündigung waren ein wenig obskur.«
Nell, dachte Kincaid. Er wünschte, er hätte ihren Namen gewusst. Er hörte immer noch ihre flehentliche Stimme.
Eine der gelben Jacken näherte sich. Die Helferin, die neben der offenen Autotür gekauert hatte, richtete sich auf und redete mit ihm. Fetzen ihres Gesprächs drangen an Kincaids Ohr.
»… tot«, sagte der Mann.
Seine Kollegin sah ihn verdutzt an. »Wovon redest du? Wir wissen, dass sie beide tot sind.«
»Nein. Ich meine den Mann auf dem Beifahrersitz. Diese Kopfwunde hat kaum geblutet. Ich könnte schwören, dass er schon tot war, als es gekracht hat.«
Er erfuhr, dass die Frau in der Krankenhauskleidung Tracey hieß, Tracey Woodman, und dass sie auf dem Heimweg von einer Rettungsdienstschicht in Cheltenham war.
»Ich war weniger als einen Kilometer hinter ihnen«, erklärte sie ihm. »Ich habe den Knall gehört.« Ihre Schultern zuckten, als ein Schauer sie überlief. »Es gibt kein Geräusch, das dem gleicht. Ich habe das Schlimmste befürchtet.« Sie sah auf ihn herab. »Sie hatten großes Glück.«
Einer der Sanitäter rief sie, und nachdem sie Kincaid ermahnt hatte, sich nicht von der Stelle zu rühren, ging sie davon. Die Polizei traf kurz darauf ein, zuerst ein Streifenwagen, dann ein zweiter. Die Feuerwehr kam nur wenig später. Kincaid sah zu, wie die Polizisten und die Feuerwehrleute sich mit den Sanitätern austauschten, weitere Signalfackeln aufstellten, um den Verkehr umzuleiten, und sich dann an die Absperrung des Unfallorts machten. Sonst gewohnt, das Kommando zu führen, kam er sich merkwürdig hilflos vor. Erst als ein Beamter herantrat, um mit ihm zu sprechen, wurde ihm bewusst, dass er nicht nur kein Auto mehr hatte, sondern auch nicht telefonieren konnte. Sein Handy hatte auf dem Beifahrersitz gelegen.
»Mein Telefon«, sagte er. »Hat jemand es gefunden?«
Der Beamte, auf dessen Namensschild »Hawkins« stand, schüttelte den Kopf. »Da kann ich Ihnen leider nicht helfen. Sie müssen warten, bis die Unfallermittler mit ihrer Arbeit fertig sind. Und das wird noch eine Weile dauern, auch wenn die Kollegen ganz bestimmt ihr Bestes tun.« Hawkins nahm Kincaids Personalien auf und zog angesichts seines Dienstgrads die Augenbrauen hoch. Wenigstens konnte Kincaid sich ausweisen – sein Führerschein und der Dienstausweis steckten noch in seiner Jackentasche. Er zuckte zusammen, als er die Papiere hervorzog. Seine Hand pochte, und jeder Atemzug ging mit einem stechenden Schmerz in den Rippen einher.
»Und was tun Sie hier? – Sir«, fügte Hawkins hastig hinzu.
»Ich treffe mich mit meiner Frau. Wir sind übers Wochenende bei Freunden zu Besuch. In Beck House.«
Auch diese Information wurde mit einem Hochziehen der Brauen quittiert. »Nur damit wir Sie kontaktieren können, Sir. Und wir müssen eine Blutprobe nehmen, ehe Sie den Unfallort verlassen. Morgen müssen Sie dann aufs Revier in Cheltenham kommen, um Ihre Aussage zu Protokoll zu geben.«
Er überlegte gerade, ob er sich das Handy des Beamten ausleihen könnte, um Gemma anzurufen, da kam Tracey Woodman zurück. »Wenn die mit Ihnen fertig sind, können Sie gerne bei mir mitfahren.«
Kincaid nahm das Angebot dankbar an.
Woodman betrachtete ihn stirnrunzelnd. »Diese Platzwunde an der Stirn müssen Sie nähen lassen.«
»Aber nicht mehr heute.« Plötzlich war er sehr erschöpft.
»Dann lassen Sie mich die Wunde wenigstens ein bisschen reinigen, nachdem die Kollegen Sie angezapft haben.« Sie führte ihn zum Krankenwagen und ließ ihn auf der Heckklappe Platz nehmen. Einer der Sanitäter nahm eine Blutprobe und beschriftete sie. Dann betupfte Woodman behutsam die Wunde an seinem Haaransatz mit Desinfektionsmittel und verband sie provisorisch. »So, das hätten wir. Sie werden ziemlich verwegen aussehen, auch nachdem Sie genäht sind. Wie ein richtiger Pirat.«
»Meine Kinder werden beeindruckt sein.« Er brachte ein Lächeln zustande. »Und meine Frau auch. Aber erst, nachdem sie mir den Kopf abgerissen hat, weil sie sich wegen mir solche Sorgen machen musste. Ich bin seit Stunden überfällig, und bei dem Unfall habe ich mein Handy verloren.«
»Möchten Sie sie mit meinem anrufen?«
Kincaid überlegte, dann schüttelte er vorsichtig den Kopf. »Es ist nicht mehr weit, glaube ich. Besser, ich sage es ihr persönlich. Die Adresse ist Beck House, bei Upper Slaughter.«
Woodman pfiff anerkennend. »Das Talbot-Haus? Sie verkehren ja in feinen Kreisen. Übrigens«, fügte sie hinzu, als sie zu ihrem Auto zurückgingen, »ich glaube, ich habe im Krankenhaus davon reden hören, dass Nell Greene sich nach Upper oder Lower Slaughter zurückgezogen habe. Sie soll da ein Cottage geerbt haben oder so. So viel Glück muss man haben.« Ihr Blick ging zu dem Blechhaufen, der einmal Nell Greens kleines Auto gewesen war, und sie zuckte mit den Achseln. »Oder vielleicht auch nicht.«
3
Die Talbots waren herausgekommen, um Gemma und Melody zu begrüßen, kaum dass Melodys Wagen auf der gekiesten Auffahrt ganz zum Stehen gekommen war. »Meine Mum hat einen eingebauten Radar – sie muss gespürt haben, dass wir kommen«, flüsterte Melody, als Gemma ausstieg und Charlotte aus ihrem Kindersitz hob. Die Kleine klammerte sich an sie, während sie das Haus und die fremden Menschen mit großen Augen musterte.
Lady Adelaide hatte ihrer Tochter ein Küsschen auf die Wange gegeben und war dann mit ausgestreckten Händen auf Gemma zugegangen. »Ich freue mich so, Sie endlich kennenzulernen. Und du musst Charlotte sein«, sagte sie und bückte sich, um dem Kind in die Augen sehen zu können, als Gemma Charlotte absetzte. »Willkommen in Beck House, meine Liebe. Wir werden ganz viel Spaß haben. Sollen wir dir das Haus zeigen?«
Charlotte nickte, immer noch schüchtern.
»Vielen Dank für die Einladung, Lady Adelaide«, begann Gemma, doch Melodys Mutter schüttelte bereits den Kopf.
»Sagen Sie Addie zu mir. Das tun alle. Können Sie sich vorstellen, mit einem Namen wie Adelaide geschlagen zu sein? Und eine Lady bin ich nur, wenn ich nicht zu Hause bin.« Ihr Lächeln war ansteckend, und Gemma entspannte sich. Melody hatte ihr immer den Eindruck vermittelt, dass ihre Mutter ziemlich steif sei. Sie hatte eine prüde, überkorrekte und vielleicht gar matronenhafte Lady erwartet. Jetzt sah sie Melody an und dachte, dass sie es hätte ahnen können. Addie Talbot war klein, dunkelhaarig und sogar noch zierlicher als ihre Tochter. Und sie strahlte eine mühelose Eleganz aus, die Gemma an ihrer eigenen Wahl einer Alltagshose und eines grob gestrickten Pullovers zweifeln und sich fragen ließ, wie dringend ihre Haare eine Bürste nötig hatten.
Um ihr Unbehagen zu kaschieren, bewunderte sie die Kaskaden von rosa Rosen, die die Haustür umrahmten. »Oh, die sind ja hinreißend. Was ist das für eine Sorte?«
»St. Swithun. Eine Kletterrose von David Austin. Ivan hat sie ausgesucht, weil ihm das scheußliche Wetter von Newcastle fehlt«, fügte Addie hinzu, während sie sich bei ihrem Mann unterhakte.
»Regnet’s am St.-Swithuns-Tag, es vierzig Tag so bleiben mag«, sagte Ivan augenzwinkernd. »Stimmt aber so gut wie nie.«
»Kommen Sie doch rein«, forderte Addie sie auf. »Ivan kann Ihre Sachen bringen.« Sie nahm Charlotte bei der Hand und flüsterte ihr etwas ins Ohr, das sie zum Kichern brachte.
Aus dem Haus drang aufgeregtes Gebell von zwei Hunden – ein hohes, schrilles Kläffen und ein tieferes Grollen. »Hundis«, rief Charlotte begeistert und wurde gleich ganz wibbelig.
»Wir haben die Hunde ins Arbeitszimmer gesperrt«, erklärte Addie und deutete mit einem Nicken auf ein Fenster an der Vorderfront des Hauses. »Wir wussten ja nicht, ob Sie vielleicht ein Problem mit ihnen haben.«
»Oh, wir haben selber zwei …«, setzte Gemma an, als ein riesiger zotteliger Kopf im Fenster auftauchte und ein lautes »Wuff« die Scheibe erzittern ließ.
Gemma und Charlotte fuhren zusammen, während die Talbots nur grinsten. »Das ist MacTavish, Mums Hund«, sagte Melody. »Er ist so groß wie ein Pferd. Aber keine Sorge, er ist ein ganz Lieber.«
»MacTavish?«
»Er ist ein Scottish Deerhound«, erklärte Addie. »Wir dachten, er verdient einen angemessen nordbritischen Namen.«
Ivan hielt ihnen die Tür auf, und Gemma stockte der Atem, als sie das Haus betrat. Durch den überdachten Vorbau gelangte man in eine Halle mit dunklen Deckenbalken, die sich über die ganze Tiefe des Hauses erstreckte. Die Sonne, die durch die Westfenster schien, malte goldene Rechtecke auf die cremefarbenen Wände, und durch Fenster zu beiden Seiten einer Treppe an der Rückfront erblickte Gemma einen Garten und dahinter sanfte grüne Hügel. In einem großen offenen Kamin an der einen Seitenwand brannte bereits ein munteres Feuer.
»Es ist wunderschön«, murmelte Gemma. »Und so ungewöhnlich.«
»Mein Urgroßvater hat es 1905 gebaut«, erklärte Addie. »Der Architekt war ein Schüler von Lutyens und ein glühender Anhänger des Arts and Crafts Movement. Funktionalität war ihnen ebenso wichtig wie Komfort.«
»Ich führ euch gleich rum«, warf Melody ein und deutete mit einem Nicken auf das Arbeitszimmer, wo das Bellen inzwischen von hektischem Winseln durchsetzt war. »Aber alles der Reihe nach. Vielleicht nimmst du Charlotte lieber hoch, damit Mac sie nicht umrennt.«
Ivan öffnete die Tür des Arbeitszimmers, und die Hunde kamen herausgeschossen. Gemma sah, dass das helle Kläffen von einem Jack Russell kam, der aufgeregt an Melodys Beinen hochsprang. »Das ist Polly«, stellte Melody vor. »Dads Liebling.«
Ivan schüttelte lachend den Kopf. »Mit Eifersucht erreichst du gar nichts, Schatz.«
Der Deerhound, ein riesenhaftes graues Viech mit einem so großen Kopf, dass er geradezu prähistorisch wirkte, kam auf sie zugetrottet. Charlotte vergrub ihr Gesicht in Gemmas Schulter, und selbst Gemma spannte sich ein wenig an. Aber der Hund war genauso sanft, wie Melody es versprochen hatte, und als er näher kam, um an Gemmas Fingern zu schnuppern und zu lecken, streckte auch Charlotte die Hand aus und kicherte, als die feuchte Zunge sie kitzelte.
Als Gemma neben dem harzigen Geruch des Feuers einen betörenden Rosenduft wahrnahm, blickte sie sich um und entdeckte auf einem Beistelltisch eine Schale voller Rosenblüten. Einige zeigten das Hellrosa der Kletterrose an der Eingangstür, andere wiederum dunklere Pink- und Rottöne. »Sind die alle aus Ihrem Garten?«, fragte sie.
»Die letzte Blüte«, antwortete Addie lächelnd. »Es ist so was wie ein Hobby von mir.«
Melody verdrehte die Augen. »So was wie ein Hobby, ja klar. Man würde nicht darauf kommen, dass Mum am glücklichsten ist, wenn sie eine Pflanzkelle in der Hand hat, nicht wahr? Kommt, ich zeig euch das Haus.«
Es war kleiner, als Gemma vermutet hatte, und wesentlich wohnlicher. Von dem tiefen Mittelmeerblau des Wohnzimmers, das einen Blick in den Garten gewährte, zum Blassrosa des Essbereichs, der zwischen dem Kamin und der Küche eingerichtet war, wirkte alles angenehm eingewohnt. Sir Ivans dunkelrot gestrichenes Arbeitszimmer lag zur Auffahrt hin, ebenso wie ein separates Esszimmer für formelle Anlässe. Hier und da ein wenig Chintz sorgte für den angemessenen ländlichen Charme, Ledermöbel steuerten die maskuline Note bei, und die Ölgemälde von Cotswold-Landschaften leuchteten wie Juwelen an den Wänden. Die Rot-, Rosa- und Blautöne verbanden die Räume zu einem harmonischen Ensemble, und Gemma konnte nicht umhin zu bemerken, dass alle Farben Addie Talbots makellos blassen Teint umso vorteilhafter zur Geltung brachten. Sie stellte auch fest, dass die zwanglose Atmosphäre des Hauses ganz bewusst – und mit viel Geld – inszeniert worden war, mit jenem Geschick, das nur Generationen von Geld und gutem Geschmack ausbilden können.
Mit einem Mal war sie gar nicht mehr so entspannt.
Im ersten Obergeschoss gab es vier Schlafzimmer und noch einmal vier kleinere im zweiten Stock, in den ehemaligen Kinderzimmern und Dienstbotenräumen. Gemma und Duncan hatten ein Zimmer im ersten Stock, gleich neben einem Ankleideraum mit einem Kinderbettchen für Charlotte. Die Fenster gingen auf die Auffahrt und boten einen Blick auf die Hügel, die jetzt allerdings nur noch tiefe Schatten im Dämmerlicht waren.
»Das ist einfach perfekt«, sagte sie zu Melody. Ein Bord mit zerlesenen Büchern nahm die ganze Breite der Wand über dem Bett ein. Die Tapete hatte ein Rosenmuster, die Federbetten waren blütenweiß, aber in einer Ecke des Zimmers standen ein kleiner Schreibtisch, ein etwas zerschlissener Polsterstuhl samt Schemel und eine Leselampe. »War das hier dein Zimmer?«, fragte sie, als ihr der Gedanke kam.
Melody nickte. »Und normalerweise ist es immer noch meins, wenn ich hier übernachte, aber es ist das einzige Zimmer außer dem Elternschlafzimmer mit eigenem Bad und einem Bett für Charlotte. Ich kann genauso gut in einem der Gästezimmer schlafen«, fügte sie hinzu, ehe Gemma protestieren konnte. »Und ich hatte ganz bestimmt nicht vor, dieses hier Doug zu überlassen.«
Aus dem Ankleideraum kam Charlottes Stimme: »Mummy, ist das für mich?«
Als Gemma sich zu ihr umdrehte, sah sie, dass Charlotte nicht das kleine Bett meinte, sondern ein Bilderbuch, das auf dem Kopfkissen gelegen hatte. Und als sie zu ihr trat, entdeckte sie die kleine Karte, die an den Buchdeckel geheftet war. »Willkommen in Beck House, Charlotte«, las sie vor. Das schwere Papier war mit einem großen stilisierten »A« signiert. »Ja, Schätzchen, es ist für dich«, sagte sie. »Ein Geschenk von Lady Addie. Du musst dich bei ihr bedanken.«
»Es ist ein Alfie! Ein neuer!« Charlotte drückte das Buch an ihre Brust. Die Geschichten von Shirley Hughes über einen kleinen Jungen namens Alfie waren Charlottes Lieblingsbücher wie zuvor schon die von Toby.
»Wie aufmerksam von deiner Mutter«, sagte Gemma zu Melody.
»Eines ihrer vielen Talente. Sie wollte, dass sich alle willkommen fühlen.«
Aber Addie konnte nicht gewusst haben, dass dies Charlottes Lieblingsbücher waren, wenn Melody es ihr nicht gesagt hatte. Wie die Mutter, so die Tochter, dachte Gemma, und sie erinnerte sich an die vielen scheinbar beiläufigen Dinge, die Melody für sie und andere Kollegen tat – Dinge, die verrieten, dass sie sich Gedanken darüber machte, womit sie ihnen eine Freude machen könnte.
»Deine Mutter wirkt erstaunlich gelassen angesichts des großen Ereignisses morgen.«
Melody lachte. »Darauf würde ich nichts geben. Ich garantiere dir, dass sie in diesem Moment noch die allerletzten Anrufe erledigt, um sicherzugehen, dass alles reibungslos abläuft.«
»Wofür ist der Erlös aus dem Lunch eigentlich gedacht? Das hast du mir noch gar nicht erzählt.« Gemma hatte diese Woche einen Gerichtstermin gehabt, und so hatten sie und Melody im Auto die meiste Zeit über die Arbeit gesprochen.
»Für die zwei hiesigen Kirchen. Upper und Lower Slaughter gehören zu verschiedenen Pfarrbezirken – die eine zu unterstützen und die andere nicht, wäre daher ein politisches Minenfeld.« Melody runzelte die Stirn. »Aber ich glaube, der wahre Grund ist ein anderer. Mum will, dass unsere hiesige Köchin – du erinnerst dich an das Pub, das ich dir gezeigt habe? – endlich mal zeigt, was in ihr steckt. Sie hat Restaurantkritiker und Food-Blogger eingeladen, und die Medien werden ausgiebig über das Event berichten. Ich hoffe, Viv wird den Erwartungen gerecht.«
»Warum sollte sie das nicht?«
»Es heißt, dass Viv vor zehn oder zwölf Jahren ein aufsteigender Stern in der Londoner Restaurantszene war. Dann war sie urplötzlich verschwunden. Ein paar Jahre später tauchte sie hier auf und kaufte sich in das Lamb ein. Offenbar wollte sie ein ruhiges Leben führen. Ich würde sagen, das ist ihr gelungen.«
»Mummy.« Charlotte hielt ihr Buch in einer Hand und zupfte mit der anderen an Gemmas Pulli. »Lies es mir vor.«
»Lass uns runtergehen, okay?«, sagte Melody zu ihr. »Dad hat uns sicher schon was zu trinken eingeschenkt, und wir wollen die zwei doch nicht warten lassen.«
»Ich kann mir nicht vorstellen, was ihn so lange aufhält«, sagte Gemma ein paar Stunden später. Es kam ihr unhöflich vor, mit dem Handy in der Hand im Wohnzimmer der Talbots zu sitzen, aber sie hatte schon ein halbes Dutzend Mal vergeblich versucht, ihren Mann zu erreichen. Es war jetzt fast neun Uhr, und er hätte kurz nach ihnen eintreffen sollen. Sie hatte sogar überlegt, Kit oder Doug anzurufen, um zu fragen, ob sie von ihm gehört hätten, aber sie wollte sie nicht unnötig beunruhigen.
»Sollen wir vielleicht einen Suchtrupp organisieren?«, fragte Addie. Gemma glaubte, dass sie scherzte, bis Addie hinzufügte: »Ivan kann den Land Rover nehmen und Melody und ich unsere Autos. Sie müssen natürlich bei Ihrer Tochter bleiben.«
»Ach nein, ich bin sicher, dass er bald auftaucht«, protestierte Gemma und schüttelte den Kopf. Kincaid wäre es sicher äußerst unangenehm, wenn sie seinetwegen so schweres Geschütz auffahren würden.
Aber Melody runzelte die Stirn. »Das sieht ihm gar nicht ähnlich.«
»Vielleicht ist sein Akku leer«, mutmaßte Gemma und versuchte sich selbst zu überzeugen. »Es wäre nicht das erste Mal, dass er sein Ladegerät vergessen hat. Oder vielleicht hatte er eine Autopanne. Ich bearbeite ihn schon seit einiger Zeit, dass er die alte Karre ausmustern soll, auch wenn er damit die Gefühle seines Vaters verletzt.« Den Astra hatte Hugh Kincaid ihnen geschenkt, nachdem die Erfordernisse des Familienlebens Duncan gezwungen hatten, seinen MG-Oldtimer aufzugeben. Eine Familie mit drei Kindern und zwei Hunden hätte beim besten Willen nicht in den kleinen Flitzer gepasst.
Gemma legte ihr Handy auf den Beistelltisch und nippte an dem Brandy, den Sir Ivan ihr nach dem Essen regelrecht aufgedrängt hatte. Weil sie nicht ohne Kincaid anfangen wollten, hatten sie mit dem leichten Abendessen, das die Talbots zubereitet hatten, so lange gewartet, bis Charlotte fast zu müde war, um zu essen. In der gemütlichen Essecke in der Küche hatten sie Salate, Pasteten, eine Käseauswahl und Brot serviert.
»Wir fanden es wenig sinnvoll, ein warmes Essen auf den Tisch zu bringen, wenn noch gar nicht alle da sind und die Kleine schon über ihre Schlafenszeit hinaus ist«, hatte Addie gesagt. »Ich habe Daylesford Organic geplündert«, fügte sie mit einem verschwörerischen Lächeln hinzu. Gemma hatte keine Ahnung, wovon sie redete.
»Der edelste Hofladen, den du dir vorstellen kannst«, erklärte Melody. »Betrieben von der Familie, der JCB gehört.« Als Gemma sie immer noch verständnislos ansah, fügte sie hinzu: »Du weißt schon – Traktoren, Raupen und so. Geld wie Heu. Und der Laden ist so vornehm, dass es sogar einen Wellnessbereich gibt.« Als Gemma die Augenbrauen hochzog, versicherte Melody ihr: »Nein, wirklich. Da trifft man die gesamte Prominenz der Region. Sogar die Camerons, wenn man Glück hat.«
Ivan grinste amüsiert. »Oder vielmehr Pech.«