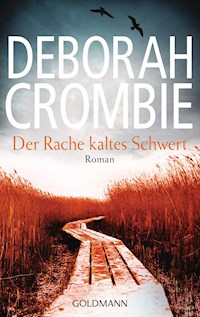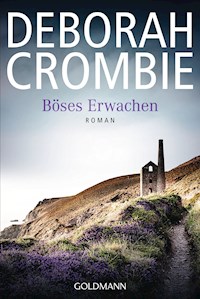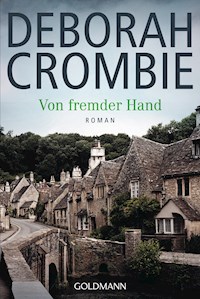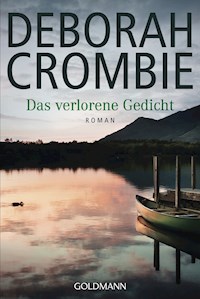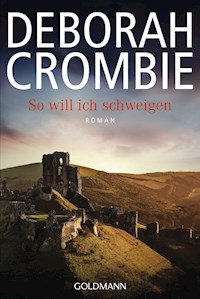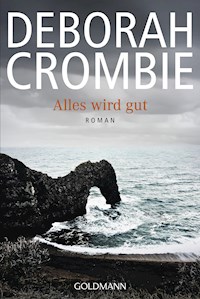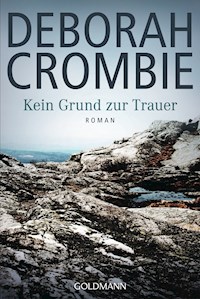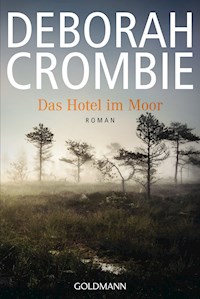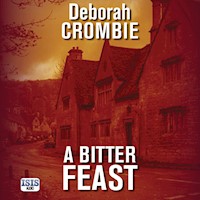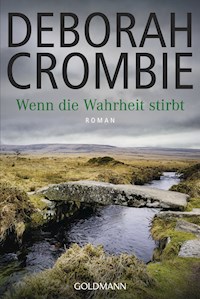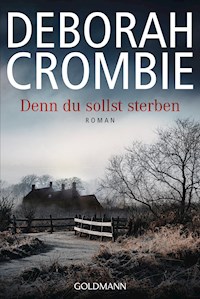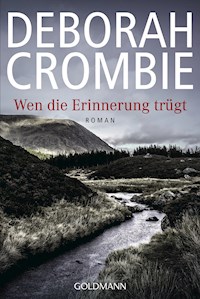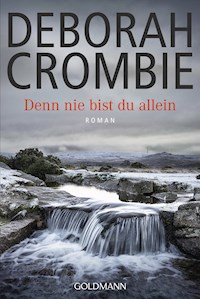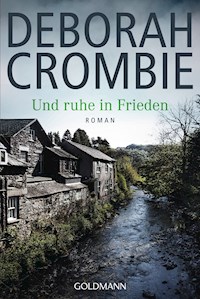
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Kincaid-James-Romane
- Sprache: Deutsch
Inspector Duncan Kincaid und seine Kollegin Sergeant Gemma James, die sich auch privat zugetan sind, stehen vor einem neuen Fall. Als Connor Swann tot aus der Themse gezogen wird, ist ein Unfall zwar nicht ganz auszuschließen, doch eigentlich deutet alles auf Mord hin. In Verdacht gerät zunächst die Ehefrau des Toten, Julia Asherton, Tochter eines bekannten Dirigenten und einer gefeierten Primadonna und das schwarze Schaf der Familie. Das Ableben ihres Gatten nimmt sie äußerst gelassen, wenn nicht gar erfreut zur Kenntnis. Außerdem hat sie kein Alibi. Als Kincaid und James die ehrenwerte Familie etwas genauer unter die Lupe nehmen, stellt sich heraus, dass der tote Schwiegersohn ein notorischer Schürzenjäger und Schuldenmacher war und dass Tod durch Ertrinken bei den Ashertons offensichtlich Tradition hat.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 427
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Buch
Inspector Kincaid und seine Kollegin Sergeant Gemma James, auch privat ein Gespann, stehen vor einem neuen Fall. An einer Kanalschleuse der Themse wird Connor Swann, Schwiegersohn von Sir Gerald Asherton, einem berühmten Dirigenten, und der Sängerin Dame Caroline Stowe, tot aus dem Wasser gezogen. Obwohl ein Unfall nicht ganz auszuschließen ist, deuten die Umstände eher auf Mord. Connors Frau Julia scheint über den Tod ihres Gatten nicht gerade unglücklich zu sein und avanciert schnell zur Hauptverdächtigen, obwohl ein Motiv nicht zu erkennen ist. Als Kincaid und James allerdings tiefer in die Geschichte der Ashertons eindringen, zeigt sich, daß bei dieser angesehenen Familie manches im dunkeln liegt – nicht zuletzt ein früherer Fall von Tod durch Ertrinken …
Autorin
Die Amerikanerin Deborah Crombie hat lange in Schottland und England gelebt. Nach Das Hotel im Moor und Alles wird gut, die von der Kritik mit den Romanen einer Elizabeth George und Martha Grimes verglichen wurden, legt sie hier ihren dritten Krimi mit
Duncan Kincaid und Gemma James vor.
Deborah Crombie
Und ruhe in Frieden
Roman
Ins Deutsche übertragenvon Mechtild Sandberg-Ciletti
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Die Originalausgabe erschien 1995 unter dem Titel »Leave the Grave Green« bei Charles Scribner’s Sons, New York
Copyright © der Originalausgabe 1995 by Deborah Darden Crombie
Published by arrangement with the author
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe 1995 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München.
Covergestaltung: UNO Werbeagentur GmbH
Satz: deutsch-türkischer fotosatz, Berlin
AB · Herstellung: Sebastian Strohmaier
ISBN 978-3-641-10748-2V006
www.goldmann-verlag.de
Für meinen Vater, dessen Kreativität und Lebensfreude mich stets aufs neue inspirieren
Prolog
»Gib acht, daß du nicht ausrutschst!« Mit ängstlich besorgtem Gesicht strich Julia die feinen Strähnen dunklen Haars zurück, die sich aus ihrem Pferdeschwanz gelöst hatten. Die Luft war schwül und schwer, so dicht wie Watte. Feuchtigkeit glänzte auf ihrer Haut, und von den Bäumen tropfte es auf den durchnäßten Boden unter ihren Füßen. »Wir kommen bestimmt zu spät zum Tee, Matty. Und du weißt, was Vater sagt, wenn du nicht rechtzeitig zum Üben mit deinen Hausaufgaben fertig wirst.«
»Ach, hör doch auf, Julia«, entgegnete Matthew, ein Jahr jünger als seine Schwester, blond und stämmig. Er hatte die schmale, dunkle Julia im Lauf des letzten Jahres körperlich überflügelt, und das hatte ihn noch selbstherrlicher gemacht. »Du bist eine richtige alte Glucke. ›Matty, gibt acht …, Matty, paß auf …‹«, äffte er sie spöttisch nach. »Als könnte ich mir noch nicht mal selbst die Nase putzen.« Die Arme in Schulterhöhe ausgebreitet, balancierte er auf einem umgefallenen Baumstamm am Ufer des angeschwollenen Bachs. Seine Schultasche lag achtlos hingeworfen im Schmutz.
Die eigenen Bücher fest an ihre Brust gedrückt, wippte Julia ungeduldig auf den Fußballen. Geschieht ihm ganz recht, wenn Vater ihn ausschimpft. Aber das Gewitter, selbst wenn es heftig war, würde sich rasch verziehen und alles wieder seinen normalen Gang gehen – wobei ›normal‹ bedeutete, daß sich alle benahmen, ›als ginge mit Matthew die Sonne auf und unter‹, wie Plummy zu sagen pflegte, wenn sie besonders verärgert über ihn war.
Mit einer kleinen Grimasse stellte Julia sich vor, was Plummy sagen würde, wenn sie seine schmutzige Schultasche und die verdreckten Stiefel sah. Aber ganz gleich, ihm wurde immer alles verziehen; Matthew nämlich besaß eine Gabe, die ihre Eltern über alles schätzten. Er konnte singen.
Er sang mühelos, leicht wie ein Hauch lösten sich die klaren reinen Soprantöne von seinen Lippen. Und beim Singen verwandelte er sich. Der tolpatschige Zwölfjährige mit den Zahnlücken schien sich zu verklären, wenn er sich voll ernster Anmut auf seinen Gesang konzentrierte. Sie pflegten sich nach dem Tee im Wohnzimmer zu versammeln, wo ihr Vater geduldig mit Matthew die Feinheiten der Bachkantate übte, die er zu Weihnachten mit dem Chor singen sollte, während ihre Mutter laut und häufig unterbrach, um Kritik oder Lob anzubringen. Julia schien es, als gehörten diese drei einer verzauberten kleinen Welt an, zu der ihr aufgrund eines Versehens bei ihrer Geburt oder einer unerklärlichen Laune Gottes der Zutritt auf immer verwehrt bleiben würde.
Die Kinder hatten am Nachmittag ihren Bus verpaßt. Julia hatte in der Hoffnung auf ein Gespräch mit ihrer Zeichenlehrerin zu lange gewartet. Vollbeladen war der Bus an ihnen vorbeigerumpelt und hatte dunkle Schlammspritzer auf ihre Beine geschleudert. Sie mußten zu Fuß nach Hause gehen, und auf dem Weg quer über die Felder wurden ihre Schuhe so schwer vom Lehm, daß sie Mühe hatten, die Füße zu heben, und sie sich fühlten wie Besucher von einem leichteren Planeten. Als sie den Wald erreichten, faßte Matthew Julia bei der Hand und zog sie rutschend und schlitternd durch die Bäume den Hang hinunter zum Bach in der Nähe ihres Hauses.
Fröstelnd blickte Julia auf. Der Tag hatte sich merklich verdunkelt, und sie fürchtete, auch wenn jetzt im November die Tage deutlich kürzer waren, das würde neuen Regen bedeuten. Seit Wochen gab es jeden Tag schwere Regenfälle. Scherze über die vierzig Tage und die vierzig Nächte hatten sich längst totgelaufen; jetzt folgte auf die Blicke zum düsteren Himmel nur noch schweigendes und resigniertes Kopfschütteln. Hier, in den Kreidehügeln nördlich der Themse, sickerte das Wasser unablässig aus dem durchtränkten Boden in die bereits überlasteten Flüsse und Bäche.
Matty hatte seinen Seiltänzerakt auf dem umgestürzten Baumstamm beendet; er hockte jetzt am Bachufer und stocherte mit einem Stock im Wasser herum. Der Wasserlauf, bei normalem Wetter ein trockener Graben, war jetzt bis zu den Uferböschungen gefüllt, das brodelnde Wasser so trübe wie milchiger Tee.
Julia, die immer ärgerlicher wurde, sagte: »Komm jetzt endlich, Matty. Bitte!« Ihr Magen knurrte. »Ich hab Hunger. Und kalt ist mir auch.« Sie drückte ihre Bücher fester an ihre Brust. »Wenn du nicht kommst, geh ich ohne dich.«
»Schau mal, Julia!« Unbeeindruckt von ihrem Drängen, wies er mit dem Stock aufs Wasser. »Da hat sich was im Wasser verfangen, gleich unter der Oberfläche. Eine tote Katze vielleicht?« Er drehte sich nach ihr um und grinste.
»Sei nicht so eklig, Matty.« Sie wußte, daß ihr pingeliger, scharfer Ton ihn in seiner Necklust nur bestärken würde, aber es war ihr inzwischen egal. »Ich geh wirklich ohne dich.« Als sie sich zornig abwandte, spürte sie, wie sich ihr Magen unwillig zusammenzog. »Ehrlich, Matty, ich hab keine Lust –«
Das aufspritzende Wasser klatschte ihr an die Beine, gerade als sie herumwirbelte. »Matty! Sei nicht so –«
Er war in den Bach gefallen, lag mit Armen und Beinen strampelnd rücklings im Wasser. »Das ist vielleicht kalt«, rief er mit verblüfftem Gesicht. Lachend robbte er auf das Ufer zu und schüttelte sich dabei das Wasser aus den Augen.
Julia sah, wie sein Lachen erlosch. Wie seine Augen sich weiteten, sein Mund sich mit einem Ausdruck des Schreckens öffnete.
»Matty –«
Die Strömung erfaßte ihn und riß ihn fort. »Julia, ich kann nicht –« Wasser überschwemmte sein Gesicht und füllte seinen Mund.
Stolpernd rannte sie am Ufer entlang und rief seinen Namen. Es begann zu regnen. Große Tropfen schlugen ihr ins Gesicht und nahmen ihr die Sicht. Sie blieb mit dem Fuß an einem Stein hängen und stürzte. Sie rappelte sich hoch und rannte weiter, den Schmerz an ihrem Schienbein kaum wahrnehmend.
»Matty! Oh, Matty! Bitte!« Die immer selben Worte wurden zur Beschwörung. Durch das schlammige Wasser konnte sie das Blau seiner Schuluniform sehen und den hellen Fleck seines Haars.
An der Stelle, wo der Bach breiter wurde und sich von ihr abwandte, fiel das Gelände jäh ab. Julia schlitterte den Hang hinunter und hielt an. Auf der anderen Seite hing eine alte Eiche über den Bach, ihre starken Wurzeln freigelegt vom Wasser, das das Ufer unterhöhlt hatte. Hier hing Matthew fest, unter den Wurzeln eingeklemmt wie von einer Riesenhand.
»Oh, Matty!« schrie sie, lauter jetzt und voller Angst. Sie watete ins Wasser, und warmes, salziges Blut sickerte in ihren Mund, als sie sich die Unterlippe aufbiß. Die Kälte war ein Schock, betäubte ihre Beine. Sie zwang sich weiterzugehen. Das Wasser wirbelte um ihre Knie, riß an ihrem Rock. Es erreichte ihre Taille, dann ihre Brust. Sie schnappte nach Luft, als die Kälte sie einschloß. Ihre Lunge schien wie gelähmt von der Kälte, unfähig, sich auszudehnen.
Die Strömung riß an ihr, zerrte an ihrem Rock, drohte ihre Füße von den bemoosten Steinen zu stoßen. Die Arme ausgebreitet, um die Balance zu halten, schob sie vorsichtig ihren rechten Fuß vorwärts. Nichts. Sie tastete nach der einen Seite, dann nach der anderen, auf der Suche nach Grund. Noch immer nichts.
Kälte und Anstrengung raubten ihr schnell die Kraft. Sie atmete mit zitternden, keuchenden Stößen, und die Strömung schien fester zuzupacken. Sie blickte bachauf und bachab, sah keinen Weg, zur anderen Seite zu kommen. Aber das hätte sowieso nicht geholfen – von dem steilen Ufer aus hätte sie ihn niemals erreichen können.
Sie begann leise zu jammern. Sie streckte ihre Arme nach Matty aus, aber er war viel zu weit weg, und sie hatte zu große Angst, um der Strömung zu trotzen. Hilfe. Sie mußte Hilfe holen.
Sie spürte, wie das Wasser sie hochhob und vorwärtsriß, als sie sich herumdrehte, aber sie stolperte weiter, stemmte ihre Absätze und Zehen in die Steine, um Halt zu finden. Die Strömung ließ nach, und sie kletterte aus dem Wasser. Von einer Welle der Erschöpfung überschwemmt, blieb sie einen Moment am schlammigen Ufer stehen. Noch einmal sah sie zu Matty hinüber, sah seine Beine, die sich seitwärts in der Strömung drehten. Dann rannte sie los.
Das Haus hob sich aus dem Dunkel der Bäume, seine weißen Kalksteinmauern schimmerten geisterhaft im frühen Zwielicht. Ohne zu überlegen rannte Julia an der Haustür vorbei, um das Haus herum, zur Küche, wo Wärme und Geborgenheit warteten. Keuchend vom steilen Anstieg den Hügel hinauf, rieb sie sich das Gesicht, das von Regen und Tränen naß war. Sie hörte ihren eigenen Atem, das Quietschen ihrer Schuhe bei jedem Schritt und spürte das Kratzen der dicken feuchten Wolle ihres Rocks an ihren Oberschenkeln.
Sie riß die Tür zur Küche auf, stürzte hinein, blieb stehen. Wasser sammelte sich auf den Fliesen zu ihren Füßen. Plummy, die mit einem Holzlöffel in der Hand am Herd stand, das dunkle Haar zerzaust wie immer, wenn sie kochte, fuhr herum. »Julia! Wo seid ihr so lange geblieben? Was wird eure Mutter sagen – ?« Sie brach plötzlich ab. »Julia, Kind, du blutest ja. Ist etwas passiert?« Sie warf den Holzlöffel weg und eilte voller Besorgnis auf Julia zu.
Julia roch Äpfel, Zimt, sah den Mehlfleck auf Plummys Busen, registrierte automatisch, daß Plummy dabei war, einen Apfelkuchen zu backen, Mattys Lieblingskuchen. Sie spürte, wie Plummy mit beiden Händen ihre Schultern umfaßte, sah durch Tränenschleier das gütige und vertraute Gesicht, das sich ihr näherte.
»Julia, was ist passiert? Was ist los? Wo ist Matty?«
Plummys Stimme klang atemlos vor plötzlicher Angst, doch immer noch stand Julia stumm und starr, mit zugeschnürter Kehle, unfähig, ein Wort hervorzubringen.
Behutsam streichelte Plummy ihr Gesicht. »Julia. Was ist mit deiner Lippe? Was ist passiert?«
Sie begann zu schluchzen, so heftig, daß es weh tat. Sie drückte ihre Arme fest auf ihre Brust, um den Schmerz zu lindern. Ein losgelöster Gedanke schoß ihr durch den Kopf – sie konnte sich nicht erinnern, ihre Bücher weggeworfen zu haben. Matty. Wo hatte Matty seine Bücher gelassen?
»Schätzchen, sag es mir. Was ist passiert?«
Sie lag jetzt in Plummys Armen, ihr Gesicht an der weichen Brust. Als wäre plötzlich ein Damm gebrochen, brachen die Worte aus ihr hervor. »Matty! Oh, Plummy, Matty ist in den Bach gefallen. Er ist ertrunken.«
1
Vom Zugfenster aus konnte Duncan Kincaid die Haufen von Gerümpel in den Gärten und auf Gemeindeland sehen. Altes Bauholz, abgebrochene Zweige und Äste, zusammengedrückte Kartons, gelegentlich ein ausrangiertes Möbelstück – alles, was irgendwie zu schleppen war, mußte als Nahrung für die Freudenfeuer des Guy-Fawkes-Tages herhalten. Ohne viel Erfolg wischte er mit seinem Jackenärmel über die schmutzige Fensterscheibe, um sich einen besseren Blick auf ein besonders eindrucksvolles Monument britischen Übermuts zu verschaffen, dann lehnte er sich seufzend wieder zurück. Der feine Nieselregen draußen reduzierte in Verbindung mit den Reinlichkeitsnormen der British Rail die Sichtweite auf wenige hundert Meter.
Der Zug fuhr langsamer, als er sich High Wycombe näherte. Kincaid stand auf und streckte sich, dann nahm er seinen Mantel und seine Reisetasche aus dem Gepäcknetz. Er war direkt vom Yard aus zum Bahnhof gefahren, hatte nur die Reisetasche mitgenommen, die stets gepackt in seinem Büro stand und das Nötigste enthielt – ein sauberes Hemd, Toilettensachen, einen Rasierapparat, was man eben für den Fall eines unerwarteten Rufs brauchte. Dabei wäre ihm praktisch jeder andere Auftrag angenehmer gewesen als gerade dieser, eine mehr oder weniger persönliche Bitte des Assistant Commissioner, einem alten Schulkameraden in einer heiklen Situation unter die Arme zu greifen. Kincaid schnitt eine Grimasse. Dann schon lieber eine unbekannte Leiche im Straßengraben.
Er schwankte, als der Zug ruckend zum Stillstand kam, und beugte sich zum Fenster vor, um auf dem Parkplatz nach dem Empfangskomitee Ausschau zu halten, das man ihm geschickt hatte. Der Streifenwagen, selbst im dichter werdenden Regen deutlich zu erkennen, stand mit eingeschalteten Parklichtern nahe am Bahnsteig.
»Jack Makepeace. Sergeant, sollte ich sagen. Kriminalpolizei Thames Valley.« Makepeace lächelte und zeigte gelblich verfärbte Zähne unter dem borstigen blonden Schnurrbart. »Freut mich, Sie kennenzulernen, Sir.« Er drückte Kincaid mit kräftiger Pranke die Hand, dann nahm er Kincaids Reisetasche und schwang sie in den Kofferraum. »Steigen Sie ein, wir können auf der Fahrt reden.«
Im Auto roch es nach kaltem Zigarettenrauch und feuchter Wolle. Kincaid öffnete sein Fenster einen Spalt und setzte sich ein wenig schräg, so daß er den Sergeant sehen konnte. Ein Haarkranz von derselben Farbe wie der Schnurrbart, Sommersprossen, die Gesicht und glänzende Glatze sprenkelten, eine kräftige, vermutlich von einem Bruch deformierte Nase – insgesamt nicht gerade ein einnehmendes Gesicht, doch die hellblauen Augen wirkten scharfsichtig, und die Stimme war unerwartet sanft für einen Mann seiner Wuchtigkeit.
Makepeace steuerte den Wagen sicher auf den regennassen Straßen nach Südwesten, bis sie die M 40 überquerten und die letzten Reihenhäuser hinter sich ließen. Dann warf er Kincaid einen Blick zu, bereit, einen Teil seiner Aufmerksamkeit von der Straße abzuwenden.
»Also dann, erzählen Sie mal«, sagte Kincaid.
»Was wissen Sie schon?«
»Nicht viel. Mir wäre es am liebsten, Sie fangen ganz von vorn an, wenn Ihnen das nichts ausmacht.«
Makepeace sah ihn an, öffnete den Mund, als wolle er eine Frage stellen, schloß ihn dann wieder. Nach einer kleinen Pause sagte er: »Okay. Als der Schleusenwärter von Hambleden, ein gewisser Perry Smith, heute morgen bei Tagesanbruch das Schleusentor öffnete, um die Kammer für ein Boot zu füllen, das schon in aller Frühe unterwegs war, hat’s plötzlich eine Leiche durch das Tor hereingespült. Er hat natürlich einen Riesenschrecken gekriegt, wie Sie sich vorstellen können. Er hat sofort in Marlow angerufen – die haben einen Streifenwagen und den Notarzt geschickt.« Er hielt inne, als er vor einer Kreuzung herunterschaltete, und konzentrierte sich dann darauf, einen uralten Morris Minor zu überholen, der den Hang hinaufkeuchte. »Sie haben den Toten rausgefischt, und als sich zeigte, daß der arme Kerl nicht mehr zu retten war, haben sie uns angerufen.«
Die Scheibenwischer krochen quietschend über trockenes Glas, und Kincaid sah, daß es nicht mehr regnete. Frisch gepflügte Felder stiegen zu beiden Seiten der schmalen Straße an. Die nackte Erde hatte eine blaßbraune Färbung, von der sich die futtersuchenden Saatkrähen wie schwarze Sprenkel abhoben. Weiter im Westen krönte eine Gruppe von Buchen einen Hügel.
»Wie haben Sie ihn identifiziert?«
»Er hatte seine Brieftasche in der Hüfttasche seiner Hose. Connor Swann, fünfunddreißig Jahre alt, braunes Haar, blaue Augen, Größe ungefähr einsachtzig, Gewicht etwa fünfundsiebzig Kilo. Wohnhaft in Henley, nur ein paar Meilen flußaufwärts.«
»Na, das klingt doch simpel genug. Damit hätten Sie doch bestimmt auch allein fertigwerden können«, sagte Kincaid, ohne sich zu bemühen, seine Verärgerung zu verbergen. Eine reizende Aussicht, seinen Freitagabend damit zu verbringen, in den Chiltern Hills herumzustapfen, anstatt den Arbeitstag mit Gemma zusammen bei einem gemütlichen Glas Bier im Pub in der Wilfred Street zu beschließen. »Er trinkt ein Glas zuviel, macht einen Spaziergang auf dem Schleusentor und fällt rein. Fertig ist der Lack.«
Makepeace schüttelte den Kopf. »Das ist noch nicht die ganze Geschichte, Mr. Kincaid. Er hatte nämlich auf beiden Seiten seines Hales ein paar deutliche Druckstellen.« Er hob einen Moment beide Hände vom Lenkrad, um seine Worte zu veranschaulichen. »Sieht aus, als sei er erwürgt worden, Mr. Kincaid.«
Kincaid zuckte die Achseln. »Tja, das ist wahrscheinlich eine ganz vernünftige Vermutung. Aber ich verstehe immer noch nicht, weshalb da gleich Scotland Yard zugezogen werden muß.«
»Es geht nicht um das Wie, Mr. Kincaid, sondern um das Wer. Der verstorbene Mr. Swann war nämlich der Schwiegersohn von Sir Gerald Asherton, dem Dirigenten, und Dame Caroline Stowe, die, soviel ich weiß, eine ziemlich bekannte Sängerin ist.«
Angesichts Kincaids verständnisloser Miene fügte er hinzu: »Sie sind wohl kein Opernfan, Mr. Kincaid?«
»Sind Sie einer?« fragte Kincaid, der seine Überraschung nicht unterdrücken konnte, obwohl er wußte, daß er nicht vom Äußeren des Mannes auf seine Vorlieben hätte schließen sollen.
»Ich hab ein paar Platten und ich schau mir immer die Opern im Fernsehen an, aber in einer Liveaufführung war ich noch nie.«
Die weiten, sanft ansteigenden Felder waren dicht bewaldeten Hügeln gewichen, und nun, als die Straße aufwärts führte, rückten die Bäume immer näher.
»Wir kommen jetzt in die Chiltern Hills«, bemerkte Makepeace. »Sir Gerald und Dame Caroline wohnen nicht weit von hier, in der Nähe von Fingest.« Er zog den Wagen um eine Haarnadelkurve herum, und dann rollten sie, von einem Bach begleitet, wieder abwärts. »Wir haben Sie übrigens im Pub in Fingest untergebracht, im Chequers. Er hat einen wunderschönen Garten, ganz herrlich bei gutem Wetter. Aber den werden Sie wahrscheinlich kaum genießen können«, fügte er mit einem Blick zum dunklen Himmel hinzu.
Die Bäume schlossen sie jetzt ein. Golden und kupferrot leuchtete es über ihnen, und feuchtes Herbstlaub bedeckte die Straße. Der Spätnachmittagshimmel war noch immer dicht bewölkt, doch im Schein eines vereinzelten Lichtstrahls schienen die Blätter einen geisterhaften, beinahe phosphoreszierenden Glanz anzunehmen.
»Denken Sie, daß Sie mich brauchen werden?« fragte Makepeace. »Ich hatte eigentlich erwartet, daß Sie mit einem Mitarbeiter kommen würden.«
»Gemma James, meine Mitarbeiterin, kommt heute abend. Bis dahin schaffe ich es sicher allein«, antwortete Kincaid.
»Ist schon besser, daß Sie das machen.« Makepeace gab ein Geräusch von sich, das halb wie ein Lachen, halb wie ein Schnauben klang. »Einer meiner Constables hat heute morgen den Fehler gemacht, Dame Caroline ›Lady Asherton‹ zu nennen. Sie hätten hören sollen, wie ihm die Haushälterin die Leviten gelesen hat. Sie hat ihm unmißverständlich erklärt, daß Dame Caroline einen Anspruch auf ihren eigenen Titel hat und erst in zweiter Linie Lady Asherton ist.«
Kincaid lächelte. »Ich werd mich bemühen, nicht ins Fettnäpfchen zu treten. Es gibt also auch eine Haushälterin?«
»Ja, eine Mrs. Plumley. Und dann noch die Witwe, Mrs. Julia Swann.« Nach einem amüsierten Seitenblick auf Kincaid fuhr er fort: »Daraus soll einer klug werden. Anscheinend wohnt Mrs. Swann bei ihren Eltern und hat nicht mit ihrem Mann zusammengelebt.«
Ehe Kincaid eine Frage stellen konnte, hob Makepeace die Hand und sagte: »Schauen Sie jetzt.«
Sie bogen nach links in eine steile, von hohen Böschungen begrenzte Straße ab, so schmal, daß Brombeerbüsche und nacktes Wurzelwerk die Seiten des Wagens streiften. Der Himmel war mit dem nahenden Abend merklich dunkler geworden, und unter den Bäumen war es schattig und düster. »Da rechts ist das Wormsley Tal, auch wenn man es kaum ahnt.« Makepeace machte eine Handbewegung, und durch eine Lücke in den Bäumen sah Kincaid flüchtig dunstige Felder, die wellig zum Tal abfielen. »Kaum zu glauben, daß man nur ungefähr vierzig Meilen von London entfernt ist, nicht wahr, Mr. Kincaid?« fügte er mit einem gewissen Besitzerstolz hinzu.
Auf der Anhöhe der Straße bog Makepeace nach links ab in das Dunkel der Buchenwälder. Die Straße führte sachte abwärts, ihr dicker Laubteppich dämpfte die Geräusche der Räder und des Motors. Einige hundert Meter weiter umrundeten sie eine Biegung, und Kincaid sah das Haus. Die weißen Steinmauern leuchteten im Dunkel der Bäume, und Lichterschein glänzte willkommenheißend in den Fenstern. Mit seinen schmucklosen weißen Mauern und den Bogenfenstern und -türen vermittelte es einen Eindruck schlichter Eleganz, hatte beinahe etwas Klösterliches.
Makepeace brachte den Wagen auf dem weichen Blätterteppich zum Stehen, ließ den Motor jedoch laufen, während er in seiner Tasche kramte. Er reichte Kincaid eine Karte. »Ich fahr gleich wieder. Hier ist die Nummer von unserem örtlichen Revier. Ich hab noch was zu erledigen, aber wenn Sie anrufen, sobald Sie fertig sind, holt jemand Sie ab.«
Kincaid winkte dem davonfahrenden Makepeace nach, dann wandte er sich dem Haus zu und blieb einen Moment stehen, während die Stille des Waldes sich über ihn senkte. Eine gramgebeugte Witwe, verstörte Angehörige, Diskretion und Takt dringend erforderlich … Das waren keine Voraussetzungen für einen gemütlichen Abend. Er straffte seine Schultern und ging auf das Haus zu.
Die Haustür öffnete sich, Licht strömte ihm entgegen.
»Ich bin Caroline Stowe. Ich danke Ihnen für Ihr Kommen.«
Ihre Hand, die die seine ergriff, war klein und weich, und er blickte in das nach oben gerichtete Gesicht der Frau. »Duncan Kincaid, Scotland Yard.« Mit seiner freien Hand zog er seinen Dienstausweis aus der Innentasche seines Jacketts, aber sie beachtete diese Geste gar nicht, sondern hielt noch immer seine Hand.
Er, der bei den Worten ›Dame‹ und ›Oper‹ Assoziationen von ›groß und imposant‹ gehabt hatte, war im ersten Moment verblüfft. Caroline Stowe war nur knapp über einen Meter fünfzig groß, und wenn auch ihr zierlicher Körper wohlgerundet war, hätte keiner sie als korpulent bezeichnen können.
Seine Überraschung war ihm offenbar anzusehen, denn sie lachte und sagte: »Ich bin keine Wagnersängerin, Mr. Kincaid. Meine Spezialität ist der Belcanto. Im übrigen ist körperliche Größe für den Stimmumfang nicht ausschlaggebend. Er hängt vielmehr von der Atemtechnik ab – unter anderem.« Sie ließ seine Hand los. »Aber bitte, kommen Sie doch herein.«
Während sie hinter ihm die Tür schloß, sah er sich mit Interesse um. Eine Lampe auf einem kleinen Tisch an der Wand beleuchtete das Vestibül mit dem glatten grauen, gefliesten Boden. Die Wände waren in einem hellen Graugrün gehalten und schmucklos bis auf einige große, in Gold gerahmte Aquarelle, die üppige, barbusige Frauen vor einer Kulisse wild romantischer Ruinen zeigten.
Dame Caroline öffnete eine Tür zur Rechten und wartete mit einladender Handbewegung, um ihm den Vortritt zu lassen.
Direkt gegenüber der Tür war ein offener Kamin, in dem ein Feuer brannte, und über dem Sims, in einem Spiegel mit verziertem Rahmen, sah er sich selbst – das kastanienbraune Haar kraus von der Feuchtigkeit, die Augen umschattet, ihre Farbe auf diese Entfernung nicht zu erkennen. Von Caroline war lediglich ihr dunkler Scheitel etwas unterhalb seiner Schulter zu sehen.
Er hatte nur einen Moment Zeit, einen Eindruck von dem Raum zu gewinnen. Der gleiche graue Fliesenboden, seine Härte hier durch Teppiche gemildert; bequeme, leicht abgenützte, chintzbezogene Sitzmöbel; Teegeschirr auf einem Tablett; alles beherrschend ein Flügel mit aufgeschlagenem Notenheft. In seiner dunklen Oberfläche spiegelte sich das Licht einer kleinen Lampe. Die Klavierbank war zurückgeschoben und stand etwas schräg, so als sei gerade jemand im Spiel unterbrochen worden.
»Gerald, das ist Superintendent Kincaid von Scotland Yard.« Caroline trat zu dem großen, zerknautscht wirkenden Mann, der aus dem Sofa aufstand. »Mr. Kincaid, mein Mann, Sir Gerald Asherton.«
»Es freut mich, Sie kennenzulernen«, sagte Kincaid und war sich bewußt, wie unangemessen diese Erwiderung war. Doch wenn Dame Caroline seinen Besuch unbedingt wie ein gesellschaftliches Zusammentreffen behandeln wollte, würde er eben das Spiel eine Weile mitspielen.
»Nehmen Sie Platz.« Sir Gerald nahm eine Zeitung von einem der Sessel und legte sie auf einen Beistelltisch.
»Möchten Sie eine Tasse Tee?« fragte Dame Caroline. »Wir haben schon welchen getrunken, aber es ist überhaupt kein Problem, frischen zu machen.«
Kincaid stieg der Duft von Toast in die Nase, der noch in der Luft hing, und ihm knurrte der Magen. Von seinem Platz aus konnte er die Gemälde sehen, die ihm entgangen waren, als er das Zimmer betreten hatte – wieder Aquarelle, von derselben Hand gemalt, diesmal jedoch ruhten die Frauen in eleganten Zimmern, und ihre Gewänder glänzten wie Seidenmoiré. Ein Haus für den Genießer, dachte er und sagte: »Nein, danke.«
»Dann nehmen Sie doch einen Drink«, meinte Sir Gerald. »Dafür ist es nun wirklich nicht zu früh.«
»Nein, danke, wirklich.« Ein seltsames Paar, diese beiden, wie sie da nebeneinander standen und sich um ihn bemühten, als sei er ein königlicher Gast. Dame Caroline, in pfauenblauer Seidenbluse und dunkler langer Hose, wirkte adrett und beinahe kindlich neben ihrem massigen Ehemann.
Sir Gerald sah Kincaid mit einem breiten, ansteckenden Lächeln an. »Geoffrey hat Sie uns sehr empfohlen, Mr. Kincaid.«
Geoffrey mußte Geoffrey Menzies-St. John sein, Kincaids Assistant Commissioner und Ashertons alter Schulkamerad. Die beiden Männer mußten im gleichen Alter sein, aber äußerliche Ähnlichkeit hatten sie keine. Doch der Assistant Commissioner, der pingelig und genau bis zur Pedanterie war, besaß eine scharfe Intelligenz, und Kincaid bezweifelte, daß die beiden Männer über die Jahre den Kontakt gehalten hätten, wenn nicht Sir Gerald über ähnliche Verstandesgaben verfügte.
Kincaid beugte sich ein wenig vor. »Möchten Sie sich nicht setzen, bitte, und mir berichten, was geschehen ist?«
Sie setzten sich gehorsam, Dame Caroline allerdings nur auf die Kante des Sofas, kerzengerade, abseits vom beschützerisch gekrümmten Arm ihres Mannes. »Es geht um Connor. Unseren Schwiegersohn. Aber das wird man Ihnen bereits gesagt haben.« Sie sah ihn an. Die braunen Augen wirkten dunkler durch die erweiterten Pupillen. »Wir können es einfach nicht glauben. Weshalb sollte jemand Connor töten wollen? Es ist völlig unsinnig, Mr. Kincaid.«
»Wir brauchen natürlich zusätzliche Indizien, ehe wir die Sache offiziell als Mordfall behandeln können, Dame Caroline.«
»Aber ich dachte –«, begann sie und sah Kincaid ratlos an.
»Beginnen wir doch einmal beim Anfang, ja? War Ihr Schwiegersohn ein Mann, den die Leute mochten?« Kincaid richtete die Frage an beide, doch es war Dame Caroline, die ihm antwortete.
»Aber ja. Jeder mochte Con. Man konnte gar nicht anders.«
»War sein Verhalten in letzter Zeit irgendwie anders als sonst? Wirkte er verstimmt oder unglücklich?«
Mit einem Kopfschütteln antwortete sie: »Con war immer – nun eben einfach Con. Sie hätten ihn kennen müssen …« Ihre Augen wurden feucht. Sie ballte eine Hand zur Faust und drückte sie an ihren Mund. »Wie albern! Ich neige sonst nicht zur Hysterie, Mr. Kincaid. Oder zum Stammeln. Es ist vermutlich der Schock.«
Kincaid fand ihre Definition von Hysterie recht übertrieben, sagte jedoch beschwichtigend: »Machen Sie sich darüber keine Gedanken, Dame Caroline. Das ist doch ganz normal. Wann haben Sie Ihren Schwiegersohn zuletzt gesehen?«
Sie schniefte einmal und rieb sich mit einer Hand über ihre Augen. »Beim Mittagessen. Er kam gestern zum Mittagessen. Das hat er oft getan.«
»Und Sie waren auch hier, Sir Gerald?« fragte Kincaid, der den Eindruck hatte, daß er von diesem Mann nur auf eine direkte Frage eine Antwort erhalten würde.
Sir Gerald saß mit zurückgelehntem Kopf, die Augen halb geschlossen, das Kinn mit dem kurzen zerzausten, grauen Bart vorgeschoben. Ohne sich zu rühren, sagte er: »Ja, ich war auch hier.«
»Und Ihre Tochter?«
Bei dieser Frage hob Sir Gerald den Kopf, doch es war wieder seine Frau, die Kincaid antwortete. »Julia war hier im Haus, aber sie hat nicht mit uns gegessen. Sie ißt mittags lieber in ihrem Atelier.«
Das wird ja immer seltsamer, dachte Kincaid. Der Schwiegersohn kommt zum Lunch, aber seine Frau lehnt es ab, mit ihm zusammen zu essen. »Sie wissen also nicht, wann Ihre Tochter ihn zuletzt gesehen hat?«
Ein rascher, beinahe verschwörerischer Blick zwischen Mann und Frau, dann sagte Sir Gerald: »Für Julia war das alles sehr schwierig.« Er lächelte Kincaid an und zupfte dabei an einem losen Fädchen seines braunen Pullovers. »Sie werden es gewiß verstehen, wenn sie ein wenig – empfindlich ist.«
»Ist Ihre Tochter im Haus? Ich würde sie gern sehen, wenn ich darf. Und ich würde gern ausführlich mit Ihnen beiden sprechen, sobald ich Gelegenheit gehabt habe, mir die Protokolle Ihrer Aussagen anzusehen.«
»Natürlich. Ich bringe Sie hinauf.« Dame Caroline stand auf, und Sir Gerald folgte ihrem Beispiel. Ihre unsicheren Mienen erheiterten Kincaid. Sie hatten ein Verhör dritten Grades erwartet und wußten jetzt nicht, ob sie erleichtert oder enttäuscht sein sollten. Keine Sorge, dachte er im stillen, ihr werdet noch froh sein, mich loszuwerden.
»Sir Gerald.« Auch Kincaid stand auf und reichte Sir Gerald zum Abschied die Hand.
Die Aquarelle fielen ihm wieder ins Auge, als er sich zur Tür wandte. Obwohl die Frauen auf den Bildern fast alle blond waren, mit zart rosiger Haut und ebenso rosigen Mündern, die halb geöffnet kleine weiße Zähne zeigten, erinnerten sie ihn irgendwie an Dame Caroline.
»Das war früher das Kinderzimmer«, bemerkte Dame Caroline, nicht im geringsten außer Atem nach den drei Treppen, die sie hinaufgestiegen waren. »Wir haben es zum Atelier für sie umbauen lassen, ehe sie aus dem Haus ging. Ich denke, man könnte sagen, es hat sich als nützlich erwiesen«, schloß sie mit einem Blick zu ihm, den er nicht deuten konnte.
Sie waren im obersten Stockwerk des Hauses. Der Flur war kahl, der Teppichboden an manchen Stellen fadenscheinig. Dame Caroline wandte sich nach links und blieb vor einer geschlossenen Tür stehen. »Sie erwartet Sie schon.« Sie lächelte Kincaid noch einmal zu und ging davon.
Er klopfte, wartete, klopfte noch einmal und lauschte einen Moment mit angehaltenem Atem, um ja nichts zu überhören. Das Geräusch von Dame Carolines Schritten war verklungen. Von unten hörte er gedämpfes Husten. Noch einmal klopfte er an, dann drehte er kurz entschlossen den Türknauf und trat ins Zimmer.
Die Frau saß mit dem Rücken zu ihm auf einem hohen Hocker, ihren Kopf über irgend etwas geneigt, das er nicht sehen konnte. Als Kincaid sagte: »Äh – guten Tag«, drehte sie sich ruckartig nach ihm um, und er sah, daß sie einen Pinsel in der Hand hielt.
Julia Swann war nicht schön. Er sagte sich das ganz bewußt und sachlich und konnte dennoch den Blick nicht von ihr wenden. Sie war größer, schmaler, kantiger als ihre Mutter, trug ein weißes Herrenhemd und enge schwarze Jeans. Ihre Figur und ihre Gestik hatten nichts Weiches, Rundes. Das kinnlange dunkle Haar folgte mit brüskem Schwung der Bewegung ihres Kopfes, als sie sich umdrehte.
Ihre Haltung, wie aufgeschreckt, die sogleich spürbare Intimität des Raums verrieten ihm das Störende seines Eindringens. »Verzeihen Sie, daß ich Sie störe. Ich bin Duncan Kincaid von Scotland Yard. Ich habe mehrmals geklopft.«
»Ich habe Sie gar nicht gehört. Ich meine, wahrscheinlich habe ich Sie gehört, aber nicht darauf geachtet. Das geht mir häufig so, wenn ich arbeite.« Selbst ihrer Stimme fehlte der samtige Wohlklang, den die Stimme ihrer Mutter besaß. Sie glitt vom Hocker und wischte sich die Hände an einem Tuch ab. »Ich bin Julia Swann. Aber das wissen Sie ja schon, nicht wahr?«
Ihre Hand war ein wenig feucht von der Berührung mit dem Tuch, doch ihr Zugriff war rasch und hart. Er sah sich nach einer Sitzgelegenheit um, konnte aber nur einen schäbigen alten Sessel entdecken, so tief, daß er ihr darin praktisch zu Füßen gesessen hätte. Er zog es vor, sich an einen Arbeitstisch zu lehnen, auf dem heilloses Durcheinander herrschte.
Obwohl der Raum ziemlich groß war – wahrscheinlich, dachte er, hatte man hier eine Wand herausgerissen, um aus zwei Zimmern eines zu machen –, war kein Winkel vom Chaos verschont. Nur die Fenster, mit Sonnenjalousien aus einfachem weißem Reispapier, waren Inseln der Ruhe im Sturm der allgemeinen Unordnung, ebenso wie der hohe Arbeitstisch, an dem Julia Swann gesessen hatte, als er ins Zimmer gekommen war. Auf diesem Tisch lag lediglich ein Stück weißen Kunststoffs, das mit leuchtenden Farbklecksen gesprenkelt war, und daneben lehnte leicht schräg eine Sperrholzplatte. Ehe sie sich wieder auf den Hocker setzte und ihm den Blick versperrte, sah er, daß ein kleines Blatt weißen Papiers mit Klebeband an der Sperrholzplatte befestigt war.
Sie warf einen flüchtigen Blick auf den Pinsel, den sie immer noch in der Hand hielt, legte ihn auf den Tisch hinter sich und zog eine Packung Zigaretten aus ihrer Hemdtasche. Sie hielt ihm die Packung hin, und als er den Kopf schüttelte und »Nein danke« sagte, zündete sie sich eine Zigarette an und musterte ihn, während sie langsam den Rauch ausblies.
»Also, Superintendent Kincaid – Sie sind doch Superintendent, nicht wahr? Meine Mutter war sehr beeindruckt von dem Titel, aber das ist nichts Ungewöhnliches. Was kann ich für Sie tun?«
»Zunächst mein Beileid zum Tod Ihres Mannes, Mrs. Swann«, sagte er, wie es sich gehörte, obwohl er bereits ahnte, daß ihre Erwiderung nicht den Konventionen entsprechen würde.
Sie zuckte die Achseln. Er sah die Bewegung ihrer Schultern unter dem losen Stoff des Hemdes. Frisch gestärkt, die Knöpfe links – Kincaid fragte sich, ob es ein Hemd ihres Mannes war.
»Nennen Sie mich Julia. An ›Mrs. Swann‹ konnte ich mich nie gewöhnen. Da bin ich mir immer vorgekommen wie Cons Mutter.« Sie neigte sich zu ihm hinüber und nahm einen billigen Porzellanaschenbecher mit der Aufschrift ›Besuchen Sie die Cheddar-Höhle‹. »Sie ist im letzten Jahr gestorben, die Schmerzensmutter bleibt uns also erspart.«
»Haben Sie die Mutter Ihres Mannes nicht gemocht?« fragte Kincaid.
»Eine zweihundertprozentige Irin, die immer nur ihr irisches Image gepflegt hat.« Dann fügte sie freundlicher hinzu: »Ihr Akzent hat sich proportional zu ihrer Entfernung von County Cork verstärkt.« Zum erstenmal lächelte Julia. Es war das Lächeln ihres Vaters, unverwechselbar, und es verwandelte ihr Gesicht. »Maggie hat Con vergöttert. Sein Tod hätte sie vernichtet. Cons Vater hat sich aus dem Staub gemacht, als Con noch ein Säugling war – wenn er überhaupt je einen Vater hatte«, fügte sie hinzu, leicht amüsiert, wie über einen Scherz, den nur sie kannte.
»Bemerkungen Ihrer Eltern entnahm ich, daß Sie und Ihr Mann schon länger nicht mehr zusammengelebt haben.«
»Nein seit …« Sie spreizte die Finger ihrer rechten Hand und schien abzuzählen. Ihre Finger waren lang und schlank, und sie trug keine Ringe. »Wir lebten seit mehr als einem Jahr getrennt.« Sie drückte ihre Zigarette im Aschenbecher aus.
»Ein etwas merkwürdiges Arrangement, wenn ich das mal sagen darf.«
»Finden Sie, Mr. Kincaid? Uns hat es gepaßt.«
»Keine Scheidungspläne?«
Wieder zuckte Julia die Achseln. Sie schlug die Beine übereinander und wippte leicht mit einem Fuß. »Nein.«
Während er sie betrachtete, fragte er sich, wie hart er sie eventuell anfassen könnte. Wenn sie um ihren Mann trauerte, so verstand sie gut, es zu verbergen. Sie wurde unruhig unter seiner Musterung und klopfte mit einer Hand leicht auf ihre Hemdtasche, als wollte sie sich vergewissern, daß ihre Zigaretten nicht verschwunden sind. Er hatte den Eindruck, daß ihre Panzerung vielleicht doch nicht ganz undurchdringlich war.
»Rauchen Sie immer so viel?« sagte er, als habe er ein Recht, das zu fragen.
Mit einem Lächeln zog sie die Packung aus der Tasche und nahm sich eine neue Zigarette.
Er bemerkte, daß das weiße Hemd nicht so makellos sauber war, wie er zuerst gedacht hatte – quer über der Brust hatte es einen violetten Farbfleck. »Standen Sie mit Ihrem Mann auf freundschaftlichem Fuß? Haben Sie ihn häufig gesehen?«
»Wir haben miteinander gesprochen, falls Sie das meinen, aber wir waren nicht gerade die dicksten Freunde.«
»Haben Sie ihn gestern gesehen, als er zum Mittagessen hier war?«
»Nein. Ich mache im allgemeinen keine Mittagspause, wenn ich arbeite. Das reißt mich aus der Konzentration.« Julia drückte die Zigarette aus, die sie gerade erst angezündet hatte, und glitt vom Hocker. »So wie Sie mich jetzt herausgerissen haben. Für heute kann ich Schluß machen.« Sie sammelte eine Handvoll Pinsel zusammen und ging durch das Zimmer zu einem altmodischen Waschtisch mit Schüssel und Krug. »Das ist der einzige Nachteil hier oben«, bemerkte sie über ihre Schulter. »Kein fließendes Wasser.«
Jetzt, da sie ihm die Sicht nicht mehr versperrte, richtete sich Kincaid auf und betrachtete das Blatt Papier, das an das Zeichenbrett geklebt war. Es hatte etwa die Größe einer Buchseite und zeigte die Bleistiftskizze einer ihm unbekannten Blume mit stacheligen Blättern. An einigen Stellen hatte sie begonnen klare, lebhafte Farben aufzutragen, Lavendelblau und Grün.
»Rauhhaarige Wicke«, sagte sie, als sie sich herumdrehte und sah, daß er das Bild betrachtete. »Eine Rankenpflanze. Sie wächst oft in Hecken. Die Blumen sind –«
»Julia!« unterbrach er den Wortschwall, und überrascht von seinem Befehlston hielt sie inne. »Ihr Mann ist gestern abend umgekommen. Heute morgen wurde seine Leiche gefunden. Reichte das nicht aus, um Sie aus Ihrer Konzentration zu reißen? Um Ihren Arbeitsrhythmus zu stören?«
Einen Moment lang wandte sie sich ab, und ihr dunkles Haar verbarg ihr Gesicht. Doch ihre Augen waren trocken, als sie ihn wieder ansah. »Sie erfahren es am besten gleich, Mr. Kincaid. Sie werden es sowieso früh genug von anderen hören. Connor Swann war ein Schwein. Und ich habe ihn verachtet.«
2
»Ein Lagerbier mit Zitronenlimo bitte«, sagte Gemma James lächelnd zu dem Mann hinter dem Tresen. Wenn Kincaid hier wäre, würde er über ihren Geschmack zumindest spöttisch eine Augenbraue hochziehen. Sie hatte sich so sehr daran gewöhnt, von ihm geneckt zu werden, daß es ihr tatsächlich fehlte.
»Unfreundlicher Abend, Miss.« Der Mann schob ihr einen Bierdeckel hin und stellte das kühle Glas darauf. »Kommen Sie von weit her?«
»Nur von London. Der Verkehr war allerdings grauenhaft.« Als sie das Verkehrschaos West-Londons endlich hinter sich gelassen hatte, war sie bis Beaconsfield auf der M 40 geblieben und dann das Themsetal hinaufgefahren. Selbst durch den Nebel hatte sie einige der prächtigen viktorianischen Häuser am Fluß gesehen, Relikte aus einer Zeit, als die ländliche Gegend hier oben ein Tummelplatz der Londoner gewesen war. In Marlow hatte sie die Straße nach Norden genommen, die sie direkt in die von Buchenwäldern bedeckten Hügel hineingeführt hatte. Es war, als dringe sie in eine geheime Welt ein, dunkel unter dichtem Laub und weit entfernt vom breiten, friedlichen Lauf des Flusses unten im Tal.
»Was sind eigentlich die Chiltern Hundreds?« fragte sie den Barkeeper. »Ich hab den Ausdruck mein Leben lang gehört und weiß bis heute nicht, was er bedeutet.«
Er stellte die Flasche ab, die er gerade mit einem Tuch abgewischt hatte, und bedachte seine Antwort. Er war ein Mann mittleren Alters mit dunklem, welligem Haar und dem Ansatz eines Bauches und schien gegen einen kleinen Schwatz nichts einzuwenden zu haben. Das Pub war fast leer – wahrscheinlich noch ein bißchen früh für die Stammgäste, dachte Gemma –, aber gemütlich mit einem offenen Feuer und Polsterstühlen. Am Ende des Tresens war ein Buffet mit kalten Pasteten, Salaten und Käse aufgebaut, bei dessen Anblick ihr das Wasser im Mund zusammenlief.
Man konnte wirklich nichts sagen gegen die Kollegen von der Kriminalpolizei Thames Valley. Sie hatten das Pub in Fingest gut ausgesucht und ihr präzise Fahranweisungen gegeben. Bei ihrer Ankunft hatte sie in ihrem Zimmer bereits ein Bündel Berichte vorgefunden, und sobald sie sie durchgesehen hatte, brauchte sie nur noch genüßlich ihr Bier zu trinken und auf Kincaid zu warten.
»Tja, also, die Chiltern Hundreds«, sagte der Barkeeper, Gemma aus ihren Gedanken reißend, »das sind Bezirke. Früher haben sie die Grafschaften in Hundertschaften aufgeteilt. Jede hatte ihr eigenes Gericht, und drei davon in Buckinghamshire bekamen den Namen die Chiltern Hundreds, weil sie in den Chiltern Hills liegen. Stoke, Burnham und Desborough, genau gesagt.«
»Ganz logisch eigentlich«, sagte Gemma beeindruckt. »Sie sind wirklich gut beschlagen.«
»Ich beschäftige mich in meiner freien Zeit ein bißchen mit Lokalgeschichte. Ich heiße übrigens Tony.« Er reichte Gemma über den Tresen hinweg die Hand.
»Gemma.«
»Die Hundertschaften sind mittlerweile veraltet, aber es gibt noch das Amt des Verwalters der Chiltern Hundreds, es untersteht dem Finanzminister. Nur wer dieses Amt innehat, darf sich aus dem Unterhaus verabschieden. Ein bißchen fauler Zauber in Wirklichkeit und wahrscheinlich der einzige Grund, warum es dieses Amt überhaupt noch gibt.« Er lächelte. »Sehen Sie, jetzt hab ich Ihnen mehr erzählt, als Sie vermutlich überhaupt wissen wollten. Möchten Sie noch ein Glas?«
Gemma blickte auf ihr beinahe leeres Glas hinunter und fand, sie habe genug getrunken, wenn sie einen klaren Kopf behalten wollte. »Lieber nicht, danke.«
»Sind Sie geschäftlich hier? Wir haben um diese Zeit eigentlich kaum Gäste. Im November zieht es Urlauber nicht gerade hierher.«
»Das kann ich mir vorstellen«, sagte Gemma, die sich des unablässigen Regens unter den dunklen Bäumen erinnerte.
Tony wusch seine Gläser und behielt sie gleichzeitig aufmerksam im Auge, bereit, mit ihr zu schwatzen, wenn sie das wollte, jedoch ohne sie zu drängen. Angesichts seiner selbstsicheren Freundlichkeit fragte sie sich, ob er vielleicht der Wirt des Pubs war; wie dem auch sein mochte, er war vermutlich ein ergiebiger Quell lokalen Klatsches.
»Ich bin wegen des Toten hier, den man heute morgen an der Schleuse gefunden hat. Ich bin von der Polizei.«
Tony starrte sie verblüfft an. »Von der Polizei sind Sie? Ist ja nicht zu glauben.« Er schüttelte ungläubig den Kopf und musterte sie ganz ungeniert, das lockige rotblonde Haar, das sie mit einer Spange zurückgesteckt hatte, den grobgestrickten naturfarbenen Pullover, die dunkle Hose. »Na, da sind Sie jedenfalls der bestaussehende Bulle, der mir je über den Weg gelaufen ist, wenn ich das mal so sagen darf.«
Gemma lächelte. »Haben Sie den Mann gekannt? Ich meine den, der ertrunken ist?«
Tony nickte. »Ja, natürlich hab ich ihn gekannt. Traurig, wirklich. Jeder hier in der Gegend hat Connor gekannt. Ich glaub, zwischen hier und London gibt’s kein Pub, wo er nicht ab und zu reingeschaut hat. Und keine Rennbahn. War ein echter Lebenskünstler, dieser Mann.«
»War wohl allgemein beliebt?« fragte Gemma, die Mühe hatte, ihre Vorurteile gegen einen Mann mit einem solchen Faible für Alkohol und Pferde zu unterdrücken. Erst nach ihrer Heirat mit Rob hatte sie entdeckt, daß er das Flirten mit anderen Frauen und das Glücksspiel als sein unveräußerliches Recht betrachtete.
»Connor war ein netter Kerl. Er hatte immer ein freundliches Wort oder einen kameradschaftlichen Klaps für andere. Und er war gut fürs Geschäft. Wenn er ein paar Gläser getrunken hatte, hat er immer sämtliche Gäste eingeladen, die gerade da waren.« Lebhaft neigte sich Tony über den Tresen. »Wirklich eine Tragödie für die Familie nach dieser anderen Geschichte.«
»Was für eine andere Geschichte? Für wessen Familie?« fragte Gemma verwirrt.
»Entschuldigen Sie.« Tony lächelte. »Ich weiß, für den Außenstehenden ist das Ganze ein bißchen unklar. Ich hab die Familie von Connors Frau Julia gemeint, die Ashertons. Die leben seit Ewigkeiten hier. Connors Familie stammt aus Irland, glaub ich, aber trotzdem …«
»Was war denn mit den Ashertons?« drängte Gemma interessiert.
»Ich war damals noch ein junger Kerl, zwei Jahre aus der Schule und hatte gerade mal in London mein Glück versucht.« Seine weißen Zähne blitzten, als er lachte. »Ich bin ziemlich schnell dahintergekommen, daß die Großstadt doch nicht so glanzvoll ist, wie ich mir das vorgestellt hatte. Es war übrigens genau um diese Jahreszeit, kalt und naß. Es hatte wochenlang unaufhörlich geregnet.« Tony hielt inne, nahm ein Glas vom Regal und hielt es hoch. »Haben Sie was dagegen, wenn ich mir auch ein Bier genehmige?«
Sie schüttelte den Kopf. »Natürlich nicht.« Das Gespräch machte ihm jetzt sichtlich Spaß, und je weiter sie ihn seine Geschichte ausspinnen ließ, desto mehr Details würde sie erfahren.
Er zapfte sich ein Guinness, trank einen Schluck und wischte sich den cremigen Schaum von der Oberlippe, ehe er zu sprechen fortfuhr. »Wie hieß er gleich wieder? Ich meine, Julias kleiner Bruder. Es ist bestimmt zwanzig Jahre her, oder fast.« Er strich sich über sein welliges Haar, als hätte die Erwähnung der vergangenen Zeit ihm sein Alter zu Bewußtsein gebracht. »Matthew, genau! Matthew Asherton. Gut zwölf Jahre alt, so eine Art musikalisches Wunderkind. Und eines Tages, als er mit seiner Schwester von der Schule heimging, ist er ertrunken.«
Das Bild ihres eigenen kleinen Sohnes stand Gemma plötzlich vor Augen – die Vorstellung, Toby, der kleine blonde Frechdachs, der gerade begann den Babyspeck zu verlieren, könnte ihr entrissen werden, drückte ihr das Herz ab. Sie schluckte und sagte: »Wie schrecklich. Für alle natürlich, aber besonders für Julia. Erst ihr Bruder und jetzt ihr Mann. Wie ist der Kleine denn ertrunken?«
»Ich glaube, so genau ist das nie rausgekommen. Es war wohl einfach so eine Verkettung unglücklicher Umstände.« Er zuckte die Achseln und kippte die Hälfte seines Biers hinunter. »Keiner hat damals offen darüber gesprochen. Es wurde nur getuschelt, und der Familie gegenüber wird es bis heute nicht erwähnt, soviel ich weiß.«
Ein kalter Luftzug blies Gemma in den Rücken, als sich die Tür des Pubs öffnete. Sie drehte sich herum und beobachtete eine Vierergruppe, die hereinkam und sich mit einem freundschaftlichen Gruß zu Tony an einem Ecktisch niederließ. »Wir möchten gern in einer halben Stunde einen Tisch, Tony«, rief einer der Männer. »Inzwischen dasselbe wie immer, okay?«
»Jetzt wird’s langsam voll werden«, bemerkte Tony zu Gemma, während er begann die bestellten Getränke zu mixen. »Am Freitagabend ist hier im Restaurant meistens Hochbetrieb – da machen sich die Leute einen netten Abend, ohne ihre Kinder.« Gemma lachte, und als erneut ein kalter Luftzug sie erfaßte, drehte sie sich nicht mehr erwartungsvoll herum.
Kincaid tätschelte leicht ihre Schulter, als er sich neben sie auf den Hocker setzte. »Hallo, Gemma. Ich sehe, Sie halten hier für mich die Festung.«
»Oh, hallo, Chef.« Sie spürte, wie ihr Herz stolperte, obwohl sie ihn erwartet hatte.
»Und flirten mit den Einheimischen. Sie Glückspilz.« Er lachte Tony an. »Ich nehme ein – Brakspear, das wird doch hier in Henley gebraut?«
»Mein Chef«, sagte Gemma erklärend zu Tony. »Tony, das ist Superintendent Duncan Kincaid.«
»Freut mich, Sie kennenzulernen.« Tony warf Gemma einen überraschten Blick zu, als er Kincaid die Hand bot.
Gemma musterte Kincaid kritisch. Groß und schlank, das braune Haar ein wenig zerzaust, die Krawatte schief, das Tweedjackett feucht vom Regen – er sah wirklich nicht so aus, wie sich die meisten Leute wahrscheinlich einen hohen Beamten von Scotland Yard vorstellen. Und er war natürlich viel zu jung dafür. Superintendents hatten entschieden älter und gewichtiger zu sein.
»Also heraus damit«, sagte Kincaid, als er sein Bier bekommen hatte und Tony damit beschäftigt war, den Gästen am Tisch ihre Getränke zu bringen.
Gemma wußte, daß er sich darauf verließ, daß sie alle Informationen sichtete und ihm dann die relevanten Einzelheiten vorlegte. Selten mußte sie von ihren Notizen Gebrauch machen. »Ich hab mir die Berichte von Thames Valley angesehen.« Mit einem Kopfnicken wies sie zu den Zimmern über ihren Köpfen hinauf. »Sie lagen schon da, als ich kam. Sehr gewissenhaft.« Sie schloß einen Moment die Augen, um ihre Gedanken zu sammeln. »Sie bekamen heute morgen um sieben Uhr fünf einen Anruf von einem Perry Smith, dem Schleusenwärter an der Hambleden Schleuse. Er hatte eine Leiche gefunden, die an seinem Schleusentor hängengeblieben war. Die Kollegen schickten einen Bergungstrupp los, um den Toten rausholen zu lassen, und identifizierten ihn anhand seiner Brieftasche als Connor Swann, wohnhaft in Henley-on-Thames. Als der Schleusenwärter sich vom ersten Schock erholt hatte, konnte er ihnen sagen, daß Connor Swann der Schwiegersohn der Ashertons ist, die ungefähr zwei Meilen von Hambleden entfernt wohnen. Er sagte aus, die Familie gehe häufig da spazieren.«
»Was, auf der Schleuse?« fragte Kincaid überrascht.
»Ja, anscheinend ist das Teil einer Panoramawanderung.« Gemma runzelte flüchtig die Stirn und führte ihren Bericht da fort, wo er unterbrochen worden war. »Nach der Bergung hat der örtliche Amtsarzt die Leiche untersucht. Er stellte erhebliche Druckstellen rund um den Hals fest. Außerdem war der Tote sehr kalt, aber die Leichenstarre hatte gerade erst eingesetzt –«
»Man würde doch erwarten, daß das kalte Wasser den Beginn der Leichenstarre verzögert«, unterbrach Kincaid.
Gemma schüttelte ungeduldig den Kopf. »Im allgemeinen setzt die Leichenstarre bei Ertrunkenen sehr rasch ein. Er hält es daher für wahrscheinlich, daß der Mann erdrosselt wurde, ehe er im Wasser landete.«
»Der gute Mann ist ja ziemlich großzügig mit seinen Vermutungen, finden Sie nicht?« Kincaid nahm einen Beutel Chips mit Zwiebelaroma von einem Ständer und zählte Tony das Geld dafür auf den Tresen. »Wir werden sehen, was die Obduktion ergibt.«
»Hauptsächlich Unappetitliches«, sagte Gemma mit einem angewiderten Blick auf die Chips.
Kincaid antwortete mit vollem Mund. »Ich weiß, aber ich bin total ausgehungert. Was haben die Aussagen der Familie ergeben?«
Sie trank den letzten Schluck aus ihrem Glas, ehe sie antwortete. »Lassen Sie mich überlegen – die Kollegen haben die Schwiegereltern und die Ehefrau befragt. Sir Gerald Asherton hat gestern abend im Coliseum in London eine Oper begleitet. Dame Caroline Stowe war zu Hause im Bett und hat gelesen. Und Julia Swann, die Ehefrau, war bei einer Vernissage in Henley. Ihren Angaben zufolge hatte niemand von ihnen mit Connor Streit oder Anlaß zu glauben, er könnte erregter oder verzweifelter Stimmung gewesen sein.«
»Natürlich nicht.« Kincaid schnitt ein Gesicht. »Das alles bedeutet gar nichts, solange wir keine geschätzte Todeszeit haben.«
»Sie haben die Familie doch heute nachmittag kennengelernt, nicht wahr? Was sind das für Leute?«
»Hm«, machte Kincaid. »Interessant. Aber ich denke, es ist besser, Sie bilden sich Ihre eigene Meinung. Wir sprechen morgen noch einmal mit ihnen.« Er seufzte und trank von seinem Bier. »Ich glaube allerdings nicht, daß da die große Offenbarung auf uns wartet. Keiner von ihnen kann sich vorstellen, weshalb jemand hätte Connor Swann töten sollen. Wir haben also kein Motiv, keinen Verdächtigen, und wir sind nicht einmal sicher, daß es Mord ist.« Er hob sein Glas und prostete ihr mit spöttischem Gesicht zu. »Auf einen spannenden Fall.«
Nach einer Nacht gesunden Schlafs brachte Kincaid etwas mehr Enthusiasmus für den Fall auf. »Zuerst die Schleuse«, sagte er beim Frühstück im Speisesaal des Chequer zu Gemma. »Ich kann erst weitermachen, wenn ich das selbst gesehen habe. Dann möchte ich einen Blick auf den Toten werfen.« Er spülte seinen Kaffee hinunter und schaute sie mit zusammengekniffenen Augen an. »Wie schaffen Sie es, so früh am Morgen so frisch und vergnügt auszusehen?« Sie trug einen Blazer in leuchtendem Rostrot, ihr Gesicht war wach und lebendig, selbst ihr Haar schien vor Energie zu knistern.
»Tut mir leid.« Sie lächelte, doch Kincaid hatte den Eindruck, daß ihre Anteilnahme mit Mitleid gefärbt war. »Ich kann nichts dafür. Wahrscheinlich hat es was mit den Genen zu tun. Oder damit, daß ich die Tochter eines Bäckers bin. Wir sind zu Hause immer sehr früh aufgestanden.«
»Puh.« Er hatte nach einem Glas Bier zuviel am Abend zuvor tief und fest geschlafen und eine zweite Tasse Kaffee gebraucht, um wenigstens halbwegs munter zu werden.
»Es wird schon werden«, sagte Gemma lachend, und sie beendeten ihr Frühstück in freundschaftlichem Schweigen.
Im frühen Morgenlicht fuhren sie durch das stille Dorf Fingest und dann weiter nach Süden in Richtung Themse. Nachdem sie Gemmas Escort auf dem Parkplatz eine halbe Meile vom Fluß entfernt stehengelassen hatten, überquerten sie die Straße zum Wanderpfad. Ein kühler Wind blies ihnen in die Gesichter, als sie langsam hangabwärts gingen. Kincaid, der mit seiner Schulter versehentlich Gemma streifte, spürte ihre Wärme selbst durch sein Jackett hindurch.
Ihr Weg kreuzte die Straße, die parallel zum Fluß verlief, und schlängelte sich dann zwischen Häusern und verwilderten Büschen hindurch. Erst als sie aus einem eingezäunten Durchgang traten, sahen sie den Fluß. Bleiernes Wasser reflektierte den bleiernen Himmel, und direkt vor ihnen führte ein Betonweg im Zickzack über den Fluß.
»Sind wir hier auch wirklich richtig?« fragte Kincaid. »Ich kann nichts entdecken, was wie eine Schleuse aussieht.«
»Da drüben, hinter dieser Böschung dort, sind Boote zu sehen. Es muß da einen Kanal geben.«
»Gut. Dann gehen Sie voraus.« Mit einer galanten kleinen Verneigung ließ er ihr den Vortritt.