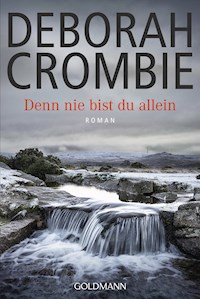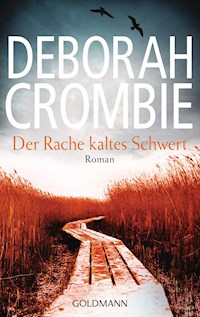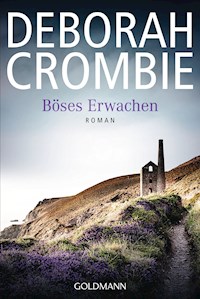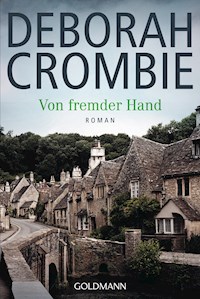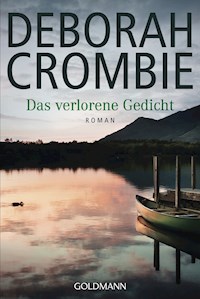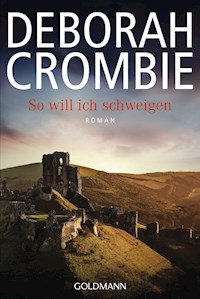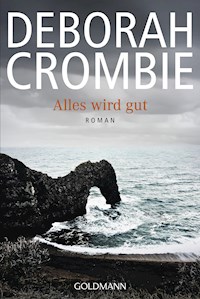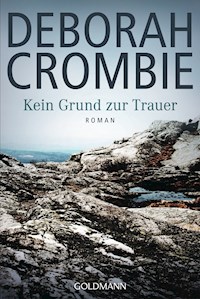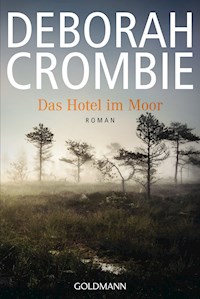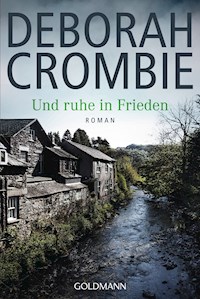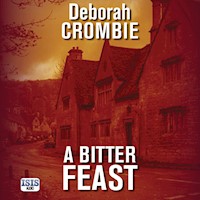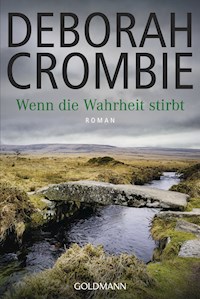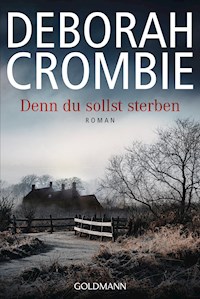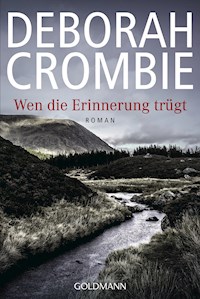Inhaltsverzeichnis
Buch
Autorin
Lob
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Danksagung
Copyright
Buch
Superintendent Duncan Kincaid wird zu einem Tatort im Londoner Stadtviertel Southwark gerufen, wo sich ihm ein furchtbares Bild bietet: In einem Lagerhaus wurde die verbrannte Leiche einer jungen Frau gefunden. Kincaid beginnt seine Ermittlungen in einem Frauenhaus, das sich in unmittelbarer Nachbarschaft des Tatorts befindet. Aber die Befragung der derzeitigen Bewohnerinnen gestaltet sich schwierig; aus Angst, ihre Ehemänner könnten ihren Aufenthaltsort erfahren, verweigern die meisten die Aussage. Jason, der in der Einrichtung arbeitet, versichert Kincaid, es werde keine Frau vermisst. Dennoch wird der Superintendent das Gefühl nicht los, dass das Opfer etwas mit dem Frauenhaus zu tun hatte.
Zur selben Zeit wird Kincaids Lebensgefährtin Inspector Gemma James von einer Bekannten um Hilfe gebeten. Elaine, eine junge Frau aus Southwark, wird vermisst. Ihre Mitbewohnerin Fanny, die an den Rollstuhl gefesselt ist, möchte sich nicht offiziell an die Polizei wenden, da Elaine sich vor ihrem Verschwinden verdächtig verhalten hat. Sowohl Kincaid als auch Gemma kommt der schreckliche Gedanke, dass es sich bei der Frauenleiche um Elaine handeln könnte. Aber die wahre Verbindung zwischen den beiden Fällen wird Kincaid und Gemma erst sehr spät bewusst – vielleicht zu spät für ein kleines Mädchen, das sich in äußerster Gefahr befindet …
Autorin
Deborah Crombies höchst erfolgreiche Romane um Superintendent Duncan Kincaid und Inspector Gemma James wurden für den »Agatha Award«, den »Macavity Award« und den »Edgar Award« nominiert. Die Autorin lebt mit ihrer Familie im Norden von Texas. Weitere Informationen zur Autorin unter www.deborahcrombie.com
Von Deborah Crombie sind außerdem folgende Romane bei Goldmann lieferbar:
Das Hotel im Moor (42618), Alles wird gut (42666), Und ruhe in Frieden (43209), Kein Grund zur Trauer (43229), Das verlorene Gedicht (44091), Böses Erwachen (44199), Von fremder Hand (44200), Der Rache kaltes Schwert (45308), Nur wenn du mir vertraust (45309)
Zur Erinnerung an Fleur Lombard,Feuerwehr Avon, England,gestorben in Ausübung ihrer Pflichtam 4. Februar 1996.
Weswegen ließt Ihr mich gefangen setzen,Ins Dunkle sperren …
William Shakespeare, Was ihr wollt
1
London … Der Rauch senkt sich von den Schornsteinennieder, ein dichter schwarzer Regen von Rußbatzen, sogroß wie ausgewachsene Schneeflocken, die in schwarzenKleidern den Tod der Sonne betrauern wollen.
Charles Dickens, Bleakhaus
Es genügte ein einziges Streichholz, platziert in einem kleinen Hohlraum zwischen zerknülltem Papier und Chipstüten aus Plastik. Das Feuer glomm, dann loderte es knisternd auf, und binnen Sekunden leckten Flammenzungen an den untersten Möbeln, die irgendjemand praktischerweise im Erdgeschoss des alten Lagerhauses gestapelt hatte. Nichts brennt so gut wie Polyurethan-Schaumstoff, und die billigen Sessel, Sofas und Matratzen, die man aus den Wohnungen in den oberen Stockwerken heruntergeschafft hatte, waren alt genug, um noch nicht mit Brandverzögerer behandelt zu sein.
Ein Geschenk. Es war ein Geschenk. Er hätte es selbst nicht besser planen können. Die Möbel würden genügend Hitze erzeugen, um einen Flashover auszulösen, und dann würden die alten Holzdielen und Deckenbalken brennen wie Zunder. Das Feuer würde ein Eigenleben entwickeln, losgelöst von seinem Urheber.
Und das Feuer besaß Macht, das hatte er schon früh gelernt; die Macht, zu berauschen und zu verwandeln; die Macht, Staunen und Entsetzen auszulösen. In der Schule hatte er zum ersten Mal von dem großen Brand in der Tooley Street im Jahre 1861 gehört; heute kam es ihm merkwürdig vor, dass er ausgerechnet an diesem Ort seine Berufung entdeckt hatte.
Die Feuersbrunst hatte zwei Tage lang gewütet und dabei Hafengebäude und Lagerhäuser auf einer Länge von fast dreihundert Metern vernichtet – ein Ausmaß von Zerstörung, wie es die Stadt seit dem großen Feuer von 1666 nicht mehr gekannt hatte und wie sie es bis zu den deutschen Luftangriffen im Zweiten Weltkrieg nicht mehr erleben würde.
Es hatte natürlich auch andere Brände gegeben: Mustard Mills 1814, Topping’s Wharf 1843, Bankside 1855; es kam ihm vor, als seien Feuer für Southwark eine Notwendigkeit wie Geburt und Tod, eine elementare Bedingung für Wachstum und Erneuerung.
Die Hitze begann sein Gesicht zu versengen; die Haut über seinen Wangenknochen und an seiner Stirn fühlte sich gespannt an, Rauch und entweichende Gase stiegen ihm beißend in die Nase. Das Feuer war jetzt so richtig in Gang gekommen; es bahnte sich seinen Weg tief in die aufgestapelten Möbel hinein und züngelte unvermittelt an anderer Stelle wieder hervor. Es war Zeit zu gehen, aber noch zögerte er, noch konnte er sich nicht losreißen von diesem Quell der Energie, der ihm mehr bedeutete als sexuelle Befriedigung – der ihm einen Blick ins Herz des Lebens selbst gewährte. Wenn er sich ihm ganz und gar hingäbe, wenn er sich davon verzehren ließe, würde sich ihm dann endlich die tiefere Wahrheit offenbaren?
Aber noch widerstand er der Versuchung, sich ganz auszuliefern. Er schüttelte sich, kniff die brennenden Augen zusammen und sah sich noch ein letztes Mal um. Er musste sich vergewissern, dass er keine Spuren hinterlassen hatte. Dann schlich er sich auf demselben Weg hinaus, auf dem er gekommen war. Er würde aus der Ferne zusehen, wie das Feuer zu seinem unabwendbaren Höhepunkt hin anwuchs, und dann … dann würde es schon bald das nächste geben. Es gab immer ein nächstes Feuer.
Am liebsten mochte Rose Kearny die Nachtschicht – wenn es ganz still war auf der Wache, bis auf die gedämpften Stimmen im Bereitschaftsraum, wo alle den ihnen zugewiesenen Aufgaben nachgingen. Es war ein beruhigendes Gefühl, diese Geborgenheit im Kreis der Kameraden, wenn draußen alles dunkel war, genau wie die allmähliche Entspannung nach einem Einsatz. Und sie schätzte sich glücklich, hier in Southwark gelandet zu sein, auf derselben Wache, wo sie ihre Ausbildung absolviert hatte – die zudem die geschichtsträchtigste von ganz London war.
Zusammen mit ihrem Kollegen Bryan Simms überprüfte sie die Atemschutzausrüstung nach dem ersten Alarm dieser Nacht – eine alte Dame hatte sich in ihrer Sozialwohnung ein Abendessen machen wollen und war eingenickt, während die Bratkartoffeln auf dem Herd brutzelten. Zum Glück hatte ein Nachbar den Rauch sehr bald bemerkt; sie hatten den Brand mühelos unter Kontrolle bringen können, und die Frau war ohne ernstliche Verletzungen davongekommen.
Aber jeder Einsatz, ganz gleich wie geringfügig, erforderte eine sorgf ältige Überprüfung aller benutzten Ausrüstungsgegenstände. Heute Nacht waren sie und Bryan dem Angriffstrupp zugeteilt, und ihr Leben hing davon ab, dass die Geräte richtig funktionierten – wie auch davon, dass sie sich aufeinander verlassen konnten. Simms, mit seinen dreiundzwanzig ein Jahr älter als Rose, war genauso solide und zuverlässig, wie es sein ehrliches, offenes Gesicht vermuten ließ, und neigte absolut nicht zur Panik.
Jetzt sah er zu ihr auf, als hätte er ihren Blick gespürt, und legte konzentriert die Stirn in Falten. »›Was ist ein Name?‹«, fragte er, wie um ein unterbrochenes Gespräch wieder aufzunehmen. »›Was uns Rose heißt, wie es auch hieße, würde lieblich duften.‹«
Im ersten Moment war Rose zu verblüfft, um etwas erwidern zu können. Nicht, dass sie es nicht gewohnt gewesen wäre, wegen ihres Namens oder wegen ihres hellen Teints und ihrer blonden Haare aufgezogen zu werden – aber das war das erste Mal, dass einer ihrer Kollegen bei der Feuerwehr sich bei Shakespeare bedient hatte.
Bryan, der ihr Schweigen als Ermutigung wertete, fuhr grinsend fort: »›Doch die gepflückte Ros’ ist irdischer beglückt, als die, am unberührten Dorne welkend, wächst, lebt und stirbt in heil’ger Einsamkeit...‹«<
»Schnauze, Simms«, unterbrach ihn Rose mit mühsam unterdrücktem Lachen. Sie war zugegebenermaßen beeindruckt, dass er sich die Mühe gemacht hatte, die Zeilen auswendig zu lernen. »Hätte nie gedacht, dass du auf Shakespeare stehst.«
»Das Zweite gefällt mir besonders. Ist aus dem Sommernachtstraum«, sagte Simms, und sie fragte sich, ob sie es sich nur eingebildet hatte oder ob sie tatsächlich einen Anflug von Schamröte auf seiner dunklen Haut bemerkt hatte.
»Was du nicht sagst«, gab Rose lächelnd zurück. »Und auch noch Romeo und Julia. Hast ja ganz schön was auf dem Kasten.« Ihr Vater war Englischlehrer am Gymnasium gewesen und hatte sie schon mit Shakespeare-Zitaten traktiert, ehe sie sprechen gelernt hatte. »Aber halt lieber die Augen offen«, fügte sie mit einem Blick auf das Gerät hinzu, das unbeachtet vor ihm lag. »Wäre doch zu blöd, wenn du einen Riss in dem Schlauch da übersehen würdest.«
Sie hatte sechs Monate vor Bryan auf der Feuerwache Southwark angefangen, und sie ließ keine Gelegenheit aus, ihn daran zu erinnern, dass sie die Dienstältere war. Sie hatte es schon schwer genug als Frau in diesem Beruf, der immer noch weitgehend eine Männerdomäne war; da konnte sie keinen Kollegen gebrauchen, der irgendwelche romantischen Flausen über ihre Beziehung im Kopf hatte.
Rose war ehrgeizig, sie wollte es eines Tages vielleicht gar zur Brandoberinspektorin bringen, und sie hatte nicht die Absicht, sich mit einer Aff äre am Arbeitsplatz den Weg zu verbauen. Sie ging durchaus gerne mal aus und hatte auch nichts gegen einen kleinen Flirt, aber nicht mit jemandem aus ihrem eigenen Revier. Und der Job ließ einem nun einmal keine Zeit für eine richtige Beziehung. Wenn man gut sein wollte, musste man mit dem Job aufstehen und zu Bett gehen, musste ihn essen, trinken, atmen. Sie wollte mehr erreichen, als nur ein Feuer löschen zu können; sie wollte das Wie und Warum begreifen, und in der Brandermittlung boten sich die besten Karrierechancen.
Es war inzwischen nach Mitternacht, und sie hatte vor, die verbleibende Zeit zum Lernen zu nutzen, solange alles ruhig blieb. Gerade hatte sie das Atemschutzgerät verstaut und ihre Bücher ausgepackt, als der Alarm zum zweiten Mal in dieser Nacht ertönte.
Rose verspürte den vertrauten Adrenalinstoß, und im nächsten Moment rannte sie mit Bryan und den übrigen Kameraden von der Nachtschicht zum Gerätehaus. Während sie sich an der Stange zu den Fahrzeugen hinunterließen, rief der Offizier vom Dienst über die Lautsprecheranlage: »Gespann!«, was bedeutete, dass sowohl die Drehleiter als auch das Tanklöschfahrzeug benötigt wurden. Wie von einem eigenen Willen beseelt, vollführten Roses Hände die vertrauten Bewegungen, als wäre es ein Ritual: das Zuknöpfen der Schutzjacke, das Schließen des Halsschutzes, das Zurückstreifen ihrer Haare, bevor sie den Helm aufsetzte und den Kinnriemen stramm zog; das Festschnallen des Gürtels, sodass das Gewicht der kleinen Axt auf ihrer Hüfte ruhte.
Der Zugführer, Charlie Wilcox, riss die Einsatzmeldung aus dem Fernschreiber. »Es ist gleich um die Ecke – ein Lagerhaus in der Southwark Street«, informierte er seine Leute. »Hört sich an, als wäre es schon ziemlich weit gediehen – da werden wir mehrere Löschzüge brauchen.«
Binnen Sekunden saßen sie alle auf dem Wagen, der sogleich auf die Southwark Bridge Street hinausrollte und mit Blaulicht und heulenden Sirenen losbrauste. Ein feiner Nieselregen ließ die Konturen in der Septembernacht verschwimmen, machte den Asphalt glitschig und hüllte die Straßenlaternen in neblige Lichtkränze. Als sie in die Southwark Street einbogen, rief Wilcox nach hinten: »Man kann es schon sehen!«
Nachdem der Löschwagen zum Stillstand gekommen war, erblickte Rose die Rauchschwaden, die schwer über der Straße hingen, und aus den unteren Fenstern des Lagerhauses – es war ein prächtiger viktorianischer Backsteinbau – schimmerte ihr ein verräterischer rötlich-orangefarbener Lichtschein entgegen. Der beißende Rauch drang ihr in die Nase, als sie von der Leiter am Heck des Löschfahrzeugs hinuntersprang und die Maske aufsetzte. Aus dem Augenwinkel nahm sie die Schaulustigen wahr, die sich herandrängten, und hörte Wilcox sagen: »Rose, Bryan, es sieht so aus, als wäre es im Wesentlichen noch auf das Erdgeschoss beschränkt. Geht mit der Fangleine rein, und seht nach, ob sich noch Personen im Gebäude befinden.« Dann wandte er sich an den Gruppenführer, Seamus MacCauley. »Sehen Sie sich inzwischen die Rückseite an, Seamus, damit wir die Lage richtig einschätzen können.«
Der Angriffstrupp des Drehleiterfahrzeugs legte bereits den ersten Schlauch aus, während Rose und Bryan die Plaketten für die Atemschutzüberwachung abgaben und ihre Funkgeräte überprüften. »Tür ist offen«, hörte sie Wilcox rufen, als sie ihr Visier herunterklappte, und sie registrierte noch flüchtig, dass die Information sie ein wenig überraschte, ehe sie sich wieder voll auf ihre Aufgaben konzentrierte.
Sie gingen gebückt hinein, Rose voran, und versuchten angestrengt, durch den dichten schwarzen Rauch irgendetwas zu erkennen. Halb blind tasteten sie sich voran. Die sengende Hitze drang sogar durch ihre Schutzjacken, und sie konnte das Ächzen und Knacken eines voll entwickelten Feuers hören. Sie stolperte, fiel gegen etwas Weiches, Sperriges, und ging in die Knie. Als der Rauch sich für einen Moment lichtete, erkannte sie die Umrisse hoch aufgeschichteter Gegenstände, die sich über ihr erhoben, als hätte ein Riesenkind Bauklötze gestapelt. Und mit einem Mal setzten sich die unzusammenhängenden Eindrücke zu einem deutlichen Bild zusammen.
»Das sind Möbel«, sagte sie. »Irgendein Idiot hat hier Möbel gestapelt.« Der Polyurethan-Schaum, der für Polster und Matratzen verwendet wurde, war extrem entzündlich – die Erinnerung an den verheerenden Brand in einem Woolworth in Manchester schoss ihr durch den Kopf, doch sie verdrängte den Gedanken und konzentrierte sich wieder auf das, was hier und jetzt zu tun war.
Immer noch auf den Knien rückte sie vor, tastete sich an den Hindernissen vorbei und versuchte, eine geeignete Stelle zum Verknoten der Leine zu finden. Plötzlich war ein lautes Knacken zu hören, gefolgt von einer Serie knallender Geräusche. Gleichzeitig wallte die Hitze noch mehr auf, und ein Schauer von Trümmerteilen prasselte auf sie herab.
»Flashover!«, rief Bryan. Sie fühlte, wie er ihren Hüftgürtel packte. »Wir müssen raus hier. Vergiss die Leine, Rose.«
Obwohl Bryans Gewicht sie schon in die andere Richtung zog, trug der Schwung ihrer eigenen Bewegung sie noch weiter nach vorn, die Leine in der ausgestreckten Hand.
»Ich sagte, vergiss die Scheißleine, Rose. Gebäude räumen! Gebäude räumen!«
Obwohl gerade ihre Hartnäckigkeit, ihre Weigerung, sich dem Feuer geschlagen zu geben, ein Grund dafür war, dass sie in ihrem Job so gut war, wusste sie doch, dass er Recht hatte. Weiter vorzurücken wäre reiner Selbstmord gewesen, und in dieser Feuersbrunst konnte nichts und niemand ungeschützt überlebt haben.
Auf der einen Seite versperrte ihr ein Sofa den Weg, auf der anderen etwas, das nach einem Stapel Bauholz aussah, und so versuchte Rose, sich auf engstem Raum umzudrehen. Während dieses Manövers stützte sie ihre behandschuhte Hand auf etwas, das unter ihren Fingern nachgab. Es fühlte sich weich und elastisch an, wie Fleisch, und darunter spürte sie etwas Hartes, Sprödes, wie Knochen. Rose sah blinzelnd nach unten, die Augen von der Hitze brennend und geschwollen. »Mein Gott«, stieß sie hervor. »Da liegt eine Leiche.«
An diesem Morgen hatte es kein gemächliches Hinübergleiten in den Wachzustand gegeben, kein Verweilen in eingebildeter Gesundheit, kein Auskosten der Erinnerung an ihr altes Leben.
Fanny Liu schlug die Augen auf und begann sich zögerlich zu orientieren. Es war später als gewöhnlich, das konnte sie an dem Winkel ablesen, in dem das Licht durch das Wohnzimmerfenster einfiel; doch der Himmel war noch ebenso bedeckt wie am Vortag. Wie immer, seit sie die Treppe nicht mehr bewältigen konnte, hatte sie auf dem alten, samtbezogenen Sofa geschlafen, das ihrer Mutter gehört hatte. In diesem Fall war ihre kleine Statur ausnahmsweise ein Segen – wäre sie nur wenige Zentimeter größer gewesen, hätten ihre Füße über den Rand ihres behelfsmäßigen Bettes hinausgeragt. In der Nacht lag sie zwischen den schützenden Armlehnen des Sofas wie in einer Wiege; am Tag konnte sie ihr Bettzeug verschwinden lassen, was ihr erlaubte, die Illusion eines normalen Lebens zu wahren.
Elaine hatte sie natürlich dazu überreden wollen, ein richtiges Bett ins Wohnzimmer zu stellen, aber dieses eine Mal hatte Fannys sanfter Widerstand den Sieg über die forsche, zupackende Art ihrer Mitbewohnerin davongetragen. Der Rollstuhl war schon schlimm genug. Ein Bett im Wohnzimmer wäre für Fanny dem Eingeständnis gleichgekommen, dass ihr Zustand sich vielleicht nie wieder bessern würde.
Ihr Kater Quinn lag noch zusammengerollt auf ihren Füßen. Das einzige Geräusch in der Wohnung war sein leises Schnurren. Es war die Stille, die sie geweckt hatte, das wurde Fanny schlagartig klar. Von oben waren keine Schritte zu hören, und auch in der Küche rührte sich nichts. Elaine war immer als Erste munter, kochte Kaffee und räumte in der Wohnung herum. Bevor sie ins Guy’s Hospital fuhr, wo sie in der Krankenhausverwaltung arbeitete, nahm sie sich stets die Zeit, für Fanny Tee und Toast zu bereiten und ihr beim Aufstehen und Waschen zu helfen.
Vielleicht hatte Elaine verschlafen, dachte Fanny – aber nein, Elaine war so pünktlich wie der Glockenschlag von Big Ben. War sie etwa krank? »Elaine?«, rief Fanny zögernd und zog sich an der Armlehne des Sofas hoch. Ihre Stimme schien in dem leeren Raum zu verhallen, und die Angst durchzuckte sie wie ein Blitz. »Elaine?«
Keine Antwort.
Plötzlich fiel Fanny ihr Traum wieder ein – ein wirrer Albtraum mit Türen, die sich leise schlossen, und sie empfand aufs Neue das unerklärliche Gefühl des Verlusts, das den Traum begleitet hatte. Es ließ sie daran denken, wie sie vor dem Ausbruch ihrer Krankheit als Privatkrankenschwester an den Betten von Sterbenden gewacht hatte; an die Nächte, in denen sie aus einem unbeabsichtigten Nickerchen aufgeschreckt war und augenblicklich gewusst hatte, dass ihr Patient gestorben war, während sie geschlafen hatte.
Und ebenso sicher wusste sie jetzt, da die Stille um sie herum immer bedrückender wurde, dass niemand außer ihr in der Wohnung war. Das Geräusch der Tür, die ins Schloss fiel, hatte sie nicht nur geträumt.
Elaine war weg.
Nichts hasste Harriet Novak mehr, als Fremden erzählen zu müssen, dass sie auf die Little-Dorrit-Schule ging. Die Erwachsenen lächelten dann immer und konnten sich kaum beruhigen, als ob sie das furchtbar süß fänden- wobei Harriet sich immer fragte, wie viele von diesen Leuten Klein Dorrit tatsächlich gelesen hatten -, und die Kinder starrten sie nur mit großen Augen an, als wäre sie gerade von einem anderen Planeten hergebeamt worden.
Dabei war die Schule gar nicht mal so schlecht, das musste sie schon zugeben, als sie an diesem Morgen auf dem Pausenhof stand und mit der Spitze ihres Turnschuhs im Sand bohrte, während sie auf das erste Läuten wartete. Wenn der Name nur nicht so furchtbar kitschig geklungen hätte – es war, als müsste man den Leuten sagen, dass man Tiny Tim, wie in der Weihnachtsgeschichte, hieß.
Es half allerdings, gut vorbereitet zu sein, das hatte Harriet gelernt – Wissen als unverzichtbare Verteidigungswaffe für jemanden, der in einer Dickens-getränkten Gegend wie dieser aufwachsen musste. Sie hatte die Biografie in der Schulbibliothek gelesen und konnte den Leuten mehr über Dickens erzählen, als die meisten hören wollten. Charles Dickens’ Vater hatte für kurze Zeit im Marshalsea-Gefängnis eingesessen, ganz in der Nähe der Schule, und der zwölfjährige Charles hatte nicht weit von dort in einem möblierten Zimmer gewohnt. Diese Erfahrung hatte ihn für den Rest seines Lebens nicht mehr losgelassen und war in viele seiner Bücher eingeflossen; später waren dann seine Schöpfungen zurückgekehrt, um das Viertel heimzusuchen. Hier gab es nicht nur einen Little Dorrit Court und eine Little Dorrit Street, sondern auch eine Marshalsea Road, eine Pickwick Street und eine Copperfield Street.
Wenigstens war nichts nach Oliver Twist benannt worden. Harriet fand Oliver richtig doof – einfach unerträglich niedlich. Davey Copperfield gefiel ihr da schon besser. Er hatte einen kleinen Tick, was seine tote Mutter betraf, aber immerhin hatte er seinen abscheulichen Stiefvater gebissen. Davey wusste, wie man sich durchsetzt.
Mit finsterer Miene betrachtete Harriet die Nachzügler, die durch das Schultor hereinschlurften, und registrierte nur unbewusst den leisen Rauchgeruch, der in der Luft hing. Wieder bewegten sich ihre Gedanken in dem gleichen, ausgefahrenen Gleis. Wäre es besser, wie Davey einen bösen Stiefvater zu haben statt einen echten Vater, der die Familie verlassen hatte? Ihr Papa sagte zwar, dass er sie liebte, aber wenn das stimmte, wie hatte er sie dann im Stich lassen können?
Er erzählte ihr, dass viele Eltern sich scheiden ließen, dass es nun einmal eine Tatsache sei, mit der sie alle zu leben lernen müssten, aber das änderte nichts daran, dass er ihr fehlte. Und auch die Streitereien zwischen ihren Eltern hatten nach seinem Auszug nicht aufgehört. Sie bekam es mit, wenn er sie abholen kam, und manchmal hörte sie auch, wie die beiden sich am Telefon anschrien.
Der letzte Streit war der schlimmste gewesen – als ihr Papa sie nach ihrem letzten Wochenende in seiner Wohnung mit einigen Stunden Verspätung zu Hause abgeliefert hatte. Ihre Mama hatte vor dem Haus auf der Türstufe gesessen, um nach ihnen Ausschau zu halten, und war auf das Auto zugerannt, kaum dass Harriet ausgestiegen war.
»Du Mistkerl, Tony, du egoistisches Arschloch«, hatte ihre Mutter geschrien – ihre Mutter, die Chirurgin, die immer so beherrscht war, die niemals ihre Stimme erhoben hatte, bevor dieser ganze Ärger angefangen hatte. Ihre lockigen, dunklen Haare standen ihr vom Kopf ab, als hätte ihr Zorn sie unter Strom gesetzt; Jeans und Pulli schlackerten an ihren allzu dünnen Gliedern und ließen ihre Knochen so scharf und spitz erscheinen wie ihre Stimme. »Du verspätest dich, du gehst nicht ans Telefon – hast du vielleicht auch mal daran gedacht, dass ich mir Sorgen machen könnte? Es hätte weiß Gott was passiert sein können.«
Harriet stand auf dem Bürgersteig, zur Salzsäule erstarrt. Aus dem Augenwinkel heraus hatte sie eine Bewegung im offenen Fenster der Wohnung nebenan bemerkt und wusste, dass ihre Nachbarin sie beobachtete. Ein Mann und eine Frau, die mit ihrem Hund vorbeigingen, sahen demonstrativ weg und beschleunigten den Schritt. Harriet spürte, wie ihr die Schamröte ins Gesicht stieg. »Mama, wir waren doch nur …«
»Herrgott, Laura«, fuhr ihr Vater dazwischen. »Wir waren im Zoo, das ist alles. Es war ein schöner Tag, und wir sind länger geblieben, als wir vorhatten. Ist das vielleicht ein Verbrechen?« Seine Stimme war mühsam beherrscht, sein Gesicht verkniffen.
»Du hättest Harriet schon vor Stunden zurückbringen sollen. Du kennst die Regeln …«
»Mama, bitte«, sagte Harriet und hörte das demütigende Zittern in ihrer eigenen Stimme. Ihr Hals tat weh, und ein scharfer Schmerz zerriss ihr fast die Brust. »Mir geht’s gut, ehrlich. Können wir jetzt bitte reingehen?«
Ihr Vater warf ihr einen sorgenvollen Blick zu. »Laura, beruhig dich wieder, okay? Du quälst doch nur Harriet …«
»Ich quäle Harriet?« Ihre Mutter trat vom Wagen zurück; sie wirkte plötzlich bedrohlich ruhig und gefasst.
»Hör zu, es wird nicht wieder vorkommen«, beeilte sich Tony zu sagen, als hätte er plötzlich seinen Fehler bemerkt. »Das nächste Mal werde ich …«
»Es wird kein nächstes Mal geben«, hatte ihre Mutter leise, aber bestimmt gesagt, hatte Harriets Arm mit festem Griff gepackt und sich mit ihr zur Tür umgedreht. Als sie am Haus angekommen waren, hatte Harriet einen Blick über die Schulter geworfen und ihren Vater davonfahren sehen, und falls er in der Zwischenzeit versucht hatte, sie anzurufen, dann hatte ihre Mutter ihr nichts davon gesagt.
Harriet hatte nicht zu fragen gewagt, wie ihre Mutter das gemeint hatte, doch die Worte hatten ihr seither stets in den Ohren geklungen, hatten sie nachts am Einschlafen gehindert und sie am Tag auf Schritt und Tritt verfolgt.
Sie zog den Riemen ihres Rucksacks zurecht und runzelte wieder die Stirn, als sie die einsetzenden Kopfschmerzen bemerkte. Sie hatte ihr Frühstück nicht angerührt, und jetzt begann ihr leerer Magen sich zu verkrampfen.
Das war mit das Schlimmste an der Trennung ihrer Eltern – jetzt, da ihr Vater nicht mehr da war, lieferte ihre Mutter Harriet immer bei der alten Mrs. Bletchley ab, wenn sie im Krankenhaus Nachtdienst hatte. Mrs. Bletchley wohnte in einem der kleinen Häuser der Sozialsiedlung gegenüber der Schule, und Mama sagte, sie sei einsam und habe gerne Kinder um sich, doch die Frau erinnerte Harriet an die Hexe in »Hänsel und Gretel«, und in ihrem Haus roch es nach Katzen. Heute Morgen hatte sie Harriet irgendeine undefinierbare, warme Getreidepampe vorgesetzt, in der Harriet nur mit dem Löffel herumgestochert hatte, um sie dann rasch in den Mülleimer zu kippen, sobald Mrs. B. einmal nicht hingeschaut hatte.
Ein auf Hochglanz polierter schwarzer Range Rover hielt vor dem Schultor, worauf ein Junge vom Rücksitz kletterte und mit der unnachahmlichen Coolness eines Elfjährigen seinen Rucksack überstreifte. Shawn Culver war eine Klasse über Harriet, und er war der beliebteste Junge in der ganzen Schule.
»Hey, Harry«, rief er, als er sah, dass sie ihn beobachtete. Sie nickte ihm zu, ohne zu lächeln, entschlossen, sich vollkommen unbeeindruckt zu zeigen, protestierte aber nicht gegen seine Verwendung ihres verhassten Spitznamens. Dann band sie ihre Haare fester zu einem Zopf, als ihr plötzlich bewusst wurde, dass sie vermutlich so aussah, als hätte sie sich heute Morgen die Haare überhaupt nicht gewaschen – was auch stimmte. Es war ja schon schlimm genug, wenn sie zu Hause schlief, wo sie das Chaos wenigstens noch mit dem Gel ihrer Mutter bändigen konnte; an einem Bletchley-Morgen dagegen war ihre Frisur einfach absolut unmöglich.
Die Glocke ertönte, und sie hatte sich gerade umgedreht, um Shawn mit einstudierter Lässigkeit in das Gebäude zu folgen, als das Geräusch eines heftig bremsenden Autos ihren Blick noch einmal zur Straße lenkte. Es war ein dunkelgrüner Volvo, wie ihr Vater einen hatte – nein, es war Papas Volvo. Dann erkannte sie sein Gesicht hinter der getönten Scheibe und sah, dass er ihr zuwinkte. Was hatte er hier zu suchen, so kurz vor Unterrichtsbeginn?
Während sie langsam auf den Wagen zuging, hörte sie es zum zweiten Mal läuten und registrierte, wie sich der Schulhof hinter ihr immer weiter leerte. Beim Näherkommen bemerkte sie, dass jemand auf dem Beifahrersitz saß – eine Frau -, und für einen Sekundenbruchteil loderte eine verrückte Hoffnung in ihrem Herzen auf.
Dann griff ihr Vater hinter sich und stieß die Fondtür auf, und sie sah, dass die Frau nicht ihre Mutter war, sondern eine Person, die sie noch nie zuvor gesehen hatte.
»Wie wär’s mit’nem Kaffee, Chef?« Doug Cullen steckte den Kopf zur Tür von Detective Superintendent Duncan Kincaids Büro herein. »Ich meine einen richtigen Kaffee und nicht diese Brühe da«, fügte er hinzu und deutete mit einem Kopfnicken auf den Becher auf Kincaids Schreibtisch.
Kincaid sah seinen Sergeant an und verzog das Gesicht, während er den Kugelschreiber hinlegte und seine steifen Schultern reckte. »Sie suchen doch bloß nach einem Grund, um an die frische Luft zu kommen, und dabei sind wir noch keine Stunde hier.« Sie hatten in den letzten Tagen immer recht früh angefangen, um den Papierkram abzuarbeiten, der sich im Lauf der Zeit angesammelt hatte; und das Labyrinth von abgetrennten Arbeitsplätzen, das die Mordkommission von Scotland Yard bildete, kam ihm allmählich immer mehr wie ein Gefängnis und nicht wie ein Büro vor.
»Ertappt.« Mit seinem glatten, blonden Haarschopf und der Nickelbrille glich Cullen mehr einem Schuljungen als einem Detective Sergeant. Aber in dem Jahr, das vergangen war, seit Kincaids frühere Partnerin bei der Mordkommission, Gemma James, zum Detective Inspector befördert und zur Metropolitan Police versetzt worden war, hatte er gelernt, gut mit Cullen zusammenzuarbeiten, und er respektierte die Intelligenz und die verbissene Beharrlichkeit, mit der sein jüngerer Kollege an Probleme heranging.
Gewiss, weder Cullen noch irgendwer sonst konnte ihm Gemma als Partnerin wirklich ersetzen. Und obwohl er und Gemma seit Weihnachten letzten Jahres zusammenwohnten, musste er feststellen, dass sie ihm bei der Arbeit immer noch fehlte.
Er warf einen Blick aus dem Fenster und war sehr versucht, mit Cullen zu gehen und eine Pause zu machen, doch der Aktenstapel auf seinem Schreibtisch sprach dagegen. Außerdem hatte sich der Himmel merklich verdüstert, seit er ins Büro gekommen war, und er hatte keine Lust, in einen Regenguss zu geraten. »Okay«, sagte er und unterdrückte einen Seufzer. »Einen Kaffee. Aber wirklich nur Kaffee, bitte, und nicht dieses neumodische Latte-Zeug.«
Cullen grinste und salutierte ironisch. »Alles klar, Boss. Bin gleich wieder da.«
Es war ein schlechtes Zeichen, dachte Kincaid, wenn einem selbst an einem so trostlosen Morgen die Aussicht auf einen Spaziergang verlockender erschien als die Arbeit am Schreibtisch, aber Verwaltungsarbeit und Berichte waren noch nie seine Stärke gewesen. Dabei war es nicht etwa so, dass er kein Talent dafür hatte; es fehlte ihm einfach nur an der nötigen Geduld. Er war nicht zur Polizei gegangen, um in der Verwaltung zu verstauben, und doch schien das zunehmend die Realität zu sein. Und er war an einem Punkt in seiner Laufbahn angelangt, an dem er sich mehr und mehr gedrängt fühlte, auf eine Beförderung hinzuarbeiten – doch das würde bedeuten, dass sich seine Außendienststunden noch weiter reduzierten.
Könnte er bleiben, wo er war, und zusehen, wie Cullen und andere Kollegen mit Uniabschluss auf der Überholspur an ihm vorbeizogen, ohne dass er irgendwann verbittert wurde? Das war eine Aussicht, über die er lieber nicht zu viel nachdenken wollte, und so wandte er sich mit düsterer Miene wieder der Leistungsbeurteilung auf seinem Schreibtisch zu. Doch als im nächsten Moment sein Telefon klingelte, stürzte er sich darauf wie ein Ertrinkender auf einen Rettungsring.
Es war die Sekretärin seines Chefs, die ihn zu einer Besprechung mit dem Chief Superintendent rief. Kincaid zog seine Krawatte stramm, schnappte sich seine Jacke vom Haken und war im nächsten Moment schon zur Tür hinaus, nicht ohne einen Anflug von Bedauern wegen des entgangenen Kaffees.
Chief Superintendent Denis Childs hatte erst kürzlich ein neues Büro bezogen und blickte jetzt aus seinem Fenster auf grüne Parks und den Fluss hinab, doch trotz seiner gehobenen Position hatte er sich seine buddhahafte Gelassenheit bewahrt. Sein rundes, fleischiges Gesicht verriet kaum Gefühlsregungen, aber Kincaid hatte gelernt, auch das leiseste Zucken in den tiefen braunen Augen zu deuten, die fast gänzlich zwischen Hautfalten verborgen waren. Heute entdeckte er darin Abbitte, Verärgerung und möglicherweise eine Spur Besorgnis.
»Tut mir Leid, Ihnen das aufs Auge drücken zu müssen, Duncan«, sagte Childs, dessen Stimme für einen Mann seiner Statur überraschend sanft war.
Kein sehr vielversprechender Auftakt, dachte Kincaid, während er es sich auf einem Stuhl bequem machte. Vielleicht wäre er doch besser bei seinem Papierkram geblieben. »Aber?«
»Aber da Sie im Moment nichts Dringendes zu erledigen haben und da Sie die Gabe haben, erregte Gemüter zu besänftigen …« – Childs’ Lippen verzogen sich zu einem angedeuteten Lächeln -, »scheinen Sie mir der richtige Mann für diese Aufgabe.«
»Das wird mir nicht gefallen, habe ich Recht?«
»Sie können es als Herausforderung an Ihre diplomatischen Fähigkeiten betrachten. Es wird bedeuten, dass Sie als Verbindungsmann zwischen dem Team der Brandermittlung und der Kripo Southwark fungieren müssen. Heute in den frühen Morgenstunden ist in einem Lagerhaus in der Southwark Street ein Feuer ausgebrochen. Kennen Sie die?«
»Die Southwark Street? Das ist nicht weit von der U-Bahn-Station London Bridge Station, nicht wahr? Aber warum wollen Sie mich dorthin schicken?«
»Geduld, mein Freund, Geduld. Dazu komme ich gleich.« Childs lehnte sich in seinem Sessel zurück und presste die Fingerspitzen beider Hände gegeneinander, eine vertraute Geste. »Das Gebäude, um das es geht, stammt aus der Viktorianischen Zeit und wurde gerade zu einer Luxuswohnanlage umgebaut. Das Feuer ist offensichtlich im Erdgeschoss ausgebrochen, doch als die Feuerwehr eintraf, hatte es schon beträchtlichen Schaden in den oberen Stockwerken angerichtet und drohte auf das angrenzende Gebäude überzugreifen.«
»Das Lagerhaus war also leer, nehme ich an, da ja die Renovierungsarbeiten schon im Gang waren?«
»Nicht ganz. Als die Feuerwehrleute hineingingen, stießen sie in den Trümmern auf eine Leiche. Ziemlich übel verbrannt, fürchte ich. Und ohne Papiere.«
»Ein Obdachloser, der dort geraucht hat …«
»Durchaus möglich, obwohl Obdachlose gewöhnlich nicht nackt und ohne jegliche persönlichen Gegenstände aufgefunden werden. Und es wird noch ein bisschen komplizierter. Besagtes Gebäude gehört nämlich rein zufällig einem unserer prominenteren Parlamentsabgeordneten, Michael Yarwood.«
»Yarwood?« Kincaid richtete sich überrascht in seinem Stuhl auf. »Ich wusste gar nicht, dass Yarwood unter die Bauunternehmer gegangen ist.« Yarwood, der nie ein Blatt vor den Mund nahm und für seine beißende Kritik bekannt war, stand weit links von der gemäßigten Linie der regierenden Labour Party und geißelte gerne öffentlich jeden, der kapitalistisch genug war, einen Profit zu erwirtschaften. »Das dürfte ziemlich unangenehm für ihn werden, nehme ich an? Und für die Presse wird es ein gefundenes Fressen sein.«
»Das ist noch eine Untertreibung. Es wäre wohl zutreffender, von einer totalen Image-Katastrophe zu sprechen, insbesondere, da eine wichtige Nachwahl ansteht. Ganz zu schweigen von den Versicherungsgutachtern, die schon in den Trümmern herumschnüffeln und Bemerkungen über einen möglichen Versicherungsbetrug fallen lassen. Und auch aus einer anderen Ecke sind mir Gerüchte zu Ohren gekommen – einer meiner Golfpartner, der im Immobiliengeschäft ist, meinte, Yarwood habe weit weniger Interessenten für seine Apartments finden können, als er zu diesem Zeitpunkt bereits erwartet hatte.«
»Autsch.« Kincaid verzog das Gesicht. »Da hat er wohl einen ziemlich kostspieligen Klotz am Bein – oder vielmehr, er hatte ihn am Bein, bis letzte Nacht.«
»Würde er natürlich nie zugeben. Aber die Mächtigen im Lande sind offenbar so beunruhigt, dass der stellvertretende Polizeichef sogar schon einen Anruf aus der Downing Street Nr. 10 erhalten hat – mit der Bitte um einen Gefallen.«
»Und da komme ich dann ins Spiel?«, fragte Kincaid, dem allmählich ein Licht aufging.
»Angeblich wollen sie nur sichergehen, dass den Ermittlungen hohe Priorität eingeräumt wird …«
»Was im Klartext heißt, dass sie Yarwoods Interessen gut vertreten wissen wollen.« Kincaid wog die Aussicht, einen politisch so heiklen Fall zu übernehmen, gegen die einer Rückkehr zu seinen Leistungsbeurteilungen ab. Durchaus möglich, dass er sich bei dem Job die Finger verbrennen würde, sowohl im wörtlichen als auch im übertragenen Sinn. Er konnte selbstgef ällige Politiker nicht ausstehen, und Orte, an denen es gebrannt hatte, waren ihm schon immer ein bisschen unheimlich gewesen.
»Sie können selbstverständlich ablehnen«, sagte Childs mit jener trügerischen Großzügigkeit, die Kincaid so gut kannte. Childs wollte, dass er die Ermittlungen übernahm, das war klar; aber er wusste auch, dass Kincaid ein paar Bonuspunkte beim stellvertretenden Polizeichef gut gebrauchen konnte.
»Ist die Leiche noch am Tatort?«, fragte Kincaid.
Childs gestattete sich wieder ein klitzekleines Lächeln. »Ich habe ihnen gesagt, dass sie auf Sie warten sollen.«
2
»Aber er mag mich hier in meinem Gefängnis ansehen. Ich leide, ohne zu murren, weil es bestimmt ist, dass ich so meine Sünden sühnen soll.«
Charles Dickens, Klein Dorrit
Reverend Winifred Catesby Montfort fand es schwieriger als erwartet, sich an das Leben in London zu gewöhnen. Nach einigen Jahren in ihrer beschaulichen kleinen Kirche vor den Toren von Glastonbury schien ihr Südlondon mit seinem Beton und seinem Schmutz wie eine Wüstenlandschaft, zumal für eine Seele, die sich nach dem sanften Grün der Somerset Levels sehnte.
Aber ihr Exil war ja nur von begrenzter Dauer, wie sie sich wohl zum hundertsten Mal sagte, als sie mit schwindender Hoffnung in den fremden Schränken der Pfarrwohnung von St. Peter nach etwas Essbarem für ihr Mittagsmahl stöberte. Und sie rief sich auch ins Gedächtnis, dass sie dieses Exil selbst gewollt hatte und somit gar keinen Grund zur Klage hatte. Als das Asthma ihrer alten Freundin und Mentorin aus dem Theologischen Seminar, Roberta Smith, so schlimm geworden war, dass ihre Ärztin ihr verordnet hatte, die Stadt für einige Monate zu verlassen, hatte Winnie vorgeschlagen, dass sie für eine Weile die Pfarrbezirke tauschten.
Zu dem Zeitpunkt war es ihr als die einzig richtige Entscheidung erschienen; so, als ob Gott ihr eine offensichtliche Gelegenheit eröffnet hätte, die sie einfach nicht ausschlagen konnte; aber inzwischen fragte sie sich, ob es nicht bloß ihr Ego gewesen war, das sich auf die Chance gestürzt hatte, als Samariterin aufzutreten – Sankt Winnie, die Retterin in der Not. Und so hatte sie ihren Mann – mit dem sie noch kein Jahr verheiratet war – ebenso zurückgelassen wie alle anderen im Haus und in ihrer Gemeinde, die auf sie angewiesen waren, um sich dem Dienst an jenen zu widmen, die sie für die armen, geknechteten Massen hielt. Stattdessen hatte sie eine relativ wohlhabende und mehr oder weniger gleichgültige Gemeinde vorgefunden, die gleiche Abfolge bürokratischer Termine, die sie gerade hinter sich gelassen hatte, und dazu Anfälle von Heimweh und Sehnsucht nach Jack, die sie quälten wie ein Phantomschmerz.
Nun, es blieb ihr nichts anderes übrig, als die Suppe auszulöffeln, die sie sich eingebrockt hatte, schalt sie sich, während sie eine Dose Thunfisch aus dem hintersten Winkel des Küchenschranks hervorkramte und einen kritischen Blick auf das Haltbarkeitsdatum warf. Ein Zuviel an Selbsterforschung war ebenso egozentrisch wie unergiebig – und ihre neue Lage hatte schließlich auch ihre guten Seiten.
Die Pfarrwohnung in der Mitre Road, gegenüber der St. Peter’s Church, war klein und gemütlich, voll gestopft mit bunten Wandteppichen und Kunstgegenständen, die Roberta auf ihren Afrika- und Asienreisen gesammelt hatte. Die Southwark Cathedral war nur einen Katzensprung entfernt, und Winnie fand es ebenso faszinierend wie bewegend, fast täglich am Leben der großen Kathedrale teilzuhaben.
Dann gab es den Borough Market, dessen Buden sich an die Flanke der Kathedrale schmiegten und der mit seinem bunten, lebhaften Treiben eine unerschöpfliche Quelle kulinarischer und anderer sinnlicher Freuden war. Wann immer Jack das Wochenende in London verbringen konnte, führte ihr erster Weg sie zum Markt.
Und inzwischen hatte sie ja auch Verwandtschaft in London – Jacks Cousin Duncan und dessen Lebensgefährtin Gemma mit ihren beiden Jungen. Wobei Winnie mit dem Eifer der frisch Vermählten immer noch hoffte, die beiden dazu ermutigen zu können, den gleichen Schritt zu wagen. Sie wusste natürlich um die Gefahren einer solchen Einmischung, aber sie wusste auch, dass manchmal ein offenes Ohr und der eine oder andere dezente Wink genügten, um die Dinge in Bewegung zu setzen.
Und schließlich waren da die Menschen in ihrer Gemeinde, die sie allmählich immer besser kennen lernte und ins Herz zu schließen begann. Eine, die es ihr besonders angetan hatte, war ihre Nachbarin Frances Liu, eine Frau in Winnies Alter, die vor einigen Jahren an dem rätselhaften, den ganzen Organismus schwächenden Guillain-Barré-Syndrom erkrankt war. Da Fanny bereits teilweise gelähmt und somit ans Haus gefesselt war, hatte Winnie es sich rasch zur Gewohnheit gemacht, so oft es ging, nach der Arbeit bei ihr vorbeizuschauen und ihr sonntags die Kommunion zu bringen.
Bei den letztgenannten Gelegenheiten spürte Winnie die Ablehnung von Fannys Mitbewohnerin Elaine, doch sie hatte noch nicht herausgefunden, ob die Feindseligkeit der Frau persönliche oder weltanschauliche Gründe hatte. Auch war sie noch nicht dahinter gekommen, welcher Art die Beziehung zwischen den beiden Frauen genau war; sie spürte lediglich, dass Elaine ihre Anwesenheit als Bedrohung empfand und dass sie deshalb sehr behutsam vorgehen musste. Auf keinen Fall wollte Winnie Fanny das Leben noch schwerer machen, als es für sie ohnehin schon war. Wenn sie nur mehr über Elaine wüsste, wäre sie vielleicht in der Lage, sie zum Reden zu bringen – und dann war da noch Elaines ungewöhnliche Ausstrahlung, die natürlicherweise Winnies Neugier weckte.
Nachdem sie den Entschluss gefasst hatte, bei ihrer nächsten Begegnung mit den beiden Frauen ein wenig hartnäckiger zu sein, aß Winnie ihr Thunfischsandwich auf und machte sich an den Abwasch. Sie hatte gerade den Teller und die Tasse abgetrocknet, als das Telefon in der Pfarrwohnung klingelte.
»Ich habe gerade an Sie gedacht«, sagte sie, als sie Fanny Lius Stimme hörte. »Ich dachte mir, ich schaue nach der Arbeit mal rein …«
»Winnie, könnten Sie nicht gleich kommen?« Fanny klang erregt und außer Atem.
Besorgt runzelte Winnie die Stirn. »Ist alles in Ordnung bei Ihnen?«
»Ich – es ist wegen Elaine. Sie war heute Morgen nicht hier, und als ich im Krankenhaus anrief, hieß es, sie sei gar nicht zur Arbeit erschienen.«
»Sie meinen, sie war überhaupt nicht in der Wohnung?«, fragte Winnie erstaunt. »Vielleicht ist sie ja nur spazieren gegangen …«
»In aller Herrgottsfrühe, bei diesem Hundewetter – und das, wo sie sonst nie spazieren geht? Warum sollte sie das tun?« Fannys Stimme überschlug sich fast. »Und selbst wenn sie es getan hätte, warum sollte sie danach nicht nach Hause kommen und zur Arbeit gehen?«
Vielleicht hatte sie sich krank gefühlt, dachte Winnie, doch sie bezweifelte, dass die Vermutung geeignet gewesen wäre, Fannys aufsteigende Panik zu dämpfen. »Hat sie Ihnen keine Nachricht hinterlassen?«, fragte sie stattdessen.
»Ich konnte jedenfalls keine finden«, erwiderte Fanny knapp, und Winnie konnte sich lebhaft vorstellen, wie frustriert sie sein musste, mit ihrem eingeschränkten Aktionsradius als Rollstuhlfahrerin. Und dann fiel ihr ein, dass Fanny ja auch nicht im Obergeschoss nachsehen konnte. Sie musste unwillkürlich an eine junge Frau aus ihrer Gemeinde denken, die ganz überraschend an einem Aneurysma gestorben war. Was, wenn Elaine, allein in einem der oberen Zimmer, plötzlich krank geworden war, ohne jede Möglichkeit, Hilfe zu holen?
»Hören Sie, ich bin sofort bei Ihnen.« Mit dem Hörer in der einen Hand griff sie mit der anderen nach Jacke und Tasche und zwang sich zu einem unbeschwerten Ton, den ihre wahren Gefühle Lügen straften. »Aber ich vermute eher, dass sie einfach nur beschlossen hat, mal einen Tag blauzumachen. Jeder hat das ab und zu mal verdient, auch Elaine.«
»Nein«, entgegnete Fanny, die sich nicht so leicht beschwichtigen lassen wollte. Ihre Stimme klang jetzt wieder ganz gefasst. »Es ist ihr irgendetwas Schreckliches zugestoßen. Das weiß ich genau.«
Der Regen setzte ein, als sie gerade über die Waterloo Bridge fuhren. Kincaid hatte Cullen freiwillig das Steuer überlassen, und nun konnte er den Blick über die Themse genießen, wie er es jedes Mal tat, wenn er den Fluss überquerte. Flussaufwärts sah er, wie graues Wasser mit grauem Himmel verschwamm, flussabwärts war die Blackfriars Bridge von einem Regenschleier verhangen. Jenseits der Brücke lagen die Tate Modern, die Millennium Bridge, das Globe Theatre – alles Attraktionen des neuen, schicken Bankside-Viertels, das noch vor kurzem hauptsächlich aus verfallenden Hafengebäuden bestanden hatte. Die radikale Verwandlung war zum Teil dem Weitblick von Leuten wie Michael Yarwood zu verdanken.
Cullen, den er vor der Abfahrt noch schnell über den Fall informiert hatte, schien Kincaids Gedanken aufzugreifen. »Sind Sie Yarwood mal persönlich begegnet?«
»Nein, ich kenne ihn nur aus dem Fernsehen.« Yarwood war ein Mensch, den man so schnell nicht wieder vergaß – untersetzt, mit beginnender Glatze und einem zerknautschten Bulldoggen-Gesicht, schienen seine unverblümte Ausdrucksweise und seine schonungslose, direkte Art genau zu seinem Aussehen zu passen. Trotz seiner tief sitzenden Skepsis gegenüber allen Politikern musste Kincaid zugeben, dass er von diesem Mann beeindruckt und sogar ein bisschen fasziniert war.
»Wieso machen die eigentlich so ein Theater, nur weil er sich ein paar Kröten mit einem Immobiliengeschäft dazuverdienen wollte?«, fragte Cullen, während er den Wagen sicher von der Waterloo Road in die Stamford Street steuerte.
Kincaid dachte einen Moment lang darüber nach. »Nun, er hat sich nie grundsätzlich gegen derartige Bauvorhaben ausgesprochen, aber er hat immer Projekte unterstützt, die der Gesellschaft insgesamt einen Nutzen bringen …«
»Und der Bau von Luxuswohnungen für Yuppies mit dicken Bankkonten zählt nicht dazu, wie?«, fragte Cullen mit unverhohlenem Sarkasmus.
»Na gut, die neuen Mieter bedeuten Kundschaft für die Restaurants und Geschäfte des Viertels«, antwortete Kincaid, der unwillkürlich die Rolle des Verteidigers übernahm. »Aber was passiert mit den einkommensschwächeren Bewohnern, die durch die Sanierung vertrieben werden? Ersatzwohnungen in der näheren Umgebung können sie sich nicht leisten, und dabei bilden doch genau diese Leute die Basis von Yarwoods Wahlkreis.« Yarwood entstammte just einer solchen Arbeiterfamilie aus Southwark, deren Wurzeln im Viertel viele Generationen zurückreichten.
»Na ja, ich würde ja liebend gerne meinen Beitrag zum Wirtschaftsaufschwung leisten, indem ich eine seiner Wohnungen miete – wenn ich es mir nur leisten könnte.« Cullens Stimme hatte einen bitteren Unterton angenommen. Kincaid wusste, wie sehr sein Sergeant seine triste Wohnung in Euston hasste, und er hegte den Verdacht, dass Cullens Freundin Stella Fairchild-Priestly – betucht und in besseren Kreisen zu Hause – auch Freunde mit Wohnungen in Southwark oder der Bankside hatte.
»Übrigens, wie geht’s eigentlich Stella?«, fragte Kincaid.
Cullen warf ihm einen fragenden Blick zu, offenbar überrascht über den scheinbar unmotivierten Themenwechsel, doch er antwortete bereitwillig. »Absolut unerträglich. Sie ist gerade befördert worden.«
Kincaid wusste, dass Stella, die als Einkäuferin für ein Einrichtungshaus der gehobenen Kategorie arbeitete, sich nur dann mit Cullens Berufswahl einverstanden erklären würde, wenn er plötzlich und wundersamerweise zum Polizeipräsidenten befördert würde, und er fürchtete, dass ihre Ungeduld nur weiter wachsen würde, je höher sie selbst auf der Karriereleiter kletterte. »Na, dann darf man ihr ja gratulieren«, sagte er zu Cullen. Seine Bedenken behielt er wohlweislich für sich. »Wir müssen euch bald mal zu uns einladen, um darauf anzustoßen«, fügte er aufgeräumt hinzu, obwohl er wusste, dass Gemma von dem Plan ebenso begeistert sein würde wie von der Aussicht auf eine Wurzelbehandlung. Zwar verstand sie sich recht gut mit Cullen, doch ihre wenigen bisherigen Begegnungen mit Stella waren nicht gerade von Erfolg gekrönt gewesen.
Der Verkehr wurde immer dichter, je weiter sie sich der Blackfriars Road näherten, und als sie in die Southwark Street einbogen, kamen sie nur noch im Schritttempo voran. »Anscheinend haben sie die Gegend immer noch teilweise abgesperrt«, sagte Cullen.
Weiter vorne konnte Kincaid schon das Rot der Feuerwehrfahrzeuge und das Blaulicht der Streifenwagen der Metropolitan Police ausmachen. Hinter dem Löschwagen stand ein Versorgungsfahrzeug der Feuerwehr. »Mist, alles zugeparkt«, brummte Cullen.
»Dann müssen Sie sich eben selber einen Parkplatz schaffen, nicht wahr, Dougie?«
Cullen sah Kincaid grinsend von der Seite an und lenkte den Astra an den Straßenrand, halb auf die doppelte gelbe Linie und halb auf den Gehsteig. Als ein uniformierter Constable auf sie zugetrabt kam, um sie zu verscheuchen, hielt Cullen seine Dienstmarke an die Scheibe.
Kincaid registrierte erleichtert, dass der Regen sich in der Zwischenzeit auf ein leichtes Nieseln reduziert hatte. Er ließ den Schirm liegen und schlug lediglich den Kragen seines Trenchcoats hoch, bevor er ausstieg.
Mit dem ersten Atemzug schlug ihm deutlich der Brandgeruch entgegen; das bittere Aroma von verkohltem Holz mischte sich in seinem Mund mit dem dunklen Ton nasser Asche. Zur Rechten erhob sich das, was von Michael Yarwoods viktorianischem Lagerhaus übrig geblieben war. Er erkannte das Gebäude sofort wieder; es war ihm wegen seiner harmonischen Architektur schon öfter im Vorbeifahren aufgefallen.
Es war vier Stockwerke hoch und aus schlichtem graubraunem Backstein erbaut, zu dem die elegant geschwungenen Bögen der großen Fenster einen interessanten Kontrast bildeten. Die Ecken und Kanten waren durch leichte Rundungen abgemildert, die dunkle Fassade mittels eingestreuter cremefarbener Steine um die Fenster und am Dach entlang wirkungsvoll aufgehellt.
Jetzt war das Dach eingefallen, und die Eingangstür hing schief in den Angeln. Die zerbrochenen Fenster starrten wie blinde Augen; an der Vorderseite waren sie von schwarzen Rauchspuren umringt. Ein Feuerwehrmann mit Helm und Schutzjacke stocherte in den Glasscherben und schwelenden Trümmerteilen herum, mit denen die Straße vor dem Haus übersät war. Vom Löschfahrzeug schlängelten sich noch die Schläuche in das ausgebrannte Gebäude hinein, ebenso wie Kabel aus dem Versorgungs-Lkw.
Das Haus und die unmittelbare Umgebung waren abgesperrt. Dahinter drängten sich die Schaulustigen, von denen sich einige durch ihre Notizblöcke und Kameras als Journalisten verrieten. Auch ein Übertragungswagen des Fernsehens harrte noch aus; vermutlich wartete die Crew auf den Abtransport der Leiche und ein Statement der Polizei.
Nun, sie konnten auch noch ein wenig länger warten, aber irgendwann würde er sich ihnen stellen müssen. Es gehörte nun einmal zu den Aufgaben eines leitenden Kriminalinspektors, die Fragen der Journalisten zu beantworten, aber Kincaid konnte sich durchaus Angenehmeres vorstellen. Er verschwendete einen kurzen Gedanken an die Krawatte, die er sich heute Morgen umgebunden hatte – ein grell gemustertes Liberty-Modell, das ihm Gemmas Mutter letztes Jahr zu Weihnachten geschenkt hatte -, dann zuckte er mit den Achseln und schmunzelte still vor sich hin. Vielleicht würde er ja einen neuen Modetrend setzen.
Als sie sich dem Eingang des Lagerhauses näherten, erblickte Kincaid einen Mann in Feuerwehruniform mit einem Schäferhund an seiner Seite. Neben ihm stand ein groß gewachsener Mann mit einer Feuerwehrjacke, die er über seinen Zivilkleidern trug, sowie eine Frau mit einem Kostüm und einem hellbraunen Wollmantel. Den großen Mann ordnete Kincaid als Mitglied der Brandermittlung ein, und irgendetwas am Gebaren der Frau trug den unverkennbaren Stempel mit der Aufschrift »Kripo«. Die Körperhaltungen der drei verrieten eine gewisse Anspannung, als ob sie sich gerade gestritten hätten.
»Sie sind der Mann von Scotland Yard, schätze ich mal«, sagte der große Mann, indem er sich mit einem Ausdruck der Erleichterung zu Kincaid und Cullen umwandte.
Kincaid stellte sich vor. »Und Sie sind …«
»Brandmeister Farrell von der Brandermittlung Südost«, bestätigte der Angesprochene Kincaids Vermutung. Er hatte lichtes Haupthaar und einen Vollbart; sein gefurchtes Gesicht wirkte intelligent, und die Augen schienen permanent zu Schlitzen zusammengekniffen, als ob er zu viele Stunden damit zugebracht hätte, über winzigen Beweisstücken zu brüten. »Ich habe gerade zu Inspector Bell gesagt, dass wir mit der Tatortbegehung warten wollen, bis Sie da sind – je weniger da drin durcheinander gebracht wird, desto besser. Mein Team und die Pathologin vom Innenministerium dürften jeden Moment eintreffen.«
Die Frau nickte ihnen zu, machte aber keinerlei Anstalten, die Hände aus den Manteltaschen zu nehmen. »Maura Bell, Kripo Southwark.« Sie hatte einen ganz leichten schottischen Akzent – Glasgow, genauer gesagt – und war schätzungsweise Mitte dreißig, mit dunklen Haaren und einem schmalen, scharfkantigen Gesicht. Ihre Miene war alles andere als freundlich. »Ich bin gebeten worden, Ihnen bei der Koordination der lokalen Ermittlungen behilflich zu sein. Wir werden in der Polizeidirektion Southwark eine provisorische Einsatzzentrale für Sie einrichten.«
Die Originalausgabe erschien 2004 unter dem Titel »In a Dark House« bei William Morrow, New York, an imprint of HarperCollins Publishers.
Umwelthinweis:Alle bedruckten Materialien dieses Taschenbuches sind chlorfrei und umweltschonend.
1. Auflage Deutsche Erstausgabe August 2005 Copyright © der Originalausgabe 2004 by Deborah Crombie
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2005 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der
Verlagsgruppe Random House GmbH Published by Arrangement with Deborah Crombie Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30827 Garbsen Umschlagfoto: Getty Images/Eden Titelnummer: 45870 Redaktion: Claudia Fink BH · Herstellung: Sebastian Strohmaier
eISBN : 978-3-641-03818-2V002
www.goldmann-verlag.de
www.randomhouse.de