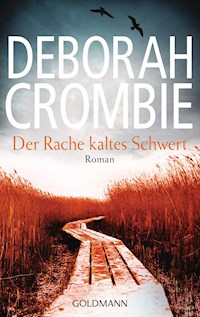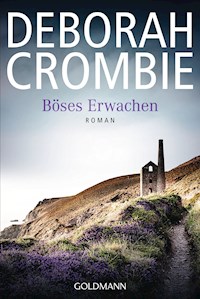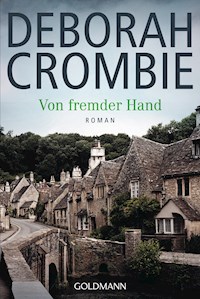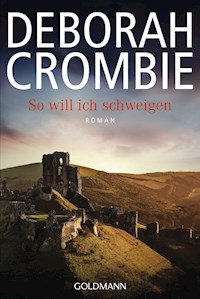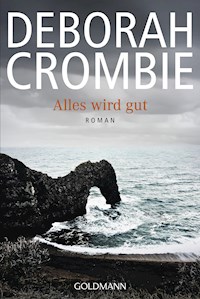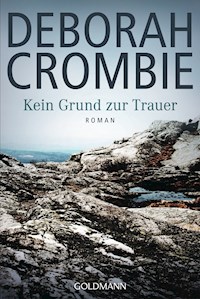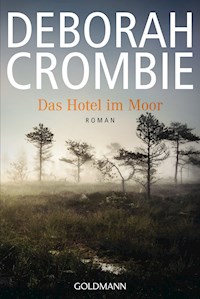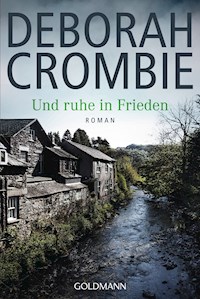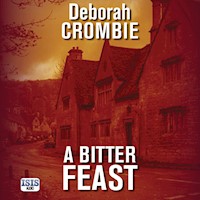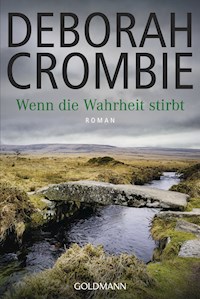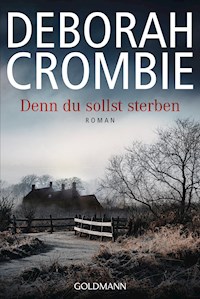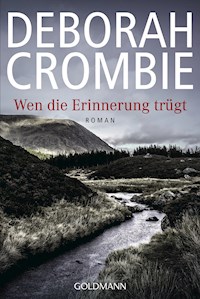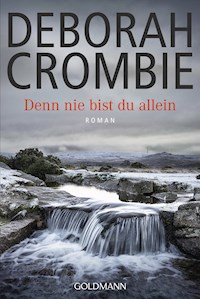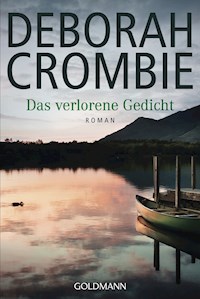
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Kincaid-James-Romane
- Sprache: Deutsch
Was steckt hinter dem Selbstmord der Lyrikerin Lydia Broke?
Fünf Jahre nach dem Tod der Autorin wird Inspektor Duncan Kincaid wider seinen Willen in neue Nachforschungen verwickelt. Denn seine Ex-Frau Vic, Englischdozentin in Cambridge, glaubt fest an Mord und bittet ihn um Beistand.
Als sie wenig später selbst umgebracht wird, verwandelt sich das ganze für Kincaid in einen Fall von höchst persönlichem Interesse...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 575
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Buch
Superintendent Duncan Kincaid ist nicht gerade begeistert, als seine Exfrau sich aus heiterem Himmel bei ihm meldet und ihn um Hilfe bittet. Seit ihrer Scheidung vor zwölf Jahren hatte er kaum Kontakt mit Vic, die inzwischen Dozentin am Lehrstuhl für englische Literatur in Cambridge ist. Und nun stieß sie durch ihre Arbeit auf eine seltsame Geschichte: Bei Nachforschungen für ein Buch über die Lyrikerin Lydia Brooke, die vor fünf Jahren starb, entdeckte Vic Ungereimtheiten und hofft nun, Duncan könne ihr weiterhelfen. Denn es sieht so aus als hätte Lydia keineswegs Selbstmord begangen, wie bislang angenommen wurde.
Autor
Deborah Crombies höchst erfolgreiche Romane um das Scotland-Yard-Paar Duncan Kincaid und Gemma James wurden für den »Agatha Award«, den »Macavity Award« und den »Edgar Award« nominiert. Die Autorin wohnt mit ihrer Familie im Norden von Texas.
Deborah Crombie
Das verlorene Gedicht
Roman
Deutsch von Christine Frauendorf-Mössel
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Die Originalausgabe von »Das verlorene Gedicht« erschien unter dem Titel »Dreaming of the Bones« bei Scribner, New York
Copyright © der Originalausgabe 1997 by Deborah Crombie
Copyright © 2008 der deutschsprachigen Ausgabe by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München Covergestaltung: UNO Werbeagentur GmbH KA • Herstellung: sc
ISBN 978-3-641-10576-1 V006
www.goldmann-verlag.de
TEIL I
Es gibt vier Formen, die Lebensgeschichte einer Frau zu schreiben: Die Betreffende selbst schildert diese in einer so benannten Autobiographie; sie erzählt sie nach Gutdünken in Romanform; ein Biograph oder eine Biographin zeichnen diese Lebensgeschichte in einer Biographie nach; oder die Betreffende schreibt ihr Leben im voraus auf, noch bevor sie es gelebt hat, sozusagen unbewußt, ohne den Vorgang als solchen zu erkennen oder gar zu benennen.
CAROLYN HEILBRUN aus: ›Darstellung eines Frauenlebens‹
1
Wo Schönheit zu Schönheit kommt, nackt und rein,
ist die Erde süß von Tränen, und flirrend klar die Luft,
die wirbelnd, schwindelnd dich erfaßt, mit leisem, trunkenem Lachen;
und alles verschleiert, das kommen mag, später … später
RUPERT BROOKE aus: ›Schönheit zu Schönheit‹
Die Post glitt durch den Briefschlitz, ergoß sich auf den Fliesenboden des Flurs mit einem Rascheln wie Wind im Bambuswald. Lydia Brooke hörte das Geräusch im Frühstückszimmer. Sie hielt die Tasse mit beiden Händen. Der Tee war längst kalt geworden, doch sie blieb sitzen, unfähig, sich zwischen den nichtigen Tätigkeiten zu entscheiden, die ihren Tagesablauf bestimmen sollten.
Durch die gläserne Flügeltür am anderen Ende des Raumes konnte sie die Buchfinken beobachten, die unter den gelben Kaskaden der Forsythien auf der Erde pickten, und versuchte stumm, das Bild in Worte umzusetzen. Für sie eine Gewohnheit, fast so selbstverständlich wie das Atmen: die Suche nach Sprachbild, Metrum, Rhythmus. Aber an diesem Morgen wollte es nicht gelingen. Sie schloß die Augen und hob ihr Gesicht der schwachen Märzsonne entgegen, die schräg durch die hochliegenden Fenster des Zimmers mit der gewölbten Decke fiel.
Morgan und sie hatten sein kleines Erbe dazu benutzt, diesen Küchen- und Eßtrakt an das viktorianische Reihenhaus anzubauen. Er ragte in den rückwärtigen Garten hinein, bestand ganz aus Glas, klaren Linien und hellem Holz, ein Monument gescheiterter Hoffnungen. Ihre Pläne für die Modernisierung des restlichen Hauses waren irgendwie in der Realität untergegangen. Die Wasserleitungen leckten noch immer, die Tapete mit dem Rosenmuster löste sich von den Dielenwänden, die Risse im Verputz platzten auf wie brüchige Adern, die Heizung zischte und rumpelte wie ein unterirdisches Ungeheuer. Lydia hatte sich an die Mängel gewöhnt, hatte einen fast bizarren Trost darin gefunden. Das alles bedeutete, daß sie klarkam, daß sie sich arrangiert hatte, und das war es schließlich und endlich, was von einem erwartet wurde, auch wenn jeder bevorstehende Tag wie eine trostlose Wüste vor ihr lag.
Sie schob ihre Tasse mit dem kalten Tee von sich und stand auf, zog den Gürtel ihres Bademantels enger um ihre schmale Taille und lief barfuß zum vorderen Teil des Hauses. Die Fliesen unter ihren nackten Fußsohlen waren sandig, und sie zog die Zehen ein, als sie in die Hocke ging, um die Post aufzuheben. Ein Umschlag wog den gesamten Rest auf. Das förmliche braune Kuvert trug den Absender ihres Anwalts. Sie warf die übrigen Briefe in den Korb auf dem Dielentisch und fuhr mit dem Daumen unter die Lasche des Umschlags, um ihn zu öffnen.
Von der Hülle befreit, glitt die dicke Urkunde in ihre Hand, und ihr Blick fiel automatisch auf die Worte ›In der Scheidungssache Lydia Lovelace Brooke Ashby gegen Morgan Gabriel Ashby …‹ Sie erreichte den unteren Treppenabsatz und hielt inne, während ihr Gehirn eine Formulierung aus dem juristischen Kauderwelsch herauspickte … Scheidungsantrag am heutigen Tag stattgegeben … Die Seiten entglitten ihren gefühllosen Fingern, und es schien ihr, als segelten sie zu Boden wie Federn im Wind.
Sie hatte gewußt, daß es kommen würde, hatte sich gewappnet geglaubt. Jetzt erkannte sie mit niederschmetternder Klarheit, wie hohl und heuchlerisch ihre Tapferkeit gewesen war – die Schale der Akzeptanz so dünn wie der Algenfilm auf einem Weiher.
Nach endlosen Augenblicken begann sie langsam, mühsam die Treppe hinaufzusteigen, und ihre Waden und Oberschenkel schmerzten unter der Last jedes Schritts. Im ersten Stock stützte sie sich wie betrunken an der Wand ab und ging ins Badezimmer.
Sie fröstelte und atmete flach. Sie machte die Tür hinter sich zu und schloß ab. Jede Bewegung erforderte besondere Konzentration; ihre Hände schienen seltsam losgelöst von ihrem Körper. Als nächstes kamen die Wasserhähne; sie stellte die Temperatur mit derselben Sorgfalt ein wie immer. Lauwarm – sie hatte irgendwo gelesen, daß das Wasser lauwarm sein sollte. Und natürlich gab sie Badesalz hinein. Auf diese Weise war das Wasser salzig, warm und samtig wie Blut.
Zufrieden stand sie einen Augenblick da. Die dunkelblaue Seide ihres Morgenmantels glitt zu Boden. Sie stieg ins Wasser. Aphrodite kehrte zurück, woher sie gekommen war, das Rasiermesser in der Hand.
Victoria McClellan nahm die Hände von der Tastatur, atmete tief durch und schüttelte sich. Was zum Teufel war gerade mit ihr geschehen? Verdammt, sie schrieb eine Biographie, keinen Roman, und sie hatte nie dergleichen selbst erlebt, geschweige denn darüber geschrieben. Trotzdem hatte sie zu spüren geglaubt, wie das Wasser über ihre Haut schwappte, hatte die Magie des Schreckens gefühlt, die vom Rasiermesser ausging.
Sie erschauderte. Natürlich war das alles Unsinn. Die ganze Passage mußte gestrichen werden. Sie strotzte vor Spekulationen und Mutmaßungen. Objektivitätsverlust war für eine Biographie fatal. Hastig markierte sie den Text auf ihrem Bildschirm und zögerte mit dem Finger über der Löschtaste…Vielleicht trat unter dem entlarvenden Licht des Morgens doch noch etwas Brauchbares zutage. Sie rieb sich die brennenden Augen, versuchte den Blick auf die Uhr über ihrem Schreibtisch zu konzentrieren. Beinahe Mitternacht. Die Zentralheizung ihres zugigen Cottages in Cambridgeshire hatte sich schon vor einer Stunde ausgeschaltet, und sie merkte plötzlich, daß sie fror. Sie bewegte die steifen Finger, sah sich um und suchte Trost in der Vertrautheit ihrer Umgebung.
Das kleine Zimmer quoll über von dem Treibgut, das von Lydia Brookes Leben zurückgeblieben war. Und Vic, von Natur aus ordentlich, fühlte sich gelegentlich machtlos angesichts der Flut von Papieren, Briefen, Journalen, Fotografien, Manuskriptfragmenten und ihren eigenen Karteikarten. All das schien sich jeder Ordnung zu widersetzen. Eine Biographie war zwangsläufig ein Abenteuer. Dabei war ihr Lydia Brooke als die ideale Persönlichkeit für eine Biographie vorgekommen, und das Thema schien perfekt dazu angetan, Vics Position an der Englischen Fakultät zu festigen. Die Lyrikerin Brooke mit dem chaotischen Privatleben, geprägt von komplizierten Beziehungen und etlichen Selbstmordversuchen, hatte die Episode in der Badewanne in den späten sechziger Jahren gut zwei Jahrzehnte überlebt. Dann, nachdem sie die Arbeit an ihrer besten Gedichtsammlung beendet hatte, war sie völlig überraschend an einer Überdosis ihres Herzmedikaments gestorben.
Der Tatsache, daß Lydia Brookes Tod nur fünf Jahre zurücklag, verdankte Vic den Umstand, daß sie Kontakt zu Lydias Freunden und Kollegen aufnehmen und sämtliche erhaltene Manuskripte und Unterlagen einsehen konnte. Womit sie allerdings nicht gerechnet hatte, war, daß im Laufe ihrer Arbeit Lydia Brooke zu neuem Leben erwachen würde. Sie hatte Lydias Haus besucht – das Morgan Ashby, ihr Ex-Mann, geerbt und an einen Arzt mit Frau und vier kleinen Kindern vermietet hatte. Trotz Legosteinen und Schaukelpferden atmete es für Vic noch immer jene Atmosphäre, die sie mit Lydia Brooke verband. Aber selbst dieses seltsame Phänomen konnte nicht ihre Faszination erklären, die einer Besessenheit von dem Thema gefährlich nahe kam.
Lydia Lovelace Brooke Ashby … wiederholte Vic stumm und fügte mit einem ironischen Lächeln ihren eigenen Namen hinzu: Victoria Potts Kincaid McClellan. Das allerdings klang bei weitem nicht so poetisch. In den letzten Jahren hatte sie kaum über ihre eigene Scheidung nachgedacht – aber möglicherweise waren ihre Eheprobleme der jüngsten Zeit daran schuld, daß sie sich so sehr mit Lydias schmerzlichen Erfahrungen identifizierte. Eheprobleme! Ist ja lächerlich … dachte sie wütend. Welchen Sinn hatte es, die Sache zu beschönigen? Sie war verlassen und verraten worden, genau wie Lydia von Morgan Ashby verlassen worden war. Dabei hatte Lydia damals wenigstens gewußt, wo Morgan sich aufhielt. Außerdem hatte Lydia kein Kind gehabt, auf das sie hätte Rücksicht nehmen müssen, ergänzte Vic stumm, als sie das Knarren von Kits Schlafzimmertür hörte.
»Mammi!« rief er leise von der Treppe herab. Seit Ian verschwunden war, hatte Kit angefangen, sie zu kontrollieren, so als habe er Angst, daß auch sie sich eines Tages einfach in Luft auflösen könne. Außerdem litt er unter Alpträumen. Sie hatte ihn im Schlaf jammern gehört, aber auf ihre Fragen am Morgen hatte er nur eigensinnig und stolz geschwiegen.
»Komme gleich rauf! Leg dich wieder ins Bett, Schatz.« Das alte Haus ächzte unter seinen Schritten und schien dann erneut in einen unruhigen Schlaf zu sinken. Mit einem Seufzer wandte Vic sich wieder dem Computer zu und strich sich das Haar aus der Stirn. Wenn sie jetzt nicht Schluß machte, kam sie am nächsten Morgen nicht aus den Federn, und sie hatte eine Frühstunde an der Universität. Aber das letzte Bild von Lydia war noch frisch. Sie konnte sich nicht davon losreißen. Etwas nagte in ihr … da war etwas, das nicht zusammenpassen wollte. Und im nächsten Augenblick wurde ihr klar, was es war und was sie in diesem Punkt unternehmen mußte.
Und zwar jetzt gleich. Noch an diesem Abend. Bevor sie Angst vor der eigenen Courage bekam.
Sie zog ein Londoner Telefonbuch aus dem Regal über ihrem Schreibtisch, suchte die Nummer heraus und notierte sie. Dann griff sie mit klopfendem Herzen nach dem Hörer und wählte.
Gemma James legte den Stift nieder, bewegte die verkrampften Finger und hob die Hand an den Mund, um ein Gähnen zu unterdrücken. Sie hatte nicht damit gerechnet, den Bericht fertigzubekommen. Jetzt fiel alle Anspannung von ihr ab. Sie hatte einen anstrengenden Tag und einen komplizierten Fall hinter sich gebracht. Angenehme Zufriedenheit stellte sich ein. Sie saß mit angezogenen Beinen in der einen Ecke von Duncan Kincaids Sofa, während er das andere Ende mit Beschlag belegte. Er hatte das Jackett ausgezogen, die Krawatte gelockert, den Hemdkragen aufgeknöpft und schrieb mit ausgestreckten Beinen. Seine Fersen balancierten gefährlich kippelig auf der Kante des Couchtischs zwischen den leeren Schachteln eines chinesischen Schnellrestaurants.
Sid verteidigte, auf dem Rücken ausgestreckt, die Augen halb geschlossen, den restlichen Sofaplatz zwischen ihnen. Alles an ihm Ausdruck kätzischer Zufriedenheit. Gemma streckte die Hand aus, um den Bauch des Katers zu kraulen. Kincaid sah auf und lächelte. »Fertig, Liebes?« fragte er, und als sie nickte, stöhnte er. »Weiß auch nicht, weshalb ich mich nie kurz fassen kann. Alles nur Korinthenkackerei. Du schlägst mich immer um Längen.«
Gemma grinste. »Reine Berechnung. Ab und zu möchte ich auch mal die Nummer eins sein.« Mit einem Gähnen sah sie auf die Uhr. »Großer Gott, ist es schon so spät? Ich muß gehen.« Sie schwang die Beine auf den Boden und schlüpfte in ihre Schuhe.
Kincaid legte seine Papiere auf den Couchtisch, setzte Sid sanft auf den Boden und rutschte zu Gemma hinüber. »Sei nicht blöd. Hazel erwartet dich heute nicht mehr. Und das Mutterkreuz verdienst du auch nicht, wenn du Toby aus dem Schlaf reißt, um ihn mitten in der Nacht nach Hause zu bringen.« Mit der rechten Hand begann er Gemma den Rücken zu massieren. »Du bist wieder ganz verspannt.«
»Autsch … Mmmm … das ist nicht fair.« Gemma protestierte halbherzig, während sie ihm genüßlich ihren Rücken überließ.
»Was soll daran nicht fair sein?« Er rutschte näher, und seine Hände glitten zu ihrem Nacken. »Du kannst gleich morgen früh nach Hause fahren, um Toby Frühstück zu machen. Und bis dahin …« Das Telefon schrillte. Kincaid zuckte zusammen. Seine Hände verharrten auf Gemmas Schultern. »Verdammter Mist!«
Gemma stöhnte. »Oh, nein! Nicht schon wieder. Nicht heute abend. Das sollen andere erledigen.«
»Mach dich schon mal auf das Schlimmste gefaßt.« Mit einem Seufzer hievte Kincaid sich aus den Polstern des Sofas und ging in die Küche. Gemma hörte, wie er sich schroff mit »Kincaid!« meldete, nachdem er das schnurlose Telefon von der Basisstation genommen hatte. Dann folgte ein verwirrtes: »Ja? Hallo!«
Falsch verbunden, dachte Gemma und sank in die Polster zurück. Aber Kincaid kam ins Wohnzimmer, das Telefon am Ohr, die Stirn in Falten.
»Ja«, sagte er schließlich. »Nein, das ist schon in Ordnung. Ich war nur so überrascht. Ist schließlich lange her«, fügte er mit einem Anflug von Sarkasmus hinzu. Er trat vor die Balkontür, zog den Vorhang zurück und starrte in die Nacht hinaus, während er zuhörte. Gemma konnte seine Anspannung an seinem Rücken ablesen.«Ja, es geht mir gut. Danke. Nur … ich verstehe nicht ganz, wie ich dir helfen kann. Wenn das eine Polizeisache ist, wende dich an die örtliche …« Er hörte erneut zu. Diesmal dauerte die Pause länger. Gemma beugte sich vor. Sie war seltsam beunruhigt.
»Na gut«, sagte er schließlich, als gäbe er nach. »In Ordnung. Bleib dran.« Er kam zum Couchtisch, griff nach seinem Notizblock und schrieb etwas darauf, das Gemma nicht entziffern konnte. »Gut. Also dann bis Sonntag. Wiedersehen.« Er drückte auf die Hörertaste und starrte auf Gemma hinab, als wisse er nicht recht, wohin mit dem Telefon in seiner Hand.
Gemma konnte sich nicht länger beherrschen. »Wer war das?«
Kincaid zog eine Augenbraue hoch und grinste schief.
»Meine Ex-Frau.«
2
Ich weiß nur, daß du dort liegst
den ganzen Tag und in den Himmel über Cambridge schaust
und blumentrunken in schläfrigem Gras
auf das kühle Rinnen im Stundenglas horchst,
bis die Jahrhunderte verschmelzen und verglimmen,
in Grantchester, in Grantchester …
RUPERT BROOKE aus ›Das alte Pfarrhaus‹
Kincaid hielt sich an Vics Wegbeschreibung, verließ die M11 über die Ausfahrt kurz vor Cambridge und nahm die Grantchester Road, die vom Kreisverkehr abzweigte. Über ihm erstreckte sich der strahlende Himmel von Cambridgeshire weit bis zum Horizont. Der Aprilmorgen war ungewöhnlich mild. Kincaid hatte Gemma vergeblich zu überreden versucht mitzukommen. Statt dessen hatte sie eisern darauf beharrt, mit Toby den angeblich vereinbarten Besuch bei ihren Eltern zu absolvieren. Sie hatten ihr gemeinsames Sonntagsfrühstück eingenommen und aufgeräumt. Kincaid hatte sich an Gemmas Wohnungstür in Islington mit einem Kuß von ihr verabschiedet, ohne daß sich das Unbehagen, das plötzlich zwischen ihnen stand, verflüchtigt hatte. Aber vorerst konzentrierte er sich auf das, was Vic von ihm wollte – das erschien ihm das mindeste, das er um alter Zeiten willen tun konnte –, und er hoffte, daß die Sache damit erledigt sei.
Er fuhr langsamer, als die ersten verstreut liegenden Häuser auftauchten und die Landstraße in eine gepflegte Dorfstraße mündete. Er bog nach rechts in die High Street ein und hielt nach einem Haus auf der linken Seite Ausschau. »Du kannst es nicht verfehlen«, hatte Vic amüsiert behauptet. »Du wirst schon sehen.« Und im nächsten Augenblick begriff er den Sinn ihrer Worte. Sein Blick fiel auf ein Haus mit buntem Ziegeldach und grell rosarotem Verputz hinter einer ausladenden Rosenhecke.
Kincaid bog in die Kiesauffahrt vor der alleinstehenden Garage ein, hielt an, stieg aus, und merkte erst jetzt, daß er keine Ahnung hatte, was er zu ihr sagen sollte. Die Fahrt hatte er damit verbracht, seine Erinnerungen an Vic aufzufrischen, hatte überlegt, wie sie gewesen war, als er sie kennengelernt hatte. Ihre Reserviertheit hatte ihn damals gereizt – er hatte sie für scheu gehalten – und er hatte die Ernsthaftigkeit, mit der sie ihr Studium absolvierte, anziehend, ja sogar amüsant gefunden. »Blöder, arroganter Idiot«, schimpfte er laut, und sein Mund zuckte verächtlich. Er hatte seine selbstgefällige Einschätzung ihrer Person damit bezahlt, daß sie ihn ohne ein Wort oder eine Nachricht verlassen hatte. Jetzt waren sie Fremde, mehr denn je, und die Erinnerung an die peinliche Beziehung von damals war eher hinderlich.
Wie sehr hatte sie sich verändert? Würde er sie überhaupt wiedererkennen?
Seitlich des Hauses ging eine Tür auf, und seine Befürchtungen verflogen. Ihr Gesicht war ihm vertraut wie sein eigenes. Sie kam auf ihn zu, ihre Turnschuhe knirschten auf dem Kies, und sie nahm seine Hand so selbstverständlich, als hätten sie sich erst gestern in gegenseitigem Einvernehmen getrennt. »Duncan! Vielen Dank, daß du gekommen bist.« Sie neigte den Kopf leicht zur Seite und betrachtete ihn, ohne seine Hand loszulassen. »Du hast dich wirklich kein bißchen verändert.«
Kincaid fand nur mit Mühe seine Sprache wieder: »Du auch nicht, Vic. Du siehst großartig aus.« Sie wirkt müde, dachte er, und zu mager, vielleicht ein bißchen kränklich. Ein Netz feiner Linien umgab ihre Augen, und zwischen Nasenflügel und Mundwinkel hatten sich zwei Falten eingegraben. Ihr Haar jedoch, das sie mittlerweile nur noch auf Schulterlänge trug, war noch immer flachsblond, und wenn sie kräftigere Farben trug als die Pastelltöne, an die er sich erinnerte, verlieh ihr das eine Eleganz, die ihr stand.
»Es ist verdammt lange her«, sagte sie lächelnd. Dabei wurde ihm klar, daß er sie unverwandt angestarrt hatte.
»Entschuldige. Es ist nur … Ich weiß nicht recht, was ich sagen soll. Ich benehme mich wie ein Idiot. Gibt es bestimmte Regeln oder einen allgemein gültigen Verhaltenskodex für das Wiedersehen von geschiedenen Ehepartnern?« In die Stille zwischen ihnen drang lautes Vogelgezwitscher. Dann ertönte ein rauhes Krächzen, und eine Krähe schoß schimpfend im Sturzflug dicht an seinem Kopf vorbei.
Vic lachte. »Denken wir sie uns doch einfach selbst aus. Ich fange am besten damit an, dich ins Haus zu bitten. Dein Wagen kann hier mit offenem Verdeck erst mal stehenbleiben.«
Kincaid fiel plötzlich ein, daß der Kauf des Midget einen ihrer letzten Kräche heraufbeschworen hatte, aber Vics Blick hatte den Wagen ohne ein Zeichen des Wiedererkennens nur flüchtig gestreift.
»Komm rein«, forderte sie ihn noch einmal auf und wandte sich dem Haus zu. »Es ist so ein schöner Tag, daß ich zum Mittagessen im Garten gedeckt habe. Hoffentlich ist dir das recht.«
Er folgte ihr ins Haus und durch ein Wohnzimmer, in dem er flüchtig blaßgelbe Wände, verblichene Chintzbezüge und eine Gruppe Fotos in Silberrahmen auf einem Beistelltisch registrierte. Sie traten durch eine Glastür auf eine Terrasse hinaus. Der Garten fiel sanft vom Haus aus ab, und hinter der niedrigen Gartenmauer sah er eine Weide und eine Baumreihe, die das nahe Flußufer verriet.
»Grantchester hat seinen Namen von ›Granta‹, dem alten Namen für die Can«, erklärte Vic und deutete zum Fluß hinunter.
»Der Garten ist wunderschön.« Löwenzahn und wilder Lauch wuchsen auf dem struppigen Rasen, aber die Blumenbeete schienen frisch gejätet, und vor der niedrigen Mauer stand das Prunkstück des Gartens – ein riesiger Holzapfelbaum über und über voll rosafarbener Blüten.
Vic warf ihm einen Seitenblick zu, der ihm sehr vertraut vorkam, und deutete auf einen der Stühle an einem schmiedeeisernen Tisch. »Hier, setz dich. Dein Lob ist reichlich übertrieben. Mein Freund Nathan findet, der Garten sei eine Schande. Aber ich bin keine Gärtnerin aus Leidenschaft. Ich bin einfach nur gern draußen bei schönem Wetter und buddel dann ein bißchen in der Erde herum – meine alternative Beruhigungstablette.«
»Soweit ich mich erinnere, hat bei dir keine einzige Topfpflanze überlebt. Und kochen konntest du auch nicht«, fügte er hinzu, als sein Blick auf den Tisch fiel, der mit Käse, Salaten, Oliven, Schrotbrot und einer Flasche Weißwein gedeckt war.
Vic zuckte die Schultern. »Menschen ändern sich. Kochen kann ich allerdings immer noch nicht«, fügte sie mit entwaffnendem Lächeln hinzu. »Selbst wenn ich die Zeit dazu hätte. Aber ich kann einkaufen, und ich habe gelernt, das Beste daraus zu machen.« Sie füllte die Gläser und prostete ihm zu. »Auf den Fortschritt. Und alte Freunde.«
Freunde? dachte Kincaid. Sie waren Liebende, Feinde, Wohngenossen gewesen, aber nie Freunde. Doch vielleicht war es noch nicht zu spät. Er hob ebenfalls sein Glas und trank. Als er seinen Teller gefüllt und den Kartoffelsalat probiert hatte, wagte er einen Vorstoß: »Du hast mir noch nichts von dir erzählt – über dein Leben. Die Fotos …« Er machte eine Kopfbewegung in Richtung Wohnzimmer. Der Mann hatte hager und bärtig, der Junge blond und kräftig ausgesehen. Er warf einen verstohlenen Blick auf Vics linke Hand, sah den blassen Abdruck um ihren Ringfinger.
Sie wandte den Blick ab, trank einen Schluck Wein und konzentrierte sich darauf, ein Stück Brot mit Butter zu bestreichen. »Ich heiße jetzt Victoria McClellan. Doktor McClellan. Mitglied des All Saints’ College und Dozentin für Literatur. Die Dichter des zwanzigsten Jahrhunderts sind mein Spezialgebiet. Damit habe ich mehr Zeit für eigene Arbeiten.«
»Dozentin?« sagte Kincaid verwirrt. »Dichter?«
»Ja, an der Englischen Fakultät der Universität. Erinnerst du dich an meine Doktorarbeit über die Auswirkungen des Ersten Weltkriegs auf die englische Lyrik?« fragte Vic, und zum ersten Mal hatte ihre Stimme eine gewisse Schärfe. »Die, mit der ich mich während unserer Ehe herumgeschlagen habe?«
Kincaid gab sich redlich Mühe, den Fehler wiedergutzumachen. »Du hast also erreicht, was du wolltest. Freut mich für dich.« Als er sah, daß Vics Ärger noch nicht verraucht war, redete er schnell weiter: »Bedeuten zwei Jobs nicht mehr Arbeit anstatt weniger? Wenn ich dich richtig verstanden habe, bist du für die Universität und dein altes College tätig, oder? Wär’s nicht besser für dich, du würdest nur den einen oder den anderen Job machen?«
Vic warf ihm einen mitleidigen Blick zu. »So funktioniert das nicht. Lehrkraft an einem College zu sein ist fast Sklavenarbeit. Sie bezahlen dir ein Gehalt, und dafür mußt du tun, was sie wollen. Sie können dir soviel Arbeit aufhalsen, wie es ihnen Spaß macht, und du hast keine Handhabe. Aber wenn du einen Lehrauftrag an einer Universität hast, bist du in einer ganz anderen Position – und irgendwann kannst du deinem College sagen, sie können dich mal. Alles ganz höflich, natürlich« , fügte sie gutgelaunt hinzu.
»Und das hast du gemacht?« fragte Kincaid. »Höflich, natürlich.«
Vic trank einen Schluck Wein und lehnte sich auf ihrem Stuhl zurück. Sie wirkte plötzlich müde. »Ganz so einfach ist es nicht gewesen. Aber doch, so könnte man es ausdrücken.«
Als sie das Thema nicht weiter verfolgte, fragte Kincaid: »Und dein Mann? Ist er auch Dozent?« Er fragte das fast wie nebenbei, freundlich und unbeteiligt.
»Ian ist am Trinity College. Politische Wissenschaften. Im Augenblick hat er sich zu Studienzwecken beurlauben lassen. Er schreibt ein Buch. Über die Teilung Georgiens.« Vic legte ihr Brot auf den Teller und fing Kincaids Blick auf. »Ach, was rede ich um den heißen Brei herum. Tatsache ist, daß er das Buch über Rußland in Südfrankreich schreibt, und rein zufällig hat er sich eine Examensstudentin mitgenommen. In dem Brief, den er mir hinterlassen hat, steht, er sei wohl in der Midlife Crisis.« Sie lächelte verkrampft. »Er hat mich um Geduld gebeten.«
Zumindest hat er dir eine Nachricht hinterlassen, dachte Kincaid. »Das tut mir leid. Ist bestimmt nicht einfach für dich.«
Vic griff erneut nach ihrem Glas und aß etwas Salat. »Eigentlich nur wegen Kit. Er ist die meiste Zeit wütend auf Ian. Gelegentlich auch auf mich. Als sei es meine Schuld, daß Ian fort ist. Vielleicht stimmt es sogar … Ich weiß es nicht.«
»Hast du mich deshalb angerufen? Brauchst du Hilfe, um Ian zu finden?«
Sie lachte überrascht auf. »Hältst du mich für so frech? Hast du das wirklich gedacht?« Als er nicht antwortete, fuhr sie fort: »Entschuldige, Duncan. Diesen Eindruck wollte ich nie vermitteln. Worüber ich mit dir reden möchte, hat mit Ian überhaupt nichts zu tun.«
»Diese vermaledeite McClellan«, schimpfte Darcy Eliot, als er die Damastserviette auseinanderfaltete und sorgfältig im Schoß ausbreitete. »Als sei es nicht schon Zumutung genug, daß ich im College und in der Fakultät mit ihr auskommen muß, schneit sie gestern in meine Wohnung und belästigt mich noch privat mit unangenehmen Fragen. Hat mir scheußliche Kopfschmerzen gemacht. Kann ich dir sagen.«
Er hielt inne, schenkte sich ein Glas Wein ein, trank einen Schluck, bewegte ihn zufrieden im Mund. Der Meursault seiner Mutter war ausgezeichnet, ja beinahe so gut wie der den Professoren vorbehaltene Vorrat im All Saints College. »Wär’s nach mir gegangen, hätte sie nie eine Dozentur an der Fakultät gekriegt, aber Iris hat einen Narren an ihr gefressen. Dieser ganze verdammte …« Mehrere Gläser des exzellenten Sherrys seiner Mutter vor dem Ritual des sonntäglichen Mittagessens hatten seine Zunge gelöst, und er war drauf und dran gewesen zu sagen: »Dieser ganze verdammte Weiberhaufen an der Uni.« Erst ein Blick auf die hochgezogenen Augenbrauen seiner Mutter ließ ihn abrupt verstummen. »Ach, ist auch egal«, murmelte er hastig und versenkte seine Nase erneut im Weinglas.
»Darcy, Liebling«, begann Dame Margery Lester, während sie die Suppe austeilte, die Grace in einer Terrine auf den Tisch gestellt hatte. »Ich bin Victoria McClellan öfter bei offiziellen Anlässen begegnet und habe sie immer als sehr charmant empfunden.« Margery Lesters Stimme klang so silbern wie ihr Haar, das sie zu einem klassischen Knoten aufgesteckt trug. Obwohl sie über siebzig war, hatte ihr Sohn gelegentlich den Eindruck, sie sei nicht gealtert, sondern vielmehr in einen anderen Aggregatzustand übergegangen. Die Eigenschaften, die Margery einzigartig machten – ihr wacher Verstand, ihr Selbstbewußtsein, die Hingabe an ihr Metier –, all das schien sich in demselben Maße zu verdichten, wie ihr Körper nachließ.
An diesem Sonntag wirkte sie noch elementarer als sonst. Der Perlmuttglanz der Perlenkette auf ihrem grauen Kaschmirtwinset spiegelte sich auf ihrer Haut wider, und Darcy fragte sich, ob in ihren Adern statt Blut vielleicht doch Quecksilber floß.
»Was genau hast du eigentlich an ihr auszusetzen?« fragte Margery, als sie Darcy den Suppenteller reichte, und fügte hinzu: »Grace hat Artischockencrèmesuppe gemacht. Dir zu Ehren.«
Darcy ließ sich Zeit beim Suppekosten und schob dann verräterischerweise einen Finger zwischen Hals und Hemdkragen. Vielleicht hatte er dem Alkohol in letzter Zeit etwas zu ausgiebig zugesprochen. Jahrelang hatte seine Eitelkeit als natürliche Bremse für seine leiblichen Gelüste funktioniert. Mittlerweile war das Fleischliche drauf und dran zu obsiegen. »Du weißt, was ich von den politisch Aufrechten halte«, erwiderte er und hob den Löffel erneut an die Lippen. »Mir graust vor ihnen. Und nichts verabscheue ich mehr als feministische Biographien. Die Autorinnen bemächtigen sich irgendeines trivialen Lebenswerks und blasen es mit Freudscher heißer Luft und grandiosen feministischen Theorien so weit auf, daß du es nicht mehr wiedererkennst.«
Margerys linke Augenbraue zuckte noch ein Stück weiter in die Höhe. Das war für Darcy das Zeichen, daß er entschieden zu weit gegangen war. »Du willst doch wohl Lydias Werk nicht als trivial bezeichnen, oder?« entgegnete sie. »Und wenn man dir so zuhört, könnte man glauben, Victoria McClellan sei ein ungepflegter Blaustrumpf. Auf mich hat sie stets einen sehr vernünftigen und gut informierten Eindruck gemacht. Jedenfalls kam sie mir nicht wie jemand vor, der sich in wilden Theorien verliert.«
Darcy schnaubte verächtlich. »Oh, nein! Dr. McClellan ist alles andere als ungepflegt. Im Gegenteil, sie sieht eher wie das Model einer amerikanischen Shampoo-Reklame aus. Sie ist der Prototyp der perfekten Frau der Neunziger – brillante akademische Karriere, Parademutter und Ehefrau … Leider war sie in der Frauenrolle nicht erfolgreich genug, um ihren Mann davon abzuhalten, reihenweise seine Examensstudentinnen zu vögeln.« Er mußte unwillkürlich lächeln. Ian McClellans einziger Fehler war seine mangelhafte Diskretion.
»Darcy!« Margery schob ihren leeren Suppenteller von sich. »Das war unerzogen und gewöhnlich.«
»Also, Mutter, ich bitte dich. Das weiß doch jeder. In der Englischen Fakultät sind die pikanten Einzelheiten Tagesgespräch. Man flüstert sie sich zu, sobald die blonde Victoria außer Hörweite ist. Und ich weiß wirklich nicht, weshalb es unerzogen sein soll, die reine Wahrheit zu sagen.«
Margery preßte die Lippen aufeinander und warf ihm einen mißbilligenden Blick zu, während sie den Deckel über dem Hauptgang lüftete und die Teller zu füllen begann. Eins zu null für mich, dachte Darcy zufrieden. Margery war nicht prüde, wie die mit zunehmend plastischer Deutlichkeit geschilderten Sexszenen in ihren letzten Romanen bewiesen. Darcy vermutete, daß sie sich lediglich in der Rolle der schockierten Biederfrau gefiel.
Er seufzte zufrieden, als Margery seinen Teller vor ihm abstellte. Kalter pochierter Lachs mit Dill-Sauce, heiße neue Kartoffeln in Butter, frischer junger Spargel – er fürchtete den Tag, an dem sein Charme bei Grace versagte. »Und jetzt fehlt nur noch …« Er legte überwältigt die Hand aufs Herz. »… Zitronentorte zum Nachtisch?«
Keinesfalls beschwichtigt machte sich seine Mutter über ihren Fisch her. Darcy konzentrierte sich auf seine Mahlzeit, bereit, die Sache auszusitzen. Er nahm kleine Bissen, um den Genuß zu verlängern, und sah in den Garten hinaus, während er kaute. Vor Jahren hatte er Lydia hierhergebracht, in das aus dem siebzehnten Jahrhundert stammende Haus seiner Familie am Rand des Dorfes Madingley. Damals hatte sein Vater noch gelebt, ein reservierter Mann in Tweed; die Mutter zeigte die ihrem Erfolg entsprechende Eleganz. Es war an einem ähnlichen Frühlingstag wie heute gewesen, und Margery und Lydia waren Arm in Arm durch den Garten spaziert, hatten die Narzissen bewundert und gelacht. Er war sich wie ein Idiot vorgekommen, ein Hornochse und Ausgestoßener angesichts ihrer feenhaften Eleganz und Aura weiblicher Intimität. In jener Nacht hatte ihn die Frage wachgehalten, welche Geheimnisse sie sich wohl erzählt haben mochten.
Er erinnerte sich an Lydias Profil, damals im Auto auf der Fahrt von Cambridge nach Madingley. Es hatte vor Anspannung über die erste Begegnung mit Margery Lester ganz streng gewirkt, und er sah wieder ihr viel zu braves Kleid und sorgfältig frisiertes Haar vor sich. Dieses eine Mal war die rebellische junge Lyrikerin jeden Zentimeter die dörfliche Lehrertochter gewesen, als die sie geboren worden war. Er hatte darüber herzlich gelacht, aber leider hatte am Ende jemand anderer …
»Darcy! Du hörst mir überhaupt nicht zu.«
Er sah seine Mutter lächelnd an. Schließlich hatte er gewußt, daß ihr Zorn bei der Aussicht, eine schweigende Mahlzeit erdulden zu müssen, verrauchen würde. »Tschuldigung, Mutter. Ich habe mich in den Gänseblümchen verloren.«
»Ich habe gefragt, was Dr. McClellan denn heute über Lydia wissen wollte?« Margerys Stimme klang noch immer leicht gereizt.
»Ach, den üblichen Unsinn nach dem Motto: Hat Lydia in den Wochen vor ihrem Tod Anzeichen von Depressionen gezeigt? Hat sie über irgendwelche Sorgen gesprochen, hatte sie sich auf eine neue Beziehung eingelassen? Etc. etc. etc. … Natürlich habe ich ihr gesagt, daß ich es nicht wüßte, und wenn, ich es ihr nicht sagen würde, weil nichts von alledem Einfluß auf Lydias Werk gehabt hat.« Darcy wischte den Mund an der Serviette ab und leerte sein Weinglas. »Vielleicht habe ich mich diesmal klar genug ausgedrückt.« Ein Schatten fiel über den Garten, als sich eine Wolke vor die Sonne schob. »Und es kommt doch Regen. Warum müssen die blöden Wetterfrösche nur immer recht haben?«
»Weißt du, mein Liebling«, sagte Margery versonnen, »ich habe deine Meinung über Biographien immer für sehr extrem gehalten. Zumindest für jemanden, der Tratsch und Klatsch so liebt wie du. Was wirst du nur machen, wenn dir je ein Verleger eine unanständig hohe Summe bietet, damit du meine Biographie schreibst?«
Nathan Winter wischte sich den Schweiß von der Stirn und sah zu den Wolken auf, die vom Nordwesten her über den Himmel jagten. Er hatte gehofft, die Pflanzen, die er am Morgen im Audley-End-Gartencenter gekauft hatte, noch vor dem Witterungsumschwung einpflanzen zu können. Leider hatte er wohl zu spät angefangen. Trotzdem hatte sich die Fahrt nach Suffolk gelohnt, denn in den Anzuchtbeeten des jakobinischen Herrenhauses gab es altertümliche Heilpflanzen, die sonst nirgends zu bekommen waren. Später hatte er der Versuchung nicht widerstehen können, durch Park und Gärten zu wandern, hatte sich sogar eine Tasse Tee und ein Sandwich im Restaurant genehmigt.
Jean hatte Audley End geliebt. Sie hatten so manchen Sonntag dort verbracht, waren durch das Herrenhaus geschlendert, hatten Lord Braybrooks Handschriftensammlung bewundert und sich kichernd wie Teenager vorgestellt, wie es wohl wäre, sich auf dem runden Divan zu lieben, der in der ›Feudal-Bibliothek‹, wie Jean sie immer nannte, seinen Platz hatte. Nathan hatte Jean ein letztes Mal dorthin gebracht, in einem Rollstuhl an einem schönen Sommertag. Das Haus war zuviel für sie gewesen. Sie hatten sich daher mit einem ausgedehnten Spaziergang durch die Kräutergärten begnügt.
Und in Audley End war er vermutlich auf die Idee verfallen, einen historischen Heilkräutergarten anzulegen. Damals jedoch hatten sie noch in Cambridge gewohnt, mit einem briefmarkengroßen Stück Land hinter dem Haus. Und Jean hatte jeden Zentimeter für ihre Blumen beansprucht.
Nathan verharrte in der Hocke und betrachtete sein Werk. Es war das erste größere Projekt für den Garten seines Cottages, und er hatte die Wintermonate damit zugebracht, viktorianische Kräutersammlungen und Gartenentwürfe zu studieren, sich das Passende herauszusuchen und eigene Entwürfe zu zeichnen. Königskerze, Gänsefingerkraut, Johanniskraut, Wacholder, Wermut, Myrte, Liebstöckel … bei letzterem hielt er lächelnd inne. Die meisten Leute verbanden mit diesem Kraut einen eher romantischen Zweck, und er vermutete, daß man einen guten stärkenden Likör für kalte Winternächte damit ansetzen konnte, aber eigentlich war es vor allem wirksam als harntreibendes Mittel.
Ein Windstoß wirbelte die leeren Plastiktöpfe durch die Luft und trieb sie ratternd über den Plattenweg. Nathan warf einen Blick auf die dunkle Wolkenwand, die sich im Westen aufbaute, und begann hastig, die letzten seiner Pflänzchen einzusetzen. Er drückte die Erde sorgfältig um die Wurzeln fest, sammelte seine Gartenwerkzeuge und den Abfall ein und richtete sich vom feuchten Boden auf. Seine Knie protestierten, wie in letzter Zeit bei Wetterumschwüngen so häufig, und er erinnerte sich wehmütig an die Tage, als er stundenlang und ohne die geringsten Beschwerden hatte knien können. Vielleicht sollte er vor dem Abendessen ausgiebig in Arnika und Lavendel baden … Abendessen! Wie hatte er nur vergessen können, daß er Adam Lamb zu einem frühen Imbiß eingeladen hatte? Und der Mann war eiserner Vegetarier. Das bedeutete, daß Nathan etwas Entsprechendes auf den Tisch bringen mußte, wenn er ihn nicht beleidigen wollte. Er ging im Geiste den Inhalt seines Kühlschranks durch. Eier, ein paar Pilze – er konnte ein Omelette machen – grüner Salat und ein halber Laib Schrotbrot von der Bäckerei in Cambridge im Schrank – ein mageres Abendessen, aber es mußte reichen. Und zum Nachtisch konnte er den Biskuitkuchen vom Supermarkt auftischen, den er eigentlich für festlichere Gelegenheiten aufbewahren wollte.
Was um Himmels willen hatte ihn veranlaßt, Adam einzuladen? Schuldgefühle vermutlich, gestand er sich mit einer Grimasse ein, als er zum Haus ging. Adam hatte ihm aus unerfindlichen Gründen immer irgendwie leid getan. Vielleicht weil Adam sich im Leben über die Maßen abmühte, ohne daß sein Einsatz für zahllose gute Zwecke je einen sichtbaren Erfolg gehabt hätte. Der Witz dabei ist, dachte Nathan, öffnete die Tür und schlüpfte aus seinen Gummistiefeln, daß er gestern am Telefon das Gefühl gehabt hatte, daß Adam offenbar Mitleid mit ihm hatte.
Adam Lamb fuhr mit seinem alten Mini gemächlich die Grantchester Road entlang, am Rugbyfeld der Universität vorbei, und stellte bei jeder Gelegenheit bergab den Motor aus, um Benzin zu sparen. Obwohl er von Automobilen nichts hielt, war er bei der Gemeindearbeit auf ein Transportmittel angewiesen. Also fuhr er seinem Gewissen zuliebe ein Auto, das nur durch Gottes Gnaden jedes Jahr durch den TÜV kam. Seine Sparsamkeit beim Benzin hatte sowohl einen moralischen als auch einen finanziellen Grund – ein paar sorgfältig koordinierte Fahrten pro Woche waren alles, was sein mageres Budget erlaubte.
Ein Windstoß rüttelte am Wagen, und Adam warf einen Blick zurück auf die düsteren Wolkentürme. Er hatte eigentlich zu Fuß gehen wollen. Am Fluß entlang waren es kaum drei Kilometer, und als Studenten hatten sie die Strecke bedenkenlos zurückgelegt. Aber das drohende Unwetter und eine leidige Erkältung hatten seinen Unternehmungsgeist gedämpft. Er fühlte sich plötzlich alt und müde.
Am Rand von Grantchester bremste Adam fast auf Schritttempo ab. So nahe es bei Cambridge lag, war er doch jahrelang nicht hierhergekommen. Und daß Nathan zurückkehren würde, war nicht zu erwarten gewesen. Schon gar nicht allein. Als er durch gemeinsame Freunde erfahren hatte, daß Nathan das Haus seiner Eltern geerbt und beschlossen hatte, dort einzuziehen, hatte ihn eine seltsame Unruhe erfaßt.
Die Grantchester Road ging in den Broadway über, und als Adam um die letzte Kurve vor der High-Street-Kreuzung bog, blinzelte er überrascht. War das eine Sinnestäuschung? Das Cottage in seiner Erinnerung war schäbig gewesen, mit bröckelnder Fassade, Brombeergestrüpp im Garten und Spatzen, die im Reetdach nisteten. Aber ein Blick in die Umgebung sagte ihm, daß er das richtige Haus gefunden hatte. Er hielt am Straßenrand und stieg gerade aus, als die ersten Regentropfen fielen. In seiner Verwirrung vergaß er, die Handbremse anzuziehen. Er stand da, starrte auf die neue, mit Ziegelsteinen gepflasterte Auffahrt und den halbmondförmigen Gartenweg, den grünen Golfrasen und die makellosen Staudenrabatten, den weißen Verputz und das Reetdach … jemand hatte ein Wunder vollbracht.
Die Haustür ging auf, und Nathan kam grinsend heraus. »Da verschlägt es dir die Sprache, was?« sagte er, als er Adam empfing und ihm die Hand schüttelte. »Schön, dich zu sehen.« Er deutete auf das Haus. »Ich weiß, es ist fast peinlich ›putzig‹, aber mir gefällt’s. Komm rein.«
Nathan sah erstaunlich gut aus. Sein Haar war seit Jeans Tod schlohweiß geworden, aber es stand ihm, bildete einen faszinierenden Kontrast zu seinen dunklen Augen und seiner gesunden Hautfarbe. Adam wußte noch, wie sie Nathan verspottet hatten, als er schon mit Mitte Zwanzig grau zu werden begann. Damals kannte Nathan Jean bereits. Es war ihm daher völlig gleichgültig gewesen, was sie über ihn gedacht hatten. Nicht einmal Lydia hatte ihn treffen können.
Bei dem Gedanken an Lydia zuckte Adam innerlich zurück und suchte Zuflucht in der Gegenwart. »Aber wie hast du … ich meine, das muß ja … deine Eltern haben doch nicht …« Ein großer Regentropfen zerplatzte auf seinen Brillengläsern und nahm ihm im ersten Augenblick die Sicht.
Nathan legte eine Hand auf seine Schulter und schob ihn durch die Tür ins Haus. »Ich mache dir einen Drink und erzähle dir dabei alles – wenn du willst.« Er sperrte den Regen aus und hängte Adams Anorak an die Garderobe. »Ist Whisky okay?«
»Hm, ja. Bestens.« Adam folgte ihm in ein Wohnzimmer, das ebenso verwandelt war wie das Äußere des Hauses. Verschwunden waren die düsteren Möbel und die viktorianischen Nippes, die Nathans Mutter so geliebt hatte. Jetzt waren die Bezüge der einladend aussehenden Polstermöbel in freundlichen Farben gehalten, ein dicker Teppich lag auf dem Riemenboden, und im Kamin brannte ein Feuer, das sich in den Butzenscheiben der Fenster spiegelte. Es war ein schönes Zimmer, verführerisch gemütlich, und Adam dachte mit bedauerndem Frösteln an sein Pfarrhaus in Cambridge. Er ging zum Kaminfeuer und wärmte sich die Hände. Nathan schenkte an der Anrichte aus einer Flasche Macallan zwei Gläser ein. »Ein großer Fortschritt gegenüber dem elektrischen Kaminfeuer«, sagte Adam, als Nathan ihm sein Glas reichte. »Zum Wohl!«
Nathan lachte und setzte sich in einen der Sessel am Kamin. »Überrascht mich, daß du dich daran noch erinnerst. Es war ziemlich schwach auf der Brust, was?« Er streckte die Beine der Wärme entgegen und nippte an seinem Drink. »Meine Eltern hatten eine Zentralheizung einbauen lassen, aber die wurde nur morgens und abends jeweils eine Stunde angeschaltet. Sie hat das Waschen, Ins-Bett-Gehen und Aufstehen einigermaßen erträglich gemacht, aber die restliche Zeit haben wir uns ständig vor der blöden Heizspirale gedrängelt. Der Kamin hatte einen ausgezeichneten Abzug, aber nachdem sie sich einmal eingebildet hatten, daß ein elektrisches Kaminfeuer billiger sei, gab’s kein Zurück.« Er schüttelte den Kopf.
»Ich habe mich hier immer wohl gefühlt«, murmelte Adam und setzte sich in den zweiten Sessel. »Deine Mutter ist sehr lieb zu uns gewesen und hat uns undankbare Bande klaglos mit durchgefüttert.«
Nathan lächelte. »Ich glaube nicht, daß sie das so empfunden hat.«
»Das mit deinen Eltern hat mir sehr leid getan.« Adam griff sich automatisch an den weißen Kragen und erinnerte sich dann, daß er einen Rollkragenpullover trug. Er fürchtete immer, daß die Kleidung des Geistlichen bei gesellschaftlichen Anlässen Verlegenheit auslöste – auch bei Leuten wie Nathan, der ihn noch aus der Zeit kannte, als er kein Geistlicher gewesen war. »Muß hart für dich gewesen sein … so kurz nach Jean.«
Nathan starrte ins Feuer, drehte das Glas in seinen Händen und sagte nachdenklich. »Ich kann das gar nicht beurteilen. Zu diesem Zeitpunkt war ich zu keiner Empfindung mehr fähig. Ich habe wie ein Roboter reagiert. Manchmal bin ich nicht sicher, daß ich es überhaupt begriffen habe.« Er sah Adam an und lächelte. »Aber ich wollte dir vom Haus erzählen. Das Cottage hat mir die Entscheidung abgenommen, wie es weitergehen sollte. Ich hätte es nicht ertragen, ohne Jean im Haus in Cambridge zu bleiben. Ich hatte längst mit dem Gedanken gespielt, wieder ins College zu ziehen. Dann, als meine Eltern innerhalb weniger Wochen nacheinander starben und mir das hier hinterließen …« Nathan stand auf, ging zum Fenster und zog die Vorhänge vor, während der Regen gegen die Scheiben trommelte.
»Es war schuldenfrei, aber in einem schrecklichen Zustand«, fuhr er fort. »Ich war völlig ratlos. Ein Freund hat mich alten Dickschädel schließlich mit der Holzhammermethode aufgeklärt. Jean und ich hatten fast fünfundzwanzig Jahre in Cambridge gewohnt. Die Hypothek auf unser Haus war fast abbezahlt. Und die Grundstückspreise waren sprunghaft gestiegen.«
»Also hast du das Haus verkauft und den Gewinn für die Renovierung benutzt.« Adams Gestik fiel ausladender aus als beabsichtigt. Der Whisky war ihm zu Kopf gestiegen. Er hatte einen leeren Magen. Vor dem Abendmahl am Morgen hatte er gefastet und dann entdeckt, daß der Gemüsekuchen, den er sich zum Mittagessen aufbewahrt hatte, schimmelig geworden war.
Nathan stand jetzt mit dem Rücken zum Feuer. »Es war komischerweise geradezu wie ein Befreiungsschlag. Jean und ich hatten im Lauf der Jahre auf so vieles verzichtet, weil wir warten wollten, bis wir es uns wirklich leisten konnten, und irgendwie war es dazu nie gekommen.« Grinsend fügte er hinzu: »Daß wir zwei Töchter haben, hat wohl auch was damit zu tun. Diese beiden zierlichen Elfen fraßen die Pfundnoten wie halbverhungerte Hunde in einer Wurstfabrik.«
Adam hatte Mühe gehabt, in den beiden jungen, dunkel gekleideten Frauen mit den verweinten Gesichtern, die er bei Jeans Beerdigung flüchtig gesehen hatte, Nathans Töchter wiederzuerkennen. Für ihn waren sie noch immer zwei kleine Mädchen in weißen Rüschenkleidern und rosaroten Haarbändern. »Jetzt sind sie doch sicher verheiratet, oder?«
»Jennifer ja. Aber Alison ist zu sehr mit ihrer Karriere beschäftigt, um Zeit für Männer zu haben – es sei denn, sie haben das Glück des Augenblicks zu bieten«, sagte Nathan liebevoll.
»Sie ist immer Lydias Liebling gewesen, deine Alison, oder?«
»Lydia hat von Anfang an behauptet, Jenny sei mit einer konventionellen Seele geboren, aber Alison sei für Höheres bestimmt. Lydia war Alisons Patin. Überrascht mich, daß du dich daran erinnerst.« Nathan verstummte und schwenkte den Whisky in seinem Glas, bevor er ihn mit einem Schluck herunterkippte. »Komm mit nach hinten, dann mache ich uns was zu essen.«
Adam erhob sich aus den Tiefen seines Sessels und folgte Nathan in die Diele. Jetzt erst sah er, daß im rechter Hand gelegenen Zimmer, das von Nathans Eltern als Salon benutzt worden war, nur ein Flügel auf dem gebohnerten Holzboden stand. Adam erinnerte sich noch an das alte Klavier, das in Nathans und Jeans Wohnzimmer gestanden hatte. Das gute Stück war von Nathan stets übel mißhandelt worden, wenn er darauf die alten Varieté-Stücke herunterhämmerte, die ihm seine Mutter beigebracht hatte. Bevor Adam noch etwas dazu sagen konnte, bat ihn Nathan durch die mittlere Tür.
An der Rückseite des Hauses, wo ursprünglich Küche, Spülküche und Eßzimmer untergebracht gewesen waren, war ein einziger großer Raum entstanden. Hier gab es eine Küche mit Eßecke und einem gemütlichen Arbeitsplatz. Außerdem waren auf der gesamten Länge Fenster eingebaut worden, von denen aus man, wie Adam vermutete, an besseren Tagen den Fluß sehen konnte.
Nathan deutete auf den Tisch, der bereits gedeckt war, und ging weiter zur Küchenzeile. »Setz dich. Ich bereite inzwischen alles vor. Ich habe noch eine Portion Karotten-Linsensuppe im Tiefkühler gefunden. Danach gibt’s Omelettes und grünen Salat, wenn’s recht ist.« Er lüpfte den Deckel eines Topfs auf dem Herd und rührte um. Dann holte er eine Flasche australischen Chardonnay aus dem Kühlschrank. »Ist alles von Ikea«, sagte er mit einem Blick auf Adam und öffnete die Flasche. »Von den Möbeln bis zum Besteck. Sonst hätte das Geld nie gereicht.«
»Es ist großartig, Nathan. Einfach großartig.« Adam nahm das Glas, das Nathan für ihn eingeschenkt hatte. »Auf dein Leben« , erklärte er, hob sein Glas und verschluckte sich, als der Wein unerwartet in seiner Kehle kratzte. »Entschuldige!« prustete er und nahm einen vorsichtigeren Schluck. »Du und Jean, ihr wart immer so gastfreundlich. Du scheinst das fortzuführen. Das bewundere ich.«
Nathan hielt inne, die Suppenkelle über einem Teller. »Die ersten Jahre habe ich Gefrierkost vor dem Fernseher verschlungen. Falls ich überhaupt gegessen habe. Und mit dem Haushalt und der Wäsche stand’s auch nicht zum besten.« Er zuckte die Schultern und gab weiter Suppe in zwei grüne Schalen. »Aber nach einer Weile ist mir klargeworden, wie verzweifelt Jean über mich gewesen wäre. Ihre Nörgeleien verfolgten mich überallhin im Haus: ›Nathan, du solltest dich schämen, dich so gehenzulassen.‹ Also habe ich mich geändert, und es macht Spaß.«
»Würdest du wieder heiraten?« fragte Adam, als Nathan die Suppe und einen Korb Brot auf den Tisch stellte und sich ihm gegenübersetzte. »Wer einmal glücklich verheiratet war, tut das meiner Erfahrung nach wieder.«
Zum ersten Mal ließ Nathan sich mit der Antwort Zeit. »Ich weiß nicht«, murmelte er schließlich. »Vor einem Jahr hätte ich kategorisch nein gesagt … sogar noch vor sechs Monaten … Aber jetzt …« Er schüttelte den Kopf und grinste. »Ach was! Ich bin ein Idiot und nicht mehr jung. Schätze, ich leide an einem reichlich verspäteten Anfall von Pubertät. Es geht vorbei.«
»Und wenn nicht?« erkundigte sich Adam, dessen Neugier geweckt war.
Nathan griff nach dem Suppenlöffel und tauchte ihn in die Suppe. »Dann helfe mir Gott.«
3
Wir waren so heiter, war’n so im Recht, so strahlend in unserem Glauben,
und der Weg war so sicher ausgelegt. Doch als ich gegangen,
welch dummes Ding erhob da den Kopf? War es ein Wort,
ein plötzlicher Schrei, daß ergeben und wortlos
die Treue du brachst und seltsam, schwach, dich aufgabst?
RUPERT BROOKE aus ›Verlassen‹
Ein heftiger Windstoß erfaßte die Papierserviette auf Vics Schoß, wirbelte sie durch die Luft und über den Rasen. Kincaid beobachtete, wie sie Anstalten machte aufzuspringen, dann jedoch auf den Stuhl zurücksank und sich geschlagen gab, als die Serviette über die Mauer segelte und verschwand. Während ihres ausgedehnten Imbisses im Garten hatten sich düstere Wolkentürme am westlichen Horizont aufgebaut, und Vic sah jetzt auf und runzelte die Stirn. »Ich glaube, der Wettergott hat uns betrogen, was? Wenn wir schlau sind, gehen wir rein«, fügte sie hinzu und begann das Geschirr abzuräumen. »Ich hole nur ein Tablett.«
Während er zusah, wie sie von ihrem Stuhl glitt und sich über die Terrasse entfernte, dachte Kincaid daran, wie seltsam es war, wieder mit ihr zusammenzusein – und wie vertraut. Er war sich deutlich der Silhouette ihrer Schulterblätter unter dem dünnen Stoff ihres Kleids bewußt, der Länge ihrer Finger, des besonderen Schwungs ihrer Augenbrauen, all jener Dinge, an die er Jahre nicht gedacht hatte. Er erinnerte sich an ihre stumme Art des Zuhörens, als sei das, was man sagte, unendlich wichtig … Dabei vergaß er nicht, daß sie ihm noch immer nicht den Grund für ihren Anruf verraten hatte. Aber auch das kam ihm bekannt vor. Bei der Trennung war ihm klargeworden, wie selten Vic ihm je gesagt hatte, was sie fühlte oder dachte. Sie hatte von ihm erwartet, daß er es wußte, und jetzt fragte er sich, ob er wieder einmal sein Stichwort verpaßt hatte.
Vic kam mit einem Tablett zurück. »Ich habe das Kaminfeuer im Wohnzimmer angemacht.« Sie hatte eine lange goldbraune Jacke übergezogen und begann das Tablett zu beladen. »Das war’s mit unserem Picknick. Kurz, aber schön.«
Kincaid stellte Teller übereinander. »Kann man von vielen Dingen sagen«, murmelte er und fluchte innerlich, als sie bei dieser unverhohlenen Spitze zusammenzuckte. »Tut mir leid, Vic. Ich …« Er verstummte unsicher. Wie sollte er sich entschuldigen, ohne die Minenfelder der Vergangenheit zu betreten, die er hatte vermeiden wollen?
Vic nahm wortlos das Geschirr und hielt mit dem Tablett in den Händen inne. Sie sah ihn einen Moment ruhig an. »Manchmal ist man zu unerfahren, um zu wissen, wie gut etwas gewesen ist. Oder den Wert eines Menschen zu erkennen. Ich war ein dummes Huhn, aber es hat lange gedauert, bis mir das klargeworden ist.« Sie lächelte. Als Kincaid sie verdutzt anstarrte, fügte sie hinzu: »Komm, hilf mir, das alles in die Küche zu bringen. Dann koche ich Tee. Es sei denn, du möchtest was Stärkeres?«
Kincaid suchte sein Heil in Allgemeinplätzen. »Nein, nein, Tee ist ausgezeichnet. Ich muß noch nach London zurückfahren. Und mit dem Wein habe ich die Promillegrenze schon überschritten.«
Er nahm ihr das Tablett aus den Händen. Sie hielt ihm die Tür auf. Er brachte es in die winzige Küche und stellte es auf die Arbeitsplatte. Vics Entschuldigung war für ihn völlig unerwartet gekommen, und jetzt wußte er nicht damit umzugehen.
Vic stellte Tassen und Teekanne bereit und bemerkte sachlich: »Es wartet also jemand auf dich.«
»Ist das eine spezifische oder eine allgemeine Feststellung?« fragte er grinsend. Er dachte an Gemma und den Balanceakt, der ihre Beziehung in den vergangenen Monaten gewesen war, und fragte sich, ob ihre Weigerung, ihn zu begleiten, einen anderen Grund hatte als ihren Wunsch, mehr Zeit mit ihrem Sohn zu verbringen. Sie hatte ihn zwar eingeladen, am Abend nach seinem Besuch in Cambridge zu ihr zu kommen, aber was ihn dort erwartete, war ungewiß.
Vic warf ihm einen Blick zu und schaltete den Wasserkocher aus. Nachdem sie Tee aufgegossen hatte, dirigierte sie Kincaid ins Wohnzimmer. Über die Schulter fragte sie: »Weiß sie dich zu schätzen?«
»Ich werde ihr erzählen, daß du nette Sachen über mich gesagt hast. Nach dem Motto ›Erprobt und für gut befunden‹.«
»Klingt wie eine Schlagzeile aus der Boulevardpresse. Untertitel: EX-FRAU GIBT GEBRAUCHSANWEISUNG. Das müßte es doch bringen.«
Sie setzten sich in die tiefen Sessel am Kamin. Vic zog die Beine an und trank einen Schluck Tee. »Ernsthaft, Duncan. Ich freue mich für dich. Aber ich habe dich nicht hergebeten, um dich über dein Privatleben auszufragen. Obwohl ich zugegebenermaßen neugierig bin.« Sie sah ihn über den Rand ihrer Teetasse lächelnd an.
Das Blumenmuster auf dem Porzellan war ihm schon die ganze Zeit irgendwie bekannt vorgekommen, und als er es so dicht an ihrem Gesicht sah, kam die Erinnerung zurück … Vic, die einen Geschenkkarton öffnete, eine Tasse herausnahm und hochhielt, damit er sie begutachten konnte. Das Porzellan war ein Hochzeitsgeschenk ihrer Eltern gewesen, ein ›gutes Service‹ hatte ihre Mutter es genannt, als befürchte sie, von seiner Familie könne etwas ›Unpassendes‹ kommen.
»Die Neugier hatte Alice von jeher in Schwierigkeiten gebracht« , neckte er sie. Alice war sein Spitzname für sie gewesen, und er hatte nicht nur wegen der physischen Ähnlichkeit gut zu ihr gepaßt.
»Ich weiß«, erwiderte sie leicht zerknirscht. »Und ich fürchte, viel hat sich daran nicht geändert. Der Grund, weshalb ich dich sprechen wollte … Es hat mit meiner Arbeit zu tun und ist ein bißchen kompliziert. Aber zuerst wollte ich dich wieder etwas besser kennenlernen, erst mal abwarten, ob du mich vielleicht für hysterisch und typisch weiblich überspannt hältst.«
»Ach, komm schon, Vic! Du und hysterisch? Nichts paßt weniger zu dir. Du bist von jeher der Inbegriff kühler Distanziertheit gewesen.« Während er das sagte, fiel ihm das einzige Gebiet ein, auf dem sie ihre Reserviertheit völlig aufgegeben hatte, und er wurde peinlicherweise rot.
»Einige Kollegen in der Fakultät würden weniger schmeichelhafte Ausdrücke für mich finden.« Sie zog eine Grimasse. »Und die Themenwahl für mein Buch hat mich in gewissen Kreisen äußerst unpopulär gemacht.«
»Buch?« Kincaid wandte den Blick von dem Foto, das Vics abtrünnigen Ehemann zeigte. Was hatte sie bloß an ihm gefunden? McClellan sah konventionell und bärtig aus, doch er erfüllte rein äußerlich das Cliché vom gutaussehenden Akademiker, und Kincaid konnte sich vorstellen, wie er seine Studentinnen einwickelte. Eigentlich hätte er Genugtuung dar über empfinden können, daß das Leben Vic so bitter bestraft hatte, statt dessen packte ihn die blinde Wut – nicht auf Vic, sondern auf den Geschlechtsgenossen.
Kincaid fühlte sich nicht schuldlos am Scheitern seiner Ehe. Sie waren beide jung gewesen, hatten gerade erst angefangen zu begreifen, was sie vom Leben erwarteten. Allerdings konnte er sich beim besten Willen nicht vorstellen, welche Entschuldigung Ian McClellan für sein Verhalten haben sollte. Und was für eine Sorte Mann, so fragte er sich, machte sich ohne ein Wort zu seinem Sohn aus dem Staub?
»Meine Biographie«, antwortete Vic. »Ich arbeite seit ungefähr einem Jahr daran. Die Biographie von Lydia Brooke.« Sie knipste die Leselampe neben ihrem Sessel an, so daß ihr Gesicht plötzlich im Schatten und ihre Hände an der Teetasse im Licht waren. »Ian hat behauptet, ich hätte ihn über meiner Arbeit vernachlässigt. Und damit hatte er vermutlich nicht ganz unrecht. Männer … Augenblicklich stehe ich mit dem männlichen Geschlecht ein wenig auf Kriegsfuß. Sie wollen einen brillant und erfolgreich. Aber nur, solange das nicht mit einem Verlust der Aufmerksamkeit für sie und ihre Bedürfnisse einhergeht. Und natürlich nur, solange die Erfolge der Frau nicht größer sind als die des Mannes.« Sie sah lächelnd zu ihm auf.
»Klingt ziemlich zickig, was? Außerdem kann man das nicht verallgemeinern. Natürlich weiß ich, daß es Männer gibt, die anders sind. Aber ich komme immer mehr zu der Ansicht, daß sie die Ausnahme darstellen. Ian hat sich erst an Studentinnen rangemacht, als ich genauso viel verdient habe wie er.« Ihr Mund zuckte verächtlich. »Egal. Was weißt du über Lydia Brooke?«
Kincaid dachte angestrengt nach. Dann kam ihm eine vage Erinnerung an schmale Gedichtbände im Bücherregal seiner Eltern. »Sie war eine Lyrikerin aus Cambridge. So was wie eine Ikone der Sechziger … Sie ist erst vor kurzem gestorben, glaube ich. War sie mit Rupert Brooke verwandt?«
»Sie war besessen von Rupert Brooke, als sie nach Cambridge kam. Ob sie mit ihm verwandt war, spielt keine Rolle.« Vic wechselte ihre Stellung, so daß der Schein der Lampe erneut ihr Gesicht erfaßte. »Und du hast recht. Lydia hat Mitte der sechziger Jahre die Szene beherrscht. Ihre Gedichte drückten Schmerz und Desillusionierung aus und haben das Lebensgefühl der Generation von damals genau getroffen. Nach dem katastrophalen Fehlschlag einer Ehe hat sie einen Selbstmordversuch unternommen, wurde jedoch gerettet. Anfang Dreißig hat sie es noch mal versucht, und dann ist es ihr schließlich vor fünf Jahren gelungen, sich umzubringen. Da war sie siebenundvierzig.«
»Hast du sie gekannt?«
»Ich habe sie einmal auf einer Veranstaltung des College gesehen. Kurz nachdem ich hierhergekommen war. Leider kannte ich niemanden gut genug, um vorgestellt zu werden. Und eine zweite Chance bekam ich nicht.« Vic zuckte die Schultern. »Klingt vielleicht komisch, aber ich habe mich schon damals zu ihr hingezogen gefühlt, spontan eine Verbindung zwischen uns gespürt, die alte Geschichte.« Sie wurde ernst. »Und als ich gehört habe, daß sie gestorben ist, war ich am Boden zerstört, als hätte ich einen mir nahestehenden Menschen verloren.«
Kincaid zog eine Augenbraue hoch und wartete ab.
»Den Blick kenne ich.« Vic zog eine Grimasse. »Jetzt fragst du dich, ob ich nicht doch eine Meise habe. Aber dieses Gefühl der Seelenverwandtschaft mit Lydia ist vermutlich der Grund, weshalb mir ihr Tod so merkwürdig vorkommt.«
»Es war doch Selbstmord? Das stand doch nicht außer Frage?«
»Die Polizei ist davon überzeugt.« Vic starrte aus dem Fenster und auf den Himmel voller tiefhängender dunkler Wolken. »Wie soll ich es erklären? Lydia hat sich angeblich mitten in einer ihrer produktivsten Schaffensperioden umgebracht. Und zwar aufgrund von Depressionen, an denen sie Zeit ihres erwachsenen Lebens gelitten hatte. Ich finde, da stimmt einfach was nicht.«
Kincaid mußte unwillkürlich an die vielen Stunden denken, die er mit ähnlichen Theorien zu Beginn seiner Ehe mit Vic verbracht hatte, und wie absolut desinteressiert sie an seinen Fällen gewesen war. Mittlerweile hatte er Verständnis für ihr Verhalten von damals. Er war neu im Morddezernat und vermutlich in seiner Faszination für das Ungewohnte für jeden Zuhörer eine Zumutung gewesen. »Und weshalb?« fragte er vorsichtig.
Vic stellte die Füße auf den Boden und beugte sich vor. »Beide früheren Selbstmordversuche sind während lange anhaltender Phasen von Schreibblockade passiert. Ich glaube, Lydia war nur wirklich glücklich, wenn sie dichtete. Fielen persönliche Probleme mit einer unkreativen Schaffensperiode zusammen, kam sie mit nichts und niemandem mehr klar. So war es zum Beispiel auch nach dem Scheitern ihrer Ehe. Später allerdings, mit fortgeschrittenem Alter, war sie sich selbst genug. Sie lebte ganz zufrieden allein. Falls sie in den letzten zehn Jahren ihres Lebens eine ernsthafte Beziehung gehabt hat, habe ich dafür keinerlei Hinweise gefunden.«
»Hatte sie denn vor ihrem Tod eine solche unproduktive Phase?« Kincaids Interesse war geweckt.
»Nein.« Vic stellte ihre Tasse auf den Tisch. »Das ist es ja, verstehst du? Als sie starb, hatte sie am Manuskript für ein neues Buch gearbeitet – das beste, das sie je geschrieben hat. Die Gedichte haben Tiefe und Lebendigkeit, es ist, als habe sie für sich plötzlich eine neue, ultimative Dimension ihrer Kunst entdeckt.«
»Vielleicht war das der Auslöser«, gab Kincaid zu bedenken. »Sie hat keine weiteren Entwicklungsmöglichkeiten mehr gesehen.«
Vic schüttelte den Kopf. »Das war auch mein erster Gedanke. Aber je besser ich sie kennenlerne, desto unwahrscheinlicher wird das. Ich glaube vielmehr, sie hatte endlich ihre Stilebene gefunden. Sie hätte noch so viel schreiben, uns noch so viel geben können …«
»Vic.« Kincaid beugte sich vor und berührte ihre Hand. »Was in einem anderen Menschen vorgeht, weiß man nie mit letzter Sicherheit. Es passiert häufiger, daß Leute morgens aufwachen und beschließen, genug vom Leben zu haben, ohne eine Erklärung zu hinterlassen. Vielleicht trifft das auch auf Lydia zu.«
Sie schüttelte energisch den Kopf. »Das ist ja noch nicht alles. Lydia starb an einer Überdosis ihres Herzmedikaments. Ist es nicht normalerweise so, daß Selbstmörder ihrer Methode treu bleiben? Nur zu noch drastischeren Methoden greifen, wenn sie keinen Erfolg haben?«
»Gelegentlich sicher. Aber das trifft nicht auf alle zu.«
»Das erste Mal hat sie sich im Bad die Pulsadern aufgeschnitten – nur weil ein Freund sie unverhofft besucht hat, konnte sie gerettet werden. Das zweite Mal ist sie mit dem Auto gegen einen Baum gerast. Sie ist mit einer schweren Gehirnerschütterung davongekommen. Später hat sie behauptet, ihr Fuß sei vom Bremspedal gerutscht. Verstehst du?«
»Du meinst, beim dritten Versuch hätte sie eine noch drastischere Methode wählen müssen?« Kincaid zuckte die Achseln. »Möglich. Worauf willst du hinaus?«
Vic wandte den Blick ab. »Ich bin nicht sicher. Bei Tag klingt es so absurd …«
»Raus damit!«
»Was, wenn Lydia sich gar nicht umgebracht hat? In Anbetracht ihrer Vorgeschichte wäre es die logische Konsequenz gewesen. Aber überleg mal, wie leicht es darum für andere gewesen wäre.« Vic hielt inne, holte Luft und fügte bedächtiger hinzu: »Was ich sagen will … Ich glaube an die Möglichkeit, das Lydia ermordet worden ist.«
In der nachfolgenden Stille zählte Kincaid stumm bis zehn. Sei vorsichtig, mahnte er sich. Sag ihr jetzt nicht, daß sie die nötige Distanz verloren hat. Sag ihr nicht, wie weit Menschen gehen, den Selbstmord ihrer Lieben zu leugnen – und er hatte keinen Zweifel, daß Vic sich Lydia Brooke enger verbunden fühlte als so manch anderer einem Familienmitglied – und sag ihr um Himmels willen nicht, sie sei hysterisch. »Also gut«, begann er laut. »Drei Fragen: Warum, wie und wer?«
»Ich weiß es nicht«, antwortete Vic beinahe heftig. »Ich habe mit allen geredet, die ich ausfindig machen konnte. Es gab offenbar niemanden, der Streit mit ihr hatte. Trotzdem ist was faul.«
Kincaid trank seinen Tee aus, während er sich eine Antwort zurechtlegte. Vor zehn, zwölf Jahren war er ein Faktenfetischist gewesen und hätte vermutlich über ihren Verdacht gelacht. Inzwischen hatte er gelernt, den Faktor Intuition nicht zu unterschätzen, auch wenn sie abwegig erschien. »Also gut«, seufzte er. »Nehmen wir an, du hast recht und an Lydias Tod ist was faul. Was erwartest du in dieser Angelegenheit von mir?«