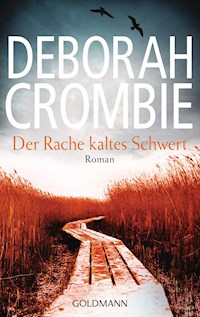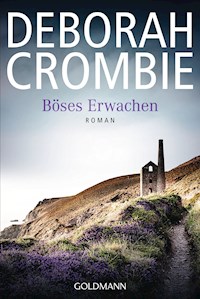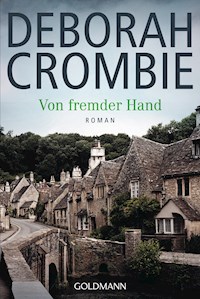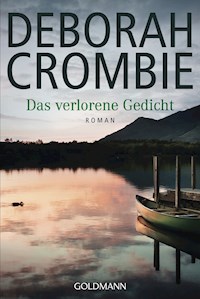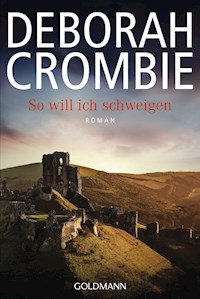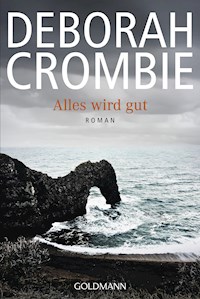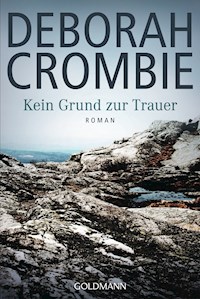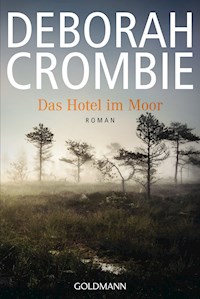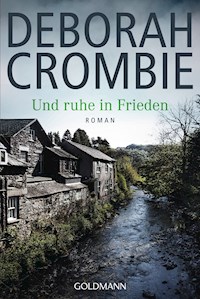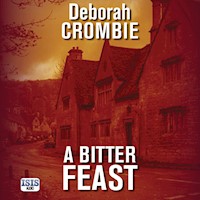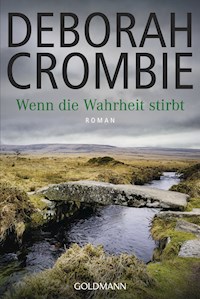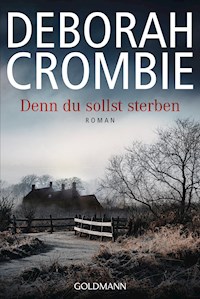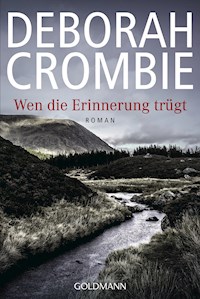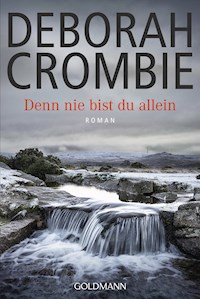9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Kincaid-James-Romane
- Sprache: Deutsch
Ein eisiger Januartag in London, eine übel zugerichtete Leiche, der Beginn einer geheimnisvollen Mordserie.
London an einem eiskalten Tag im Januar: Detective Inspector Gemma James und ihre Assistentin Detective Sergeant Melody Talbot werden zu einem Tatort gerufen: Rechtsanwalt Vincent Arnott liegt tot in einem Hotelbett – nackt und mit gefesselten Händen und Füßen. Ein Sexspiel mit tödlichem Ausgang oder ein Verbrechen? Als jedoch kurz darauf ein weiterer Anwalt auf dieselbe Weise zu Tode kommt, ist klar, dass es sich um Mord handelt. Haben es Gemma und Melody mit einem Serienmörder zu tun?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 634
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Buch
Ein eiskalter Januartag in London: Detective Inspector Gemma James wird zusammen mit ihrer Assistentin Detective Sergeant Melody Talbot zu einem Tatort gerufen: Rechtsanwalt Vincent Arnott wurde tot in einem Hotelbett gefunden – nackt, an Händen und Füßen mit einem Gürtel gefesselt. Offensichtlich wurde er erdrosselt, doch zunächst ist nicht klar, ob sich Arnott bei einem autoerotischen Sexspiel selbst erwürgt hat oder ob es sich um ein Verbrechen handelt. Kurz darauf wird ein weiterer Anwalt tot aufgefunden. Auch er ist gefesselt, auch er starb durch Strangulation. Nun gibt es keinen Zweifel mehr, dass es sich bei beiden Todesfällen um Mord handelt – und zwar um einen besonders perversen. Während ein eisiger Wind durch die Straßen von London fegt, versuchen Gemma und Melody verzweifelt, der Lösung des Falles näherzukommen. Dann schaltet sich Gemmas Mann, Superintendent Duncan Kincaid, in die Ermittlungen ein, denn Kincaid glaubt das nächste Opfer zu kennen …
Informationen zu Deborah Crombie
sowie zu lieferbaren Titeln der Autorin
finden Sie am Ende des Buches.
Deborah Crombie
Wer Blut vergießt
Roman
Deutsch vonAndreas Jäger
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Die Originalausgabe erschien 2013 unter dem Titel »The Sound of Broken Glass« bei Harper Collins, New York.
Die Shakespeare-Zitate wurden in der Übertragung nach Schlegel/Tieck wiedergegeben.
Deutsche Erstveröffentlichung August 2013
Copyright © der Originalausgabe 2013
by Deborah Crombie
Published by Arrangement with Deborah Crombie
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische
Agentur Thomas Schlück GmbH, 30827 Garbsen.
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2013
by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der
Verlagsgruppe Random House GmbH,Neumarkter Str. 28, 81673 München
Covergestaltung: UNO Werbeagentur GmbH
Covermotive: © plainpicture/Robert Harding
Karte von Laura Hartman Maestro
Redaktion: Claudia Fink
BH · Herstellung: Str.
Satz: omnisatz GmbH, Berlin
ISBN: 978-3-641-09967-1V003
www.goldmann-verlag.de
Für Lisa Haskell und Ann Christ,
deren Gastfreundschaft und Großzügigkeit ich es verdanke,
dass London mir im Lauf der Jahre
zur zweiten Heimat geworden ist.
Und für Steve Ullathorne,
der unbedingt wollte,
dass ich ein Buch über Crystal Palace schreibe.
Prolog
… Der Name Denmark Street ist untrennbar mit Musik verbunden. Seit den 1920er-Jahren als »Tin Pan Alley von London« bekannt, war diese berühmte Straße in Soho schon immer ein Treffpunkt für Musiker, seit in den Tagen von Queen Victoria die ersten Notenhändler sich hier niederließen.
www.coventgarden.co.uk
Es war Jahre her, dass sie zuletzt eine englische Kirche betreten hatte. Ob die Türen am frühen Abend dieses trostlosen Januartages wohl verschlossen sein würden? Einer plötzlichen Eingebung folgend wartete sie, bis sich eine Lücke im Verkehr auftat, überquerte mit raschen Schritten die Charing Cross Road und bog in die Denmark Street ein.
Und dann blieb sie erneut stehen und starrte wie hypnotisiert in die Schaufenster der Geschäfte, deren Auslagen hell erleuchtet waren, obwohl sie bereits geschlossen hatten. Wie hatte sie das vergessen können? Das hier war die Straße der Gitarren. Die Instrumente mit ihren elegant geschwungenen Formen und glänzenden Lackierungen schienen sie magisch anzuziehen.
Sie ging weiter, langsamer nun, vorbei am ersten Geschäft, am zweiten. Die Farben sprangen sie regelrecht an – Scharlachrot, Türkis, Honiggelb, Mahagoni, helles Flachsgelb, und dann der harte Kontrast von Schwarz und Weiß.
Es lag etwas Verlockendes darin – nicht nur in der Schönheit der Instrumente, sondern auch in ihrer Unerreichbarkeit. Eine Verheißung, eingeschlossen hinter Glas. Viele der Gitarren waren mit handgeschriebenen Karten versehen, die über ihre Herkunft informierten. Die Vorstellung, dass Gitarren genau wie Menschen ihre Geschichte hatten, gefiel ihr.
Als sie zum nächsten Laden weiterging, wurde ihr Blick nicht von den Gitarren angezogen, sondern von den Plakaten, die in den Fenstern eines schäbigen Clubs hingen – des 12 Bar Club, wie das Schild über dem Eingang verriet.
Der 12 Bar Club – jetzt erkannte sie ihn wieder. Den Laden gab es schon seit vielen Jahren; als Teenager hatte sie ein- oder zweimal den langen Weg von Hampstead hierher auf sich genommen, und damals war ihr der Club so erwachsen vorgekommen, so mondän. Natürlich total verraucht seinerzeit, aber das hatte sie nicht gestört. Jeder Gitarrist, der diesen Namen verdiente, war in diesem winzigen, schmuddeligen Club aufgetreten, und die Mädchen hatte die Aussicht angelockt, vielleicht einmal einen Blick auf einen Star zu erhaschen.
Wieder betrachtete sie die Flyer, die im Fenster klebten. Der Name einer Band entlockte ihr ein Lächeln – aber dann stockte ihr der Atem, und sie sah sich das körnige Schwarzweißfoto unter dem Bandnamen genauer an.
Dieses Gesicht … Der Schock fuhr ihr in die Glieder. War das denn möglich? Nach so langer Zeit? Gewiss nicht, aber … Ihre Fingerspitze hinterließ eine Spur auf dem kalten Glas, als sie die Namen der Bandmitglieder las.
Ihr Blick trübte sich. Sie blinzelte, bis sie wieder klar sehen konnte, doch der Name war immer noch derselbe. »Du lieber Gott«, hauchte sie, und die Vergangenheit brach über sie herein wie eine gewaltige Flutwelle.
1
Crystal Palace ist ein Bezirk von Süd-London zwischen Dulwich, Croydon und Brixton. Der Name ist mit vielen verschiedenen Dingen in Verbindung gebracht worden. Geprägt wurde die Bezeichnung »Crystal Palace« von der Zeitschrift Punch für das Gebäude der Großen Weltausstellung von 1851 – eine Konstruktion aus Eisen und Glas, entworfen von Joseph Paxton, die 1854 im Crystal Palace Park neu errichtet und am 30. November 1936 durch einen Brand zerstört wurde.
www.crystalpalace.co.uk
Crystal Palace, August, fünfzehn Jahre zuvor
Er saß auf den Stufen vor der Eingangstür des Hauses in der Woodland Road und zählte die Geldscheine, die er in der Keksdose aufbewahrte – alles, was vom Lohn seiner Mutter übrig war. Mit gerunzelter Stirn zählte er noch einmal nach. Es fehlten zehn Pfund. Oh, verdammt. Sie hatte das neue Versteck gefunden und es geplündert. Schon wieder.
Er blinzelte, als ihm plötzlich die Tränen in die Augen schossen, und rieb sich mit dem Handrücken die Nase, während er gegen die Panik ankämpfte, die sich in seiner Magengrube ausbreitete.
Nicht nur Panik, auch Hunger. Es war erst Mittwoch, und den nächsten Lohn bekam sie erst am Samstag. Wie sollte er sie beide von dem bisschen Geld, das noch übrig war, bis dahin ernähren? Dabei rührte seine Mum die Eier mit Toast, die er ihr morgens zum Frühstück machte, sowieso kaum an. Und wenn sie einmal im Pub angefangen hatte, schien sie sich nur noch von Zigaretten und ab und zu einem Teller Pommes frites zu ernähren.
Pommes. Sein Magen knurrte. »Ruhe da unten«, sagte er laut. Er könnte sich zum Abendessen Toast mit Marmite machen. Und nächste Woche würde er sich ein besseres Versteck für das Geld suchen.
In den letzten Monaten war er dazu übergegangen, am Samstagabend vor dem Pub auf sie zu warten, wenn sie ihren Lohn ausbezahlt bekam, auch wenn sie ihn dafür ausschimpfte, dass er sich so spät allein im Zentrum herumtrieb. Der Wirt, Mr Jenkins, drückte ihm das Geld direkt in die Hand, begleitet von einem Augenzwinkern und einem herzhaften Klaps auf den Rücken. Mr Jenkins war eigentlich ganz in Ordnung, auch wenn Andy sich sicher war, dass er etwas von dem Geld für die Drinks einbehielt, die seine Mum konsumierte.
An den Abenden, an denen sie torkelnd nach Hause kam, dachte er lieber nicht viel darüber nach, woher sie das zusätzliche Geld hatte. Und er dachte auch lieber nicht darüber nach, was passieren würde, wenn er nach den Sommerferien wieder in die Schule musste. Er würde nicht zu Hause sein, wenn sie aufwachte, würde nicht dafür sorgen können, dass sie etwas aß, nicht darauf achten, dass sie wenigstens bis zum Beginn ihrer Schicht nüchtern blieb.
In letzter Zeit schien es mit ihr immer schlimmer zu werden, und wenn sie ihren Job verlor … Er schüttelte den Kopf und weigerte sich schlicht, in diese Richtung auch nur zu denken.
Irgendetwas würde ihm schon einfallen. Ihm war noch immer etwas eingefallen. Vielleicht könnte er ja irgendeinen Job kriegen; immerhin war er schon dreizehn.
Er blinzelte wieder, diesmal aber, weil ihm der Schweiß in die Augen rann. Die Sonne war noch nicht hinter den Häusern auf der Westseite der Woodland Road versunken, und es war heiß hier auf der Treppe, aber in ihrer Erdgeschosswohnung war es auch noch stickig.
Außerdem machte es ihm Spaß, das nachmittägliche Kommen und Gehen auf der Straße zu beobachten. Und einfach die Aussicht zu genießen. Die steile Straße, in der sie wohnten, bot einen schäbigen Anblick; die meisten Häuser waren in schlechtem Zustand, einige standen gar leer. Doch wenn er nach Norden schaute, den Hang hinunter, konnte er eine grüne Fläche durch den Dunst schimmern sehen. Das war London, und er wusste, dass gleich unterhalb seines Blickfeldes die Biegung der Themse lag.
Wenn er zum oberen Ende der Straße hinaufstieg, konnte er das Herz der großen Stadt sehen, flimmernd wie eine Fata Morgana. Eines Tages würde er dort leben – dort, wo immer etwas los war. Er würde diesem todlangweiligen Crystal Palace den Rücken kehren, und er würde seine Mum mitnehmen. Wenn sie woanders wohnten, würde sie vielleicht noch einmal die Kurve kriegen.
Aufgemuntert durch diesen Gedanken überlegte er sich die Sache mit dem Marmite-Toast noch einmal. Im Schrank war noch eine Dose Baked Beans – die könnte er sich stattdessen warm machen und sich danach den Schokoriegel genehmigen, den er gebunkert hatte.
Der Nachmittag zog träge dahin; alles war totenstill, bis auf das Knurren seines Magens. Er hatte gerade beschlossen, dass er das Abendessen nicht länger hinausschieben konnte, als er vom unteren Ende der Straße das Knirschen eines Getriebes hörte. Ein kleines Auto kam den Berg heraufgetuckert. Er erkannte es wieder – es war ein VW, der schon bessere Tage gesehen hatte.
Als der Wagen vor dem Haus nebenan am Bordstein hielt, erkannte er auch die Fahrerin. Es war ihre neue Nachbarin – eine Witwe, hatte seine Mutter ihm erklärt, obwohl er fand, dass die Frau, die jetzt aus dem Auto stieg, für eine Witwe viel zu jung aussah. Eher wie die große Schwester von irgendwem, mit ihrem geblümten Sommerkleid und den sanft gewellten braunen Haaren.
Die beiden Häuser waren symmetrisch, und die Haustüren lagen direkt nebeneinander, sodass er die Frau, als sie jetzt die Stufen hinaufging, fast hätte berühren können. Sie war mit einer Einkaufstüte beladen, und er überlegte kurz, sie zu fragen, ob sie Hilfe brauche, doch er war zu schüchtern.
Dann aber, als sie auf seiner Höhe war, fing sie seinen Blick auf und nickte. Es war ein ernsthaftes Nicken, eine Begrüßung wie unter Erwachsenen. Er erwiderte sie.
Sie nahm die Einkaufstüte in die andere Hand, um in ihrer Handtasche nach dem Hausschlüssel zu kramen, doch als sie ihn gefunden und ins Schloss gesteckt hatte, hielt sie inne. »Heiß heute, nicht wahr?«, sagte sie.
Sie sprach diesen kleinen Satz mit solcher Ernsthaftigkeit aus, dass er fand, er verdiene eine angemessen kluge Erwiderung. Aber leider war sein Mund mit einem Mal wie ausgetrocknet, und die Zunge klebte ihm am Gaumen. »Hier draußen ist es kühler«, brachte er schließlich krächzend heraus.
Sie schien darüber nachzudenken. »Was ist mit eurem Garten?«, fragte sie. »Da müsstet ihr doch um diese Tageszeit Schatten haben.«
»Da hinten gibt es nichts zu sehen.« Ihre Wohnung hatte Zugang zu dem langen, schmalen Garten hinter dem Haus, aber er war verwahrlost und von Unkraut überwuchert. Gartenarbeit gehörte nicht gerade zu den Stärken seiner Mutter.
»Das stimmt allerdings.« Ihr Lächeln war flüchtig und unpersönlich, und er war sich sicher, dass sie ihn für einen Schwachkopf halten musste. Doch als sie den Schlüssel im Schloss umdrehte, blickte sie sich noch einmal zu ihm um, als ob sie einem plötzlichen Impuls folgte. »Übrigens«, sagte sie, »ich bin Nadine. Ich habe kalte Limonade im Kühlschrank. Ich könnte dir eine rausbringen, wenn du magst.«
Es gab doch kaum etwas Schöneres als so einen knackig kalten Wintertag im Hyde Park, dachte Duncan Kincaid.
Schon als kleiner Junge in Cheshire hatte er die winterkahlen Bäume vor dem Hintergrund des klaren, blassblauen Himmels der üppigen Pracht des Sommers vorgezogen. Und offensichtlich war er nicht der Einzige, der den ersten schönen Tag nach zwei Wochen scheußlichsten Januarwetters genießen wollte – der Park war voll von Menschen, die joggten, ihre Hunde ausführten oder mit ihren Kindern spazieren gingen.
Er selbst gehörte sozusagen zu allen drei Kategorien gleichzeitig.
»Papa«, sagte Charlotte in ihrem Buggy, »ich will die Pferde sehen.«
»Du willst immer die Pferde sehen«, neckte er sie. Seit einiger Zeit sagte sie Papa zu ihm. Nicht Dad, wie Kit, oder Daddy, das Wort, das Toby abwechselnd mit Duncan benutzte. Er hatte Louise Phillips, die Anwaltskollegin von Charlottes verstorbenem Vater, gefragt, ob Charlotte Naz so genannt habe, doch sie hatte verneint; aus Charlottes Mund habe sie immer nur das pakistanische Abba gehört. Dann musste sie den »Papa« wohl aus einem ihrer Bilderbücher haben – vielleicht sogar aus Alice im Wunderland, das immer noch ihre Lieblingsgeschichte war. Inzwischen hatten sie es schon so oft gelesen, dass er glaubte, jeder einzelne Satz müsse sich unauslöschlich in sein Gehirn eingebrannt haben.
»Pferde sehen«, fügte Charlotte kichernd hinzu. »Pferde sehen ist besser als Fernsehen.« Für eine Dreijährige hatte sie schon einen ausgeprägten Sinn für Humor und konnte sich besonders über Sprachspielereien amüsieren. »Bob will auch Pferde sehen«, stellte sie sodann fest und setzte sich ihren zerrupften Plüschelefanten auf dem Schoß zurecht, damit er die Aussicht besser genießen konnte. Charlotte hatte anfangs gegen den Kinderwagen protestiert und darauf beharrt, sie sei alt genug, um selbst zu gehen, und Kincaid hatte sie nur überzeugen können, indem er erklärt hatte, Bob würde doch sicher gerne in einem Buggy fahren, der auch »Bob« hieß – eine Marke, die bei den jungen Eltern von Notting Hill sehr beliebt war.
Kincaid verlangsamte seinen Schritt auf Spaziergeschwindigkeit, und selbst Geordie, der Cockerspaniel, schien für die Verschnaufpause dankbar zu sein. Terrierhündin Tess blieb zu Hause, wenn Duncan mit Charlotte und Geordie joggen ging, da sie mit ihren kurzen Beinchen nicht mithalten konnte.
Jetzt blickte Geordie mit heraushängender Zunge fragend zu Kincaid auf. »Du bist auch schon ganz wild auf die Pferde, was, Junge?«, fragte Kincaid. Er hatte zu seinem Verdruss feststellen müssen, dass der Anblick und der Geruch von Pferden ihren sonst so gutmütigen Hund in ein kläffendes, geiferndes Ungeheuer verwandelten. Geordie überschätzte ganz offenbar seine Körpergröße, jedenfalls im Verhältnis zu seiner Angriffslust.
»Heben wir’s uns für nächstes Mal auf, ja?«, schlug er Charlotte vor und schob den Buggy vom Weg auf den Rasen. »Du könntest stattdessen ein bisschen für Geordie den Ball werfen.«
Ihr üppiger karamellfarbener Lockenschopf kitzelte ihn an der Nase, als er ihren Gurt aufschnallte und sie schwungvoll aus dem Wagen hob, um sie auf dem Boden abzusetzen. Er konnte den Duft des Bio-Babyshampoos riechen, das er ihr zu Gemmas Erheiterung gekauft hatte, vermischt mit einem undefinierbaren Hauch des Exotischen. Essence de Charlotte, dachte er mit ironischem Lächeln, während er Geordie von der Leine nahm und den Tennisball aus der Anoraktasche zog.
Geordie machte sogleich brav »Sitz« und bellte in freudiger Erwartung. Dieses kostbare Objekt war kein gewöhnlicher Tennisball, sondern ein Hundeball, knallpink und grün, die Außenhaut rissig, der Quietscher längst herausgerissen – und doch liebte Geordie die leere Hülle aus seinem ganzen kleinen Cockerspaniel-Herzen.
Kincaid warf den Ball, und Hund wie Mädchen jagten hinterdrein, Geordie aufgeregt kläffend, Charlotte schrill kreischend. Natürlich erreichte Geordie ihn als Erster, und sofort entspann sich eine wilde, ausgelassene Jagd.
Kincaid war am Rand einer grasbewachsenen Senke nahe dem Nordrand des Parks stehen geblieben, und das Spiel gab ihm Gelegenheit, Atem zu schöpfen und sich dabei ein wenig unter den anderen Parkbesuchern umzuschauen. Er sah zu, wie sie joggten, spazieren gingen oder Frisbees für ihre Hunde warfen, während ein paar ganz Abgehärtete einfach nur dasaßen und sich die willkommene Wintersonne ins Gesicht scheinen ließen. Musste hier eigentlich keiner arbeiten? Ein Mann und eine Frau kamen aus verschiedenen Richtungen aufeinander zu und blieben stehen, scheinbar nur für ein paar beiläufige Worte, doch als die Frau sich umsah, wirkte ihr Blick verstohlen. Dann nahm sie den Arm des Mannes, und sie gingen zusammen weiter.
Ein heimliches Stelldichein, dachte Kincaid und schalt sich gleich darauf für seinen eigenen Argwohn. Da kam wieder der Kriminalbeamte in ihm durch – offenbar gelang es ihm immer noch nicht, vom Dienst abzuschalten. Dabei nützte ihm sein Polizisteninstinkt dieser Tage herzlich wenig, wenngleich es eine gehörige Portion Wachsamkeit erforderte, auf drei Kinder im Alter von drei, sechs und vierzehn Jahren aufzupassen.
Als er und Gemma gegen Ende des vergangenen Sommers Charlotte in Pflege genommen hatten, waren sie übereingekommen, dass zunächst Gemma in Elternzeit gehen würde. Falls sich später herausstellen sollte, dass Charlotte sich immer noch nicht an eine Betreuung außer Haus gewöhnen konnte, würde Gemma wieder arbeiten gehen, und Kincaid würde für den gleichen Zeitraum Erziehungsurlaub nehmen.
Allerdings war es nicht ganz so gelaufen, wie sie es geplant hatten.
Statt ihren Dienst als Detective Inspector auf dem Polizeirevier Notting Hill wieder antreten zu können, war Gemma gebeten worden, kurzfristig in einem Mordermittlungsteam in South London einzuspringen, und zwar im Rang eines stellvertretenden Detective Chief Inspector.
Kincaid hatte mit Stolz – und auch mit ein wenig Neid – verfolgt, wie sie sich in ihren neuen, anspruchsvollen Job eingearbeitet hatte. Und während er anfangs Mühe gehabt hatte, sich in der Rolle als Hausmann und Vater in ihrer Patchworkfamilie zurechtzufinden, hatte er auch festgestellt, dass er die Kinder dadurch auf eine Art und Weise kennenlernte, wie er es sich nie hatte vorstellen können, als ihn seine eigene Arbeit noch voll und ganz in Anspruch genommen hatte.
Aber dann war seine Elternzeit zum Ersten des Jahres ausgelaufen, und es hatte sich gezeigt, dass Charlotte doch noch nicht reif für die Tagesbetreuung war. Eine Woche lang hatten sie es in der Schule in ihrem Viertel versucht – es war eine Katastrophe. Charlotte war untröstlich gewesen und hatte die ganze Woche lang von morgens bis abends nur geheult. Schließlich hatte sogar die Erzieherin ihnen nahegelegt, dass das Mädchen vielleicht noch etwas mehr Zeit in seinem neuen Zuhause brauchte, ehe man es dem Stress einer ungewohnten Umgebung aussetzte. Die ausgeprägte Trennungsangst von Kindern wie Charlotte, die einen sehr schweren Verlust erlitten hatten, verlange sehr viel Zeit und Geduld, hatte Miss Love ihnen in dem belehrenden Ton erklärt, der normalerweise für ihre Schützlinge vorbehalten war.
Als ob sie das nicht selbst wüssten, hatte Kincaid gedacht und sich auf die Zunge gebissen.
Jetzt war es Mitte Januar, und Kincaid fragte sich allmählich, wie lange sein Geduldsvorrat noch reichen würde. Er vermisste seine Arbeit, und gleichzeitig bereitete es ihm Sorge, dass die Arbeit ihn offenbar nicht zu vermissen schien.
»Papa, bist du traurig?«, fragte Charlotte. Das Ballspiel hatte offenbar seinen Reiz schon wieder verloren. Sie kniete neben einem Laubhaufen unter einem Baum und betrachtete Kincaid eingehend mit ihren leuchtenden blaugrünen Augen, die sich auffallend von ihrer hellbraunen Haut abhoben. Charlotte hatte ein so feines Gespür für seine Stimmungen entwickelt, dass es ihm manchmal schon unheimlich war.
»Natürlich bin ich nicht traurig«, sagte er und ging auf sie zu. Geordie beschnupperte sein Gesicht, als Kincaid sich hinkniete, und hinterließ einen nassen Fleck auf seiner Wange. »Wie könnte ich traurig sein, wenn ich mit dir in den Park gehen kann? Was hast du da gefunden?«, fügte er hinzu. Sie hatte etwas aus dem Laub gefischt, und es war eindeutig nicht Geordies Ball.
»Eine nackige Frau.« Charlotte hielt ihm ihren Fund hin. Es war tatsächlich eine nackte Frau – eine Barbiepuppe mit etwas schief sitzendem Kopf, das blonde Haar wirr und zerzaust. »Darf ich sie behalten?«, fragte Charlotte.
»Na ja, warum nicht?«, meinte Kincaid, obwohl ihm durchaus bewusst war, was Gemma von Barbiepuppen hielt. Vielleicht würde diese hier ja nicht zählen. Die Haut der Puppe wirkte in Charlottes Hand unnatürlich rosa, ihr Körper mit seiner bizarren Anatomie fremdartig. Aber Charlotte hatte nun einmal eine sehr fürsorgliche Ader; schon lief sie auf ihren Buggy zu, wo sie die Puppe in ein Stück einer alten Babydecke hüllte, das sie immer für Bob den Elefanten dabeihatte.
»Sie friert«, erklärte Charlotte, und Kincaid bemerkte plötzlich, dass das Wetter umschlug. Der strahlend blaue Januarhimmel hatte sich eingetrübt, und im Westen sah er eine dunkle Wolkenbank heraufziehen.
»So, rein mit dir«, sagte er, während er sie wieder in den Buggy hob und nach Geordie pfiff. »Sonst muss deine arme Puppe nicht nur frieren, sondern wird auch noch nass. Nach Hause, James.«
»Ich heiß doch gar nicht James. Und ich will nicht nach Hause«, protestierte Charlotte. »K und P, K und P«, trällerte sie, als er den Kinderwagen wendete und in Richtung Notting Hill zurückzulaufen begann.
»K und P, hm?« Er runzelte die Stirn und tat so, als ob er überlegte. »Na ja, ich denke, wir könnten kurz dort vorbeischauen. Vielleicht treffen wir ja MacKenzie und Oliver, was?« Das Kitchen and Pantry, ein Café in der Kensington Park Road, hatte sich an Vormittagen unter der Woche zu einem regelmäßigen Anlaufpunkt entwickelt, wie auch für viele Mütter aus dem Viertel mit kleinen Kindern. Zumindest bot es Charlotte eine Gelegenheit, mit anderen Kindern in Kontakt zu kommen, sagte sich Kincaid, während er seinen Schritt beschleunigte.
Ganz zu schweigen davon, dass es ihm die Gelegenheit gab, ein wenig Zeit in Gesellschaft von Erwachsenen – und, ja, speziell in weiblicher Gesellschaft – zu verbringen. Er gab sich alle Mühe, die Tatsache zu ignorieren, dass ihm die Kapitulation von Tag zu Tag ein wenig leichter fiel.
»Wir hätten in Clerkenwell auftreten können.« George blickte von seiner Snare Drum auf, die er gerade spannte. Sein rundes Gesicht war von der Hitze im Pub schon ganz rot, sein Ton genervt.
»Wie oft sind wir schon in jedem verdammten Pub in North London aufgetreten?«, gab Andy zurück. Er wusste genau, dass er im Unrecht war, und das erklärte seine defensive Haltung. Der Gig, den sie ausgeschlagen hatten, wäre im Slaughtered Lamb gewesen, einer guten Musikkneipe, bekannt als Sprungbrett für hoffnungsvolle junge Bands. »Es wurde mal Zeit, dass wir etwas anderes machen.« Er fand selbst, dass es nicht sehr überzeugend klang.
Nick hielt den Kopf über die Wirbel seiner Bassgitarre gebeugt und sah keinen der beiden an. »Du meinst, es wurde Zeit, dass du etwas anderes machst«, sagte er. Seine Stimme verriet, wie gekränkt er war.
In jeder Band neigen die einzelnen Mitglieder dazu, sich ihre jeweils eigene Persönlichkeitsnische zu suchen, und in ihrer war George, seinem fröhlichen, ein wenig pummeligen Äußeren zum Trotz, der Nörgler. Andy hatte die typischen Allüren eines Leadgitarristen. Und Nick, der Leadsänger und Bassist, strahlte die unerschütterliche Gelassenheit der letztgenannten Spezies aus. Wenn Nick wütend wurde, wusste man, dass man zu weit gegangen war.
»Hört mal, Leute«, begann Andy, doch er musste die Stimme heben, um sich in dem anschwellenden Lärm verständlich zu machen, den die Gäste nach dem Ende der Freitagabend-Happy-Hour veranstalteten. Es war ein gutes Pub, aber die Band war offenbar nebensächlich, sobald es ums Essen und Trinken ging, und außerdem waren sie in einer kleinen Nische am Ende des Tresens eingezwängt. »Tam hat gesagt, dass dieser Produzent kommen würde …«
»Um dich zu hören«, unterbrach ihn George und warf ihm einen finsteren Blick zu. »Nicht, dass man in diesem Laden allzu viel hören könnte. Und weißt du eigentlich, wie weit weg ich den verdammten Bus parken musste?« Sie hatten den verbeulten Ford Transit zum Entladen im Halteverbot vor dem White Stag abgestellt, worauf George sich auf die Suche nach einem Parkplatz gemacht hatte. Erst nach vollen zwanzig Minuten war er wieder aufgetaucht, nass vom Regen und ziemlich angefressen. »Da könnten wir auch gleich auf einer einsamen Insel auftreten. Crystal Palace, Mann – ich meine, geht’s noch?«
Da hat er absolut recht, dachte Andy, und er verfluchte sich selbst. Er hatte gewusst, dass es eine schlechte Idee war, aber Tam hatte so überzeugend geklungen. Für einen Manager war Tam gar kein so schlechter Kerl. Er hatte sein Bestes für sie gegeben, aber in letzter Zeit beschlich Andy das Gefühl, dass selbst Tams Gutmütigkeit an ihre Grenzen stieß und sein Optimismus erlahmte. Die meisten Bands hatten nur eine begrenzte Lebenserwartung, und für ihn und seine Freunde lief die Zeit allmählich ab. Wenn sie bis jetzt den Durchbruch nicht geschafft hatten, würden sie ihn wahrscheinlich nie mehr schaffen.
Die Tatsache, dass sie alle es wussten, machte es auch nicht leichter, und es bedeutete auch nicht, dass sie darüber redeten. Aber Nick hatte sich für einen Kurs in Rechnungswesen eingeschrieben. George arbeitete tagsüber in der Reinigung seines Vaters in Hackney. Und Tam hatte für Andy immer öfter Studiosessions ohne die Band gebucht. Die Wahrheit war, dass Andy besser war als die anderen, und auch das wussten sie alle. Aber sosehr Andy auch über die Band gemeckert und darauf beharrt hatte, dass sich etwas ändern müsse, fiel es ihm doch verdammt schwer, als es nun wirklich konkret wurde. Sie waren Freunde. Sie hatten in wechselnden Besetzungen zehn Jahre lang fast ununterbrochen zusammen gespielt. Nick und George waren beinahe so etwas wie seine Familie, und erst jetzt wurde ihm allmählich klar, was es bedeuten würde, sie zu verlieren.
»Hört mal, Leute«, sagte Andy noch einmal, »es ist ja nur der eine Abend, okay? Danach können wir …«
»Tam ist da.« George nahm auf seinem Hocker Platz und unterstrich seine Worte mit einem leichten Schlag auf die SnareDrum. »Und wo ist denn nun dieser geheimnisvolle Produzent, der kommen wollte, um zu sehen, ob du mit einem Mädchen spielen kannst?«
»Halt doch die Klappe, ja?«, fauchte Andy. Er konnte sehen, wie Tam sich seinen Weg durch die Menge bahnte, ein erwartungsvolles Lächeln auf den Lippen. Der richtige Name ihres Managers war Mick Moran, aber das hatten die meisten schon vergessen. Er stammte aus Glasgow, und seinen Spitznamen verdankte er seinem Tam O’Shanter, der Schottenmütze, mit der er winters wie sommers seine Glatze bedeckte. Die Mütze war so alt, dass der rot-grüne Moran-Tartan längst verblasst und von den Mustern anderer Clans nicht mehr zu unterscheiden war.
»Hallo, Jungs«, sagte Tam, als er die Bühne erreichte. »Alles klar so weit? Gutes Publikum, wie’s scheint.« Er wippte auf den Fußballen und grinste sie an.
»Sicher, Tam.« Andy rang sich ein Lächeln ab und verkniff sich die Bemerkung, dass das Publikum ganz nach der Sorte aussah, die immerzu dazwischenbrüllte und die langweiligsten Coverversionen verlangte, die man sich vorstellen konnte. Weder Nick noch George erwiderten etwas, und als er sich zu ihnen umsah, sprach aus ihren Mienen Meuterei.
Na schön, dachte Andy. Wenn das ihre Einstellung war, dann bitte. Er strich noch einmal mit dem Plektrum über die Saiten seiner Strat, um die Stimmung zu prüfen, und spielte dann die eingängigen Anfangsakkorde von Green Days Good Riddance. Normalerweise sang er Back-up, aber dies war einer der wenigen Songs, bei denen er die Leadstimme hatte und nicht Nick.
Von da an ging es den ganzen Abend stetig bergab. Nick und George verschleppten den Takt, und als Nick die Leadstimme übernahm, nuschelte er und verschluckte die Silben. Als Andy Tam hinten im Publikum entdeckte und seine besorgte Miene sah, spielte er schneller und lauter. Wenn seine Bandkollegen beschlossen hatten, ihm diesen Auftritt zu versauen, dann machten sie ihre Sache bisher verdammt gut.
Dann sah er einen anderen Mann bei Tam stehen. Groß, mit kurz geschorenen Haaren, Bart und Nickelbrille. Caleb Hart, der Produzent, der Tam gebeten hatte, ihnen diesen Gig zu buchen. Der Produzent, der eine vielversprechende junge Sängerin entdeckt hatte und einen Gitarristen brauchte, um mit ihr Aufnahmen zu machen. Caleb Hart und Tam kannten sich schon ewig, und als Tam ihm erzählt hatte, dass er einen guten Sessionmusiker an der Hand habe, hatte Hart diesen Auftritt vorgeschlagen, dem am nächsten Tag eine Probesessionin einem Studio in Crystal Palace folgen sollte, das er öfter benutzte. Er wollte Andy mit der Band hören, und Andy hatte den Fehler begangen, Nick und George den Grund für dieses Engagement zu verraten.
Jetzt sagte Hart etwas in Tams Ohr und schüttelte den Kopf.
Die Band holperte durch die letzten Takte von Nirvanas Smells Like Teen Spirit, und Andy trat der Schweiß der Verzweiflung auf die Stirn. Im Publikum rief jemand: »Mumford!«
Aus einer anderen Ecke des Lokals konterte irgendein Witzbold mit »Stairway to Heaven, du Wichser!« Ein Stöhnen ging durch die Menge. »Stairway, Stairway«, skandierten die Freunde des Witzbolds, und im Publikum begann es zu brodeln. Die Temperatur im Pub war gestiegen, der Alkoholkonsum ebenso, und Andy wusste, dass die Stimmung sehr schnell kippen konnte.
Stairway to Heaven stand bei den meisten Bands ganz oben auf der Liste der meistgehassten Titel, und Nick bekam den Gesangspart von Robert Plant beim besten Willen nicht hin. Aber Andy hatte die Leadgitarre von Jimmy Page hundertprozentig drauf, also trat er auf den Verzerrer und legte gleich mit dem Gitarrensolo los, das er mit einem bluesigen Reggae-Feeling spielte. Es dauerte keine Minute, bis die Menge vor Begeisterung stampfte.
Als er wusste, dass er sie gepackt hatte, ging er zu Dr. Feelgoods Milk and Alcohol über, wobei er Wilko Johnsons Leadpart spielte und Lee Brilleaux’ raue Gesangsstimme imitierte. Gott sei Dank war die Nummer nicht allzu schwierig, sodass er gleichzeitig spielen und singen konnte.
Erst als er den letzten Akkord anschlug und sich vor dem Publikum verbeugte, merkte er, dass er blutete. Er hatte sich in den linken Daumen geschnitten, doch die hellroten Blutspritzer waren auf dem roten Lack der Strat kaum zu sehen.
»Zeit, mal die Luft aus den Gläsern zu lassen«, sagte er ins Mikro. »Wir sind gleich wieder da.«
Er blickte suchend ins Publikum. Tam und Caleb Hart waren nirgendwo zu entdecken. Aber dann tauchte ein Profil in seinem Blickfeld auf – das Gesicht einer Frau, das nur ganz kurz im hinteren Teil des Raums zu sehen war, ehe sie wieder von den anderen Gästen verdeckt wurde. Dann war sie verschwunden, doch etwas hatte eine Erinnerung aufgewühlt; er war verwirrt und außer Atem, als ob plötzlich die ganze Luft aus dem Raum entwichen wäre.
Dann hörte er George lachen – ein schrilles Kichern –, und er nahm wieder das Blut an seinem Daumen wahr, spürte wieder seine eigene Wut. »Ihr Arschlöcher«, fuhr er Nick und George an. »Was zum Teufel habt ihr euch dabei gedacht?«
George hob ein volles Pintglas und prostete ihm ironisch zu. »Auf unseren Gitarrenstar.«
»Ihr Arschlöcher«, wiederholte Andy. Er zitterte, und einen Moment lang fragte er sich, ob er vielleicht krank wurde. »Ihr habt mit voller Absicht …«
Eine Hand zupfte an seinem Ärmel. »He, Alter.« Die Stimme klang leicht vernuschelt.
Andy drehte sich um und sah sich einem Typen etwa in seinem Alter gegenüber, der einen zerschlissenen Kapuzenpulli trug. Als Andy ihn stirnrunzelnd ansah, schlug der Typ die Kapuze zurück und ließ seine braunen Haare sehen, die trotz des Kurzhaarschnitts irgendwie ungepflegt aussahen. Ein Lichtstrahl fiel auf das spärliche Kinnbärtchen unter seiner etwas zu vollen Unterlippe.
»Hör mal«, sagte Andy, »ich bin hier mitten in einem …«
»Hab’s doch immer gewusst, dass du mal richtig gut wirst. Schöne Gitarre.« Der Typ streckte die Hand nach der Strat aus.
»Fass meine Gitarre nicht an!« Andys Reaktion war automatisch. Wieder zerrte die Erinnerung an ihm, und ihm war flau im Magen. »Du …« Er schüttelte den Kopf und sah sich das Gesicht des Typen noch einmal genauer an. Hätte er nur seine Brille mitgenommen. »Kennen wir uns?«
»Ha, ha. War doch immer schon ein Scherzkeks, unser Andy.«
Was zum Teufel wollte der Typ von ihm? Andy trat einen Schritt zurück. »Hör zu, verpiss dich einfach, ja? Und nenn mich nicht …«
»Erinnerst du dich wirklich nicht an mich?« Der Typ mit dem Kinnbärtchen klang jetzt gereizt, und irgendetwas an seinem Tonfall gab seiner Erinnerung den entscheidenden Schub. Jetzt wusste er, wer dieser Typ war, der ihm die ganze Zeit schon irgendwie bekannt vorgekommen war.
»Joe?«
»Ich wusste, dass du es bist, als ich das Plakat für die Band gesehen habe. Ich wusste, dass du eines Tages zurückkommen würdest.« Joe lächelte und ließ seine weißen, ebenmäßigen Zähne sehen, die nicht so recht zu seinem eher verwahrlosten Äußeren zu passen schienen. »Ich dachte mir, wir könnten vielleicht zusammen einen trinken. Auf die alten Zeiten, hm? Oder bist du jetzt zu gut für uns? Andy, der Rockstar.«
Das Kinnbärtchen. Joe. Es war tatsächlich dieser verdammte Joe, und er bot ein noch jämmerlicheres Bild als damals. »Die alten Zeiten? Du miese Ratte.« Er wusste, dass er schrie, aber es war ihm egal. »Du – Wie kommst du darauf, dass ich deine blöde Fresse jemals wiedersehen will?« Andy sah die Umstehenden nur als verschwommene Masse durch den rotglühenden Nebel seiner Wut.
»He, Mann, das ist doch Jahre her!« Joes Ton hatte jetzt etwas Einschmeichelndes. »Alles Schnee von gestern. Können wir das nicht einfach ver–«
»Vergessen? Das könnte dir so passen!« Andy spuckte ihn an und ballte unwillkürlich die Fäuste. Nick näherte sich ihm von hinten und murmelte etwas, doch Andy stieß ihn mit der Schulter zurück.
»Ich wollte doch nur, dass wir Freunde sind, weiter nichts …«
»Freunde? Freunde? Das hättest du dir vielleicht damals überlegen sollen, meinst du nicht?« Andy war plötzlich ganz kalt, und alles um ihn herum verblasste, bis er nichts mehr wahrnahm als dieses Summen in seinen Ohren. Er wollte nur noch, dass dieses Gesicht aus seinem Blickfeld verschwand. »Verpiss dich einfach, okay?« Seine rechte Faust krachte in Joes Gesicht.
Dann schlang Nick die Arme um ihn und zerrte ihn rückwärts durch das Gewirr von Kabeln, um ihn auf seinem Verstärker abzusetzen.
Ein neues Gesicht tauchte über ihm auf, ein Mann mit weißen Haaren, der ihn mit dröhnender Stimme zurechtwies. »… solches Benehmen in einem öffentlichen Lokal nicht dulden … man sollte die Polizei rufen … die Gäste verprügeln, Sie Rowdy.«
»Rowdy?« Andy brachte ein ersticktes Lachen hervor. »Sie haben doch keine Ahnung. Wer sind Sie überhaupt?« Er versuchte aufzustehen, um diesem Wichser so richtig die Meinung zu sagen, doch Nick hielt ihn immer noch fest an den Schultern gepackt.
»Lassen Sie den Jungen in Ruhe.« Das war Tams Stimme. »Und passen Sie bloß auf seine Gitarre auf«, fügte er hinzu. Sein angespanntes Gesicht tauchte über Andy auf, als er ihm den Umhängegurt der Strat über den Kopf zog und sie auf dem Ständer abstellte. »Und du, Jungchen, raus mit dir«, befahl er und zog Andy mit einem Ruck auf die Beine. Die Menge teilte sich, als Tam ihn in Richtung Ausgang schob. Von Joe und dem weißhaarigen Mann war nichts mehr zu sehen.
Tam bugsierte ihn durch den Seitenausgang auf die Church Road hinaus, und Andy schnappte nach Luft, als ihm die plötzliche Kälte entgegenschlug. Aus dem Nieselregen war Nebel geworden, dicht wie Watte.
Tam drehte Andy zu sich herum, sodass er ihn ansehen musste, und schüttelte ihn. »Was zum Teufel hast du dir dabei gedacht? Erst lässt du diese Idioten den Gig sabotieren, und dann fängst du auch noch eine verdammte Kneipenschlägerei an?« Der Nebel dämpfte seine Stimme, doch Andy hatte Tam noch nie so wütend gesehen.
»Ich …«
»Erzähl mir bloß nicht, dass du dir die verdammte Flosse gebrochen hast«, fuhr Tam mit etwas sanfterer Stimme fort, doch der Glasgower Akzent war immer noch sehr ausgeprägt. »Zeig mal her.«
Andy hielt seine rechte Hand hoch. Er wunderte sich, dass er gar keine Schmerzen gespürt hatte.
»Kannst du die Finger bewegen?«
Andy wackelte versuchsweise mit den Fingern und nickte. Dann drückte er die Hand, die auf einmal teuflisch wehtat, an seine Brust.
»Eis. Du tust am besten Eis drauf.« Tams Stimme war jetzt wieder stahlhart. »Aber erst erzählst du mir, was da drin los war. Und du kannst heilfroh sein, dass Caleb Hart gegangen ist, bevor du deine kleine Nummer abgezogen hast.«
»Die zwei waren stinksauer, Nick und George«, sagte Andy in der Hoffnung, Tam von dem abzulenken, was hinterher passiert war. »Ich finde, sie haben das Recht …«
»Sie haben das Recht, samstags in ihren popeligen Eckkneipen zu spielen, wenn ihnen das Spaß macht. Sie sind Amateure. Aber du …« Tam bohrte Andy den Finger in die Brust und verfehlte nur knapp dessen verletzte Hand. »Du hast heute gerade noch mal die Kurve gekriegt. Caleb will immer noch, dass du morgen mit dem Mädel spielst, und ich will doch schwer hoffen, dass du dann deine Griffel wieder zum Gitarrespielen benutzen kannst.«
»Aber ich kann nicht …«
»Ich will nichts hören.« Tam trat zurück. Seine Augen hatten sich zu Schlitzen verengt, seine Stimme war leise, und das war noch schlimmer als sein Wutausbruch zuvor. »Wenn du das hier versaust, Jungchen, dann hast du nicht so viel Hirn, wie der liebe Gott einem Schaf geschenkt hat, und dann ist dein Talent nicht mal so viel wert wie dein oller, versiffter Gitarrenkoffer.« Er holte tief Luft und fuhr dann noch leiser fort: »Wenn du jetzt kneifst, dann bin ich fertig mit dir. Hast du mich verstanden, Jungchen? Zehn Jahre hab ich dir gegeben, alles für eine Chance wie diese, und jetzt hast du nicht den Mumm, sie zu nutzen.«
Tam hätte eigentlich eine lächerliche Figur abgeben müssen, wie er seine Patschhände in die Seiten stemmte, die Lippen zu einem blutleeren Strich zusammengepresst, aber dem war nicht so.
Andy fröstelte. Er spürte einen Strudel der Gewalt in der kalten Luft, ein Pulsieren negativer Emotionen, bei dem es ihn eiskalt überlief.
Aber es kam nicht von Tam – Tams Wut war greifbar, direkt. Da war noch etwas anderes, dort draußen im Nebel, eine undefinierbare Aura des Bösen, und Andy bekam es plötzlich mit der Angst zu tun.
Und außerdem wusste er, dass Tam recht hatte.
2
Die Grenzen des Bezirks Crystal Palace sind nicht eindeutig definiert. Der Name ist abgeleitet von Crystal Palace Park, doch es gibt auch einen Bahnhof Crystal Palace und den Stimmbezirk Crystal Palace Ward innerhalb des London Borough of Bromley.
www.crystalpalace.co.uk
Das hartnäckige Geräusch riss Gemma aus dem Tiefschlaf.
Sie wälzte sich auf den Rücken und zog das Kissen über den Kopf, um das störende Gedudel nicht mehr hören zu müssen. Duncan tippte ihr auf die Schulter und murmelte etwas.
»Telefon«, sagte er etwas vernehmlicher. »Es ist deins.« So war es – jetzt erkannte sie den nervigen Standard-Klingelton, den sie nach Meinung der gesamten Familie schon längst hätte ändern sollen. Als sie das Kissen vom Gesicht nahm, stellte sie fest, dass das Zimmer von blassgrauem Morgenlicht erfüllt war, und als sie nach dem Wecker schielte, las sie die Ziffern 8:05.
»O Gott«, stieß sie hervor. Mit einem Schlag war sie hellwach, und ihr Herz raste. Wie hatten sie so lange schlafen können? Wieso waren die Kinder noch nicht auf? Kit hatte keine Probleme, am Wochenende auszuschlafen, aber Charlotte und Toby hüpften normalerweise spätestens um sieben auf dem Bett herum.
Dann fiel es ihr wieder ein. Gestern war die Premiere des Pizza-und-Spiele-Abends gewesen, den Duncan eingeführt hatte. Selbst gebackene Pizza und Scrabble, lautete das Programm. Sämtliche elektronischen Geräte waren verboten, ebenso wie jegliches Fast Food. Kit hatte heftig protestiert, als sowohl sein Handy als auch sein iPod verbannt worden waren, aber letztlich schien auch er den Abend genossen zu haben. Die Kleinen hatten lange aufbleiben dürfen, und nachdem sie im Bett waren und Kit sich auf sein Zimmer verzogen hatte, machten sie und Duncan es sich noch mit einer sehr feinen Flasche Bordeaux vor dem Kamin gemütlich und planten das Wochenende. Heute wollten sie mit den Kleinen einkaufen gehen und irgendwo zu Mittag essen, und am Sonntag hatte sie versprochen, zusammen mit den Kindern ihre Eltern in Leyton zu besuchen.
Ihr Handy verstummte, doch ehe sie einen Seufzer der Erleichterung ausstoßen konnte, fing es wieder an zu läuten. Kein gutes Zeichen. Sie setzte sich auf, zog sich die Decke über die Schultern und tastete nach dem Handy in der Ladestation. Nachdem sie einen Blick auf das Display geworfen hatte, nahm sie den Anruf an.
»Melody?«, meldete sie sich gähnend.
»Tut mir leid, Chefin.« Melody klang hellwach. »Der Samstag fällt ins Wasser, fürchte ich. Wir werden gebraucht.«
»Häusliche Gewalt?«, fragte Gemma, die die Hoffnung auf ein freies Wochenende noch nicht ganz aufgegeben hatte. Der Freitagabend war berüchtigt für familiäre Auseinandersetzungen, die unter Alkoholeinfluss in Gewalt ausarteten, doch solche Fälle waren in der Regel schnell aufgeklärt.
»Nein. Etwas viel Interessanteres«, antwortete Melody munter. »Ein Mann, der in einem Hotelzimmer aufgefunden wurde. Nackt, gefesselt und erdrosselt. Ich kann dich in« – Gemma wusste, dass sie in der nun folgenden Pause beide die gleichen Berechnungen anstellten: eine schnelle Dusche, Anziehen, ein bisschen Make-up auflegen – »in zwanzig Minuten abholen«, sagte Melody. »Allenfalls fünfundzwanzig.«
Mit einem bedauernden Achselzucken in Duncans Richtung schwang Gemma sich aus dem Bett und tappte ins Bad. »Wohin geht’s denn?«, fragte sie Melody.
»Nach Crystal Palace.«
In diesem August wurde es mittags so heiß, dass man auf dem Asphalt der Crystal Palace Parade Spiegeleier hätte braten können, und im Zentrum roch die Luft nach Dieselabgasen, vermischt mit einem Hauch von Zuckerwatte.
Morgens aß Andy in der Küche seine Cornflakes, dann las er ein wenig oder sah fern – leise, um seine Mum nicht zu wecken. Wenn sie aufstand, machte er ihr Frühstück und begleitete sie dann zum Pub. Er hatte dafür eine Reihe von Ausreden, die er abwechselnd vorbrachte, und nie gab er zu, dass er es nur deswegen tat, weil er sicherstellen wollte, dass sie auch tatsächlich dort ankam. Meist grummelte sie vor sich hin, während sie die Woodland Road zum Westow Hill hinaufgingen, und zog ein finsteres Gesicht, wenn sie in die Church Road einbogen. Aber wenn sie dann im Pub ankamen und sie sich ihre Servierschürze umband, wurden ihre Züge für einen kurzen Augenblick milder, und sie ermahnte ihn, ein braver Junge zu sein und keinen Ärger zu machen.
Nachdem er sie sicher abgeliefert hatte, schlenderte er mit seiner Gitarre die Parade hinunter und in den Park.
Er mochte den Crystal Palace Park, im Sommer wie im Winter, und in dieser langen Schönwetterperiode herrschte dort so etwas wie eine ausgelassene Volksfeststimmung. Zwei der alten Sphinx-Figuren, die noch von dem alten Glaspalast übrig geblieben waren, flankierten eine Treppe zwischen zwei leeren Terrassen. Hier saß er gerne im Schatten einer der großen Steinkreaturen und sah den Ausflüglern zu, während er auf seiner Gitarre spielte.
Seine Mutter hasste das alte Höfner-Standardmodell, und sie hasste es noch mehr, wenn er darauf spielte. Sein Vater hatte die Gitarre zurückgelassen, als er sie sitzenließ, und an einem besonders schlechten Tag konnte der Anblick des Instruments sie immer noch zur Weißglut bringen.
Er hatte kaum eine Erinnerung an seinen Vater – er war ausgezogen, als Andy vier Jahre alt gewesen war. Er hatte ein verschwommenes Bild seines Dads vor Augen, wie er auf den Stufen vor dem Haus in der Woodland Road saß und auf der Gitarre spielte, während von der Zigarette zwischen seinen Lippen der Rauch aufstieg, doch Andy war sich nicht sicher, ob das eine echte Erinnerung war oder ein Produkt seines Wunschdenkens.
Woran er sich erinnerte, das war die Erklärung seiner Mutter, dass sein Vater »zu neuen Ufern aufgebrochen« sei. Er hatte geglaubt, das hieße, dass er gestorben und in den Himmel gekommen sei, aber als er es in der Schule erzählte, hatte eine der Nonnen ihn beiseitegenommen und erklärt, dass sein Vater gesund und munter sei und auf einer Gasbohrinsel vor Canvey Island arbeite. Es war ihm immer noch furchtbar peinlich, wenn er sich daran erinnerte, und er war sich inzwischen nicht mehr sicher, ob er überhaupt so etwas wie Erleichterung darüber empfunden hatte, dass sein Vater noch am Leben war.
Als er älter wurde und die dahingemurmelten Bemerkungen seiner Mutter besser deuten konnte, hatte er sich nach und nach den Rest zusammengereimt. Die »neuen Ufer« bedeuteten eine andere Frau, eine Geliebte. Soweit Andy wusste, hatten sich seine Eltern nie scheiden lassen. Er nahm an, dass sein Vater noch eine Weile Geld geschickt hatte, aber das war lange vorbei.
In der ersten Zeit hatte seine Mum einen Job als Kassiererin in einem Supermarkt gehabt, doch nach ein paar Jahren war sie plötzlich von einem Tag auf den anderen nicht mehr hingegangen. Er hatte nie herausgefunden, was passiert war. Eine Zeitlang hatten sie sich praktisch nur von Brot und Marmite ernährt, aber dann hatte seine Mutter den Job im Pub bekommen, und danach war es ihnen erst einmal besser gegangen.
Manchmal tauchten irgendwelche »Onkel« auf, aber keiner schien sehr lange zu bleiben, und Andy war jedes Mal froh, sie wieder los zu sein.
Von seinem Platz auf der Treppe aus beobachtete er andere Familien, und in seine Neugier mischte sich Neid. Mütter, die Eis am Stiel verteilten; Väter, die mit ihren Söhnen Fußball spielten. Er konnte sich gar nicht vorstellen, wie das wäre. Seine Mutter war noch nie mit ihm in den Park gegangen; allerdings erinnerte er sich vage, dass sein Vater ihn einmal mitgenommen hatte, um ihm die Dinosaurier zu zeigen.
Auch andere Jungen sah er dort an den langen Augustnachmittagen, Jungen in seinem Alter, und auch ohne Aufsicht wie er – sonnengebräunte kleine Wilde, die in Shorts und Turnschuhen mit makellos weißen Schnürsenkeln im Park herumstreunten. Besonders fielen ihm zwei auf, die fast jeden Tag mit ihren Fahrrädern herkamen. Er wusste, dass diese Räder mehr kosteten, als seine Mutter in einem Monat verdiente. Die Jungen fuhren Rennen und vollführten Kunststücke, und dann standen sie mit ihren Rädern zwischen den Beinen da und beobachteten ihn aus den Augenwinkeln. Er konnte nicht sagen, ob in ihren Blicken nur Interesse oder eine Drohung lag, aber an diesem Tag hielt er seine Gitarre ein bisschen fester und sah auf seine Uhr.
Er hatte jetzt einen Zeitplan, an den er sich halten musste. Zuerst in den Park, dann für ein, zwei Stunden in die Bücherei, und dann nach Hause zum Abendessen. Später, wenn die Sonne hinter den Häusern auf der Westseite der Woodland Road versank und die Luft kühler wurde, setzte er sich mit der Gitarre auf den Knien vor die Tür und wartete.
Er wusste auf die Minute genau, wann er den kleinen VW den Berg herauftuckern hören würde.
»Ein Hotel, sagst du?«, fragte Gemma, als sie sich auf dem Beifahrersitz von Melodys knallblauem Renault Clio anschnallte. Nachdem sie rasch in Hose und Stiefel geschlüpft war und zum Pulli ihre cremefarbene Wolljacke angezogen hatte, war ihr nur noch Zeit geblieben, ihr wirres Haar zu einem kurzen, etwas schludrigen Zopf zu flechten. Jetzt sah sie, dass ihre Kollegin einen dunklen Hosenanzug zu einer türkisfarbenen Bluse trug und dass ihr dunkles, glänzendes Haar zu einer perfekten Bobfrisur gestylt war. Melody Talbot war die einzige Frau in Gemmas Bekanntenkreis, die einen Hosenanzug tragen konnte, ohne altbacken zu wirken, und an diesem scheußlichen Morgen ging ihr das ein wenig gegen den Strich.
Melody schaltete vor der Ampel an der Holland Park Avenue herunter. »Ja, es heißt Belvedere.«
Die Straßen glänzten vom Nieselregen, und Gemma war froh, dass sie wenigstens nicht im Freien arbeiten mussten. »Ist der DCS schon informiert?«, fragte sie. Die Leiterin ihres Teams, Detective Chief Superintendent Diane Krueger, würde die Ermittlung von der Polizeidirektion South London aus koordinieren.
»Sie ist auf dem Weg zum Revier.«
»Und das Team?«
»Die Kriminaltechnik ist unterwegs, die Rechtsmedizin auch. Und Shara dürfte vor uns dort sein; sie wohnt ja in Brixton.«
Gemma warf Melody einen Seitenblick zu und versuchte herauszuhören, ob ihr Tonfall irgendetwas verriet. Gleich nachdem Melody ihre Sergeant-Prüfung bestanden hatte, hatte Gemma um die Versetzung ihrer Mitarbeiterin in ihr neues Team in South London ersucht.
Sie waren unterbesetzt, denn das Team hatte nicht nur den DCI, den Gemma nun ersetzte, durch einen schweren Herzinfarkt verloren, sondern auch einen Detective Sergeant, der zu einer anderen Abteilung gewechselt war.
Aber Melody war gleich zu Beginn mit dem Detective Constable des Teams, Shara MacNicols, aneinandergeraten – wenngleich das nicht Melodys Schuld war.
Shara war eine junge alleinerziehende Mutter und eine gute Polizistin, legte aber ein ausgeprägtes Revierverhalten an den Tag. Gemma gefiel es gar nicht, wenn es solche Spannungen in ihrem Team gab, doch sie wusste, dass sie die Probleme mit Geduld und Fingerspitzengefühl angehen musste. Sie konnte Shara gut verstehen – schließlich war es nicht so lange her, dass sie selbst mit Toby allein dagestanden hatte und sich im Job mit einem System konfrontiert sah, in dem sie von Anfang an benachteiligt schien. Und sie wusste, dass es für Shara den Anschein hatte, als ob Melody über ihren Kopf hinweg ins Team geholt worden wäre, nur weil sie weiß war und offensichtlich aus privilegiertem Elternhaus kam.
Dabei legte sich Shara in Wahrheit durch ihre Komplexe nur selbst Steine in den Weg, doch die junge Frau würde das niemals wahrhaben wollen. Und dann, dachte Gemma mit einem Seitenblick auf ihre Kollegin und einem unterdrückten Lächeln, waren da Melodys Hosenanzüge und Kostüme. Man konnte es Shara vielleicht wirklich nicht verdenken, wenn sie Melody als Überfliegerin abgehakt hatte.
»Ist das Opfer schon identifiziert?«, fragte sie und verdrängte damit erst einmal das Problem der Teamdynamik.
Melody musste ihre Notizen nicht konsultieren. »Ein gewisser Mr Vincent Arnott. So steht es jedenfalls in dem Führerschein in seiner Brieftasche. Der Hotelangestellte hat den Kollegen von der Streife gesagt, der Mann habe sich immer als Mr Smith angemeldet.«
»Wie originell«, meinte Gemma. Dann runzelte sie die Stirn. »Immer? Er war also Stammgast? Was für eine Art Hotel ist das denn?«
»Ich kenne es nicht.« Melody warf einen Blick auf das Navi. »Es ist hinter dem Crystal Palace Park. In der Church Road.«
»Das Einzige, was ich von Crystal Palace kenne, ist der Fußballverein«, sagte Gemma. Die Straßen waren so früh am Samstag relativ leer, und sie hatten schon die Battersea Bridge erreicht. Als sie auf der Brücke waren, blickte Gemma nach unten und sah, dass die Themse ebenso bleigrau war wie der Himmel.
Während sie durch Battersea fuhren, dachte sie an ihre Freundin Hazel, die in einem winzigen, von einer Grundstücksmauer umgebenen Bungalow in einer Seitenstraße der Battersea Park Road wohnte, und sie erinnerte sich mit Bedauern daran, dass sie gehofft hatte, an diesem Wochenende wenigstens kurz dort vorbeischauen zu können. Das konnte sie jetzt wohl vergessen.
»Ich war ein Mal dort«, sagte Melody, und als Gemma sie verständnislos ansah, fügte sie hinzu: »In Crystal Palace. Im Park. Ein Schulausflug. War das zu Beginn der dritten oder der vierten Klasse?«, überlegte sie und runzelte die Stirn. »Also, jedenfalls war es früh im Schuljahr, im September, glaube ich. Wir hatten uns im Unterricht Bilder angeschaut, und ich weiß noch, wie ich über die leeren Terrassen gegangen bin und mir vorzustellen versucht habe, wie er wohl ausgesehen haben musste, dieser riesige Glaspalast. Und ich konnte nicht begreifen, dass von so einem prachtvollen Bauwerk nur noch so wenig übrig war.«
»Er ist abgebrannt, nicht wahr?«
Melody nickte. »Ein paar Jahre vor dem Krieg. Ich nehme an, dass er die Bombenangriffe sowieso kaum überstanden hätte – so ein Ziel wäre zu verlockend gewesen.« Sie deutete nach oben, zu der Anhöhe von Clapham Common und der Nebelbank darüber. »Man konnte ihn übrigens von der City aus sehen.«
»So groß war er?«
»Riesig. Und sie hatten ihn ganz oben auf den Sydenham Hill gepflanzt, den höchsten Punkt zwischen London und der Südküste.«
»Wie ist Crystal Palace denn so? Die Gegend, meine ich.« Im Norden Londons aufgewachsen hatte Gemma vor ihrer jüngsten Versetzung überwiegend in West-London gearbeitet, und sie musste ihr neues Revier erst noch kennenlernen.
»Wird auch immer exklusiver, denke ich, aber so gut kenne ich es dann doch nicht. Schau mal.« Melody deutete in Richtung der blauen Lücken, wo der Nebel ein wenig aufriss, und Gemma erhaschte einen Blick auf einen der Fernsehtürme von Crystal Palace, ehe die graue Wand sich wieder schloss.
Melody konzentrierte sich auf ihr Navi, als sie im Bogen um die eleganten Gebäude des Dulwich College herumfuhren und dann bergauf zwischen kahlen Bäumen hindurch, bis die Straße am höchsten Punkt von Gipsy Hill wieder eben verlief.
Gemma sah Pubs und Geschäfte vorbeiziehen, als sie oben auf dem Hügel vom Einbahnstraßensystem um einen dreieckigen Block herumgeführt wurden. Und dann, als es auf einer von Bäumen gesäumten Straße wieder leicht bergab ging, bemerkte sie das vertraute Flackern des Blaulichts. Die Fahrt hatte nicht ganz fünfundvierzig Minuten gedauert, sie waren also relativ gut vorangekommen.
»Das Belvedere, nehme ich an«, sagte Melody, als sie hinter dem letzten Streifenwagen anhielt.
Das Hotel war zu ihrer Rechten; ein wuchtiges Gebäude, blassrosa verputzt, mit dunkelblauen Markisen an den Erdgeschossfenstern. Ein uniformierter Constable spannte gerade blau-weißes Flatterband vor die Stufen, die zum Eingang hinaufführten. Oben auf der Treppe stand DC Shara MacNicols, anscheinend in eine hitzige Diskussion mit einer untersetzten Frau in einem blauen Kostüm verwickelt.
»Die Inhaberin?«, murmelte Melody, während sie den Motor abstellte und ihren Gurt löste.
»Würde ich auch vermuten.« Gemma stieg aus und zeigte einem der uniformierten Constables, die an der Absperrung Wache hielten, ihren Dienstausweis. Dann ging sie mit Melody auf den Eingang zu.
Als sie näher kamen, sah Gemma, dass Shara rote Perlen in die Enden ihrer kleinen Zöpfe geflochten hatte, lebhafte Farbtupfer, leuchtend wie Beeren an diesem grauen Wintertag. Die blassen Wangen der anderen Frau waren fleckig vom Schock, ihr strohblondes Haar spröde und leicht zerzaust.
»Sie haben seine Identität nicht überprüft?«, sagte Shara gerade, als Gemma und Melody zu den beiden Frauen traten.
»Mr Smith hat immer bar bezahlt. Es schien mir nicht nötig«, antwortete die Frau. Sie hatte einen leichten Akzent, den Gemma als osteuropäisch einordnete.
Shara begrüßte die Neuankömmlinge mit einem Nicken. »Morgen, Chefin. Hallo, Sarge. Das ist Irene Dusek. Sie ist die Nachtmanagerin, bei der das Opfer eingecheckt hat.«
»Ich bin Detective Inspector James, Ms Dusek«, sagte Gemma. »Und das ist Detective Sergeant Talbot.« Sie setzte eine strenge Miene auf, ehe sie fortfuhr: »Ms Dusek, Ihnen ist doch sicher bekannt, dass Hotels verpflichtet sind, die Ausweisdaten ihrer Gäste aufzunehmen.«
»Ja, aber wir kennen Mr Smith. Er hat nie Schwierigkeiten gemacht, und er ist nie lange geblieben.«
»Tja, jetzt hat er schon gewisse Schwierigkeiten, nicht wahr?«, entgegnete Shara, worauf Gemma ihr einen warnenden Blick zuwarf. Ms Dusek wirkte eingeschüchtert, und Gemma war es eindeutig wichtiger, an Informationen zu kommen, als sie wegen Verstößen gegen die Vorschriften zu maßregeln.
»Um wie viel Uhr hat Mr Smith gestern Abend eingecheckt?«, fragte sie.
Die Frau schien sich zu entspannen. »Es war vielleicht elf, aber ich bin mir nicht ganz sicher.«
»War er in Begleitung?«
»O nein. Mr Smith kommt immer allein.«
»Hatte er Gepäck?«, fragte Melody.
»Oh, das habe ich nicht gesehen. Ich hatte zu tun – ein Anruf. Vielleicht hat er noch etwas aus dem Auto geholt.« Ms Dusek trat von einem Fuß auf den anderen, und Gemma vermutete, dass sie log.
»Sie haben sein Auto gesehen?«, fragte sie.
»Nein, nein. Aber ich dachte – er sah aus wie ein Mann, der ganz bestimmt ein Auto hat. Ein schickes Auto, wissen Sie?«
»Also, dieser Gentleman« – Shara legte besonderen Nachdruck auf das Wort – »ist regelmäßig in Ihrem Hotel abgestiegen, immer allein und ohne Gepäck. Und Sie sagen, er sei nie lange geblieben. Soll das heißen, dass er normalerweise nicht die ganze Nacht geblieben ist? Ich habe langsam den Verdacht, dass Sie hier ein Bordell betreiben.«
Ms Dusek schüttelte heftig den Kopf. »Nein, nein«, sagte sie. »Wir tun nichts Verbotenes. Die Servicekraft hat gesagt, er hat immer früh ausgecheckt. Wir sind anständiges Hotel.« Unter dem Druck schien ihr Englisch schlechter zu werden.
Gemma betrachtete prüfend die Fassade des Hotels und konnte auf den ersten Blick keine weiteren Türen entdecken. »Ms Dusek, hat das Hotel noch andere Eingänge?«
»Wir haben natürlich Notausgänge. Die sind vorgeschrieben.« Ms Dusek schien froh zu sein, sich wieder auf sichererem Boden zu bewegen. »An den Seiten und nach hinten raus.«
»Okay«, sagte Gemma. »Die werden wir uns mal ansehen. Aber zuerst wollen wir uns Ihren Mr Smith anschauen.«
Ms Dusek schluchzte leise auf und presste die Faust an ihren Mund. »Er war ein netter Mann, immer sehr freundlich. Ich verstehe nicht, wie so etwas passieren konnte.«
»Es ist unser Job, das herauszufinden, Ms Dusek. Wir müssen später noch einmal mit Ihnen sprechen. Ist hier jemand, der Ihnen so lange Gesellschaft leisten kann?«
»Raymond ist da, der Tagportier. Und die Servicekraft. Es hat sie sehr mitgenommen.« Ms Dusek, die keine Jacke trug, fröstelte jetzt.
»Na, dann kommen Sie mal mit rein.« Gemma führte die Frau in die Eingangshalle, Melody und Shara folgten.
Sie betraten ein Foyer mit einem Teppich in einem schrillen rosa-blauen Muster. Auf einer Seite befand sich ein etwas schäbiger Empfangstresen, auf der anderen eine Sitzecke mit Fernseher. Drei Personen saßen dort an einem der Tische: eine Frau in einem Kittel, die sich schniefend ein Taschentuch an die Nase hielt, ein junger Mann mit pickligem Gesicht, der ein weißes Hemd und eine schwarze Hose trug, sowie ein korpulenter Constable in Uniform. Sie sahen aus wie die bunt zusammengewürfelten Teilnehmer einer Kartenrunde – oder, angesichts der Kannen und Tassen, die auf dem Tisch herumstanden, einer Teegesellschaft.
Der Constable sprang sofort auf und kam ihnen entgegen. Nachdem Gemma sich identifiziert hatte, sagte er: »DC Turner, Ma’am. Revier Gipsy Hill.« Er war blond und wirkte ein wenig schwerfällig, doch seine blauen Augen waren hellwach.
»Ms Dusek wird vorläufig bei Ihnen bleiben. Ich möchte später auch mit den anderen sprechen. Können Sie die Kollegen von der Spurensicherung zu uns schicken, wenn sie eintreffen? Und den Rechtsmediziner? Ach ja, und noch etwas, Turner: Ich möchte, dass keiner der anderen Gäste das Haus verlässt, bevor wir sie befragt haben.«
»Ich kümmer mich schon drum, Ma’am. Sind sowieso nur rund ein Dutzend, wie’s aussieht. Die Geschäfte scheinen nicht besonders zu laufen. Ich habe die, die schon runtergekommen sind, in den Speisesaal verfrachtet.«
Gemma nickte. »Gut. Und können Sie dafür sorgen, dass niemand das Haus durch die Notausgänge verlässt?«
»Schon erledigt, Ma’am«, erklärte Turner mit unübersehbarer Selbstzufriedenheit, was er allerdings mit seinem Grinsen wiedergutmachte.
»Frecher Kerl«, murmelte Shara.
Zwar hätte Gemma es vorgezogen, wenn das Tatortteam schon da gewesen wäre, bevor sie die Leiche in Augenschein nahm, doch sie sah wenig Sinn darin, die übrigen Angestellten zu befragen, solange sie nicht wusste, womit sie es genau zu tun hatten. »In Ordnung, Turner. Wir sind dann …«
»Durch die Rezeption, die Treppe runter und dann rechts. Da sehen Sie dann schon den Constable vor der Tür stehen.« Turner lächelte jetzt nicht mehr. »Und falls Sie keine Zeit fürs Frühstück hatten, seien Sie nur froh.«
Gemma folgte seiner Wegbeschreibung. War ihr bisheriger Eindruck von dem Hotel noch einigermaßen positiv gewesen, so blieb davon nichts mehr übrig, als sie die öffentlich zugänglichen Bereiche hinter sich ließen. Im Treppenhaus war es schummrig, die Wände waren fleckig und zerschrammt. Es roch nach starkem Desinfektionsmittel, aber nicht genug, um den penetranten Feuchtigkeitsgeruch zu kaschieren. Der Flur im Untergeschoss war auch nicht besser. Zwei der Neonröhren waren kaputt, und die übrigen gaben ein unangenehmes Summen von sich. Der uniformierte Officer, der im hinteren Teil des Flurs Posten bezogen hatte, war ein willkommener Anblick.
Er war jünger als Turner, und sie vermutete, dass er bei der Aufgabenverteilung den Kürzeren gezogen hatte.
»Ma’am.« Er nickte, als sie ihren Dienstausweis hochhielt, sah ihr aber nicht in die Augen.
Die Tür, vor der er Wache stand, war geschlossen, doch der Schlüssel steckte.
»Hat den außer der Servicekraft noch irgendjemand angefasst?«, fragte sie.
»DC Turner war als Erster am Tatort, Ma’am, aber er hat Handschuhe benutzt. Ich – Ich bin nicht reingegangen.«
»In Ordnung. Gute Arbeit, Constable.« Gemma zog ein Paar Nitrilhandschuhe aus der Tasche und streifte sie über. »Dann wollen wir uns mal umsehen, ja?«
Sie drehte den Schlüssel im Schloss, stieß die Tür auf und blieb auf der Schwelle stehen.
Der Gestank schlug ihr wie eine Wand entgegen. Urin, Kot – und der unverwechselbare Geruch des Todes. Das Hotel mochte nicht ausgelastet sein, aber man sparte offensichtlich nicht an den Heizkosten. Das Zimmer war wie ein Backofen, und Gemma spürte das Prickeln von Schweiß unter ihrem Jackenkragen.
Graues Tageslicht strömte durch die Fenster herein, die dicht unter der Decke in der Außenwand saßen. Gemma blinzelte, als ihre Augen sich allmählich an die Helligkeit gewöhnten, und richtete dann den Blick auf das Doppelbett, das von einem plötzlichen Sonnenstrahl erhellt wurde wie eine Szene in einem mittelalterlichen Gemälde.
»Oh, verdammt«, stieß sie hervor.
3