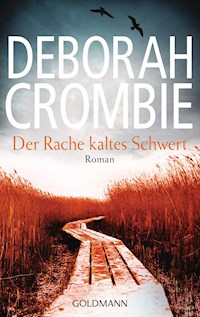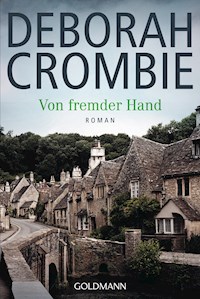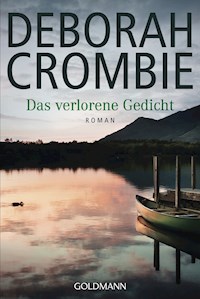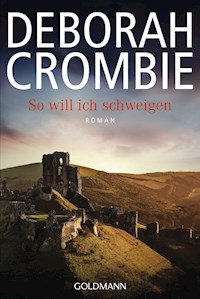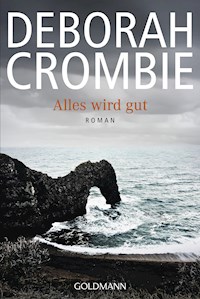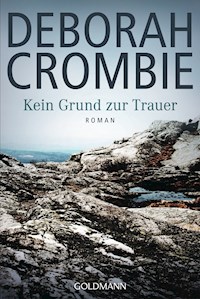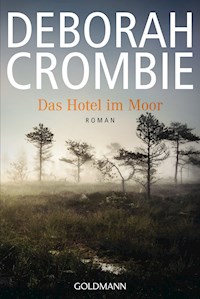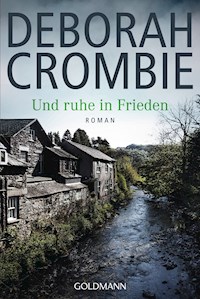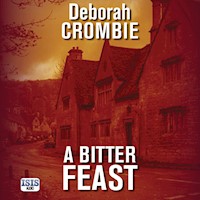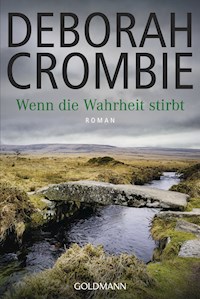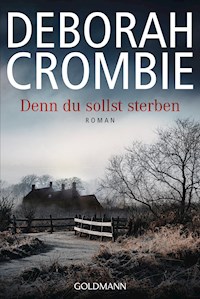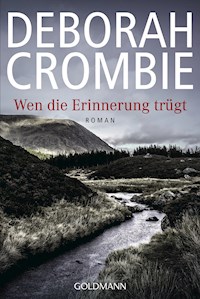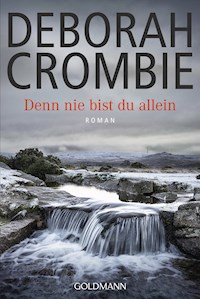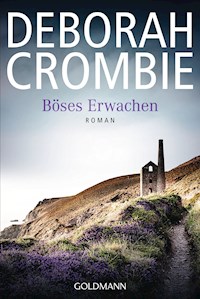
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Kincaid-James-Romane
- Sprache: Deutsch
London während des Zweiten Weltkriegs: Als deutsche Bomber die Stadt verwüsten, flüchtet ein Junge aus dem East End aufs Land. Dort lernt er nicht nur die Freuden des Landlebens kennen, sondern auch die Leidenschaft der ersten Liebe. 50 Jahre später erzählt ihm seine Frau unsicher und stockend von ihren Erfahrungen als Evakuierte – Erfahrungen, über die sie noch nie zuvor gesprochen hat. Und als sich die Vergangenheit, die lange ruhte, plötzlich in die Gegenwart eingreift, stehen Superintendent Duncan Kincaid und Sergeant Gemma James von Scotland Yard zunächst hilflos vor den verheerenden Konsequenzen.
Von den tödlichen Bombardierungen im September 1939 bis zur Gegenwart, als die Leiche der jungen Erbin eines Tee-Imperiums in den verlassenen Royal Albert Docks gefunden wird, spinnt Deborah Crombie die Fäden einer Geschichte von zwei jungen Männern, die zunächst Verbündete, dann Freunde werden. Es ist eine Geschichte von Vertrauen und Betrug, deren Folgen irgendwann nicht mehr zu kontrollieren sind.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 656
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Buch
London im September 1939: Als deutsche Bomber die Stadt verwüsten, wird ein Junge aus dem East End aufs Land evakuiert. Dort lernt er nicht nur die Freude des Landlebens kennen, sondern auch die Leidenschaft der ersten Liebe.
London, 50 Jahre später: In den verlassenen Royal Albert Docks wird die Leiche einer jungen Frau gefunden. Diese wird als Annabelle Hammond identifiziert, die Millionenerbin eines großen Tee-Imperiums. Als Superintendent Duncan Kincaid und Sergeant Gemma James von Scotland Yard versuchen, die verwickelten Affären und Beziehungen der Toten zu ergründen, reihen sie immer mehr Namen auf die Liste der Verdächtigen ...
Autor
Deborah Crombies höchst erfolgreiche Romane um das Scotland-Yard-Paar Duncan Kincaid und Gemma James wurden für den »Agatha Award«, den »Macavity Award« und den »Edgar Award« nominiert. Die Autorin wohnt mit ihrer Familie im Norden von Texas.
Deborah Crombie
Böses Erwachen
Roman
Deutsch vonChristine Frauendorf-Mössel
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Die Originalausgabe von »Böses Erwachen« erschien unter dem Titel »Kissed a Sad Goodbye« bei Bantam Books, New York
Copyright © der Originalausgabe 1999 by Deborah Crombie Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2008 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München. Covergestaltung: UNO Werbeagentur GmbH KA • Herstellung: sc
ISBN 978-3-641-10578-5 V005
www.goldmann-verlag.de
Für Rick, der es möglich macht.
1
Die »Docklands« von einst sind den Londonern nochdeutlich im Gedächtnis. Generationen von Kindern sindin jenen Straßen im Schatten der Ozeanriesen aufgewachsen, deren Bordwände, weiße Klippen, gleich hinter ihren Gärten aufragten.
GEORGE NICHOLSON aus: Docklands,ein illustrierter historischer Überblicküber Arbeit und Leben in East London
Er sah jede Note, die seiner Klarinette entschwebte. Es waren Töne, sanft und anhaltend, mit dem rauchig vollen Timbre, das ihn an schwarze Perlen auf der durchsichtig weißen Haut einer Frau erinnerte. If I had you hieß das Stück, ein alter Schlager in langsamen, melodischen Tempi. Hatte er dieses Stück je für sie gespielt?
Am Anfang war sie bei seinem Spiel auf der Straße stehen geblieben, hatte ihm zugesehen, sich im Rhythmus der Musik gewiegt. Er hatte ihrer eleganten Erscheinung, ihrem an das Schönheitsideal der Präraffaeliten erinnernden Gesicht mißtraut. Und doch hatte sie ihn fasziniert. In den folgenden Monaten hatte er nie gewußt, wann sie auftauchen würde. Ein System war nicht zu erkennen gewesen. Trotzdem hatte sie ihn stets gefunden, auch wenn er seinen Standplatz wieder einmal verlegt hatte.
Es war ein Tag wie dieser gewesen, als er sie zum ersten Mal gesehen hatte, ein heißer Sommertag, mit dem vagen, unbewußt wahrnehmbaren Duft, der Regen verhieß. In der Abenddämmerung kühlten Schatten die heiße, flirrende Luft etwas ab, und die Menschen strömten wie befreit auf die Straßen, rastlos und drängend, erhitzt von Getränken und vom Sommer. Und er hatte eine jazzige Improvisation auf Summertime gespielt, um die Stimmung der Leute aufzugreifen.
Sie hatte etwas abseits hinter der Menge gestanden, ihn beobachtet und sich schließlich abgewandt, ohne ihm auch nur eine einzige Münze zuzuwerfen. Sie bezahlte nie, bei keiner der folgenden Gelegenheiten, und sie sprach nicht ein Wort. Eines Abends allerdings, als sie allein gekommen war, war er es gewesen, der sie zurückrief, als sie sich zum Gehen gewandt hatte.
Später saß sie nackt auf seinem zerwühlten Bett, sah ihm beim Klarinettenspiel zu, und er hatte sich vorgestellt, wie die Töne, von der schimmernden Masse ihres Haars magnetisch angezogen, darin verschwanden. Als er sie beschuldigt hatte, aus purer Neugier Slumtourismus zu betreiben, hatte sie nur gelacht — ein anhaltendes, herrliches Lachen — und seine Vorwürfe als »absurd« zurückgewiesen.
Er hatte ihr geglaubt — damals. Er hatte nicht geahnt, daß die Wahrheit jenseits jedes Vorstellungsvermögens lag.
»Ich gehe nicht!« Lewis Finch lehnte sich in seinem Stuhl zurück und stemmte störrisch die Stiefel gegen die abgetretene Fußstütze unter dem Küchentisch.
Seine Mutter stand am Herd, hatte ihm den Rücken zugewandt und stellte Kohl und Kartoffeln für das Abendessen des Vaters auf.
»Du brauchst jemand, der sich um dich kümmert, wenn Dad eingezogen wird«, sagte er. »Und wenn Tommy und Edward sich freiwillig melden …« Er wußte, welchen Fehler er gemacht hatte, als sie zu ihm herumwirbelte, den Löffel noch in der Hand.
»Schäm dich, Lewis Finch, daß du mich so quälst. Meinst du nicht, deine Brüder machen mir nicht schon genug Sorgen mit ihrem Gerede von Uniformen und Krieg? Du tust, was ich dir sage …« Sie verstummte, ihr schmales Gesicht von Sorge gezeichnet. »Oh, Lewis! Ich will nicht, daß du aufs Land verschickt wirst, aber die Behörden behaupten, es muß sein …«
»Aber Cath …«
»Cath ist fünfzehn und hat einen Job in der Fabrik. Du bist noch ein Kind, Lewis. Und ich ruhe nicht, bevor du nicht in Sicherheit bist.« Sie kam zu ihm, strich ihm sein dickes blondes Haar aus der Stirn und sah ihn eindringlich an. »Außerdem ist bisher alles nur Geschwätz. Ich glaube keine Sekunde, daß es Krieg gibt. Jetzt beeil dich, sonst kommst du zu spät in die Schule. Und nimm deine schmutzigen Stiefel von meinem Tisch«, fügte sie mit einem bedeutungsvollen Blick auf seine Füße hinzu.
»Ich bin kein Kind mehr«, schimpfte Lewis laut, während er zur Haustür hinauspolterte. Einen Moment war er versucht, einfach die Schule zu schwänzen. Es schien irgendwie nicht richtig zu sein, in einem muffigen Schulzimmer herumzusitzen … am ersten Tag im September.
Er sah die Stebondale Street hinauf und dachte sehnsuchtsvoll an die Molche und Kaulquappen, die in der Lehmkuhle hinter dem Zaun warteten, aber er hatte nichts, mit dem er sie hätte fangen können. Außerdem … wenn er zu spät kam, setzte es vor der ganzen Klasse Tatzen mit dem Lineal von Miß Jenkins, und seine Mutter hatte gedroht, ihn nach St. Edmund’s zu schicken, falls es wieder Ärger in der Schule gab. Mit einem Seufzer steckte er die Hände in die Taschen und trabte in Richtung Schule.
Der Morgen verging, und durch das offene Fenster seines Klassenzimmers in der Cubitt Town School konnte Lewis die massigen, düsteren Silhouetten der Lagerschuppen entlang des Flußufers sehen. Hinter den Lagerschuppen lagen die großen Schiffe mit ihren exotischen Ladungen … Zucker von den Westindischen Inseln, Bananen aus Kuba, Wolle aus Australien, Tee aus Ceylon … Miß Jenkins’ Geographiestunde rückte in immer weitere Ferne. Was weiß sie schon von der Welt, dachte Lewis, während sie weiter über Steuern, Abgaben und Gesetze referierte. Zum Beispiel die Penang, die konnte von exotischen Ländern, konnte von Dingen erzählen, die wirklich wichtig waren. Die Penang war einer der wenigen Großsegler, die noch die Themse heraufkamen, und lag jetzt im Britannia-Trockendock zur Überholung. Allein der Geruch dieses Schiffs ließ Lewis sehnsuchtsvoll erschaudern. Nach der Schule wollte er …
Das Quietschen der Klassenzimmertür riß Lewis mit einem Ruck aus seinen Gedanken. Mr. Bales, der Direktor, stand im Türrahmen, und der Ausdruck in seinem langen, schmalen Gesicht war so eigenartig, daß Lewis’ Magen sich zusammenkrampfte. Aus dem Korridor schwappte eine Welle des Lärms in Lewis’ Klassenzimmer. Es war das Geschrei und Gepolter der Kinder aus den anderen Klassen.
»Miß Jenkins, Kinder!« Mr. Bales räusperte sich. »Ihr müßt jetzt alle sehr tapfer sein. Die Meldung kam gerade übers Radio. Wir stehen kurz vor Eintritt in den Krieg. Die Regierung hat Anweisung zur Evakuierung Londons gegeben. Wir sollen alle nach Hause gehen und uns hier in einer Stunde mit unserem Gepäck wieder melden.« Er wandte sich ab. Die Hand an der Tür, drehte er sich noch einmal um und drohte mit dem Finger: »Und vergeßt nicht eure Namensschilder und Gasmasken! Und seid pünktlich. In einer Stunde, habe ich gesagt.«
Die Tür fiel hinter ihm zu. Im ersten Moment herrschte atemlose Stille. Dann ertönte der Schrei von Ned Norris in der letzten Reihe: »Ferien! Wir haben Ferien!«
Die Klasse nahm die Parole auf, drängte sich hinaus und mischte sich unter die anderen Kinder im Korridor. Lewis war mitten unter ihnen, zwängte sich durch das Schultor und sprang mit einem Indianerschrei die Treppe hinunter. Mit dem Herzen allerdings war er nicht dabei.
Die Kinder zerstreuten sich, doch als Lewis in die Seyssel Street einbog, wurde sein Schritt langsamer. Plötzlich war er sich der Geräusche der Insel bewußt, hörte das unaufhörliche Poltern, Ächzen und Pfeifen von den Docks her, das Tuten der Schlepper und das gedämpfte Stampfen der Schiffsmaschinen vom Fluß. Wie sollte Krieg sein, wenn sich nichts geändert hatte?
Er dachte erneut an die Penang, die für die Rückreise nach Australien überholt wurde. Er wollte sich am liebsten an Bord verstecken, ein neues Leben in den Outbacks beginnen, sich nicht zu einer fremden Familie auf dem Land verschicken lassen wie ein fehlgeleitetes Gepäckstück. Mit fast elf Jahren war er alt genug, um zu arbeiten. Er war groß für sein Alter und stark, sicher gab man ihm irgendwo Arbeit.
Als er oben in die Stebondale Street einbog, sah er das alte Fahrrad seines Vaters ordentlich gegen die Vordertür ihres Hauses gelehnt stehen. Die Spitzenvorhänge der Mutter, brüchig vom vielen Waschen, blähten sich im offenen Fenster.
In diesem Moment wußte er, daß er nicht weglaufen konnte. Allein die Vorstellung von den Tränen der Mutter oder der stummen Enttäuschung des Vaters waren für ihn unerträglich.
Lewis versetzte dem Fahrrad einen so kräftigen Fußtritt, daß es mit zufriedenstellendem Krachen umfiel. Erließ es einfach liegen, ging hinein und in die Küche, und als er die Gesichter seiner Eltern sah, wußte er, daß die Nachricht ihm schon vorausgeeilt war.
George Brent schwenkte die Arme, soweit es die Hundeleine erlaubte, und ging etwas schneller. Er brauchte die körperliche Bewegung in diesen Tagen ebenso dringend wie Sheba, denn selbst bei dieser Hitze taten ihm morgens beim Aufstehen sämtliche Knochen weh. Er verdrängte hastig die Gedanken daran, wie er den kalten feuchten Winter überstehen sollte. Hatte keinen Sinn, über etwas zu jammern, das man nicht ändern konnte, schon gar nicht an einem so herrlich heißen Sommertag. Der Winter war noch Monate entfernt, und seine größte Sorge im Moment war, sich keinen Sonnenbrand auf der Glatze zu holen.
Sheba trottete vor ihm her, die Schnauze tief über dem Boden, um jede Witterung aufzunehmen, der kleine schwarze Körper zitternd vor gespannter Erregung. Als sie das indische Restaurant in der Manchester Road passierten, hob sie die Nase und schnüffelte geräuschvoll. Die würzigen Düfte, die aus der Küche drangen, waren George jetzt so vertraut wie einst der Geruch von Kohl und Wurst in seiner Kindheit, aber er hatte sich nie recht entschließen können, das Zeug zu probieren … obwohl er zugeben mußte, daß er auf das Drängen von Mrs. Singh hin wohl eines Tages seinen Widerstand aufgeben würde.
Er winkte Mrs. Jenkins in der Reinigung nebenan zu und ging wieder schneller. Er war an diesem Morgen spät dran, denn er hatte Mrs. Singh mit ihrem Fernseher geholfen, und vermutlich würde er seine Kumpel verpassen, die sich täglich zum Kaffee im ASDA-Supermarkt trafen. Allerdings war es schließlich nur fair, einem Nachbarn zu helfen, oder? Besonders einer so guten Nachbarin wie Mrs. Singh.
Er lächelte bei dem Gedanken daran, was seine Töchter sagen würden, wenn sie wüßten, was mit der Witwe nebenan lief, und bog um die Ecke in die Glengarnock. Sie dachten wohl, damit sei’s für ihn vorbei. Aber er hatte noch nicht alle Munition verschossen. Wie konnte man von einem Mann erwarten, sich nach so vielen Jahren mit regelmäßigem Sex zu kasteien? Was für ihn das Andenken an die Mutter seiner Kinder allerdings nicht schmälerte.
Als sie in die Stebondale Street kamen, zerrte Sheba an der Leine, witterte die Nähe des Parks, doch George verlangsamte seine Schritte, als sie die Wohnhäuser gegenüber dem Eingang zum Rope Walk erreichten. Sie weckten in ihm die Erinnerung an die Sendung über den Blitzkrieg, die er am Vorabend im Radio gehört hatte. Während er gemütlich bei einer abendlichen Tasse Tee in seiner Küche gesessen hatte, hatte ihn unerwartet die Flut der Erinnerungen eingeholt … an das Geräusch der Bomber im Anflug, die Sirenen, die Zerstörung.
Er blieb stehen und befahl Sheba, sich zu setzen. Er nahm die Häuser jetzt für selbstverständlich, ging täglich gedankenlos an ihnen vorüber, aber diese kurze Reihe von einem halben Dutzend Häusern war alles, was von der Stebondale Street übrig geblieben war, die er vor dem Krieg gekannt hatte. Der Rest war zerstört worden, wie das meiste auf der Insel, wie die Häuser, in denen er aufgewachsen war.
Er war damals zu alt gewesen, um aufs Land verschickt zu werden, und hatte daher die schlimmsten Luftangriffe im Herbst und Winter 1940 miterlebt. Seine Mundwinkel zuckten nach oben, als er sich daran erinnerte, wie er sich an seinem siebzehnten Geburtstag in der Rekrutierungsstelle gemeldet hatte. Das eigentliche Kampfgeschehen, dessen war er sicher gewesen, war besser als das ständige Warten darauf, daß die Bomber kamen.
Wenige Monate später waren ihm die Nächte im Unterstand im Garten wie das Paradies erschienen. Aber er hatte auch das überstanden. Zumindest hatte ihn die Zeit in Italien gelehrt, die Zukunft Zukunft sein zu lassen.
Shebas ungeduldiges Kläffen riß ihn aus seinen Tagträumereien. Er ging gehorsam weiter, und bald, als er sie von der Leine und in ihre ersehnte Freiheit entließ, rannte sie in gestrecktem Galopp davon. George folgte ihr in seinem Tempo, den Rope Walk zwischen Mudchute und Millwall Park hinunter, und geriet leicht außer Atem, als es die Anhöhe zum Mudchute Plateau hinaufging. Oben verschwand Sheba aus seinem Blickfeld, während sie den Karnickelspuren durch das dichte Gras folgte. George jedoch blieb auf dem schmalen Weg, der am Rand des Parks entlangführte. Der Hund schien stets zu wissen, wo sein Herrchen war, auch wenn dieser ihn längst aus den Augen verloren hatte. Und Sheba streunte nie.
Als er das Parkgatter zum ASDA-Supermarkt erreichte, warf er einen Blick auf die Uhr. Es war mittlerweile halb zehn geworden — und seine Kumpel hatten das gemeinsame Frühstück wahrscheinlich längst beendet. Die Sonne stand bereits hoch am Himmel, und er schwitzte … der Gedanke an eine Tasse Kaffee, auch wenn er sie allein trinken mußte, war trotzdem verlockend. Doch je länger er herumtrödelte, desto heißer würde es auf dem Heimweg werden.
Er wischte sich die Stirn mit dem Taschentuch trocken und ging weiter. Auf diesem Abschnitt wuchsen die Brombeerranken bis in den Weg, verhakten sich in seinen Hosenbeinen, und er blieb einen Moment stehen, um besonders hartnäckige Brombeerdornen aus den Schnürsenkeln seiner Schuhe zu lösen. Während er noch kniete, hörte er Sheba laut aufjaulen.
Stirnrunzelnd löste er die Brombeerranke aus dem Schuhband. Daß Sheba ausgerechnet hier jaulte, kam ihm merkwürdig vor, da ihr normales Repertoire auf dieser Wegstrecke aus aufgeregtem Bellen und Kläffen bestand. Hatte sie sich vielleicht verletzt? Unruhig geworden, stand er hastig auf und starrte angestrengt auf den Weg. Der Laut hatte geklungen, als sei Sheba weit vorausgelaufen.
»Sheba!« rief er und hörte selbst das ängstliche Vibrieren seiner Stimme.
Diesmal war das Jaulen noch deutlicher zu hören. Es kam irgendwo von vorn und nach rechts versetzt neben dem Weg. George rannte in diese Richtung, sein Herz klopfte, als er die sanfte Kurve im Dauerlauf umrundete.
Die Frau lag auf dem Rücken im hohen Gras gleich neben dem Trampelpfad. Sie hatte die Augen geschlossen, und die Strähnen ihres üppigen langen, rotblonden Haars waren mit den Ranken einer weißblühenden Winde verwoben. Sheba, die neben ihr kauerte, sah erwartungsvoll zu George auf.
Sie war wunderschön. Im ersten Augenblick dachte er, sie schliefe, sagte sogar zögernd: »Miß …«
Dann ließ sich eine Fliege auf der weißen Hand nieder, die bewegungslos auf dem Revers ihres Jacketts ruhte, und da wußte er Bescheid.
2
Drunten bei den Docks ist die Gegend, die ich mir alsAuswanderer als den Ort wählen würde, um ein Schiffzu besteigen. Sie ließe meine Entscheidung in vernünftigem Licht erscheinen; würde mir viele der Dinge aufzeigen, die ich hinter mir lassen wollte.
CHARLES DICKENS (1861)
Um fünf vor zehn an einem bereits heißen Samstag morgen suchte Gemma nach einer Adresse am Lonsdale Square. Nur wenige Gehminuten von ihrer Wohnung in Islington entfernt war der Platz von den Autos der Anwohner gesäumt, die das Wochenende zu Hause verbrachten. Und es war kein Zentimeter freigeblieben. Es war eine schicke Wohngegend, Einzugsgebiet aufstrebender Blair-Anhänger, und Gemma fragte sich, wie sich eine alleinstehende Frau eine derart exklusive Adresse leisten konnte. Die Reihenhäuser im Stil der Zeit von George III. wirkten streng, ihre grauen Backsteinfassaden nur durch das Schwarzweiß von Fenstern und Türen durchbrochen. Nur eine glänzend rot gestrichene Tür bildete die Ausnahme.
Gemma vergewisserte sich mit einem Blick auf ihren Notizblock erneut, daß sie bei der richtigen Adresse war, stieg die Stufen zum Eingang hinauf und klingelte. Sie steckte eine Haarsträhne zurück, die sich aus ihrem Zopf im Nacken gelöst hatte, und sah an ihrer saloppen Samstagskleidung hinab … Jeans, Sandalen und ein limonenfarbenes Leinenhemd. Was war für den bevorstehenden Anlaß das richtige Outfit? Vielleicht hätte sie sich …
Bevor sie sich noch entschließen konnte, doch lieber den Rückzug anzutreten, schwang die Tür auf. »Sie müssen Gemma sein«, sagte die Frau im kirschroten Trägerkleid und lächelte. Bis auf ihre grellrot geschminkten, vollen Lippen war sie kaum zurechtgemacht. Ihr kurzes, dunkles Haar war modisch zerzaust, als sei es mit einer Nagelschere geschnitten worden, und ihre Augen im blassen Gesicht waren bernsteinfarben. »Ich bin Wendy.«
»Ihre Tür gefällt mir«, sagte Gemma.
»Bricht das Eis, finde ich. Kommen Sie rein.« Das Zimmer, in das sie Gemma führte, war der Straße zugewandt. Es nahm offenbar das gesamte Parterre ein, war lang und schmal, einfach geschnitten und verhältnismäßig hoch. Ein schlichter Kamin im georgianischen Stil teilte den Raum in zwei symmetrische Hälften.
Alles andere stellte Gemmas Erwartungen völlig auf den Kopf. Die Wände waren kreidegelb, die Möbel im Stil der Sechziger, die Bezüge in Primärfarben. Über dem Kaminsims hing ein großes Plakat, das die Beatles auf der Abbey Road zeigte.
An der einen Längswand zwischen Kamin und dem rückwärtigen Teil des Raumes stand ein Klavier. Während Gemma sich noch umsah, berührte ihre Gastgeberin sie leicht am Arm und deutete auf das Sofa.
»Setzen Sie sich doch. Ich habe uns Kaffee gekocht. Heute morgen sollten wir uns erst mal kennenlernen.«
»Aber ich dachte …« Gemmas Nervosität regte sich wieder. Was hatte sie sich nur dabei gedacht, diese Verabredung zu treffen, einen freien Samstag morgen zu opfern, den sie mit Toby hätte verbringen können? Es war eine Schnapsidee gewesen, eine Marotte, die sie lieber hätte vergessen sollen, anstatt eine komplette Idiotin aus sich zu machen. Zum Glück hatte sie niemandem außer ihrer Freundin Hazel von ihrem Vorhaben erzählt.
Wendy Sheinart setzte sich neben Gemma und griff nach der Kaffeekanne. »Also …« Sie füllte Gemmas Tasse. »Jetzt erzählen Sie mir bitte, weshalb Sie Klavierspielen lernen möchten.«
Kincaid hatte fürs Picknick die Dinge eingepackt, die er für jungengerecht hielt: dicke Schinkenbrote, Kartoffelchips, Coca-Cola und als Krönung ein riesiges Stück Schokoladentorte aus der Konditorei in der Heath Street. Er stellte den Korb – speziell für diese Gelegenheit gekauft — in den Kofferraum des Midget und öffnete das Cabriodach des Wagens mit einem dankbaren Blick hinauf in den klaren blauen Himmel über der Carlingford Road.
Nach den schweren Regenfällen Anfang Juni hatten die Wetteraussichten für die Endrunde in Wimbledon trübe ausgesehen. Kincaid hatte sich trotzdem beharrlich um Karten bemüht und schließlich zwei Plätze am Center Court für diesen Tag ergattert, und es schien, als wolle der Wettergott seine Ausdauer belohnen.
Mit einem letzten, dankbaren Blick zum Himmel setzte er sich mit einer für ihn neuen, freudigen Erwartung hinters Steuer. Der Motor des Midget röhrte sonor, und als er den ersten Gang einlegte, dachte er voller Schuldbewußtsein daran, daß er drauf und dran gewesen war, den altersschwachen Sportwagen zu verkaufen. Jetzt kam ihm dieses Ansinnen geradezu frevelhaft vor, nachdem ihm das Cabrio so viele Jahre treue Dienste erwiesen hatte … fast so, als setze man einen lieben alten Hund aus. Und sowieso hätte Kit ihm das vermutlich nie verziehen. Der Junge hatte sich auf den ersten Blick in das Auto verliebt, und in seiner Lage brauchte er Kontinuität in seiner Umgebung mehr als alles andere.
Seit der Ermordung von Kincaids geschiedener Frau im April hatte er alles getan, um die Lücke im Leben ihres Sohnes zu füllen, die sie hinterlassen hatte. Dabei war es ihm mittlerweile zur Gewißheit geworden, daß Kit wirklich nicht das Kind von Vics zweitem Mann, sondern sein, nämlich Kincaids, Sohn war, gezeugt, kurz bevor sich Vic vor zwölf Jahren von ihm getrennt hatte … Nur ahnte Kit bisher nichts von alledem.
Kincaid bog in die Rosslyn Hill ein und fuhr in südliche Richtung weiter zum Haverstock Hill, von dort ging es in die Chalk Farm und schließlich in die Camden High Street. Als er auf seinem Heimweg von Gemma früher am Morgen durch Camden Town gekommen war, hatten die Straßenverkäufer dort gerade ihre Stände aufgebaut. Jetzt war der Wochenendmarkt in vollem Gang, und die Auslage an bunten Baumwollröcken und Kleidern erinnerte ihn unwillkürlich an Gemma. Diese Art der Kleidung stand ihr, und er wußte, daß ihr das bunte Treiben gefallen würde. Vielleicht sollten sie bald mal mit Kit einen Wochenendausflug machen.
Er fragte sich, wie sie wohl ihren Samstag verbringen mochte. Sie hatte ihm versichert, sich wegen der Wimbledonkarten keinesfalls vernachlässigt vorzukommen, und behauptet, er und Kit bräuchten Zeit füreinander. Ihre eigenen Pläne fürs Wochenende hatte sie dabei mit keinem Wort erwähnt. Oder hatte er es einfach nur unterlassen, sie danach zu fragen?
Die abrupte Vollbremsung des Wagens vor ihm zwang ihn, seine Grübeleien über die Minenfelder zwischenmenschlicher Beziehungen aufzugeben und sich aufs Überleben im Straßenverkehr zu konzentrieren. Der Verkehrsstrom bewegte sich nur zäh in Richtung King’s Cross vorwärts. Trotzdem fand er sofort einen Parkplatz am Straßenrand und erreichte den Bahnsteig mehr als rechtzeitig.
Als der Zug aus Cambridge wenige Minuten später anhielt, empfand Kincaid dieselbe Erregung, die ihn schon als Kind bei der Ankunft eines Zuges erfaßt hatte. In seiner kleinen Heimatstadt in Cheshire hatten die Züge etwas von dem Flair der großen weiten Welt, von Abenteuern und interessanten Menschen verbreitet.
Sein Blick schweifte auf der Suche nach Kits semmelblondem Haarschopf über die Menge der aussteigenden Fahrgäste. Er winkte, als er ihn entdeckt hatte. Mit einem Lächeln überspielte er den Schock, den er noch immer angesichts der Ähnlichkeit des Jungen mit Vic empfand, gab dem Jungen einen freundschaftlichen Klaps auf die Schulter, bevor er für die übliche rituelle Begrüßung, die sie sich angewöhnt hatten, den Arm mit der Handfläche nach oben ausstreckte. »Hallo, Sportsfreund! Schlag ein! Heiß auf Tennis?«
Kit schlug grinsend ein, warf seine Reisetasche über die Schulter und folgte Kincaid zum Ausgang. »Colin war grün vor Neid. Du hättest sein Gejammere hören sollen. Laura war ziemlich sauer.«
»Und wie ich dich kenne, hast du ihn gern in seinem eigenen Saft schmoren lassen«, bemerkte Kincaid trocken, als er den Kofferraum öffnete und Kits Tasche nahm. »Nein, nicht reinsehen.« Er klappte den Kofferraumdeckel zu, bevor Kit den Inhalt begutachten konnte. »Ich habe eine Überraschung.«
»Eine Überraschung? Wirklich?« Kits Augen wurden groß; ein Beweis dafür, daß man mit elf Jahren für Überraschungen noch nicht zu alt war. Kit hechtete geschickt auf den Beifahrersitz des Midget. »Was für eine Überraschung?«
»Die von der eßbaren Sorte«, neckte Kincaid, als er den Wagen startete. »Warte und …« Sein Telefon klingelte, als er den Wagen aus der Parklücke fuhr. Leise fluchend zog er es mit einer Hand aus der Tasche, während er mit der anderen das Auto wieder an den Straßenrand zurücklenkte.
»Kincaid!« meldete er sich unwirsch und hörte am anderen Ende die vertraute Stimme der Telefonistin von Scotland Yard: »Augenblick, ich verbinde.«
»Was gibt’s?« fragte Kit.
Kincaid deckte eine Hand über die Sprechmuschel und antwortete: »Ist beruflich.« Dann fügte er mit einer Zuversicht hinzu, die er nicht empfand: »Dauert nicht lange.«
Chief Superintendent Denis Childs meldete sich am anderen Ende mit der für ihn typischen, stoischen Ruhe. Kincaid hatte mehr als einmal, wenn auch mit schlechtem Gewissen, eine Naturkatastrophe herbeigesehnt, nur um zu testen, ob Childs Herzfrequenz jemals zu einer Beschleunigung fähig war.
»Duncan? Tut mir leid.« Die sonor knarrende Stimme des Superintendent entsprach seiner beeindruckenden Körpergröße und Statur. »Ich weiß, Sie stehen dieses Wochenende nicht auf dem Dienstplan.«
Kincaid stöhnte innerlich. Eine Entschuldigung als Einleitung war ein mieses Zeichen.
»Ist wieder mal einer dieser Chaostage«, fuhr sein Chef fort. »Die anderen Teams sind schon im Einsatz, und gerade ist die Meldung über einen Mordfall reingekommen, der für die Kollegen vor Ort offenbar eine Nummer zu groß ist. Ihr leitender Kriminalinspektor ist übers Wochenende verreist, und der Polizeichef ist der Meinung, der frischgebackene weibliche Inspector, der übers Wochenende Dienst hat, sei überfordert.«
»Mord als Feuertaufe … ein bißchen happig, was?« stimmte Kincaid zu. »Und wo liegt die Leiche?«
»Isle of Dogs. Mudchute Park.«
»Heiliger Strohsack!« Kincaid haßte Tatorte im Freien. In geschlossenen Räumen konnte man zumindest auf interessante Spuren hoffen.
»Es handelt sich um eine junge Frau«, fuhr Childs fort. »Der Vorbericht klingt nach Tod durch Erwürgen.«
»Ist die Spurensicherung schon unterwegs?« fragte Kincaid und zog eine Grimasse. Ein Sexualmord im Freien. Wurde ja immer schöner. »Haben die Uniformierten den Tatort gesichert?«
»Sind gerade dabei. Wie schnell können Sie dort sein?«
»Geben Sie mir …« Kincaid warf einen Blick auf seine Uhr und sah dabei aus den Augenwinkeln Kits bleiches, gespanntes Gesicht.
Er hatte den Jungen völlig vergessen.
»Chef …« Er verstummte. Wie konnte er Childs seine mißliche Lage erklären? »In einer knappen Stunde«, sagte er schließlich mit einem weiteren Blick auf Kit. »Ich muß zuerst noch was regeln. Was ist mit Gemma?«
»Der diensthabende Sergeant ruft sie gerade an. Halten Sie mich auf dem laufenden«, fügte Childs hinzu und legte auf.
Kincaid schaltete das Handy aus und wandte sich langsam Kit zu. »Tut mir leid. Ist was dazwischengekommen. Ich muß leider arbeiten.«
»Kannst du nicht …«, begann der Junge, aber Kincaid schüttelte bereits den Kopf.
»Habe keine Wahl, Kit. Ist wirklich ein Jammer, aber du mußt nach Cambridge zurück.«
»Kann ich nicht«, antwortete Kit mit schriller werdender Stimme. »Die Millers sind übers Wochenende verreist. Schon vergessen?«
Kincaid starrte Kit an. Auch das hatte er vergessen. Es fiel ihm zunehmend schwerer, die Anforderungen seines Jobs mit seinen Verpflichtungen gegenüber Kit unter einen Hut zu bringen. Jetzt saß er in der Patsche.
»Schätze, dann mußt du den Tag allein in meiner Wohnung verbringen«, erklärte er mit einem Lächeln, das die Hiobsbotschaft abmildern sollte.
»Aber das Tennismatch …« Kit biß sich auf die zitternde Unterlippe.
Kincaid wandte den Blick ab, gab dem Jungen Zeit, sich zu fassen. Dann kam ihm die Idee. »Vielleicht können wir was deichseln. Abwarten und Tee trinken«, sagte er nachdenklich. Seidengelb, hatte sich das Farbmuster genannt, und Jo Lowell hatte sowohl der Name als auch der Farbton gefallen. Während sie malte, stellte sich Jo vor, wie sich die Farbe wie flüssige Butter über Küchen- und Eßzimmerwände ausbreitete und immerwährenden Sonnenschein in Räume zauberte.
Nichts heiterte bei Niedergeschlagenheit so wirksam auf wie ein bißchen frische Farbe, sagte sie oft zu ihren Kunden, fand jedoch selten die Zeit, dem eigenen Rat zu folgen. Und selbstverständlich erledigten ihre Kunden Malerarbeiten nie selbst; dabei war die körperliche Betätigung ihrer Ansicht nach der effizienteste Teil der Therapie. Vielleicht konnte sie den Aufdruck auf ihrer Visitenkarte in »Inneneinrichtung und Stimmungsberatung« ändern und den Stundensatz erhöhen.
Das flüchtige Lächeln, das der Gedanke hervorrief, verschwand schnell, als ihr der vorausgegangene Abend einfiel. Ihre fröhlichen gelben Wände mit dem beruhigenden Grün der Fensterlackierung hatten wenig dazu beigetragen, die eruptiven Gefühlsausbrüche zu verhindern, die sie unbedingt hatte vermeiden wollen. Sie hatte eine kleine, kultivierte Dinnerparty geplant gehabt … als Mittel zum Zweck, um mit Annabelle Frieden zu schließen, ohne ihr explizit verzeihen zu müssen. Schließlich war sie trotz allem, was zwischen ihnen geschehen war, ihre Schwester, und sie hatte den Kontakt mit ihr vermißt.
Jo war früher eine gute Gastgeberin gewesen. Jetzt war es ihr erster Versuch einer Einladung ohne Martin gewesen, und es war ihr nicht leichtgefallen, die richtige Mischung der Gäste zusammenzustellen. Eine der unangenehmsten Folgen einer Scheidung, so hatte sie erfahren, war die Aufteilung der Freunde in »sein« und »ihr« Lager. Martins Freunde waren selbstverständlich tabu. Trotzdem hatte sie es nicht gewagt, ihre eigenen Parteigänger mit Annabelle zusammenzubringen, da sie die Schwester als die böse Hexe aus dem Märchen betrachteten. Folgerichtig hatte sie Gäste eingeladen, von denen sie sicher annehmen konnte, daß sie einen erfreulichen, neutralen Abend garantierten: ein Ehepaar, das seit kurzem zu ihren Kunden zählte; Rachel Pargeter, eine Nachbarin, die eine enge Freundin ihrer Mutter gewesen war; Annabelle und Reg. Und beinahe hätte es auch funktioniert … wenn ihr Sohn Harry seiner Tante nicht die Meinung gesagt hätte.
Vorsichtig stellte Jo den letzten Strauß Frühsommerblumen in die Vase auf dem Eßtisch. Die Küchentür schlug zu, und Sarahs hohe Piepsstimme drang deutlich von der Rückseite des Hauses herüber. »Mami! Mami!«
»Ich bin hier, Schätzchen!« Jo nahm ihre Schere und das Blumenpapier und lief in die Küche. Ihre Tochter stand direkt hinter der Tür, das dunkle Haar zerzaust, die Wangen von der Hitze gerötet. Sie hatte etwas, das verdächtig nach Cola aussah, über der Vorderfront ihres T-Shirts verkleckert, und das Taillenband ihrer geblümten Shorts war unter ihren Nabel geruscht. Mit vier Jahren war Sarah eine sprachlich versierte, geschickte kleine Petze.
»Harry ist im Schuppen, Mami. Du hast gesagt, er darf da nicht rein. Und ich weiß, daß er was kaputt gemacht hat. Ich hab gehört, wie’s gekracht hat.«
Jo fühlte, wie Ärger in ihr hochstieg. Sie unterdrückte ihn. Sarah brauchte in ihrer selbstgerechten Empörung keine Ermutigung. »Ich rede mit Harry … du wäschst dir inzwischen am Spülbecken die Hände. Außerdem bist du wieder an der Cola gewesen, was, Fräulein?«
Sarah sah an ihrem T-Shirt hinunter, und Jo erkannte, welch berechnender Ausdruck über ihr herzförmiges Gesicht huschte, bevor sie ernst entgegnete: »War ich nicht, Mami, Ehrenwort. Harry hat sie geholt und sie auf meinem Hemd verkleckert.« Sie zog den fleckigen Stoff von ihrer Brust weg, als wolle sie nichts damit zu tun haben.
»Großer Gott!« Jo schloß die Augen und sprach ein stummes Gebet. Ihre süße kleine Tochter würde entweder Schauspielerin oder kriminell werden, und sie fühlte sich außerstande, sich mit der einen oder anderen Alternative im Augenblick auseinanderzusetzen. Sie holte tief Luft. »Gut. Wenn deine Hände sauber sind, räumst du die Spielsachen im Wohnzimmer auf. Außerdem möchte ich jetzt keine Geschichten mehr hören. Ist das klar?«
Sarah setzte ihre beleidigste Miene auf. »Aber, Mami …«
Jo jedoch stieß bereits die Tür in den Garten auf. Sie begann zu lernen, daß die einzige Methode, mit ihrer Tochter fertig zu werden, die war, sich einem Dialog zu entziehen. Wenn sie sich weiter darauf einließ, zog sie regelmäßig den kürzeren und streckte die Waffen. Bei Harry war das anders gewesen. Der geringste Tadel hatte genügt, um dem Jungen die Tränen in die Augen zu treiben. Er war in diesem Alter eher dünnhäutig gewesen. Aber jetzt, seit sich seine Sensibilität in wütenden Trotz verwandelt zu haben schien, war sie unfähig, überhaupt zu ihm durchzudringen.
Im Garten war es still. Nur das Summen der Hummeln im Lavendel war zu hören. Niemand war zu sehen. Die einzigen Zeichen von Aktivität waren ein zerbrochener Kricketschläger und ein alter Gummiball im dichten Gras. Am Ende des Gartens stand die Tür zum Schuppen offen. Das kleine Fertigbauhäuschen war Jos Zuflucht und Studio.
Sie hatte die Außenwände in einer Farbe gestrichen, die sich Labrador-Blau nannte, und das Holz der Fenster weiß abgesetzt. Drinnen hatte sie die Wände mit Beize behandelt und den Raum mit alten Möbeln, einigen Gießkannen und Büchern ausgestattet. Hier experimentierte sie mit ihren Qualitätslacken, für die sie bekannt war, oder las oder versuchte gelegentlich einfach, mit ihrem Leben klarzukommen. Der Zutritt zum Schuppen war beiden Kindern strikt untersagt.
Langsam überquerte sie den Rasen und trat ein. Harry saß auf dem Boden mit dem Rücken zum Bücherregal, die Knie bis zum Kinn hochgezogen. Neben ihm lag der schöne Glaskrug, in den sie Rosen aus dem Garten gestellt hatte, und der Henkel war abgebrochen. Wasser perlte auf dem Fußboden und lief in den Flickenteppich; Rosen lagen überall kreuz und quer wie die Hinterlassenschaft eines Gewitters.
Jo kniete nieder und berührte seine Schulter. »Hast du dich daran geschnitten? Bist du in Ordnung?« Als er nicht antwortete, nahm sie seine Hände von den Knien und untersuchte sie. Sie waren unverletzt. Sie behielt eine Hand in der ihren und versuchte es erneut: »Harry, hast du die Vase zerbrochen, weil du so wütend auf mich bist? Du weißt, daß das, was du gestern abend gemacht hast, falsch war. Aber vielleicht war es falsch von mir, dich zu bestrafen, ohne vorher mit dir zu reden.«
Harry drehte den Kopf noch weiter von ihr weg, und der Sonnenstrahl, der durchs Fenster fiel, ließ sein Haar wie Feuer leuchten. Was für eine Ironie des Schicksals, dachte Jo, daß, während Sarah ihr kastanienbraunes Haar geerbt hatte, Harry eigentlich von ihrer Schwester hätte stammen können. Und von ihrem Vater, der Annabelle Jo stets vorgezogen, all seine Erwartungen auf Harry als den Erben fixiert hatte, wenn auch nicht des Familiennamens so doch der Familientradition wegen.
»Manchmal können sich auch Mütter irren«, fuhr sie fort. »Aber ich muß dir irgendwie begreiflich machen, daß du anderen Menschen nicht solche Dinge sagen darfst. Ich bin sicher, du hast Annabelle sehr weh …«
»Ist mir völlig egal.« Harry entzog ihr abrupt seine Hand und sah sie zum ersten Mal an. »Sie ist eine Hure. Ich wollte ihr weh tun.« Er blinzelte, und Tränen kullerten zwischen seinen blaßblonden Wimpern hervor.
»Harry, benutz diese Ausdrücke nicht. Du weißt genau …«
»Ist mir egal. Ich hasse sie.«
»Harry, Schätzchen …«
»Nenn mich nicht so!« Er sprang auf und baute sich vor ihr auf. »Ich bin nicht dein Schätzchen! Und ich hasse dich genauso.« Die Tür schlug krachend hinter ihm zu. Dann war er fort.
Die Münzen klimperten in unregelmäßigem Stakkato in Gordon Finchs Klarinettenkasten. Die Kinder warfen sie, kamen so nahe, wie sie es wagten, und selbstvergessen in ihrer Faszination, bewegten sie ihre Körper unbewußt in Richtung zur Musik. Die kleinen Mädchen und Jungen hatten bei der Hitze freie Oberkörper, und ihre Rippen zeichneten sich unter ihrer Haut ab wie die zarten Adern eines Blattes. Ihre Gesichter waren von der Sonne gerötet, und einige hielten halbvergessen Eiswaffeln in klebrigen Fingern.
Er beneidete die Kinder um ihre schlichte Unschuld, ihre Unverdorbenheit, denn es war abzusehen, daß jemand kam und all das zunichte machte. Ein Glück, daß ihm die Verantwortung für ein anderes Menschenleben bislang erspart geblieben war. Die Sorge für Sam war ungefähr das Maximum dessen, was er bewältigen konnte. Alles andere würde ihn um den Verstand bringen.
Er spielte Cherry Blossom Pink zu Ende und wischte das Klarinettenmundstück ab. Die Kinder sahen ihm mit großen Augen zu und hüpften in gespannter Erwartung auf und ab. Ihre Eltern standen hinter ihnen; einige hatten sich auf den kniehohen Eisenzaun gesetzt, der die Blumenrabatte vom leicht schwülstigen Bogeneingang des Fußgängertunnels der Isle of Dogs trennte. Er hob die Klarinette erneut an die Lippen und intonierte ein paar Takte von London Bridge. Die Kinder begannen zu kichern. Er hielt inne, dachte einen Moment nach, zerbrach sich den Kopf darüber, welche Melodien sie mögen könnten, und improvisierte schließlich über die Leitmelodie von Here We Go Round the Mulberry Bush.
Er, der Rattenfänger mit der Klarinette, ging anschließend zu Ob-La-Di, Ob-La-Da über, und spielte danach When I’m Sixty-Four aus dem Sergeant-Peppers-Album der Beatles, und die Kinder hüpften und wiegten sich glücklich im Takt. Nach einiger Zeit jedoch wurden die Eltern unruhig, und eine Familie nach der anderen ging weiter. Sie haben alle einen genauen Tagesplan, dachte er, während er sie davongehen sah … Da waren Orte, wohin sie gehen konnten, Dinge, die sie tun mußten, Leute, die sie besuchen wollten. Er beneidete sie doch wohl nicht darum, oder?
Er beendete das Stück, trank einen Schluck Wasser aus der Flasche, die er am Kiosk einige Meter entfernt gekauft hatte. Er stand mit dem Rücken gegen die Platane mit den frischen, grünen Knospen am hinteren Ende von Island Gardens. Hinter ihm, direkt auf der anderen Seite des Baumes, verlief die Uferpromenade am Fluß entlang. Leute schlenderten in dem langsamen Tempo vorbei, das die sommerliche Hitze diktierte, blieben gelegentlich stehen, um auf einer der Bänke auszuruhen oder auf das grelle Glitzern der Themse hinauszuschauen. Direkt über dem Fluß zogen die weiten Zwillingskuppeln des Royal Naval College, der Königlichen Marineakademie, unweigerlich die Blicke auf sich, deren Form sich im Gewölbe des bereits in Greenwich gelegenen Fußgängertunnels wiederholte.
Zwischen dem Naval College und dem Tunnel ragten die hohen Masten der Cutty Sark auf, die am Greenwich-Pier auf dem Trockendock lag. Das Schiff war das letzte Exemplar jener herrlichen Schnellsegler, die einst ihre Ladung an den East End Docks gelöscht hatten, und er hatte sich oft gewünscht, zumindest das Ende dieser Ära noch miterlebt zu haben. Aber dazu war er zu jung. Neben der Cutty Sark allerdings bewies die über die Toppen geflaggte, wesentlich kleinere Gipsy Moth, daß Abenteuer noch immer möglich waren. Im Jahr 1967 nämlich hatte Sir Francis Chichester die kleine Yacht per Einhand um die Welt gesegelt.
Eine Reise um die Welt wäre der einfachste Ausweg aus seiner gegenwärtigen, mißlichen Lage gewesen. Aber kaum daß Gordon der Gedanke gekommen war, wußte er, daß er hier viel zu tief verwurzelt war, hier am Ort seiner Kindheit. Außerdem konnte Flucht letztendlich keine Lösung sein.
Er kauerte nieder und goß etwas Wasser in die Schale, die er stets für Sam dabeihatte. »Durst, Kumpel?« Der Hund hob den Kopf und rappelte sich mit einem eher pflichtschuldigen als freudigen Ausdruck hoch. Nach ein paar Schlucken beendete er die Gehorsamsübung, drehte sich zweimal auf dem kahlen Fleck um die eigene Achse, den er als Schlafstatt gewählt hatte, ließ sich nieder und legte die Schnauze auf die Vorderläufe. Sams Bewegungen waren in diesen Tagen merklich langsamer geworden. Aber die Hitze machte alle lethargisch. Trotzdem hatte sich Gordon entschlossen, den Hund nicht mehr mit in den Tunnel zu nehmen. Die bis in die Knochen kriechende Feuchtigkeit war auch für die Gesundheit eines Hundes sicher nicht zuträglich.
Allerdings hatte er nicht vor, im Tunnel zu spielen; schon gar nicht nach dem, was vergangene Nacht geschehen war. Natürlich hatte er gewußt, daß er sie sehen würde … das war unausweichlich, wenn man so dicht beieinander arbeitete und wohnte. Trotzdem war er auf der Insel geblieben, spielte im Park, im Tunnel, im Schatten der Kräne auf der Glengall Bridge … und forderte das Schicksal heraus. Selbst an diesem Tag — und mochte der Standort noch so gut sein — hätte es lukrativere Gegenden für einen Straßenmusikanten gegeben. Vielleicht sollte er seine Sachen zusammenpacken und es in South Kensington an der Hampstead High Street oder wieder in Islington versuchen.
Er kniete nieder, die Hände an der Klarinette, als wolle er sie zerbrechen, als vor seinem geistigen Auge Annabelles Bild erschien, bleich und wütend. Am vergangenen Abend hatte die Wut ihr die typisch distanziert-kühle Maske vom Gesicht gerissen, die sie ihm selbst damals gezeigt hatte, als er ihr den Laufpaß gegeben hatte. Und zum ersten Mal, vermutete er, hatte er gesehen, wie sie wirklich war und was sie wirklich fühlte. Und doch war er nicht willens gewesen, ihr Glauben zu schenken. Jetzt allerdings kamen ihm Zweifel, und er fragte sich, ob er sich von seinem Stolz hatte blenden lassen.
Was, wenn er sie falsch eingeschätzt hatte? Was, wenn er sich geirrt hatte?
Janice Coppins Herz hatte einen Sprung getan, als das Telefon geklingelt hatte. Eine seltsame Mischung aus Furcht und Erregung hatte sie erfaßt. Wenn sie an Wochenenden in den Dienst gerufen wurde, war die häusliche Situation immer schwierig … Seit Bill nicht mehr da war, mußte sie die Kinder in die Krippe schicken, und bei zehn Pfund pro Tag und Kind fragte sie sich, ob es nicht kostengünstiger gewesen wäre, stempeln zu gehen. Besonders hilfreich mit den Kindern — oder sonst zu etwas nutze — war Bill allerdings auch nicht gewesen. Zu mehr als zum Hosen herunterlassen und ihr Kinder zu machen, hatte es bei dem Filou nicht gereicht. Sie hätte auf ihre Mutter hören sollen.
Ihre Tochter Christine kam herein und setzte sich auf die Bettkante und beobachtete sie mit jener ihr eigenen Aufmerksamkeit, die Janice stets beunruhigend fand. Das älteste ihrer drei Kinder war ein scheues Mädchen, das Verantwortung sehr ernst nahm; so ernst, als wolle es damit wettmachen, daß es im Gebüsch von Mudchute Park mit Bills Lederjacke als Unterlage gezeugt worden war. Ihr molliger Körper wehrte sich hartnäckig gegen jedes Anzeichen von Pubertät, und ihr glattes braunes Haar sah aus, als sei es wie um einen Topf herum abgeschnitten worden. Sie selbst allerdings schien sich dieser Unzulänglichkeiten nicht bewußt zu sein.
»Was ist es diesmal, Mami?« fragte sie und schob die Brille auf ihrer Stupsnase hoch.
Janice, einen Fuß gerade in eine saubere Strumpfhose gesteckt, sah ihre Tochter an. Ein verdächtiger Todesfall, hatte der diensthabende Sergeant gesagt, und da ihr Chef übers Wochenende verreist war, bedeutete das, daß sie dafür zuständig war. »Weiß ich noch nicht, Kleines«, erwiderte sie ausweichend. Sie versuchte stets, die unangenehme Seite ihres Berufs von den Kindern fernzuhalten. »Mist!« fügte sie hinzu, als sie aufstand, und die Laufmasche in der Strumpfhose entdeckte. Es war ihr letztes Paar. Sie mußte sich damit begnügen. Eigentlich wäre heute ihr Tag für den Friseur gewesen. Jetzt mußte sie noch eine weitere Woche ohne neuen Schnitt und frische Tönung auskommen. Und für ihr Wollkostüm war es eigentlich viel zu warm. Trotzdem hatte sie keine andere Wahl, selbst wenn sie am Ende des Tages stinken sollte wie eine Morchel. Es war das Kleidungsstück, das noch am ehesten Autorität und Professionalität ausstrahlte. Und wenn heute ihr großer Tag werden sollte, mußte wenigstens die äußere Erscheinung stimmen.
»Bist du wieder zu Hause, bevor die Krippe zumacht?« Christine ignorierte wie stets ihr Fluchen. Im Gegensatz zu den Jungen, die ihre Kraftausdrücke meistens begierig aufgriffen, nur um dann von ihr getadelt zu werden. »Die Jungs wollen sicher nicht zu Großmutter.«
»Ihr Pech«, sagte Janice gereizt und seufzte. Sie schlüpfte in ihre neuen Schuhe, zog das Jackett an, und fühlte umgehend durch den dünnen Stoff der Bluse den unangenehm rauhen Stoff auf ihrer Haut. »Chris, du weißt, ich komme so schnell zurück, wie ich kann. Ich ruf in der Krippe an, okay? Sobald ich absehen kann, wie’s wird.«
Christine nickte, die Augen hinter der Brille blieben ernst.
»Du holst die Jungs von den Nachbarn und gehst mit ihnen in die Krippe … sag ihnen, sie sollen gehorchen …« Beim Hinausgehen griff sie nach Schlüsselbund und Handtasche. Mit einem letzten Blick zurück erfaßte sie das ungemachte Bett, den Berg Schmutzwäsche, die zu waschen sie noch keine Zeit gehabt hatte, und dachte unwillkürlich an das schmutzige Geschirr in der Küche und das Chaos im Wohnzimmer. Du hast es so gewollt, erinnerte sie sich. Du wolltest die Uniform ablegen; du hast die Ellbogen eingesetzt und bist anderen auf die Zehen getreten, um genau das zu erreichen.
Draußen vor der Haustür umarmte sie Christine hastig und sah der Tochter nach, die zu den Nachbarn rannte. Ein anderer Nachbar wusch auf der gegenüberliegenden Straßenseite seinen Wagen. Sein fetter Bauch wölbte sich unter der dünnen Baumwollweste über dem Hosenbund, der so tief hing, daß beim Bücken sogar die Pofalte zu sehen war. Janice wandte sich leicht angeekelt ab, wußte, er würde ihr lächelnd hinterherpfeifen, sobald er ihren Blick bemerkte. Bastarde! Die denken doch alle, man will von ihnen flachgelegt werden, egal, wie sie aussehen.
Sie zögerte, überlegte kurz, ob sie zu Fuß und über die Glengall Bridge gehen sollte. Es wäre der direkte Weg gewesen. Mit dem Wagen mußte man den Umweg um die Docks machen. Andererseits festigte es kaum ihre Autorität, wenn sie zu Fuß am Tatort erschien.
Einige Minuten später stellte sie ihren Vauxhall neben den parkenden Funkstreifenwagen auf dem Parkplatz des ASDA-Supermarkts ab. Detective Miller empfing sie, sein pickeliges Gesicht war bleich … und hatte beim näheren Hinsehen eine deutlich grünliche und ungesunde Farbe.
»Sagen Sie mir, daß es ein schlechter Scherz ist«, seufzte sie. »Hat sich bestimmt dieser alte Idiot George Brent ausgedacht, um mir meinen Samstag vormittag zu versauen.«
Miller wurde noch eine Nuance bleicher. »Nein, Madam. Da oben liegt eine Leiche.« Er deutete zum Hang unterhalb des Parks hinauf. »Genau da.«
Menschliches Strandgut, vermutete Janice automatisch. Hat sich ein nettes, friedliches Plätzchen zum Sterben ausgesucht. War zwar unpassend, aber sicher nicht weiter schlimm. Nicht ausgerechnet an diesem Wochenende, da sich ihr Chef bei der Hochzeit seines Sohnes bewußtlos soff.
»Ist eine Frau«, sagte Miller. »Jung. Die Spurensicherung ist unterwegs.«
Janice fühlte Schweißtropfen in ihren Achselhöhlen kitzeln. Jetzt war sie gefordert. Ob sie sich der Sache gewachsen fühlte, interessierte niemanden.
3
Der Mudchute Park von heute war ursprünglich einStück Land, das einst von den Docks mit verwaltet wurde. Es umfaßt ein ungefähr zwölf Hektar großes, beinahe quadratisch angelegtes Gebiet, umgeben von mit Klinkersteinen befestigten Böschungen (an denen jetzt Grasund Wildblumen gedeihen). Diese Böschungen warenangelegt worden, um die Berge von Schlick zu befestigen,die in den achtziger und neunziger Jahren des letztenJahrhunderts aus dem Millwall Dock ausgebaggert unddort aufgeschüttet worden waren.
EVE HOSTETTLER, aus: Erinnerungenan eine Kindheit auf der Isle of Dogs,1870–1970
Kincaid mußte zu seinem großen Bedauern zweimal anhalten, um einen Blick in seinen Stadtplan zu werfen. Es war lange her, daß er einen Fall im East End bearbeitet hatte. Außerdem ergab sich selten ein Grund, sich weiter östlich als Wapping oder Limehouse zu begeben. Die gesamte Gegend östlich der Towerbridge nannte sich mittlerweile »Docklands«, aber nicht einmal der enorme Wiederaufbauplan des letzten Jahrzehnts hatte es vermocht, den Charakter der einzelnen Gegenden vollständig auszumerzen.
Als er zur Canary Wharf kam, sagte ihm ein Blick auf seinen Plan, daß er sich mittlerweile auf der Halbinsel »Isle of Dogs« befand, die eigentlich eine Insel war.
Er fuhr auf der West Ferry Road weiter in südlicher Richtung, folgte der Kette neuer Wohnprojekte und gähnender Baugruben, die wie Pilze zwischen Straße und Ufer aus dem Boden schossen. An vielen Bauzäunen prangte in auffälliger Graphik die Firmensignatur der legendären »Finch Ltd.«.
Gelegentlich blitzte der Fluß zwischen den Bauten hindurch, und einmal erhaschte er einen flüchtigen Blick auf einen riesigen Passagierdampfer, weiß und behäbig wie ein Eisberg. Als er den unteren Rand des hufeisenförmigen Gebietes fast erreicht hatte, bog er von der East Ferry Road nach links ab und fuhr erneut in nördlicher Richtung durch das Zentrum der Insel.
Zu seiner Linken entdeckte er eine Reihe alter, leicht erhöht gelegener Häuser aus der Vorkriegszeit; zu seiner Rechten lag eine Bauwüste. Hier mußte die Verlängerung der Docklands — Light Railway — geplant sein, von der er gelesen hatte, die unter dem Fluß hindurch nach Greenwich und weiter nach Lewisham führen sollte. Das Ausmaß von Chaos und Erdbewegungen allerdings, die das kontrovers diskutierte Projekt offenbar mit sich brachte, übertraf sein Vorstellungsvermögen.
Die Bauplanung hatte vorgesehen, zumindest die East Ferry Road passierbar zu halten, und hinter den Bauzäunen zu seiner Rechten stieg das Land steil zum Mudchute Park an. Kincaid fuhr am ersten Eingang des Parks vorbei, einem hohen, gewölbten Tunnel gegenüber dem Millwall Dock, und erreichte bald den Eingang am ASDA-Supermarkt.
Als er auf den Parkplatz einbog, sah er die Funkstreifenwagen mit blinkendem Blaulicht, die in einem Knäuel vor der Tankstelle des ASDA parkten. Gemmas verbeulter Escort stand etwas abseits, und zwei uniformierte Beamte hielten eine kleine Menge Schaulustiger zurück.
Kincaid parkte zwischen Gemmas Wagen und einem roten Vauxhall, stieg aus und ging auf eine Gruppe von Leuten zu, die am Rand des Parkplatzes stand. Die Front der Personen geriet in Bewegung, und plötzlich entdeckte er Gemmas kupferrote Haarmähne und ihre grüne Bluse, als sie sich umdrehte, um ihn zu begrüßen.
»Boß …« Gemma nickte ihm zu. »Darf ich vorstellen? Detective Inspector Janice Coppin. Sie ist die leitende Beamtin des zuständigen Reviers.«
Kincaid streckte der Frau im marineblauen Kostüm die Hand entgegen. Sie erwiderte die Geste äußerst zurückhaltend, und die Miene ihres groben Gesichts war kaum freundlicher als ihr Händedruck. Sogar ihr störrisches blondes Haar schien Mißfallen auszudrücken.
»Womit haben wir’s denn zu tun, Inspector?« fragte Kincaid leichthin, während er sich an die Andeutung seines Chefs erinnerte, der frischgebackene, weibliche Inspector sei einem Mord vermutlich nicht gewachsen. Schon aus diesem Grund konnte ihn Coppins Feindseligkeit kaum überraschen. Immerhin pfuschte Scotland Yard ihr ungefragt ins Handwerk.
»Dort droben.« DI Coppin trat zur Seite, um den Blick auf den Eingang zum Mudchute Park freizugeben, der durch das dichte Gebüsch, das den Parkplatz säumte, kaum zu sehen war. »Eine Frauenleiche. Liegt völlig frei neben dem Weg. Wir haben schon auf Sie gewartet«, fuhr sie fort. »Die Polizeiärztin ist fertig, aber wir konnten die Leiche nicht wegschaffen, solange Sie sie nicht gesehen haben.«
Kincaid hatte nicht die Absicht, sich für seine Verspätung zu entschuldigen. »Na, dann sehen wir uns die Bescherung mal an«, erwiderte er und ging in Richtung Parkeingang.
Der Müll, der die Asphaltfläche des Parkplatzes bedeckte, hatte sich bis auf das nackte Erdreich dahinter ausgebreitet und säumte den Plattenweg, der zum Eingang hinaufführte. Die Unmengen an Müll ließen den pastoralen, hölzernen Laubengang über dem Schwinggatter zum Park geradezu als Hohn erscheinen und würden natürlich erfahrungsgemäß die Arbeit der Spurensicherung sehr erschweren.
Es war nur ein sanfter Anstieg zu den bewaldeten Hängen des Parks, doch als Kincaid das Schwinggatter passiert hatte, stand ihm bereits der Schweiß auf der Stirn. Von ihm gabelte sich der Weg, dessen Oberfläche auch nach den Regenfällen der vergangenen Wochen noch so hart war, daß seine Gummistiefel keinen Abdruck hinterließen. Die rechte Abzweigung stieg leicht zu einer Heckenanpflanzung und zu den weiten Parkwiesen dahinter an, während sich der Pfad zu seiner Linken einen steilen Abhang entlangschlängelte. Ungefähr in zehn Meter Entfernung entdeckte Kincaid auf dem Weg eine Ansammlung von Leuten der Spurensicherung in weißen Kitteln.
Kincaid zog einen Overall über und ging auf die Gruppe zu. Aus alter Gewohnheit verschränkte er die Hände auf dem Rücken, während er dem blau-weißen Band folgte, das den Tatort absperrte, denn auf diese Weise war die Versuchung geringer, unüberlegt etwas zu berühren.
Die Leute von der Spurensicherung traten beiseite, um ihn durchzulassen, und dann sah er sie, halb im Schatten der Hecke liegend.
»Sie war eine Schönheit, muß man sagen«, erklärte Willy Tucker, der Fotograf, der neben ihn getreten war.
Sie lag auf dem Rücken zwischen Wegrand und Hecke, die den Parkweg gegen das höher gelegene Gelände abschirmte. Sein erster flüchtiger Eindruck war, daß ihre Kleidung sorgfältig arrangiert worden war.
Der kurze Rock war auffällig glatt über ihre Oberschenkel gezogen. Das lange, schwarze Leinenjackett war züchtig hochgeschlossen bis zum letzten Zinnknopf. Nur ein cremefarbener BH-Träger aus Satin war dort sichtbar, wo ihr die Jacke leicht in Richtung Schulter verrutscht war. Eine Bluse trug sie offenbar nicht.
Mit einem Blick auf Tucker sagte Kincaid: »Ihre Strumpfhose … war nicht verrutscht oder ausgezogen?«
»Nicht, soviel wir sehen konnten … ohne sie zu bewegen.«
Die Strümpfe waren dünn, nur ein Hauch von Schwarz über ihrer weißen Haut, und hatten Laufmaschen an beiden Beinen. Ein Fuß war nackt, der andere steckte in einem schwarzen Schuh mit breitem, hohem Absatz.
Kincaid ging in die Hocke, ohne sich der Toten weiter zu nähern, und betrachtete ihr Gesicht. Es war ein perfektes Oval, die Haut selbst im grellen Licht faltenlos glatt. Die Nase gerade, die Lippen gut geformt. Als der Schatten weiterwanderte, entzündete die Sonne Funken auf der üppigen Mähne ihres rotgoldenen Haars. Sie sah so lebendig aus, daß — wären die Starre der Züge und die Fliegen nicht gewesen — man hätte annehmen können, sie habe sich hier nur zum Schlafen niedergelegt.
Ein erdiger, würziger Duft stieg von der zertrampelten Vegetation zu seinen Füßen auf, der ihn unwillkürlich an Liebende denken ließ, die sich auf einem schattigen Plätzchen am Hang umfangen hielten. »Hat man den zweiten Schuh gefunden?« wollte er wissen.
Der Fotograf schüttelte den Kopf. »Noch nicht. Die Uniformierten haben eine gründliche Suche gestartet.«
Festlich gekleidet, aber jeder Möglichkeit beraubt, je wieder eine Veranstaltung zu besuchen, schoß es Kincaid durch den Kopf, während er auf ihren leblosen Körper starrte. Er widerstand der Versuchung, die seidige Haarsträhne zurückzustreichen, die sich an ihrer Wange verfangen hatte. »Vielleicht hat sie ihn auf einem Fest beim Tanzen verloren.«
Gemma beobachtete Kincaid, der den Weg zurück entlang der Absperrung kletterte, das Gesicht ausdruckslos wie immer unter diesen Umständen. »Die Tat eines Psychopathen? Oder was meinst du?« fragte sie, als er sie erreicht hatte. Man sagte nicht »Serienkiller«, nicht, wenn auch nur annähernd die Möglichkeit bestand, daß die Presse lange Ohren machte. Trotzdem war es immer der erste Verdacht, wenn eine junge Frau auf diese Weise ermordet wurde.
Mit einem Blick zurück auf die Leute von der Spurensicherung, die wie seltsame weiße Insekten um die Leiche herumkrochen, schüttelte Kincaid den Kopf. »Ich glaube, der Mörder hat sie gekannt. Sieht so aus, als habe jemand ihre Kleidung züchtig arrangiert. Falls sie vergewaltigt worden sein sollte, läßt sich das auf den ersten Blick nicht erkennen. Nach der Obduktion wissen wir mehr.«
»Ich bestelle jetzt den Leichenwagen«, sagte DI Coppin. »Ihr Einverständnis vorausgesetzt, Sir«, fügte sie unverhohlen feindselig hinzu.
Kincaid zog leicht die Augenbrauen hoch, ließ sich jedoch auch diesmal nicht provozieren. »Nur zu, Inspector. Je schneller, desto besser … bei dieser Hitze. Ein Glück, daß die Temperaturen vergangene Nacht gesunken sind.«
Coppin kletterte ungeschickt den Hang hinunter. Ihr enger Kostümrock behinderte sie ganz offensichtlich. Gemma beobachtete sie, bis sie durch das Schwinggatter entschwunden war, und wandte sich dann an Kincaid. »Hör mal …«
Bevor sie fortfahren konnte, zog Kincaid sie in den Schatten, weit weg von den Kollegen der uniformierten Truppe. »Ist verdammt viel zu heiß, um in der Sonne rumzustehen«, sagte er, nahm ein Taschentuch aus der Tasche und trocknete sich die Stirn.
Ein geschwungener Lattenzaun trennte die Rasenfläche neben dem Weg von der abschüssigen Böschung, die den Park umgab. Er lenkte Gemmas Blick zum Parkeingang. Das laubenartige Dach über dem Holzgatter erinnerte an einen japanischen Schrein, was die in der Sonne schimmernden Gebäude der Canary Wharf jenseits der dichten Baumkulisse wie Fremdkörper in einer Idylle erscheinen ließ.
Der tröstlich vertraute Geruch von gebratenem Speck und Eiern stieg vom Café des ASDA-Supermarkts mit einer sich rasch verflüchtigenden Brise zu ihnen auf, und Gemmas Magen knurrte laut. Vor der ersten Klavierstunde war sie zu nervös gewesen, um zu essen, und sie hatte vorgehabt, sich später ein ausführliches Frühstück zu gönnen. Dabei hätte sie es besser wissen müssen. Ihr Handy hatte geklingelt, noch bevor Wendy Sheinart und sie ihre halbstündige Unterhaltung beendet hatten.
»Um noch mal auf Inspector Coppin zurückzukommen«, sagte sie und warf einen Blick zu den Uniformierten hinüber, um sich zu vergewissern, daß sie außer Hörweite waren. »Ihr Chief Inspector ist das ganze Wochenende bei der Hochzeit seines Sohnes. Offenbar hat er uns eingeschaltet, ohne sie zu informieren. Sie meint natürlich, daß es eigentlich ihr Fall hätte sein müssen. Und wer will ihr das übelnehmen? Vielleicht kannst du ihr gegenüber etwas nachsichtiger …«
»Warum soll’s ihr bessergehen als anderen?« entgegnete Kincaid, grinste und wurde schlagartig ernst: »Ist eine harte Erfahrung für sie, aber wenn sie eine gute Kriminalbeamtin werden will, muß sie lernen, damit umzugehen.«
Gemma konnte das nur unterstreichen. Ihr war es nicht anders ergangen. Trotzdem hatte sie Mitleid. »Und wenn schon, ich möchte nicht in ihren Schuhen stecken.«
»Wenn du mich fragst, drücken die tierisch«, bemerkte Kincaid leise, denn Janice Coppin hatte ihren Funkspruch beendet und begann vom Eingang aus zu ihnen heraufzusteigen.
Als DI Coppin sie schließlich erreichte, mußte sie mehrfach tief Luft holen, bevor sie ein Wort herausbrachte: »Sie sind unterwegs. Was jetzt, Sir?«
»Erzählen Sie mir, was die Polizeiärztin bisher festgestellt hat.« Kincaid zückte sein kleines Notizbuch.
Janice Coppin konsultierte ihre Notizen. »Sie meint, daß das Opfer im Lauf des Abends oder in den frühen Morgenstunden gestorben ist … viel länger kann sie bei diesen hohen Temperaturen nicht tot sein, anderenfalls hätte die Verwesung bereits eingesetzt. Äußere Zeichen von Vergewaltigung waren nicht festzustellen. Allerdings hat sie einen Bluterguß im Halsbereich.«
»Irgendwelche Papiere und so weiter?«
»Nein, Sir. Wir haben weder ihre Handtasche noch Reinigungsetiketten in ihrer Kleidung gefunden.«
»Wer hat die Leiche entdeckt?«
»Ein Rentner, Sir. George Brent. Lebt in der Siedlung unten am Park. Er war mit seinem Hund unterwegs, als er sie am Gebüsch entdeckt hat. Trotzdem wundert es mich, daß nicht schon früher jemand über sie gestolpert ist … sie lag schließlich wie auf dem Präsentierteller.«
»Hat man diesen Brent schon vernommen?«
Coppin runzelte die Stirn. »Nein, das halte ich für zwecklos. Ich kenne ihn … ein harmloser, alter Mann. Unwahrscheinlich, daß ihm überhaupt was Wichtiges aufgefallen ist.«
Nach kurzem Schweigen sagte Kincaid ruhig: »Inspector, in diesem Stadium der Ermittlungen wissen wir überhaupt nicht, was relevant sein könnte. Insofern ist alles und nichts wichtig. Ich knöpfe mir Mr. Brent persönlich vor.«
»Aber …«
»Inzwischen sollten wir umgehend mit den Befragungen der Anwohner beginnen und die mobile Einsatzzentrale aufbauen. Die Identifizierung der Leiche hat absolute Priorität. Und wir sollten die Medien vor unseren Karren spannen.«
Ein zerfetztes Stück Plastik wehte trudelnd über jenen Teil des Supermarkt-Parkplatzes, der durch die Bäume hindurch sichtbar war. Teresa Robbins stand auf ihrem Balkon und dachte an einen Film über das Igelgras in der amerikanischen Wüste, den sie gesehen hatte. Die riesigen Graskugeln waren in ähnlich wilden Wirbeln vom Wind verblasen worden, beinahe so, als hätten sie ein Eigenleben entwickelt. Die Bewegung dieses Stücks Abfall machte sie ebenso nervös wie der heiße Wind, der sie verursachte.
Trotzdem blieb sie gegen die Eisenbalustrade gelehnt und versuchte, durch die Bäume hindurchzusehen. Der erste Polizeiwagen war am frühen Vormittag eingetroffen, während sie Wäsche auf ihrer Hälfte des schmalen Betonbalkons aufgehängt hatte. Jetzt stand hinter der Tankstelle in einem vagen Halbkreis eine ganze Ansammlung von Autos. Nicht zu wissen, was los war, beunruhigte sie. Trotzdem konnte sie sich nicht dazu überwinden, sich zu den Schaulustigen auf dem Parkplatz zu gesellen.
Ein lautes Plumpsen von nebenan warnte sie, daß ihr Nachbar aufgestanden und ihre beschauliche Zeit auf dem Balkon damit begrenzt war. Teresa schätzte ihre ruhigen Morgenstunden auf dem Balkon, besonders an Samstagen, wenn sie Zeit hatte, ihre Geranien und Petunien zu pflegen. Die Abende gehörten ihm. Dann frönte er seiner Vorliebe für Heavy-Metal-Musik und Bier im Sechserpack und heizte ihren stillen Grabenkampf an, indem er Zigarettenkippen in ihre Blumentöpfe warf, die sie dann am darauffolgenden Morgen aufsammeln mußte. Sie wußte, daß sie ihm hätte die Meinung sagen müssen, aber es war ihr von jeher schwergefallen, sich anderen Menschen gegenüber zu behaupten. Im Gegensatz zu Annabelle.
Auch wenn sie sich in diesem Punkt in den fünf Jahren, die sie jetzt für Annabelle Hammond arbeitete, schon sehr gebessert hatte. Annabelle war einfach nie auf die Idee gekommen, sie könne nicht bekommen, was sie haben wollte; ob beruflich oder privat spielte dabei keine Rolle. Und Teresa hatte oft stumm und interessiert beobachtet, wie ihre Chef in in eine Besprechung mit ahnungslosen Managern gerauscht war, die nicht einsehen wollten, warum sie eine Frau ernst nehmen sollten. Bevor sie jedoch angesichts von Annabelles Schönheit aus ihrer Verzauberung aufgewacht waren, hatte diese ihre Unterschriften unter die relevanten Papiere bereits in der Tasche.
Obwohl Teresa wußte, daß sie Annabelle in diesem Punkt nie würde das Wasser reichen können, hatte sie sich ihrem Job als Buchhalterin der Firma mit einem Eifer und einer Tüchtigkeit gewidmet, die ihr ihre Kameraden von der Gesamtschule Croyden nie zugetraut hätten … dort war sie eine so unauffällige Schülerin gewesen, daß einer der Lehrer von ihr einmal gesagt hatte, sie sei »das Mädchen, das man immer übersieht« .
Nach etlichen Buchhalterstellen, die sie in keiner Weise gefordert hatten, hatte sie bei Hammond ohne große Erwartungen angefangen. Zu ihrer eigenen Überraschung hatte sie die Branche fasziniert, und sie hatte alles wie ein Schwamm in sich aufgesogen, bei sich ein Organisationstalent und einen Sinn für Zahlen entdeckt, von dem sie nichts geahnt hatte. Sie hatte erfahren, daß sie ein blendendes Erinnerungsvermögen besaß, und eine Leidenschaft für Tee entwickelt, der an Annabelles Besessenheit heranreichte. Vor einem Jahr dann hatte Annabelle sie zu ihrer Finanzchefin gemacht.
Sie waren ein gutes Team und hatten die Traditionsfirma Hammond’s Fine Teas zu einem modernen Unternehmen gemacht. Erst in den vergangenen Monaten, als Annabelle begonnen hatte, die Zukunft der Firma zu planen, hatte Teresa sie zum ersten Mal zaudernd und zweifelnd erlebt.