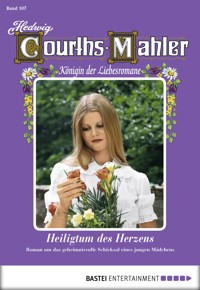9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wer sehnt sich nicht nach Liebe und Glück? Hedwig Courths-Mahler wusste um diese Sehnsucht ihrer Leserinnen und bediente sie: Mit 208 Romanen und einem großen Fankreis ist sie eine der erfolgreichsten Autorinnen, die Deutschland je gesehen hat. Diese liebevoll gestaltete Jubiläumsausgabe vereint nun pünktlich zu ihrem 150. Geburtstag die Romane Des Schicksals Wellen, Nach dunklen Schatten das Glück und Das ist der Liebe Zaubermacht - drei Geschichten, drei Schicksale, drei Happy Ends. Pures Leseglück!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 812
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Inhalt
Über dieses Buch
Wer sehnt sich nicht nach Liebe und Glück? Hedwig Courths-Mahler wusste um diese Sehnsucht ihrer Leserinnen und bediente sie: Mit 208 Romanen und einem großen Fankreis ist sie eine der erfolgreichsten Autorinnen, die Deutschland je gesehen hat. Diese liebevoll gestaltete Jubiläumsausgabe vereint nun pünktlich zu ihrem 150. Geburtstag die Romane Des Schicksals Wellen und Nach dunklen Schatten das Glück – zwei Geschichten, zwei Schicksale, zwei Happy Ends. Pures Leseglück!
Des Schicksals Wellen
Eines geheimnisvollen Gelübdes wegen verlangt Georg Roland von seiner Tochter Waltraut, dass sie ihren Pflegebruder Rudolf heiratet. Der Wunsch ihres Vaters verstört Waltraut zunächst, letztlich willigt sie aber in diese Verlobung ein. Auf einer Reise nach Ceylon begegnet sie jedoch Jan Werkmeester. Waltraut wehrt sich anfangs gegen die in ihr aufkeimenden Gefühle für ihn – schließlich ist sie bereits einem anderen Mann versprochen. Aber die Liebe ist stärker und fordert ihr Recht. Werden die jungen Liebenden ihr Glück finden?
Nach dunklen Schatten das Glück
Sein Töchterchen Conny ist das Einzige, was Frank Markwald aus einer unglücklichen Ehe geblieben ist. Um neuen Lebensmut zu schöpfen, reist er mit ihr in die Schweiz. Dort lernt er die Geschwister Freda und Blandine Nordmann kennen. Freda, die selbst eine große Enttäuschung hinter sich hat, fühlt sich zu Frank hingezogen, aber dieser scheint von einer unüberwindbaren Mauer umgeben. Bis eines Tages Conny ein schweres Unglück zustößt und ihr Leben auf Messers Schneide steht. Freda steht Frank in den schwersten Stunden seines Lebens bei – doch reicht das aus für eine gemeinsame Zukunft?
Über die Autorin
Die Lebensgeschichte der Hedwig Courths-Mahler könnte aus einem ihrer Romane stammen: ein wahrgewordenes Märchen, die Geschichte vom Aschenputtel, das zwar nicht den Prinzen heiratet, aber aus eigener Kraft Königin wird. Am 18. Februar 1867 als Ernestine Friederike Elisabeth Mahler in Nebra a. d. Unstrut unehelich geboren, wuchs Hedwig – wie sie sich selbst als Kind nannte – bei verschiedenen Pflegeeltern auf. Zunächst arbeitete sie in Leipzig als Verkäuferin und schrieb mit siebzehn ihren ersten Roman. Zwischen 1905 und 1939 entstanden die Courths-Mahlerschen Liebesromane und machten ihre Verfasserin – inzwischen verheiratet und Mutter zweier Töchter – zur auflagenstärksten Autorin. In den Schoß fiel der energischen jungen Frau, die zunächst schrieb, um ihre Familie zu ernähren – ihr Mann Fritz Courths war lange Zeit arbeitslos –, der Erfolg allerdings nicht. Sie arbeitete hart, saß bis zu vierzehn Stunden am Schreibtisch und verfaßte sechs bis acht Romane im Jahr.1939 hörte sie auf zu schreiben. Die Nationalsozialisten verweigerten ihrem Verlag das Papier. Schließlich ließ das Leid um ihre Tochter Friede Birkner, die in Gestapohaft kam, die beliebte Schriftstellerin endgültig verstummen. Am 26. November 1950 ist Hedwig Courths-Mahler auf ihrem Bauernhof am Tegernsee gestorben. Die Renaissance ihrer Romane hat sie noch miterlebt.
Hedwig Courths-Mahler
Am Ende steht die Liebe
Des Schicksals WellenNach dunklen Schatten das Glück
Mit einem Nachwort vonProf. Dr. habil. Gunnar Müller-Waldeck
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige eBook-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Abdruck des Essays »Die ›große Realistin‹. Hedwig Courths-Mahler oder Die Wahrheit der Märchen« von Gunnar Müller-Waldeck (zuerst erschienen in: ndl 49 (2001), S. 140–155) mit freundlicher Genehmigung des Autors.
Copyright © 2017 by Bastei Lübbe AG, Köln
Umschlaggestaltung: Sandra Taufer, München
Unter Verwendung von Motiven von © shutterstock: Ola-la |
Knopazyzy | Lekovic Maja | ryabinina
eBook-Produktion: Dörlemann Satz, Lemförde
ISBN 978-3-7325-3998-7
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Du weißt es
Du fühlst es, wie ich glühend für dich brenne
Und wie mein ganzes Ich dein Eigen ist
Du weißt es, dass ich meinen Gott dich nenne
Und dass du meiner Seele Höchstes bist.
Du weißt es, dass ein Blick aus deinen Augen
Mich willenlos zu deinen Füßen zwingt
Dass, wenn sie in die meinen untertauchen,
Ein atemloses Glück mich heiß durchdringt.
So reich bin ich, wie kann ich ganz verarmen
Ich tausche keine andre Seligkeit
Für eine Stunde ein, in deinen Armen
Und für ein »Deingedenken« alle Zeit.
14. August 1901
Des Schicksals Wellen
1
Die beiden Besitzer der großen Plantage Larina standen auf der Veranda ihres großen Bungalows. Es waren Vater und Sohn, beides hochgewachsene Männer mit gebräunten Gesichtern. Sie trugen kurze Beinkleider und leichte Jacken aus getöntem Leinen. Es waren zwei prachtvolle Erscheinungen.
»Also, ich fahre jetzt hinunter, Vater. Die Elefanten müssen in den Fluss, und ich will selber mit in die Schwemme reiten.«
»Tue das, Jan. Du kannst überall selber noch einmal nach dem Rechten sehen unten auf den Plantagen. Morgen hast du dann mit deinen letzten Reisevorbereitungen zu tun – und übermorgen fährst du nach Kandy.«
»Ja, Vater, ich habe dann gerade noch Zeit, mit der Bahn von Kandy nach Colombo zu fahren und rechtzeitig an Bord meines Dampfers zu gelangen. Dann geht es nach Europa.«
Der Vater legte seine Hand auf die Schulter des Sohnes.
»Du freust dich auf die Reise, Jan?«
Dieser sah etwas bekümmert in das seltsam düstere Gesicht des Vaters, in dem tiefe Falten von einem schweren Schicksal sprachen.
»Ich weiß nicht, Vater, ob ich mich freuen soll. Wenn ich dich nicht allein zurücklassen müsste, würde ich mich bestimmt freuen, aber so reise ich eben nur, um den notwendigen Klimawechsel vornehmen zu können.«
»Du vergisst die Hauptsache, Jan, du hast mir doch versprochen, dich drüben nach einer Frau umzusehen.«
Jan sah gedankenverloren ins Weite.
»Eine Frau? Ach ja, Vater, ich möchte mich sehr gern verheiraten, es ist ein unausgefeiltes Leben hier, wenn man jung ist und keine Frau hat. Ich sehe es doch drüben bei meinem Freund Schlüter, wie schön es ist, eine junge Frau zu haben. Aber ob ich die rechte finden werde? Es ist nicht so leicht, eine weiße Frau hierher zu verpflanzen. Jede geht nicht mit mir – und jede mag ich auch nicht.«
»Du musst suchen, Jan – sieh, dass du eine Deutsche findest.« Jan sah den Vater fragend an.
»Warum gerade eine Deutsche, Vater? Mutter war eine Holländerin, wie du ein Holländer bist – also warum soll ich mir nicht auch lieber eine Holländerin nehmen?«
Das Gesicht des alten Herrn überflog ein Schatten.
»Nun gut – es kann auch eine Holländerin sein, Jan.«
Dieser sah seinen Vater forschend an.
»Es ist seltsam, Vater, dass du für alles, was deutsch ist, so eine große Vorliebe hast – aber noch viel seltsamer ist es, dass ich diese Vorliebe teile.«
In die Stirn des alten Herrn stieg eine leichte Röte, und er wandte sich ab, damit Jan nicht in sein Gesicht sehen konnte.
»Das ist doch gar nicht so seltsam, Jan. Ich bin drüben auf Sumatra schon mit Deutschen viel zusammen gewesen, deine Mutter ist in einer deutschen Pension erzogen worden, und – deine Freunde drüben auf Saorda sind auch Deutsche. Und sie sind dir lieb und haben dich für ihre Heimat gewonnen.«
Jan nickte lachend.
»Ja, Vater, so sehr, dass ich den größten Teil meiner Ferien in Deutschland, im bayrischen Hochgebirge verbringen will. Harry Schlüter sagte mir, dass ich in Tirol und den bayrischen Bergen genug Eis und Schnee finden werde. Danach gelüstet es mich. Es wird Zeit, dass ich mir einmal wieder einen Schneesturm um die Nase wehen lassen kann.«
Und Jan breitete die Arme aus und merkte nicht, wie es düster in den Augen seines Vaters aufflammte.
»Also in die Berge willst du gehen?«, fragte er heiser.
Jans Augen leuchteten.
»Darauf freue ich mich am meisten. Und deshalb werde ich mich auch in Holland nur kurze Zeit aufhalten – da gibt es keine Berge, Vater.«
»Nein, da gibt es keine Berge.«
»Es tut mir nur so leid, Vater, dass ich dich allein zurücklassen muss, du bist gerade in letzter Zeit wieder so schwermütig und bedrückt gewesen.«
»Darauf brauchst du nicht zu achten, Jan, das hat nichts auf sich.«
»Ich weiß aber, dass du dich sehr einsam fühlen wirst, wenn ich fort bin.«
Der alte Herr zwang sich zu einem Lächeln.
»Das musst du doch auch durchhalten, wenn ich einen Klimawechsel vornehme und dich allein lasse. Zusammen können wir nun mal nicht fort.«
»Für mich ist es auch nicht so schwer, allein zu bleiben, Vater, ich habe Schlüters zur Gesellschaft. Aber du kommst ja nicht heraus aus dem Haus, kommst selten einmal mit Harry zusammen, wenn ihr euch gerade trefft, und bist sonst nur auf die Eingeborenen angewiesen.«
»Mache dir keine Sorge um mich, Jan, die Zeit wird mir schnell genug vergehen, denn gottlob gibt es Arbeit in Hülle und Fülle. Ein halbes Jahr ist schnell herum.«
»Aber ich befürchte, dass ich dich düsterer und schwermütiger als bisher wiederfinden werde.«
Der Vater legte den Arm um seine Schulter.
»Bist du dann wieder da, Jan, dann ist es doppelt schön. Und – wenn du eine junge Frau mitbringst –«
Jan lachte.
»Rechne nur nicht so bestimmt damit, sonst bist du enttäuscht, wenn ich allein wiederkomme.«
»Wir wollen es dem Schicksal überlassen, Jan.«
»Das wollen wir, Vater. Und nun muss ich hinunter – die Treiber warten auf mich, da sie die Elefanten nicht eher ins Wasser lassen wollen, bis ich komme.«
»Sei vorsichtig, die Tiere sind übermütig, wenn sie ins Wasser kommen.«
Jan lachte.
»Ich reite meinen Jumbo, du weißt, er hält die andern vor zu großen Torheiten zurück.«
Die beiden Herren drückten sich die Hand, und Jan sprang mit zwei Sätzen die Verandastufen hinab, setzte sich an das Steuer seines bereitstehenden Autos und fuhr die scharfen Kurven des Berges hinab ins Tal, zu dem Fluss hinüber.
Dort warteten seine Leute mit etwa zwanzig Elefanten, die von den Plantagen herübergetrieben worden waren, um zu baden.
Jan sprang aus seinem Wagen, warf rasch den Tropenhut, die leichte Jacke und die Stiefel hinein und zog das Hemd über den Kopf, sodass er nur mit den kurzen Beinkleidern bekleidet war. Lachend trat er dann an den größten Elefanten heran.
»Nun, Meister Jumbo, du freust dich wohl schon auf das Bad. Es kann losgehen!«
Jumbo, der große Elefant, wackelte ein wenig mit seinen Schlappohren, sah sich nach seinem Herren um, kniff das eine Auge zu und streckte seinen Rüssel einladend aus. Jan schwang sich elastisch auf den Rüssel, und Jumbo hob ihn mit einem eleganten Schwung empor auf seinen Rücken. Die Treiber folgten Jans Beispiel, sodass auf einer Anzahl der größten Elefanten je ein Treiber saß. Die kleineren liefen ohne Führer nebenher.
Jan ritt nun voraus, und Jumbo watete in den Fluss, stieß einen Trompetenton aus, der den andern Tieren anscheinend als Kommando galt, und sah sich sorglich um, ob die andern auch in den Fluss hineinwateten.
Das gab nun ein lustiges Bad. Die grauen, breiten Elefantenrücken sahen noch eine Weile trocken aus dem Fluss heraus, aber dann tauchte Jumbo unter, und die andern folgten seinem Beispiel. Es war für die Treiber nicht immer eine leichte Arbeit, ihren Sitz auf dem Rücken der übermütigen Tiere, die sich anscheinend im Wasser sehr wohl fühlten, zu behaupten. Sie wurden verschiedene Male gründlich getaucht, aber es ging alles ganz harmlos ab.
Jan redete mit Jumbo, als sei er ein verständiger alter Herr. Immer gab Jumbo an, was die andern ihm nachmachen sollten. Es war ein seltsamer Anblick, als all diese massigen Tierrücken nebeneinander den Fluss hinabschwammen.
So kamen sie fast bis zur Brücke, die über den Fluss führte, als am gegenseitigen Ufer ein Auto aus dem Walde herauskam. Das Auto stoppte, als der am Steuer sitzende Herr die Elefanten sah. Er erhob sich und sprang aus dem Wagen.
»Hallo, Jan!«
»Hallo, Harry!«
»Ist gut, dass ich heute nicht auch meine Elefanten in den Fluss trieb, sonst wäre er übergelaufen«, scherzte Harry Schlüter, der Herr von Saorda, Jans Freund.
»Musst ja deine Tiere nicht gerade baden lassen, wenn wir Badezeit haben, Harry. Was hast du vor?«
»Ich fahre heim. Kannst du nicht mitkommen? Dora könnte eine kleine Aufmunterung brauchen, sie ist wieder ein wenig heimwehkrank, seit deine Reise nach Europa feststeht.«
»Wenn du warten willst, bis ich die Tiere heraushabe, komme ich mit, ich wollte heute ohnedies meinen Abschiedsbesuch bei Frau Dora machen.«
»Abschiedsbesuch? O weh, da wird es wieder Tränen geben bei meiner Frau. Ist es denn schon so weit?«
»Ja, übermorgen reise ich ab, und morgen möchte ich dann Vater nicht allein lassen. Also warte ein paar Minuten, wir treiben gleich aus dem Fluss.«
Und Jan trieb Jumbo an das Ufer zurück. Sehr erbaut war dieser anscheinend nicht, aber Jan redete ihm gut zu.
»Jumbo, du willst doch nicht ein schlechtes Beispiel geben? Raus aus dem Wasser!«
Jumbo kniff das Auge zu, stieß wieder einen Trompetenton aus, um seine Artgenossen zu veranlassen, ihm zu folgen. Die schweren Tierleiber wälzten sich an das Ufer. Jumbo stieg als Erster aus dem Wasser, und die andern folgten. Während Jan die Landung der Tiere überwachte, zog er die nassen Sachen aus, schüttelte das Wasser von sich und streifte sie wieder über. In wenigen Minuten war er fertig.
Die Tiere wurden von den Treibern zu den Plantagen zurückgetrieben, und Jan sprang an das Steuer seines Wagens. Schnell ging es über die Brücke zu dem andern Ufer. Da hielt er seinen Wagen neben dem Harry Schlüters an.
Die Freunde reichten sich die Hände, und dann fuhren sie hintereinander nach Saorda, der Schlüter’schen Besitzung. Das Wohnhaus Harry Schlüters lag auch oben auf einem Berge, weil oben die Luft besser war. Im scharfen Tempo nahmen sie die Kurven aufwärts und hielten bald vor dem Schlüter’schen Bungalow. Auf der Veranda saß eine schlanke, junge Frau. Sie sprang auf und warf die Näherei in weitem Bogen von sich. Eiligst kam sie die Treppe herunter und flog in ihres Mannes Arme.
Dann begrüßte sie auch Jan.
»Famos, dass Sie mitkommen, Jan, ich brauche sehr nötig Ihre gute Laune. Ich habe einen Brief von meiner Freundin Waltraut bekommen, mit einer Absage. Sie bekommt von ihrem Vater keinen Urlaub, mich zu besuchen.«
Jan schüttelte ihr die Hand.
»Frau Dora, das wäre doch auch wider die Abrede gewesen, wenn Ihre Freundin nach Saorda kommen würde, wenn ich in Europa bin.«
»Ich kann mir die Zeit leider nicht aussuchen, Jan, Sie müssen bedenken, dass Waltraut bei ihrem Vater einmal eine günstige Stimmung abpassen muss, in der sie ihm die Erlaubnis zu dieser Reise abschmeicheln kann. Sie möchte ja sehr gern kommen, aber der Vater will sie nicht fortlassen. Also muss ich weiter warten. Und nun reisen auch Sie bald fort, und dann bringen Sie sich sicher eine Frau mit heim.«
»Setzen Sie mir nicht auch noch zu, Frau Dora, mein Vater hat mir den Kopf schon warm genug geredet. Ich will ja auch ganz gern heiraten, aber so eine Frau müsste ich finden, wie Ihre Freundin ist. Zeigen Sie mir doch noch einmal ihr Bild, Frau Dora.«
Dora brachte das Bild ihrer Freundin herbei. Jan sah lange in das reizende Mädchengesicht, dann atmete er tief auf.
»Also wie gesagt, zeigen Sie mir eine Frau wie diese, und ich heirate sie auf der Stelle«, scherzte er.
Frau Dora lachte.
»Das haben Sie mir schon wiederholt gesagt, Jan, aber wer weiß, ob Sie sich diesmal nicht schon eine Frau mitbringen werden. Wenn Waltraut dann endlich kommen wird, sind Sie längst glücklicher Ehemann.«
Jan sah wieder lange in das Gesicht Waltrauts und sagte dann, das Bild Frau Dora zurückreichend:
»Wer weiß, Frau Dora. Ich bin allerdings des eintönigen Lebens müde. Warum soll es Harry allein so gut haben, eine schöne junge Frau sein Eigen nennen zu können.«
Frau Dora lachte.
»Sie üben sich wohl schon in Komplimenten, Jan. Wann reisen Sie denn nun?«
»Ich komme, um Abschied zu nehmen, Frau Dora. Übermorgen geht es fort.«
Dora Schlüter schluckte verstohlen ein paar Tränen hinunter, damit ihr Mann nicht merkte, wie sie das Heimweh packte. Sie wollte ihn doch nicht betrüben.
»Also, so bald schon?«
»Ja. Und ich wollte Sie und Harry herzlich bitten, sich mal nach meinem Vater umzusehen. Ich bin in großer Sorge um ihn. Er wird, wenn ich fort bin, noch viel düsterer und schwermütiger werden.«
»Ich suche ihn zuweilen auf, Jan. Aber seine Schwermut werde ich kaum heilen können.«
»Die ist nicht mehr zu heilen, Harry. Seit ich meinen Vater kenne, ist er nicht anders gewesen. Irgendetwas Schweres lastet auf ihm, etwas, das in der Vergangenheit liegt. Er spricht sich nie aus darüber, und deshalb kann ich ihm nicht helfen. Ich bitte dich nur, zuweilen nach ihm zu sehen, damit er sich nicht gar zu einsam fühlt.«
»Das ist selbstverständlich.«
Inzwischen hatte Frau Dora eine Erfrischung bestellt, eine der Dienerinnen brachte sie heraus. Die drei Menschen saßen beisammen auf der Terrasse und hatten einander noch viel zu sagen. Dann wurde Abschied genommen, er tat allen weh. In der weltabgeschiedenen Einsamkeit, in der sie hier im fremden Lande lebten, war es schwer, einen zu entbehren.
Frau Dora weinte, und auch den Männern wurden die Augen feucht. Dann raffte sich Jan auf.
»Hallo, Frau Dora, jetzt zum Abschied noch einmal klare Augen und ein frohes Lachen. Sechs Monate sind bald vorbei, dann sehen wir uns wieder. Harry, führe deine Frau einige Male nach Kandy, damit sie das Tanzen und das Lachen nicht verlernt.«
Dora erzwang ein Lachen, die Hände wurden noch einmal geschüttelt, dann sprang Jan in seinen Wagen und fuhr davon. Dora warf sich in die Arme ihres Mannes, die sie fest und liebevoll umfingen.
Jan fuhr auf seine Plantage und sah überall nach dem Rechten. Dann kehrte er nach Hause zurück.
Am übernächsten Tage reiste er ab. Sein Vater sah ihm mit umflorten Augen nach. Ein brennendes Weh malte sich in seinem Gesicht. Würde er seinen Sohn noch einmal wiedersehn – seinen einzigen – den einzigen, den ihm das Schicksal gelassen?
Langsam, mit schweren Schritten ging er ins Haus zurück, warf sich in einen Sessel und stützte die Arme auf den Tisch. Und seine Gedanken flogen in die Vergangenheit zurück – und suchten da draußen in der Welt –, was ihm teuer war – was er verloren hatte.
»Hast du einen Moment Zeit für mich, lieber Vater?«
»Einen Moment? Der ist schon vorbei.«
»Also fünf Minuten!«
»Gut, die bewillige ich dir. Was hast du auf dem Herzen, Waltraut?«
»Ich habe wieder einen Brief von Dora Schlüter. Sie bittet mich dringend, sie auf längere Zeit zu besuchen. Willst du mir wirklich nicht erlauben, es zu tun?«
»Aber Kind, darüber haben wir doch schon oft debattiert.«
»Ja, Vater, und leider hast du mir nie eine Zusage gegeben.«
»Könntest du es wirklich ernsthaft in Erwägung ziehen, mich so lange zu verlassen?«
»Ach, lieber Vater, du wirst mich – leider – kaum vermissen. Du bist von deinen Geschäften immer so stark in Anspruch genommen oder bist im Klub. Und wenn du doch einmal daheim bist, dann sprichst du meist mit Rudolf über Geschäfte oder über Dinge, die ich nicht verstehe. Ihr beiden vergesst dann ganz, dass ich auch auf der Welt bin. Und deshalb wird es euch kaum zu Bewusstsein kommen, wenn ich einmal fort bin.«
Georg Roland sah etwas unsicher zu seiner Tochter auf, die, rank und schlank in ihrem eleganten Kostüm vor ihm stehend, einen sehr erfreulichen Anblick darbot. Es zuckte leise in seinem Gesicht, wie ein vorüberhuschender Schmerz, aber dann wurde sein Blick wieder ganz ruhig. Er fasste ihre Hand und zog sie näher zu sich heran an den Schreibtisch, an dem er saß.
»Waltraut, für wen arbeite ich denn, wenn ich mich in Geschäfte vergrabe?«
Diese Worte klangen weicher, als er sonst zu sprechen pflegte. Das rührte an Waltrauts Herz. Sie legte den Arm um seinen Hals und strich ihm mit der andern Hand zärtlich über die Stirn.
»Ich weiß, Vater, du tust es für mich. Aber was hilft es mir, wenn du immer mehr Reichtümer für mich sammelst und mich doch darben lässt an deiner Liebe, an deiner Gesellschaft? Ich möchte lieber ärmer sein, wenn ich nur nicht immer so einsam zu sein brauchte.«
Er lehnte sich einen Moment mit geschlossenen Augen in ihren Arm zurück und empfand das wie eine Wohltat. Aber dann riss er sich gleich wieder zusammen.
»Das wird alles anders werden, Waltraut.«
»Willst du dich endlich vom Geschäft zurückziehen und dir mehr Ruhe gönnen? Soll ich etwas von meinem Vater haben? Dann verzichte ich natürlich auf die Reise zu Dora.«
Er schüttelte den Kopf.
»Aber Kind, mit kaum fünfundsechzig Jahren setzt man sich doch noch nicht zur Ruhe. Ich werde mich doch nicht außer Kurs setzen.«
»Rudolf könnte dich doch vertreten.«
»Rudolf? Nun ja, später einmal, wenn ich mich nicht mehr arbeitsfähig fühle, dann soll Rudolf mein Nachfolger werden, obwohl er nicht mein Fleisch und Blut ist. Aber noch stehe ich selbst meinen Mann. Und du darfst nicht neidisch sein auf meine Geschäfte. So ein großes Handelshaus braucht ungeteilte Aufmerksamkeit, es ist doch mein Lebenswerk. Als ich es von meinem Vater erbte, stand es schon auf der Höhe, aber ich habe es doch noch weiter emporgebracht und bin stolz darauf. Und meine ganze Kraft gehört der Firma Roland, solange ich welche habe. Aber sei versichert, wenn ich mich dir auch nicht viel widmen kann, so gehört dir doch meine väterliche Liebe, meine Fürsorge.«
Wieder streichelte sie seine Stirn.
»Das weiß ich, lieber Vater, sonst wäre es auch noch viel trauriger für mich, dass ich so wenig von dir habe.«
Er sah sie mit einem forschenden Blick an.
»Du hast doch Rudolf. Ist er dir nicht sehr viel?«
Sie merkte nicht, dass eine gewisse Unruhe in seiner Frage lag.
»Ja doch, Rudolf ist mir gewiss lieb und wert, ich habe ihn lieb, als sei er mein richtiger Bruder, und was er an Zeit übrig hat, widmet er mir. Aber das ist eben sehr wenig. Auch er wird ja von Geschäften ganz in Anspruch genommen, wenn er nicht mit dir konferiert oder mit dir im Klub ist. Ihr beide seid immer zusammen und könnt mir gar nicht nachfühlen, wie das ist, wenn man den ganzen Tag so einsam und allein ist. Du solltest mich wirklich beurlauben, ich bin so leicht abkömmlich. Im Hause läuft auch alles ohne mich wie am Schnürchen unter der Aufsicht unserer Haushälterin. Lass mich doch nach Ceylon, Vater.«
Er richtete sich schroff auf, und sein Gesicht bekam einen harten, strengen Ausdruck, der ihr immer den Vater so fremd machte. Sie wusste, dass er gegen sich selbst am strengsten und härtesten war. Irgendetwas war aber in des Vaters Wesen, über das hinweg sie zuweilen den Weg zu seinem Herzen nicht finden konnte.
»Es geht nicht, Waltraut, ich kann dich nicht für lange Zeit fortlassen. Eine Reise zu deiner Freundin würde mindestens einige Monate in Anspruch nehmen, denn zur Reise allein brauchst du hin und zurück fast zwei Monate. Auch könntest du diese Reise nicht allein machen.«
»Doch, Vater, ich würde mich unter den Schutz des Kapitäns stellen, sehr viele Damen müssen solche Reisen allein machen.«
Der alte Herr machte eine hastig abwehrende Bewegung.
»Es geht nicht, schon deshalb nicht, weil ich andere Pläne habe. Doch davon später, die fünf Minuten sind schon längst verstrichen. Lass mich jetzt allein.«
Er küsste sie auf die Stirn, und ein trüber, sorgenschwerer Blick in seinen Augen hinderte sie an jedem weiteren Einwand. Still und beklommen verabschiedete sie sich und ging hinaus aus dem Privatkontor des Vaters, das in der ersten Etage des großen Geschäftshauses lag. Er sah ihr mit einem Blick nach, der sie tief erschüttert haben würde. Und ein dumpfer Seufzer stieg wie ein Stöhnen aus seiner Brust empor.
Als sie auf das Treppenhaus hinaustrat, kam gerade der Fahrstuhl auf der Etage an, und ein hochgewachsener junger Herr trat heraus. Er mochte fast die Mitte der Dreißig erreicht haben und war ohne Hut und Überrock. Aus seinem offenen sympathischen Gesicht leuchteten zwei graue, kluge Augen, in denen viel Güte lag, als er sie jetzt auf Waltraut richtete, während sein Gesicht sonst einen sehr energischen, bestimmten Ausdruck hatte, lächelnd trat er auf sie zu, während der Fahrstuhl mit einigen anderen Herren weiter hinauffuhr.
»Du hier in unserem nüchternen Geschäftshaus, Waltraut, das dir doch sonst so unsympathisch ist?«
Damit reichte er ihr die Hand.
Sie seufzte tief auf. »Ja, Rudolf, es ist mir sehr unsympathisch, manchmal hasse ich es direkt wie einen Moloch, der alles, was mir lieb ist, auffrisst«, sagte sie zornig.
Er lachte leise.
»Aber Schwesterchen, du siehst ja ganz kriegerisch aus. Bist du so schlecht gelaunt?«
Kläglich sah sie zu ihm auf.
»Betrübt bin ich, sehr betrübt, weil Vater meine Bitte rundweg abgeschlagen hat zum soundsovielten Male.«
»Was denn für eine Bitte?«
»Dora hat wieder geschrieben und mich dringend um meinen Besuch gebeten. Ich soll auf einige Monate zu ihr kommen.«
»Ah, also wieder Reiselust, Waltraut? Und Vater hat deine Bitte wieder abgelehnt?«
»Leider!«
»Möchtest du uns denn so gern allein lassen, kleine Waltraut?« Er fragte das mit einem warmen Lächeln.
Vorwurfsvoll sah sie ihn an. »Ihr braucht mich ja gar nicht, ich bin so überflüssig, das habe ich Vater auch gesagt.«
Er streichelte ihre Hand.
»Überflüssig? Das ist doch nicht dein Ernst, Waltraut?«, fragte er ernst.
»Doch, ihr habt immer allerlei vor, nie habt ihr Zeit für mich. Ich bin so viel allein, das spüre ich um so mehr, da ich leider keine ausfüllende Tätigkeit habe.«
»Du stehst doch im Haushalt vor.«
Sie zuckte die Achseln. »Nur nominell! In Wahrheit geht ohne mich alles viel besser. Frau Hag hat alles am Zügel und versteht ja auch alles besser als ich, und unsere Leute sind sehr tüchtig. Alles um mich her hat ernste Pflichten, nur ich nicht – ich bin einfach überflüssig.«
Er legte den Arm leicht um ihre Schulter.
»Aber Schwesterchen, was ist mit dir, so kenne ich dich gar nicht.« Es zuckte um ihren Mund.
»Kennt mich denn überhaupt ein Mensch, nimmt sich jemand nur die Zeit dazu, mich richtig kennenzulernen? Vater denkt, es ist alles gut und in Ordnung, wenn er Geld für mich verdient, und du – du wirst vom Vater immerfort in Anspruch genommen und vom Geschäft.«
Er sah sie forschend an und strich ihr dann über die Wange.
»Es wäre vielleicht wirklich gut, wenn du einmal für eine Weile fortkämest, dann würdest du vielleicht am ehesten erkennen, dass du im Grunde doch der Mittelpunkt bist, um den sich alles dreht, und dass du durchaus nicht überflüssig bist.«
»Vater lässt mich aber nicht fort.«
»Er fürchtet die Trennung von dir.«
Sie sah ihn fragend an.
»Glaubst du das wirklich?«
»Aber Waltraut, er hat dich doch lieb!«
»Soweit er sich Zeit lässt, sich darauf zu besinnen, und das geschieht sehr selten«, sagte sie mit schmerzlicher Bitterkeit.
»Du bist ungerecht, Waltraut«, sagte er ernst und vorwurfsvoll.
Sie seufzte. »Vielleicht – ich weiß nicht, wie es kommt, dass ich in dieser Beziehung so anspruchsvoll bin. Dafür hältst du mich doch gewiss. Und ich weiß ja natürlich auch, dass Vater nur für uns arbeitet, für dich und mich.«
»Hauptsächlich doch für dich. Waltraut, du bist ja sein einziges Kind.«
Ernst sah sie ihm in die Augen.
»Du bedeutest ihm trotzdem mehr als ich.«
Er stutzte und sah sie fast erschrocken an.
»Waltraut, du bist doch nicht etwa eifersüchtig, du wirst mir doch nicht missgönnen, dass dein Vater mir auch ein Vater wurde?«
Lächelnd hing sie sich an seinen Arm und sah ihn mit einem liebevollen Ausdruck an.
»Aber nein, um Gottes willen, so musst du das nicht auffassen, Rudolf. Ich gönne dir die Liebe meines Vaters, wie ich sie einem rechten Bruder gönnen würde. Nur erkenne ich einfach Tatsachen. Es ist doch so verständlich, dass du ihm näherstehst als ich. Du warst schon jahrelang von ihm als Sohn angenommen, als ich zur Welt kam, und er hing an dir mit einer so großen Beharrlichkeit, dass es mir schwer wurde, ein Plätzchen in seinem Herzen zu erobern, genau, als hätte ich schon einen großen Bruder gehabt. Was soll ein Mann wie mein Vater mit einem kleinen Mädchen anfangen? Wenn Mutter noch am Leben wäre, dann wäre ja alles gut. Solange sie lebte, habe ich mich nicht einsam gefühlt, obwohl ich da von Vater und dir auch nicht mehr hatte. Aber – nun habe ich Mutter doch nicht mehr.«
Es klang ein tiefer Schmerz aus ihren Worten. Eine tiefe Rührung flog über Rudolfs Gesicht.
»Ja, leider ist sie von uns gegangen, deine liebe, herrliche Mutter. Sie war die personifizierte Menschengüte. Nie vergesse ich ihr, wie mütterlich sie für mich, den Heimatlosen, gesorgt hat. Ich kann dir sehr gut nachfühlen, Waltraut, wie sehr sie dir fehlt, wie einsam du dich ohne sie fühlst. Habe ich doch selbst die Lücke, die sie hinterließ, schmerzlich empfunden. Das Scheiden von dir ist ihr auch sehr schwer geworden, sie hing mit zärtlicher Inbrunst an dir.«
Waltraut nickte und schluckte aufsteigende Tränen hinunter.
»Ja, siehst du, Mutter gehörte in der Hauptsache mir, Vater gehört in der Hauptsache dir. So war es immer, und es war gut so. Aber nun habe ich Mutter nicht mehr, und das macht mich so einsam. Deshalb gönne ich dir Vaters Liebe aber von Herzen. Ein Vater braucht einen Sohn mehr, eine Mutter die Tochter. Du musst mich doch verstehen.«
Nachdenklich sah er sie an.
»Ich verstehe dich schon, mein armes Kleines! Mutter füllte das ganze Haus mit Liebe und Güte, mit Licht und Wärme für uns alle. Nun, da sie fort ist, musst du ja frieren und einsam sein, zumal dir fast zu gleicher Zeit die liebste Freundin genommen wurde durch ihre Heirat und die damit verbundene Übersiedlung in ein fernes Land. Ich verstehe auch, dass du dich an die anderen jungen Damen deiner Bekanntschaft nicht inniger anschließen kannst, sie sind mehr oder minder oberflächlich. Nun bist du den größten Teil des Tages allein zu Hause. Vater und ich, wir haben unsere Geschäfte, die uns ablenken und ausfüllen. Ich sehe schon ein, es wäre besser für dich, wenn du eine Weile fortkämst zu deiner Freundin Dora. Dort würdest du Mutters Verlust eher verschmerzen, und wenn du wieder heimkehren würdest, dann würdest du erst wieder merken, wie warm und traulich es trotz allem im Vaterhause ist. Soll ich Vater für dich bitten, soll ich ihm das ans Herz legen?«
Sie fasste seine Hand mit festem Druck.
»Ach bitte, tue das, Rudolf! Auf dich hört Vater vielleicht. Weißt du, Dora fehlt mir so sehr, und sie sehnt sich auch nach mir, weil ihr Mann sie auch viel allein lassen muss. Sie ist nun schon fast drei Jahre fort nach Ceylon. Und wenn sie auch ihr Mann sehr glücklich macht und ihr jeden Wunsch von den Augen absieht, so wäre sie doch sehr glücklich, wenn ich zu ihr käme. Ihre Mutter kann die weite Reise nicht machen, und ihr Vater kann, wenn er sich wirklich zu einem Besuch bei ihr entschließt, nur kurze Zeit bei ihr sein. Und wenn ihr Mann auf der Plantage zu tun hat, was natürlich meistens der Fall ist, dann ist sie allein. So himmlisch schön es in ihrer neuen Heimat ist, würde sie sich doch sehr freuen, wenn ich kommen würde. Und wenn du mit Vater sprichst und er macht seine Bedenken wieder geltend, dass ich nicht allein reisen kann, dann sage ihm nur, dass ich unter dem Schutz des Kapitäns ganz sicher reise, und im Hafen würde mich dann, wenn ich allein kommen würde, Dora mit ihrem Manne erwarten.«
Er küsste sie lachend auf die Wangen.
»Ich werde nichts vergessen, was deinem Wunsch Erfüllung bringen könnte.«
»Du bist gut, wie immer, Rudolf.«
»Und werde mir selber damit wehe tun, denn ich werde dich sehr entbehren«, sagte er, sehr ernst werdend.
»Ach, weißt du, für die paar Stunden, die du für mich übrig zu haben pflegst, findest du andere Verwendung.«
Er zog sie leise am Ohr.
»Das war eine kleine Stichelei, Waltraut.«
Sie reckte sich und küsste ihn schwesterlich auf die Wange.
»So, nun habe ich abgebüßt. Also versuche, Vater umzustimmen, ich würde mich so sehr freuen. Von allem anderen abgesehen, wäre schon die weite Reise auf dem Dampfer wunderschön. Wenn ich ein Mann wäre, hätte mich Vater längst auf Reisen geschickt, wie er dich auch hat reisen lassen.«
Er sah sie lachend an.
»Wenn du ein Mann wärst? Ach, Waltraut, in deinem Alter saß ich noch fest auf der Handelshochschule und konnte noch nicht an Reisen denken.«
Sie zog ein Mäulchen.
»Nun ja, ihr Männer werdet eben später reif als wir Frauen«, neckte sie. »Aber nun will ich dich nicht länger aufhalten. Auf Wiedersehen.«
»Wiedersehen, Waltraut!«
Sie trennten sich mit warmem Händedruck, und Waltraut huschte schnell die Treppe hinab.
Rudolf Werkmeister, Georg Rolands Pflegesohn, suchte seinen Pflegevater auf.
2
Als er dessen Privatkontor betrat, sah er betroffen, dass sein Pflegevater vor seinem Schreibtisch saß und das Gesicht in den Händen vergraben hatte.
»Ich störe doch nicht, lieber Vater?«, fragte Rudolf ganz betreten, dass er den Vater in solch einer Situation überraschte.
Georg Roland zuckte zusammen. Er hatte den Eintritt Rudolfs überhört. Jetzt sah er auf und starrte Rudolf fassungslos an. Nur mühsam rang er eine große Erregung nieder.
»Ich habe dich erschreckt, Vater – bist du nicht wohl?«
Besorgt sah der junge Mann in das blasse Gesicht des älteren. Mit einem tiefen Atemzug fand sich Georg Roland wieder in die Wirklichkeit.
»Es ist seltsam, Rudolf, ich dachte gerade an deinen Vater – heute ist sein Todestag. Und da standest du vor mir, und es ist mir noch nie so aufgefallen wie heute, wie sehr du ihm gleichst. Deinen Eintritt hatte ich überhört, weil ich mit meinen Gedanken in vergangenen Zeiten war. Und als ich aufblickte, war mir, als sei dein Vater aus meinen Gedanken heraus vor mich hingetreten.«
Es geschah sehr selten, dass Georg Roland mit seinem Pflegesohn von dessen Vater sprach.
»Gleiche ich meinem Vater wirklich so sehr?«, fragte Rudolf.
Der alte Herr nickte.
»Ja, je älter du wirst, je mehr gleichst du ihm.«
»Er war ja wohl ungefähr in meinem Alter, als er starb?«
»Ganz recht, vierunddreißig Jahre war er alt, genau wie du jetzt.«
»Und heute ist sein Todestag – seit dreiunddreißig Jahren ist er nun schon tot.«
Schwer nickte Georg Roland mit dem Kopfe.
Rudolf setzte sich zu ihm und nahm seine Hand.
»Du sprachst mir so selten von ihm, ich weiß so wenig über ihn, dass ich dich gerade heute bitten möchte, mir doch wenigstens über seinen plötzlichen Tod einmal ausführlich zu berichten.«
»Es weckt schmerzliche Erinnerungen, wenn ich von ihm spreche, deshalb vermeide ich es gern. Aber ich kann deinen Wunsch verstehen und will mich dazu aufraffen, davon zu sprechen. Also höre mich an.«
Der alte Herr setzte sich so, dass sein Gesicht im Schatten blieb. Dann begann er mit heiserer Stimme:
»Es war die schwerste Stunde meines Lebens, Rudolf, und gerade, ehe du eintratest, hielt ich sie mir wieder in der Erinnerung vor. Ganz lebendig steht sie wieder vor mir. Du weißt, dein Vater war mein bester, wohl mein einziger Freund, was man wirklich einen Freund nennen kann. Wir kannten uns von der Schule her schon. Dein Vater war einer der besten und kühnsten Bergsteiger, und einige Tage vor seinem Tode waren wir wieder einmal in die Schweiz gereist, in den Engadin, um verschiedene Touren zu machen. Wir waren über Nacht in der Schutzhütte geblieben und wollten nun den letzten Teil des Aufstiegs auf den Gipfel eines Berges machen. Ich verschweige dir absichtlich, welcher Berg es war, denn da du selber gern auf die Berge steigst, will ich dich nicht damit belasten. Dein Vater kannte Weg und Steg genau, und wir machten die Tour, die durchaus nicht zu den gefährlichsten gehörte, die wir schon zusammen gemacht hatten, ohne Führer, wie immer.
Bei schönstem, klarstem Wetter brachen wir auf, aber nach einer Stunde setzte plötzlich, nachdem sich der Himmel schnell umzogen hatte, ein heftiges Schneetreiben ein. Es wunderte mich, denn dein Vater war sonst im Voraussagen des Wetters fast unfehlbar. Diesmal hatte er sich wohl geirrt, sonst wären wir sicher in der Schutzhütte geblieben. Ich muss gestehen, dass mir nicht sehr wohl in meiner Haut war, denn es hatte sich auch ein starker Schneesturm erhoben, und die Staublawinen fegten über uns hinweg, als wollten sie uns mitreißen. Und seltsamerweise war auch dein Vater sehr still und in sich gekehrt, was mich allerdings nicht so sehr wunderte, weil er in jener Zeit viel Schweres erlebt hatte. Der dicht fallende Schnee, der wie ein weißes Tuch über uns herniederfiel, und die Staublawinen verschütteten sofort unsere Spuren. Aber trotzdem, wir waren schon in schlimmerer Situation gewesen, ohne dass dein Vater die Richtung verloren hätte. An jenem Tage war es aber doch geschehen. Wir waren über eine Stunde in diesem wüsten Schneetreiben unterwegs und waren dicht neben einem steilen Abgrund angekommen, von dessen Schauerlichkeit ich durch den dichten Schnee, der uns fast blind machte, keine Ahnung hatte. Und da setzte sich dein Vater, der sonst nie die Ruhe und Sicherheit verlor, dicht neben den Abgrund nieder in den Schnee und stöhnte: Ich habe die Richtung verloren, wir haben uns verirrt. –
Aber das war nicht das Schlimmste, dein Vater erklärte plötzlich: ›Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, geh du allein weiter, halte dich immer rechts an der Felswand – lass mich allein – rette dich.‹
Es fiel mir natürlich nicht ein, diesen Worten Folge zu leisten, aber was nun kam, war etwas so Rätselhaftes, Unverständliches für mich, dass ich es heute noch nicht begreifen kann. Dein Vater, dieser kühne und unverzagte Bergsteiger, bekam, wie ein Neuling, einen furchtbaren Anfall von Bergkrankheit. Du weißt, das ist ein vollständiges Versagen der Nervenkraft, eine absolute Willenlosigkeit, die durch nichts zu besiegen ist. Ich war fürchterlich erschrocken. Wohl hatte dein Vater in jener Zeit Schweres erlebt, und deshalb hatte ich ihn überredet, zu seiner Erholung mit mir in die Berge zu gehen, aber einen solchen Nervenzusammenbruch hätte ich bei ihm nicht für möglich gehalten. Der einige Wochen zurückliegende Tod deiner Mutter, die er sehr geliebt und die er nach schwerer Krankheit verloren, hatte ihm wohl mehr zugesetzt, als ich geglaubt hatte. Ich war gerade erst von einer mehrjährigen Auslandsreise zurückgekommen und hatte ihn sehr verändert gefunden, aber wie gesagt, einen solchen Nervenzusammenbruch hatte ich bei ihm nicht für möglich gehalten. Offen gesagt, ich war sehr gegen die Verbindung deines Vaters mit deiner Mutter gewesen, weil sie beide völlig vermögenslos waren und dein Vater auf sein Gehalt angewiesen war, das er in einer Stellung in einem großen Handelshause bezog. Er hätte bei seiner fabelhaft interessanten Erscheinung und seinen glänzenden Fähigkeiten eine ganz andere Partie machen können. Aber er liebte deine Mutter namenlos und wollte nicht von ihr lassen. Fast zwei Jahre ist das gut gegangen, aber dann begann deine Mutter nach deiner Geburt zu kränkeln und starb dann auch nach monatelangem Leiden. Wie gesagt, kurz nach ihrem Tode kehrte ich zurück, und nun saßen wir da oben in dem Schneetreiben fest. Dein Vater war völlig hilflos, ganz zusammengebrochen. Er beschwor mich nur immer wieder mit matter Stimme, ich möge mich allein retten, er sei nicht mehr imstande, nur noch einen Schritt zu tun.
Ich hätte natürlich gern Hilfe herbeigerufen, denn ich allein konnte den großen, schweren Mann nicht tragen, zumal ich auch etwas von Kräften war durch das Ankämpfen gegen den Schneesturm, aber ich wagte nicht, deinen Vater in der gefährlichen Nähe des Abgrundes allein zu lassen.«
Eine Weile verstummte Georg Roland und vermochte nicht, weiterzusprechen. Er stützte den Kopf in die Hand und verbarg sein Gesicht. Rudolf sah ihn erregt und erwartungsvoll an, drängte aber nicht, dass er weiter berichten möge. Endlich richtete sich der alte Herr auf, seufzte tief auf und wischte sich über die Augen, als müsse er ein quälendes Bild verscheuchen. Dann sprach er weiter mit heiserer, gepresster Stimme:
»Ich beschwor deinen Vater, sich zusammenzunehmen, sich aufzuraffen und mit mir zu kommen, aber er reagierte gar nicht mehr, saß nur stumm und starrte vor sich hin. Ich wurde ärgerlich. ›Willst du hier liegen bleiben und erfrieren? Komm mit mir, denke doch an dein Kind‹, sagte ich.
Er sah mich an mit einem Blick, den ich nie vergessen werde.
›Ich will sterben, geh, lass mich allein‹, stieß er hervor. ›Versprich mir, dass du dich meines Sohnes annimmst, ich weiß, du wirst dies Versprechen halten.‹
Um ihn zu beruhigen, sagte ich, dass ich ihm das verspreche, aber er möge nicht so törichtes Zeug reden und möge aufstehen, da ich ihn doch nicht tragen könne.
Er schüttelte den Kopf und starrte wieder vor sich hin. Da sagte ich, um ihn aufzustacheln:
›Sei keine Memme, so kenne ich dich gar nicht.‹
Wieder sah er mich seltsam an.
›Nein – du kennst mich nicht.‹
Da zwang ich mich, in meiner Angst um ihn, zu einem verächtlichen Ton: ›Feigling!‹, rief ich ihm zu.«
Wieder machte Georg Roland eine Pause und kämpfte erst die Erregung in sich nieder. Dann fuhr er, mit starren Augen auf einen Fleck sehend, fort:
»Als ich ihm dieses Wort zurief, erhob er sich plötzlich – tat es aber so schwerfällig und ungeschickt, dass er auf dem glatten Boden ins Gleiten kam und – vor meinen entsetzten Augen – in den Abgrund stürzte, ehe ich ihn nur halten konnte.«
Lange war es still zwischen den beiden Männern, Georg Roland war totenblass geworden, und seine Augen sahen glanzlos in die Weite, als sähe er das Grauenhafte wieder vor sich.
Endlich fasste Rudolf, der sich gefasst hatte, seine Hand. Auch er war tief erschüttert.
»Verzeihe mir, ich habe schlimme Erinnerungen in dir geweckt durch meine Bitte.«
Georg Rolands Brust hob sich in einem stöhnenden Atemzug.
»Die brauchen nicht geweckt zu werden, Rudolf, sie sind immer wach, immer lebendig, jene Stunde steht immer in grauenvoller Klarheit vor mir. Also höre weiter: Dein Vater war abgestürzt, und ich konnte nichts, nichts tun, ihn zu retten. Der Abgrund, den ich ja nur ahnen konnte, da ihn das Schneetreiben ganz verdeckte, hatte deinen Vater aufgenommen. Ich stand eine Weile wie gelähmt, habe wohl vor Schreck laut aufgeschrien, schrie nun weiter wie sinnlos und beugte mich über den Rand des Abgrundes, um deines Vaters Namen zu rufen. Eine grauenvolle Stille antwortete mir. Und da endlich kam mir zum Bewusstsein, dass ich um jeden Preis Hilfe holen müsse. Ich lief davon wie ein Blinder, aber instinktiv mich nach deines Vaters Rat immer rechts haltend. Immer wieder schrie ich laut um Hilfe, und nachdem ich wohl eine halbe Stunde so gelaufen war, hörte ich eine Antwort auf meine Rufe – sie kam aus der Schutzhütte; zu meinem Erstaunen stand ich dicht davor, und drei Männer kamen mir entgegengestürzt, auf meinen Ruf antwortend. Wir mussten im Kreise herumgelaufen sein, da wir die Hütte vor Stunden verlassen hatten. Die drei Männer waren zwei Engländer und ein Führer, die dieselbe Tour, wie wir vorgehabt, machen wollten und in der Schutzhütte noch vor dem Schneetreiben angekommen waren. Ich berichtete völlig verstört von dem Unglück, das meinen Freund betroffen hatte, und musste von dem Führer allerlei Vorwürfe anhören, weil wir die Tour ohne Führer gemacht hatten. Ich konnte ihm kaum erklären, dass wir ganz andere Touren schon ohne Führer gemacht hatten. Aber er und die Engländer begleiteten mich zurück zu der Unfallstelle. Wie durch einen Zauberspruch hatte plötzlich das Schneetreiben wieder aufgehört, und hell und klar schien die Sonne. Wir fanden die Stelle bald, an der dein Vater abgestürzt war, seinen Eispickel, das Seil und den Rucksack fanden wir schon tief unter dem Schnee. Der Schnee hatte alle Spuren verwischt. Aber ich sah nun erst den grauenvollen Abgrund klar vor mir und starrte entsetzt hinab.
Es war ausgeschlossen, dass wir von hier oben aus deinem Vater hätten zu Hilfe kommen können, selbst wenn er noch am Leben gewesen wäre. Der Felsen fiel ganz steil ab in eine tiefe Schlucht, in die von halber Höhe des Felsens ein tosender Wasserfall mit furchtbarer Gewalt herniederbrauste und auf dem Grund der Schlucht einen brodelnden Wasserkessel bildete, der von rotierenden Steinen durch die Gewalt des Wassers ausgehöhlt worden war. Aus diesem Wasserkessel suchte sich das Wasser mit großer Gewalt einen Ausweg, um sich in eine Ache zu ergießen. Das alles sah man aber nicht vom Rand des Abgrunds aus, es wurde mir nur von dem Führer der Engländer erzählt. Ganz glatt fiel der Felsen ab, nur etwa drei Meter tiefer, als wir standen, war ein schmaler Vorsprung zu sehen, der sich zu einer aufwärtsführenden Felsschrunde hinzog. Der Vorsprung war aber nur so schmal, dass ein Mensch vielleicht einen Halt gefunden hätte, wenn er vorsichtig und sanft hinuntergeglitten wäre, aber im jähen Fall konnte sich hier niemand halten. Der Körper deines Vaters war aufgeschlagen auf diesem Vorsprung, denn der Schnee lag nicht so hoch an der Stelle, wo er abgestürzt war, als an den anderen. Sonst aber war keine Spur von deinem Vater zu erblicken. Tief unten brodelte der Wasserfall, der sicher alles mit sich in die Tiefe riss, was ihm in den Weg kam. Es war aber unmöglich, auf den Grund der Schlucht zu sehen, obwohl es ganz klar geworden war. Der Führer sagte uns, dass es ausgeschlossen sei, dass dein Vater noch am Leben sei. Selbst, wenn er sich nicht gleich zu Tode gestürzt hätte, wäre er von dem Wasserfall in den brodelnden Wasserkessel gestürzt und dort zerrieben worden durch die Gewalt des Wassers. Es sei kaum eine Möglichkeit, dass die Leiche unversehrt geborgen werde, wenn sie überhaupt zutage gefördert werden könne, was unerhört schwierig sein würde.
Trotzdem wurde, nachdem wir sofort abgestiegen waren – den Engländern war die Lust an der geplanten Partie vergangen –, eine umfassende Rettungsaktion, die voraussichtlich im günstigsten Falle nur eine Bergung der Leiche möglich erscheinen ließ, in die Wege geleitet. Aber sie verlief trotz unbeschreiblicher Mühen ergebnislos. Auch von deines Vaters Leiche fanden wir keine Spur, weder damals noch später. Ein Priester weihte die Stelle, und wir beteten für das Heil seiner Seele, weiter konnten wir nichts tun. Nicht einmal ein christliches Begräbnis konnte ich dem Freunde verschaffen.«
Erschöpft schwieg der alte Herr und sank in sich zusammen. Auch Rudolf saß mit blassem, fahlem Gesicht da und konnte nicht sprechen. Nach einer langen Weile fuhr Georg Roland fort:
»Du kannst dir denken, wie der Tod deines Vaters auf mich gewirkt hat. In einer unbeschreiblichen Stimmung reiste ich nach Hause, als alles getan war, was getan werden konnte. Mein Erstes war, dass ich mich deiner annahm, nicht nur, weil ich es deinem Vater versprochen hatte, sondern auch, weil es mir Bedürfnis war. Du warst unter der Aufsicht deiner alten Kinderwärterin zurückgeblieben, die nun mit dir in meine Junggesellenwohnung übersiedelte. Als ich bald darauf heiratete, geschah es nicht zuletzt, um dir eine Mutter zu geben, die sich deiner annehmen konnte. Meine Wahl fiel auf eine Frau, der ich zutraute, eine gute Mutter auch für dich zu werden. Sie war einverstanden, dich aufzuziehen mit liebevoller Sorgfalt, und ich brauche dir nicht in Erinnerung zu bringen, was für eine gute Mutter sie dir wurde.«
»Nein, wahrlich nicht, lieber Vater, nie, niemals werde ich euch beide vergessen, was ihr für mich getan habt«, sagte Rudolf warm und herzlich.
»Von mir sprich nicht, ich erfüllte nur eine Pflicht und löste ein Versprechen. Nicht nur deinem Vater hatte ich gelobt, für dich zu sorgen, auch mir selbst hatte ich es gelobt, dich wie meinen eigenen Sohn aufzuziehen. Und ich hoffe, du bist überzeugt, dass ich dich wie einen Sohn an mein Herz nahm.«
Rudolf fasste seine Hand.
»Ja, Vater, davon bin ich überzeugt und danke dir von ganzem Herzen.«
Und damit drückte er schnell einen Kuss auf die Hand seines Wohltäters. Dieser zog wie in tiefem Erschrecken seine Hand zurück.
»Nein, danke mir nicht! Ich will keinen Dank! Und – nun lass mich allein. Ich muss mich erst wiederfinden und habe dann noch zu tun. Oder hattest du noch ein besonderes Anliegen?«
»Ja, Vater, ich traf Waltraut draußen im Treppenhaus. Sie sagte mir, weshalb sie bei dir war, und bat mich, ein gutes Wort für sie bei dir einzulegen. Könntest du Waltraut nicht gestatten, ihre Freundin für einige Zeit zu besuchen? Du hast mich vor Jahren lange Zeit ins Ausland gehen lassen, willst du deiner Tochter diese Erlaubnis nicht auch gewähren?«
»Du bist ein Mann und du gingst hauptsächlich, um unsere geschäftlichen Verbindungen im Ausland zu festigen. Frauen gehören ins Haus.«
»Aber sie will doch nur die Freundin besuchen, die ja nun einmal so weit fort geheiratet hat. Du musst bedenken, wie schwer Waltraut durch den Verlust ihrer Mutter betroffen ist – viel schwerer als du und ich. Wir haben unsere geschäftlichen Ablenkungen und sind abends oft im Klub. Waltraut ist so viel allein in dem Hause, das sonst die Liebe ihrer Mutter mit Wärme füllte. Leider ist fast zu gleicher Zeit ihre einzige Freundin von hier fortgegangen, und du weißt, wie schwer sich Waltraut an andere Menschen anschließt, die ihr zudem nicht zusagen. Nun kommen immer von ihrer Freundin die Sehnsuchtsrufe, weil auch diese sich im fremden Lande einsam und allein fühlt, da ihr Mann den ganzen Tag unterwegs ist. Wie verständlich ist es, dass Waltraut diesem Rufe gern Folge leisten möchte. Lass sie doch einige Zeit nach Ceylon gehen. Reisen ist ein gutes Mittel gegen Stimmungen, wie Waltraut solchen anscheinend unterworfen ist. Kommt sie zurück, wird sie sich freuen, wieder daheim zu sein, und den Verlust ihrer Mutter nicht mehr so schmerzlich empfinden.«
Georg Roland hatte seinen Pflegesohn mit forschenden Augen angesehen. »Würdest du Waltraut nicht vermissen?«
»Doch, Vater, sehr, wie ich auch weiß, dass du sie vermissen würdest, aber an uns dürfen wir in diesem Falle wirklich nicht denken, nur an Waltraut. Ich muss gestehen, ich sorge mich um sie, sie ist jetzt immer so still und bedrückt und grübelt zu viel.«
Der alte Herr strich sich über die Stirn, als sei ihm zu heiß. »Ihr setzt mir beide sehr zu, aber – ich kann nicht einwilligen, weil ich einen ganz bestimmten Grund habe. Ich habe andere Pläne – lange schon –, und die sollen sich jetzt verwirklichen. Und zwar erscheint mir der heutige Tag, der Todestag deines Vaters, besonders dafür geeignet. Aber jetzt nichts mehr davon, heute Abend daheim, da werden wir weitersprechen. Jetzt lass mich allein, ich habe zu viel zu erledigen, die Arbeit wächst mir zuweilen über den Kopf, und ich sehe ein, dass ich mir eine Sekretärin engagieren muss. Wenn man nur gleich eine tüchtige, anstellige Persönlichkeit finden würde. Für Versuche am untauglichen Objekt fehlt mir die Zeit und die Geduld. Also geh, mein Junge, hier nimm diese Post mit, sie geht dich an.«
Er reichte seinem Pflegesohn einen Stoß Briefe, und dieser entfernte sich, um in sein eigenes Kontor zurückzukehren. Er war seit zwei Jahren Prokurist der Firma Roland mit einigen anderen Herren zusammen. Freilich war er der jüngste Prokurist.
Als Georg Roland allein war, begann er aber nicht gleich zu arbeiten. Er hatte nur allein sein wollen, denn was er seinem Pflegesohn erzählt hatte, wühlte alles wieder in ihm auf, was er an jenem Tage erlebt hatte. Wieder wie vorhin vergrub er das Gesicht in den Händen und saß in qualvolle Gedanken versunken. Fast sechsundsechzig Jahre war er alt geworden, und dreiunddreißig Jahre lag jener Tag hinter ihm, aber er konnte ihn nie vergessen. Immer wieder sah er den gleichaltrigen Freund vor sich, wie er ihn gesehen hatte, ehe er abstürzte. Er hatte sich bei seiner Erzählung in einigen Punkten nicht ganz streng an die Wahrheit gehalten, nie hatte er einem Menschen die unbedingte Wahrheit über jene Szene, die dem Absturz seines Freundes vorausgegangen war, gesagt. Wahrheit war, dass er mit Heinrich Werkmeister, seinem Freund, jene Bergtour gemacht hatte, und auch sonst stimmten alle Einzelheiten, nur hatte er sich in jener gefährlichen Situation nicht nur damit begnügt, dem Freunde zuzureden, dass er sich aufraffen solle, er hatte sich schließlich zu dem Willenlosen herabgebeugt und hatte versucht, ihn emporzuheben. Dieser hatte sich dagegen gewehrt, und zwar mit viel mehr Kraft, als das völlige Versagen seiner Nerven hätte zulassen können. Und da erst hatte ihm Georg Roland, um ihn aufzustacheln aus seiner Lethargie, zugerufen, dass er ein Feigling sei. Darauf hatte sich Heinrich Werkmeister plötzlich aufgerichtet, hatte sich auf den Freund gestürzt und ihm zugerufen:
»Das lasse ich mir auch von dir nicht ungestraft sagen – wehre dich!«
Und dicht an dem furchtbaren Abgrund hatten sie zu ringen begonnen, und Heinrich Werkmeister hatte plötzlich eine erstaunliche Kraft entfaltet. Georg hatte ihn im Ringen von dem Abgrund fortziehen wollen, aber er hatte sich nicht vom Fleck bringen lassen, hatte so unglücklich manövriert, dass er immer dichter herankam. Und dann hatte er ihm einen so kräftigen Stoß versetzt, dass er ein Stück zurücktaumelte und zu Boden fiel. Aber wohl dadurch, dass er den Freund in diesem Augenblick losgelassen hatte, war dieser plötzlich über den Rand des Abgrunds in die Tiefe geglitten.
Wie gelähmt hatte Georg Roland auf die Stelle gestarrt, wo der Freund gestanden hatte, und hatte nur einen grauenvollen Schrei ausgestoßen, als sei er selbst in höchster Todesnot gewesen. Und dann hatte er sich mühsam erhoben, hatte immer wieder um Hilfe geschrien, obwohl er keinen Menschen in der Nähe wusste, und hatte sich weit über den Abgrund gebeugt, um den Namen des Freundes in qualvoller Angst zu rufen, ohne dass er eine Antwort erhalten hätte. Endlich hatte er sich dann aufgemacht, um Hilfe um jeden Preis zu holen. Und sein Herz hatte die Gewissheit bedrückt, dass er schuld sei an dem Tod des Freundes, obwohl er ihn doch nur hatte retten wollen. Eine heiße Angst war dabei über ihn gekommen. Wenn man ihn nun zum Mörder seines Freundes stempelte, wenn man ihm nicht glaubte, dass er ihn nur einen Feigling genannt hatte, um ihn aus seiner Lethargie zu reißen, wenn man annahm, der Ringkampf habe im Ernst stattgefunden und er habe bei diesem Ringkampf den Freund mit Vorbedacht in den Abgrund gestürzt? Da warf man ihn vielleicht ins Gefängnis, stellte Verhöre mit ihm an und wühlte in der Wunde, die ihm durch den Tod des Freundes geschlagen worden war. Und sein stolzer Vater – was sollte der leiden, wenn er nur einen solchen Verdacht auf seinen Sohn geworfen sehen würde? Nein, er durfte nicht die volle Wahrheit sagen, musste sich eine andere Version zurechtlegen.
Und während er, die Seele voll Verzweiflung, im Schneetreiben nach Hilfe rief und dahineilte wie ein Blinder, sich nur instinktiv so weit wie möglich rechts haltend, hatte ihn der Selbsterhaltungstrieb befähigt, sich die Szene am Abgrund in etwas veränderter Gestalt zurechtzulegen, und niemand hatte seine Schilderung bezweifelt.
Aber obwohl er sich im Grunde seines Herzens unschuldig fühlen musste, blieb doch immer ein heimlicher Stachel in seiner Brust, der ihm sagte: Wenn du Heinrich nicht einen Feigling genannt hättest, hätte er nicht mit dir gerungen und wäre nicht abgestürzt. Dann lebte er vielleicht noch. Und so bist du unschuldig schuldig geworden.
Und noch etwas hatte er Rudolf verschwiegen, in bester Absicht freilich. Als er damals aus den Bergen heimgekehrt war mit bedrücktem Herzen, hatte er die Firma aufgesucht, bei der Heinrich Werkmeister angestellt gewesen war, um dort den Tod seines Freundes zu melden. Man hatte aber dort schon in den Zeitungen davon gelesen und – da der Posten Heinrich Werkmeisters neu besetzt werden sollte, hatte man eine Revision seiner Bücher vorgenommen. Dabei war dann zutage gekommen, dass Heinrich Werkmeister im Laufe einiger Jahre zwanzigtausend Mark unterschlagen hatte. Erst waren es nur ganz kleine Summen, die nicht ordnungsgemäß gebucht waren, dann immer größere und zuletzt, kurz vor seiner Abreise, waren noch zehntausend Mark unterschlagen worden. Im Ganzen fehlten also zwanzigtausend Mark.
Georg Roland war durch diese Nachricht wie vor den Kopf geschlagen gewesen, das veränderte, nervöse Wesen seines Freundes war ihm nun in einem anderen Lichte erschienen. Erst jetzt kam ihm zum Bewusstsein, dass Heinrich Werkmeister doch all die großen Kosten, die ihm die Krankheit seiner Frau, die Anschaffung des Hausstandes, der Tod der Frau und die Geburt seines Sohnes verursacht haben mussten, nicht von seinem Gehalt hatte bestreiten können. Leider war er selbst in all der Zeit im Ausland gewesen, sonst hätte sich der Freund sicher um Hilfe an ihn gewandt, die er ihm auch gewiss gewährt hätte. So hatte er sich an fremdem Eigentum vergriffen, hatte die Bücher fälschen müssen und hatte dann nicht gewusst, was er hätte tun sollen. Nun wurde ihm der völlige Nervenzusammenbruch des Freundes erklärlich. ›Nein, du kennst mich nicht!‹, hatte ihm Heinrich da oben zugerufen und hatte ihn mit einem gramerfüllten Blick angesehen, den er nie vergessen konnte.
Alles das erschien ihm jetzt in einem anderen Licht, und er hatte sich gefragt: Wollte er sterben, um sein Unrecht zu sühnen? Hatte er ihn deshalb fortschicken wollen, ihm den rechten Weg angebend, den er also sicher nicht verloren hatte, damit er sich dann in die Tiefe stürzen konnte, deren Furchtbarkeit er doch sicher kannte, da er nicht zum ersten Male diese Partie machte?
Dies Geheimnis würde nie geklärt werden. Heinrich Werkmeister hatte es mit sich in sein grausiges Grab genommen.
Aber es war für Georg Roland eine Selbstverständlichkeit gewesen, dass er dem ehemaligen Chef des Freundes die unterschlagene Summe ersetzte. Deshalb sah dieser von einer Publizierung des Falles ab, und Heinrich Werkmeisters Name war rein erhalten worden für seinen kleinen Sohn. In der Zerrissenheit seines Gemüts, niedergedrückt von einem Schuldbewusstsein, das doch keines war, suchte Georg Roland an dem Sohne seines Freundes gutzumachen, was in seiner Macht stand. Und dabei wuchs der Knabe ihm ans Herz wie ein eigenes Kind. Rudolf zählte bereits dreizehn Jahre, als Georg selbst ein Töchterchen geboren wurde. Georg Roland war dadurch in eine schwierige Lage gekommen. Er hatte in Rudolf seinen Sohn und Erben gesehen, und fast erschien es ihm nun wie ein Unrecht an diesem, dass ihm durch die Geburt seiner Tochter dies Erbe verloren gehen sollte. Er grübelte, wie er das abwenden konnte, und kam zu einem Entschluss. Er legte sich selbst ein feierliches Gelübde ab, dass seine Tochter eines Tages die Gattin seines Pflegesohnes werden solle, damit ihm so das ihm zugedachte Erbe erhalten bliebe, ohne dass er seine eigene Tochter hätte enterben müssen. Dies Gelübde, in einer Stunde seelischer Erregung abgelegt, hielt er für bindend. Da nun seine Tochter herangewachsen war, hielt er es an der Zeit, die beiden jungen Menschen aneinanderzubinden. Waltraut war nun einundzwanzig Jahre alt, also heiratsfähig. Hatte doch ihre kaum zwei Jahre ältere Freundin Dora schon vor drei Jahren Hochzeit gehalten. Heute, am Todestage seines Freundes, wollte er noch mit Rudolf und danach auch mit Waltraut sprechen und ihnen sagen, dass sie füreinander bestimmt seien.
Und er sagte sich, dass er, wenn Rudolf der Gatte seiner Tochter geworden sei, alles getan haben würde, was er hätte für Rudolf tun können. Dann musste doch endlich seine »Schuld« gesühnt sein. Er hatte sich bis heute noch nicht mit der Tatsache abfinden können, dass der Freund wohl selbst hatte den Tod suchen wollen und dass es eher ein Verhängnis für ihn selbst gewesen sei als eine Schuld, dass er die Ursache zum Tode seines Freundes geworden war. In seinem Unterbewusstsein hatte er es immer als Schuld empfunden, und die wollte er gutmachen um jeden Preis.
Dass er schon getan hatte, was in seinen Kräften stand, dass er Heinrich Werkmeisters Namen rein erhalten hatte und seinem Sohne eine sorglose Heimat gab, damit begnügte sich der äußerst gewissenhafte Mann nicht.
Ganz fest war er entschlossen, sein Gelübde zu halten und aus Rudolf und Waltraut ein Ehepaar zu machen. Er tat damit auch seiner Ansicht nach das Beste für seine Tochter und bezweifelte gar nicht, dass die beiden jungen Menschen füreinander geschaffen seien.
Niemals hatte Georg Roland seinem Vater Mitteilung davon gemacht, was damals in den Bergen geschehen war. Und ebenso wenig seiner späteren Frau. Oft war er nahe daran gewesen, ihr auch das Letzte zu enthüllen, aber immer hatte er es wieder in sich verschlossen, und sie war wohl zu feinfühlig, um nicht zu spüren, dass er sein tiefstes Inneres ihr verschlossen hielt, wenn sie auch nie darüber sprach.
Über all das grübelte der stille Mann am Schreibtisch noch in dieser Stunde, und er kam nicht mehr zum Arbeiten, bis es Zeit war, zu Tisch zu gehen – obwohl die Arbeit drängte.
3
E