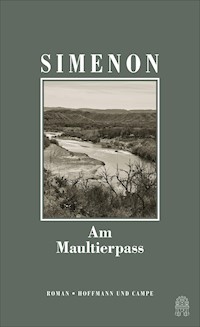
17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die großen Romane
- Sprache: Deutsch
Ein Drama mit Wildwestcharakter um zwei rivalisierende Brüder In Tumacacori im Süden Arizonas, fernab der Heimat, lebt Patrick Martin Ashbridge, kurz genannt "P. M.", ein unbescholtenes und begütertes Leben als Anwalt. Seine Wurzeln hat er längst gekappt, sein altes Leben als "Pat" samt Familie und erster Ehefrau hinter sich gelassen. Bis eines Tages sein Bruder Donald auftaucht – geflohen aus dem Gefängnis, wo er wegen Mordversuchs saß. Nie hat P. M. jemandem von Donald erzählt, der nun verlangt, dass P. M. ihm bei der Flucht nach Mexiko hilft. Als der Grenzfluss ausgerechnet in diesen Tagen anschwillt, spitzt sich die Lage zu ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 214
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Georges Simenon
Am Maultierpass
Die großen Romane – Band 65
Aus dem Französischen von Michael Mosblech
Hoffmann und Campe
1
Er hielt sein Glas in der Hand und blickte ausdruckslos auf den fahlen Rest Whisky, den es noch enthielt, wie jemand, der genießerisch den letzten Schluck hinauszögern möchte. Als er das Glas endlich geleert hatte, starrte er es noch eine Weile an. Er konnte sich nicht entschließen, es auf die Theke zu stellen, es ein kleines Stück, zwei, drei Zentimeter, nach vorn zu schieben. Bill, der Barkeeper, der in eine Würfelrunde mit einigen Cowboys vertieft schien, würde das Signal verstehen, denn er war auf der Lauer: Er war immer auf der Lauer, vor allem bei einem Gast wie P.M.
Das Ganze ist verteufelt gut eingespielt. Alles wirkt zufällig, jede Bewegung ist die unschuldigste der Welt, und das Ergebnis ist, dass man trinken kann, ohne dass es danach aussieht. Das hat etwas von einem Geheimbund an sich, mit Zeichen, die den Eingeweihten quer durch alle Länder der Welt bekannt sind.
Beim ersten Glas zum Beispiel, wenn P.M. einen Whisky bestellt oder, genauer gesagt, das Wort Whisky undeutlich, mit einer gewissen Mattigkeit, wenn nicht Zerstreutheit, über die Lippen bringt, was tut Bill? Er murmelt:
»Doppelten?«
Das ist eigentlich keine Frage. Es versteht sich von selbst, dass kein Gentleman die Montezuma Bar betritt, um einen einfachen Whisky zu trinken. Besser noch: Er braucht nicht einmal einen Ton zu sagen. Wenn man eintritt, wenn man sich auf einen der hohen Barhocker schwingt, greift Bill, oder auch ein anderer, mit verständnisinnigem Lächeln nach der guten Flasche Bourbon, nach der, die einem am liebsten ist, der Flasche für Kenner.
Manchmal behält er die Flasche in der Hand, wenn er das erste Glas vollgeschenkt hat.
P.M. bräuchte sein Glas nur ein klein wenig über die Theke zu schieben, aber er tut es nicht, er steigt schwer von seinem Stuhl und schreitet zur Toilette.
Er gehört nicht zu denen, die jeden Samstagabend die Selbstbeherrschung verlieren. Und im Tal sind manche, für die hat die Woche so einige Samstage.
Er fühlt sich wohl, bloß ein wenig schummrig, sein Gang ist leicht schwankend – aber er ist überzeugt, dass das nicht auffällt. Wenn er jetzt zur Toilette geht, dann nur, um sich im Spiegel zu betrachten und zu prüfen, ob er sich noch einen letzten Bourbon leisten kann.
»Hello, P.M.!«
»Hello, Jack …«
Ein Typ sitzt ungerührt auf einer Kloschüssel in einer der türlosen Kabinen. Wie P.M. hat er seinen Hut aufbehalten. Wie alle anderen in der Bar und in der Stadt tragen die beiden Männer kein Jackett, nur ein weißes Hemd. Kaum jemand bindet sich eine Krawatte um, P.M. jedoch hat stets Wert auf eine gewisse Korrektheit gelegt und behält seine an, selbst auf der Ranch.
»Gießt es?«
»Noch nicht.«
»Wird es aber, und zwar tüchtig.«
Es ist kurz vor Mitternacht. Seit dem frühen Abend sind Blitze zu sehen, und man hört das Grollen des Donners auf der mexikanischen Seite.
P.M. betrachtet sich in der trüben Fläche des Spiegels. Er ist ein wenig fett, nicht sehr. Hier wirkt er gelblich, wegen des schlechten Lichts. In der Bar hingegen, in der es farbige Lampenschirme gibt, war er bonbonrosa. Seine Augen sind noch nicht verquollen. Kann er sich ein letztes Glas leisten?
Jack setzt das Gespräch von seiner Schüssel aus fort.
»Wie viele sind noch im Rennen? Ich hatte auf den 8. Juni gesetzt. Zu optimistisch!«
»Ich auf den 4. Juli. Auch zu optimistisch!«
Es ist schon einige Jahre her, dass die Zeitung von Nogales auf diese Idee gekommen ist. Eine kleine Zeitung für eine kleine Stadt, die auf der amerikanischen Seite kaum mehr als siebentausend Einwohner zählt.
Wenn die Regenzeit naht, wenn sich die Leute allmählich über die Straßen schleppen, wenn der Asphalt schmilzt, das Thermometer beharrlich 105°F zeigt und die Rancher überlegen, ob sie nicht, wie in manch anderen Jahren, ihr Vieh mangels Weidefläche nach New Mexico oder sogar Nevada treiben sollen, eröffnet die Zeitung eine Art Wettbewerb. Jeder trägt auf einer Tafel das Datum ein, an dem seiner Meinung der erste Regen fällt, und diese Tafel wird in einem Schaufenster ausgestellt.
Es stehen kaum noch Namen auf der Liste, höchstens vier oder fünf; P.M. ist vorhin vorbeigegangen, um einen Blick darauf zu werfen. Kaum jemand hat sich vorstellen können, dass bis zum 24. Juli kein Tropfen vom Himmel fällt.
»Ich glaube, eine Frau ist am nächsten dran. Den Namen habe ich vergessen.«
P.M. fährt sich mit einem Kamm durch die Haare. Er hat stets einen kleinen Kamm in der Tasche. Als er in das Lokal zurückkommt, versteht Bill sofort, dass er den Arm nach einer der Flaschen ausstrecken darf.
P.M. setzt sich beharrlich auf den gleichen Platz, ganz am Ende, wo die Theke einen Knick hat, sodass es ein wenig so aussieht, als hätte er den Vorsitz. Schließlich hat er auch nicht die gleichen Vorlieben wie die anderen. Diejenigen, die wie er aus dem Tal kommen, sitzen zumeist in kleinen Gruppen zusammen und diskutieren lautstark.
Patrick Martin Ashbridge drückt im Vorbeigehen mit respektvoller Vertrautheit einige Hände, wechselt mit jedem ein paar Worte, in Wirklichkeit jedoch hält er sich stets ein wenig abseits.
Eine Frage der Würde? Vielleicht. Auch des Geschmacks. Deshalb legt er es darauf an, samstagabends einer der Letzten zu sein. Die Bar ist fast leer. Er fühlt sich wohl auf seinem Hocker, sein Glas in der Hand, dazu Bill, der zwischen zwei Bestellungen auf einen kurzen Plausch vorbeikommt.
Bill hebt den Kopf.
»Es ist so weit!«
Es hört sich an, als prasselten Schrotkörner auf das Dach. Jemand ist aufgestanden, um die Tür zu öffnen, und in der Dunkelheit der Straße sieht man den Bürgersteig, der mit langen grauen Regenlanzen schraffiert ist.
»Ihr solltet mal das Wasser im Fluss sehn!«
Ob es richtig war, ein letztes Glas zu trinken? Schon reißt ihn dieses Wasser vom Himmel innerlich mit. Zumal der Barkeeper hinzufügt:
»Gut möglich, dass wir Sie ein paar Tage nicht zu sehen bekommen.«
Das kommt vor. Die Menschen im Tal sind von der Landstraße durch einen Fluss getrennt, der den größten Teil des Jahres ausgetrocknet ist, sich jedoch im Laufe einer Gewitternacht, manchmal binnen einer Stunde oder weniger, füllen kann, wenn das Wasser aus den mexikanischen Bergen herabströmt. Eine Brücke gibt es nicht. Wenn das Wasser nicht zu hoch ist, kommt man gerade noch mit dem Wagen hinüber, notfalls auch zu Pferd, wenn der Grund zu aufgeweicht ist für ein Fahrzeug. Aber man kann auch zehn Tage und mehr auf der anderen Seite des Santa Cruz festsitzen.
Liegt es an dieser Aussicht, dass er Lust bekommt, die Grenze zu überschreiten? Er sieht sein Bild zwischen zwei Flaschen, und sein Gesicht ist rot, die Augen groß, die Pupillen glänzen. Es stört ihn. Er mag sich so nicht.
»Ich glaube, morgen früh werden einige hier Schwierigkeiten haben, nach Hause zu kommen«, sagt der Barkeeper.
Besonders die Cowboys. Wenn sie samstagabends in die Stadt fahren, brechen sie selten vor dem frühen Morgen wieder auf.
P.M. wird nicht so lange brauchen. Nun gut. Er wird auf den Hügel fahren. Er zieht einige Dollar aus der Gesäßtasche seiner Hose, in der er stets ein Bündel Scheine mit sich trägt. Als er zur Tür geht, ist sein Gang unsicherer, als er gedacht hat, aber er kämpft nicht mehr dagegen an, er weiß, jetzt, da ein bestimmtes Bild von ihm Besitz ergriffen hat, gibt es kein Mittel mehr, dagegen anzukämpfen. Nur kurz über den Bürgersteig, über dem es schüttet wie aus Eimern, schon klebt ihm sein Hemd auf der Haut. Er stochert ein wenig herum, um den Zündschlüssel ins Schloss zu stecken. Hundert Meter weiter kommt bereits der Grenzzaun, der die Stadt in zwei Hälften teilt, in eine amerikanische und eine mexikanische. Er bremst, hält an. Die Gestalt eines Beamten der Einwanderungsbehörde nähert sich. Natürlich erkennt man ihn. Er braucht seine Papiere nicht zu zeigen.
Es ist merkwürdig: Selbst bei dem Regen, der alles gleichmachen müsste, fällt einem der Unterschied noch auf. Ein Tor, durch das man fährt, ein paar Reifenumdrehungen, und P.M. hat das Gefühl, eine fremde, zweideutige, verbotene Welt zu betreten.
Auf der Seite, die er gerade verlassen hat, war alles still, beruhigend, die breite Straße mit den anheimelnden Fenstern, die sauberen Bürgersteige, zwei Bars, die noch geöffnet waren. Jetzt gerät er in ein geheimnisvolles Wimmeln. Noch nach Mitternacht, selbst bei dieser Sintflut, streifen Gestalten umher, Leute sitzen auf der Türschwelle, Händler, die einen in ihre Läden locken, in denen Schnaps und irgendwelche Raritäten verkauft werden. Schon wälzen Bäche ihre gelben Fluten durch die von Schlaglöchern ausgehöhlten Straßen, und in jeder dunklen Ecke wähnt man menschliche Wärme, Gesten, Tuscheln.
Er wird dort hinauffahren. Nicht unbedingt mit Vergnügen. Besonders freudig fährt er nie dorthin. Vielleicht fährt er wegen des letzten Whiskys, der dunkle Bilder heraufbeschworen hat, vielleicht auch – wahrscheinlicher noch – wegen des Regens, der ihm einen Schwall Erinnerungen hat zu Kopfe steigen lassen.
Der Weg führt in ein Gassengewirr hügelaufwärts; bald schon umfängt ihn ein Geruch, Schatten und Licht bekommen einen neuen Sinn, nackte Arme winken ihm zu, spärlich bekleidete Frauen schlendern zuversichtlich im Lichtkegel der Scheinwerfer über die Straße.
Er weiß, dass er auf dem gesamten Rückweg den üblichen Groll hegen wird, der vor allem auf Ekel beruht, dass er das Lenkrad ganz sonderbar halten wird, als fürchte er, es zu infizieren, dass er vermeiden wird, sein Gesicht zu befühlen, die Zigarre an dem Ende anzufassen, das mit seinen Lippen in Berührung kommt.
Das Wasser strömt von überall. Die Scheibenwischer arbeiten ruckweise. Als er den Hügel wieder hinunterfährt, erzeugen seine Reifen schmutzige Fontänen, und er wird den Eindruck nicht los, diesen Geruch mitzunehmen, vor allem den Anblick dieser Sitzbecken, dieser widerlichen Emaillebecken, an die er sich nie hat gewöhnen können.
Er würde sich gern im Las Cavas die Händen waschen, einem mexikanischen Restaurant mit einem mächtigen Tresen, das amerikanischen Gästen die ganze Nacht über offen steht. Er fährt daran vorbei, erkennt die Musiker in den Operettenkostümen, die mit ihren Gitarren und ihren bunten Hüten von Tisch zu Tisch gehen. Wenn er anhält, wird er etwas trinken müssen, und wenn er trinkt, besteht die Gefahr, dass er zu verwegen fährt.
Er ist Deputy Sheriff, wie schier jeder im Tal, die vornehmen Leute, die Ranchbesitzer. Einige pfeifen darauf, fahren deshalb nicht weniger halsbrecherisch.
Die Leute begreifen nicht immer, dass er ein gewissenhafter Mann ist. Genau! Er hat das Wort eine Zeitlang gesucht. Er hätte auch sagen können: Ein rechtschaffener Mann, aber das ist zu wenig. Dass er getrunken hat, ist für ihn kein Grund, nicht mehr auf sich zu achten. Er hat sich sogar im Spiegel betrachtet, bevor er sich einen letzten Bourbon gegönnt hat. Er ist zwar auf diesen Hügel gefahren, dennoch …
Er verzieht seinen Mund zu einem bitteren Lächeln im Dunkel seines Wagens, der zum ersten Mal seit Monaten richtig durchgelüftet wird. Er hat Verständnis für sich. Er fährt dort nicht hinauf, um wie so manche, die er kennt, schändlich über die Stränge zu schlagen. Was die Vorsichtsmaßnahmen anlangt, die er trifft, sie würden weiß Gott darüber lachen!
Ob Nora schon zurück ist? Wohl kaum. Bestimmt wird sie mehr getrunken haben als er. Sie wirkt nie betrunken. Sie ist zu den Cadys gefahren, zwei Ranches weiter, zum Bridgespielen. Das ist ihr Tag. Schön – nur bei den Cadys, wie woanders auch, bleiben die Gläser nicht lange trocken. Wenn man so vor sich hin spielt, merkt man gar nicht, wie viel man trinkt.
Was ficht es ihn an? Wie kommt er dazu, sich Sorgen zu machen? Er ist am anderen Ende von Nogales angelangt. Bills Bar ist geschlossen, was bedeutet, dass es schon später als ein Uhr ist. Sie dürften ungefähr gleichzeitig nach Hause kommen, Nora und er. Wenn er vor ihr da ist, wird er sich ein Glas Bier gönnen, denn das räumt auf nach dem Bourbon. Ein Stück weiter kommt er in die Nähe des Santa Cruz, der sich rechts von ihm dahinschlängelt, und er hört ein charakteristisches Murmeln, das anzeigt, dass der Fluss bereits Wasser führt.
Vor ihm zuckelt ein Wagen. Er traut sich nicht, ihn zu überholen, aus Furcht, von der Straße zu geraten, und wird ungeduldig. Wegen des Biers? Wegen Nora? Er kann es kaum erwarten, sich die Hände zu waschen, warm zu duschen, sich von Kopf bis Fuß einzuseifen.
Normalerweise braucht man eine halbe Stunde, um die Ranch zu erreichen; wegen des Gewitters und dieses Autos vor ihm, das nicht vom Fleck kommt, benötigt er fast eine Stunde.
Die weißen Pfosten, die ihm zeigen, dass er angekommen ist und rechts abbiegen muss, sind in dem Regen kaum zu erkennen. Der Weg führt zu mehreren Ranches. Nach zweihundert Metern ist er vom Santa Cruz versperrt, und die Scheinwerfer streichen über fließendes Wasser, über Abfälle, die mit dem Strom schwimmen.
Da das Wasser nicht sehr tief ist, lenkt er den Wagen hinein, auf der anderen Seite erklimmt er nur mühsam die Böschung. Wer weiß? Vielleicht war es Zeit. In ein, zwei Stunden wird man wohl nicht mehr hinüberkommen.
Er erahnt Pferde hinter dem Stacheldraht; ein gelber, wie durchsichtiger Leguan huscht vor den Rädern quer über die Straße.
Die Lichter rechts in der Ferne, hinter der Baumreihe, das ist das Haus der Cadys. Die Bridgerunde ist offenbar noch nicht beendet. Auch bei den Nolands brennt noch Licht, aber das ist fast jede Nacht so. Merkwürdig, dass er ihre Wagen nicht am Fluss gesehen hat. Ob sie warten, bis das Wasser höher steht? Es kommt selten vor, dass jemand die erste Welle verpasst. Nachher, wenn sie ihr Quantum getrunken haben, werden sie allesamt kommen, um das Wasser fließen zu sehen.
Vielleicht wird er auch mit Nora kommen.
Er biegt links ab. Die Durchfahrt ist schlecht, ein riesiges Schlagloch, das in einem fort zugeschüttet wird und immer wieder neu entsteht. Man muss es vorsichtig umfahren, ehe man das Tor passiert. Auf der mexikanischen Seite zucken weiterhin Blitze, der Regen fällt ebenso dicht wie in Nogales, wenn nicht dichter, doch das ferne Grollen des Donners ist kaum zu vernehmen. Das Garagentor steht offen. Sie lassen es meistens offen. Er fährt den Wagen hinein, kehrt noch einmal um, weil er das Standlicht angelassen hat. Um ins Haus zu finden, greift er nach seiner Stablampe, und im gleichen Moment, in dem er den Strahl nach vorne richtet, hört er eine Stimme:
»Pat!«
Niemand nennt ihn hier Pat, nicht einmal Nora. Zehn, zwanzig Jahre ist er nicht mehr Pat genannt worden. Schon als kleiner Junge hasste er diese Koseform.
Seltsam, er hat die Stimme erkannt, ohne sie wiederzuerkennen. Seine Brust schnürt sich zusammen, wie wenn man große Angst hat, aber im ersten Moment versteht er nicht, weshalb.
Jemand ist da, eine Gestalt, die sich nicht vor dem Unwetter zu schützen sucht. Das ist kein Hinterhalt. Die Gestalt verharrt reglos, beide Arme am Körper. Tatsächlich steckt in dieser Haltung etwas Unterwürfiges und Bedrohliches zugleich, oder eine Gleichgültigkeit, die schon unmenschlich ist. Selbst die Kaufleute vorhin, auf der mexikanischen Seite von Nogales, machten sich die Mühe, sich im Türrahmen unterzustellen.
Er hat bereits verstanden. Es ist unmöglich, und doch weiß er, es ist so. Auch er möchte einen Namen aussprechen, einen Vornamen, er wagt es nicht, blickt sich entsetzt um, darauf gefasst, jeden Augenblick Noras Scheinwerfer auftauchen zu sehen.
»Wie hast du das gemacht?«
»Ich würde gern etwas essen. Ist das möglich?«
»Weiß jemand davon?«
»Nein. Nur Emily.«
»Hast du sie gesehen?«
»Ich bin über Los Angeles gefahren, um sie zu besuchen.«
»Und niemand …?«
»Niemand hat mich erkannt.«
Als er aus der Garage trat, hatte er den Hausschlüssel in der Hand, denn die beiden Dienstmädchen schlafen zu Hause. Sonntags kommen sie ohnehin nie. Dort ist die Tür, drei Meter vor ihm. Das Wasser rinnt den beiden Männern über Kopf und Schultern. Aber er rührt sich nicht, er steht wie gelähmt, und der andere wartet, ohne ihn zu drängen.
»Wie hast du es bis hierher geschafft?«
»Irgendwie. Emily hat mir alles Geld gegeben, das sie flüssig hatte. Ich bin mit dem Bus gefahren. In Phoenix habe ich zwei Tage in einem Drugstore gearbeitet. Danach bin ich per Anhalter weiter.«
»Hat dir Emily meine Adresse gegeben?«
»Ja.«
»Wie hast du das Haus gefunden?«
»Ich warte schon vier Stunden auf dich.«
»Hast du mit Nachbarn gesprochen?«
»Mit niemand, keine Bange.«
»Wie hast du es dann geschafft?«
Diese Tür, die so nahe ist, er bräuchte sie nur aufzustoßen und er wäre in Sicherheit, und doch kann er sich nicht dazu entschließen! Dabei darf sie Nora auf keinen Fall im Regen, in der Dunkelheit antreffen. Er hat die Lampe noch in der Hand, aber er richtet den Strahl auf den Boden.
»Emily hat mir den Namen deiner Ranch gesagt, und dass das in Tumacacori sei, zwischen Tucson und der Grenze.«
»Hat sie dir geraten herzukommen?«
»Nein. Der Fahrer, der mich hergebracht hat, hat mich an einem Lokal nördlich der Straße abgesetzt.«
»Hast du in dem Lokal von mir gesprochen?«
»Ich habe zuerst versucht, dich anzurufen, aber es ist niemand ans Telefon gegangen.«
Es läuft P.M. kalt über den Rücken. Was wäre geschehen, wenn Nora im Haus gewesen wäre und den Hörer abgenommen hätte?
»Danach habe ich die Frau gefragt, der das Lokal gehört, ob sie deine Ranch kennt. Ohne deinen Namen zu nennen. Als wäre ich jemand, der Arbeit sucht.«
»Was hat sie gesagt?«
»Sie hat mir freundlich gesagt, ich könnte es versuchen, die Leute blieben aber nicht lange bei dir. Ich habe mich im Dunkeln auf die Suche gemacht. Ich habe Hunger.«
Die Stimme klingt monoton, nicht wütend, nicht ungeduldig, aber auch nicht unterwürfig. Es dauert eine ganze Weile, bis P.M. den Strahl seiner Stablampe auf das Gesicht des Mannes richtet.
Was hat er erwartet? Er hat ein gewöhnliches Gesicht vor sich, nicht besonders hager, mit noch runden Zügen und sehr lebhaften Augen, und auf den Backen findet sich keine Spur von dem beunruhigenden Dreitagebart der Herumtreiber.
»Emily hat mir ein Rasiermesser gegeben. Ich habe mich das letzte Mal noch heute Nachmittag in Tucson rasiert.«
Er trägt ein weißes Hemd, wie P.M., und eine Hose, die trotz des Regens nicht schäbig wirkt.
»Was hast du vor?«
»Erst einmal essen. In Tucson hatte ich kein Geld mehr. Zu dumm! Ich hatte ein paar Dollars in meinem Taschentuch, und ich habe sie verloren. Vielleicht habe ich sie mir stehlen lassen, als ich aus dem Bus gestiegen bin.«
Er bricht in ein kurzes, trockenes Lachen aus, das P.M. nicht an ihm kennt.
»Komm.«
Er ist kurz davor, sich eines Besseres zu besinnen, ihn zu den Ställen zu führen, ihm zu essen zu bringen, ihm zu sagen, er solle sich in der Nacht davonmachen, damit Nora …
»Danach fährst du mich nach Mexiko. Mildred und die Kinder sind schon dort.«
»Und wo?«
»In Nogales. Sie erwarten mich.«
»Was sagst du, Mildred …?
»Ja.«
»Hast du sie in Iowa besucht?«
»Nein.«
»Woher weiß sie, dass du …?«
»Wir haben alles während der Besuchszeiten vereinbart. Ich konnte nicht mehr. Ich musste mit ihnen leben.«
»Aber …«
»Ich habe Hunger, Pat.«
Schließlich dreht er den Schlüssel im Schloss, und das umso heftiger, als er das Gefühl hat, ein Motorengeräusch aus der Richtung der Cadys zu hören.
»Bist du nicht verheiratet? Emily hat mir gesagt …«
»Meine Frau wird jeden Augenblick zurücksein.«
Er macht Licht. Die Vorhalle hinter den Moskitonetzen ist geräumig und kühl, dahinter kommt das Wohnzimmer mit den mächtigen Ohrensesseln, wie er sie sich immer gewünscht hat.
»Komm.«
Ehe er die Küche betritt, kehrt er zur Tür zurück. Drei Wagen haben das Haus der Cadys verlassen, und alle drei fahren zum Fluss: Er hat es vorausgesehen. Alle wollen den Wasserstand begutachten, bevor sie schlafen gehen.
»Pass auf. Nenn mich bitte nicht mehr Pat.«
»Wie denn?«
»Hier nennt mich jeder P.M.«
Er mag diese Abkürzung. Als kleiner Junge hat er gelesen, dass sich die großen Bosse von New York, die Bankiers, die Geschäftsleute, nur mit ihren Initialen anreden lassen.
»Was wirst du deiner Frau erzählen?«
»Ich weiß es nicht. Wäre ich früher zurückgekommen, hätte ich dich heute Abend fahren können.«
»Nach Mexiko?«
Sein Begleiter ist bleich geworden, vergisst darüber, in den Kühlschrank zu schauen, dem P.M. einen halben Schinken entnimmt. In den Fächern stehen auch Bierflaschen und Ale, bei deren Anblick P.M. seinerseits unsicher wird, heftig schließt er die Tür.
»Ich hole dir Wasser. Warte. Es ist so gut wie unmöglich, dass ich dich heute Abend fahre.«
»Wieso? Mildred wartet drüben mit den Kindern.«
»Im Hotel?«
Er hat Angst, einmal mehr. Hat sie ihren richtigen Namen angegeben?
»Der Fluss schwillt an. Ich laufe Gefahr, dass ich auf dem Rückweg festsitze.«
Wenn er doch nur ein paar Stunden, nur eine Stunde Zeit hätte. Aber Nora wird kommen. Wer weiß, vielleicht wird sie noch Freunde auf einen letzten Drink mitbringen, wie das öfter vorkommt.
»Stell mir jetzt keine Fragen. Bist du sicher, dass man dich nicht erkannt hat?«
»Man hätte mich wohl festgenommen, oder?«
Natürlich. Dumme Frage.
»Wissen die Leute hier Bescheid?«, fragt der Mann. »Deine Frau?«
»Nein.«
»Ich dachte es mir.«
»Wäre dir lieber, ich hätte es ihr gesagt?«
Es gibt Augenblicke, da werden die Stimmen schärfer, aber immer wieder hat sich der Mann im Zaum, stets jedoch mit demselben Mangel an Unterwürfigkeit.
»Hast du kein Gepäck?«
Achselzucken.
»Was könnte ich ihr erzählen? Warte! Du bist ein Jugendfreund … Na ja, ein alter Bekannter …«
»Verstehe.«
»Jemand, den ich seit langem aus den Augen verloren habe …«
»Ja …«
»Am schwierigsten dürfte zu erklären sein, weshalb du keinen Wagen hast.«
»Tut mir leid.«
»Irgendwie musst du schließlich gekommen sein.«
»Freunde …«
»Natürlich. Freunde, die nach Mexiko fahren. Du wolltest auf ein paar Stunden bei mir vorbeischauen.«
»Ich werde mich daran halten.«
»Moment. Du stößt in Nogales wieder zu ihnen … Nein! Sie würden unter irgendeiner Adresse erreichbar sein, einem Hotel, und wir könnten sie anrufen.«
Die Angst lässt seine Knie zittern, und er lauscht durch den prasselnden Regen nach einem Motorengeräusch. Er ist überhaupt nicht mehr betrunken. Er war nicht betrunken. Dennoch muss er nach Alkohol riechen, und er hält Abstand von seinem Begleiter.
»Das Wasser steigt. Vielleicht ist es bis morgen wieder gefallen. Dann können wir fahren.«
»Und wie?«
»Wir werden schon sehen. Unterbrich mich nicht ständig.«
»An der Grenze haben sie wahrscheinlich einen Steckbrief und ein Foto von mir. Ich habe gedacht, über die Berge …«
»In den Bergen gibt es berittene Patrouillen.«
»Eben noch hast du gesagt …«
»Sie kommt. Sei ruhig. Du heißt … Warte …
Eric … Eric Bell …«
»Wie du willst.«
»Nenn mich P.M. Kannst du das behalten?«
»Aber sicher.«
»Wirf die Schinkenreste hier rein. Wir haben ein Gästezimmer. Du …«
»Ja?«
Die Frage, die P.M. stellen möchte, schnürt ihm die Kehle zusammen, und die Zeit drängt, draußen sind tatsächlich Motorengeräusche zu hören.
»Und … Seitdem du raus bist, hast du keinen …?«
»Ich habe nur Wasser und Cola getrunken.«
Er wischt sich erleichtert über die Stirn.
»Setz dich. Mach dir eine Zigarette an.«
»Ich habe keine.«
Er reicht ihm eine Schachtel.
»Mach ein natürliches Gesicht. Nora ist …«
Während er noch das passende Wort sucht, hört man die Tür schlagen und Stimmen in der Halle.
»Bist du da?«
Sie sind zu mehreren, ebenfalls durchnässt, denn sie haben den Fluss von nahem sehen wollen und sind aus den Wagen gestiegen, die Cadys und Mrs Pope mit ihrem Hund unter dem Arm, dazu die Nolands, die sie unterwegs aufgelesen haben.
»Kommt rein, Kinder. Moment, ich hole zu trinken. Guck an! Du hast …«
Nora ist vor dem Unbekannten stehen geblieben, der in einem Sessel des Wohnzimmers sitzt und zu dessen Füßen sich bereits eine Wasserlache bildet.
»Ein Bekannter, Eric Bell. Das heißt, ein alter Freund. Stell dir vor …«
Plötzlich fällt ihm ein, dass er sich die Hände nicht gewaschen hat, und die Erinnerung an den mexikanischen Hügel macht ihn unsicher.
»Bell ist auf ein paar Stunden vorbeigekommen, aber ich glaube …«
»Es werden auf jeden Fall ein paar Tage«, erwidert sie ohne die geringste Schärfe.
Sie öffnet die Schrankbar, und P.M. würde sie am liebsten daran hindern.
»Ich hoffe, er hat Sachen dabei, um sich umzuziehen. Der Fluss wird von Minute zu Minute breiter. Als wir ankamen, konnte man schon nicht mehr hinüber. Die Pembertons hätte es fast auf der anderen Seite erwischt. Cady behauptet …«
»Ich wette, das dauert eine Woche«, fällt ihr Cady ins Wort. »Ich habe soeben den Wetterdienst angerufen. In der Sonora hat es richtige Wasserhosen gegeben.«
»Wie ist nochmal sein Name?«
»Eric Bell.«
»Sind Sie zum ersten Mal hier im Tal, Mr Bell?«
»Ja.«
»Sie werden sehen, wir blasen hier nicht Trübsal, selbst wenn uns der Santa Cruz absperrt. Scotch? Bourbon?«
»Nein, danke.«
»Bier?«
»Nein, danke.«
»Nein! Wirklich nicht?«
»Mein Freund war schwer krank und darf keinen Alkohol trinken«, schaltet sich P.M. ein.
»Wenn das so ist, bestehe ich natürlich nicht darauf. Ihr andern, ihr bedient euch. Habt ihr wenigstens Vorräte?«
»Genug Konserven, um locker acht Tage durchzuhalten.«
»Und zu trinken?«
»Uns fehlt nur Bier«, erwidert Mrs Cady. »Harry wollte heute Nachmittag ein paar Kästen besorgen. Die Smileys sind vorbeigekommen und haben uns bis sechs Uhr aufgehalten. Danach war es zu spät.«
»Wir geben euch einen Kasten ab. Hat jemand Hunger?«
Das kann jetzt bis fünf, sechs Uhr morgens gehen. Es gibt Schinken, Käse, Konserven. Nora hat vier, fünf Flaschen und Gläser auf den Tisch gestellt.
Jeder kennt sich im Haus aus, geht in die Küche, um sich mit Eis oder Brot zu versorgen.
»Die Pembertons kommen bestimmt guten Tag sagen.«
Weiß Gott! Und die anderen auch, all die, die den Fluss ansehen möchten. Wenn sie bei den Ashbridges Licht sehen und Wagen vor der Tür, werden sie hereinschneien, als wären sie hier wie zu Hause.
»Bourbon? Scotch?«
»Nur keine Umstände!«





























