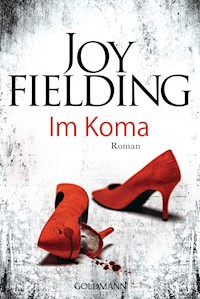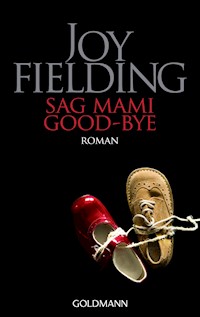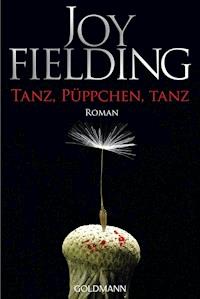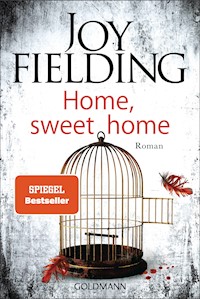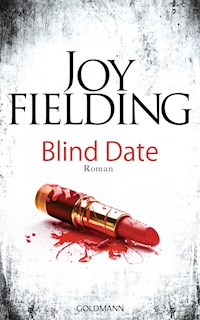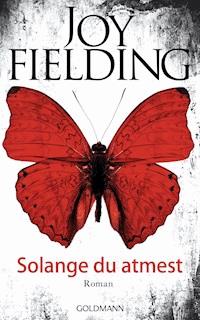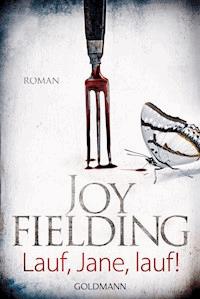SONDERANGEBOT
SONDERANGEBOT
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
-100%
Sammeln Sie Punkte in unserem Gutscheinprogramm und kaufen Sie E-Books und Hörbücher mit bis zu 100% Rabatt.
Mehr erfahren.
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Die Familientherapeutin Kate Sinclair war sich bisher ihres erfüllten Familienlebens gewiss. Doch dass ihre siebzehnjährige Tochter zu rebellieren beginnt, ihre Mutter die Umwelt im Alterswahn terrorisiert und Kates Ehe kriselt, ist erst der Anfang einer wahren Höllenfahrt. Denn eines Tages verkündet ihre Halbschwester Jo Lynn, dass sie heiraten wird – einen Mann, der wegen Mordes an 13 Frauen vor Gericht steht. Kate und ihre Familie werden in das dunkle Spiel des Psychopathen hineingezogen, bis das Schicksal aller an einem seidenen Faden hängt...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 634
Veröffentlichungsjahr: 2010
0,0
Bewertungen werden von Nutzern von Legimi sowie anderen Partner-Webseiten vergeben.
Legimi prüft nicht, ob Rezensionen von Nutzern stammen, die den betreffenden Titel tatsächlich gekauft oder gelesen/gehört haben. Wir entfernen aber gefälschte Rezensionen.
Ähnliche
Das Buch
Bis vor kurzem noch war Kate Sinclair stolz auf ihr geregeltes Leben. Ihr Erfolg als Psychotherapeutin, eine lange, glückliche Ehe, zwei gesunde Töchter und ein hübsches Heim im sonnigen Palm Beach sprachen dafür. Dann aber zeigen sich Risse in ihrer perfekten Welt: Die siebzehnjährige Tochter beginnt mit aller Gewalt gegen sie zu rebellieren. Ihre Mutter terrorisiert im Alterswahn die Umwelt. Und ihr Mann zieht sich unmissverständlich auf den Golfplatz zurück. Aber der wahre Alptraum beginnt für sie, als ihre exzentrische Halbschwester vor aller Welt verkündet, sie werde demnächst einen Mann heiraten, der wegen Mordes an dreizehn Frauen vor Gericht steht. Ohne es zu wissen, sind Kate und ihre ganze Familie längst in ein diabolisches Spiel verwickelt, dessen Regeln im Hochsicherheitsgefängnis von Florida festgelegt werden. Und schließlich hängt alles nur noch am seidenen Faden …
Autorin
Joy Fielding gehört zu den unumstrittenen Spitzenautorinnen Amerikas. Seit ihrem Psychothriller „Lauf, Jane, lauf“ waren alle ihre Bücher internationale Bestseller. Joy Fielding lebt mit ihrem Mann und zwei Töchtern in Toronto, Kanada, und in Palm Beach, Florida.Weitere Informationen unter www.joy-fielding.de
Mehr von Joy Fielding:
Solange du atmest • Die Schwester • Sag, dass du mich liebst • Das Herz des Bösen • Am seidenen Faden • Im Koma • Herzstoß • Das Verhängnis • Sag Mami Goodbye • Nur der Tod kann dich retten • Träume süß, mein Mädchen • Tanz, Püppchen, tanz • Schlaf nicht, wenn es dunkel wird • Nur wenn du mich liebst • Bevor der Abend kommt • Zähl nicht die Stunden • Die Katze • Ein mörderischer Sommer • Lebenslang ist nicht genug • Schau dich nicht um • Lauf, Jane, lauf!
Alle auch als E-Book erhältlich.
Joy Fielding
Am seidenenFaden
Roman
Aus dem Amerikanischen
von Mechthild Sandberg-Ciletti
Inhaltsverzeichnis
Das Buch
Die Autorin
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Copyright
1
Wieder ist eine Frau verschwunden.
Sie heißt Millie Potton und wurde das letzte Mal vor zwei Tagen gesehen. Der Zeitung zufolge ist Millie groß und schlank und hinkt etwas. Sie ist vierundfünfzig Jahre alt, was nicht überrascht. Nur Frauen über fünfzig haben heutzutage noch Namen wie Millie.
In dem kurzen Bericht auf Seite drei des Lokalteils der Palm Beach Post heißt es, daß sie zuletzt gesehen wurde, als sie im Bademantel die Straße hinunterging. Die Nachbarin, die sie gesehen hat, fand daran offenbar nichts Besonderes. Millie Potton, heißt es weiter, leide seit langem an Zuständen geistiger Verwirrung, was wohl bedeuten soll, daß diese Zustände an ihrem Verschwinden schuld sind und wir uns deshalb nicht weiter Gedanken darüber machen müssen.
Mehr als zwei Dutzend Frauen sind in den letzten fünf Jahren in der Gegend von Palm Beach verschwunden. Ich weiß es, weil ich die Fälle verfolgt habe, nicht bewußt zunächst, aber als sie sich allmählich zu häufen begannen, setzte sich eine ungefähre Zahl in meinem Bewußtsein fest. Die Frauen sind zwischen sechzehn und sechzig Jahre alt. Einige hat die Polizei als Ausreißerinnen abgetan, vor allem die jungen Mädchen wie Amy Lokash, siebzehn Jahre alt, die eines Abends um zehn bei einer Freundin wegging und danach nie wieder gesehen wurde. Andere Fälle, und zweifellos wird der Millie Pottons zu ihnen zählen, hat man aus diversen unbestreitbar logischen Gründen ad acta gelegt, obwohl die Polizei sich bei Amy Lokash getäuscht hatte.
Aber solange nicht irgendwo eine Leiche gefunden wird, in einem Müllcontainer hinter dem Burger King Restaurant wie die von Marilyn Greenwood, 24, oder mit dem Gesicht nach oben in einem Sumpf bei Port Everglades treibend wie Christine McDermott, 33, kann die Polizei im Grunde nichts tun. Behauptet sie jedenfalls. Frauen, so scheint es, verschwinden einfach immer wieder.
Es ist still im Haus heute morgen. Alle sind weg. Ich habe viel Zeit, meinen Bericht auf Band aufzuzeichnen. Ich nenne es einen Bericht, aber eigentlich ist es nichts so klar Definiertes. Es ist eher eine lose Folge von Erinnerungen, wenn auch die Polizei mich gebeten hat, so präzise und systematisch wie möglich vorzugehen, darauf zu achten, daß ich nichts auslasse, ganz gleich, wie unbedeutend – oder wie persönlich – es mir erscheinen mag. Sie werden entscheiden, was wichtig ist und was nicht, haben sie mir erklärt.
Ich weiß nicht recht, was das Ganze für einen Sinn haben soll. Was geschehen ist, ist geschehen. Ich kann das Rad nicht zurückdrehen und den Lauf der Dinge verändern, so sehr ich mir das wünschte. Ich habe versucht einzugreifen, solange es noch möglich schien, aber ich habe gegen Windmühlenflügel gekämpft. Ich wußte es damals schon. Ich weiß es heute. Es gibt nun mal Dinge, über die wir keine Macht haben – das beste Beispiel dafür ist das Verhalten anderer. So wenig es uns gefällt, wir müssen die anderen ihren eigenen Weg gehen, ihre eigenen Fehler machen lassen, auch wenn wir das heraufziehende Verhängnis schon in aller Klarheit sehen. Sage ich nicht genau das stets meinen Klienten?
Es ist natürlich viel einfacher, gute Ratschläge zu geben, als sie selbst zu befolgen. Vielleicht ist das einer der Gründe, weshalb ich Familientherapeutin geworden bin, obwohl es gewiß nicht der Grund war, mit dem ich mich damals um die Aufnahme ins College bewarb. Ich schilderte vielmehr, wenn mich mein Gedächtnis nicht im Stich läßt, was es leider mit zunehmender Häufigkeit tut, meinen intensiven Wunsch, anderen zu helfen, meinen Ruf unter Freunden, ein Mensch zu sein, dem man sich stets mit all seinen Schwierigkeiten anvertrauen könne, meine persönlichen Erfahrungen mit einem dysfunktionalen Familiensystem, obwohl es das Wort dysfunktional zu der Zeit, als ich 1966 mein Studium aufnahm, noch gar nicht gab. Heute ist es so geläufig, so sehr Teil der Alltagssprache, daß schwer vorstellbar ist, wie wir so lange ohne es auskommen konnten, obwohl es ja im wesentlichen gar nichts sagt. Was ist denn letztlich Dysfunktion? Welche Familie hat keine Probleme? Ich bin sicher, meine eigenen Töchter könnten Ihnen da einiges erzählen.
Also, wo soll ich anfangen? Das fragen meine Klienten immer, wenn sie das erstemal zu mir kommen. Mit argwöhnischen Blicken treten sie in meine Praxis, die sich in der zweiten Etage eines vierstöckigen pillenrosa Gebäudes am Royal Palm Way befindet, lassen sich an ihrem Ehering drehend auf der äußersten Kante der grau-weißen Polstersessel nieder, die Lippen erwartungsvoll geöffnet, die Zunge schon gespitzt, um ihrer Wut, ihren Ängsten, ihrer Unzufriedenheit Ausdruck zu geben, und das erste, was ihnen über die Lippen kommt, ist stets die gleiche Frage: Wo soll ich anfangen?
Im allgemeinen fordere ich sie auf, mir das Ereignis zu schildern, das sie bewogen hat, mich aufzusuchen, den sprichwörtlichen Tropfen, der das Faß zum Überlaufen brachte. Sie überlegen ein paar Sekunden, dann beginnen sie langsam, bauen ihre Beweisführung auf wie ein neues Haus, schichten wie Bausteine Detail auf Detail, immer eines auf das andere, eine Demütigung neben die andere, empfundene Kränkung über unterschwellige Drohung, und schließlich sprudeln die Worte nur so hervor, daß ihnen kaum Zeit bleibt, sie alle im begrenzten Raum einer Stunde unterzubringen.
Ich habe eine Baumetapher gewählt – das würde Larry amüsieren. Larry ist der Mann, mit dem ich seit vierundzwanzig Jahren verheiratet bin, er ist Bauunternehmer. Einen guten Teil der spektakulären neuen Häuser, die überall in Palm Beach County an den Golfplätzen aus dem Boden schießen, hat er gebaut. Die beruflichen Möglichkeiten waren der angebliche Grund, daß wir vor sieben Jahren von Pittsburgh hierher, nach Florida, gezogen sind, aber ich habe immer den Verdacht gehabt, daß hinter Larrys Drängen, hierherzuziehen, zumindest teilweise der Wunsch stand, meiner Mutter und meiner Schwester zu entkommen. Er bestreitet das, aber da es für mich der Hauptgrund war, dem Umzug zuzustimmen, habe ich seinem Leugnen niemals recht geglaubt. Doch es erübrigt sich, darüber zu streiten, da meine Mutter uns kaum ein Jahr später folgte, und wenige Monate danach auch meine Schwester.
Meine Schwester heißt Jo Lynn. So wird sie jedenfalls genannt. Getauft wurde sie auf den Namen Joanne Linda. Aber unser Vater rief sie Jo Lynn, als sie noch ein Kind war, und der Name ist ihr geblieben. Er paßt zu ihr. Sie sieht aus wie eine Jo Lynn, groß und blond und vollbusig, mit einem ansteckenden Lachen, das irgendwo tief in ihrer Kehle beginnt und schließlich wie goldflirrender Blütenstaub ihren Kopf umschwebt. Selbst die honigsüße schleppende Sprechweise, die sie sich angewöhnt hat, seit sie in Florida lebt, wirkt bei ihr passender, echter irgendwie, als die platten kühlen Töne des Nordens, in denen sie sich den größten Teil ihrer siebenunddreißig Jahre ausgedrückt hat.
Ich sagte vorhin, unser Vater. Tatsächlich war er nur Jo Lynns Vater, nicht meiner. Mein Vater starb, als ich acht Jahre alt war. So wie meine Mutter es mir erzählte, stand er eines Tages vom Eßtisch auf, um sich ein Glas Milch zu holen, bemerkte beiläufig, er habe plötzlich höllische Kopfschmerzen, und lag im nächsten Moment tot auf dem Boden. Ein Aneurysma, stellte der Arzt später fest. Meine Mutter verheiratete sich im folgenden Jahr wieder, und Jo Lynn wurde im Jahr darauf geboren, wenige Wochen nach meinem zehnten Geburtstag.
Mein Stiefvater war ein gewalttätiger und manipulativer Mensch, der sich mehr auf seine Fäuste als auf seinen Verstand verließ, sofern man annehmen will, daß er überhaupt Verstand besaß. Ich bin überzeugt, es ist ihm zu danken, daß Jo Lynn sich ihr Leben lang gewalttätige Männer suchte, auch wenn er zu ihr, die ganz klar sein Liebling war, immer sehr zärtlich war. Seine Wut ließ er an meiner Mutter aus. Mich bedachte er hin und wieder mit ein paar gutplacierten Kopfnüssen, sonst ignorierte er mich meistens. Wie dem auch sei, meine Mutter verließ ihn, als Jo Lynn dreizehn war. Ich war damals schon aus dem Haus und mit Larry verheiratet. Mein Stiefvater starb im folgenden Jahr an Bauchspeicheldrüsenkrebs. Jo Lynn war die einzige von uns, die um ihn trauerte.
Und heute weine ich um meine Schwester, wie ich das im Lauf der Jahre so oft getan habe. Strenggenommen ist sie natürlich nur meine Halbschwester, und die zehn Jahre Altersunterschied in Verbindung mit ihrem sprunghaften Verhalten haben es uns schwergemacht, einander nahezukommen. Aber niemals werde ich den Morgen vergessen, an dem meine Mutter mit ihr aus dem Krankenhaus kam. Mit dem kleinen goldenen Bündel im Arm trat sie zu mir und legte es mir behutsam in die Arme. Jetzt, sagte sie, hätte ich ein richtiges Baby, das ich mit ihr zusammen versorgen könne. Ich erinnere mich, daß ich oft stundenlang an Jo Lynns Kinderbett stand, wenn sie schlief, und aufmerksam nach sichtbaren Zeichen des Wachstums Ausschau hielt, während aus dem Säugling unaufhaltsam ein Kleinkind wurde. Sie war ein so bezauberndes Kind, so eigenwillig und voller Selbstvertrauen, mit der unerschütterlichen Gewißheit des kleinen Kindes, in allem absolut recht zu haben, daß es mir noch heute schwerfällt, dieses Bild mit dem Menschen in Einklang zu bringen, der dann aus ihr geworden ist, eine verlorene Seele, einer jener Menschen, die ziellos durch das Leben irren, immer überzeugt, daß Glück und Erfolg gleich hinter der nächsten Ecke warten. Nur daß sie immer wieder von ihrem Weg abkam, vergaß, in welche Richtung sie eigentlich wollte, um die falsche Ecke bog und in einer Sackgasse landete.
Manchmal erinnert mich meine ältere Tochter Sara an sie, die auch alles auf dem Weg bitterer Erfahrung lernen muß, und das macht mir angst. Vielleicht ist das der Grund, warum ich ständig etwas an ihr auszusetzen habe, wie sie erklärt. Das heißt, Sara erklärt nie etwas – sie brüllt einfach los. Sie ist der Meinung, daß man bei einer Auseinandersetzung nur gewinnen kann, wenn man immer wieder dasselbe sagt, nur jedesmal lauter als zuvor. Wahrscheinlich hat sie recht; entweder gibt man am Ende nach oder man läuft schreiend aus dem Zimmer. Ich habe beides häufiger getan, als ich gern zugebe. Meine Klienten wären mit Recht entsetzt.
Sara ist siebzehn und knapp einen Meter achtzig groß. Sie hat wie Jo Lynn große grüne Augen und einen Wahnsinnsbusen. Ich weiß nicht, woher sie den hat. Um ehrlich zu sein, ich weiß eigentlich nicht einmal, wie ich zu ihr gekommen bin. Manchmal, wenn sie mitten in einer ihrer Tiraden ist, starre ich sie an und frage mich: Ist den Leuten im Krankenhaus vielleicht ein Irrtum unterlaufen? Kann dieses hochgewachsene, großäugige, großbusige Geschöpf, das da vor mir steht und kreischt wie ein Jochgeier, wirklich meine Tochter sein? Es gibt Tage, da sehe ich sie an und denke, daß sie das schönste Geschöpf auf Gottes Erdboden ist. Dann wieder gibt es Tage, da finde ich, daß sie aussieht wie Patricia Krenwinkel. Sie erinnern sich an sie – sie gehörte zu Charles Mansons Mörderbande, eine minderjährige Killerin mit finsterem Gesicht, das lange braune Haar in der Mitte gescheitelt, in den Augen einen Blick, der leer ist und doch unversöhnlich, der gleiche Blick, den ich manchmal in Saras Augen sehe. Sara trägt Sachen, die ich vor fünfundzwanzig Jahren ausrangiert habe, diese formlosen, durchsichtigen indischen Gewänder, die ich längst fürchterlich finde. Ganz anders Michelle, meine Vierzehnjährige, die nur Markenkleidung trägt und jeden Familienkrach aufmerksam aus der Kulisse verfolgt, um später ihren Kommentar dazu zu geben wie ein spilleriger, pubertärer griechischer Chor. Oder eine zukünftige Familientherapeutin.
Ist das der Grund, warum ich relativ wenig Schwierigkeiten mit meiner jüngeren Tochter habe? Möchte ich, wie meine Große unzählige Male behauptet hat, daß jeder so ist wie ich? »Ich bin nicht du«, brüllt sie mich an. »Ich bin ein eigener Mensch.« Und habe ich sie nicht genau dazu erzogen? War ich auch so rebellisch, so ungezogen, so schlichtweg ekelhaft? frage ich meine Mutter, die rätselhaft lächelt und mir versichert, ich sei vollkommen gewesen.
Jo Lynn, fügt sie müde hinzu, war da ganz anders.
»Ich wünsch dir eine Tochter, die genauso ist wie du«, höre ich noch heute meine Mutter erbittert Jo Lynn zurufen, und mehr als einmal mußte ich mir auf die Zunge beißen, um nicht das gleiche zu meiner Tochter zu sagen. Aber ob nun aus Trotz oder Furcht, meine Schwester ist in drei gescheiterten Ehen kinderlos geblieben, und die Tochter, die Jo Lynns Ebenbild ist, wurde mir beschert. Ich finde das ungerecht. Ich war diejenige, die sich immer an die Regeln gehalten hat, die, wenn sie überhaupt rebellierte, dies innerhalb der vorgeschriebenen Grenzen tat. Ich machte die Schule fertig, ich studierte, ich rauchte nicht, ich trank nicht, ich nahm keine Drogen und heiratete den ersten Mann, mit dem ich je geschlafen hatte. Jo Lynn hingegen fing ihr Studium nur an, um es gleich wieder an den Nagel zu hängen, und war früh und häufig mit Männern zugange. Ich wurde Familientherapeutin; sie wurde der Alptraum jeder Familientherapeutin.
Warum ich das alles so ausbreite? Sind das denn Dinge, die die Polizei für relevant halten wird? Ich weiß es nicht. Um die Wahrheit zu sagen, ich weiß eigentlich überhaupt nichts mehr. Mein ganzes Leben erscheint mir wie eines dieser Riesenpuzzles, für die man ewig braucht, um dann, gerade wenn man zum Ende kommt, wenn man meint, endlich alles richtig zu haben, zu entdecken, daß alle Schlüsselteile fehlen.
Mit dem Alter kommt die Weisheit; ich erinnere mich deutlich, das in meiner Jugend gehört zu haben. Ich glaube es aber nicht. Mit dem Alter kommen Falten, wollte man wohl sagen. Und Blasenprobleme und Arthritis und Hitzewellen und Gedächtnisschwund. Ich komme mit dem Alter nicht sehr gut zurecht, was mich überrascht, da ich immer überzeugt war, ich wäre eine der Frauen, die einmal mit Würde alt werden. Aber die Würde geht einem leicht verloren, wenn man alle zehn Minuten zur Toilette rennen muß und jedesmal, wenn man sich gerade fertig geschminkt hat, einen Schweißausbruch bekommt.
Alle sind jünger als ich. Mein Zahnarzt, meine Ärztin, die Lehrer und Lehrerinnen meiner Töchter, meine Nachbarn, die Eltern der Freundinnen meiner Kinder, meine Klienten. Selbst die Polizeibeamten, die mich befragten, sind alle jünger als ich. Es ist merkwürdig, weil ich immer das Gefühl habe, jünger zu sein als alle anderen, und dann stelle ich fest, daß ich nicht nur älter bin, sondern Jahre älter. Und ich bin die einzige, die das überrascht.
Es passiert mir immer wieder. Ich mache mich zurecht, fühle mich glänzend, finde, ich sehe großartig aus, und dann sehe ich unerwartet mein Spiegelbild in einem Schaufenster und denke, wer ist denn das? Wer ist diese alte Schachtel? Das kann doch nicht ich sein. Ich habe doch nicht solche Säcke unter den Augen; das sind doch nicht meine Beine; das ist doch nicht mein Hintern. Es ist wirklich erschreckend, wenn das Selbstbild nicht mehr dem Bild entspricht, das man im Spiegel sieht. Und es ist noch erschreckender, wenn man merkt, daß andere Menschen einen kaum noch wahrnehmen, daß man unsichtbar geworden ist.
Vielleicht erklärt das die Geschichte mit Robert.
Wie sonst könnte ich sie erklären?
Na bitte, jetzt ist es schon wieder soweit, ich schweife ab, komme vom Hundertsten ins Tausendste. Larry behauptet, das täte ich dauernd. Ich erkläre, daß ich mich langsam zum springenden Punkt vorarbeite; er behauptet, ich wolle ihn umgehen. Wahrscheinlich hat er recht. Zumindest in diesem Fall.
Gleich wird mich wieder eine Hitzewelle packen. Ich weiß es, weil ich eben dieses gräßliche Beklemmungsgefühl hatte, das diesen Wallungen immer vorausgeht, so ähnlich, als hätte mir jemand ein Glas Eiswasser die Kehle hinuntergeschüttet. Es füllt meine ganze Brust und sammelt sich in einer kalten Lache um mein Herz. Eis, dem Feuer folgt. Ich weiß nicht, was schlimmer ist.
Anfangs glaubte ich, diese Beklemmungsgefühle hätten mit dem Chaos um mich herum zu tun. Ich gab meiner Mutter die Schuld, meiner Schwester, Robert, dem Prozeß. Allem und jedem. Aber allmählich wurde mir klar, daß dieser überfallartigen Angst jedesmal unverzüglich alles überschwemmende Hitzewellen folgten, die von meinem Bauch zu meinem Kopf hochschwappten und mich schwitzend und atemlos zurückließen, als wäre ich in Gefahr zu implodieren. Ich kann es kaum fassen, wie stark diese Anfälle sind, wie ohnmächtig ich ihnen gegenüber bin, wie wenig ich mein eigenes Leben im Griff habe.
Mein Körper hat mich verraten; er folgt einem eigenen geheimen Fahrplan. Ich trage jetzt eine Lesebrille; meine Haut verliert ihre Geschmeidigkeit und knittert wie billiger Stoff; um meinen Hals ziehen sich Ringe wie die Altersringe eines Baums. Unerwünschte Gewächse wuchern in mir.
Kürzlich war ich zu einer Vorsorgeuntersuchung. Bei der Routineuntersuchung der Gebärmutter entdeckte Dr. Wong, die klein und zierlich ist und aussieht wie höchstens achtzehn, mehrere Polypen, die, wie sie sagte, entfernt werden müßten. »Wie sind die dahin gekommen?« fragte ich. Sie zuckte die Achseln. »So was passiert, wenn wir älter werden.« Sie ließ mir die Wahl: Ich könne einen Termin für eine Operation mit Narkose in einigen Wochen haben, oder sie könne die Wucherungen sofort herausschneiden, gleich hier, in ihrer Praxis, ohne Betäubung. »Wozu raten Sie mir?« fragte ich, von beiden Möglichkeiten wenig begeistert. »Wie hoch ist Ihre Schmerzschwelle?« entgegnete sie.
Ich entschied mich dafür, die Polypen gleich entfernen zu lassen. Ein paar Minuten starker Krämpfe, fand ich, wären einer Narkose, einem Eingriff, gegen den ich immer schon eine Abneigung hatte, vorzuziehen. Die ganze Sache war, wie sich erwies, relativ einfach und dauerte keine zehn Minuten, in denen die Ärztin mir klar und deutlich und detaillierter, als mir im Grunde lieb war, erklärte, was sie tat. »Jetzt werden Sie vielleicht gleich das Gefühl haben, dringend zur Toilette zu müssen«, sagte sie, Sekunden bevor mein Bauch sich in einer Folge von Krämpfen zusammenzuziehen begann.
Als Dr. Wong fertig war, hielt sie mir einen kleinen Glasbehälter vor die Nase. Darin befanden sich zwei kleine rote Kügelchen, ungefähr von der Größe großer Preiselbeeren. »Sehen Sie«, sagte sie beinahe stolz. »Das sind Ihre Polypen.«
Zwillinge, dachte ich benommen, dann brach ich in Tränen aus.
Ich sollte zwei Wochen später bei ihr anrufen, um nachzufragen, ob es Probleme gäbe. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, ob ich es getan habe. Ich war mitten drin in diesem ganzen Wahnsinn. Es ist durchaus möglich, daß ich es vergessen habe.
Drüben auf der anderen Straßenseite tut sich was. Ich kann es von meinem Fenster aus sehen. Ich sitze an meinem Schreibtisch im Arbeitszimmer, einem kleinen Raum voller Bücher im vorderen Teil des Hauses. Ob die Polizei wohl eine Beschreibung des Hauses haben möchte? Ich werde auf jeden Fall eine beifügen, obwohl sie das Haus bestimmt bestens kennen. Sie waren oft genug hier; sie haben genug Fotos gemacht. Aber der Ordnung halber: Das Haus ist ein relativ großer Bungalow mit sechs Zimmern. Die Zimmer der Mädchen sind rechts von der Haustür, unser Schlafzimmer ist links hinten. Dazwischen sind der Salon und das Eßzimmer, vier Badezimmer und ein großer offener Raum mit Küche, Frühstücksecke und dem Wohnzimmer, dessen Rückwand aus einer Reihe großer Fenster und Glasschiebetüren mit Blick auf den nierenförmigen Swimmingpool im Garten besteht. Die Räume sind hoch, an den Decken verteilt sind Ventilatoren wie der, der sich gerade leise summend über meinem Kopf dreht; die Böden sind aus Keramikfliesen. Nur die Schlafzimmer und das Arbeitszimmer sind mit Teppich ausgelegt. Die vorherrschende Farbe ist Beige, mit Akzenten in Braun, Schwarz und Pflaumenblau. Larry hat das Haus gebaut; ich habe es eingerichtet. Es sollte unsere Zuflucht sein.
Ich glaube, ich weiß, was drüben, auf der anderen Straßenseite, vorgeht. Es passiert nicht das erste Mal. Mehrere große Jungen schikanieren zwei kleinere, damit sie zu uns herüberlaufen und an die Tür klopfen. Die Großen lachen, machen sich über die Kleinen lustig, puffen und stoßen sie, nennen sie herausfordernd Feiglinge. Ihr braucht nur zu läuten und sie zu fragen, kann ich sie hören, obwohl außer ihrem grausamen Gelächter kein Laut mich erreicht. Na los, läutet bei ihr, dann lassen wir euch in Ruhe. Die beiden Kleinen – ich glaube, der eine ist der sechsjährige Ian McMullen, der am Ende der Straße wohnt – straffen die Schultern und fixieren das Haus. Noch ein Stoß, und sie stolpern vom Bürgersteig auf die Fahrbahn, schleichen den Gartenweg herauf, die kleinen Finger schon zum Läuten ausgestreckt.
Und dann sind sie plötzlich weg, rennen wie gejagt die Straße hinunter, obwohl die großen Jungen sich bereits abgewandt haben und in der anderen Richtung davonlaufen. Vielleicht haben sie bemerkt, daß ich sie beobachte; vielleicht hat jemand sie gerufen; vielleicht hat am Ende doch die Vernunft gesiegt. Wer weiß? Was immer sie auch veranlaßt hat, kehrtzumachen und davonzulaufen, ich bin froh darüber, obwohl ich schon halb aus meinem Sessel aufgestanden bin.
Das erstemal passierte es, kurz nachdem die Geschichte auf den Titelseiten erschienen war. Die meisten Leute waren sehr zurückhaltend, aber es gibt immer einige, die mit dem, was sie zu lesen bekommen, nicht zufrieden sind, die mehr wissen wollen, die der Meinung sind, sie hätten ein Recht darauf. Die Polizei hat es geschafft, uns die meisten dieser Leute vom Leib zu halten, aber ab und zu ist es kleinen Jungen wie diesen doch gelungen, zu unserer Haustür vorzudringen.
»Was wollt ihr denn?« höre ich mich in der Erinnerung fragen.
»Ist es hier passiert?« erkundigen sie sich mit nervösem Gekicher.
»Was denn?«
»Sie wissen schon.« Pause, sensationslüsterne Blicke, Versuche, an meiner unverrückbaren Gestalt vorbeizuspähen. »Können wir mal das Blut sehen?«
Etwa zu diesem Zeitpunkt schlage ich ihnen die Tür vor den neugierigen Nasen zu, wenn ich auch zugeben muß, daß es mich auf eine perverse Art lockt, sie höflich hereinzubitten, durch das Haus nach hinten zu geleiten wie eine Fremdenführerin und mit gedämpfter Stimme auf jenes Stück Boden im Wohnzimmer hinzuweisen, das einst mit Blut bedeckt war und selbst jetzt noch, nach mehreren professionellen Reinigungen, einen Hauch feiner Röte zeigt. Wahrscheinlich werde ich diese Fliesen austauschen lassen müssen. Einfach wird es nicht werden. Die Herstellerfirma hat vor mehreren Jahren Pleite gemacht.
Also, wie ist das alles gekommen? Wann begann mein einst stabiles und gesetztes Leben außer Kontrolle zu geraten wie ein Auto ohne Bremsen, das auf einer abschüssigen Bergstraße immer schneller wird und schließlich in den Abgrund stürzt und in Flammen aufgeht? Wann genau war der Moment, als Humpty Dumpty von der Wand gefallen und in tausend kleine Stücke zersprungen ist, die keiner mehr zusammenfügen oder ersetzen kann?
Es gibt natürlich keinen solchen Moment. Wenn ein Teil deines Lebens in Stücke geht, sitzt der Rest deines Lebens nicht einfach däumchendrehend da und wartet geduldig ab, bis es weitergeht. Das Leben läßt dir nicht die Zeit, dich erst einmal zu fassen, nicht den Raum, dich auf die neuen Gegebenheiten einzustellen. Es fährt einfach fort, ein verwirrendes Ereignis auf das andere zu häufen, wie ein Verkehrspolizist, der durch die Gegend rast, um sein Kontingent an Strafzetteln zu verteilen.
Bin ich theatralisch? Vielleicht. Aber ich finde, ich habe ein Recht darauf. Ich, die immer die Zuverlässige war, die Praktische, die, die mehr Vernunft als Phantasie besitzt, wie Jo Lynn einmal behauptete, ich habe ein Recht auf meine melodramatischen Momente, finde ich.
Soll ich ganz am Anfang beginnen, mich in aller Form bekanntmachen – Guten Tag, mein Name ist Kate Sinclair? Soll ich berichten, daß ich vor siebenundvierzig Jahren an einem ungewöhnlich warmen Apriltag in Pittsburgh geboren wurde, daß ich einen Meter siebenundsechzig groß bin und sechsundfünfzig Kilo wiege, daß ich hellbraunes Haar habe und Augen, die eine Nuance dunkler sind, einen kleinen Busen und schöne Beine und ein etwas schiefes Lächeln? Daß Larry mich liebevoll Funny Face nennt, daß Robert sagte, ich sei schön?
Es wäre viel einfacher, am Ende zu beginnen, Fakten aufzuzählen, die bereits bekannt sind, die Toten zu nennen, das Blut ein für allemal wegzuwischen, anstatt den Versuch zu unternehmen, nach Motiven, Erklärungen, Antworten zu suchen, die vielleicht niemals gefunden werden.
2
Ich erinnere mich, daß es ein sonniger Tag war, einer jener prachtvollen Tage, an denen der Himmel so blau ist, daß er fast künstlich erscheint, die Luft angenehm warm, der Wind nur ein flüsternder Hauch. Ich trank den Rest Kaffee, der noch in meiner Tasse war, mit dem gleichen Genuß wie eine Kettenraucherin den Rauch ihrer letzten Zigarette einzieht, und blickte durch das hintere Fenster zu der hohen Kokospalme hinaus, die sich über das Schwimmbecken hinweg zum Terrakottadach des Hauses neigte. Es war ein Bild wie auf einer Ansichtskarte. Der Himmel, der Rasen, selbst die Baumrinden leuchteten in so kräftigen Farben, daß sie zu pulsieren schienen. »Was für ein herrlicher Tag«, sagte ich.
»Hm«, brummte Jo Lynn hinter der Morgenzeitung versteckt.
»Schau doch mal raus«, drängte ich, obwohl ich wirklich nicht wußte, wozu ich mir die Mühe machte. Suchte ich Bestätigung oder Gespräch? Hatte ich das nötig? »Sieh doch nur, wie blau der Himmel ist.«
Jo Lynns Blick hob sich kurz über den Rand des Lokalteils der Palm Beach Post. »Stell dir mal einen Pulli in dieser Farbe vor«, sagte sie träge.
So eine Antwort hatte ich nun eigentlich nicht erwartet, aber für Jo Lynn, für die die Natur immer nur Kulisse war, war sie typisch. Ich hüllte mich wieder in Schweigen, überlegte, ob ich mir noch eine Tasse Kaffee eingießen sollte, entschied mich dagegen. Drei Tassen waren mehr als genug, auch wenn mir mein Morgenkaffee noch so sehr schmeckte – mein einziges Laster, pflegte ich immer zu sagen.
Ich dachte an Larry, der seit acht mit ein paar möglichen Kunden draußen auf dem Golfplatz war. Er spielte erst seit kurzem wieder. Auf dem College hatte er ein bißchen gespielt, war ziemlich gut gewesen, wie er sagte, hatte es aber damals aufgegeben, weil er weder Zeit noch Geld dafür hatte. Jetzt, da er von beidem mehr als genug hatte und Kunden und Geschäftsfreunde ihn immer wieder zu einer Runde aufforderten, hatte er wieder damit angefangen, obwohl er es nicht ganz so entspannend fand, wie er es in Erinnerung hatte. Am vergangenen Abend hatte er fast eine Stunde lang vor dem Ankleidespiegel im Bad geübt, um den mühelos lockeren Schlag seiner Jugend wiederzufinden. »Ich hab’s gleich«, sagte er immer wieder, während ich im Bett auf ihn wartete und schließlich mit einem leichten Kribbeln der Frustration in den unteren Regionen einschlief.
Als ich aufwachte, war er schon weg. Ich stand auf, schlüpfte in einen kurzen pinkfarbenen Baumwollmorgenrock, trottete in die Küche, kochte eine große Kanne Kaffee und setzte mich mit der Morgenzeitung hin, die Larry netterweise hereingebracht hatte, ehe er losgefahren war. Die Mädchen schliefen noch und würden voraussichtlich frühestens in ein paar Stunden aufstehen. Michelle war mit ihren Freundinnen bis nach Mitternacht unterwegs gewesen. Sara hatte ich nicht einmal nach Hause kommen hören.
Ich las gerade die Filmbesprechung und schlürfte meine zweite Tasse Kaffee, als Jo Lynn aufkreuzte. Statt einer Begrüßung teilte sie mir mit, es gehe ihr mies, zum Teil, weil sie nicht gut geschlafen hatte, vor allem aber, weil sie am Abend zuvor versetzt worden war. Der Mann, mit dem sie verabredet gewesen war, ein ehemaliger Footballspieler, der jetzt Sportartikel verkaufte und Jo Lynns Behauptung zufolge wie ein Brad Pitt mit Patina aussah, hatte in letzter Minute mit der Begründung abgesagt, daß er Hals- und Gliederschmerzen habe. Sie war daraufhin allein in eine Kneipe gegangen, und wer kam zur Tür herein, frisch und munter wie ein Fisch im Wasser? Na, den Rest kannst du dir denken, sagte sie, goß sich eine Tasse Kaffee ein und ließ sich häuslich nieder.
Da war sie also, in weißen Shorts und gewagtem Oberteil, sah trotz der schlaflosen Nacht toll aus wie immer, die schulterlangen blonden Locken malerisch zerzaust – den »frisch-gefickt-Look« nannte sie es, obwohl nun wirklich nichts dergleichen passiert war, wie sie mißmutig sagte. Da geht’s dir nicht besser als mir, hätte ich beinahe gesagt, aber ich tat es nicht. Es war mir noch nie eingefallen, mit Jo Lynn über mein Liebesleben zu sprechen, zum einen, weil ich mich bei ihr nicht auf Diskretion verlassen konnte, zum anderen und vor allem, weil es da nicht viel zu erzählen gab. Ich lebte seit fast einem Vierteljahrhundert in einer monogamen Beziehung. Für Jo Lynn war Monogamie gleich Monotonie. Ich hatte es längst aufgegeben, ihre Auffassung ändern zu wollen. In letzter Zeit klangen meine Worte selbst in meinen Ohren ziemlich hohl.
Jo Lynn ihrerseits war immer mehr als bereit, ja sogar begierig darauf, die Geheimnisse ihres Liebeslebens mit mir zu teilen. Plastische Details ihrer Abenteuer flossen ihr so munter von den Lippen, wie das Wasser einen Gebirgsbach hinunterplätschert. Ich versuchte immer wieder, ihr klarzumachen, daß ihr Intimleben nur sie allein etwas anging, aber das war ein Gedanke, den sie offensichtlich nicht verstand. Ich versuchte, sie daran zu erinnern, daß Reden Silber und Schweigen Gold ist; sie sah mich an, als wäre ich nicht ganz dicht. Ich versuchte, sie vor Krankheiten zu warnen; sie runzelte finster die Stirn und sah weg. Ich erklärte ihr, mich interessiere das alles nicht sonderlich; sie lachte nur. »Natürlich interessiert es dich«, pflegte sie zu widersprechen. Und natürlich hatte sie recht. »Dann sprich wenigstens nicht vor den Mädchen darüber«, bat ich, aber natürlich ohne Erfolg. Jo Lynn liebte Publikum. Sie genoß ihre Wirkung auf meine Töchter, die sie offen anhimmelten, besonders Sara. Manchmal rotteten sie sich gegen mich zusammen, machten sich über meine angeblich konservative Art lustig, redeten davon, mich in einer dieser gräßlichen Talk-Shows vorzuführen, die sie sich manchmal ansahen. »Junge Frau, Sie müssen gründlich überholt werden!« rief Jo Lynn dann wohl mit der schrillen Stimme Rolandas oder Ricki Lakes, und Sara krümmte sich vor Lachen.
»Der ist ja süß«, murmelte Jo Lynn jetzt, so tief in die Zeitung vergraben, daß ich nicht sicher war, richtig gehört zu haben.
»Was hast du gesagt?«
»Ich hab gesagt, der ist süß«, wiederholte sie, deutlicher diesmal. »Schau dir nur mal dieses Gesicht an.« Sie breitete die Zeitung auf der Glasplatte des runden Küchentisches aus. »Den Mann heirate ich«, erklärte sie.
Ich blickte auf die Titelseite des Lokalteils. Drei Männer waren zu sehen: der Präsident der Vereinigten Staaten, der zu einem Gespräch mit Lokalpolitikern nach Florida gekommen war; ein katholischer Priester, der einer geplanten Demonstration von Schwulen und Lesben seine Unterstützung zugesichert hatte; und Colin Friendly, des Mordes an dreizehn Frauen angeklagt, der in einem Gerichtssaal in West Palm Beach saß. Ich wagte nicht zu fragen, welchen der drei sie meinte.
»Im Ernst«, sagte sie und tippte mit langem orangelackierten Fingernagel auf das Foto des Mordverdächtigen. »Schau dir nur mal das Gesicht an. Er hat eine gewisse Ähnlichkeit mit Brad Pitt, findest du nicht?«
»Er sieht aus wie Ted Bundy«, entgegnete ich, obwohl ich gar nicht erkennen konnte, wie er aussah. Ich hatte meine Lesebrille abgenommen, und die ganze Zeitung war nur ein verschwommenes Flimmern.
»Setz deine Brille auf«, befahl sie mir und schob mir die Brille mit den Halbgläsern zu. Die körnigen schwarzen und weißen Punkte der Fotografie fügten sich augenblicklich zu einem scharfen Bild zusammen. »Was siehst du?«
»Ich sehe einen kaltblütigen Killer«, sagte ich und wollte meine Brille wieder abnehmen. Doch sie hinderte mich daran.
»Wer sagt, daß er jemanden umgebracht hat?«
»Jo Lynn, liest du eigentlich die Zeitung oder siehst du dir nur die Bilder an?«
»Ich hab den Bericht gelesen, Frau Superschlau«, versetzte sie, und mit einem Schlag waren wir beide zehn Jahre alt, »und nirgends steht ein Wort davon, daß er ein Mörder ist.«
»Jo Lynn, er hat mindestens dreizehn Frauen getötet …«
»Er wird beschuldigt, sie getötet zu haben, aber das heißt noch lange nicht, daß er es auch getan hat. Ich meine, klär mich auf, wenn ich mich täusche, aber ist das nicht der Grund für den Prozeß?«
Ich wollte protestieren, überlegte es mir dann aber anders und sagte nichts.
»Und was ist mit ›unschuldig bis zum Beweis der Schuld‹, hm?« fuhr sie fort, wie ich es geahnt hatte. Mit Schweigen war bei Jo Lynn nie etwas auszurichten.
»Du hältst ihn also für unschuldig«, sagte ich, auf eine Technik zurückgreifend, die ich oft im Gespräch mit meinen Klienten anwende. Anstatt zu widersprechen, anstatt zu versuchen, sie umzustimmen, anstatt ihnen Antworten zu liefern, die vielleicht richtig sind, vielleicht aber auch nicht, wiederhole ich ihnen einfach ihre eigenen Worte, manchmal, indem ich sie positiver formuliere, um ihnen Zeit zu geben, die Antwort selbst zu finden, manchmal nur, um ihnen zu zeigen, daß ich sie gehört habe.
»Ich halte es auf jeden Fall für sehr gut möglich. Ich meine, schau dir doch nur mal dieses Gesicht an. Es ist schön.«
Widerstrebend betrachtete ich die Fotografie. Colin Friendly saß zwischen zwei Anwälten, zwei gesichtslosen Männern, die hinter seinem Rücken miteinander konferierten, und schaute leicht vorgebeugt mit leerem Blick in die Kamera. Ich sah einen Mann Anfang dreißig mit dunkelbraunem, welligem Haar, das ordentlich aus dem feingemeißelten Gesicht gekämmt war, einem Gesicht, das ich unter anderen Umständen vielleicht als gutaussehend bezeichnet hätte. Ich wußte, weil ich schon andere Bilder von ihm gesehen hatte, daß er über einen Meter achtzig groß war, schlank, beinahe drahtig. Seine Augen waren den Berichten zufolge blau, allerdings nie einfach blau, sondern immer durchdringend blau oder tiefblau, wenn auch die Fotografie dieses Tages nichts dergleichen offenbarte. Aber es fiel mir schwer, diesen Menschen objektiv zu sehen, selbst damals schon.
»Findest du ihn nicht toll?«
Ich schüttelte den Kopf.
»Das kann nicht dein Ernst sein. Er sieht aus wie Brad Pitt, nur daß sein Haar dunkler und seine Nase länger und schmäler ist.«
Ich starrte die siebenunddreißigjährige Frau an, die mir gegenüber saß. Erst hatte sie sich angehört wie eine aggressive Zehnjährige, jetzt redete sie wie ein verknallter Teenager. Würde sie jemals erwachsen werden? Werden wir überhaupt je erwachsen? Oder werden wir nur alt?
»Okay, vielleicht sieht er Brad Pitt ja auch gar nicht so ähnlich, aber du mußt zugeben, daß er gut aussieht. Charismatisch. Ja, genau – charismatisch. Das mußt du wenigstens zugeben.«
»Tut mir leid, aber ich kann jemanden, der dreizehn Frauen und Mädchen gequält und ermordet hat, nicht toll oder charismatisch finden. Das schaff ich nicht.« Ich dachte an Donna Lokash, eine meiner Klientinnen, deren Tochter Amy vor fast einem Jahr verschwunden war; sie war ein mögliches Opfer Colin Friendlys, obwohl man bisher keine Leiche gefunden hatte.
»Du mußt die beiden Dinge auseinanderhalten«, sagte Jo Lynn, und ich hätte beinahe gelacht. Ich war diejenige, die immer predigte, man müsse Birnen und Äpfel auseinanderhalten. »Die Tatsache, daß er gut aussieht, hat nichts damit zu tun, ob er jemanden umgebracht hat oder nicht.«
»Ach nein?«
»Nein. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun.«
Ich zuckte die Achseln. »Was siehst du, wenn du ihn anschaust?« fragte ich. »Abgesehen von Brad Pitt.«
»Ich sehe einen kleinen Jungen, der verletzt worden ist.« Jo Lynns Stimme war ernst und aufrichtig.
»Du siehst einen Jungen, der verletzt worden ist«, wiederholte ich und sah Jo Lynn als kleines Mädchen vor mir, wie sie ein streunendes Kätzchen, das sie irgendwo aufgelesen hatte, zärtlich auf ihrem nackten Bauch wiegte. Sie hatte sich eine Scherpilzflechte von ihm geholt. »Wo? Wo siehst du das?«
Der knallige orangerote Fingernagel zog einen kleinen Kreis um Colin Friendlys Mund. »Er hat so ein trauriges Lächeln.«
Ich sah mir das Foto genauer an und stellte überrascht fest, daß sie recht hatte. »Findest du es nicht merkwürdig«, fragte ich, »daß er unter den gegebenen Umständen überhaupt lächelt?«
»Das ist doch nur jungenhafte Verlegenheit«, erklärte sie, als hätte sie Colin Friendly ihr Leben lang gekannt. »Ich finde es liebenswert.«
Ich stand auf, ging zur Anrichte hinüber und schenkte mir noch eine Tasse ein. Ich brauchte sie jetzt. »Können wir uns vielleicht über was andres unterhalten?«
Jo Lynn drehte sich auf ihrem Stuhl herum und hielt mir ihre Tasse hin. Sie streckte ihre langen sonnengebräunten Beine aus. »Du nimmst mich einfach nicht ernst.«
»Jo Lynn, laß uns doch jetzt nicht …«
»Laß uns nicht was? Über was reden, was mir wichtig ist?«
Ich starrte in meinen Kaffee und wünschte mich zurück ins Bett. »Das ist dir wichtig?« fragte ich.
Jo Lynn setzte sich gerade und zog ihre Beine zurück. Sie verzog ihre Lippen zu einer Bardot-Schnute, die die meisten Männer anziehend finden, die mich aber immer schon bis zur Weißglut gereizt hatte. »Ja, es ist mir wichtig.«
»Na schön, wohin soll ich das Hochzeitsgeschenk schicken?« fragte ich, bemüht, die Sache mit Humor zu nehmen.
Das kam bei Jo Lynn nicht an. »Natürlich, mach dich nur über mich lustig. Für dich bin ich ja immer nur ein Witz!«
Ich trank einen Schluck Kaffee. Es war das einzige, was mir einfiel, um zu verhindern, daß ich gleich ins nächste Fettnäpfchen trat. »Jo Lynn, was soll ich denn sagen? Was möchtest du denn?«
»Ich möchte, daß du aufhörst, so verdammt abschätzig daherzureden.«
»Entschuldige, ich war mir nicht bewußt, daß ich abschätzig bin.«
»Eben! Das ist ja das Problem. Du merkst es nie.«
Meine Fehler waren nicht gerade das Thema, das ich an diesem Morgen behandeln wollte. »Hör mal, können wir uns nicht einfach darauf einigen, daß wir unterschiedlicher Meinung sind? Es ist ein herrlicher Tag. Ich möchte ihn wirklich nicht mit einem Streit über einen Mann verschwenden, dem du nie begegnet bist.«
»Das wird sich ändern.«
»Was?«
»Ich werde ihn kennenlernen.«
»Was?«
»Ich werde ihn kennenlernen«, wiederholte sie eigensinnig. »Ich setze mich nächste Woche in diesen Gerichtssaal und werde ihn kennenlernen.«
Meine Geduld war fast erschöpft. Das war ja schlimmer als eine Auseinandersetzung mit Sara. »Du willst in den Gerichtssaal …«
»Richtig. Ich setze mich in den Gerichtssaal. Gleich am Montag.«
»Und was glaubst du, daß du damit erreichst?« fragte ich, ohne auf die leise Therapeutenstimme im Hintergrund zu hören, die mir riet, den Mund zu halten und Jo Lynn quasseln zu lassen, bis ihr einfach der Dampf ausging. »Die lassen dich doch nicht mit ihm reden.«
»Vielleicht doch.«
»Bestimmt nicht.«
»Dann setze ich mich eben einfach in den Saal und hör mir alles an. Nur um für ihn dazusein.«
»Um für ihn dazusein«, wiederholte ich fassungslos.
»Zu seiner Unterstützung, ja. Und wiederhol nicht dauernd alles, was ich sage. Das geht mir unheimlich auf den Keks.«
Ich versuchte es mit einer anderen Taktik. »Ich dachte, am Montag wolltest du auf Arbeitsuche gehen.«
»Ich bin seit zwei Wochen Tag für Tag auf Arbeitsuche. Ich habe meine Bewerbungen in der ganzen Stadt verteilt.«
»Hast du mal irgendwo mit einem Anruf nachgehakt? Du weißt, man muß hartnäckig sein.« Der Klang meiner Stimme widerte mich genauso an wie Jo Lynn, deren Gesicht Bände sprach. »Und du kannst ja weiß Gott hartnäckig sein, wenn du willst.«
»Vielleicht will ich aber nicht«, gab sie schnippisch zurück. »Vielleicht hab ich’s satt, für einen Hungerlohn für einen Haufen minderbemittelter Idioten zu arbeiten. Vielleicht mach ich mich selbständig.«
»Als was denn?«
»Das weiß ich noch nicht. Vielleicht mach ich ein Fitneßstudio auf oder eine Hundepension, irgend so was.«
Ich gab mir die größte Mühe, keine Miene zu verziehen, während ich diese Neuigkeiten zu verarbeiten suchte. Jo Lynn hatte nie in ihrem Leben einen Fitneßklub aufgesucht; sie wohnte in einem Mietshaus, in dem Haustiere nicht erlaubt waren.
»Du glaubst natürlich, ich schaff das nicht.«
»Ich bin überzeugt, du schaffst alles, was du dir vornimmst«, antwortete ich aufrichtig. Im Moment war es gerade das, was mir die größten Sorgen machte.
»Aber du findest die Idee blöd.«
»Das habe ich nicht gesagt.«
»Brauchst du auch gar nicht. Ich seh’s dir an.«
Ich wandte mich ab und sah mein Gesicht im dunklen Glas des Backrohrs. Sie hatte recht. Selbst in dem getönten Glas konnte ich erkennen, daß mein Gesicht blaß geworden war, daß meine Mundwinkel herabhingen. Es war natürlich nicht gerade von Vorteil, daß mir das Haar wie ein nasser Mop um den Kopf hing und die Tränensäcke unter meinen Augen im hellen Morgenlicht besonders gut zur Geltung kamen. »Um sich selbständig zu machen, braucht man Geld«, begann ich, wiederum die kleine Therapeutin ignorierend, die mir mit Fäusten aufs Gehirn trommelte.
»Das Geld krieg ich schon.«
»Ach ja? Woher denn? Wann?«
»Wenn Mama stirbt«, antwortete sie und lächelte so traurig wie der Killer in der Morgenzeitung.
Einen Moment war ich wie vom Donner gerührt. Hastig stellte ich meine Kaffeetasse auf die Anrichte und krampfte eine zitternde Hand in die andere. »Wie kannst du so was sagen!«
Sie begann plötzlich zu lachen. Ihr Gelächter schoß in lauten Juchzern in die Luft, die wie riesige Lassos meinen Kopf umkreisten und herabzufallen, meine Kehle zu umschlingen drohten, um mich erbarmungslos zur Decke emporzureißen, bis ich nur noch hilflos mit den Beinen strampeln konnte. »Nimm doch nicht alles gleich so ernst. Merkst du nicht, wenn jemand einen Scherz macht?«
»Einen Scherz mit der Wahrheit«, entgegnete ich und hätte mir am liebsten auf die Zunge gebissen. Unsere Mutter sagte das immer.
»Ich hab nie verstanden, was das heißen soll«, sagte Jo Lynn gereizt.
»Es heißt, daß man scherzt, aber in Wirklichkeit doch nicht scherzt. Sondern es ernst meint.«
»Ich weiß, was es heißt«, sagte sie.
»Ist ja auch egal«, versetzte ich. »Mama ist erst fünfundsiebzig, und es geht ihr bestens. Ich würde mich an deiner Stelle nicht darauf verlassen, daß sie so bald das Zeitliche segnet.«
»Bei ihr konnte ich mich noch nie auf was verlassen«, sagte Jo Lynn.
»Wo kommt denn das plötzlich alles her?« fragte ich.
Jetzt war es Jo Lynn, die mich ungläubig anstarrte. »So war es immer. Wo bist du eigentlich die ganze Zeit gewesen?«
»Und wie lang soll das so weitergehen? Du bist erwachsen. Wie lange willst du ihr noch Vorwürfe machen für Dinge, die sie vor zwanzig Jahren vielleicht getan oder nicht getan hat?«
»Du brauchst es gar nicht so herunterzuspielen!«
»Ja, was zum Donnerwetter hat sie dir denn angetan?«
Jo Lynn schüttelte den Kopf, schob das blonde Haar zurück und zupfte an dem goldenen Ring, der in ihrem rechten Ohr hing. »Nichts. Sie hat alles richtig gemacht. Sie war die perfekte Mutter. Vergiß es einfach.« Wieder schüttelte sie den Kopf. Das blonde Haar fiel ihr wieder ins erhitzte Gesicht. »Das ist nur PMS-Geschwätz.«
Das konnte mich nicht besänftigen. »Hast du mal dran gedacht, daß es so was wie PMS gar nicht gibt und du eben einfach so bist?«
Jo Lynn kniff die Augen zusammen und starrte mich an, als dächte sie ernsthaft daran, über den Tisch zu springen und mir eine runterzuhauen. Dann weiteten sich ihre Augen plötzlich, die orange gemalten Lippen öffneten sich, und sie lachte wieder, nur war das Gelächter diesmal echt und herzlich, und ich konnte einstimmen.
»Das war echt komisch«, sagte sie, und ich genoß dankbar ihr unerwartetes Wohlwollen.
Das Telefon läutete. Es war unsere Mutter. Wie auf Kommando. Als hätte sie unser Gespräch gehört. Als wüßte sie über unsere geheimsten Gedanken Bescheid.
»Sag ihr, daß wir gerade über sie gesprochen haben«, flüsterte Jo Lynn so laut, daß man nicht umhin konnte, sie zu hören.
»Wie geht es dir, Mama?« sagte ich statt dessen und sah sie vor mir, wie sie am anderen Ende am Telefon saß, schon geduscht und angezogen, das kurze, gelockte Haar, das ihr schmales Gesicht umgab, frisch gekämmt, in den dunkelbraunen Augen blitzende Vorfreude auf den kommenden Tag.
Ihre Stimme war im ganzen Zimmer zu hören. »Glänzend«, erklärte sie. Das sagte sie immer. Glänzend – Jo Lynn sprach das Wort lautlos mit. »Und wie geht es dir, Kind?«
»Gut, danke.«
»Und den Mädchen?«
»Oh, denen geht es bestens.«
»Und mir auch«, rief Jo Lynn laut.
»Oh, ist Jo Lynn bei dir?«
»Ja, sie ist auf eine Tasse Kaffee vorbeigekommen.«
»Grüß sie von mir«, sagte unsere Mutter.
»Grüß zurück«, sagte Jo Lynn trocken.
»Hör mal, Kind«, fuhr meine Mutter fort, »ich rufe an, weil ich das Rezept für den Pfirsenkuchen nicht mehr finden kann. Hast du vielleicht eine Kopie davon?«
»Pfirsenkuchen?« wiederholte ich.
»Ja«, sagte sie. »Du weißt doch, ich habe dir erst vor ein paar Wochen einen gebacken, und er hat dir so gut geschmeckt.«
»Ach, du meinst den Pfirsichkuchen?«
»Ja«, antwortete sie. »Hab ich was andres gesagt?«
»Du hast … Ach, laß. Es ist nicht wichtig. Ich schau nachher gleich mal nach und ruf dich dann zurück. Ist dir das recht?«
Einen Moment blieb sie still. »Ja, aber laß mich nicht zu lange warten.« Ein Anflug von Erregung hatte sich in ihre Stimme geschlichen.
»Ist irgend etwas?« fragte ich und dachte, lieber Gott, laß alles in Ordnung sein. Schon begann der Tag sich zu trüben, der Himmel zusehends blasser zu werden.
»Nein, nein«, beruhigte sie mich eilig. »Es ist nur wegen Mr. Emerson von nebenan. Er ist mir aus irgendeinem Grund böse. Ich habe keine Ahnung, warum, aber er war in den letzten Tagen ziemlich unfreundlich, weißt du.«
»Unfreundlich? Inwiefern denn?« Ich kannte Mr. Emerson, einen liebenswürdigen, weißhaarigen alten Herrn, ein wenig gekrümmt vom Alter, aber immer noch gewandt und umgänglich. Seit meine Mutter vor zwei Jahren in das Palm Beach Lakes Seniorenheim übergesiedelt war, lebte er in dem Apartment neben dem ihren. Er war der ideale Nachbar, rücksichtsvoll, freundlich, im Vollbesitz seiner geistigen und körperlichen Kräfte. Er näherte sich allerdings den Neunzigern, da konnte natürlich alles mögliche geschehen.
»Ich wollte ihm einen Pfirsichkuchen backen, als Friedensangebot«, fuhr meine Mutter fort. »Aber jetzt kann ich das Rezept nicht finden.«
»Ich seh nach, ob ich es habe, und ruf dich später an«, versprach ich ihr. »Mach dir inzwischen keine Gedanken. Was es auch sein mag, er wird mit der Zeit darüber wegkommen.«
»Wieviel Zeit hat er denn noch?« scherzte meine Mutter, und ich lachte.
»Sag ihr, daß ich heirate«, rief Jo Lynn, als ich gerade auflegen wollte.
»Was? Sie heiratet wieder?«
»Du wirst begeistert sein von ihm«, sagte Jo Lynn, während ich meiner Mutter hastig zuflüsterte, es sei nur ein Scherz.
Jo Lynn war wütend. Wieder kniff sie die grünen Augen zusammen. »Wieso hast du das gesagt? Warum mußt du sie immer schonen?«
»Warum mußt du sie immer verletzen?«
Eine Ewigkeit, wie mir schien, starrten wir einander wortlos an, und unsere unbeantworteten Fragen hingen wie Staubkörnchen zwischen uns in der Luft. Was ist nur los mit dir? hätte ich sie am liebsten angeschrien. Du willst doch diesen Colin Friendly nicht im Ernst kennenlernen? Hast du nicht endlich genug davon, dich von egoistischen Männern mißbrauchen zu lassen? Wen willst du eigentlich bestrafen?
»Hey, was ist denn hier los?« klang es irgendwo hinter uns verschlafen. Als ich mich umdrehte, sah ich Sara mit bloßen Füßen in die Küche trotten. Ihr Amazonenkörper steckte in einem blauseidenen Hemdchen und Boxershorts. In meinem Hemdchen und meinen Boxershorts, erkannte ich und begriff, warum ich die Sachen seit Wochen vergeblich suchte. Die Augen unter ihrem langen wirren Haar kaum geöffnet, tastete sie sich wie eine Blinde mit ausgestreckten Armen zum Kühlschrank vor, öffnete die Tür. Sie nahm den Karton mit dem frischgepreßten Orangensaft heraus und hob ihn an die Lippen.
»Bitte, laß das«, sagte ich so ruhig wie möglich.
»Mach keinen Streß«, entgegnete sie, einen dieser wunderbaren Teenagerausdrücke benutzend, die ich hasse wie die Pest.
»Im Schrank stehen Gläser«, sagte ich.
Sara stellte den Saft ab, und machte den Schrank auf, nicht ohne dabei demonstrativ die Augen zu verdrehen. »Also, was war das hier vorhin für ein Krach? Ihr habt so laut gelacht, daß ich davon aufgewacht bin.«
Im ersten Moment hatte ich keine Ahnung, wovon sie sprach. Es schien so lange her zu sein.
»Deine Mutter hat tatsächlich mal was Komisches gesagt«, erklärte Jo Lynn, als wäre ich normalerweise ein Ausbund an Humorlosigkeit. »Es war was über PMS. Wie war es gleich wieder?«
»Na ja, das ist nicht auf meinem eigenen Mist gewachsen«, schränkte ich ein. »Ich hab’s mal in einer Comedy-Sendung gehört.«
»Und was war es?« Sara füllte das hohe Glas mit Orangensaft, spülte ihn geräuschvoll in einem Zug hinunter und stellte dann Karton und leeres Glas auf die Anrichte.
»Moment mal!« protestierte ich. »Den Karton in den Kühlschrank, das Glas in die Spülmaschine.«
3
Der Montag kam. Ich hatte Klienten von morgens um acht bis abends um sechs, mit einer Dreiviertelstunde Mittagspause.
Meine Praxis liegt mitten in Palm Beach, nur ein paar Straßen vom Meer entfernt. Sie besteht aus zwei kleinen Zimmern und einem noch kleineren Warteraum. Die Zimmerwände sind zartrosa, die Möbel überwiegend grau. Stapel aktueller Zeitschriften füllen mehrere große Körbe zu beiden Seiten zweier gepolsterter Bänke im Wartezimmer. Ich achte darauf, stets die neuesten Ausgaben zu haben, seit einmal eine meiner Klientinnen mit Tränen in den Augen und einer Newsweek in den Händen in mein Zimmer kam und fragte, ob ich wüßte, daß Steve McQueen Krebs habe. Steve McQueen war zu diesem Zeitpunkt bereits viele Jahre tot.
Die Wände schmückt ein kunterbuntes Sortiment von Bildern: eine Schwarzweiß-Fotografie von einem Eisbären, der mit seinem Jungen spielt; ein Aquarell von einer Frau, die im Schatten eines riesigen Banyanbaums sitzt und liest; eine Reproduktion von einem weltberühmten Toulouse-Lautrec-Plakat – Jane Avril, das Bein zum Tanz erhoben. Im Hintergrund plätschert klassische Musik, nicht zu laut, aber hoffentlich laut genug, um die manchmal erhobenen Stimmen hinter den geschlossenen Türen meines Zimmers zu übertönen.
Drinnen sind drei grauweiße Polstersessel um einen rechteckigen niedrigen Glastisch gruppiert. Weitere Stühle können, wenn nötig, hereingeholt werden. Ein paar Grünpflanzen sind da, die echt aussehen, aber aus Plastik sind, da ich mit Pflanzen keine gute Hand habe und es eines Tages leid war, immer wieder zusehen zu müssen, wie die echten welkten und starben. Außerdem schienen mir die welken Pflanzen symbolisch gesehen ein schlechtes Licht auf meine therapeutischen Fähigkeiten zu werfen.
Auf dem Couchtisch habe ich immer eine kleine Schale Kekse, einen großen Schreibblock und eine noch größere Schachtel Papiertücher. In einer Ecke ist eine Videokamera, mit der ich manchmal Sitzungen aufzeichne – natürlich nur mit Erlaubnis der Klienten. An der Wand hinter meinem Kopf hängen eine Uhr und mehrere Drucke berühmter Impressionisten: Monets Seerosen; ein friedliches Pissarro-Dorf; ein apfelwangiges Renoir-Mädchen auf einer Schaukel.
Im hinteren Zimmer sind mein Schreibtisch, das Telefon, die Akten, ein kleiner Kühlschrank, mehrere Extrastühle und eine Tretmühle, für mich ein perfektes Symbol unserer Zeit: Die Leute rennen sich die Lunge aus dem Leib und kommen doch nirgends hin. Dennoch versuche ich, mindestens zwanzig Minuten jeden Tag auf diesem gräßlichen Gerät zu verbringen. Es soll meinen Geist entspannen und gleichzeitig meine Muskeln stählen. Tatsächlich geht es mir nur auf die Nerven. Aber dieser Tage geht mir so ziemlich alles auf die Nerven. Ich schreibe es meinen Hormonen zu, die sich, wie alle Zeitschriften mir erklären, in einer ständigen Bewegung befinden. Diese Artikel gehen mir genauso auf die Nerven. Und es ist kein Trost, daß »Frauen in einem gewissen Alter«, wie die Franzosen das angeblich nennen, in den begleitenden Illustrationen stets als vertrocknete kahle Äste eines einst blühenden Baums dargestellt werden.
Wie dem auch sei, es war Montag, ich hatte den ganzen Morgen Klienten gesehen, und mein Magen sehnte knurrend das Ende der letzten Sitzung vor der Mittagspause herbei. Das Paar, das mir gegenübersaß, war hilfesuchend zu mir gekommen, weil es mit seinem vierzehnjährigen Sohn, der so trotzig und schwierig war, wie man sich das bei einem Teenager nur vorstellen kann, nicht mehr fertig wurde. Nach zwei Sitzungen hatte er sich geweigert wiederzukommen, seine Eltern jedoch blieben bei der Stange und bemühten sich tapfer um einen Kompromiß, mit dem alle leben konnten. So ein Kompromiß hat natürlich nur Erfolg, wenn alle Beteiligten sich an ihn halten, und daran dachte der Sohn der beiden überhaupt nicht.
»Er hat sich wieder heimlich rausgeschlichen, nachdem wir zu Bett gegangen waren«, berichtete Mrs. Mallory gerade, während ihr Mann steif und schweigend an ihrer Seite saß. »Wir hätten nicht einmal gemerkt, daß er weg war, wenn ich nicht aufgewacht wäre, weil ich zur Toilette mußte. Da habe ich in seinem Zimmer Licht gesehen und bin rübergegangen, um nach ihm zu sehen. Sie werden es nicht glauben, er hatte sein Bett mit Kissen ausgestopft, um den Anschein zu erwecken, er läge drin und schliefe, genauso wie in diesen Gefängnisfilmen, die man im Fernsehen sieht. Er ist morgens um drei nach Hause gekommen.«
»Wo war er?« fragte ich.
»Das hat er uns nicht gesagt.«
»Wie haben Sie reagiert?«
»Wir haben ihm gesagt, was für Sorgen wir uns gemacht haben …«
»Du hast dir Sorgen gemacht«, korrigierte ihr Mann kurz.
»Sie nicht?« fragte ich ihn.
Jerry Mallory schüttelte den Kopf. Er war ein gepflegter Mann, fast immer im dunkelblauen Anzug mit konservativ gestreifter Krawatte, während seine Frau meistens aussah, als hätte sie sich das nächstbeste Kleidungsstück übergeworfen, das gerade aus dem Wäschetrockner gefallen war. »Das einzige, was mir Sorgen macht, ist, daß eines Tages die Polizei bei uns vor der Tür stehen wird.«
»Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll.« Jill Mallory blickte von mir zu ihrem Mann, der stur geradeaus starrte. »Ich bin nur noch ein Nervenbündel. Ich kann nicht schlafen; ich schreie jeden an. Jenny hab ich heute morgen auch wieder angeschrien. Ich habe ihr dann zu erklären versucht, daß es nichts zu bedeuten hat; daß ich sie liebhabe, auch wenn ich zur Zeit dauernd herumbrülle.«
»Sie haben sich also selbst die Erlaubnis gegeben, sie weiterhin anzuschreien«, sagte ich so behutsam wie möglich. Sie sah mich an, als hätte ein Pfeil ihr Herz durchbohrt.
Jill, Jerry, Jenny, Jason, leierte ich im stillen herunter und fragte mich, ob diese Folge von Js bewußt gewählt war. Jo Lynn, fügte ich unwillkürlich hinzu. Sofort sah ich sie in einem vollen Gerichtssaal in West Palm Beach sitzen und hoffte doch gleichzeitig, sie sei so vernünftig gewesen, zu Hause zu bleiben.
»Gibt es nicht ein Mittel, Jason zur Therapie zu zwingen?« fragte die Mutter. »Vielleicht wenn wir einen Psychiater …«
Ich erklärte ihr, daß ich das für zwecklos hielt. Jugendliche sind vor allem aus zwei Gründen schlechte Therapiekandidaten: Erstens haben sie keine Einsicht in die Ursachen ihres Handelns, und zweitens interessieren sie die Ursachen ihres Handelns gar nicht.
Als die Stunde um war und die Mallorys sich verabschiedet hatten, ging ich ins andere Zimmer, nahm mir ein Thunfischsandwich aus dem Kühlschrank und hörte meinen Anrufbeantworter ab. Sieben Nachrichten warteten auf mich: drei von Leuten, die Termine haben wollten; eine vom Studienberater an Saras Schule mit Bitte um Rückruf; zwei von meiner Mutter mit der Bitte, mich so bald wie möglich zu melden; und einer von Jo Lynn, die mir mitteilte, daß sie den ganzen Morgen beim Prozeß gewesen sei, daß Colin Friendly in natura noch besser aussehe als auf den Fotos, daß sie mehr denn je von seiner Unschuld überzeugt sei und daß ich am Mittwoch, meinem freien Tag, unbedingt mitkommen müsse, um mich mit eigenen Augen zu überzeugen. Ich schloß einen Moment die Augen, holte tief Luft und rief dann meine Mutter an.
In ihrer Stimme schwang ein Unterton der Verzweiflung, den ich an ihr nicht kannte. »Wo bist du nur gewesen?« fragte sie. »Ich habe den ganzen Morgen angerufen. Immer hat sich nur dieser blöde Anrufbeantworter gemeldet.«
»Was ist denn los, Mama? Ist was passiert?«
»Ach, es ist dieser verdammte Mr. Emerson.«
»Was ist denn mit Mr. Emerson?«
»Er behauptet, ich hätte ihn mit dem Pfirsichkuchen, den ich ihm gebacken habe, vergiften wollen. Er sagt, er sei die ganze Nacht aufgewesen und habe sich übergeben. Ich bin außer mir, wirklich. Allen im Haus erzählt er, ich hätte ihn vergiften wollen.«
»Ach, Mama, das tut mir aber leid. Ich kann mir vorstellen, wie enttäuscht du bist. Da hast du dir extra solche Mühe gemacht.« Ich stellte sie mir vor, wie sie, über die Arbeitsplatte in ihrer kleinen Küche gebeugt, die Pfirsichscheiben in ordentlichen Reihen auf dem Teig anordnete. »Denk einfach nicht daran. Es nimmt ihn bestimmt keiner ernst.«
»Könntest du nicht mal mit Mrs. Winchell sprechen?« fragte sie. »Ich bin zu erregt dazu, und ich weiß, wenn du sie anrufen und ihr alles erklären würdest …«
»Ach, ich glaube nicht, daß das nötig ist, Mama.« Mrs. Winchell war die Leiterin des Altenheims, und ich hielt es für überflüssig, sie da hineinzuziehen.
»Bitte!« Wieder dieser mir so fremde, verzweifelt drängende Ton.
»Na schön. Hast du die Nummer da?«
»Die Nummer?«
»Schon gut.« Meine Mutter war offensichtlich nicht in der Verfassung, an solche Details zu denken. »Ich suche sie mir selbst raus.«
»Und du rufst gleich an?«
»Sobald ich kann.«
»Tausend Dank, Kind. Sei mir nicht böse, daß ich dir so zur Last falle.«
»Du fällst mir nie zur Last. Ich melde mich später.« Ich legte auf, biß ein paar mal in mein Brot und blätterte in meinem Adreßbuch nach Mrs. Winchells Telefonnummer. Aber vorher wollte ich noch in Saras Schule anrufen. Der Studienberater meldete sich genau in dem Moment, als mir ein Riesenstück Thunfisch am Gaumen kleben blieb.
»Sara versäumt in letzter Zeit häufig den Unterricht«, erklärte er mir ohne Umschweife. »In den vergangenen zwei Wochen hat sie viermal in Mathematik gefehlt und zweimal in Spanisch.«
Du lieber Gott, dachte ich. Geht das schon wieder los. Hatten wir das nicht erst letztes Jahr?
»Ich werde mit ihr reden«, sagte ich und kam mir vor wie eine komplette Versagerin, obwohl ich wußte, daß dies natürlich Saras Problem war und nicht meines. Eine tolle Familientherapeutin, dachte ich, während ich die letzten Bissen meines Brots verschlang, die wie schwere Klumpen in meinen Magen fielen.