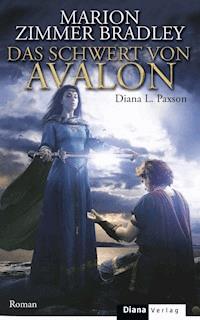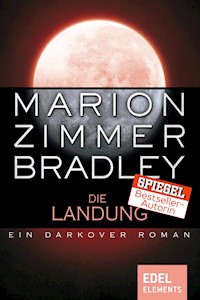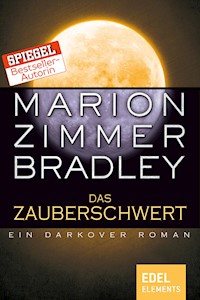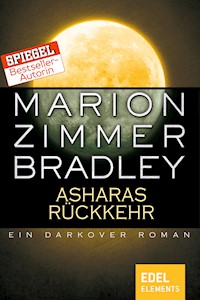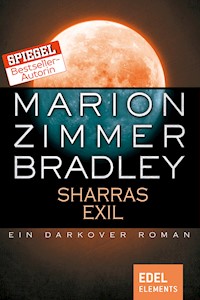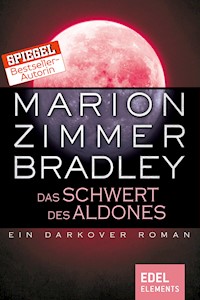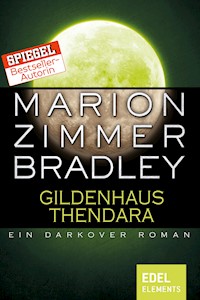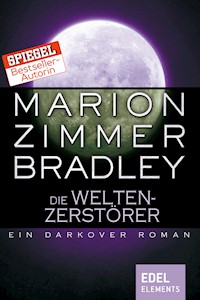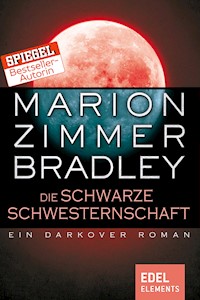Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Darkover-Zyklus
- Sprache: Deutsch
Bestsellerautorin Marion Zimmer Bradley ("Die Nebel von Avalon") hat mit dem opulenten Darkover-Zyklus eine einzigartige Romanreihe geschaffen: Die fesselnde Geschichte einer geheimnisvollen fremden Welt und ihrer Bewohner ist Kult! Ein Raumschiff der Erde taucht über Darkover auf. Und die terranischen Raumfahrer sehen sich einem Volk gegenüber, das eingebettet in Familien- und Sippenstrukturen lebt. In der rationalen Denkweise der Terraner ist kein Platz für die geheimnisvolle Kraft des Laran, die einen entscheidenden Machtfaktor auf Darkover darstellt. In den Mittelpunkt der schicksalhaften Ereignisse gerät Leonie Hastur, eine intelligente und schöne junge Frau aus der Hastur-Familie, die darüber hinaus noch über ein besonders starkes Laran verfügt. Schon zeitig befallen sie Ahnungen, dass sich auf Darkover bald alles verändern wird. Eine unvorstellbare Gefahr droht dem Planeten, doch Leonie kann sich auf ihre Träume und Visionen keinen Reim machen. Dann auf einmal schwebt ein Raumschiff über den Wäldern des friedlichen Planeten Darkover...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 521
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Marion Zimmer BradleyAn den Feuern von Hastur
Ein Darkover RomanIns Deutsche übertragen von Rosemarie Hundertmarck
Edel eBooks
Marion Zimmer Bradley – Der “Darkover”-Romanzyklus bei Edel eBooks:
Copyright dieser Ausgabe © 2014 by Edel eBooks, einem Verlag der Edel Germany GmbH, Hamburg. Copyright © 1993 Marion Zimmer Bradley Copyright First german Edition © 2001 by Droemersche Verlagsanstalt Th. Knaur Nachf., München. Die Originalausgabe erschien 1993 unter dem Titel "Rediscovery of Darkover" Ins Deutsche übertragen von Rosemarie Hundertmarck
Covergestaltung: Agentur bürosüd°, München
Konvertierung: Datagrafix
Alle Rechte vorbehalten. All rights reserved. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des jeweiligen Rechteinhabers wiedergegeben werden.
ISBN: 978-3-95530-596-3
edel.comfacebook.com/edel.ebooks
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Epilog
Ein Darkover-Roman
»Weit entfernt in der Galaxis ungefähr 4000 Jahre in der Zukunft gibt es einen Planeten mit einer großen roten Sonne und vier Monden. Willst Du nicht mitkommen
1
Ysaye? Bist du da oben?« Elizabeth Mackintosh steckte den Kopf vorsichtig in den Schacht, der den Computerkern enthielt. Sie war eine kleine, zierliche Frau, nicht eigentlich hübsch, aber von einer sanften und doch intensiven Lebendigkeit, die das Wort »hübsch« bedeutungslos machte. Sie hatte dichtes dunkles Haar und blaue Augen, lieblich und klar, und eine Stimme, die in dem widerhallenden Schacht klang, als würde sie singen. Für Computer hatte sie nicht viel übrig, und der enge Schacht mit all seinen aktivierten Komponenten vermittelte ihr ein beklemmendes Gefühl von Klaustrophobie. Sie hatte einmal zu Ysaye gesagt, in dem warmen, von winzigen roten Lichtern getupften Dunkel komme sie sich vor, als sei sie von einer Sphäre rotäugiger Dämonen umgeben. Ysaye hatte gelacht und an einen Scherz geglaubt, aber es war wahr.
»Ich bin in einer Minute fertig«, rief Ysaye Barnett hinunter. »Lass mich nur noch diese letzte Schalttafel anschließen.« Sie ersetzte die Schalttafel, an der sie gearbeitet hatte, und drückte die Fingerspitzen leicht gegen das Paneel, damit sich ihr hoch gewachsener Körper die Röhre hinunterbewegte. In der geringen Schwerkraft des Kerns war dazu kein starker Schub notwendig. Je näher sie dem Ende des Schachtes kam, desto höher wurden die ge-Zahl und ihre Geschwindigkeit. Mit vorsichtig gebeugten Knien landete sie unten neben Elizabeth. Die Schwerkraft im Computerraum betrug wie üblich 0,8 Standard, und Elizabeth klammerte sich, ebenfalls wie üblich, verzweifelt an das Geländer, das mitten durch den Raum lief. Veränderungen der Schwerkraft machten Elizabeth nervös. Sie lebte für den Tag, an dem das Schiff zu einem Planeten gelangte, auf dem sie bleiben konnte. Manchmal fragte sie sich, warum sie überhaupt in den Raum gegangen war. Aber dann hielt sie sich vor Augen, wie es auf der übervölkerten, lärmigen, techniksüchtigen Erde aussah, und sie wusste genau, dass sie niemals zurückkehren würde. Nur die sehr Reichen konnten sich auf Terra Platz und Privatleben leisten. Vom kläglichen Gehalt einer Kultur-Anthropologin hätte sie sich dort, Lichtjahre hinter ihnen, nicht einmal die Abgeschlossenheit einer winzigen Zelle der Art, die sie an Bord bewohnte, leisten können.
Ysaye dagegen war für das Leben in einem Raumschiff wie geschaffen. Sich verändernde Schwerkraftzonen waren für sie ein Spiel, so etwas wie die Version für Erwachsene vom Kästchenhüpfen. Ihr schwarzes, drahtiges Haar war in viele winzige Zöpfchen geflochten, damit es ihr nicht ins Gesicht in die Ausrüstung, mit der sie arbeitete, oder in die Ventilationsleitungen geriet. Sie hielt ihre Unterkunft so ordentlich, dass nicht einmal bei negativen ge’s etwas von seinem Platz fiel. Sie kannte die Zeitpläne, Abläufe und Notfallübungen des Schiffes vorwärts und rückwärts. Wenn man den Fähnrichen Glauben schenken konnte, war jedes Stück Information im Computer in Ysayes Kopf dupliziert und konnte ebenso schnell hier wie dort abgerufen werden.
Ein Fähnrich, der in der dritten Schicht arbeitete, behauptete sogar, der Computer wache nachts auf und rufe nach ihr. Ysaye hatte ihm mit einem Zwinkern in ihren glänzenden braunen Augen geraten, er solle mit seiner Neigung, Maschinen zu vermenschlichen, vorsichtig sein. Zwar redete sie selbst mit dem Computer, aber sie achtete darauf, es nur dann zu tun, wenn niemand sie hören konnte. Schließlich hatte sie ihren Ruf als Wissenschaftlerin zu wahren.
»Damit dürfte die kleine Macke beseitigt sein«, stellte Ysaye glücklich fest. Nichts freute sie mehr, als die Antwort auf ein Rätsel zu finden, und dieses hatte die Techniker tagelang gequält, ein in Abständen immer wieder auftretender Signalverlust von der Robotsonde, die dem Schiff in etwa einem Tag Abstand vorausflog. »Ich habe doch gleich gesagt, es müsse an unserer Hardware liegen, nicht an der Sonde. Und ich werde irgendwem die Haut dafür abziehen, dass er die vorgeschriebenen Tests, mit denen er den Fehler gefunden hätte, nicht durchgeführt hat.«
»Gibt es etwas Neues über unseren neuen Planeten?« David Lorne, Elizabeths Verlobter, betrat den Computerraum und ging vorsichtig an dem Geländer entlang auf die Frauen zu. Elizabeth streckte unwillkürlich die Hand aus, und ebenso unwillkürlich ergriff er sie. Wie eine phototropische Reaktion, dachte Ysaye. David war Elizabeths Sonne, und manchmal konnte man meinen, ohne ihn werde sie schnell welken und verblassen.
»Kein Name«, antwortete Ysaye, klickte den Bibliotheks-Modus an und tippte Befehle in die Konsole. »Auch der Stern ist nur im ungekürzten Verzeichnis zu finden. Cottmans Stern. Sechs Planeten, heißt es in der Aufzeichnung, aber ...« Sie holte ein Diagramm auf den Konsolenschirm. »... die letzten Daten unserer Scanner machen sieben daraus. Drei kleine Felsbrocken, vier große kugelige Schwämme. Der Vierte von der Sonne aus ist bewohnbar oder steht zumindest am Rand der Bewohnbarkeit. Er hat wenig schwere Metalle, aber er wäre nicht der erste besiedelte Planet, der knapp an Metallen ist. Etwas besitzt er in Massen, nämlich Sauerstoff.«
»Ist das der Planet mit den vier Monden? Das klingt so exotisch – als gebe es dort eine Menge Stoff für Balladen«, sagte Elizabeth.
»Nun, für dich klingt alles wie ein Stoff für eine Ballade«, meinte Ysaye liebevoll.
»Warum auch nicht?«, gab Elizabeth vollkommen ernst zurück. Ysaye schüttelte den Kopf. Elizabeth hatte die Gewohnheit, alles mit der einen oder anderen Ballade in Verbindung zu bringen. Natürlich war Volksmusik ihr Hobby und Anthropologie ihr Spezialgebiet, und natürlich ist sehr viel primitive Geschichte in Liedern und Balladen enthalten, aber trotzdem ... Es gab eine Grenze, wenigstens soweit es Ysaye betraf. Einmal hatte Elizabeth versucht, Ysayes Neigung, für mehrere Tage zu verschwinden, wenn sie einem Computerfehler nachspürte, mit der Entführung Toms des Reimers durch die Elfenkönigin zu vergleichen ... Ysaye hatte Wochen gebraucht, um all den Unsinn über im Kern lebende Elfen und Feen auszumerzen.
»Irgendwelche Bewohner?«, fragte David. »Oder, besser gesagt, irgendwelche Zeichen von intelligenten Lebewesen?« Sowohl für David als auch für Elizabeth war das die große Frage. Ysaye machte sich weniger daraus, denn sie gehörte zur Schiffsbesatzung. Aber David und Elizabeth wollten heiraten und eine Familie gründen, und an Bord konnten sie das nicht. Kinder durften nicht einmal auf einem Schiff reisen, falls sie mit etwas, das einem menschlichen Skelett ähnelte, groß werden sollten. Kindliche Körper sind viel zarter und zerbrechlicher, als Planetenbewohner es sich vorstellen können. Das Paar hatte noch Zeit. Beide waren ebenso wie Ysaye gleich nach Abschluss der Universität in den Raumdienst eingetreten und erst Ende Zwanzig. Theoretisch würde früher oder später ein Planet auftauchen, der entweder für die Kolonisierung oder einen Imperiumskontakt geeignet war. Dann konnten die Kontakt- und Erkundungsteams sich dort niederlassen und zwanzig Jahre oder länger bleiben. Aber nach drei Jahren mit nichts als Felsbrocken bekam es zumindest Elizabeth mit der Angst zu tun.
»Ihr seid beide Telepathen«, zog Ysaye sie auf, »sagt ihr es mir.« So hatten sie sich überhaupt kennen gelernt, als Versuchspersonen im parapsychologischen Labor der Universität. Unglücklicherweise waren die Instrumente nicht darauf eingestellt gewesen, Liebe auf den ersten Blick zu registrieren, sonst hätten sie vielleicht ein paar hochinteressante Daten bekommen. Ysaye hatte an diesem Tag als Technikerin Dienst getan und pflichtgemäß alles andere aufgezeichnet, was die Maschinen maßen. Sie hatte nie jemandem von den anderen Effekten erzählt, die sie gesehen zu haben glaubte. Schließlich war es zweifellos eine höchst subjektive Erfahrung, eine Aura zu erblicken.
Elizabeth machte überhaupt kein Geheimnis aus ihrer »Gabe« – auch wenn sie immer meinte, sich ein bisschen deswegen verteidigen zu müssen. David tat es mit einem Achselzucken ab. Wenn die Leute ihm nicht glaubten, war das ihr Problem, nicht seins. Wenn man Ysaye sehr drängte, gab sie zu, so etwas wie Intuition oder eine gelegentliche Vorahnung zu haben. Ansonsten zog sie es vor, nicht darüber zu sprechen. Sie benutzte die »unsichtbaren Dinge« und das Wissen, das ihr aus einer unbekannten Quelle zufloss, aber sie ging nicht damit hausieren.
Immer war sie so etwas wie eine Einzelgängerin gewesen, und ihr »Talent« trieb sie noch weiter in diese Richtung. Als Kind hatte sie gelernt, ihr »Wissen« in Form von Fragen an die Menschen ihrer Umgebung weiterzugeben. In ihrer Familie ließ man es Kindern nicht durchgehen, dass sie Erwachsene korrigierten, wahrscheinlich weil man davon ausging, ein Kind wisse weniger als ein Erwachsener. Doch es kam Ysaye hart an zu verbergen, was sie wusste, und so hatte sie stattdessen die Einsamkeit als ein besseres »Versteck« gewählt.
Auch ihre Intelligenz hatte sie sorgfältig hinter einer Maske kindlicher Unschuld verborgen und jeden möglichen Augenblick mit ihrem Computer verbracht. Das war für sie nicht so schwierig gewesen wie für irgendein anderes Kind. Ihre Eltern hatten sie für die Computer-Unterweisung angemeldet – »Heimschulung« wurde es genannt – statt sie in eine öffentliche Schule zu schicken. Die Werte, die in den Schulen der Erde gelehrt wurden, widersprachen ihrer religiösen Auffassung. Es mangelte den Schulen traurigerweise an Ethik und Moral, und man unterschied nicht zwischen Recht und Unrecht, ein Thema, das Ysayes Mutter besonders am Herzen lag. Im Geist hörte Ysaye immer noch, wie ihre Mutter sich entrüstete, wenn jemand in ihrer Anwesenheit eine laxe Moral oder eine verschwommene Logik verriet.
»Eine so starke Telepathin bin ich nicht«, erwiderte Elizabeth ganz ernsthaft, obwohl Ysaye doch nur gescherzt hatte. »Außerdem möchte ich, dass es dort Menschen gibt, und bin voreingenommen. Du hast keine emotionale Einstellung, Ysaye. Was meinst du? Gibt es dort Menschen?«
Weder ihre Eltern noch die Computer, mit denen Ysaye arbeitete, hatten jemals »Ich weiß es nicht« als Antwort akzeptiert. Wenn man etwas nicht gleich wusste, besorgte man sich weitere Daten. Beinahe in einem Reflex wandte Ysaye ihre Gedanken dem Planeten zu und erhielt eine Antwort, ganz ohne bewussten Einsatz ihres Willens oder Worte.
Der Planet war bewohnt, das wusste sie plötzlich. Aber sie konnte nicht erklären, wieso sie es wusste, und es auch nicht beweisen. Deshalb wich sie aus: »Wir werden es bald genug herausfinden. Euretwegen hoffe ich, der Planet ist bewohnt – obwohl ihr mir fehlen werdet, wenn ihr das Schiff verlasst. Stein und Fels haben wir jetzt oft genug gesehen. Die Leute bekommen allmählich den Isolationskoller.«
Kleine Verhaltensstörungen drohten in den letzten paar Monaten, sich zu richtigen Neurosen auszuwachsen. Ysaye war wenig davon betroffen gewesen, da sie den Großteil ihrer Zeit mit ihren geliebten Computern verbrachte. Aber gemerkt hatte sie es wohl. Jeder suchte einen Weg, wie er den anderen Mitgliedern der beiden Crews entfliehen konnte. Sogar langjährige Freunde – oder Liebende – fingen an, sich gegenseitig auf die Nerven zu gehen. »Auf jeden Fall bedeutet es wahrscheinlich ein paar Monate unten«, bemerkte David fröhlich, »selbst wenn der Planet sich als nicht bewohnt erweist. Es mag für uns nicht viel Arbeit auf unseren Spezialgebieten geben, Elizabeth, wohl aber in unseren Nebenfächern.« David Lorne war Linguist und Xenokartograf, Elizabeth Anthropologin und Meteorologin. Jeder an Bord hatte zwei oder drei Berufe – ausgenommen Ysaye und der Computer, die ein bisschen von beinahe allem taten.
»Darauf freue ich mich«, sagte Elizabeth. »Ich freue mich auf etwas Platz. Auf einen Ort, wo ich nicht dauernd gegen irgendwen anrenne. All dieses Reisen bringt uns nirgendwohin.«
»Das klingt irgendwie komisch«, neckte David sie, »vor allem, wenn man die Lichtjahre bedenkt, die wir auf diesem Schiff zurückgelegt haben.«
»Ich meine das nicht wörtlich.« Elizabeth schnitt ihm eine Grimasse. »Das weißt du doch. Bildlich gesprochen, stehen wir still, ganz gleich, wie viele Lichtjahre wir hinter uns bringen. Ich finde, soweit es uns angeht, könnten wir in den letzten drei Jahren ebenso gut auf ein einziges Gebäude in Dallas oder San Francisco beschränkt gewesen sein. Ich habe es satt, Lehrbücher und Computersimulationen zu studieren. Ich möchte mich wieder einmal mit etwas Wirklichem befassen.«
»Nun, ich hätte auch nichts dagegen, wieder beschäftigt zu sein«, gestand David mit schiefem Grinsen. »Dieses ewige Reisen durch den Raum wird allmählich langweilig. Ich hätte ebenso gut Frachtaufseher werden können. Es wird gut tun, wieder an die Arbeit zu gehen.«
An David Lorne war nichts Ungewöhnliches bis auf seine erstaunlich klaren Augen und seine Art, jedem, mit dem er sprach, gerade ins Gesicht zu sehen. Er war ein sehr ernsthafter junger Mann, dem die Haare bereits ausgingen und der älter wirkte, als er es mit seinen siebenundzwanzig Jahren war. Dabei hatte er jedoch einen subtilen und einzigartigen Sinn für Humor, den er stärker mit Elizabeth als mit sonst jemandem teilte.
»Was möchtest du wirklich da unten finden, David?«, fragte sie und war plötzlich ganz sachlich.
»Einen Planeten, der zu meinem Lebenswerk werden soll, interessante Materie, in die ich die Zähne schlagen kann«, antwortete er. »Einen Ort, den du und ich uns zu Eigen machen können. Ist es nicht das, was wir beide wollen? Eine Möglichkeit, ein Heim zu gründen und ein paar Kinder zu haben, die als Eingeborene dieser Welt aufwachsen werden – als was auch immer sie sich herausstellen mag.«
»Ich wäre froh, auf eine planetare Oberfläche hinunterzukommen, auf irgendeine Oberfläche«, stimmte Elizabeth ihm zu. »Ich bin es so müde, mich überflüssig zu fühlen. Im Raum gibt es für dich und mich kaum mehr zu tun, als Konzerte für die Crew zu geben.« Elizabeth sammelte und studierte nicht nur Balladen, sondern trug sie auch vor. Sie hatte ein umfangreiches Repertoire und spielte und sang sehr gut. Deshalb war sie für improvisierte Darbietungen im Gemeinschaftsraum ebenso begehrt wie für die fest eingeplanten Konzerte.
»Nun, es gibt gewiss genug Leute, die die Konzerte zu schätzen wissen«, sagte Ysaye lachend. »Und wir müssen doch unseren Ruf wahren! Es heißt, wir seien das einzige Schiff der Flotte, wo der Kapitän jemanden zum Chef-Ingenieur gemacht hat, weil dieser gut Oboe spielt.«
Elizabeth lachte. Kapitän Enoch Gibbons war in der ganzen Flotte des Imperiums für seine Exzentrizität bekannt. Natürlich war jeder in seiner Crew, ob er nun zur Schiffsbesatzung oder einem anderen Team gehörte, seiner Fähigkeiten wegen ausgewählt worden, aber Kapitän Gibbons fand immer qualifizierte Leute, die zufällig eine Leidenschaft für Musik hatten. Wegen der Sache mit dem Ingenieur herausgefordert, hatte er argumentiert, gute Sternenschiff-Ingenieure würden von den militärischen Colleges en gros abgegeben, wohingegen gute Oboisten selten seien. Schließlich sei die Oboe im Volksmund »das böse Holzblasinstrument, das niemand gut bläst«. Kapitän Gibbons war auch Opernsänger, und wenn jemand an Bord Italienisch, Deutsch oder Französisch nicht oder nur unzureichend beherrschte, war das seine eigene Schuld. Niemand konnte jedenfalls behaupten, nicht zumindest einem Teil des Vokabulars dieser Sprachen ausgesetzt worden zu sein. Das war eigentlich gar keine schlechte Sache, dachte Ysaye, wenn Monat auf Monat folgte, ohne dass man auf einem Planeten landete. Immer noch besser als ein Schiff voller Amateurathleten, die überschnappten bei dem Versuch, sich fit zu halten – oder eins mit eingefleischten Kampfspielern, bei denen aus dem Wettstreit Streit wurde. Das Personal auf Gibbons’ Schiff konnte die Harmonie, die ihm während einer langen Reise allmählich verloren ging, zumindest in der Musik finden.
»Es ist ja nichts verkehrt daran, Konzerte zu geben«, sagte David. »Du bist eine gute Sängerin und trägst deinen Teil dazu bei, uns alle daran zu hindern, dass wir aus Langeweile an den Nägeln kauen.«
»Gut genug für die Konzerte«, stimmte Elizabeth schüchtern zu. »Aber eine Opernsängerin bin ich nicht.«
»Da mich Opern nicht so sehr interessieren, macht mir das nichts aus«, meinte David lachend. »Und ich bezweifele, dass es in der Crew viele Opernliebhaber gibt, den Kapitän ausgenommen. Doch ich räume ein, dass jemand, der Opern so richtig hasst, nicht lange auf diesem Schiff bleiben wird.«
»Wie dein Freund Lieutenant Evans?«, forschte Elizabeth und rümpfte die Nase. Sie konnte Evans nicht leiden. Sein Benehmen stieß sie ab. David dagegen mochte ihn recht gern. Der Lieutenant hatte etwas an sich, das irgendwie störte. Ysaye hatte die Sache einmal mit den Worten abgetan: »Oh, mach dir wegen Evans keine Gedanken. Er hat eine große Karriere als Verkäufer von gebrauchten Luftwagen vor sich.« Elizabeth brachte es nicht fertig, ihn so gelassen zu betrachten.
»Davon weiß ich nichts«, protestierte David. »Sicher, er macht unfeine Bemerkungen über die Oper, aber das ist nun einmal sein Stil. So spricht er über beinahe alles.« Er schüttelte den Kopf. »Warum in aller Welt reden wir eigentlich über Musik, wenn es in wenigen Tagen einen neuen Planeten zu erkunden gibt?«
»Weil dein neuer Planet nur eine Möglichkeit und noch Tage von uns entfernt ist. Das Konzert für die Crew ist jedoch eine Gewissheit.« Elizabeth seufzte. »Es ist schwer, an etwas anderes als unseren normalen Alltag zu denken, wenn es noch Tage dauern wird, bevor wir auch nur nahe genug herankommen, um ein paar anständige Bilder von dem Planeten zu machen. Ich habe meiner Abteilung versprochen, sie eingehend zu informieren, sobald es etwas zu berichten gibt. Aber wenn es nichts gibt, gehe ich besser. Mein Dienst fängt an.«
»Gut, Liebes.« David küsste sie schnell. »Bis später.«
David und Elizabeth gingen, um ihre verschiedenen Posten aufzusuchen, und Ysaye wandte sich wieder ihrer Konsole zu. Statt jedoch etwas einzugeben, das nur mit »Daten unzureichend« beantwortet werden konnte, saß sie still da und dachte über das Rätsel des bewohnten Planeten nach.
Wer oder was mochten diese Bewohner sein? Vielleicht kannten sie die Raumfahrt noch nicht, was bedeuten würde, dass man aus dem Orbit keine Anzeichen von Zivilisation erkennen konnte, falls der Himmel auf weiten Strecken nicht so klar war, dass die optischen Instrumente hinunterspähen konnten.
Es könnte sogar eine Verlorene Kolonie sein, gegründet von einem der Verlorenen Schiffe aus der Zeit vor der Gründung des Imperiums. Das wäre faszinierend. Allerdings hatte Ysaye noch von keiner Kolonie gehört, die sich so weit draußen befand. Aber warum nicht?, sagte sie zu sich selbst. Nur weil noch nie eine gefunden worden war? Das mochte einfach daran liegen, dass noch nie jemand an der richtigen Stelle nachgesehen hatte.
Eine dieser Verlorenen Kolonien war erst letztes Jahr entdeckt worden, und einige der ganz alten Verlorenen Schiffe mussten erstaunlich weit gekommen sein, Schiffe, die vor zweitausend Jahren gestartet waren, bevor die Terraner lernten, von einer Bodenstation aus einen Kurs zu verfolgen. Später vermisste Schiffe hatte man innerhalb weniger Jahre aufgespürt. Falls sich hier also tatsächlich eine Kolonie befand, würde das Verlorene Schiff bestimmt eins der ganz frühen sein, das, lange bevor es ein Imperium gab, auf sich selbst gestellt gewesen war.
Selbst wenn ihre Ahnung falsch und der Planet unbewohnt war – nicht, dass sie das wirklich glaubte, aber bis sie einen echten Beweis hatte, war es gut, alle Möglichkeiten zu bedenken –, hatte er doch eine günstige Position für einen Transfer-Raumhafen, denn er lag in der Nähe des Punktes, wo sich die Spiralarme der Galaxis vereinigten, plus oder minus rund eine Milliarde Meilen. Falls er also bewohnbar war und sich David und Elizabeth bereit erklärten, ihre Nebenberufe auszuüben, würde es hier für ihr ganzes Leben Arbeit genug geben, sofern die maßgeblichen Stellen den Bau eines solchen Raumhafens anordneten.
Es läutete zum Schichtwechsel. Der Cheftechniker, der die nächste Wache hatte, trat ein und schritt mühelos über das Schwerkraftgefälle auf das Terminal zu. Ysaye trug sich aus, er trug sich ein, und sie verließ den Computerraum.
Auf dem Weg den Korridor hinunter streckte sie die schmerzenden Muskeln und stellte fest, dass ihre Schultern, Arme und Hände verkrampft und steif waren. Offenbar hatte sie mehr Zeit zusammengekrümmt damit verbracht, im Kern peinlich genaue Einstellungen vorzunehmen, als ihr bewusst geworden war. Sie entschloss sich, ein bisschen umherzuwandern, bevor sie ihre Unterkunft aufsuchte.
So kam sie an die Tür mit der Aufschrift »Aussichtsraum« und trat ein. »Möchten Sie einen Blick auf unser neues System werfen?«, fragte ein junger Mann. Er gehörte, wie Ysaye wusste, zum wissenschaftlichen Stab des Schiffes. Deshalb würde er nur auf dem Planeten bleiben, wenn es zum Bau eines Raumhafens kommen sollte. Seine gegenwärtige Aufgabe bestand darin, den Planeten so gut wie möglich zu erkunden, bevor sie darauf landeten – und im Augenblick kam alles, was sie an Informationen erhielten, von der Sonde. »Danke, dass Sie den Fehler gefunden haben, Ysaye. Er hat uns alle verrückt gemacht«, setzte er hinzu. »Oder vielmehr, noch verrückter.«
Ysaye schüttelte den Kopf. »Das war nichts Besonderes«, wehrte sie bescheiden ab. »Wenn ich ihn nicht gefunden hätte, wäre es jemand anders gewesen.«
Der junge Mann sah sie skeptisch an, bemerkte aber nichts dazu. »Sie wissen sicher schon, dass mindestens ein Planet bewohnbar ist«, fuhr er fort, »und zwar der Vierte. Der Fünfte vielleicht auch, aber das ist ziemlich unwahrscheinlich – er ist zum größten Teil gefroren, hat das ganze Jahr Eiskappen, und das Jahr ist fünf Standardjahre lang. Nummer vier ist mit Ach und Krach bewohnbar: Ein ziemlich raues Klima, aber auf Kohlenstoff basierendes Leben wäre hier möglich. Keine größeren ungefrorenen Meere, ein einziger Kontinent. Ich möchte nicht dort leben, und ich bezweifele, dass Sie es wollen. Er ist so kalt wie Dantes Hölle. Doch er liegt eindeutig innerhalb der Grenzwerte.«
»Nicht schlecht, Haldane«, sagte Ysaye und lächelte dann. »Proben Sie Ihren Bericht für den Kapitän?«
»Sie haben es erraten«, erwiderte John Haldane fröhlich. »Oh – habe ich schon erwähnt, dass er vier Monde hat, jeder von einer anderen Farbe?«
Ysaye schüttelte den Kopf und schnalzte mit der Zunge. »Nein, die Monde hatten Sie vergessen. Sie müssen Ihr Material besser organisieren. Sind vier Monde nicht ein Rekord für einen so kleinen Planeten?«
Er nickte. Seine Aufmerksamkeit war zur Hälfte auf die Konsole gerichtet. »Da mögen Sie Recht haben. Wenn ein Planet mehr als das hat, ist er für gewöhnlich ein dicker Brocken, und die Monde sind planetenähnlich. Wie Jupiter im alten Solarsystem. Ich habe vergessen, auf wie viele Monde man sich in seinem Fall schließlich geeinigt hat. Anscheinend fing er jedes bisschen Treibgut ein, das ihm auch nur halbwegs in die Nähe kam. Aber es waren mindestens elf größere.«
Ysaye blickte auf den Schirm hinab. Der Gegenstand all ihrer Untersuchungen zeigte sich aus dieser Entfernung wenig anziehend. »Vier Monde. Hmm. Wie mag er das wohl angestellt haben?«
Haldane zuckte die Achseln. »Wer weiß? Das ist nicht mein Fachgebiet. Ich glaube, Bettmars Welt hat fünf, aber es gibt eine Grenze: Ein Planet ist nur bewohnbar, wenn die Summe der Masse aller seiner Monde geringer ist als seine eigene. Für gewöhnlich ist sie geringer als ein Fünftel. Auch die Größe der Monde hat ein Limit. Sind sie zu klein, entkommen sie dem Planeten und werden zu Asteroiden.« Haldane wies auf den Schirm. »Der weiße da liegt so ungefähr an der unteren Grenze für die Größe.«
»Elizabeth meinte, eine Welt mit vier Monden müsse allerlei Stoff für Balladen abgeben.«
Haldane justierte die Brennweite, und es war, als springe der weiße Mond sie aus dem Bildschirm an. »Ich könnte mir vorstellen, dass sie der Mythologie der Eingeborenen Seltsames antun, sofern es überhaupt Eingeborene gibt. Bei vier Monden wird die Wahrscheinlichkeit gering sein, dass sie einen Monotheismus entwickeln. Von der Oberfläche des Planeten aus muss das schon ein Anblick sein – alle in unterschiedlichen Farben. Ich habe noch nie so etwas gesehen. Es ist entschieden anomal.«
Ysaye kniff die Augen zusammen und versuchte, weitere Einzelheiten des Planeten selbst zu erkennen, aber er blieb ein in Wolken gehülltes Geheimnis. »Sind es wirklich unterschiedliche Farben, oder ist es nur ein Effekt der Sonne, der sie so aussehen lässt?«
Haldane schüttelte den Kopf. »Ihre Vermutung ist ebenso gut wie meine. Ich habe noch nie so etwas – oh, das habe ich schon gesagt. Eins jedoch weiß ich«, setzte er hinzu. »Ich wette, ganz gleich, wie fortgeschritten die Eingeborenen sind, die Monde spielen eine wesentliche Rolle in der Religion, die sie da unten haben mögen. Das tun Monde immer.«
»Wissen Sie, ob wir auf einem von ihnen landen werden?«, fragte Ysaye.
»Wahrscheinlich werden wir eine Wetterstation auf einem von ihnen errichten«, meinte Haldane. »Das wäre in jedem Fall der erste Schritt. Und wenn die Eingeborenenkultur das Raumfahrtzeitalter noch nicht erreicht hat, ist so ungefähr alles, was wir tun können, das Wetter zu beobachten. Es würde uns nicht erlaubt werden, ihr Tun in irgendeiner Weise zu beeinflussen. Primitive Völker müssen in Ruhe gelassen werden, damit sie sich auf ihre eigene Weise entwickeln können.«
»Wenn es da unten irgendeine Art von Kultur gibt, würde es sie doch schon beeinflussen, wenn wir nur auf dem Planeten landeten«, wandte Ysaye ein.
»Stimmt«, gab Haldane unbekümmert zu, »aber alles, was wir tun, bevor wir eine offizielle Einschätzung der Leute abgeben, zählt nicht. Mein Gott! Sehen Sie sich das an!« Er brach plötzlich ab und beschäftigte sich eifrig mit seinen Instrumenten. »Nein, ich kann das Bild nicht näher heranholen – die Wolken da unten sind schrecklich.«
»Was ist denn?« Ysaye beugte sich über seine Schulter, um besser zu sehen. »Zeichen von Leben? Ein Richtstrahl, der sagt: ›Hier sind wir, kommt und holt uns?‹« Als er nicht antwortete, setzte sie spöttisch hinzu: »Eine riesige Lichtwerbung von Aliens?«
»Nichts, was so eindeutig wäre«, erwiderte Haldane. »Es wirkt wie die Große Mauer von China – aber die war ein künstlich errichtetes Bauwerk. Ich habe den Verdacht, es handelt sich hier um eine natürliche Formation.«
»Wie was?«, fragte Ysaye. »Welche Art von Formation wäre groß genug, um aus dieser Entfernung gesehen zu werden? Die Sonde ist noch nicht einmal auf eine Umlaufbahn eingeschwenkt!«
»Ein Gletscher«, sagte Haldane. »Etwas, das größer ist als jeder Gletscher in einer der Eiszeiten Terras. Einer, der sich nahezu um die ganze Welt erstreckt. Ein Wall um die Welt.«
Ein Wall um die Welt? Das regte ihre Phantasie an. »Wer könnte ihn gebaut haben?«
»Niemand – es ist ein natürliches Phänomen«, behauptete Haldane überzeugt.
»Eine natürliche Formation?« Ysaye war skeptisch.
»Warum nicht?«, gab er zurück. »Die Große Mauer auf der Erde kann mit geeigneter Vergrößerung vom Mond aus gesehen werden. Es hat sogar einmal eine Diskussion gegeben, ob die Große Mauer von den Chinesen eigens zu diesem Zweck errichtet wurde und die Gesellschaft, die sie gebaut hat, auf einen prätechnischen Stand zurücksank – oder meine ich posttechnisch?«
»Ob Sie nun das eine oder das andere meinen«, warnte Ysaye ihn, »ich würde Ihnen nicht raten, diese spezielle Theorie dem Kapitän vorzutragen. Haben Sie seine Standardansprache über ›die Pseudowissenschaft der Psychokeramik‹ noch nicht gehört?«
»Schon mehrere Male«, gestand Haldane und wand sich. »Nun gut: In Anbetracht des scheußlichen Klimas, das dort unten herrscht, vermute ich, dass dieses Gebilde natürlichen Ursprungs ist, aber ich kann mir dessen nicht sicher sein. Vielleicht wurde es auch von dort lebenden intelligenten Lebewesen erbaut oder ist von einem früheren Besuch intelligenter Lebewesen übrig geblieben. Es könnte durchaus ein Modell des sprichwörtlichen glotzäugigen Monsters für den Schulunterricht sein. Oder sogar ein Kunstwerk.«
»Genug der Theorien.« Ysaye lachte. »Gibt es irgendwelche Spuren von Verkehr auf einem der Monde?«
»Nichts Offensichtliches«, antwortete Haldane. »Jedenfalls nichts, was die Sonde feststellen kann. Wir haben Fußabdrücke und ein Sortiment Müll auf unserem Mond hinterlassen, aber es ist noch zu früh, um hier nach Vergleichbarem Ausschau zu halten. Wenn wir gründlich suchen, finden wir vielleicht eine weggeworfene Bierdose oder dergleichen, und das wäre auch ein Beweis. Ah, sehen Sie! Die Wolken verziehen sich.«
Er stellte an seinen Instrumenten herum, bis der Gletscher genau in der Mitte des Betrachters lag. »Wenigstens kann er als Markierungspunkt für eine Landung dienen, obwohl das Terrain dort ziemlich rau und gebirgig sein muss. Der Sauerstoffgehalt ist höher als normal, so dass der Hyper-Himalaja dort immer noch erstiegen werden könnte, ob Sie es glauben oder nicht. Falls einem so etwas gefällt. Ich persönlich denke, wenn Gott gewollt hätte, dass wir Berge ersteigen, hätte er uns Hufe und Kletterhaken anstelle von Händen und Füßen gegeben.«
»Von wem könnte er erstiegen werden?«, fragte Ysaye zweifelnd. »Glauben Sie, der Planet ist bewohnt?«
Haldane zuckte die Achseln. »Kann man von hier aus nicht sagen. Das kann man von hier aus nicht beurteilen, es sei denn, er wäre stark industrialisiert, und das scheint nicht der Fall zu sein. Sollten wir feststellen, dass er bewohnt ist, werden wir wohl auf einem der Monde eine Wetterstation errichten und nach Hause gehen, ohne die Leute zu stören.«
»Und wenn es eine Verlorene Kolonie ist?« Warum habe ich das gefragt?, wunderte Ysaye sich. Sie hatte den Gedanken schon einmal verworfen, und hier war er wieder, tauchte auf und gab ihr ein vage unbehagliches Gefühl.
»Ich weiß es nicht«, sagte er unsicher. »Es gibt keine festen Vorschriften für den Umgang mit Verlorenen Kolonien. Jedesmal, wenn wir auf eine gestoßen sind, war die Situation unterschiedlich. Sie sind wir – und doch sind sie nicht wir, wenn Sie verstehen, was ich meine.«
»Eigentlich nicht«, antwortete Ysaye. »Aber wie stehen die Chancen?«
Haldane schüttelte den Kopf. »Es ist sehr unwahrscheinlich. Aber ich weiß, dass der Verbleib von einigen Schiffen immer noch nicht aufgeklärt ist. Eine komische Vorstellung, dass wir in einem solchen Fall für die Leute nur Legenden wären. Oder vielleicht eine Religion – ich möchte zu gern wissen, was dabei, gemischt mit vier Monden, herauskäme! Wären wir wiederkehrende Götter oder etwas Scheußliches aus der schwärzesten Nacht?«
»Wahrscheinlich Götter. Wenn dies entgegen aller Wahrscheinlichkeit eine Verlorene Kolonie wäre, würde es Elizabeth glücklich machen«, stellte Ysaye fest. »Legenden sind ihr Job, und Religion ist es in gewissem Sinn auch.«
John Haldane lachte. »Ich kann es mir richtig vorstellen. Sie und Elizabeth werden die Göttinnen sein, die eine schwarz, die andere weiß.« Er verbeugte sich vor ihr, legte die Hände auf die Brust. »Oh, große Himmelsgöttin der Nacht, höre die Gebete deines demütigen Dieners! Sie würden niemals mehr aufs Schiff zurückkehren wollen. Sie hätten hunderte von heiratsfähigen jungen Männern, die Ihnen buchstäblich anbetend zu Füßen lägen!«
Ysaye musste ebenfalls lachen. »Sie sind unverbesserlich, Haldane. Ich versichere Ihnen, das einzige Göttliche, für das ich mich interessiere, ist eine leckere Götterspeise.«
2
Der Bannerträger sah den Turm zuerst, der sich isoliert und einsam erhob, ein Gebilde aus braunem, unbearbeitetem Stein. Er ragte hoch über die Ebene und das kleine Dorf empor, das sich an seinen Fuß schmiegte, als suche es Schutz unter den Röcken des Turms. Es war fast Abend, die große rote Sonne hing niedrig über dem Horizont und sank sichtbar. Schon standen drei der vier Monde am Himmel, beinahe unsichtbar hinter den Wolken. Ein Spätfrühlingsregen hatte gerade begonnen, sich wie feiner, blasser Nebel auf die Reiter niederzusenken, nicht mehr als etwas hellere Schwaden inmitten der Düsternis. Die Wolken waren schwer, aber zu dieser Jahreszeit gab es wenigstens keinen Schnee mehr.
Es waren acht Gardisten einschließlich des Bannerträgers, und alle ritten erstklassige Tiere. Das Hastur-Banner zog ihnen voran, nobel blau und silbern mit dem Emblem des silbernen Baums und dem Motto Permanedal – »Ich werde bestehen bleiben.« Hinter ihnen ritten Lorill Hastur, seine Schwester Lady Leonie Hastur und Melissa di Asturien, die Gesellschafterin und Anstandsdame der Lady – obwohl Melissa in dem fortgeschrittenen Alter von sechzehn Jahren kaum eine Anstandsdame abgab und, da sie Leonie unendlich langweilte, auch kaum eine Gesellschafterin war. Beide Frauen waren in lange Reitschleier gehüllt. So edel die Reittiere waren, sie bewegten sich langsam, müde, denn die Karawane war seit Sonnenaufgang unterwegs.
Lorill gab das Zeichen zum Halten. Mit dem Turm bereits in Sichtweite war das hart, auch wenn sie alle wussten, dass ihr Ziel noch mehrere Reitstunden entfernt lag. Hier auf der Ebene täuschte man sich oft über die Entfernung.
Aus langer Gewohnheit überließ Lorill Hastur die Entscheidung, ob man das Lager aufschlagen oder weiterziehen sollte, seiner Schwester.
»Wir könnten hier lagern.« Er wies auf eine Lichtung neben der Straße, die von knospenden Bäumen geschützt war, und ignorierte den Nebel, der Perlen auf seinen Wimpern bildete. »Wenn es beginnt, heftig zu regnen, müssten wir sowieso Halt machen. Ich sehe keinen Grund, warum wir versuchen sollten, in einem Unwetter voranzukommen, wobei wir riskieren würden, dass unsere Tiere lahm werden.«
»Ich könnte die ganze Nacht reiten«, protestierte Leonie, »und ich hasse es, die Reise in Sicht des Turms zu unterbrechen. Aber ...«
Sie hielt einen Augenblick inne und dachte nach. Wenn sie im Regen weiterritten, kamen sie durchnässt, ausgekühlt und erschöpft im Turm an. Es war eine Nacht der vier Monde – und ihre letzte Nacht der Freiheit. Vielleicht wäre es gar nicht schlecht, sie im Freien zu verbringen ...
»Und wo werden wir bleiben?«, fragte Melissa. Ihr Stirnrunzeln verriet, dass sie Leonies Idee sofort ablehnte. »Etwa in Zelten?«
»Derik erzählte mir, dass im nächsten Dorf ein guter Gasthof ist«, sagte Lorill. »Vermutlich denkt er dabei aber ans Bier und nicht an die Unterbringung.«
Leonie kicherte, denn Deriks Fassungsvermögen war auf der ganzen Reise ein stehender Witz bei ihnen geworden.
»Er trinkt wie ein Mönch zu Mittwinter«, lachte sie. »Aber auf der Straße bleibt er nüchtern. Ich finde, wir sollten ihm sein Bier nicht missgönnen ...«
»Ich möchte nicht die ganze Nacht durchreiten«, quengelte Melissa in einer seltsamen Kombination aus Jammern und ihrem üblichen affektierten Lächeln.
Leonie richtete sich gereizt auf und unterdrückte eine scharfe Antwort. Lorill jedoch meinte nur gutmütig: »Nun, ich nehme nicht an, dass ihr an Bier denkt.«
»Durchaus nicht.« Melissa zog eine Schnute. »Nur an ein warmes Feuer. Warum sollen wir in einem Zelt leiden, wenn wir nur noch ein bisschen weiterzureiten brauchen, um dieses warme Feuer zu bekommen?«
In einem Zelt leiden? Bei der Art von Zelten, die eine Hastur-Entourage mit sich führte, dachte Leonie, brauchte man des Nachts im Zelt kaum zu leiden, obwohl es ein bisschen kühler sein mochte, als Melissa es gern hatte – aber Melissa neigte dazu, sich zu beschweren und versteckte Anspielungen auf ihre zarte Gesundheit zu machen. Und zweifellos würde Melissa sich, sobald sie sich aufgewärmt hatte, über das Essen und den verräucherten Raum beklagen und beim Anblick irgendwelchen Ungeziefers vor Angst quietschen. Leonie zog eine Nacht in einem Zelt, mochte es auch ein bisschen kalt und feucht sein, bei weitem einer Nacht in einem von Ungeziefer verseuchten Gasthof vor. Das Zelt war wenigstens eine bekannte Größe. Die Qualität des Gasthofs vor ihnen hingegen war eine Sache der Spekulation.
Und es gab noch eine andere Überlegung ...
Leonies Reittier wurde unruhig. Mit einem sehnsüchtigen Seufzer, darauf berechnet, ihren Bruder zum Nachgeben zu bringen, sagte sie: »Es wird eine Nacht der vier Monde sein ...«
»Nur wirst du sie nicht sehen können«, erwiderte Lorill mit unausweichlicher Logik. »Sie sind hinter Wolken verborgen, da könntest du ebenso die Feuerstelle genießen. Der Gasthof wird wenigstens geheizt und trocken sein.«
»Der Gasthof könnte durchaus so leck sein wie die Versprechungen eines Trockenstädters und eine Legion von Mäusen und Flöhen beherbergen. Aber ich werde für den Rest meines Lebens Gelegenheit haben, am Feuer zu sitzen«, protestierte Leonie. »Ich werde für den ganzen Rest meines Lebens nur die Welt innerhalb von vier Wänden sehen! Und eine Nacht der vier Monde kommt nicht so oft, dass ich sie einfach so verpassen möchte!«
Sie schoss einen verächtlichen Blick zu Melissa hinüber und wünschte die junge Frau irgendwohin, nur nicht als Anstandsdame an ihrer Seite reitend. Übrigens hätte sie sehr gern auch auf die Gardisten und den Bannerträger verzichtet. Um die Wahrheit zu sagen, am liebsten wäre sie mit Lorill allein geritten. Die Hastur-Zwillinge waren sich immer nahe gewesen, und sie sah keine Gefahr in einer so kurzen gemeinsamen Reise – schließlich war er ihr Zwillingsbruder, er würde ihr doch nichts tun!
Doch sowohl ihr hoher Rang als auch die gegenwärtige Mode im Benehmen ließen es nicht zu, dass junge Ladies in Begleitung ihrer Brüder ohne schickliche Eskorte und Anstandsdamen reisten, mit Gardisten und Entourage. Entsprechend dem darkovanischen Brauch, war Lorill an ihrer beider fünfzehntem Geburtstag offiziell zum Mann erklärt worden, und Leonie wurde jetzt als junge Frau betrachtet, nicht mehr als Kind. Sie war immer noch ein ziemlicher Wildfang und sehr eigensinnig, aber ihr Ruf war makellos.
Ein langer Ritt ohne Anstandsdame hätte ihn merklich schädigen können.
Eine blöde Sitte, dachte sie rebellisch. Wenn Lorill als Schutz nicht genügte, war sie schließlich nicht darüber erhaben, sich selbst zu schützen! Gemessen an anderen Männern, war Lorill von mittlerer Größe, wohingegen Leonie, beinahe ebenso groß wie er, als ungewöhnlich groß für eine Frau galt. Diese Größe allein würde nicht wenige Männer erst einmal nachdenken lassen.
Auch in anderer Beziehung war sie eindrucksvoll. Wie alle Hastur-Frauen und die meisten der Männer hatte sie einen hellen Teint und leuchtend kupferfarbenes Haar. Im Augenblick lag es als Krone aus Zöpfen über ihrer Stirn. Noch deutlicher als Lorill trug sie den Stempel der Hastur-Sippe. Comyn, das war in jeden Zoll von ihr eingebrannt. Comyn und Hastur – die Kombination sollte sogar den kühnsten Gesetzlosen hindern, sich an sie heranzumachen. Geschah ihr ein Leid, würde die Suche nach den Angreifern gnadenlos und die an ihnen geübte Rache schrecklich sein.
Leonie war außerdem auffallend schön – und sich dessen außerordentlich bewusst – und in den letzten drei Jahren am Hof in vielen Trinksprüchen gefeiert worden. Zwischen den Höflingen und den Männern, die gern um sie geworben hätten, war Leonie ganz der verhätschelte und verwöhnte Liebling ihrer Umgebung gewesen. Der Vater der Zwillinge war einer von König Stefans ersten Ratgebern, und man wusste zu erzählen, dass sogar der verwitwete König Stefan Elhalyn selbst einmal Leonies Hand zur Ehe begehrt hatte. Das hatte sie noch populärer gemacht, wenn das überhaupt möglich war. Sogar Höflinge außerhalb ihrer Altersgruppe suchten ihre Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, weil sie an den Tag dachten, an dem sie Königin sein mochte.
Aber Leonie hatte keine Lust gezeigt zu heiraten. Sie war ganz von einem anderen Ziel erfüllt, und nicht einmal die Aussicht auf eine Krone konnte sie davon ablenken. Denn die Macht einer Königin war auf das beschränkt, was ihr Herr und König ihr gewährte. Leonie wollte sich nicht beschränken lassen. Lorill brauchte es auch nicht, warum also sie? Waren sie nicht Zwillinge, von Geburt an gleich bis auf das Geschlecht?
Von ihrer frühen Mädchenzeit an hatte Leonie einen Platz in einem der Türme haben wollen, wo sie sich ihr ganzes Leben lang dem Beruf einer leronis widmen konnte. Das würde ihr eine Stellung weit über jeder anderen Aristokratin verschaffen, sowohl politisch als auch gesellschaftlich, und eine Macht, die der Lorills gleichkam.
Und wenn sie ihr heimliches Ziel erreichte und die Bewahrerin des Arilinn-Turms wurde, wäre ihre Macht größer als die ihres Zwillingsbruders, zumindest solange ihr Vater lebte. Denn die Bewahrerin von Arilinn hatte kraft eigenen Rechts einen Sitz im Rat und nahm von keinem Mann außer dem König selbst Befehle an.
Es machte keine Schwierigkeiten, einen Turm zu finden, der sie aufnehmen würde. Wie allgemein bekannt, war Lady Leonie in reichem Maß mit dem Hastur-laran begabt. Doch jetzt, da dieser Schritt unmittelbar bevorstand, war sich Leonie in aller Deutlichkeit schmerzlich bewusst geworden, dass dieser von ihr selbst gewählte Weg sie von ihrer Familie und allen Lieben trennte, denn sie würde während der Zeit ihrer Ausbildung im Turm isoliert werden. In diesem Augenblick war sie, ganz gleich, was sie einmal werden würde, nichts als ein junges Mädchen, dem der Abschied vom Bruder und allen Verwandten bevorstand. Das war eine beängstigende Aussicht, sogar für Leonie.
»Ich werde für den Rest meines Lebens Gelegenheit haben, am Feuer zu sitzen«, wiederholte sie, den Blick zu dem sich verdunkelnden Himmel empor gewandt. »In einer Nacht der vier Monde ...«
»Die du unglücklicherweise – oder vielleicht glücklicherweise – nicht sehen kannst«, neckte Lorill sie. »Du weißt, was man über das sagt, was unter den vier Monden geschieht.«
Sie ignorierte ihn. »Ich will heute Nacht nicht in einem Gebäude eingesperrt werden!«, erklärte sie hartnäckig. »Glaubst du, ein chieri könne kommen und mich in meinem Zelt vergewaltigen, ohne dass du und die Gardisten etwas davon merkten? Oder es würden plötzlich Trockenstädter auf der Ebene erscheinen und mich wegtragen?«
»Oh! Skandalös, Leonie! Schäm dich!«, tadelte Lady Melissa sie und bedeckte wie schockiert von einer so törichten Idee den Mund mit der Hand.
Vielleicht entsetzte es sie auch nur, dass Leonie es wagte, über Dinge wie Entführung und Vergewaltigung Witze zu machen.
Leonie hatte Melissas Marotten und Hirngespinste reichlich genossen, und sie hatte sie von Herzen satt. »Sei doch still, Melissa!«, fuhr sie sie an. »Mit sechzehn bist du schon eine alte Jungfer! Und eine kleinliche noch dazu!«
Lorill grinste nur. »Das heißt also, du willst nicht in den Gasthof? Nun, Derik wird einmal ohne sein Bier auskommen!« Er schüttelte den Kopf. »Wenigstens können wir die Zelte aufstellen, bevor es richtig zu regnen beginnt. Aber du bist das unnatürlichste Mädchen, das ich je gesehen habe«, hänselte er sie. »Du willst im Freien kampieren, statt in einen guten Gasthof zu gehen!«
»Ich will unter den Sternen sein«, wiederholte Leonie. »Dies ist meine letzte Nacht außerhalb des Turms, und ich möchte sie unter den Sternen verbringen.«
»Was, in diesem Regen?«, fragte er lachend. »Sterne? Nach dem, was du von ihnen sehen wirst, könntest du ebenso gut ein hölzernes Dach über dir haben.«
»Es wird nicht die ganze Nacht regnen«, behauptete Leonie überzeugt.
»Mir sieht es ganz danach aus, dass es vor morgen früh nicht aufhört.« Achselzuckend gab Lorill nach. »Aber wir werden tun, wie du es wünschst, Leonie. Schließlich ist es deine letzte Nacht, bevor du den Turm betrittst.«
Leonie saß bequem im Sattel, die Zügel locker in der Hand. Ihr Tier stand ruhig. So wartete sie, während Lorill das Lager aufschlagen ließ. Sie war eine gute Reiterin – und ihr chervine war sowieso zu müde, um durchzugehen.
Lorill gab Befehl, die Zelte aufzustellen, und Leonie ignorierte das leise Murren und die gelegentlichen grollenden Blicke, die sie außerdem trafen. Die Gardisten sollten froh sein, dass Halt gemacht wurde, und in einem Stall – das war alles an Unterkunft, was ein Gefolgsmann in einem kleinen Gasthof bekommen konnte – schlief es sich auch nicht besser als in einem Zelt. Tatsächlich mochte es im Stall kälter sein, denn ein Feuer durfte dort nicht angezündet werden. Sobald die Männer es sich in ihren eigenen Zelten bequem gemacht hatten, würden sie vielleicht daran denken.
Während die Gardisten die Zeltplanen aufrollten, stieg Lorill ab. Er half Leonie von ihrem Reittier und in das zweifelhafte Obdach unter einem Baum. Melissa folgte ihnen laut schnüffelnd, damit auf einen Schnupfen hindeutend, den sie, wie Leonie argwöhnte, nicht wirklich hatte. Melissa wollte nur, dass sie anderen Leid tat – wie immer. Leonie hatte keine Ahnung, warum ihr Vater Melissa als ihre Gesellschafterin ausgewählt hatte. Vielleicht, weil Melissa so tugendhaft war und deshalb keine Gefahr bestand, dass sie Leonie zu irgendeinem Streich verführte, wie es eine temperamentvollere Freundin möglicherweise getan hätte.
Der Regen wurde heftiger. Die Gardisten kämpften mit den sperrigen Zeltbahnen, und Leonies Reitmantel gab ihr von Minute zu Minute weniger Schutz. Schon spürte sie Feuchtigkeit entlang den Schultern und mehr als Feuchtigkeit am Saum – und Melissas Schnüffeln hatte sich von einem gespielten zu einem echten verwandelt. Für einen Augenblick bereute sie ihren eigensinnigen Entschluss – aber nur für einen Augenblick. Dies war ihre letzte Nacht in relativer Freiheit. Erst wenn sie die karmesinrote Robe einer Bewahrerin trug, würde sie wieder so viel Freiheit haben. Sie war entschlossen, sie zu genießen.
Sobald die Zelte aufgestellt waren, gab der junge Hastur-Lord Befehl, ein Feuer anzuzünden und Kohlenpfannen in die Zelte zu tragen, um sie zu erwärmen. Er führte Leonie durch die dichter werdende Dunkelheit zu ihrem Zelt und hielt dabei ihre Hand, damit sie nicht fiel, wenn der durchnässte Saum ihres Mantels sich um ihre Knöchel wickelte.
»Da wären wir. Ich glaube immer noch, du hättest es im Gasthof des Dorfes bequemer gehabt, und ich weiß ganz genau, dass Melissa es bequemer gehabt hätte«, seufzte er geduldig. »Na, hier hast du dein Bett unter den Sternen – nicht etwa, dass du diese Nacht viel von Sternen oder Monden sehen wirst. Ich kann mir nicht vorstellen, wie du auf solche Ideen kommst, Leonie. Entspringen sie irgendeiner Logik, die nur du begreifst, oder einfach dem Wunsch, uns alle deinem Willen zu unterwerfen?«
Leonie legte ihren nassen Mantel ab, warf sich in das Nest aus Kissen und sah zu ihrem Bruder hoch. Kerzenlicht von der Laterne, die an der mittleren Zeltstange hing, ließ sie sein hübsches Gesicht deutlich erkennen. Es gab Leonie das beunruhigende Gefühl, auf sich selbst zurückzublicken. »Ich denke oft über die Monde nach«, erklärte sie unvermittelt. »Was meinst du, was sie wohl sein mögen?«
Wenn der abrupte Themenwechsel ihn verblüffte, ließ er es sich nicht anmerken. »Mein Lehrer sagt, ungeachtet der alten Legenden über chieri, die in die Domänen eingeheiratet haben, seien die Monde nichts weiter als gewaltige Felsbrocken, die unsere Welt umkreisen. Tot, wüst, luftlos, kalt und ohne Leben.«
Leonie schwieg eine Weile versonnen. Das passte nicht zu dem Unbehagen, das sie in letzter Zeit verspürte. »Und glaubst du das, Lorill?«
»Ich weiß es nicht.« Lorill zuckte die Achseln, als sei es bedeutungslos. Vielleicht war es das für ihn auch. »Ich bin nicht so romantisch eingestellt wie du, chiya. Ich sehe keinen Grund, daran zu zweifeln, und im Grunde interessiert es mich nicht sehr, was sie sind. Schließlich haben sie keine Wirkung auf uns, und wir haben keine auf sie.«
»Mich interessieren sie aber.« Leonie runzelte plötzlich die Stirn. Dies war vielleicht die einzige Gelegenheit, um mit ihrem Bruder in Person über ihre Vorahnungen zu sprechen. Es mochte nicht die beste Zeit dafür sein – aber sobald sie innerhalb von Dalereuth war, gab es keine Chance mehr. »Ich spüre, dass etwas von den Monden auf uns zukommt – dass unser Leben vielleicht nie mehr so wie früher sein wird.« Sie drehte sich auf den Rücken und starrte zu der Zeltdecke hoch, als könne sie die Plane und die Wolken darüber mit ihren Blicken durchdringen und die Monde sehen. »Im Ernst, Lorill, fühlst du nicht, dass bald etwas sehr Wichtiges geschehen wird?«
»Eigentlich nicht.« Er gähnte. »Ich fühle mich nur schläfrig. Du bist eine Frau, Leonie. Du spürst den Einfluss der Monde, vielleicht ist es nicht mehr als das. Obwohl es regnet und du sie nicht sehen kannst, zieht Liriel an dir. Jeder weiß, wie sensibel Frauen auf die Monde reagieren – und wie dramatisch ihr Einfluss sein kann.«
Leonie wusste, dass Lorill die Wahrheit sprach. »Bei der gegenwärtigen Konjunktion ziehen sie alle an mir«, stellte sie fest. »Ich wünschte, der Himmel wäre heute Nacht klar. Aber ganz abgesehen davon fühle ich ...«
»Nicht doch, Leonie, komm mir nicht mit irgendwelcher Mystik«, unterbrach Lorill sie. Er wirkte ein bisschen besorgt. »Demnächst muss ich noch glauben, du habest dich in Melissa verwandelt, nichts als Hirngespinste und Unsinn, und du wirst Visionen von Evanda und Avarra haben!«
»Nein«, widersprach sie. »Mach dich nur über mich lustig, Lorill, und zweifele daran, so viel du willst. Ich sage, etwas kommt auf uns zu – eine große Veränderung in unserem Leben –, und nichts wird jemals wieder sein wie früher. Das gilt für uns alle, nicht nur für dich und mich.«
Sie sprach mit solcher Überzeugung, dass Lorill sie scharf musterte und mit seinen Witzeleien aufhörte. Er nickte ganz ernst. »Du bist eine leronis, Schwester, ob im Turm ausgebildet oder nicht. Wenn du sagst, es wird etwas geschehen – nun, es mag sein, dass du mit Vorherwissen begabt bist. Hast du eine Ahnung, was dieses große Ereignis sein wird?«
Die Unbestimmtheit der Gefühle verursachte bei ihr Kopfschmerzen. »Ich wünschte, ich hätte eine Ahnung, Lorill«, antwortete sie unsicher und unglücklich. »Ich weiß nur, dass es etwas mit den Monden zu tun hat, mehr nicht. Ich spüre es, ich könnte darauf schwören. Manchmal weiß ich nicht einmal mehr, ob ich angesichts der Zeiten, die anbrechen werden, überhaupt noch nach Dalereuth gehen möchte.«
»Was meinst du?« Lorill erschrak, und das zu Recht. Leonie hatte bisher nie zugelassen, dass sich irgendwelche Bedenken ihrem Wunsch, in einen Turm zu gehen, in den Weg stellten. Sie hatte rücksichtslos jeden Vorschlag abgewiesen, vielleicht einen anderen Weg für ihre Zukunft zu wählen. Sie hatte sogar die Hand des Königs abgelehnt, alles in dem Bestreben, eine leronis zu werden.
»Ich wünschte, das könnte ich dir sagen.« Sie zog die Brauen zusammen, versuchte, sich zu konzentrieren. »Wenn ich eine voll ausgebildete leronis wäre, nicht nur eine Novizin ...« Sie verstummte, als entschlüpften ihr die Worte, mit denen sie hätte formulieren können, was sie wusste. Aber es mangelte ihr nicht an Worten, sondern an der Fähigkeit, ihre Vorahnungen auf etwas mehr als bloße Gefühle zu verdichten, die sich verflüchtigten wie der Morgennebel und ebenso schwer zu fangen waren.
Lorill wirkte nachdenklich. »Was es auch sein mag, ich wünschte, ich könnte deine Vorahnungen teilen. Du weißt jedoch, was mir gesagt wurde, als ich meine Matrix erhielt.« Gedankenverloren befühlte seine Linke den seidenen Beutel an seinem Hals. »Bei Zwillingen hat der eine mehr, der andere weniger als den normalen Anteil an laran. Ich brauche dir nicht zu erzählen, wie sich die Gabe zwischen uns beiden aufteilt. Zweifellos wirst du dein laran besser nutzen als ich meines.«
Leonie wusste, was er meinte. Es war ganz gut, dass Lorill das schwächere laran besaß, denn heutzutage würde es, auch wenn Frieden im Land herrschte, einem männlichen Hastur nicht erlaubt werden, einen so vom Leben zurückgezogenen Beruf wie den eines Matrix-Arbeiters zu ergreifen, es sei denn, er stellte etwas so Überflüssiges dar wie einen siebten Sohn. Es war unvermeidlich, dass Lorill seinen Platz am Hof neben seinem Vater einnahm, und ob ihm das passte oder nicht, spielte kaum eine Rolle. Leonie würde auf ihre Weise weit mehr Freiheit erfahren als er, wenn sie erst einmal voll ausgebildet war. Sie würde wählen können, wohin sie ging, und allein das Ausmaß ihres laran zog die Grenzen für ihr Streben nach dem höchsten Ziel – Bewahrerin zu werden.
»Was ist es, das du siehst, Schwester?« Lorills Stimme war leise, dunkel von Befürchtungen.
»Nicht mehr, als ich dir gesagt habe.« Leonie seufzte und drehte ihm wieder das Gesicht zu. »Gefahr und Veränderung und Möglichkeit kommen auf uns zu – von den Monden. Ist das nicht genug?«
»Das kann ich unmöglich unserem Vater oder dem Rat vortragen«, protestierte Lorill. »Wenn ich nicht mehr zu bieten habe als ein vages Vorgefühl und von den Monden rede, wird man denken, ich hätte getrunken wie – was hast du vorhin über Derik gesagt? – wie ein Mönch zu Mittwinter.«
»So ist es«, stimmte Leonie betrübt zu. »Aber was kann ich tun?«
»Wenn du mehr Informationen für mich hättest ...«, regte er vorsichtig an. Es war eigentlich nicht richtig, dass er ein unausgebildetes Mädchen aufforderte, ohne Anleitung nach Erleuchtung zu suchen. Besonders gefährlich war das bei einer Hastur, denn die Hastur-Gabe war – die Kraft der lebenden Matrix. Wenn Leonie sie in vollem Ausmaß besaß, würde sie keinen Matrix-Kristall brauchen, um sich in Schwierigkeiten zu bringen, aus denen nur eine Bewahrerin sie wieder herausholen konnte. Aber Leonie war daran gewöhnt, auf ihre eigene Weise vorzugehen – und Lorill war an ihre bemerkenswerte Fähigkeit gewöhnt, so gut wie alles zu schaffen, was sie sich in den Kopf setzte.
Leonie runzelte die Stirn, aber mehr aus Verzweiflung als aus Missbilligung. »Ich will es versuchen«, versprach sie dann. »Ich werde mein Bestes tun. Vielleicht gelingt es mir, etwas Bestimmteres zu sehen – etwas, das wir benutzen können, um Vater zu überzeugen.«
Lorill überließ sie ihrer einsamen Meditation. Leonie löschte die Laterne, zog sich dann aber nicht aus, sondern lauschte stattdessen auf die sie umgebenden Geräusche des Lagers. Geduldig wartete sie darauf, dass der letzte Gardist in seinen Schlafsack kroch.
Sie brauchte nicht lange zu warten. Alle waren die Kälte und den Regen so leid, dass sie nur zu gern die Wärme der Decken suchten. Sobald Leonie den Eindruck hatte, dass sie sich für die Nacht zurückgezogen hatten, abgesehen von dem Posten, der in seinem durchnässten Umhang die Runde um das Lager machte, stand sie auf und trat an den Eingang ihres Zeltes.
Vorsichtig spähte sie hinaus, wandte ihre Aufmerksamkeit dem Himmel zu. Die Wolken hingen schwer und tropfend über ihr und zeigten wenig Neigung, sich zu bewegen, bevor sie allen Regen ausgeschüttet hatten, den sie trugen. Aber Leonie wusste aus jahrelanger Erfahrung, dass Wolken sich immer bewegen. Es ging nur darum, in welche Richtung und wie schnell. Erst innerhalb des letzten Jahres war es ihr gelungen, daraus praktischen Nutzen zu ziehen.
Sie passte genau auf, bis sie die Richtung der Bewegung kannte, die Richtung, die ihr verriet, wohin der Wind in der Höhe der Wolken blies. Wie sie wusste, stimmte sie nicht immer mit der auf dem Boden überein. Sie griff mit ihren Gedanken hinaus und schubste die schweren Wolken in diese Richtung, sie schob sie weiter, wie ein Schäfer es mit einer Herde fetter, fauler Schafe tut. Schließlich hatte sie sie aus dem Weg, und sie konnte den Himmel sehen. Die vier Monde schwammen hoch über den Zelten dahin, alle voll, jeder in einer anderen Farbe. Sie waren wunderschön – aber sie waren so stumm und rätselhaft wie immer.
Leonie zog die Eingangsklappe auf und setzte sich auf eins ihrer Kissen. Sie versuchte, irgendetwas in sich zu berühren, das ihren vagen Vorahnungen Form oder Substanz geben würde.
Alles, was sie erreichte, war wachsende Schlaflosigkeit.
Mehrere Stunden lang saß sie im Eingang ihres Zeltes, blickte zum Himmel hoch, versuchte, ihr laran auf das zu konzentrieren, was sie mit ihren körperlichen Augen sehen konnte, die Kreise der vier Monde – versuchte, ihre Gedanken auf das zu richten, was unvermeidlich kommen würde, versuchte, die Wurzeln ihrer schrecklichen Vorahnung aufzuspüren.
Sie versuchte, die Antworten zu finden, von denen sie spürte, dass sie sie brauchen würde – und zwar bald.
3
Ein Ring aus kleinen Kuppeln, einem unordentlichen Nest von Pilzen ähnlich, war auf der Oberfläche des größten der Monde emporgewachsen. Um die Kuppeln trafen sowohl Menschen in Raumanzügen als auch Maschinen Vorkehrungen, dass die Anlage sich bald selbst versorgen konnte.
Im Inneren der größten Kuppel saß Ysaye vor einem Computerterminal und betrachtete auf dem Schirm den Satelliten, der mit seinen bunten Farben wie ein Spielzeug aussah. Eben zündete er die Bremsraketen und glitt elegant in den Orbit.
David sah ihr über die Schulter. »Nun, das ist Nummer eins – der erste Kartografierungs- und Wettersatellit«, bemerkte er glücklich. »Nun können Elizabeth und ich uns im Ernst an die Arbeit machen. Ein hochrangiges Hightech-Produkt, meint Elizabeth.«
»Hochrangig in welcher Beziehung?«, fragte Ysaye. »Die Bordcomputer sind eigentlich nichts Besonderes.«
Sie wollte, dass er weitersprach. Auf dem Schiff war sie sich des Zischens der Luft im Ventilationssystem nie so bewusst gewesen, und ihr war gar nicht wohl zu Mute mit nichts zwischen sich selbst und dem Vakuum als einer dünnen, flexiblen Haut.
David tat ihr den Gefallen. »Das Besondere sind die Beobachtungsinstrumente, die Optiken. Dieser Terra-Mark-XXIV-Satellit hat eine so hohe Auflösung, dass er ein brennendes Streichholz auf der Nachtseite sehen kann. Würde sich eine solche Optik fünfzigtausend Meter über Terra in einem geosynchronen Orbit befinden, könnte man damit das Nummernschild eines Wagens auf dem Parkplatz der Botschaft in Nigeria lesen. Ich denke, unser Satellit hier bringt ebenso viel zu Stande.«
»Vorausgesetzt, sie haben hier Autos und Parkplätze.« Elizabeth trat von hinten an sie heran. »Und Botschaften. Aber wenn es keine gibt, können wir sicher helfen, welche zu bauen ...«
David drehte sich lächelnd um und antwortete: »Hier sind es vielleicht die Nummern auf einem Straßenschild. Oder auf dem, was sie da unten als Straßen und Schilder benutzen. Hallo, Liebes! Bist du gekommen, um die Wetterbeobachtungen in Gang zu setzen?«
»Du hast es erraten.« Elizabeth nickte. »Wenn du die erste Wache für Kartografierung und Erkundung bekommen hast, werden wir zusammenarbeiten können.« Sie blickte ringsum, sah sich die Reihe der Monitore an, auf denen die draußen arbeitende Schiffsmannschaft zu sehen war. »Glaubst du, dass die Menschen dort unten ihre Monde schon erreicht haben?«
»Wohl kaum. Zumindest haben wir bislang nichts gefunden, was darauf hindeutet, nicht einmal eine weggeworfene Folienverpackung oder Nahrungsmitteltube. Es gibt keine Zeichen für eine Technologie, die wir als solche erkennen würden – keine großen beleuchteten Gebiete des Nachts, die eine Stadt sein könnten, und überhaupt keine Radiosignale.«
Ysaye schüttelte den Kopf. »Die Techniker erinnern mich dauernd daran, dass wir vorerst nicht einmal wissen, ob es da unten überhaupt intelligentes Leben gibt, und wir werden es auch nicht wissen, bis die Kameras des Satelliten zu arbeiten beginnen.«
Elizabeth bedachte die leeren Monitore, auf denen die von dem Satelliten hereinkommenden Bilder zu sehen sein würden, mit einem Stirnrunzeln. »Ich bin mir nicht einmal sicher, ob wir es dann wissen werden, Ysaye. Die Planetenoberfläche verbirgt sich unter einer dichten Wolkendecke. Wenn es da unten intelligente Lebewesen gibt und wenn sie nicht allzu fortgeschritten sind, könnten wir ihre Anwesenheit leicht übersehen.«
»Da bin ich anderer Meinung«, warf David ein. »Bei dieser Auflösung brauchen wir nichts weiter als eine Lücke in den Wolken, und schon werden wir sehen, wie ein Affe oder sein hiesiges Pendant sich durch die Zweige des Waldes da unten schwingt.«
»Nur in den oberen Zweigen«, wandte Elizabeth ein. »Und nur, wenn die Wolkendecke tatsächlich aufreißt und die Kamera in die richtige Richtung zeigt!«
»Das wird bestimmt früher oder später geschehen.« David tat die Sache mit einem Achselzucken ab. »Und früher oder später muss die Wolkendecke aufreißen. Aber selbst wenn es da unten intelligente Lebewesen gibt, werden wir nichts erkennen, das wesentlich kleiner ist als eine beleuchtete Stadt, bis wir den größten Teil des Wettersatelliten-Netzwerks in Betrieb genommen haben. Hast du eine Vorstellung, wie lange das dauern wird, Ysaye?«
»Stunden«, erwiderte Ysaye erschöpft. »Nur gut, dass alles nach einem eigenständigen Programm abläuft. Ich habe weiter nichts zu tun, als den Babysitter zu spielen.«
»Du siehst schrecklich müde aus, Ysaye.« In Elizabeths blauen Augen stand die Sorge geschrieben. »Wie lange arbeitest du übrigens schon? Oder sollte ich sagen: Wie lange überarbeitest du dich schon?«
Ysaye zuckte hilflos die Achseln. »Ich weiß es nicht. Ich habe nicht auf die Uhr gesehen.«
»Kann man das übersetzen mit: ›Ich habe mein Gehirn vor drei Tagen mit dem Computer verbunden und seitdem keine Pause mehr gemacht‹?«, neckte David sie.
»Etwas in der Art«, gab Ysaye mit mattem Auflachen zu. »Das und – nun, ihr beiden wisst ja, dass ich nicht gern in einem fremden Bett schlafe. Ich konnte einfach nicht einschlafen, da habe ich eben weitergearbeitet.«
»Warum legst du dich da drüben nicht ein bisschen hin und versuchst es noch einmal?«, schlug Elizabeth vor und zeigte auf einen Stapel wattierter Computerdecken in der Ecke. »Du sagst ja selbst, dass alles automatisch abläuft. David und ich werden hier sein und dir Bescheid geben, wenn etwas schief geht. Sonst wird in den nächsten Stunden kaum jemand hier hereinkommen. Außer uns und dem Bauteam sind alle noch auf dem Schiff. Du hättest es ruhig und gemütlich.«
»Das wird nicht mehr lange so bleiben«, warnte David. »Sobald die Sicherheit grünes Licht gibt, setzt eine Stampede sondergleichen ein. Auch hier wird es so sein. Die Sicherheit braucht sich nur noch zu überzeugen, dass die Kuppeln stabilisiert sind. Nicht etwa, dass es hier irgendwo frische Luft gäbe, aber wenigstens bieten die Kuppeln eine Abwechslung gegenüber dem Schiff.«