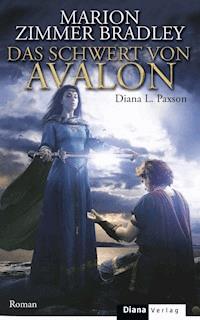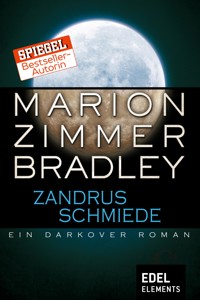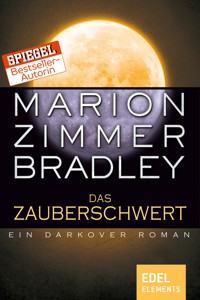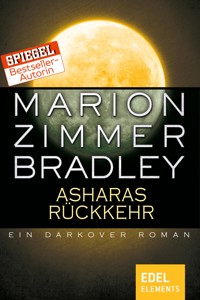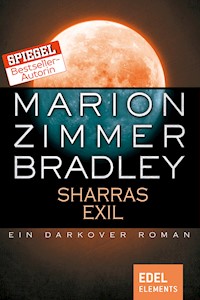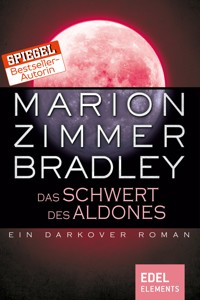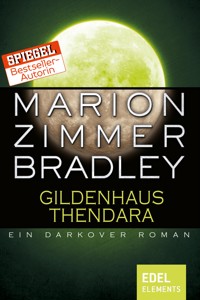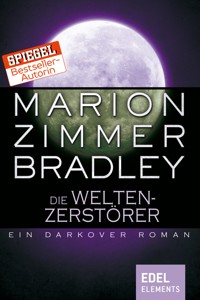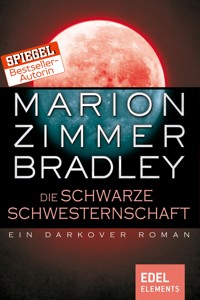Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Darkover-Zyklus
- Sprache: Deutsch
Bestsellerautorin Marion Zimmer Bradley ("Die Nebel von Avalon") hat mit dem opulenten Darkover-Zyklus eine einzigartige Romanreihe geschaffen: Die fesselnde Geschichte einer geheimnisvollen fremden Welt und ihrer Bewohner ist Kult! König Carolin Hastur und sein Freund Varzil setzen alles daran, die Herrscherhäuser von Darkover zu einem Verzicht auf alle magischen Waffen zu bewegen. Dabei ahnen sie nicht, dass ihr ärgster Feind längst dagegen intrigiert: Eduin Deslucido will die Hasturs vernichten, getrieben von einem Rachezauber seines toten Vaters. Sogar ein Attentat auf die Festung ist geplant, in der sich Varzils Schwester befindet. Sie ist Eduins frühere Geliebte, und er muss sich schließlich eingestehen, dass er sie noch immer liebt…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 829
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Marion Zimmer Bradley
Ein Darkover Roman
Ins Deutsche übertragen von Michael Nagula
Marion Zimmer Bradley – Der “Darkover”-Romanzyklus bei EdeleBooks:
Copyright dieser Ausgabe © 2014 by Edel eBooks, einem Verlag der Edel Germany GmbH, Hamburg. Copyright © 2004 by Marion Zimmer Bradley
Copyright First german Edition © 2006 by Random House GmbH, München.
Die Originalausgabe erschien 2004 unter dem Titel "A Flame in Hali"
Ins Deutsche übertragen von Michael Nagula
Covergestaltung: Agentur bürosüd°, München
Konvertierung: Datagrafix
Alle Rechte vorbehalten. All rights reserved. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des jeweiligen Rechteinhabers wiedergegeben werden.
ISBN: 978-3-95530-607-6
edel.comfacebook.com/edel.ebooks
Inhalt
Dementi
Anmerkung der Autorin
Prolog
1. Buch
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
2. Buch
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
3. Buch
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
4. Buch
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
5. Buch
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Epilog
Dementi
Dem aufmerksamen Leser werden möglicherweise bei einigen Details Unterschiede zu neueren Erzählungen auffallen. Das ist ohne Zweifel auf die fragmentarische Geschichtsschreibung zurückzuführen, die bis zum heutigen Tage anhält. In den Jahren nach der Zeit des Chaos und der Hundert Königreiche gingen viele Zeugnisse verloren, und andere wurden durch die mündliche Weitergabe entstellt.
Anmerkung der Autorin
Marion Zimmer Bradley ging mit »ihrer besonderen Welt« Darkover immer sehr großzügig um, und sie ermutigte für ihr Leben gern junge Schriftstellerinnen. Wir waren schon Freundinnen, als sie ihre Anthologien über DARKOVER und die SCHWESTERN-Reihe herauszugeben begann. Meine natürliche literarische »Stimme« und das, wonach sie suchte, passten ungewöhnlich gut zueinander. Sie las immer gern, was ich mit so viel Freude schrieb, und bezeichnete »Brendan Ensolares Tod« (FOUR MOONS OF DARKOVER, USA 1988, dt. DIE VIER MONDE) oft als eine ihrer Lieblingsgeschichten.
Als Marions Gesundheitszustand sich verschlechterte, lud sie mich ein, mit ihr an einem oder mehreren Darkover-Romanen zu arbeiten. Wir beschlossen, dass wir, statt die Geschichte des »modernen« Darkover fortzuschreiben, besser in die Zeit des Chaos zurückkehrten. Marion schwebte eine Trilogie vor, die mit dem Hastur-Aufstand und DIE FLAMME VON HALI beginnen und über die anhaltende Freundschaft zwischen Varzil dem Guten und Carolin Hastur bis zur Ratifizierung des Vertrags führen sollte. Während ich mir so schnell wie möglich Notizen machte, lehnte sie sich zurück, richtete den Blick nach oben und begann die Geschichte mit den Worten: »Also, die Hastur versuchten, die schlimmsten Auswüchse der Laran-Waffen in den Griff zu bekommen, aber ständig wurden neue entwickelt...«, oder sie sagte: »Varzil und Carolin waren natürlich mit den Geschichten von den unglückseligen Liebenden vertraut, die bei der Zerstörung von Neskaya ihr Leben verloren...«
Das hier ist ihre Geschichte.
Deborah J. Ross
Prolog
Rumail Deslucido hatte dem Tod schon oft ein Schnippchen geschlagen, aber diesmal gab es kein Zurück mehr. Er lag auf einem Bett, so gebeutelt und verschlissen wie sein gebrechlicher Körper, in dem schmutzigen Zimmer, das lange seine Zuflucht und sein Gefängnis gewesen war, und wartete. Jeder Atemzug war ein Ringen nach Luft geworden, um die vernarbten Lungen zu füllen. Mit jedem verstreichenden Augenblick taumelte sein Herz mehr, als zittere es aufgrund der Anstrengung, zu lange gelebt zu haben.
Die Tür öffnete sich, und ein Mädchen aus dem Dorf trat ein. Es trug einen Korb mit Brot und einen irdenen Krug. Er nippte an der Brühe, die sie ihm Löffel für Löffel reichte, dann legte er sich zurück. Sie sprach mit ihm, belangloses Zeug, das die Mühe des Zuhörens nicht wert war. Ihre Stimme verklang, ging unter in der Erinnerung an andere Stimmen. Manchmal sprach er mit längst verstorbenen Menschen – seinem königlichen Bruder...
Ah! Da war wieder das unbeugsame goldene Haupt, der Blick, in dem der Wille zum Sieg brannte. Seite an Seite standen sie auf einem Balkon, während unter ihnen Deslucidos schwarz-weiße Banner mit dem Diamantenmotiv im Wind wehten. Die Morgensonne ließ das braune Haar des Königs wie eine Krone erstrahlen. Er sprach, und seine Worte riefen Bilder vor Rumails geistigem Auge wach, die Hoffnung auf eine Zeit, in der die Hundert Königreiche zu einem einzigen harmonischen Reich vereint sein würden. Keine ständigen Kriege, kein kleinliches Gezänk mehr, während Männer auf den verwüsteten Schlachtfeldern ihr Leben aushauchten. Rumails Laran-Talente würden endlich gefeiert werden; sein Platz als Bewahrer eines eigenen Turms, den ihm diese mental blinden Puristen so lange verwehrt hatten, wäre ihm sicher...
Der helle Himmel verdunkelte sich, die Vision verwehte wie winterdürres Laub, und nun stand Rumail auf dem Schlachtfeld von Drycreek, wo die Armee seines Bruders auf die von König Rafael Hastur getroffen war. Die Soldaten seines Bruders hielten inne, um zum Himmel zu schauen. Über dem Feind schwebend, ließen Rumails mechanische Vögel Schauer leuchtend grüner Teilchen herabregnen, so unheimlich schön wie tödlich: Knochenwasserstaub, durch die konzentrierte Macht talentierter Geistesarbeiter geschaffen, zu einem horrenden Preis einem abtrünnigen Kreis abgekauft.
Als Rumail zusah, wie das leuchtende Gift zu dem ahnungslosen Feind trieb, wünschte er, es hätte einen anderen Weg gegeben, den Hastur-König und seine Nichte, die Hexe Taniquel Hastur-Acosta, aufzuhalten. Durch Verrat und eigene psi-begabte Diener hatten sie das Schlachtenglück gewendet.
Mir blieb nichts anderes übrig. Keinem von uns blieb etwas anderes übrig.
Rumail hatte diese Szene schon tausendmal durchlebt, vom ersten Augenblick an, da ihnen der Sieg entglitten war, weil der Wind jäh umschlug und den Knochenwasserstaub zu ihren eigenen Streitkräften zurücktrieb. Als wäre es gestern gewesen, erinnerte er sich an den panischen Rückzug, an die Männer und Tiere, die binnen eines Herzschlags starben, und die tausende, denen ein langsamer Tod bevorstand. Er selbst war nur mit knapper Not entronnen. Verletzt, kaum im Stande, einen psychischen Abwehrschirm gegen den giftigen Staub aufrechtzuerhalten, hatte er sich an den kleinsten Hoffnungsschimmer geklammert.
Er hätte dort sterben sollen, reglos und hilflos. Aber er starb nicht. Damals war er dem Tod entronnen, wie schon frühere Male und auch bei späteren Gelegenheiten. Die Götter hielten ein anderes Schicksal für ihn bereit, nicht das einer weiteren namenlosen Leiche auf einem Schlachtfeld, das für eine Generation oder länger niemand mehr zu überqueren wagte.
Nun stand er in seiner Erinnerung hoch oben auf einem Balkon des Turms, in das scharlachrote Gewand eines Bewahrers gehüllt. Endlich befehligte er einen eigenen Kreis, und wie sehr seine Arbeiter ihn auch verabscheuten, sie würden ihm gehorchen. Ihr Turm hatte seinem königlichen Bruder einen Treueeid geleistet, und auf sein Geheiß führten sie jetzt diesen Angriff auf einen Hastur-Turm durch.
Schreie hallten in dem Labyrinth von Rumails Gedanken wider. Um ihn herum erzitterten die Mauern unter Blitzschlägen, als die Türme einander mit ihren schrecklichen Waffen bekämpften. Steine zerbarsten in einem unnatürlichen Licht. Er spürte die Sterbegedanken seiner Arbeiter und in weiter Ferne die ihrer Feinde. Blaue Flammen schossen himmelwärts und brachten die Fundamente zum Erbeben.
Rumail erinnerte sich, wie er aus dem zerstörten Turm getaumelt war – ein körperloser Geist in der Überwelt, zerlumpt und halb verhungert – und benommen durch das wilde Land gestreift war, in dem niemand ihn kannte.
Nun flackerten die Erinnerungen durch seinen Geist wie Kerzen, die der Winterwind zum Tropfen bringt. Er blickte die hausbackene Dorfbewohnerin an, die er zu seiner Frau erkoren hatte, starrte auf das rundliche Gesicht eines neugeborenen Sohnes hinab, dann auf noch einen und noch einen. Die Jahre zogen flirrend vorüber. Er starrte in die hellen Augen seiner Söhne, und seine eigenen Rachegelüste spiegelten sich darin. Er empfand ein jähes Reißen, als das Bewusstsein seines ältesten Sohns aufflammte und verstummte. Sah das verwitterte Antlitz eines reisenden Kesselflickers, der die Kunde brachte, dass König Rafael Hastur unter geheimnisvollen Umständen gestorben war.
Er vernahm die Stimme seines zweiten Sohns: »Vater, Felix Hastur von Carcosa hat Anspruch auf den Thron erhoben, und er hat einen gesunden Erben, seinen Neffen Carolin.«
»Dann muss auch Carolin sterben«, hatte Rumail gesagt, »damit ihre Linie ausgelöscht wird. Ich werde meinen jüngsten Sohn, meinen Eduin, zum Arilinn-Turm schicken, damit er dort zum Laranzu ausgebildet wird, die perfekte Waffe gegen diesen Hastur-Prinzen.«
Eduin...
»La! So ist’s fein!«, sagte das Dorfmädchen und strich Rumail das Haar aus der Stirn. »Jetzt fühlen wir uns doch schon viel besser, nicht wahr?« Er hatte nicht mehr die Kraft, ihr eine Antwort zu geben, denn die Vergangenheit lastete jetzt noch schwerer auf ihm.
Das Gesicht seines jüngsten Sohns stieg hinter Rumails geschlossenen Lidern auf, und es hatte den Anschein, als versänke er wieder im Delirium, sein Körper bis ins Mark vom Lungenfieber zermartert, die Lungen von seinem Martyrium auf dem Schlachtfeld geschwächt. Als die Kunde von seiner Krankheit Arilinn erreicht hatte, war Eduin ihm zu Hilfe gekommen. Rumail spürte, wie sein Sohn ihn mit seinem trainierten Laran berührte.
Vater, bitte! Du musst leben, und sei’s nur deshalb, um dich bei den Hasturs gerächt zu sehen!
Leben..., hörte er seine eigene mentale Stimme, schwach und weit entfernt. Ja, ich muss leben. Und dafür sorgen, dass du mich beim nächsten Mal nicht im Stich lässt.
Eduin hatte sich unter dem geistigen Angriff gekrümmt. Seine Schwäche, seine Schuldgefühle waren durchgeschimmert. Rumail stürmte durch jede Erinnerung, jeden einzelnen Augenblick des Verrats. Als Carolin eine Jahreszeit lang im Arilinn-Turm ausgebildet worden war, hatte Eduin ein Dutzend Gelegenheiten zum Zuschlägen gehabt – ein Stoß mit dem Dolch, ein Sturz vom Balkon, ein jäher Herzstillstand, während seine Finger sich um Carolins Sternenstein schlossen... Doch in jedem kritischen Augenblick hatte etwas seine Hand zur Ruhe ermahnt.
Es war nicht meine Schuld!, hatte Eduin geschrien. Stets ist Varzil Ridenow dazwischengetreten, der mir mit Argwohn begegnete und Carolin beschützte...
Keine Ausflüchte! Mit aller Kraft seiner turmtrainierten Gedanken schlug Rumail zu. Eduin, zwischen Verzweiflung und Hoffnung gefangen, war schutzlos. Rumail drang in den Verstand seines Sohns ein, tief ins Zentrum seiner Laran-Gaben, packte zu und drehte...
Du wirst weder Ruhe noch Freude erfahren, solange Carolin Hastur und alle anderen, die ihm halfen, nicht tot sind.
Als es getan war, hatte Rumail die Augen aufgeschlagen und seine beiden letzten Söhne angesehen, Eduin den Laranzu und Gwynn den Attentäter. Eduin war zu seinem Werkzeug geworden, nur noch seiner Sache verschrieben.
Rumail schickte seine Söhne wieder in die Welt hinaus. »Findet Taniquels Kind! Tötet Carolin Hastur und jeden, der sich euch in den Weg stellt!«
Bruchstücke von Laran-Energie stiegen in Rumails Erinnerung auf, Dinge, die er von fern gespürt hatte, verbunden mit dem Geist seiner Söhne. Gwynn kämpfte an einem schlammigen Ufer mit Carolin und lieferte sich dann eine mentale Schlacht mit Varzil Ridenow, der den Attentatsversuch vereitelt hatte. Varzils Gedanken bedrängten ihn: Wer hat dich geschickt? Wer?
Noch jetzt hörte Rumail das Echo von Gwynns letztem, verzweifeltem Gedanken: MAN WIRD UNS RÄCHEN!
Aus der Ferne schwelgte Eduin in einem Triumphgefühl, als er die Identität von Felicia Hastur-Acosta aufdeckte; seine Hände berührten und erbauten eine tödliche Matrix-Falle. Er floh aus den Ruinen des Hestral-Turms, wurde gejagt... zum Gesetzlosen... Rumail wusste nicht mehr, ob es Eduins oder seine Erinnerungen waren – die Kälte, die Furcht, die ständige Notwendigkeit, sich zu verstecken, in Bewegung zu bleiben...
Vater, ich bin hier..., warte auf dich...
Rumail blinzelte, als eine Vision die andere überlappte. Gwynn winkte ihm, und hinter dieser geisterhaften Gestalt standen andere – die Söhne, die er auf seiner Suche nach Vergeltung verloren hatte. In jedem Gesicht sah er das Licht des Erkennens und Willkommens. Dort stand sein Bruder, golden und königlich, neben seinem eigenen Sohn und Erben..., dort der General, der ihn geführt hatte..., dort die Männer, die durch den Knochenwasserstaub starben. Sie warteten, warteten alle darauf, sich zu ihm zu gesellen.
Ich darf nicht sterben, noch nicht, nicht, solange Carolin auf seinem Thron sitzt! Welches verfluchte Zauberwerk schützt ihn?
Eduins schattenhafte Gestalt schimmerte vor den Augen des alten Mannes.
Du hattest Recht, mein Sohn. Ohne Varzil Ridenow hättest du Erfolg gehabt.
Unter Aufbietung seiner letzten Kräfte bemühte er sich zu sprechen, bekam aber kein Wort heraus. Seine Stimmbänder waren wie der restliche Körper taub geworden. Hungrig griff das Grau nach ihm.
Wir warten auf dich...
»Sir, Ihr müsst ruhen.« Eine leise Stimme, mädchenhaft.
Ruhe. Schon bald. Rumail schloss die Augen und rief das Laran herbei, das ihm einst in vollem Umfang zur Verfügung gestanden hatte. Er war vor seinem Sturz im Neskaya-Turm ausgebildet worden, bevor Varzil der Gute ihn mit Carolin Hasturs Hilfe wieder aufgebaut hatte. Er hätte selber ein Bewahrer werden können. Werden sollen.
Aber dafür war jetzt keine Zeit. Seine Gedanken wurden zusammenhanglos, zerfielen wie Rost.
Die Hasturs. Müssen vernichtet werden, sandte er aus. Tötet sie... Tötet sie alle. Über die Entfernung hinweg spürte er, wie Eduin reagierte.
Varzil Ridenow, beharrte Rumail, während seine Gedanken zerfaserten. Er ist der Schlüssel zu Carolins Macht. Ohne seine Kraft... wird Hastur fallen...
Ja, entgegnete Eduin mit einem Hass, der den Hass seines Vaters widerspiegelte.
Räche uns... Die geisterhaften Gestalten schoben sich nun näher, und ihre Stimmen wurden so laut, als stünden sie vor ihm. Gesell dich zu uns...
»Schwöre mir...« Rumail war sich nicht sicher, ob er den Befehl geistig sandte oder laut aussprach. Sein Atem strich wispernd durch die Kehle, der leiseste aller Seufzer. »Schwöre mir, dass es geschehen wird!«
Das Grau stieg ringsum auf, und die Gesichter wurden deutlicher, ihre Haut und Kleidung so farblos wie die Landschaft dahinter. Die Überwelt schloss ihre Kiefer um ihn, und diesmal würde es kein Zurück mehr geben.
Ich... schwöre...
1. Buch
1
Der lange Darkover-Winter schien in diesem Jahr kein Ende zu nehmen. Monat um Monat hingen Eiswolken vor der aufgeblähten Blutigen Sonne. Schnee fiel, hart wie Glas, und dann fiel noch mehr davon, bis die zusammengedrückten Schichten das Land wie mit einer Rüstung einhüllten. Die Pässe durch die Venza-Hügel oberhalb von Thendara waren unpassierbar. Selbst Kaufleute, deren Lebensunterhalt vom Reisen abhing, verloren jede Lust, sich über die Stadtmauern hinauszubegeben. Sowohl Comyn-Lords als auch Gemeine verbarrikadierten sich hinter ihren Türen und verkrochen sich für die Jahreszeit.
Dann kam das Mittwinterfest und mit ihm ein Wirbel von Lustbarkeiten. König Carolin Hastur öffnete für einen Zehntag die Tore seiner großen Halle weit, und es gab genug Musik und Festessen, um selbst das Herz des ärmsten Straßenbettlers zu erfreuen. Der König hatte erst vor kurzem seinen Sitz von Hali, wo sein Großvater geherrscht hatte, in das größere Thendara verlegt. Schon früher hatten Hastur-Könige hier ihren Wohnsitz gehabt – der letzte von ihnen, Rafael II., zur Zeit des Hastur-Aufstands. Indem er seinen Hof nach Thendara verlegte, ließ Carolin die Menschen wissen, dass er ganz Hastur regieren wollte. Er war kein Hastur von Carcosa oder Hastur von Hali mehr, sondern ein Hochkönig in Thendara. Um seinen neuen Regierungssitz zu feiern, war er an diesen Feiertagen so großzügig, dass dies bei einigen seiner Untertanen weniger Dank als Misstrauen auslöste. Wenn er in der Öffentlichkeit erschien, sei es vor Comyn-Lords oder Gemeinen, redete er stets von dem Pakt, der für ganz Darkover eine Zeit des Friedens und der Ehre bringen würde.
Nur noch wenige Karren und Wagen rollten durch die Kaufmannstore. Getreidehändler erhöhten die Preise, horteten die schrumpfenden Vorräte. Ein trostloser grauer Zehntag folgte dem anderen, und das Fest wurde zu einer fernen Erinnerung, die in der gnadenlosen Kälte verkümmerte. König Carolin richtete eine Reihe von Unterkünften ein, ähnlich den Schutzhütten für Reisende an den Bergstraßen, in denen Arme in den bitterkalten Nächten Zuflucht finden konnten.
Eine Weile wurden Spenden aus der königlichen Kornkammer an die Armen verteilt. An diesen Tagen sammelten sich die Menschen schon vor dem Morgengrauen schaudernd in ihren Wollumhängen und -tüchern, Jacken und häufig geflickten Decken, und umklammerten ihre Krüge und Körbe. Ihr Atem stieg wie Nebel in die Luft. An manchen dieser Tage erhielt jeder eine Portion Getreide, getrocknete Bohnen und ein gewisses Maß an Bratöl und hin und wieder sogar Honig. In der letzten Zeit hatte es allerdings nicht mehr genug für alle gegeben.
Dichte, dunkle Wolken hingen tief über der Stadt, als wäre selbst der Himmel schlecht gelaunt. Die Wachen des Königs, warm gekleidet in Hastur-Blau und Silber, räumten den Bereich vor den Toren und ließen die Leute einzeln hinein. Sie wählten die Schwächsten aus, die Frauen und die Älteren. Viele Männer wurden weggeschickt, besonders solche, die dicke, pelzgefütterte Wolle über ihren umfangreichen Bäuchen trugen.
»Warum werfen sie gutes Essen an solche wie die da weg?«, rief ein Mann, der abgewiesen worden war. Er zeigte auf eine Frau, die einen Steingutkrug umklammerte, der nun mit Getreide gefüllt war. Ihre Röcke und das Schultertuch waren so verschlissen, dass an einzelnen Stellen mehrere Schichten durchschimmerten. Sie sah aus wie eine aufgeplusterte Puppe, wenn man einmal von ihrem spitzen Gesicht und den eingefallenen Wangen absah; sie trug offensichtlich jedes Kleidungsstück am Leib, das sie besaß.
»Sie wird es nur verschwenden...«
»Während du es an ein armes Geschöpf verkaufen würdest, das noch ärmer und verzweifelter ist«, erwiderte der Wachtposten neben ihm. »Der König will, dass dieses Getreide an jene geht, die es wirklich brauchen. Du siehst nicht aus, als hättest du je Hunger gehabt.«
»Zandrus Skorpione sollen dich stechen!« Fluchend entriss der Mann dem Wachtposten seinen Arm.
»Vor noch nicht allzu langer Zeit«, knurrte einer in einer Anspielung auf die Herrschaft von König Carolins Vetter Rakhal, »ging es hier anders zu. Für einen Mann mit Initiative stand immer ein Weg offen; man konnte feilschen, konnte Gefallen austauschen. Vielleicht hatte man sogar einen Freund im Schloss. Aber diese Zeiten sind vorbei. Mit Carolins Haufen kann man keine Geschäfte machen.« Er zuckte resignierend die Achseln. »Sobald die Straßen im Frühjahr wieder offen sind, gehe ich nach Temora. Für unsereinen ist hier nichts mehr zu holen.«
»Du meinst, wir müssen unser Brot ehrlich verdienen?«, witzelte ein Dritter. Er winkte den beiden anderen zu, dann verschwand er in einer Seitenstraße.
»Sie brauchen nicht zu hungern. Sie frieren auch nicht, und es mangelt ihnen nicht an Bequemlichkeit.« Ein Fremder, der ein wenig von den anderen entfernt gestanden hatte, kam nun auf sie zu. Er warf einen Blick zum Schloss Hastur und dann zu den prunkvollen Residenzen der Comyn-Lords. Die Sonne war noch nicht vollkommen aufgegangen, und Schatten lagen in eisigen Tümpeln auf den Straßen. Turm und Schloss strahlten im Licht von Lampen, die mithilfe von Laran-Batterien betrieben wurden.
»Sie werfen uns ein paar Brosamen hin und erwarten, dass wir dankbar sind. Und währenddessen sitzen sie dort oben auf ihren Seidenkissen in ihren geheizten Räumen mit ihren Matrix-Schirmen. Gift, Pestilenz und mörderische Zauber, das interessiert sie alles nicht, nicht im Geringsten...«
»Komm, mein Freund«, sagte der Mann, der nach Temora gehen wollte, und streckte den Arm aus. »Komm. Ich gebe dir ein Bier aus.«
»Ein Bier wird das, was diese Stadt quält, nicht heilen.« Der Mann mit der Kapuze riss sich los, den Mund höhnisch verzogen. Die Kapuze seines schäbigen Umhangs verbarg sein Gesicht zum Teil, und man könnte nur sein kantiges, von der Kälte raues Kinn sehen.
Der andere Mann stutzte und kniff abschätzend die Augen zusammen. Die Kleidung des Fremden war zwar fleckig und zerrissen, aber offensichtlich einmal von guter Qualität gewesen, und er hielt sich nicht wie einer, der aus der Gosse kam.
»Dann lass mich dich nach Hause bringen, weg von...«
»Nach Hause?« Die Stimme des Mannes mit der Kapuze war heiser, tief und verbittert. »Es ist ihre Schuld, dass ich kein Zuhause mehr habe. Aber es wird eine Zeit kommen, in der sie um Brot betteln und auf kaltem Stein schlafen werden...«
»Sei doch still, Mann«, zischte der andere. »Oder wenn du das nicht kannst, dann geh allein weiter, denn ich will nichts mit solch aufrührerischem Gerede zu tun haben. Es ist eine Sache, die Großzügigkeit des Königs anzunehmen oder mit seinen Männern zu feilschen, und eine andere, hier zu stehen und mit solchen Worten zum Verrat aufzufordern. All diese Wachtposten können uns hören, und sie stehen wie ein einziger Mann hinter Carolin.« Er ging ohne einen Blick zurück weiter, als wollte er sich so schnell wie möglich von diesem Unruhestifter entfernen.
Der erste Mann – der, der so zornig gewesen war – reichte dem mit der Kapuze eine Münze. »Sieh zu, dass du aus der Kälte kommst!« Dann ging auch er, ohne auf ein Wort des Danks zu warten.
Der Mann mit der Kapuze starrte die Münze in seiner Hand an, während die Leute, die schon etwas zu essen erhalten hatten, nach Hause eilten, und jene, die zu spät gekommen waren, mit hängenden Köpfen davonschlurften. Seine Kapuze verbarg seine Miene, aber etwas an seiner Haltung hielt die Unzufriedenen von ihm fern.
»Du da!«, rief einer der Wachtposten, nachdem er die Tore der Kornkammer verschlossen hatte. »Wir sind für heute fertig.« Etwas freundlicher fügte er hinzu: »Wenn du morgen ein bisschen früher kommst, werden wir versuchen, dir etwas zu geben.«
»Von solchen wie euch brauche ich nichts«, fauchte der Mann. »Ihr und eure verfluchten Zaubererherren...«
Die Züge des Wachtpostens erstarrten, und er machte einen Schritt vorwärts. Der Kapuzenmann fuhr überraschend schnell herum, stieß noch einen Fluch aus und eilte davon. Der Soldat wandte sich seinem Kameraden zu, der noch die Schärpe eines Kadetten trug: »Den da sollten wir im Auge behalten. Ich habe so etwas schon öfter gesehen. Leute wie er machen überall Ärger.«
»Ärger hatten wir diesen Winter schon genug, auch ohne einen Verrückten, der es noch schlimmer macht.« Der Junge schüttelte den Kopf. »Sollen wir es dem Hauptmann sagen?«
»Was denn? Dass es einen weiteren Unzufriedenen auf der Straße gibt? Wir können ihn genauso gut gleich darüber informieren, dass die Sonne aufgegangen ist oder es zu viele Mäuse in der Kornkammer gibt.« Er stieß ein bellendes Lachen aus. »Komm, gehen wir zurück zur Kaserne. Ein Tropfen heißer Gewürzwein wäre jetzt angenehm.«
»Mein Freund.«
Ein Geräusch formte sich zu Worten, die nun wiederholt wurden, zusammen mit einem sanften Schütteln der Schultern. Eduins Kopf fühlte sich an, als wäre er zu einem Mehrfachen der normalen Größe angeschwollen, und mit jedem Pulsschlag zuckte es schmerzhaft hinter seinen Augen. Hände schoben sich unter seine Arme und zogen ihn hoch. Er öffnete den Mund, um zu widersprechen, denn selbst die kleinste Bewegung ließ seine Kopfschmerzen schlimmer werden. Er bemerkte, dass seine Augen immer noch geschlossen waren, aber offenbar schien ihm helles Licht direkt ins Gesicht.
Es war Tag.
Er fluchte leise. Es war Tag gewesen, als er unter der Kneipenbank das Bewusstsein verloren hatte, aber nun war es wieder Tag. Wahrscheinlich nicht derselbe, aber das war ihm im Grunde egal.
»Komm schon, setz dich. Ja, genau so«, erklang die Stimme abermals.
Geh weg. Lass mich in Ruhe.
Er konnte nur langsam denken, als flösse das billige Bier immer noch in seinen Adern. Irgendwie kam er auf die Beine, die Augen gegen die Helligkeit zusammengekniffen. Verschwommen nahm er die Gestalt eines Mannes wahr – ein Kopf, zwei Arme, zwei Beine –, was ihn davon überzeugte, dass dies wahrscheinlich Wirklichkeit und keine weitere Halluzination der Trunkenheit war.
»Aldones, du stinkst vielleicht!«, sagte der Fremde. »Aber du bist klatschnass, und ich kann dich nicht hier draußen lassen. Es ist schon fast dunkel. Und heute Nacht wird es kalt genug werden, um selbst Zandrus Knochen erfrieren zu lassen.«
Erfrieren. Er hatte gehört, es sei ein schmerzloser Tod. Man schlief ein, wachte nie wieder auf und brauchte sich nicht mit aufdringlichen Fremden abzugeben. Es klang wunderbar.
Er würde nie wieder Bier in sich hineinschütten müssen, das so schlecht war, dass selbst ein Hund es nicht trinken würde, so lange, bis der Knoten in seinem Bauch sich schließlich entspannte und die Stimme in seinem Kopf schwieg. Es würde keine jämmerlichen, erniedrigenden Tagelöhnerarbeiten mehr geben, kein Stehlen von Kleingeld mehr, kein Betteln um den nächsten Krug. Essen, ein Bett oder der Spott der Straßenjungen – das interessierte ihn schon lange nicht mehr. Das Einzige, was zählte, waren das nächste Bier, der nächste Schnaps. Und Ruhe, gesegnete Ruhe.
Nun bewegte er sich, teilweise reflexartig, teilweise von den sanften, unnachgiebigen Händen gezogen. Vor ihm tauchte eine Gasse auf. Er erkannte sie nicht – sie hätte überall in den ärmeren Vierteln von Thendara sein können. Oder vielleicht auch in Dalereuth oder Arilinn.
Nein, nicht Arilinn. Dort könnte er sich nicht verstecken. Sie würden ihn erkennen, ganz gleich, wie schmutzig oder betrunken er war. Sie würden seinen Geist erkennen, die Leronyn des Turms. Selbst mit den geistigen Schilden, die für ihn schon seit langer Zeit so automatisch geworden waren wie das Atmen› würden sie ihn erkennen, denn er war einmal einer von ihnen gewesen. Hier im anonymen Dreck von Darkovers größter Stadt würde niemand nach ihm suchen. Er konnte sich in einem Fluss aus Bier ersäufen. Niemand würde wissen, ob er lebte oder starb. Niemand würde sich dafür interessieren. Nur im bitteren Winter konnte es passieren, dass ein Passant oder ein Bierhausbesitzer einen namenlosen Betrunkenen aus dem Schnee zog, denn keiner konnte solche Nächte überleben.
»Wir sind beinahe da«, sagte die Stimme.
»W-wo?«, krächzte er.
Er spürte das Lächeln des Fremden eher, als dass er es sah. »An einem sicheren Ort.«
Sie kamen zwischen zwei Gebäuden hindurch, die tief im Schatten lagen. Ein kalter Wind mit eisigen Klauen fegte durch die enge Gasse. In dieser Nacht würde es wieder schneien. Eduin schauderte und stellte sich vor, wie er in eine Schneeverwehung kriechen würde. Er würde allerdings sehr betrunken sein müssen, um das zu tun, beinahe erstarrt, oder der Druck in seinem Kopf würde ihn davon abhalten. Er hatte schon mehrmals versucht, dauerhaftes Vergessen zu finden, aber jedes Mal hatte sein zweites Bewusstsein ihn wie ein alter, böswilliger Begleiter am Leben gehalten und ihn wieder an seine ganz eigenen Ziele gekettet.
Eine Tür schwang auf, und er spürte wärmere Luft. Er streckte die Hand aus, um im Gleichgewicht zu bleiben, und berührte die rissigen, verwitterten Bretter. Drinnen flackerte Licht auf. Er entzog sich taumelnd dem Griff des Fremden und sackte auf einen grob gezimmerten Stuhl.
Er war in einer Art Dienstbotenquartier, vielleicht einer alten Spülküche, obwohl er nichts weiter sehen konnte als einen klapprigen Tisch an einer Wand. Ein Krug mit abgebrochenem Rand stand neben einer ebenso angeschlagenen Schüssel. Er konnte den Rest des Raums nicht sehen, ohne den Kopf zu drehen, und das hätte bedeutet, eine weitere Welle Übelkeit erregenden Schmerzes zu riskieren.
»Durst«, sagte er flehentlich und machte eine Geste.
Der Fremde beugte sich über ihn, und es sah aus, als läge ein Mantel aus blauem Licht auf seinen Schultern. Die Kapuze verbarg sein Gesicht. Er legte eine Hand auf Eduins Stirn.
Ruh dich aus. Ruh dich jetzt aus und vergiss. Wir unterhalten uns morgen.
Eduin erwachte in einem trüben, wässrigen Licht. Er war von einem seltsamen, ruhelosen Traum zum anderen gehetzt, und in allen war er von gesichtslosen Männern verfolgt worden, die ihn jedes Mal, wenn er versuchte, sich zu verstecken, entdeckten. Nun lag er auf einem dünnen Strohsack auf dem Boden in einem Raum, der ihm fremd sein sollte, aber vertraut vorkam.
Von seinem körperlichen Unbehagen, dem Drängen seiner Blase und der dicken, wattigen Schicht in seinem Mund einmal abgesehen konnte er sich nicht erinnern, wann er sich je unbeschwerter und innerlich ruhiger gefühlt hatte. Es war, als wäre eine Stimme, die ihn Tag und Nacht angeschrien hatte, plötzlich verstummt.
Als er sich hinsetzte, knackten seine Wirbel, und die Muskeln waren steif. Das Licht fiel durch Schichten von geöltem Tuch, die anstelle von Glas im Fensterrahmen angebracht waren. Eine Kerze, dick und unregelmäßig, brannte auf der anderen Seite des Raums. Auf dem Boden neben dem Strohsack entdeckte er einen Krug. Er enthielt Wasser und keinen Fusel, nicht einmal schlechtes Bier, aber Eduin trank gierig. Ein vertrauter säuerlicher Geschmack ließ seinen Kopf klarer werden und half gegen die Trockenheit in seiner Kehle. Es gab ihm Kraft, sich aufzuraffen und zur Tür und nach draußen zu gehen. Der angewehte Schnee brannte an seinen nackten Füßen. Die Gasse war leer, und er erkannte überrascht, dass ihm das wichtig war. Er erleichterte sich an der Mauer des Gebäudes.
So schnell er konnte, eilte er wieder nach drinnen. Es gab keine Feuerstelle, nur ein kleines steinernes Kohlebecken voller Asche. Aber die Wände hielten den schlimmsten Wind ab.
Ermutigt begann er, seine Umgebung zu erforschen. In dem Krug war noch mehr von dem Zitronenwasser; daneben lagen Brot, das nur auf einer Seite ein wenig schimmlig war, und harter Käse. Er konnte sich nicht erinnern, wann er das letzte Mal etwas gegessen hatte. Er kaute langsam und aß alles auf, bis auf den schimmligen Teil. Es hatte Zeiten gegeben, in denen er auch den gegessen hätte, aber nun widerte der Geruch ihn an.
Er ging einige Zeit im Zimmer umher, entdeckte aber keine Spur der Habe des Bewohners. Der Boden war aus nacktem Holz, fleckig und körnig von trockenem Schlamm. Die Schlafplattform war von der einfachsten Art, Schichten aus Stroh und Decken, zu verschlissen für jeden anderen Gebrauch, auf einem Rahmen von Holzdielen, damit man nicht direkt auf dem Boden lag. An der Rückseite der Tür gab es eine Reihe von Holzhaken, von denen einige abgebrochen waren wie verfaulte Zähne, und hier hing seine Jacke. Jemand hatte den schlimmsten Dreck abgebürstet, und an den abgewetzten Stellen schimmerte das Steppfutter durch. Er fand seine Stiefel in einer Ecke. Als er sie anzog, kam er zu dem Schluss, dass der Raum offenbar ihm gehörte, und dennoch konnte er sich nicht erinnernde zuvor hier gewesen zu sein. Wenn es ihm irgendwann gelungen wäre, die paar Reis für die Miete zusammenzukratzen, hätte er sie doch sicher längst für Bier ausgegeben.
Wieder fiel ihm auf, wie klar sein Kopf war und wie ungewohnt das Schweigen in seinem Geist. Er hatte kein Bedürfnis nach Alkohol, obwohl es eigentlich genügend Gründe dafür gab. Sein Gedächtnis zeigte ihm zahllose Tage, an denen sein erster und einziger Gedanke der gewesen war, wie er sich wieder betrinken könnte. Seinerzeit in Thendara und zuvor auf der Straße hatte er viele Männer kennen gelernt, die ebenso lebten, die von einem stumpfsinnigen Rausch zum nächsten taumelten. Sie schworen, dass die einzige Kur für die Übelkeit, die Kopfschmerzen und die Alptraumvisionen in mehr Alkohol bestand.
Eduin hatte nie getrunken, um den Nachwirkungen des Trinkens zu entgehen. Nein, er hatte gesucht, was er nun spürte – dieses gesegnete Schweigen. Hatte es etwas mit diesem Raum zu tun, so gewöhnlich und heruntergekommen er auch wirkte? Er nahm keine Spur eines telepathischen Dämpfers wahr, und er wusste ohnehin aus Erfahrung, wie nutzlos ein Dämpfer gegen diese innere Qual war. Ein gut eingestellter Dämpfer schützte einen Raum vor geistiger Energie von außen oder verhinderte, dass welche von drinnen herausdrang. Aber vor etwas, das sich bereits in seinem eigenen Kopf befand, schützte ein Dämpfer nicht. Eduin hatte einen Dämpfer benutzt, als er in einem Turm gelebt hatte, zuerst in Arilinn, wo er ausgebildet worden war, später für kurze Zeit in Hali und dann bis zur Zerstörung des Turms auch in Hestral.
Hali. Nur einen Halbtagesritt von Thendara entfernt, aber es hätte genauso gut auf einem anderen Planeten liegen können. Am anderen Ende der Stadt, am Ufer des geheimnisvollen wolkengefüllten Sees, erhob sich ein Turm zum Himmel, ein schlanker Alabasterfinger. Dort, wie in jedem anderen Turm, verbanden begabte Männer und Frauen ihren Geist, um unvorstellbare Dinge zu vollbringen, von der Herstellung von Waffen bis zum Heilen von Wunden. Relais sandten Botschaften über Ebenen und Berge; laran-geladene Batterien betrieben Luftwagen, beleuchteten Paläste und schützten die Geheimnisse von Königen.
Hali. Sie war einmal dort gewesen. Es war durchaus möglich, dass sie immer noch dort lebte.
Schmerz überwältigte ihn, aber es war nichts Körperliches.
Eduin sank auf den Strohsack und schlug die Hände vors Gesicht. Er atmete stoßweise und rang um die Beherrschung, die er in seinen Jahren als Laranzu, als Meister der geistigen Kraft namens Laran, erworben hatte. Bilder zuckten hinter seinen geschlossenen Augen auf, Fetzen von Erinnerungen, die er mit dem Alkohol weggewaschen hatte. Die hellen, durchscheinenden Steinmauern, die ein Gefühl von Licht und endlosem Raum bewirkten..., der ewig ruhelose Nebel des Hali-Sees... Dyannis, warm und anschmiegsam in seinen Armen.
Süße und Bitterkeit, Gefühle, die er längst für tot gehalten hatte, erfüllten ihn – Sehnsucht, Bedauern und andere Emotionen, die er nicht einmal benennen konnte. Er ließ sich wieder auf den Strohsack fallen, geschüttelt von lautlosem Schluchzen. Lange Zeit später kam es ihm so vor, als hielte ihn jemand fest, wiegte ihn, striche ihm über das verfilzte Haar.
Auch dieser Schmerz wird vergehen.
Wieder schlief er ein.
Er wanderte durch eine Traumlandschaft mit sanft geschwungenen Hügeln und einem Felsen, der neben einem Fluss aufragte. Er konnte sich nicht erinnern, je dort gewesen zu sein, aber etwas an diesem Ort rührte sein Herz. Die Luft schimmerte beinahe, die Wärme war hypnotisch. Die Zeit selbst schien den Atem anzuhalten. Zweige rührten sich, und kleine Lichtflecke fielen auf sein Gesicht. Rings um ihn her schwebten transparente Gestalten wie Wesen aus der Überwelt. Sie schwebten in sein Blickfeld und verschwanden dann wieder. Er spürte keine Gefahr von ihnen.
Er glaubte, Gesang in süßen Glockentönen zu hören, so schwach, dass es vielleicht auch nur die Brise in den Blättern war. Die Gestalten nahmen Substanz an. Aus dem Augenwinkel sah er schlanke Körper und Kaskaden silbrigen Haars. Augen und Haut hatten ein farbloses Strahlen an sich, als wären sie aus Mondlicht gemeißelt.
Nein, Menschen bewegten sich nicht mit solcher Grazie; das hier waren Chieri, Wesen, die bereits in jenen längst vergessenen Zeiten uralt gewesen waren, als die Menschen nach Darkover gekommen waren. Es hieß, dass sie im Wahnsinn des Geisterwinds ihre Wälder verließen, um Menschenfrauen als Geliebte zu nehmen. Sie traten dann als schöne, stolze Elfenlords auf, und daher kam es, dass in den Adern der Comyn das Blut der Chieri floss – und ihr Laran.
Ihre Stimmen kamen näher, während sie sich durch die trägen, feierlichen Figuren ihres Tanzes sangen. Vier Monde hingen am klaren Himmel und überzogen diesen mit ihrem vielfarbigen Pastelllicht.
Teils Klage, teils Jubel, hallten ihre Worte in Eduin wider. Er fühlte sich seltsam gewichtslos, als hätte das Lied der Chieri sein sterbliches Fleisch in Glas verwandelt. Nun bewegte er sich mitten unter ihnen, diesen Wesen, die seit hunderten von Jahren kein Mensch gesehen hatte und die nur durch Legenden bekannt waren. Ihr Blut floss in seinen Adern, sang in seinem Laran, bis tief in seine Seele hinein. Sie schauten ihn aus ihren wissenden, strahlenden Augen an und streckten die Hände aus, um ihn zu begrüßen.
Der gelbe Wald und der weiße, die Sterne, die sich langsam, langsam drehten... Der Schmerz des Exils, die Jahreszeiten in ihrem Zyklus wie der Schlag eines riesigen, lebendigen Herzens...
Und das Wichtigste: der endlose Tanz von Himmel und Baum, von Händen und Stimmen, miteinander verbunden, so ruhig, so traurig, so freudig, dass es einem das Herz brach, und der dann verklang...
Verklang...
Beim nächsten Mal erwachte Eduin rascher. Seine Sinne waren sogar noch schärfer geworden, und sein Hunger quälender. Er hatte tief geschlafen, war durch Träume gewandert, die mit jedem Herzschlag weiter davonglitten. Ein widerlicher Geruch ging von seinem Körper aus, alter Schweiß, Gossendreck und der Gestank nach Bier. Ihm wurde übel davon.
Es gab nichts zu essen, nur den vollen Krug. Mit einiger Anstrengung trank er das Wasser, das er nun als verdünnte Kirian-Tinktur erkannte, ein psychoaktives Destillat, das die Türme benutzten, um Schwellenkrankheit und andere geistige Krankheiten zu behandeln.
Eduin runzelte die Stirn, nachdem er alles getrunken hatte. Nur jemand, der ausgebildet war, würde wissen, wie man das Zeug herstellt, nicht davon zu reden, es angemessen zu verabreichen. In seinem Fall war die Wirkung eindeutig wohltuend. Es war unmöglich, dass er in die Hände von jemandem mit Turmausbildung gefallen war. Denn dann wäre er nicht in einem solchen Rattenloch gewesen und auch nicht mehr frei.
Nein, Verbrechen wie die seinen gerieten nicht so schnell in Vergessenheit.
Sein unbekannter Wohltäter hatte noch mehr getan, als den Krug neu zu füllen. Holzkohle glühte in dem kleinen Becken und strahlte gemütliche Wärme aus. Auf dem Tisch lag Kleidung, ein dickes Hemd und eine Hose, abgetragen und kunstlos gestopft, aber sauber.
Ganz oben lag eine Scheibe aus gebranntem Ton, deren Besitz zum Besuch eines der örtlichen Badehäuser berechtigte. Eduin griff nach der sauberen Kleidung und der Marke, zog seine Jacke an und ging auf die Straße hinaus. Er erkannte das Badehaus an dem stilisierten Rabbithorn auf dem Schild, dessen Gegenstück auf die Marke geprägt war.
Die Frau am Eingang inspizierte die Marke. »Seife, Handtücher und Rasur sind eingeschlossen. Ein Haarschnitt kostet extra.« Sie sah ihn kritisch an.
Er dachte daran, ihr zu versichern, dass er die Marke nicht gestohlen hatte, wie sie eindeutig annahm. Er hatte einen zu großen Teil seines Lebens damit verbracht, Ärger zu machen, wo es keinen gab. Er wollte auf keinen Fall riskieren, vor die Cortes geschleppt zu werden, weil man ihn verdächtigte, ein Bad gestohlen zu haben.
»Das ist in Ordnung«, sagte er daher bescheiden.
Die Wanne hatte kaum eine Armeslänge Durchmesser. Die Holzwände waren vom Alter samtig und stanken nach Schwefel, aber das störte ihn nicht. Das Wasser reichte ihm bis über die Schultern. Als er an sich hinunterschaute, erkannte er diesen Körper kaum als seinen eigenen wieder. Wann war er so mager geworden, seine Haut so kränklich blass und gezeichnet von den kleinen roten Bissen der Läuse? Woher stammten die Narben auf seinen Rippen – von einem Streit mit einem Mann, der noch weniger Grund hatte zu leben als er selbst?
Seufzend lehnte er den Kopf gegen den Wannenrand, während die Hitze tief in seine Muskeln drang. Sein Haar hing ins Wasser.
Er hätte nicht sagen können, wie lange er in der Wanne gesessen hatte und immer wieder erwacht und erneut eingeschlafen war. Das Wasser wurde kühl. Er stand auf, bemerkte die runzlige Haut an seinen Händen und griff nach der Seife. Als er sich zweimal eingeseift und das Haar dreimal gewaschen hatte, war das Wasser schaumig vor Dreck. Ein Eimer mit Abspülwasser stand in der Ecke. Er stieg aus der Wanne und goss es über sich, obwohl es ihn schaudern ließ. Er trocknete sich mit den rauen Handtüchern ab und packte seine alten Sachen zu einem Bündel. So schmutzig sie waren, sie waren vielleicht doch einen Reis oder zwei für Lumpen wert.
Nachdem er seine neuen, sauberen Sachen angezogen hatte, steckte er ein kleines Bündel in den Hosenbund. Seine Finger verharrten noch einen Augenblick darauf. In der vor Dreck starren Seide befand sich der einzige Besitz, den er nie verkaufen konnte, ganz gleich, wie verzweifelt er sein mochte. Wenn man es an ihm entdeckte, würde man zweifellos erkennen, dass er ein abtrünniger Laranzu war, aber er konnte nicht wagen, es nicht am Körper zu tragen. Der hellblaue Sternenstein war ihm bei seinem Eintritt in den Turm von Arilinn überreicht worden. Während seiner Ausbildung hatte er ihn benutzt, um sein Laran zu konzentrieren und zu verstärken, sodass der Stein zu einer kristallisierten Ausweitung seines eigenen Geistes geworden war. Sollte er verloren gehen, gestohlen werden oder in die Hände eines anderen als eines Bewahrers fallen, wäre es gut möglich, dass der Schock Eduins Herz zum Stillstand brachte.
Eduin konnte sich nicht daran erinnern, wann er zum letzten Mal von einem anderen rasiert worden war. Der Barbier, ein drahtiger alter Mann, dem mehr Haare aus den Warzen an seinem Kinn wuchsen als auf dem Kopf, summte bei der Arbeit vor sich hin. Als er nach Eduins immer noch feuchtem Haar griff, wandte dieser ein, dass er für einen Haarschnitt nicht bezahlt hatte.
»Ach, aber es wäre ein Verbrechen, Euch so sauber und hübsch und mit solchem Haar gehen zu lassen. Ihr könnt diese verfilzten Stellen nicht mehr auskämmen, nicht einmal mit einem Pferdestriegel. Außerdem gibt es so etwas wie Berufsstolz.«
Eduin bedankte sich leise – nicht nur für den Haarschnitt, sondern auch für die Freundlichkeit des Mannes. Es war lange her, seit sein Leben solchen Luxus erlebt hatte.
Die nächsten Stunden verbrachte er damit, durch die Straßen zu wandern. Die Umgebung war ihm vertraut, und dennoch kam es ihm vor, als hätte er nie den Teil dieser Straßen gesehen, der oberhalb der Gosse lag. Als er zu dem Raum zurückkehrte, war die Tür nur angelehnt.
Ein hoch gewachsener, schlanker Mann blickte vom Tisch auf. Er trug einen kurzen Umhang mit einer Kapuze, die er tief ins Gesicht gezogen hatte. Eduin wusste, dass er seinen geheimnisvollen Wohltäter vor sich hatte.
»Ich bin froh, dass Ihr zurückgekehrt seid«, sagte er, »damit ich mich für alles bedanken kann, was Ihr für mich getan habt.«
»Das ist nicht notwendig«, lautete die Antwort. Die Stimme klang vertraut, als hätte Eduin sie in seinen alkoholdurchtränkten Träumen gehört. »Denn Gleiches zieht einander an, und Geist hat auf Geist geantwortet.«
»Ich – ich weiß nicht, was Ihr meint«, stotterte Eduin beunruhigt.
»O doch. Denn wer außer einem anderen Laranzu könnte erkennen, was du wirklich bist?«
Der Mann hob die Hand, zog die Kapuze zurück und enthüllte ein kantiges, wettergegerbtes Gesicht und das hellrote Haar der laran-begabten Comyn.
2
Adrenalin schoss durch Eduins Nerven; Entsetzen, das von Jahren des Versteckens herrührte. Nur ein Angehöriger der Comyn, Darkovers telepathischer Kaste, konnte solch flammend rotes Haar haben und würde imstande sein, Eduins Laran zu bemerken. Eduin konnte sich kaum an die Hälfte der Dinge erinnern, die er im vergangenen Jahr getan hatte, aber er hätte sein Leben – so wenig das auch wert sein mochte – darauf verwettet, dass seine geistige Schilde nicht nachgelassen hatten. Sie waren ebenso Teil von ihm wie sein Atem oder das Geräusch seines Herzens in der Stille vor dem Morgengrauen. Sobald seine Macht sich gerührt hatte, hatte man ihn darauf gedrillt, seine innersten Geheimnisse zu wahren. Und das hatte er getan, sogar seinen eigenen Bewahrern in Arilinn und Hali gegenüber. Wenn diese Männer, die mächtigsten und am besten ausgebildeten Telepathen von Darkover, nicht imstande gewesen waren, seine Barrieren zu durchdringen, dann war es doch sicher unmöglich, dass es diesem abgerissenen Fremden gelungen sein sollte, ganz gleich, welche Farbe sein Haar hatte und wie dreist er sich gab.
»Ich weiß nicht, wovon Ihr redet«, sagte Eduin also.
»Erniedrigen wir uns nicht mit kleinlichen Spielchen«, erwiderte der Fremde. »Jeder von uns hält das Schicksal des anderen in seinen Händen. Man nennt mich Saravio.«
Eduins Blick zuckte noch einmal zu dem flammend roten Haar des Mannes und der Kapuze, die nun auf seinen Schultern lag. Man nennt mich..., hatte er gesagt. Nicht ich bin oder mein Name ist. Was verbarg er? War er ebenfalls ein Abtrünniger aus einem Turm, auf den eine Belohnung ausgesetzt war? Hatte er erraten, dass sich Eduin in einer ähnlichen Situation befand?
»Du kannst mich Eduin nennen«, sagte er mit bewusst sanfter Stimme. Saravio hatte keinen Familiennamen genannt, aber das war vielleicht nicht mit böser Absicht geschehen. Viele illegitime Kinder großer Comyn-Lords fanden ein Zuhause in den Laran-Kreisen. Dort zumindest waren die Fähigkeiten eines Menschen wichtiger als sein Titel.
Einen Augenblick später fragte Eduin: »In welchem Turm wurdest du ausgebildet?«
»Wahrheit für Wahrheit, mein Freund. Ich werde meinen Turm nennen, wenn du mir deinen verrätst.«
»Was bringt dich auf die Idee, dass ich in einem Turm ausgebildet wurde?«, fragte Eduin. »Du hast mich in der Gosse gefunden; das ist kaum ein angemessener Platz für einen mächtigen Laranzu.«
Saravio lachte. »Und dein Haar ist Schlammfarben und nicht rot. Aber was bedeutet das schon? Dann behalte deine Geheimnisse eben für dich, und saufe dich zu Tode oder erfriere, weil du nicht mehr genug Verstand hast, dir einen Unterschlupf zu suchen. Falls du jedoch...«
In einem raschen Stimmungswechsel kniff er die Augen zusammen. »Falls man dich geschickt hat, um mich auszuspionieren, wirst du dir wünschen, du wärest draußen im Schnee geblieben.«
Ohne jede Vorwarnung wurde Eduin von einem Ausbruch psychischer Macht aus dem Geist des anderen getroffen. Er wich zurück. Telepathischer Kontakt bedeutete Entdeckung, und Entdeckung bedeutete Tod. Instinktiv wehrte er die Sondierung ab und benutzte Fähigkeiten, die er nicht mehr eingesetzt hatte, seit er den Turm von Hestral verlassen hatte.
Ah, dann bist du also im Exil, genau wie ich. Diesmal war Saravios geistige Berührung sanfter und mitleidiger.
Das hier ist gefährlich, erwiderte Eduin lautlos. Es gab keine Fluchtmöglichkeit. Er hatte bereits zu viel von sich preisgegeben. Aber was hatte Saravio darüber gesagt, dass jeder von ihnen das Schicksal des anderen in den Händen hielt? Er wurde neugierig.
»Bist du ebenfalls ein Flüchtling?« Er sprach laut, denn er hatte immer noch Angst vor geistiger Kommunikation. Aber Saravio ließ sich nicht anmerken, ob er Eduins unbewachte Gedanken aufgefangen hatte oder nicht.
»In gewissem Sinne«, antwortete Saravio. »Auf mich ist keine Belohnung ausgesetzt, wenn du das meintest. Mein eigenes Gewissens hat mich zum Ausgestoßenen gemacht.« Er warf einen Blick auf die mit Papier bespannten Fenster und die Stadt dahinter.
»Mein Turm, Cedestri, hat mich ausgestoßen«, sagte er verbittert. »Denn sie waren zu Verbündeten des Bösen geworden.«
Eduin runzelte die Stirn. Cedestri lag zwei oder drei Tagesreisen von Thendara entfernt in Richtung der Trockenstädte. Während seiner kurzen Zeit in Hali hatte er gehört, dass dort erforscht wurde, wie man Spurenelemente aus Sand gewinnen konnte – kaum etwas Gefährliches oder Kontroverses.
Saravios Blick verlor sich in der Ferne. »Als die wiedererbauten Türme von Neskaya und Tramontana den verfluchten Pakt der Hasturs Unterzeichneten, haben viele, die sich nicht daran halten konnten, in Cedestri Aufnahme gefunden. Aber am Ende war Cedestri nicht aufgeklärter als jeder andere Turm. Sie haben mich weggeschickt.«
»Der Arm der Hasturs reicht weit«, sagte Eduin. Er wählte seine Worte vorsichtig und beobachtete die Reaktion. »Ich fürchte, es wird eine Zeit kommen, in der ganz Darkover sich unter das Joch ihrer Herrschaft beugt und die Türme vollkommen in ihrem Dienst stehen.« Er setzte sich auf den Strohsack. »Ich bin kein Freund der Hasturs oder ihres Pakts.«
Er hätte es vielleicht einmal sein können, denn er hatte Carolin Hastur kennen gelernt. Als Jungen waren sie in Arilinn zusammen gewesen, wo der junge Prinz sich kurz nach dem Beginn von Eduins Ausbildung eine Weile aufgehalten hatte. Gegen seinen Willen hatte er den lässigen, großzügigen Carolin lieb gewonnen. Er fragte sich, ob es ihm vielleicht deshalb nie gelungen war, Carolin zu töten, oder ob es nur eine Mischung aus Pech und der teuflischen Einmischung von Carolins anderem Freund Varzil Ridenow gewesen war.
Saravio setzte sich. »Was ist deine Geschichte, Freund? Wieso hasst du die Hasturs so?«
Wo sollte er anfangen? Er kam zu dem Schluss, dass es besser wäre, nicht über den letzten Vorfall zu sprechen. Ein Gesetzloser zu sein, war genügend Grund, etwas gegen die Hastur-Familie zu haben.
»In den Tagen von König Carolins Exil«, begann er, »hat Rakhal, der Usurpator, eine Armee nach Hestral geschickt, um uns zu zwingen, Haftfeuer für seine Kriege herzustellen.«
Kurz berichtete er darüber, was als Nächstes geschehen war. Der Bewahrer von Hestral hatte sich geweigert, hatte erklärt, die alten Vorräte des ätzenden Brandmittels wären vernichtet worden und er würde kein neues mehr herstellen. Er weigerte sich allerdings auch, die gewaltige geistige Kraft seines Kreises zu benutzen, um den Turm aktiv zu verteidigen. Er gab sich damit zufrieden, einfach jeden Angriff zu neutralisieren und zu hoffen, dass Rakhals Leute sich nach einiger Zeit leichterer Beute zuwenden würden. Bei der Erinnerung verspürte Eduin ein Echo seines alten Zorns.
Tag um Tag waren sie belagert worden und dem Hungertod immer näher gekommen. Verzweifelt über die Untätigkeit des Bewahrers hatte Eduin schließlich eine Gelegenheit genutzt, Rakhals Armee zu besiegen. Insgeheim hatte er einen Kreis der stärksten Arbeiter versammelt. Gemeinsam hatten sie die Feinde mit Entsetzen und Wahnsinn erfüllt. Er hätte Erfolg gehabt, wäre er nicht entdeckt und von Varzil Ridenow in Gewahrsam genommen worden.
Eduin versuchte nicht einmal, seine Bitterkeit zu verheimlichen, als er diesen Teil der Geschichte erzählte. Zur Strafe hatte Hastur den Turm von Hali in den Kampf befohlen. Als sie den Turm von Hestral einstürzen ließen, hatte Eduin der Gefangenschaft entkommen können.
Als er seine Geschichte beendet hatte, nickte Saravio, die Lippen zusammengekniffen. In diesem Augenblick bemerkte Eduin eine Art von Verwandtschaft zwischen ihnen.
Wir sind wie Brüder, dachte er. Unsere Begabung und Ausbildung macht uns unfähig, in der normalen Welt zu leben. Die Türme, die uns zu dem gemacht haben, was wir sind, haben uns ausgestoßen und zu einem Leben im Verborgenen gezwungen.
Es war so lange her, dass ein anderer Mensch verstanden hatte, wie es war. Selbst sein Vater...
Eduin brach den Gedanken ab. Er hob unwillkürlich die Hand an die Schläfe. »Ich danke dir für deine Hilfe gestern Abend, fetzt werde ich mich auf den Weg machen.«
Er wagte nicht zu bleiben. Die Gefahr, entdeckt zu werden, war zu groß, denn selbst ein anderer Flüchtling würde sich vielleicht von der Belohnung verlocken lassen. Zandru allein wusste, dass es Zeiten gegeben hatte, in denen Eduin sich am liebsten selbst für einen Krug Bier verkauft hätte.
Beweg dich, und lass dich nicht sehen, war seit dieser verzweifelten Flucht aus Hestral seine Parole gewesen.
Er schloss die Tür hinter sich. Mit einigem Glück würden sie einander nie wieder begegnen.
Draußen blendete ihn das helle Tageslicht beinahe. Ansonsten fühlte er sich ausgesprochen gut. Wie lange das dauern würde, wusste er nicht. Er würde die Zeit nutzen, sich ein wenig Geld zu verschaffen, um vielleicht selbst ein kleines Zimmer zu mieten und sich, so lange er konnte, unauffällig zu verhalten.
In den nächsten beiden Tagen arbeitete er für einen Schmied, dessen Lehrling am Lungenfieber erkrankt war, schleppte Wasser und Holzkohle und verdiente sich eine Mahlzeit und eine Unterkunft für die Nacht. Das Bedürfnis zu trinken nagte hin und wieder an ihm, aber er zwang sich, es zu ignorieren. Stattdessen rollte er sich auf dem Strohsack in der Hütte hinter der Schmiede zusammen, schlang die Arme um den Oberkörper und klammerte sich fest. Solange der Druck in seinem Kopf nicht zurückkehrte, sagte er sich immer wieder, würde alles in Ordnung sein. Er konnte denken, er konnte anfangen, Pläne zu schmieden.
Stunden vergingen. In der Nacht stand er auf, um Wasser aus dem mit Eis verkrusteten Eimer zu trinken, dann kroch er schaudernd wieder ins Bett. Während er dort lag und darauf wartete, dass der Schlaf zurückkehrte, musste er wieder an diesen Traum von Licht und Gesang denken. Die Erinnerung verschwamm bereits. Er wusste nicht mehr genau, wo er gewesen war, mit wem er getanzt und warum er solch übermütige Freude empfunden hatte. Sein Herz schmerzte vor Sehnsucht, aber er hatte nicht das Bedürfnis, sie in Alkohol zu ertränken. Stattdessen drückte er sie an sich wie einen kostbaren Gegenstand, diese halb erinnerte Schönheit.
Nach dem Vormittag des dritten Tags brauchte der Schmied ihn nicht mehr. Eduin beschloss, es in einem der Mietställe zu versuchen, wo er manchmal die Pferdeboxen ausgemistet hatte, wenn er nicht zu betrunken gewesen war. Ein paar würden ihm vielleicht immer noch Arbeit geben. Auf dem Weg zu diesem Stadtviertel veränderte sich etwas in ihm – als ob eine Wolke sich vor die Sonne schieben würde. Druck streifte seine Schläfen, und sein Magen zog sich zusammen.
Töte die Hasturs... Töte sie alle...
Nein, das war unmöglich! Nicht nach so vielen Tagen.
Versagt..., flüsterte die vertraute gnadenlose Stimme. Du hast versagt.
Eduins Magen zog sich zusammen. Galle stieg ihm in den Mund. Er bebte wie ein Mann mit Schüttellähmung. Ihr Götter, er musste unbedingt etwas trinken. Er brauchte Alkohol.
Bevor er die nächste Kneipe erreichte, traf ihn der Zwang mit voller Kraft. Er taumelte und sackte gegen die Seite des Gebäudes. Die Kanten von Stein und Mörtel stachen durch die Schichten seiner Kleidung. Seine Gedanken wurden klarer, und der Schmerz schob das Verlangen einen Augenblick beiseite. Das Bedürfnis zu trinken zog sich ein wenig zurück, und ein noch tieferes Verlangen begann in seinem Bauch zu toben, der zerschmetternde Drang zu suchen..., zu vernichten...
Töte..., t-t-töte... Die Silben klackten wie die Zangen eines Trockenstadtskorpions.
Er schrie auf und sank an der Wand nach unten. Ob er sich nun das Gesicht zerkratzte, sich die Ohren zuhielt oder in einem Meer von Bier ertrank, er konnte sich dieser lautlosen, beharrlichen Forderung nicht entziehen.
Flucht war unmöglich. So war es immer gewesen. Wie dumm von ihm zu glauben, es könnte anders sein.
Verzweiflung zerriss ihn, Welle um Welle, so intensiv, dass er es nicht ertragen konnte. Wie lange er dort gelegen hatte, halb an die grob gemauerte Wand gesackt, halb im Dreck der Gosse, hätte er nicht sagen können.
Schließlich begannen seine Gedanken sich wieder zu regen, zusammen mit neuem Durst.
Trinken – Alkohol würde diese Schlinge um seine Seele lockern. Nur dieses eine Mal. Nicht genug, um völlig betrunken zu sein, nur um der schlimmsten Qual zu entgehen, damit er klar denken konnte.
Ein paar Stunden Ausmisten in einem der ärmeren Mietställe und der Verkauf seines Bündels schmutziger Kleidung brachten ihm genug für einen Krug vom billigsten Bier, das er finden konnte.
Im Bierhaus suchte sich Eduin einen wackligen Tisch in einer nach Schimmel riechenden Ecke. An der Theke tranken Männer, lachten und erzählten unflätige Geschichten. Er war zufrieden, dass man ihn in Ruhe ließ.
Zunächst trank er schnell wie immer. Die ersten Schlucke brannten in seiner Kehle. Er schloss die Augen und wartete darauf, dass die vertraute Wärme sich in seinem Bauch ausbreitete. Noch ein Schluck und dann noch einer. Bald schon schmeckte er das Zeug nicht mehr; sein Hals schien weiter zu werden und die Flüssigkeit einzusaugen. Erleichterung breitete sich aus, das unaufhaltsame Drängen ließ ein wenig nach.
Seufzend goss er den Rest aus dem Krug in seinen Becher und trank ihn aus.
Er taumelte nur ein wenig, als er zur Theke ging, um noch einen Krug zu kaufen. Einer der Männer erzählte gerade eine Geschichte über einen betrunkenen Bauern und sein geduldiges Chervine. Eduin bemerkte, dass er lachen musste, ein Lachen, das seinen ganzen Körper erschütterte und durch ihn hindurchrollte.
Jemand schlug ihm auf den Rücken.
»Noch einen Krug für diesen feinen jungen Mann.«
Eduin nahm einen weiteren vollen Krug entgegen und hob ihn zum Gruß. Der Alkohol floss durch seine Kehle wie Honig. Jemand begann ein Lied zu singen, und andere Gäste stampften oder klatschten rhythmisch dazu.
»Ein Prosit dem Mann, der sein Bierchen genießt, einem glücklichen Manne, den nichts verdrießt. Ein Prosit dem Mann, der sein Bierchen genießt, Und ein Prosit all seinen Freunden!«
Eduin warf den letzten Rest seines Lohns für einen weiteren Krug auf die Theke. Ein Lied ging ins nächste über. Er zog sich wieder in seine Ecke zurück und gab sich damit zufrieden, aus dem Schatten mitzusummen. Alles rings um ihn her verschwamm, es blieb nur die selige Stille in ihm. Er sackte gegen die Wand und wiegte den Krug in den Armen. Die Flüssigkeit schwappte tröstlich, und dann schwappte nichts mehr. Der Krug kippte um. Eduin konnte nicht mehr klar sehen, aber das Gefäß schien leer zu sein.
Das zählte nicht; es genügte, einfach hier zu sitzen..., hier zu liegen, auf dem Boden, eingezwängt zwischen Tischbein und Wand, sein Körper zu einem Knoten seligen Schweigens zusammengerollt.
Stimmen drangen auf ihn ein, aber er winkte ab. Lasst mich schlafen. Sie verschwanden eine Weile, dann kehrten sie zurück, verärgerter und beharrlicher als zuvor.
»Kommt schon, steht auf, Freund...«
Die Stimme hallte auf seltsame Weise wider. »Wir machen zu. Hast du ein Zuhause?«
Dann stand er aufrecht, feste Hände hielten ihn, und die Welt drehte sich. Seine Beine bewegten sich unter ihm, als gehörten sie einem anderen.
»Lass mich in Ruhe...« So warm, so still.
»Ich kümmere mich um ihn.« Die Stimme war heiser, aber vertraut. Der Mann, der ihm einen Krug spendiert hatte.
»Wie wäre es mit noch einem?«, fragte Eduin.
»Ich sollte ihn lieber in eine der Unterkünfte des Königs bringen«, sagte der Mann. »Das ist genau der richtige Platz.«
Nein! Dort würden Comyn als Kadetten dienen, und es würde von Männern der Stadtwache nur so wimmeln. Man würde ihn erkennen und...
Eduin wich zurück. »Ich brauche keine Hilfe. Weder von dir noch von diesem Mist... noch vom König.«
»Immer mit der Ruhe, Freund. Wir versuchen nur zu helfen.«
»Ich gehe nach Hause..., kein Problem..., kann alleine gehen.« Eduin eilte auf die Tür zu, bevor sie ihn aufhalten konnten.
Die kalte, feuchte Luft traf ihn wie ein Schlag. Er musste sich anstrengen, auf den Beinen zu bleiben, stolperte ein paar Schritte, dann brach er zusammen. Er raffte sich wieder auf und drehte sich zu dem Bierhaus um. Ein Mann zeichnete sich als Silhouette vor dem Licht von drinnen ab.
Dann verschwand das Rechteck aus gelbem Licht.
Nur noch das schwache Flackern von Kerzen war in den Fenstern im oberen Stockwerk zu sehen, und eine Querstraße weiter brannte eine einzelne Fackel. Kein Mond schien, keine Sterne waren zu sehen. Der Wind hatte eisige Spitzen und drohte mit Schlimmerem.
Finde einen trockenen, windgeschützten Platz, drängte er sich, und dann schlaf einfach...
Halb kriechend, halb stolpernd bewegte er sich auf die flackernde Fackel zu. Die wenigen Türen, an denen er vorbeikam, waren fest verschlossen. Er suchte nach einem Torbogen, einer Nische, irgendetwas, was ein wenig Schutz bieten konnte. Er fand nichts, aber das zählte nicht wirklich. Die Nacht war nicht so kalt. Der Wind war nicht viel mehr als eine leichte Brise. Sein Körper kam ganz von selbst unter einem vorspringenden Giebel zur Ruhe. Aus den Augenwinkeln heraus sah Eduin, wie die Fackel zu spucken begann und dann ausging.
Dunkelheit verschlang ihn.
»Du da!« Finger gruben sich in seinen Arm, Hände zogen ihn hoch.
Er blinzelte in die unerwartete Helligkeit. Eine Fackel erhellte die Nacht. Ein Mann hielt diese Fackel, während ein anderer ihn auf die Beine zerrte. Er schnappte nach Luft und atmete den säuerlichen Geruch von Erbrochenem ein. Der Wind blies in grausamen Böen, schnitt durch seine Kleidung, brannte auf seiner Haut.
»Bah!«, schnaubte der Mann, der ihn festhielt, angewidert. »Er stinkt zum Himmel!«
»Er ist keine Gossenratte.« Der zweite Mann war ein wenig näher gekommen. »Sieh dir seine Kleidung an.«
Eduin bemerkte die Abzeichen an ihren Umhängen, die Schwerter am Gürtel, die gewichsten Stiefel, das präzise geschnittene Haar.
Stadtwachen. Bei Zandrus siebter Hölle!
»Er ist nur ein armer Teufel, der mehr getrunken hat, als ihm gut tut«, sagte der zweite Mann und hob die Fackel noch höher. »Bringen wir ihn rein, bis er wieder nüchtern ist.«
»In Ordnung«, erwiderte der erste. Er drehte Eduin um und schob ihn in Richtung des Wachhauptquartiers.
In beinahe instinktivem Entsetzen erstarrten Eduins Muskeln.
Der Wachmann hatte keinen Widerstand erwartet. »Heh, du kannst nicht einfach gehen. Du wirst dich zu Tode frieren!«
Eduin drehte sich um und rannte. Irgendwie brachte er seine Beine dazu, ihm zu gehorchen. Er rannte weiter auf die dunklen Gassen zu. Seine einzige Hoffnung war Flucht, und er klammerte sich daran wie an eine Rettungsleine. Jahre des Verbergens, des heimlichen Umherschleichens führten ihn. Die Wachen riefen ihm hinterher, er solle stehen bleiben, aber er rannte weiter, stolperte um Ecken, spürte kaum den Biss des Windes oder den Aufprall, wenn er gegen eine Wand stieß.