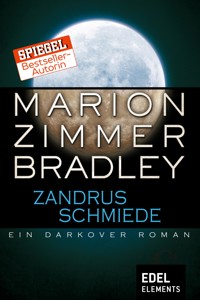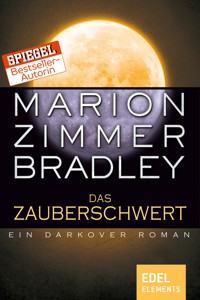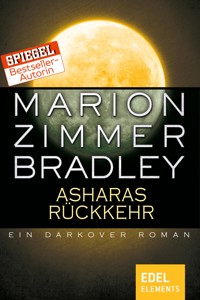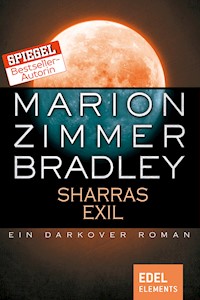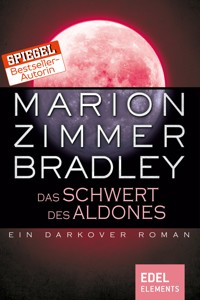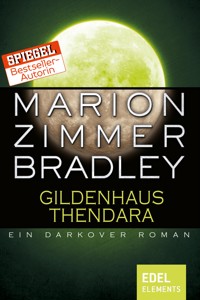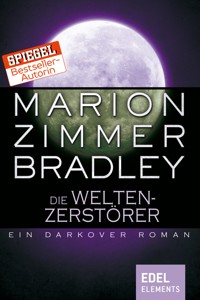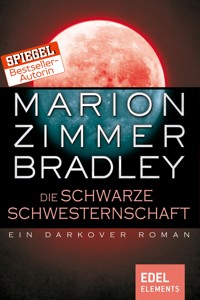
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Darkover-Zyklus
- Sprache: Deutsch
Bestsellerautorin Marion Zimmer Bradley ("Die Nebel von Avalon") hat mit dem opulenten Darkover-Zyklus eine einzigartige Romanreihe geschaffen: Die fesselnde Geschichte einer geheimnisvollen fremden Welt und ihrer Bewohner ist Kult! Zunächst sieht es so aus, als sei es nur eine harmlose Rettungsmission: Margali, Jaelle und eine Gruppe Freier Amazonen erhalten den Auftrag, einen Piloten zu suchen, der in der zerklüfteten Landschaft Darkovers verschollen ist. Dann aber wird Margali von unheilvollen Träumen gequält, die ein schlechtes Omen für die Mission bedeuten könnten… Magdalen Loren, ehemalige terranische Agentin, hat sich mittlerweile im Gildenhaus Thendara eingelebt. Da erhält sie eine Botschaft vom terranischen Nachrichtendienst, dass ihre Kollegin Alexandra Anders auf unerforschtem Gebiet abgestürzt ist. Mit Hilfe ihres Matrix-Steins nimmt Magdalen Kontakt zu der Verschollenen auf – und findet Merkwürdiges heraus. Kurz vor ihrem Absturz hatte Alexandra die Vision von schwarz gekleideten Frauen in einer verborgenen Stadt. Magdalen und Alexandra machen sich, unabhängig voneinander, auf den Weg, um die geheimnisvolle Stadt zu finden. Eine abenteuerliche Reise nimmt ihren Anfang, die einige Weggefährtinnen das Leben kosten wird. Denn immer wieder versucht eine geheimnisvolle Gegnerin, den Erfolg der Expedition zu verhindern.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 587
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Marion Zimmer Bradley – Der “Darkover”-Romanzyklus bei EdeleBooks:
Marion Zimmer Bradley
Die schwarze Schwesternschaft
Ein Darkover Roman Ins Deutsche übertragen von Rosemarie Hundertmarck
Copyright dieser Ausgabe © 2014 by Edel eBooks, einem Verlag der Edel Germany GmbH, Hamburg.
Copyright © 1983 by Marion Zimmer Bradley
Copyright First german Edition © 2000 by Droemersche Verlagsanstalt Th. Knaur Nachf., München.
Ins Deutsche übertragen von Rosemarie Hundertmarck
Trotz intensiver Recherche war es dem Verlag nicht möglich, den Rechteinhaber der Übersetzung zu identifizieren bzw. einen Kontakt herzustellen. Wie bitten den Übersetzer bzw. seinen Nachfolger, sich ggf. beim Verlag zu melden.
Covergestaltung: Agentur bürosüd°, München
Konvertierung: Datagrafix
Alle Rechte vorbehalten. All rights reserved. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des jeweiligen Rechteinhabers wiedergegeben werden.
ISBN: 978-3-95530-595-6
edel.comfacebook.com/edel.ebooks
1. Kapitel
Der Bote war eine Frau, und obwohl sie darkovanische Kleidung trug, war sie keine Darkovanerin und nicht daran gewöhnt, des Nachts auf den Straßen der Altstadt von Thendara unterwegs zu sein. Sie hielt sich daran, daß anständige Frauen selten belästigt werden, wenn sie sich um ihre eigenen Angelegenheiten kümmern, sich benehmen und dreinblicken, als hätten sie ein bestimmtes Ziel. Deshalb trödelte sie nicht, sondern blieb ständig in Bewegung.
Sie hatte ihre Lektion so gut gelernt, daß sie auch den Marktplatz raschen Schrittes überquerte, weder nach links noch nach rechts sah, die Augen immer geradeaus.
Die rote Sonne von Cottman Vier, inoffiziell von den Beschäftigten auf dem Raumhafen des Terranischen Imperiums die Blutige Sonne genannt, schwebte am Rand des Horizonts und erzeugte ein angenehmes Zwielicht von rötlichem Umbra. Ein einziger Mond, im Abnehmen begriffen, stand wie ein blaßvioletter Schatten hoch am Himmel. Auf dem Markt schlössen die Händler die Läden an den Frontseiten ihrer Stände. Eine Frau, die gebratenen Fisch verkaufte, kratzte die letzten knusprigen Krumen aus dem Kessel. Ein paar herrenlose Katzen beobachteten sie dabei. Sie warf ihnen die Reste hin und provozierte unter ihren Füßen einen Katzenkrawall, dem sie eine Weile belustigt zusah. Dann legte sie den Kessel auf die Seite und filterte das Fett durch mehrere Lagen Tuch. In der Nähe ließ ein Sattelmacher die Rolläden seines Stands hinunterrasseln und sicherte sie mit einem Vorhängeschloß.
Ein reicher Mann, dachte die darkovanisch gekleidete Terranerin. Er kann sich ein terranisches Metallschloß leisten. Der Planet Darkover, Cottman Vier für die Terraner, war arm an Metallen. Andere Händler banden ihre Läden mit Stricken fest und verließen sich darauf, daß es dem Nachtwächter auffallen würde, wenn eine unbefugte Person sich daran zu schaffen machte. Eine Bäckerin brachte gerade noch ihre letzten altbackenen Rosinenbrötchen an den Mann. Sie blickte auf, als die terranische Botin mit schnellen Schritten vorüberging.
„He! Vanessa n’ha Yllana, wohin so eilig?“
Vanessa strebte so entschlossen vorwärts, daß sie mehrere Schritte über den Stand der Bäckerin hinaus war, bevor sie die Worte wirklich hörte. Sie blieb stehen, kehrte zurück und lächelte der rundlichen Frau zu, die einem kleinen Jungen mit einem Rosinenbrötchen in der Hand gerade das Wechselgeld herausgab.
„Sherna“, entschuldigte sie sich, „ich habe dich gar nicht gesehen!“
„Das habe ich mir gedacht“, lachte die Bäckerin. „Du bist gerannt, als wolltest du zumindest eine Banshee-Kolonie vernichten, meine Liebe! Möchtest du ein Brötchen?“ Vanessa zögerte, und Sherna drängte: „Nimm ruhig, es hat keinen Sinn, sie ins Gildenhaus zurückzutragen, denn es sind nicht genug, daß jeder eins zum Abendessen haben könnte.“
So aufgefordert, nahm sich Vanessa eins der übriggebliebenen Brötchen und biß hinein. Es schmeckte herzhaft nach den gemahlenen Nüssen, mit denen das Mehl gestreckt war, und süß nach getrockneten Früchten. Der Kaufmann nebenan begann, das Pflaster vor seinem Laden zu fegen, und Vanessa, noch kauend, trat automatisch zur Seite.
„Bist du unterwegs zum Gildenhaus, oder hast du etwas anderes vor?“ erkundigte sich Sherna.
„Zum Gildenhaus“, antwortete Vanessa. „Ich hätte gleich daran denken sollen, zu dir zu kommen, damit wir den Weg gemeinsam machen können!“ Insgeheim ärgerte sie sich über sich selbst. Wo hatte sie ihren Verstand gelassen?
„Gut“, nickte Sherna. „Du kannst mir helfen, die Körbe zu tragen. Aber heute abend ist kein Brücken-Treffen, nicht wahr?“
„O nein, nein, nicht daß ich wüßte.“ Vanessa ergriff einen der Brotkörbe. „Ich habe eine Botschaft für Margali n’ha Ysabet. Ich kann nicht begreifen, warum die Gildenmütter sich weigern, im Gildenhaus einen Kommunikator installieren zu lassen. Dann wäre es nicht mehr notwendig, Boten durch die Straßen zu schicken, vor allem nach Dunkelwerden.“
Sherna lächelte nachsichtig. „Du Terranan! Soll der Lärm von dem Ding bei Tag und Nacht in unsere Privatsphäre eindringen, nur um einem Boten die Mühe zu sparen, ein paar Minuten bei gutem Wetter zu laufen? Ah, deine armen, mißbrauchten Füße, das Herz tut mir weh um die faulen Dinger!“
„Das Wetter ist nicht immer so gut“, protestierte Vanessa, aber es war ein alter Streit, den die Frauen gewohnheitsmäßig führten, und nicht böse gemeint.
Beide Frauen waren Mitglieder der Brücken-Gesellschaft (Penta Cori’yo), die vor ein paar Jahren gegründet worden war. Damals hatten sich Mitglieder der Freien Amazonen (Comhi’ Letziis, die Gilde der Entsagenden) als erste Darkovaner erboten, als medizinisch-technische Assistentinnen, als Bergführerinnen und Reiseleiterinnen, als Übersetzerinnen und Sprachlehrerinnen für das Terranische Hauptquartier zu arbeiten. Die Brücken-Gesellschaft gab ihnen ein Heim und Freundinnen unter darkovanischen Frauen, und für Terranerinnen, die bereit waren, nach den Gesetzen der Entsagenden zu leben, aber nicht ins Gildenhaus eintreten konnten, gab es sogar eine eigens abgeänderte Form des Eides. Die Brücke unterhielt ein Wohnquartier für Darkovanerinnen, meistens Entsagende, die durch ihre Arbeit gezwungen waren, im Terranischen HQ zu leben.
Es stand jeder Darkovanerin offen, die drei der aus vierzig Tagen bestehenden Mondzyklen im Terranischen HQ Dienst getan hatte, und jeder Terranerin, die die gleiche Zeit in einem Gildenhaus gewesen war. Sherna n’ha Marya, eine Entsagende aus dem Thendara-Gildenhaus, war ein halbes Jahr als Übersetzerin tätig gewesen und hatte geholfen, Nachschlagewerke in Casta und Cahuenga, den beiden Sprachen Darkovers, zusammenzustellen. Vanessa ryn Erin, eine Absolventin der Terranischen Akademie für Nachrichtendienst auf Alpha, war jetzt vier Jahre auf Darkover. Den größten Teil des letzten Jahres hatte sie im Gildenhaus gewohnt und sich auf den Feldeinsatz außerhalb des Hauptquartiers vorbereitet.
Sherna gab die letzten süßen Brötchen einer Frau, die ein kleines Kind auf dem Arm trug, während sich ein zweites an ihren Rock klammerte. „Nehmt sie für die Kleinen. Nein, nein“, wehrte sie ab, als die Frau nach Münzen zu suchen begann, „sie kämen ja doch nur als Hühnerfutter in den Eimer. So, Vanessa, das haben wir gut gemacht, wir brauchen nur zwei Laibe zurückzutragen. Die Küchenfrauen werden uns Brotpudding daraus kochen.“
„Dann können wir jetzt ins Gildenhaus gehen?“
„Es eilt nicht“, meinte Sherna, und Vanessa war lange genug auf Darkover, um trotz der Dringlichkeit ihrer Botschaft nicht zu widersprechen. Sie half Sherna, die Läden an der Vorderseite des Bäckerstandes auf gemächliche Weise festzubinden und die verstreuten Körbe einzusammeln.
Plötzlich entstand rege Geschäftigkeit an einem der Tore, die vom Marktplatz aus sichtbar waren, und eine Karawane aus Packtieren klapperte über die Steine. Eine Gruppe kleiner Kinder, die vom Dach eines leeren Standes aus „König des Berges“ gespielt hatte, sprang aus dem Weg. Eine hochgewachsene, dünne Frau in der üblichen Tracht der Entsagenden, einer losen Jacke und in niedrige Stiefel gesteckten Hose, bewaffnet mit einem Amazonen-Messer, so lang wie ein kurzes Schwert, schritt auf sie zu.
„Rafi!“ begrüßte Sherna sie. „Ich wußte nicht, daß du heute abend zurückkommen würdest.“
„Das wußte ich auch nicht“, sagte Rafaella n’ha Doria. „Diese Leute haben drei Tage lang in der Nähe des Passes gebummelt. Ich glaube, die Packtiere rochen den heimatlichen Stall, sonst würden sie dort immer noch herumwandern und zusehen, wie das grüne Gras wächst, und Pilze auf Apfelbäumen suchen. Jetzt muß ich erst noch mein Honorar abholen. Ich hätte mich von den Leuten gern am Stadttor verabschiedet, aber bestimmt hätten sie sich dann zwischen hier und den Ställen verlaufen, so wie sie sich die ganze Zeit benommen haben. Und Zandru peitsche mich mit Skorpionen, wenn ich noch einmal einen Auftrag übernehme, bevor genau feststeht, wer während der Reise der Chef ist! Glaubt mir – ich könnte euch Geschichten erzählen…“ Sie eilte davon und sprach kurz mit dem Anführer der Karawane. Geld wechselte den Besitzer. Vanessa sah, daß Rafaella es sorgfältig nachzählte – und sogar sie als Terranerin wußte, welch eine Beleidigung das auf einem offenen Marktplatz war. Rafi kam zu ihnen zurück, grüßte Vanessa mit einem beiläufigen Nicken, schwang sich den letzten der geflochtenen Brotkörbe auf die Schulter, und gemeinsam gingen die drei Frauen über das Kopfsteinpflaster davon.
„Was tust du hier, Vanessa? Gibt es etwas Neues aus dem HQ?“
„Nicht viel“, wich Vanessa aus. „Eins unserer Flugzeuge von V und E ist in den Hellers abgestürzt.“
„Dann wird es vielleicht Arbeit für uns geben“, meinte Rafaella. „Im letzten Jahr, als sie mit uns einen Bergungsvertrag für ein abgestürztes Flugzeug abschlossen, hatten alle eine Menge zu tun.“ Rafaella war Reise-Organisatorin und sehr gefragt bei den Terranern, die sich in die wenig bekannten, weg- und steglosen Berge der nördlichen Domänen wagen mußten.
„Ich weiß nicht, ob es das ist, was sie im Sinn haben. Das Flugzeug ist nicht an einem Ort abgestürzt, wo es geborgen werden könnte“, sagte Vanessa. Nun schritten die Frauen schweigend durch eine der stilleren Straßen der Stadt, bis sie vor einem großen Steingebäude, das der Gasse eine fensterlose Front zukehrte, stehenblieben. Ein kleines Schild an der Eingangstür verkündete:
THENDARA-GILDENHAUS SCHWESTERNSCHAFT DER ENTSAGENDEN
Sherna und Vanessa waren mit den Körben beladen; allein Vanessa hatte eine Hand frei, um die Glocke zu läuten. Eine hochschwangere Frau ließ sie in den vorderen Flur ein. Sie verschloß und verriegelte die Tür hinter ihnen wieder. „Oh, Vanessa, ist es der Abend für die Brücken-Gesellschaft? Das hatte ich vergessen.“ Sie gab Vanessa keine Gelegenheit zu antworten. „Rafi, deine Tochter ist hier!“
„Ich dachte, Doria habe immer noch bei den Terranan zu tun“, antwortete Rafaella nicht sehr liebenswürdig. „Was tut sie hier, Laurinda?“
„Sie hält mit dem Kasten, der beleuchtete Bilder an die Wand wirft, einen Vortrag für sieben Frauen, die mit Beginn der nächsten zehn Tage zu Heil-Assistentinnen ausgebildet werden sollen“, berichtete Laurinda. „,Nurses‘ nennen die Terranan sie, ist das nicht ein komisches Wort? Hört sich an, als sollten sie Terranan-Babys die Brust geben, und darum geht es bei ihrer Ausbildung gar nicht. Sie sollen sich nur um die Kranken und Bettlägerigen kümmern und Wunden verbinden und dergleichen. Sie müssen inzwischen fast fertig sein; geh nur hinein und sprich mit Doria.“
Vanessa erkundigte sich: „Ist Margali n’ha Ysabet im Haus? Ich habe eine Botschaft für sie.“
„Da hast du Glück“, antwortete die Frau. „Sie will morgen früh mit Jaelle n’ha Melora nach Armida aufbrechen. Sie wären schon heute vormittag abgereist, aber eins der Pferde verlor ein Hufeisen, und bis die Schmiedin mit ihrer Arbeit fertig war, drohte Regen. Deshalb haben sie die Abreise auf morgen verschoben.“
„Wenn Jaelle noch im Haus ist“, sagte Rafaella, „würde ich sie gern sprechen.“
„Sie hilft Doria bei dem Vortrag. Wir alle wissen, daß sie bei den Terranan gearbeitet hat“, sagte Laurinda. „Geht ruhig hinein. Sie sind im Musikzimmer.“
„Ich will erst meine Körbe wegstellen“, meinte Sherna, aber Vanessa folgte Rafaella in den hinteren Teil des Gebäudes. Sie öffneten die Tür und schlüpften leise ins Musikzimmer.
Eine junge Frau, deren Haar nach Art der Entsagenden kurz geschnitten war, beendete gerade einen Dia-Vortrag. Sie zählte mehrere Punkte an den Fingern ab und ließ, als Vanessa und Rafaella eintraten, das letzte Farbbild verschwinden.
„Man erwartet von euch, daß ihr gut lesen und schreiben könnt, im Gedächtnis behaltet, was ihr gelesen habt, und fähig seid, korrekte Notizen zu machen. Ihr werdet an Einführungskursen über Anatomie und persönliche Hygiene teilnehmen, ihr werdet lernen, wie man wissenschaftlich beobachtet und die Beobachtungen aufzeichnet, bevor man euch erlaubt, einem Patienten auch nur ein Essenstablett oder eine Bettpfanne zu bringen. Vom ersten Tag des Unterrichts an werdet ihr den ausgebildeten Krankenschwestern helfen, die Patienten zu versorgen, und wenn ihr die Aufgaben einer Pflegerin beherrscht, wird man euch erlauben, Dienst auf der Station zu tun. Erst im zweiten Halbjahr der Ausbildung dürft ihr Chirurgen assistieren oder den Hebammenberuf erlernen. Es ist schwere, schmutzige Arbeit, aber mir hat sie große Befriedigung gewährt, und ich glaube, euch wird es ebenso gehen. Irgendwelche Fragen?“
Eine der jungen Frauen, die zuhörend auf dem Boden saßen, hob die Hand.
„Mierella n’ha Anjali?“
„Warum müssen wir Unterricht in Hygiene bekommen? Glauben diese Terraner, Darkovaner seien dreckig oder liederlich?“
„Das darfst du nicht persönlich nehmen“, antwortete Doria. „Auch ihre eigenen Frauen müssen neue und andere Arten der Reinlichkeit lernen, wenn sie Krankenpflegerinnen werden wollen: Die klinische Sauberkeit, die man beachten muß, wenn man Menschen betreut, die sehr krank sind oder offene Wunden haben oder Krankheitserreger in sich tragen, ist etwas ganz anderes als die Sauberkeit im täglichen Leben, wie ihr erfahren werdet.“
Eine andere Frau erkundigte sich: „Ich habe gehört, daß die Uniformen“ – sie stolperte über das unvertraute Wort –, „die die terranischen Arbeiterinnen tragen, so herausfordernd sind wie die Kleider einer Prostituierten. Müssen wir sie anziehen, und brechen wir damit unsern Eid?“
Doria zeigte auf die Jacke und die Hose in Weiß, die sie anhatte. „Die Sitten sind nicht überall die gleichen. Ihre Begriffe von Schicklichkeit unterscheiden sich von unseren. Aber der Brücken-Gesellschaft ist ein Kompromiß gelungen. In der Medizinischen Abteilung beschäftigte Darkovanerinnen tragen eine besondere Uniform, die eigens dafür entworfen ist, daß sie unsere Gefühle für Anstand nicht verletzt, und sie ist so bequem und warm, daß viele der terranischen Pflegerinnen sich auch dafür entschieden haben. Und bevor ihr fragt, das Bild auf der Brust der Uniform“ – es war ein rotes Emblem, ein Stab, um den sich eine Schlange wand – „ist ein sehr altes terranisches Symbol für den Medizinischen Dienst. Ihr werdet euch ein Dutzend solcher Zeichen einprägen müssen, um euch im HQ zurechtzufinden.“
„Was hat es zu bedeuten?“ wollte ein Mädchen, nicht älter als fünfzehn, wissen.
„Ich habe meine Lehrerin danach gefragt. Es soll das Symbol eines sehr alten terranischen Gottes der Heilkunst sein. Heute betet ihn niemand mehr an, aber das Symbol hat sich erhalten. Sonst noch Fragen?“
„Ich habe gehört“, sagte eine Frau, „daß die Terraner geil sind, daß sie Darkovanerinnen wie – wie die Frauen in den Raumhafen-Bars betrachten. Ist das wahr? Müssen wir dort Messer tragen, um uns zu schützen?“
Doria lachte. „Jaelle n’ha Melora hat eine Weile bei ihnen gelebt. Ich will sie diese Frage beantworten lassen.“
Eine kleine Frau mit flammendrotem Haar erhob sich hinten im Raum. „Ich kann nicht für alle terranischen Männer sprechen“, sagte sie. „Nicht einmal die Götter Zandru und Aldones haben die gleichen Eigenschaften, und ein Cristofero-Mönch benimmt sich anders als ein Bauer aus der Ebene von Valeron. Es gibt unter den Terranern Flegel und Grobiane ebenso wie auf den Straßen von Thendara. Aber ich kann euch versichern, daß ihr von den Terranern in der Medizinischen Abteilung keine Unhöflichkeiten oder Belästigungen zu befürchten braucht. Ihre Ärzte verpflichten sich durch einen Eid, sich gegenüber jedem, Patienten und Helfern, korrekt zu verhalten. Es mag euch sogar stören, daß sie gar keine Notiz davon nehmen, ob ihr ein Mann, eine Frau oder ein Stück Maschinerie seid, aber respektieren werden sie euch, als wäret ihr Bewahrerinnen-Novizen. Was das Tragen von Messern angeht, so ist es bei den Terranern nicht üblich, und man wird euch nicht gestatten, Waffen zur Verteidigung in die Medizinische Abteilung mitzubringen. Doch die Terraner tragen auch keine; ihnen ist das durch ihre Vorschriften verboten. Die einzigen Messer, die ihr sehen werdet, sind die Skalpelle der Chirurgen. Gibt es sonst noch irgendwelche Fragen?“
Vanessa sagte sich, daß die Fragen weitergehen mochten, bis die Glocke zum Abendessen läutete. So meldete sie sich von ihrem Platz an der Tür: „Ich habe eine Frage. Ist Margali n’ha Ysabet in diesem Raum?“
„Ich habe sie seit heute mittag nicht mehr gesehen“, antwortete Doria. Dann entdeckte sie Rafaella im Eingang neben Vanessa.
„Mutter!“ rief sie, eilte zu ihr und drückte sie fest. Lächelnd kam Jaelle zu ihrer alten Freundin, und die drei Frauen hielten sich einen Augenblick umschlungen.
„Wie schön, dich zu sehen, Jaelle. Verdammt, wie lange ist es her? In den letzten drei Jahren haben wir uns immerzu verpaßt. Wenn ich in Thendara war, warst du auf Armida, und kommst du in die Stadt, stecke ich wahrscheinlich irgendwo nördlich von Caer Don!“
„Diesmal ist es reines Glück. Margali und ich wollten schon heute mittag abreisen“, antwortete Jaelle. „Ich bin schon zweimal zehn Tage von meiner Tochter getrennt.“
„Sie muß jetzt ein großes Mädchen sein, Dorilys n’ha Jaelle“, lachte Rafaella. „Ist sie fünf oder schon sechs? Alt genug, daß du sie herbringst, damit sie im Gildenhaus aufwächst.“
„Dazu ist immer noch Zeit.“ Jaelle blickte zur Seite und grüßte Vanessa mit einem Nicken. „Ich weiß, wir sind uns vor ein paar Tagen beim Treffen der Brücken-Gesellschaft begegnet, aber ich habe deinen Namen vergessen.“
„Vanessa“, erinnerte Doria sie.
„Es tut mir leid, deinen Vortrag zu unterbrechen.“ Vanessa sah zu den Frauen hin, die herumliefen und die Sitzkissen aufräumten. Doria zuckte nur die Schultern.
„Das macht nichts. Alle ernsthaften Fragen waren beantwortet. Aber sie sind nervös im Gedanken an ihre neue Arbeit und hätten sich noch bis zum Abendessen dumme Fragen einfallen lassen!“ Sie kehrte in den Mittelpunkt des Raumes zurück und begann, ihre Dias und den Projektor einzupacken. „Ein glücklicher Zufall, daß du heute gekommen bist. Du kannst für mich diese Sachen der Medizinischen Abteilung zurückgeben und mir einen Gang durch die nächtlichen Straßen ersparen. Ich habe sie von der Leiterin der Schwesternschule ausgeliehen. Du nimmst sie mit, wenn du gehst, nicht wahr? Oder willst du die Nacht hier schlafen?“
„Nein, ich bin wegen einer Botschaft für Margali gekommen…“
Wieder zuckte Doria die Schultern. „Bestimmt ist sie irgendwo im Haus. Es ist fast Zeit für die Abendbrot-Glocke. Ganz bestimmt wirst du sie beim Essen sehen.“
Vanessa war lange genug auf Darkover und hatte lange genug im Gildenhaus gelebt, um sich an diese sorglose Einstellung gegenüber der Zeit zu gewöhnen. Die Terranerin in ihr dachte, sie hätte jemanden bitten müssen, Margali zu holen oder ihr zumindest zu sagen, wo sie sie antreffen könne, aber sie befand sich im Augenblick auf der darkovanischen Seite der Stadt. Resignierend antwortete sie Doria, sie werde die Dia-Ausrüstung gern für sie bei der Medizinischen Abteilung abgeben, obwohl es für sie in Wirklichkeit eine ziemliche Unbequemlichkeit bedeutete und sie sich über Doria ein bißchen ärgerte. Aber Doria war ihre Gildenschwester, und es gab keine Möglichkeit, eine Bitte dieser Art auf höfliche Weise abzulehnen.
„Gibt es etwas Neues über das Flugzeug, das in den Hellers abgestürzt ist?“ erkundigte Doria sich.
Ein verächtliches Schnauben Rafaellas ersparte Vanessa die Antwort.
„Diese blöden Terranan“, sagte sie. „Was denken sie sich? Sogar wir armen kleinen Dummchen ohne den Vorzug terranischer Wissenschaft“ – die Worte klangen in ihrem Mund wie eine Gossen-Obszönität – „wissen, daß es Wahnsinn ist, die Hellers zu überqueren, ganz gleich zu welcher Zeit des Jahres, und auch einem Terraner sollte bekannt sein, daß es nördlich von Nevarsin bis zum Wall um die Welt nichts gibt als gefrorenes Ödland! Geschieht ihnen recht, sage ich! Wenn sie ihre blöden Flugzeuge dorthin schicken, müssen sie damit rechnen, daß sie sie verlieren!“
„Ich finde, du urteilst zu hart über sie, Rafi“, meinte Doria. „Ist der Pilot jemand, den ich kenne, Vanessa?“
„Es ist eine Frau namens Anders. Sie ist kein Mitglied der Brücken-Gesellschaft.“
„Alexis Anders? Ich habe sie kennengelernt“, fiel Jaelle ein. „Man hat das Flugzeug nicht entdeckt? Wie schrecklich!“
Rafaella legt Jaelle einen Arm um die Taille. „Laß uns keine Zeit damit verschwenden, über die Terraner zu reden, Shaya, Liebe, wir sind in letzter Zeit so wenig beisammen. Deine Tochter ist jetzt schon ein großes Mädchen. Wann wirst du sie ins Gildenhaus bringen? Vielleicht kommst auch du dann zurück.“
Jaelles Gesicht bewölkte sich. „Ich weiß nicht, ob ich sie überhaupt herbringen kann, Rafi. Es gibt – Schwierigkeiten.“
Mit Rafaella ging das hitzige Temperament durch. „Es ist also wahr! Ich hätte nie von dir geglaubt, Jaelle, daß du demütig zu deiner hochgeborenen Comyn-Sippe zurückkehrst, die dich hinausgeworfen hat! Aber vielleicht hat schon immer festgestanden, daß die Comyn dich niemals gehen lassen würden, bestimmt nicht, nachdem du einem von ihnen ein Kind geboren hast! Ich wundere mich nur, daß noch keiner deinen Eid in Frage gestellt hat!“
Jetzt rötete sich auch Jaelles Gesicht vor Zorn. Sie besaß, so dachte Vanessa bei sich, das Temperament, das sich bei den Terranern im allgemeinen mit flammendrotem Haar verband.
„Wie kannst du es wagen, so mit mir zu sprechen, Rafaella?“
„Leugnest du, daß der Vater deines Kindes der Comyn-Lord Damon Ridenow ist?“
„Ich leugne gar nichts“, erwiderte Jaelle heftig, „aber was soll das? Ausgerechnet du wirfst mir das vor, Rafi? Hast du nicht selbst drei Söhne?“
Rafaella zitierte aus dem Eid der Entsagenden:
„Men dia pre’ zhiuro, ich schwöre, daß ich ein Kind nur dann gebären will, wenn es mein Wunsch ist, das Kind von diesem Mann und zu diesem Zeitpunkt zu empfangen. Weder die Familie noch der Clan des Mannes, weder Fragen der Erbfolge noch sein Stolz oder sein Wunsch nach Nachkommenschaft sollen dabei Einfluß auf mich haben. Ich allein werde bestimmen, wie und wo ein von mir geborenes Kind erzogen werden soll, ohne Rücksicht auf Stellung oder Stolz eines Mannes.“
„Du wagst es, mir den Eid in einem Ton vorzuhalten, als hätte ich ihn gebrochen? Cleindori ist mein Kind. Ihr Vater ist Comyn; wenn du ihn kennen würdest, wüßtest du, wie wenig ihm das bedeutet. Meine Tochter ist eine Aillard; in den Sieben Domänen geht die Erbfolge allein im Hause Aillard über die weibliche Linie. Ich habe meine Tochter für mein eigenes Haus geboren, nicht für das irgendeines Mannes! Welche Amazone hat nicht das gleiche getan, es sei denn, sie ist so einseitig in ihrer Liebe für Frauen, daß sie keinem Mann erlaubt, sie auch nur zu diesem Zweck zu berühren?“ Jaelles Zorn verflog; von neuem umarmte sie Rafaella. „Oh, laß uns nicht streiten, Rafi, du bist beinahe meine älteste Freundin, und glaubst du, ich hätte die Jahre vergessen, als wir Partnerinnen waren? Aber du bist nicht die Bewahrerin meines Gewissens.“
Rafaella ließ sich nicht so schnell versöhnen.
„Den Platz nimmt jetzt ja wohl dieser männliche Bewahrer des Verbotenen Turms ein – heißt er nicht Damon Ridenow? Wie kann ich mit ihm konkurrieren?“
Jaelle schüttelte den Kopf. „Was du auch denken magst, Rafi, ich halte meinen Eid.“ Rafaella blickte skeptisch drein, aber in diesem Augenblick klang das liebliche Geläut einer Glocke durch den Raum und verkündete, daß das Essen in ein paar Minuten aufgetragen werden würde.
„Abendessen, und ich habe immer noch den Dreck der Packtiere und des Marktplatzes an mir! Ich muß gehen und mich waschen, auch wenn ich keine von Dorias Pflegerinnen werden will. Komm mit mir nach oben, Shaya. Streiten wir nicht, schließlich sehe ich dich jetzt so selten – wir wollen keine Zeit darauf verschwenden, uns über Dinge aufzuregen, die wir nicht ändern können. Vanessa, kommst du mit?“
„Nein, ich muß Ausschau nach Margali n’ha Ysabet halten.“ Vanessa wandte sich der Tür zum Speisesaal zu, während Jaelle und ihre Freundin die Treppe hinaufliefen. Es roch gut nach Essen, etwas Heißem und Leckerem, dem Hefeduft frischgebackenen Brots, das gerade aus dem Ofen genommen worden war. Dazu kam das Klappern von Geschirr; die Frauen, die in der Küche halfen, stellten Schüsseln und Teller auf den Tisch.
Wenn sich Magdalen Lorne, im Gildenhaus als Margali bekannt, überhaupt hier befand, mußte sie auf ihrem Weg zum Speisesaal an dieser Stelle vorbeikommen. Vanessa fragte sich, ob sie sie am Gesicht erkennen werde. Sie hatte sie nur drei- oder viermal gesehen, das letzte Mal erst vor zehn Tagen bei einem Treffen der Brücken-Gesellschaft in diesem Haus.
In diesem Moment sah sie Magdalen Lorne vom Gewächshaus auf der Rückseite des Gildenhauses den Flur entlangkommen. Ihre Arme waren voll von frühen Melonen. Neben ihr ging, ebenfalls Melonen tragend, eine große, drahtige Frau mit Narben im Gesicht – eine Emmasca, die sich der gefährlichen, illegalen und häufig tödlichen Operation unterzogen hatte, die sie zum Neutrum machte. Vanessa kannte den Namen der Frau, Camilla n’ha Kyria; sie wußte, daß Camilla früher Söldnerin gewesen war und jetzt im Gildenhaus Unterricht im Schwertkampf erteilte – und daß es von ihr hieß, sie sei Magdalen Lornes Liebhaberin. Das setzte Vanessa immer noch ein bißchen in Verlegenheit, wenn auch nicht mehr so sehr wie vor ihrem monatelangen Aufenthalt im Gildenhaus, wo sie gelernt hatte, wie alltäglich und wenig bemerkenswert so etwas war. Es schien ihr nicht mehr mysteriös und pervers zu sein, doch sie war Terranerin, und es war ihr peinlich.
Noch bevor sie nach Darkover gekommen war, gleich zu Beginn ihrer Ausbildung für den Nachrichtendienst, hatte Vanessa ryn Erin von der legendären Magdalen Lorne erfahren. Sie kannte die ganze Geschichte: Magdalen Lorne war auf Darkover in den Bergen nahe Caer Donn geboren, als der Raumhafen bei Thendara noch nicht gebaut war. So war sie mit darkovanischen Kindern aufgewachsen und hatte die Sprache als Eingeborene gelernt. Wie Vanessa auch, war Magda an der Akademie des Nachrichtendienstes auf Alpha von Vanessas Chefin Cholayna Ares ausgebildet worden, die damals die Akademie leitete und erst später nach Darkover versetzt wurde. Eine Zeitlang war Magda mit dem gegenwärtigen terranischen Legaten Peter Haldane verheiratet gewesen. Als erste Frau hatte sie nachrichtendienstliche Feldarbeit auf Darkover geleistet, und bis heute hatte es auf diesem Gebiet nur sehr wenige Frauen gegeben. Ebenfalls als erste hatte sie die Gilde der Entsagenden infiltriert, und es war ihr sogar gelungen, den Eid abzulegen. Wunderlicherweise hatte sie darauf bestanden, ihn zu halten, hatte sogar das volle Hausjahr im Gildenhaus abgeleistet, was vor der Gründung der Brücken-Gesellschaft ohne Erleichterungen auch von Terranerinnen verlangt wurde. Vor ein paar Jahren hatte Magda das Gildenhaus verlassen und widmete sich nun einer geheimnisvollen Tätigkeit auf Armida. All das wußte Vanessa von der Legende. Aber sie hatte die wirkliche Frau erst vor ein paar Tagen kennengelernt und sich noch nicht an sie gewöhnt. Irgendwie hatte sie sich Magda als überlebensgroß vorgestellt.
Im Gildenhaus verlangte die Höflichkeit, daß sie nur Lornes darkovanischen Namen benutzte.
„Margali n’ha Ysabet? Darf ich dich eine Minute sprechen?“
„Vanessa? Wie schön, dich zu sehen.“ Magda Lorne (Margali) wirkte hochgewachsen, obwohl sie von nicht viel mehr als durchschnittlicher Größe war. Sie war Mitte Dreißig. Schweres dunkles Haar, nach Art der Entsagenden kurz geschnitten, beschattete ihre Stirn. Sie hatte tiefliegende, lebhafte graue Augen, die Vanessa neugierig betrachteten. „Hier, halte mal, ja?“ Sie schob Vanessa ein paar Melonen zu, schnüffelte und verzog das Gesicht. „Riecht wie Kaldaunen. Du kannst meinen Anteil haben. Wie habe ich das Zeug in meinen ersten Monaten hier gehaßt! Aber vielleicht schmeckt es dir, manche Leute mögen es. Und wenn nicht, dann ist reichlich Brot und Käse da, und zum Nachtisch gibt es Melonen. Camilla, gib ihr ein paar von deinen, wenn du sie hier im Flur fallen läßt, können wir ihnen im ganzen Haus nachjagen – und platzt dabei eine auf, ist eine schöne Schweinerei wegzuputzen! Und mir persönlich ist diese Woche gar nicht nach Fußbodenschrubben zumute!“
Camilla, die größer als Magda war, belud Vanessas Arme zusätzlich mit einigen ihrer Melonen. In ihren süßlichen Duft mischte sich der erdige Geruch des Gewächshauses. Vanessa ärgerte sich, daß sie ihre Botschaft nicht ausrichten konnte. Camilla sah, daß sie die Stirn runzelte.
„Was tust du hier, Vanessa? Wenn heute der Abend der Brücken-Gesellschaft ist, habe ich es vergessen.“
Gereizt dachte Vanessa, daß sie laut fluchen werde, wenn noch eine einzige Person das zu ihr sagte. „Nein – aber ich habe eine Botschaft für dich, Margali, von Cholayna n’ha Chandria.“ Vanessa benutzte den Gildenhaus-Namen. Magda schüttelte verwirrt den Kopf.
„Zum Kuckuck mit der Frau, was kann sie von mir wollen? Ich habe erst Vor drei Tagen mit ihr gesprochen, und sie weiß, daß ich abreisen will. Jaelle und ich hätten schon heute mittag aufbrechen sollen. Falls du es vergessen hast, wir haben Kinder auf Armida.“
„Sie möchte, daß du etwas für sie tust, und sie sagt, es sei wichtig, möglicherweise eine Sache von Leben und Tod“, berichtete Vanessa ihr.
Camilla bemerkte: „Cholayna übertreibt nicht. Wenn sie sagt Leben und Tod, dann stimmt es.“
„Davon bin ich überzeugt!“ Magda runzelte die Stirn. „Hast du keine Ahnung, um was es geht, Vanessa? Ich möchte hier nicht festgehalten weren. Wie schon erwähnt, werde ich auf Armida gebraucht. Jaelles Tochter ist alt genug, daß man sie allein lassen kann. Shaya dagegen ist noch keine zwei, und wenn ich noch länger in der Stadt bleibe, hat sie vergessen, wie ich aussehe.“
„Ich kann es nicht sagen“, wich Vanessa aus, die Behauptung vermeidend, sie wisse es nicht. Sie war informiert worden, warum Magda das Gildenhaus verlassen hatte, und was Magdas Arbeit auf Armida anging, hatte sie die geheimsten Unterlagen einsehen dürfen, allerdings nicht so gründlich, daß sie es verstanden hätte.
Vanessa konnte sich überhaupt keinen Grund vorstellen, warum eine Agentin von Magdas Status sich freiwillig mit einem halbdarkovanischen Kind belastete, und wie alle Frauen, die aus eigener Wahl kinderlos sind, beurteilte sie Magda hart. Obwohl sie die Legende bewunderte, hatte sie sich noch nicht mit der Realität der lebenden Frau abgefunden. Als sie neben Magda weiterging, stellte sie zu ihrer Verblüffung fest, daß Magda tatsächlich einen oder zwei Zoll kleiner war als sie.
„Es ist noch nicht allzu spät. Bleibt uns Zeit, hier zu essen? Nein, lieber nicht, Cholayna hat es zu dringend gemacht. Ich will nur noch Jaell n’ha Melora Bescheid geben, daß ich nun vielleicht doch nicht im ersten Morgengrauen aufbrechen kann.“ Mit grimmigem Gesicht stieg Magda die Treppe hoch.
„Ich will dir was sagen, Vanessa. Wenn das irgendein Blödsinn ist, wird Cholayna wünschen, den Weg zum Gildenhaus nie kennengelernt zu haben. Ich reite morgen, und damit hat sich’s!“
Plötzlich lächelte sie, und zum erstenmal spürte Vanessa hinter der kurz angebundenen Frau die machtvolle Persönlichkeit, die zur Legende geworden war.
„Nun ja, wenn so etwas schon passieren mußte, ist es gerade zur richtigen Zeit gekommen. Wenigstens brauche ich die Kaidaunen nicht zu essen.“
2. Kapitel
Es war jetzt stockfinster, und in den nächtlichen Regen mischten sich Graupeln. Die Straßen waren völlig leer. Magda und Vanessa überquerten den Platz vor dem Eingang zum Terranischen HQ und nannten dem Raumpolizisten in seiner schwarzen Leder-Uniform das Losungswort. Er war bis zur Nase in einen schwarzen Wollschal gehüllt, der ebensowenig wie die schwere Steppjacke über der Uniform den Vorschriften entsprach, es aber auf diesem besonderen Planeten bei Nacht hätte tun sollen. Magda wußte, daß man ein Auge zudrückte, nur war das nicht genug. Man hätte die warmen Kleidungsstücke offiziell erlauben sollen.
Und da behaupten sie, die Darkovaner seien nicht bereit, ihre primitivsten Sitten zu ändern!
Die meisten neuen Raumpolizisten kannte Magda nicht. Noch vor einem Jahr hätte sie sich vorgestellt; jetzt fand sie es sinnlos. Sie würde morgen nach Armida zurückkehren, dort spielte sich ihr Leben ab. Sie hatte Cholayna noch geholfen, die Brücken-Gesellschaft zu gründen und in Gang zu bringen, doch mittlerweile funktionierte sie allein. Und ihr Kind band sie noch stärker an Armida und den Verbotenen Turm. Cholayna Ares, Chefin des Nachrichtendienstes auf Cottman Vier, würde gezwungen sein, ohne sie auszukommen.
Wenn sie glaubt, sie kann mich von heute auf morgen zum Feldeinsatz schicken, wird sie ihre Meinung revidieren müssen.
Magda hatte so lange unter der darkovanischen Sonne gelebt, daß sie in dem hellen gelben, erdnormalen Licht des Hauptgebäudes zusammenzuckte. Aber ohne Zögern betrat sie den Aufzug. Sie hatte eine gewisse Ungeduld mit diesen terranischen Erfindungen erworben, aber sie war nicht bereit, zweiundvierzig Stockwerke hochzusteigen, um ihre Einstellung zu demonstrieren.
Zu dieser Stunde war der Abschnitt, der dem Nachrichtendienst zur Verfügung stand, dunkel und verlassen. Nur aus dem Büro von Cholayna Ares drang ein Lichtschimmer. Magda sagte sich, wenn Cholayna sie hier im Büro erwartete, statt sie in ihrer gemütlichen Wohnung zu empfangen, müsse etwas wirklich Wichtiges im Gange sein.
„Cholayna? Ich bin so schnell gekommen, wie ich konnte. Aber was in aller Welt – in dieser oder einer anderen – ist so dringend, daß es nicht bis morgen warten konnte?“
„Ich fürchtete, du würdest morgen schon weg sein“, antwortete Cholayna, „und ich war nicht gerade erpicht darauf, dir einen Boten bis Armida nachzuschicken. Doch das hätte ich getan, wenn es notwendig geworden wäre.“
Cholayna Ares, Terranischer Nachrichtendienst, war eine sehr große Frau mit einer Mähne silberweißer Haare, die einen verblüffenden Gegensatz zu ihrer schwarzen Haut bildeten. Sie stand auf, um Magda zu begrüßen, und wies auf einen Sessel. Magda blieb stehen.
„Es ist freundlich von dir, daß du gekommen bist, Magda.“
„Es ist überhaupt nicht freundlich. Du hast mir ja keine Wahl gelassen“, gab Magda gereizt zurück. „Du sagtest, es ginge um Leben und Tod. Ich glaube nicht, daß du so etwas leichtfertig dahinredest. Habe ich recht?“
„Magda – erinnerst du dich an eine Agentin namens Anders? Alexis Anders. Sie kam vor zwei Jahren von Magaera her. Grundausbildung im Nachrichtendienst, hier versetzt zu Vermessung und Erkundung.“
„Lexie Anders? Ich kannte sie nicht gut“, sagte Magda, „und sie ließ sich deutlich anmerken, daß sie keine Lust hatte, mich besser kennenzulernen. Später, als ich ihr vorschlug, der Brücken-Gesellschaft beizutreten, wenn sie Kontakt mit den hiesigen Frauen wünsche, lachte sie mir ins Gesicht. Ich muß gestehen, daß sie mir nie besonders sympathisch war. Warum?“
„Ich finde, du bist zu hart gegen sie“, meinte Cholayna. „Sie kam hier an und wurde sofort mit der Lorne-Legende konfrontiert.“ Magda machte eine ungeduldige Handbewegung, aber Cholayna ließ sich nicht aufhalten.
„Nein, nein, meine Liebe, das ist mein Ernst. Du hattest auf einer Welt, wo einer Frau im allgemeinen nachrichtendienstliche Arbeit unmöglich war, mehr vollbracht als Anders bei ihren ersten drei Kommandos. Was sie auch tat, sie fand sich in Konkurrenz mit dir, und als Folge davon fühlte sie sich geschlagen, noch bevor sie begonnen hatte. Es überraschte mich gar nicht, als sie zu V und E überwechselte.“
„Ich sehe nicht ein, warum sie glaubte, sie müsse in Konkurrenz…“, begann Magda. Cholayna wischte das beiseite.
„Dem mag sein, wie ihm wolle. Ihr Flugzeug stürzte vor drei Tagen über den Hellers ab. Wir erhielten einen Funkspruch, sie habe sich verirrt, könne nicht navigieren – es stimme etwas nicht mit dem Computer-Kompaß. Dann nichts mehr. Todesstille, nicht einmal mehr ein Spurstrahl zum Satelliten. Nicht einmal ein Signal von der Black Box.“
„Das hört sich sehr unwahrscheinlich an“, sagte Magda. Die „Black Box“, das automatische Aufzeichnungsgerät eines Kartographierungsflugzeugs, sollte, zumindest bei den neueren Modellen, noch drei Jahre nach dem Absturz Signale aussenden. Magda kannte Alexis Anders gut genug, um sich zu sagen, sie hätte sich niemals mit etwas Schlechterem als der allerneuesten Ausrüstung hinausschicken lassen.
„Unwahrscheinlich oder nicht, es ist geschehen, Magda. Das Flugzeug gab keine Signale, die Black Box und der Spurstrahl waren verstummt, der Satellit konnte nichts finden.“
„Dann ist sie also abgestürzt?“ Magda war elend zumute. Sie hatte Lexie nicht besonders gemocht, aber sie wünschte jetzt, sie habe nicht so unfreundlich von der Frau gesprochen, die vermutlich tot war.
Natürlich war es schon vorgekommen, daß Terraner den Absturz eines Kartographierungsflugzeugs überlebt, ein Obdach und – zumindest in einem Fall, wie Magda wußte – ein neues Leben und eine neue Heimat gefunden hatten. Aber nicht in den Hellers, den wildesten, am wenigsten erforschten, unwegsamsten und von Leben leersten Bergen auf Darkover, den vielleicht schlimmsten auf jedem bewohnten oder bewohnbaren Planeten. Es war beinahe unmöglich, in den Hellers, vor allem im Winter, ohne Spezialausrüstung länger als ein paar Stunden zu überleben. Und jenseits der Hellers war nichts, soweit man wußte (und heute kannte das Imperium Cottman Vier beträchtlich besser als die Darkovaner selbst), nur die undurchdringliche Bergkette, die als Wall um die Welt bekannt war. Und jenseits des Walles nur kahle Eiswüsten, die sich von Pol zu Pol erstreckten.
„Dann muß man davon ausgehen, daß sie tot ist? Wie schrecklich.“ Jedes Wort mehr wäre Heuchelei gewesen. Ihre Abneigung hatte auf Gegenseitigkeit beruht.
„Nein“, sagte Cholayna, „sie ist unten in der Medizinischen.“
„Ihr habt das Flugzeug gefunden? Aber…“
„Nein, wir haben das Flugzeug nicht gefunden. Glaubst du, ich hätte dich wegen einer normalen Rettungsaktion oder eines Abschlußberichts in größter Hast aus der Stadt geholt?“
„Du erzählst mir dauernd, was es nicht ist“, beschwerte sich Magda. „Bis jetzt hast du keine Andeutung gemacht, was es ist…“
Cholayna zögerte immer noch. Endlich erklärte sie ziemlich steif: „Magda, ich erinnere dich daran, daß du immer noch eine vereidigte Agentin des Nachrichtendienstes bist und den Geheimhaltungsvorschriften des Zivildienstes unterliegst…“
„Cholayna, ich weiß überhaupt nicht, wovon du redest!“ Allmählich wurde Magda ärgerlich. Was sollte dieser ganze Unfug? Sie hatte ihre Verpflichtung dem Nachrichtendienst gegenüber nie geleugnet, ausgenommen während der schmerzlichen Identitätskrise in ihrem ersten halben Jahr unter den Entsagenden. Es hatte damals keine Brücken-Gesellschaft gegeben, die ihr den Übergang erleichtert hätte. Sie war die erste gewesen.
„Du weißt, ich habe darum gekämpft, daß du als nicht mehr aktive Agentin behalten, statt entlassen wurdest“, stellte Cholayna mit Nachdruck fest. „Einer der Grundsätze unserer Arbeit – übrigens nicht nur auf Darkover, sondern auf allen Imperiumsplaneten – ist: Geht einer unserer Leute über die Mauer – lebt er unter den Eingeborenen, nimmt er eine eingeborene Frau und zeugt mit ihr Kinder –, dann ist die Faustregel, daß er dadurch zu einem besseren Agenten wird. Natürlich ist in seiner Akte immer ein Fragezeichen bei von ihm getroffenen Entscheidungen der Art, die ihn möglicherweise in einen Konflikt mit seinen persönlichen Interessen bringen. Das weißt du doch bestimmt.“
„Ich könnte aus den Vorschriften seitenlang zitieren“, erwiderte Magda trocken. „Auf so etwas war ich vorbereitet. Es gilt auch für mich, weil ich ein Kind habe, obwohl ich, soviel du weißt, nicht verheiratet bin. Richtig? Nun, du irrst dich.“
„Dann bist du verheiratet?“
„Nicht auf eine Weise, die das terranische Gesetz anerkennen würde. Aber ich habe mit Jaelle n’ha Melora den Eid der Freipartnerinnen geschworen. Nach darkovanischem Recht ist das eine Verbindung, die einer Ehe ähnlich ist. Im besonderen bedeutet sie, daß, sollte eine von uns sterben, die andere sowohl das Recht als auch die Pflicht hat, das Kind oder die Kinder der Verstorbenen aufzuziehen und als ihr Vormund zu wirken, genau wie es eine Ehefrau oder ein Ehemann tun würde. Dieser Eid hat nach dem Gesetz Vorrang vor jedem Anspruch seitens der Kindesväter. Für alle praktischen Zwecke ist die Situation also identisch mit einer Ehe. Ist das klar?“
Cholaynas Stimme klang hart. „Ich bin überzeugt, die Xenoanthropologen werden das faszinierend finden, und ich werde dafür sorgen, daß sie die Aufzeichnungen erhalten. Aber ich habe nicht nach Einzelheiten deines Privatlebens gefragt.“
„Ich habe dir keine Einzelheiten mitgeteilt.“ Magda war ebenso barsch, obwohl Cholayna zu den wenigen Menschen zählte, denen sie, falls gefragt, solche Einzelheiten anvertraut hätte. „Ich habe dich auf die rechtliche Situation hingewiesen. Also werden solche Standard-Annahmen über Imperiumsagenten mit eingeborenen Frauen und Kindern auch für mich gelten, und man rechnet damit, daß ich mich entsprechend verhalte.“
„Du ziehst falsche Schlüsse, Magda. Ja, auf dem Papier stimmt das. In der Praxis – und die Information, die ich dir jetzt gebe, ist geheim – wird eine Frau, die über die Mauer geht, was äußerst selten vorkommt, in der Regel auf der Stelle aus dem Nachrichtendienst entlassen. Es werden dafür zahlreiche Gründe genannt, aber sie laufen im Kern alle auf dasselbe hinaus. Die offizielle Politik des Nachrichtendienstes geht davon aus, daß ein Mann sich trotz Frau und Kindern ein objektives Urteil bewahren kann, während eine Frau – Magda, vergiß nicht, daß ich zitiere, das ist nicht meine eigene Meinung – sich gefühlsmäßig enger bindet. Angeblich kann ein Mann sich leichter von einer Frau lösen als umgekehrt, und die Kinder stehen der Frau, die sie geboren hat, näher als dem Mann, der sie gezeugt hat.“
Magda fluchte. „So etwas hätte ich mir denken können. Soll ich dir sagen, was ich von dem Reish halte?“ Das darkovanische Wort war eine kindische Unanständigkeit und bedeutete wörtlich Stallmist, aber Magdas Gesicht verzog sich vor echtem Zorn, als sie es aussprach.
„Das ist unnötig. Was du davon hältst und was ich davon halte, ist so ziemlich das gleiche, aber was eine von uns beiden denkt, hat absolut nichts mit der Sache zu tun. Ich spreche von der offiziellen Politik. Man erwartete von mir, daß ich schon dein erstes Kündigungsschreiben akzeptierte.“
„In diesen streng geheimen Personalakten steht vermutlich auch, daß ich Frauen liebe?“ erkundigte sich Magda. Einer ihrer Mundwinkel zuckte. „Ich weiß, wie man bei Liebhabern von Männern vorgeht. Nach dem Gesetz sind sie durch die offizielle Politik der Nichtdiskriminierung geschützt. In der Praxis werden sie, wie du weißt und ich weiß, bei dem ersten Vorwand, der sich finden läßt, hinausgeworfen.“
„Du hast unrecht“, gab Cholayna zurück. „Zumindest ist das nicht in jedem Fall so. Es gibt ein Schlupfloch im Gesetz: Ein Mann, der mit einer Frau und Kindern lebt, wird nicht als homosexuell eingestuft, ganz gleich, welche privaten Vorlieben er haben mag. Er kann Vorwürfe dieser Art zurückweisen. Du bist in der gleichen Situation, Magda, seit dein Kind geboren ist. Niemanden kümmert es im Grunde, ob du den Vater geheiratet hast oder nicht. Aber nachdem du Immunität vor dieser Art von Verfolgung erworben hast, fällst du einer anderen zum Opfer. Jetzt geht man davon aus, daß du für nachrichtendienstliche Tätigkeit absolut ungeeignet bist, weil deine Loyalität deinem Kind oder deinen Kindern und dem Manne, der sie gezeugt hat, gehört. Den Richtlinien entsprechend hätte ich deine Kündigung also annehmen müssen.“
„Ich wäre damit vollkommen einverstanden gewesen“, brummte Magda.
„Ich weiß. Mein Gott, du hast mir Gelegenheit genug gegeben. Du hast so regelmäßig jedes halbe Jahr eine Kündigung eingereicht, daß ich mich schon fragte, ob es einfach deine Art sei, Mittsommer und Mittwinter zu feiern. Aber immer noch glaube ich, daß ich ein bißchen weiter sehe als du. Wir können es uns nicht leisten, auf diese Weise qualifizierte Frauen zu verlieren.“
„Warum erzählst du mir all das?“
„Weil ich dir klarmachen möchte, warum meine Bitte inoffiziell ist und warum du mich trotzdem anhören und mir helfen mußt. Magda, ich kann dir nichts befehlen. Du kannst mir ins Gesicht lachen und mir sagen, ich soll dir den Buckel herunterrutschen, und die Vorschriften liefern mir keine Handhabe dagegen. Die juristische Situation ist, daß du über die Mauer gegangen bist und ich nicht das Recht habe, dich zurückzurufen. Aber ich pfeife auf die Vorschriften, weil du der einzige Mensch bist, der die Dinge, die sich abspielen, aufzuklären vermag.“
„Also jetzt kommen wir endlich zur Sache“, sagte Magda. „Der Grund, warum du mich in einer regnerischen Nacht herzitiert hast…“
„Hier sind alle Nächte regnerisch, aber auch das hat nichts mit dem Thema zu tun.“
„Lexie Anders?“
„Etwa zehn Minuten, bevor ihr Flugzeug abstürzte, übermittelte sie via Satellit eine Nachricht. Sie näherte sich dem Wall um die Welt und wollte umkehren. Ihre letzten Worte besagten, sie habe etwas entdeckt, etwas wie eine Stadt, die nicht auf der Radar-Karte verzeichnet sei. Sie stieg auf fünftausend Meter hinab, um nachzusehen. Dann verloren wir sie und das Flugzeug. Nichts mehr. Nicht einmal die Black Box, wie ich schon erwähnte. Nach dem, was das HQ und der Satellit wissen, verschwand das Flugzeug mitsamt der Black Box und allem übrigen einfach aus der Atmosphäre des Planeten. Aber heute morgen erschien Lexie Anders am Tor des HQ, ohne Uniform, ohne ihre Identitätskarte. Ihr Verstand war ausgelöscht. Vollständige Amnesie. Magda, sie kann kaum noch Terra-Standard sprechen! Sie bedient sich des Dialekts ihres Heimatplaneten Vainwal – aber auf dem Niveau von Baby-Sprache. Folglich können wir sie nicht fragen, was geschehen ist.“
„Aber – aber all das ist unmöglich, Cholayna! Ich verstehe nicht…“
„Wir auch nicht. Und das ist noch eine Untertreibung. Es hat keinen Sinn, Anders in ihrem Zustand zu vernehmen.“
„Und weshalb hast du nun nach mir geschickt?“ fragte Magda. Sie fürchtete, es schon zu wissen, und es machte sie wütend. Obwohl Cholayna, soviel Magda bekannt war, nicht über Laran verfügte, schien die Frau ihre Verärgerung zu spüren. Sie zögerte. Dann sprach sie es trotzdem aus, wie Magda es nicht anders erwartet hatte.
„Du bist Psi-Technikerin, Magda. Die einzige in der näheren Umgebung, die einzige ordnungsgemäß ausgebildete auf dieser Seite der Alpha-Kolonie. Du kannst herausfinden, was wirklich geschehen ist.“
Magda starrte Cholayna geraume Zeit böse an. Das hätte sie sich denken können. Es war, so dachte sie, ihre eigene Schuld, ein Band nicht zerissen zu haben, das aufgehört hatte, irgendeine Bedeutung für sie zu besitzen. Mehrmals hatte sie, wie Cholayna gesagt hatte, versucht, aus dem terranischen Nachrichtendienst auszuscheiden, und Cholayna hatte ihr Kündigungsgesuch jedesmal abgelehnt. Magda, so hatte sie behauptet, sei am besten dafür qualifiziert, eine engere Verbindung, eine Brücke, zwischen der Welt ihrer Herkunft und ihrer Wahlheimat Darkover herzustellen. Das war auch Magdas Wunsch gewesen. Die Brücken-Gesellschaft legte Zeugnis ab für ihre Bemühungen, diese Verbindungen zu stärken. Doch als Magda das Gildenhaus verließ, um Mitglied des einzigen Matrix-Kreises von ausgebildeten Psi-Technikern zu werden, der außerhalb der sorgfältig abgeschirmten und bewachten Turme arbeitete, hätte sie sich sagen sollen, daß das Problem von neuem akut werden würde.
Nicht etwa, daß dem Imperium keine Psi-Techniker zu Gebote standen, wenn auch diese Wissenschaft nicht so verbreitet und nicht so hochentwickelt war wie auf Darkover. Einige wenige Planeten des bekannten Universums hatten sie auch entdeckt und sahen die Fähigkeiten von Telepathen und anderen psi-sensitiven Personen, die die Darkovaner Laran nannten, als selbstverständlich an. Doch bis heute war Darkover in dieser Beziehung einzigartig.
Diese Talente, das wußte man jetzt, waren ein unausrottbarer Bestandteil des menschlichen Geistes. Obwohl es immer noch ein paar beharrliche Skeptiker gab – und aus irgendeinem Grund stellte beharrlicher Skeptizismus eine sich selbst erfüllende Prophezeiung dar, so daß Skeptiker selten irgendwelche Psi-Fähigkeiten entwickelten –, wo Menschen lebten, tauchten auch die Psi-Talente auf, die Bestandteil des menschlichen Geistes sind. Und deshalb gab es auch ausgebildete Telepathen, allerdings nicht viele, und es waren sogar mechanische Psi-Sonden erfunden worden, die fast die gleiche Arbeit leisteten.
„Leider haben wir sie nicht auf Darkover. Die uns nächste Möglichkeit wäre die Akademie des Nachrichtendienstes auf Alpha“, sagte Cholayna. „Wir müssen aber wissen, was mit Alexis Anders passiert ist. Begreifst du das nicht, Magda? Wir müssen es wissen.“
Magda antwortete nicht. Cholayna holte deutlich hörbar Atem. „Sieh mal, Magda, du weißt ebensogut wie ich, was das zu bedeuten hat! Du weißt, jenseits des Hellers ist nichts, nichts! Sie meldet also, daß sie da draußen etwas entdeckt hat, und dann geht sie tiefer. Nichts auf dem Satelliten-Bild, keine Black-Box, kein Spurstrahl – nichts. Aber wenn da draußen nichts ist, ist sie immer noch mit ihrem Flugzeug abgestürzt. Wir haben schon früher Flugzeuge bei Vermessungen und Erkundungen verloren. Auch Piloten. Nur ist sie nicht abgestürzt. Irgend etwas hat sie da draußen gepackt – und sie dann zurückgegeben! In diesem Zustand!“
Darüber dachte Magda eine Weile nach. Schließlich meinte sie: „Es bedeutet, daß etwas da draußen sein muß, etwas hinter dem Wall um die Welt. Doch das ist unmöglich.“ Sie hatte die Fotos des Wetter-Satelliten von Cottman Vier gesehen. Ein kalter Planet, dessen starke Achsneigung durch die hohen Gipfel der Hellers und des Walls um die Welt, die praktisch einen „dritten Pol“ darstellten, hervorgerufen wurde. Ein nur in einem relativ kleinen Teil eines einzigen Kontinents bewohnbarer Planet, und überall sonst gefrorenes Ödland ohne Anzeichen von Leben.
„Langsam erkennst du, was ich meine“, stellte Cholayna grimmig fest. „Und du bist in dem, was die Darkovaner Laran nennen, geschult.“
„Es war dumm von mir, es dich je wissen zu lassen!“ Magda wußte, es war ihre eigene Schuld, daß sie dies letzte schwache Band nicht zerrissen hatte. Als sie über das Gildenhaus hinausgewachsen war, hätte sie wie vor ihr Andrew Carr die Terraner – und vielleicht auch die Entsagenden – in dem Glauben lassen sollen, sie sei tot.
In dem Verbotenen Turm hatte sie eine Heimat gefunden. Die Menschen dort waren wie sie, gehörten nicht in eine Welt, die von ihnen verlangte, sich in engen Kategorien zu definieren. Callista, Bewahrerin, von ihrem Turm verstoßen, weil sie weder auf ihre irdische Liebe noch auf den Gebrauch ihres Laran verzichten wollte, für das sie beinahe ihr Leben gegeben hatte. Andrew Carr, Terraner, hatte seine eigenen Kräfte entdeckt und eine neue Welt und ein neues Leben gefunden. Damon, aus einem Turm weggeschickt, hatte als einziger Mann den Mut besessen, etwas zu verlangen, das seit Jahrhunderten keinem Mann mehr erlaubt worden war: Er war Bewahrer des Turms geworden, den man den Verbotenen nannte, und kämpfte um dessen Anerkennung. Noch andere hatten sich ihnen angeschlossen, Vertriebene aus den regulären Turmen und solche, die trotz ihrer Talente niemals in einen Turm aufgenommen worden wären. Und jetzt gehörten auch sie, Magda, und Jaelle dazu.
Und sie war so töricht gewesen, Cholayna davon zu erzählen….
„Du möchtest, daß ich bei ihr eine Psi-Sondierung vornehme, Cholayna? Warum läßt du keinen Techniker von Alpha kommen? Schicke eine Nachricht, und du hast ihn in zehn Tagen hier.“
„Nein, Magda. In diesem Zustand könnte Alexis Anders in Katatonie fallen, und wir würden es nicht einmal merken. Außerdem, wenn da draußen etwas ist, müssen wir es wissen. Jetzt. Wir dürfen kein weiteres Flugzeug hinschicken, bis wir erfahren haben, was mit diesem geschehen ist.“
„Da draußen ist nichts“, erklärte Magda härter, als es ihre Absicht war. „Satelliten-Fotos lügen nicht.“
„Das habe ich ja immer gesagt“ Cholayna blickte auf die erleuchtete Platte ihres Schreibtisches nieder. Als Magda schwieg, stand sie auf, kam um den Schreibtisch herum und faßte Magdas Schultern. „Verdammt noch mal, irgend etwas ist mit ihr geschehen! Mir leuchtet ein, daß das Flugzeug abgestürzt ist. Ich selbst habe nie versucht, die Hellers zu überfliegen, aber ich habe mit Leuten gesprochen, die es versucht haben. Was mir Angst einjagt, ist die Frage, wie sie hierhergekommen ist, und der Zustand, in dem sie sich befindet. Wenn das Lexie passiert, kann es jedem passieren. Keine einzige Person in Vermessung und Erkundung oder sonst jemand außerhalb der Handelsstadt ist sicher, bis wir wissen, was sie und ihr Flugzeug ergriffen hat – und wie und warum… sie sie zurückgeschickt haben. Du mußt uns helfen, Magda.“
Magda trat von Cholayna zurück und blickte auf die Lichter des Raumhafens hinunter. Von hier oben sah sie das ganze terranische HQ und hinter der Handelsstadt die Altstadt. Es war ein starker Gegensatz, die gleißende Beleuchtung des terranischen Gebiets und die wenigen matten Lichter des alten Thendara, die zu dieser Stunde noch brannten. Irgendwo in dieser Dunkelheit waren das Gildenhaus und ihre Freundinnen, und jenseits des Passes, der sich als tiefere Finsternis vor dem dunklen Himmel abhob, wenig mehr als einen Tagesritt nach Norden, lag das Gut Armida, ihre neue Welt. Könnte sie sich nur mit einem von ihnen beraten, mit ihrem Bewahrer Damon, mit Andrew, der wie sie den Kampf zwischen seinem terranischen Ich und seiner darkovanischen Welt hatte ausfechten müssen! Aber sie waren dort, und sie war hier, und sie allein steckte in dieser unangenehmen Situation und stand vor einem unlösbaren Problem.
„Ich bin die letzte, von der Lexie wünschen würde, daß sie in ihrem Gehirn herumstöbert, glaub mir.“
„Ebensowenig würde sie für immer in diesem Zustand bleiben wollen“, sagte Cholayna, und darauf gab es keine Anwort. „Sie ist in der Medizinischen, auf der Isolierstation. Es sollte niemand erfahren, was geschehen ist.“
Eines Tages, dachte Magda, würden die HQ-Leute mit der Nase darauf stoßen, daß es Dinge gab, die auch sie nicht kontrollieren konnten. Ihr persönlich war es verdammt gleichgültig, ob es den Terranern gelang, die Fiktion ihrer Allmacht aufrechtzuerhalten. Aber es war ein Mitmensch, eine Frau, in die Maschen des Netzes geraten. Rauher, als es ihre Absicht war, stieß sie hervor: „Dann los, an die Arbeit. Aber ich bin keine ausgebildete Psi-Technikerin, deshalb mach mir keine Vorwürfe, wenn ich die Sache nur verschlimmere. Ich werde mein Bestes tun. Mehr kann ich nicht versprechen.“
3. Kapitel
Nur ungern läutete Magda die Nachtglocke des Gildenhauses. Es bedeutete, daß jemand aufstehen, die Treppe hinunterkommen und die verriegelte Tür öffnen mußte. Aber immer noch lieber das, so unangenehm es ihr war, als Cholaynas Angebot annehmen, in einem Zimmer des Blocks für unverheiratetes Personal oder gar im Heim der Brücken-Gesellschaft, wo einige der darvokanischen Schwesternschülerinnen wohnten, zu übernachten.
Schaudernd stand sie auf den Stufen, denn zu dieser Stunde war es auch im Hochsommer kalt, und horchte auf das Läuten der Glocke drinnen. Dann hörte sie das lange Scharren des schweren Riegels. Endlich öffnete die Tür sich widerwillig, und die Stimme einer jungen Frau fragte: „Wer ist da? Braucht Ihr die Hebamme?“
„Nein, Cressa. Ich bin es, Margali n’ha Ysabet“ Magda trat ein. „Es tut mir wirklich leid, dich zu stören. Ich werde ganz still nach oben und zu Bett gehen.“
„Das macht nichts, ich habe nicht geschlafen. Erst vor einer Weile kam jemand und holte Keitha. Das arme Mädchen, sie war den ganzen Tag fort und hatte sich gerade hingelegt, und dann kam ein Mann und sagte, seine Frau erwarte ihr erstes Kind. Jetzt wird sie auch noch die ganze Nacht aufsein. Beim Haustreffen vor ein paar Monden schlug jemand vor, wenn nachts geläutet werde, sollten immer die Hebammen öffnen, denn meistens sei es doch für sie.“
„Das wäre ungerecht“, meinte Magda. „Sie verdienen es zu schlafen, wenn sie können, schon aus dem Grund, weil sie so oft auf den Schlaf verzichten müssen. Nochmals, entschuldige, daß ich dich geweckt habe. Brauchst du Hilfe mit dem Riegel?“
„Ja, danke, er ist wirklich zu schwer für mich.“
Magda half ihr, den mächtigen Riegel zu befestigen. Cressa begab sich wieder in die Kammer der Nachtpförtnerin, und Magda stieg langsam die Treppe zu dem Zimmer hinauf, das man ihr während dieses Aufenthalts im Haus zur gemeinsamen Benutzung mit Jaelle angewiesen hatte. Vor der Tür blieb sie stehen, wandte sich wieder ab, ging zu einer nahe gelegenen Tür weiter und klopfte leise. Nach einem Augenblick hörte sie eine gedämpfte Antwort. Sie drehte den Knauf und trat ein.
„Camilla“, flüsterte sie, „schläfst du?“
„Natürlich schlafe ich! Könnte ich wohl mit dir reden, wenn ich wach wäre?“ Camilla richtete sich im Bett auf. „Margali? Was ist?“
Ohne zu antworten, setzte Magda sich auf die Bettkante, sank in sich zusammen und ließ den Kopf müde in die Hände fallen.
„Was ist, Bredhiya?“ fragte Camilla sanft. „Was haben sie diesmal von dir verlangt?“
„Ich möchte nicht darüber sprechen“ Ihr Empfindungsvermögen war so geschärft – sie hatte Laran auf einer solchen Ebene benutzt –, daß sie Camillas Gedanken fast hörte, als habe die Frau sie laut ausgesprochen:
O ja, natürlich, weil du nicht darüber sprechen willst, bist du zu mir gekommen und hast mich aufgeweckt, statt dich in deinem eigenen Zimmer schlafen zu legen!
Laut sagte Camilla nur: „Du hast das Abendessen hier versäumt. Hat man dir in der Terranischen Zone wenigstens zu essen gegeben?“
„Es ist meine eigene Schuld. Nach all diesen Jahren, in denen ich Laran-Arbeit getan habe, hätte ich gescheit genug sein sollen, etwas zu verlangen“, gestand Magda. „Aber ich wollte nichts als weg, ich konnte es nicht erwarten wegzukommen. Cholayna bot mir an…“
Camillas Augenbrauen wanderten im Dunklen in die Höhe. „Du hast Laran im terranischen HQ benutzt? Und du willst nicht darüber sprechen. Das klingt nach einer Geschichte, die ich Cholayna n’ha Chandria nicht zugetraut hätte.“ Sie stieg aus dem Bett, zog einen schweren wollenen Morgenrock über ihr warmes Nachthemd und fuhr mit den langen, schmalen Füßen in Pelzpantoffeln. „Komm, wir gehen in die Küche hinunter und sorgen dafür, daß du etwas Warmes in den Magen kriegst.“
„Ich habe keinen Hunger“, wehrte Magda müde ab.
„Trotzdem. Wenn du Laran benutzt hast – du weißt, daß du essen und deine Kräfte wiederherstellen mußt…“
„Was, bei allen Höllen Zandrus, weißt du davon?“ fauchte Magda. Camilla zuckte die Schulter.
„Ich weiß, was alle Welt weiß. Ich weiß, was die kleinen Kinder auf dem Marktplatz wissen. Und ich kenne dich. Komm mit nach unten, zumindest kann ich dir nach dem langen Weg in der Kälte heiße Milch geben. Zieh aber die Stiefel aus und deine Pantoffeln an.“
„Verdammt, Camilla, betüttele mich nicht.“
Wieder das gleichmütige Schulterzucken. „Wenn du die ganze Nacht in nassen Kleidern herumsitzen willst, bitte sehr. Vermutlich wird eine der jungen Schwesternschülerinnen entzückt sein über die Chance, dich bei einer Lungenentzündung zu pflegen. Aber es ist nicht recht, nach Mitternacht in schweren Stiefeln durch die Flure zu trampeln und alle zu wecken, die auf diesem Gang schlafen, nur weil du zu faul bist, die Stiefel auszuziehen. Bist du jedoch einfach zu müde, helfe ich dir.“
Magda raffte sich dazu auf, ihre Stiefel und ihre durchweichte Jacke abzustreifen. „Ich werde mir eins von deinen Nachthemden ausborgen; ich möchte Jaelle nicht wecken.“ Irgendwie brachte sie es fertig, sich der nassen Sachen zu entledigen und in ein Nachtgewand aus dickem Flanell zu schlüpfen.
„Wir nehmen deine Kleider am besten mit nach unten und trocknen sie; in der Küche wird Feuer sein“, sagte Camilla. Magda war zu erschöpft, um zu widersprechen. Sie hängte sich die nassen Sachen über den Arm und folgte Camilla.
Auf dem Weg die leeren Korridore und Treppen hinunter zitterte Magda, aber in der Küche des Gildenhauses brannte das Feuer noch unter der Asche, und in der Nähe des Herdes war es warm. Ein Kessel mit heißem Wasser zischte leise an seinem Haken. Camilla nahm Becher von einem Wandbrett, während Magda das Feuer schürte und ihre nassen Kleider ausbreitete. Camilla goß ihr Borkentee auf, ging in die Speisekammer und schnitt Brot und kaltes Fleisch ab. Sie stellte das Essen auf den Küchentisch neben die Schüsseln, in denen gewalzte Körner und Trockenobst für den Frühstücksbrei eingeweicht waren.
Lustlos nippte Magda an dem heißen bitteren Tee, zu müde, um auf dem Regal nach Honig zu suchen. Sie rührte Fleisch und Brot nicht an, saß bewegungslos auf der Bank vor dem Tisch. Camilla machte sich selbst auch Tee, doch statt ihn zu trinken, stellte sie sich hinter Magda. Ihre starken Hände kneteten die verspannten Muskeln in Schultern und Nacken der jüngeren. Nach langer Zeit streckte Magda die Hand nach einem Stück Butterbrot aus.
„Ich habe eigentlich keinen Hunger, aber ich glaube, ich sollte doch etwas essen“, meinte sie matt und führte es zum Mund.
Wie Camilla erwartet hatte, überfiel sie nach einem oder zwei Bissen der rasende Hunger eines Menschen, der mit Laran gearbeitet hat, und sie aß und trank beinahe mechanisch. Als sie Brot und Fleisch verspeist hatte, stand sie auf und suchte in der Speisekammer nach noch verbliebenem Kuchen mit Gewürzen und Zucker.
Endlich war ihr Hunger gestillt. Sie drehte die Bank um, damit sie die Füße auf das Kamingitter stellen konnte. Camilla setzte sich zu ihr und legte ihre eigenen Füße – lang und schmal und irgendwie aristokratisch – neben die Magdas. Schweigend saßen sie zusammen und blickten in die Glut. Nach einer Weile stand Magda auf und legte Holz aufs Feuer. Die Flammen loderten auf, und flackernde Schatten spielten über die Wände der höhlenartigen Küche.
Endlich sagte sie: „Ich bin keine richtige Psi-Technikerin, nicht in der Art, wie man sie sich in der Terranischen Zone vorstellt. Ich bin keine Therapeutin. Die Arbeit, die ich auf Armida tue, ist – ist anders. Heute nacht mußte ich in den Verstand eines anderen eindringen, eines Menschen, der normalerweise kopfblind ist, und versuchen…“ Sie benetzte die Lippen mit der Zunge. „Es ist nicht leicht zu erklären. Es gibt keine Worte dafür.“
Zögernd sah sie zu Camilla hinüber. Sie kannte diese Frau seit Jahren und wußte längst, daß Camilla Laran