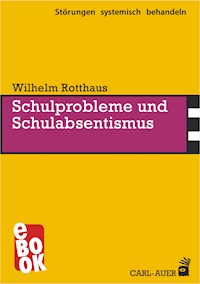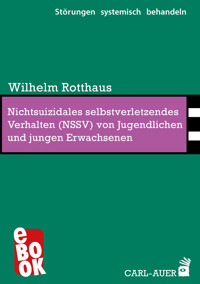Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl-Auer Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Störungen systemisch behandeln
- Sprache: Deutsch
Angststörungen gehören im Kindes- und Jugendalter zu den häufigsten psychischen Störungen. Fast jedes zehnte Kind leidet daran, und es gilt als erwiesen, dass sich Angststörungen nicht "von alleine auswachsen". Wilhelm Rotthaus stellt in diesem Buch zunächst aktuelle Erkenntnisse aus Neurobiologie, Evolutionsbiologie und Physiologie zu Angst und Angststörungen zusammenfassend dar. Es folgt eine Übersicht über die wichtigsten Risikofaktoren sowie das Störungsverständnis und die Therapieansätze der verschiedenen Psychotherapieverfahren. Der Schwerpunkt liegt auf der Darstellung eines systemtherapeutischen Krankheitsverständnisses und der systemischen Psychotherapie der Angststörungen im Kindes- und Jugendalter. Nutzen und Gefahren einer Störungsorientierung werden ebenso diskutiert wie die Vor- und Nachteile diagnostischer Klassifikationen. Vor allem aber wird ein breites Spektrum systemischer Methoden ausgebreitet, die sich für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen und ihren Angehörigen anbieten. Sie versprechen eine hohe und anhaltende Wirksamkeit und ermöglichen zudem einen humorvoll-heiteren Umgang auch mit ernsten Problemen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 306
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Störungensystemischbehandeln
Störungen systemisch behandelnBand 3
Herausgegeben vonHans Lieb und Wilhelm Rotthaus
Zu diesem Buch gibt es ergänzendes Materialonline: carl-auer.de/zmkj
Wilhelm Rotthaus
Ängste von Kindernund Jugendlichen
Zweite Auflage, 2021
Mitglieder des wissenschaftlichen Beirats des Carl-Auer Verlags:
Prof. Dr. Rolf Arnold (Kaiserslautern)
Prof. Dr. Dirk Baecker (Witten/Herdecke)
Prof. Dr. Ulrich Clement (Heidelberg)
Prof. Dr. Jörg Fengler (Köln)
Dr. Barbara Heitger (Wien)
Prof. Dr. Johannes Herwig-Lempp (Merseburg)
Prof. Dr. Bruno Hildenbrand (Jena)
Prof. Dr. Karl L. Holtz (Heidelberg)
Prof. Dr. Heiko Kleve (Witten/Herdecke)
Dr. Roswita Königswieser (Wien)
Prof. Dr. Jürgen Kriz (Osnabrück)
Prof. Dr. Friedebert Kröger (Heidelberg)
Tom Levold (Köln)
Dr. Kurt Ludewig (Münster)
Dr. Burkhard Peter (München)
Prof. Dr. Bernhard Pörksen (Tübingen)
Prof. Dr. Kersten Reich (Köln)
Dr. Rüdiger Retzlaff (Heidelberg)
Prof. Dr. Wolf Ritscher (Esslingen)
Dr. Wilhelm Rotthaus (Bergheim bei Köln)
Prof. Dr. Arist von Schlippe (Witten/Herdecke)
Dr. Gunther Schmidt (Heidelberg)
Prof. Dr. Siegfried J. Schmidt (Münster)
Jakob R. Schneider (München)
Prof. Dr. Jochen Schweitzer (Heidelberg)
Prof. Dr. Fritz B. Simon (Berlin)
Dr. Therese Steiner (Embrach)
Prof. Dr. Dr. Helm Stierlin (Heidelberg)
Karsten Trebesch (Berlin)
Bernhard Trenkle (Rottweil)
Prof. Dr. Sigrid Tschöpe-Scheffler (Köln)
Prof. Dr. Reinhard Voß (Koblenz)
Dr. Gunthard Weber (Wiesloch)
Prof. Dr. Rudolf Wimmer (Wien)
Prof. Dr. Michael Wirsching (Freiburg)
Prof. Jan V. Wirth (Meerbusch)
Reihe »Störungen systemisch behandeln«, Band 3
hrsg. von Hans Lieb und Wilhelm Rotthaus
Reihendesign: Uwe Göbel
Umschlag und Satz: Heinrich Eiermann
Printed in Germany
Druck und Bindung: CPI books GmbH, Leck
Zweite Auflage, 2021
ISBN 978-3-8497-0069-0 (Printausgabe)
ISBN 978-3-8497-8281-8 (ePub)
© 2015, 2021 Carl-Auer-Systeme Verlag und Verlagsbuchhandlung GmbH, Heidelberg
Alle Rechte vorbehalten
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Informationen zu unserem gesamten Programm, unseren Autoren und zum Verlag finden Sie unter: www.carl-auer.de.
Wenn Sie Interesse an unseren monatlichen Nachrichten haben, können Sie dort auch den Newsletter abonnieren.
Carl-Auer Verlag GmbH
Vangerowstraße 14 • 69115 Heidelberg
Tel. +49 6221 6438-0 • Fax +49 6221 6438-22
Inhalt
Vorwort der Herausgeber
Vorwort
Zum Geleit
1 Einleitung
2 Klinisches Erscheinungsbild
2.1 Vom Phänomen zur Diagnose (und zurück)
2.1.1Ängste in der Kindheit
2.1.2Die Angst, dein sorgender Freund
2.1.3Diagnose »Angststörung«
2.1.4 Was sagen Diagnosen?
2.1.5 Chancen und Risiken von Diagnosen
2.2 Angststörungen
2.2.1 Angststörungen generell
2.2.1.1 »Angststörung« als Oberbegriff für unterschiedliche Störungsbilder
2.2.1.2 Häufigkeit von Angststörungen
2.2.1.3 Komorbidität
2.2.1.4 Verlauf
2.2.1.5 Angststörungen und Suizid
2.2.1.6 Geschwister von Kindern mit Angststörungen
2.2.1.7 Differenzialdiagnose
2.2.2 Spezielle Angststörungen
2.2.2.1 Angststörung mit Trennungsangst
2.2.2.2 Spezifische Phobie
2.2.2.3 Soziale Phobie
2.2.2.4 Generalisierte Angststörung
2.2.2.5 Panikstörung
2.2.2.6 Agoraphobie
2.2.2.7 Prüfungsangst
2.2.2.8 Albträume
3 Neurobiologie der Angst
3.1 Generelle Erkenntnisse zur Bedeutung der Angst
3.1.1 Neurobiologie und Psychotherapie
3.1.2 Die Angst als stammesgeschichtlicher und individueller Motor der Entwicklung des Menschen
3.1.3 Das Zusammenspiel von Amygdala und präfrontalem Kortex
3.1.4 Angsterregung klingt nur langsam ab
3.1.5 Stress senkt die Schwelle für Angst
3.1.6 Der »Sinn« typischer Symptome bei Angststörungen
3.1.7 Nichtbewusste Auslöser von Angst und Stress
3.1.8 Die Bedeutung der »Bedeutungszuordnung«
3.1.9 Angst beeinträchtigt Lernen und Leistung
3.2 Spezielle neurobiologische Erkenntnisse zur Therapie von Angststörungen
3.2.1 Angst kann man nicht willentlich »wegmachen«
3.2.2 Angstreaktionen kann man nicht löschen
3.2.3 Der Weg der Angstreduzierung ist Hemmung
3.2.4 Neulernen im bewussten Funktionsmodus
4 Evolutionsbiologie der Angst
5 Risikofaktoren für Angststörungen von Kindern und Jugendlichen
5.1 Familiäre Häufung von Angststörungen
5.2 Höhere Rate an Angststörungen bei Mädchen
5.3 Kinder mit verhaltensgehemmtem Temperament
5.4 Angstsensitivität
5.5 Verzerrungen der Informationsverarbeitung
5.6Kontrollerfahrungen in der Kindheit
5.7 Elterlicher Erziehungsstil
5.8 Emotionsregulation
6 Störungsverständnis und Therapieansätze der verschiedenen Psychotherapieverfahren
6.1 Störungsverständnis und Therapieansätze der psychodynamischen Therapie
6.1.1 Störungsverständnis
6.1.2 Therapieansätze
6.2 Störungsverständnis und Therapieansätze der Gestalttherapie
6.2.1 Störungsverständnis
6.2.2 Therapieansätze
6.3 Störungsverständnis und Therapieansätze der personenzentrierten Psychotherapie
6.3.1 Störungsverständnis
6.3.2 Therapieansätze
6.4 Störungsverständnis und Therapie ansätze der Verhaltenstherapie
6.4.1 Störungsverständnis
6.4.2 Therapieansätze
6.5 Bindungstheoretisches Störungsverständnis
6.6 Schematheoretisches Störungsverständnis
7 Systemtherapeutisches Störungsverständnis der Angststörungen von Kindern und Jugendlichen
7.1 Generelle Aspekte
7.2 Angst als Signal für anstehende Entwicklungsprozesse
7.2.1 Entwicklung als familiäre Koevolution
7.2.2 Das Angsttetralemma
7.2.3 Angst als Ausdruck des Noch-nicht-Wissens
7.3 Die beziehungsregulierende Funktion von Angststörungen
7.4 Keine Angst haben wollen
7.5 Das Vermeiden der Angstsituation
7.6 Hilfe von Angehörigen
7.7 Das Symptom als kommunikativ erzeugtes Problem
7.8 Krankheitsverständnis der sozialen Phobie
8 Systemische Therapie der Angststörungen von Kindern und Jugendlichen
8.1 Systemische Therapie in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen und ihren Angehörigen
8.2 Das Konzept der klinischen Konstellation
8.3 Der Nutzen störungsspezifischer Erkenntnisse für die Systemische Therapie
8.4 Neugierde und die Fähigkeit, Unsicherheit zu ertragen und zu schätzen
8.5 Systemische Hypothesenbildung
8.6 Die Entwicklung neuer Ideen zu Angst im therapeutischen Gespräch
8.6.1 Konsequenzen aus Neurobiologie und Evolutionsbiologie
8.6.2 Die Physiologie der Angst
8.6.3 Lösungen 2. Ordnung
8.6.4 Die guten Seiten der Angst
8.6.5 Angst als aktives Tun
8.7 Die Wahl des Settings als Intervention und Thema der Kommunikation
8.8 Ziel- und Auftragsklärung
8.9 Das Vermeiden vermeiden – sich der Angst aussetzen
8.10 Ablenkung
8.11 Energie folgt der Aufmerksamkeit
8.12 Musterunterbrechung
8.13 Paradoxe Handlungsvorschläge
8.14 Positive Konnotation und Umdeutung (Reframing)
8.15 Die Externalisierung der Angst
8.16 Teilearbeit
8.17 Teilearbeit mit Handpuppen
8.18 Geschichten
8.19 Symptomdarstellung und -veränderung
8.20 Imaginäre Helfer
8.21 Rituelle Handlungen
8.22 Angsten und Entangsten
8.23 Zutrauen – Zumuten – Zulassen
8.24 Unterstützer gewinnen
8.25 Lebensgeschichtliche Sequenz von Familienbrettskulpturen
8.26 Spezifische Angststörungen
8.26.1 Prüfungsangst
8.26.2 Albträume
9 Medikamentöse Therapie
10 Rückfallprophylaxe
Literatur
Über den Autor
Vorwort der Herausgeber
Ursprünglich ein querdenkendes Außenseiterkonzept, hat sich der systemische Ansatz heute in vielen Bereichen der Therapie und der Beratung theoretisch wie praktisch etabliert. Auch Vertreter anderer Schulen bereichert er mittlerweile in ihrer Arbeit. Die Etablierung eines Paradigmas birgt für dieses selbst aber auch Risiken, weil sie stets mit der Verfestigung von Denk- und Handlungsgewohnheiten einhergeht. Die Reihe Störungen systemisch behandeln stellt sich vor diesem Hintergrund zwei Herausforderungen: Nichtsystemischen Behandlern und Vertretern anderer Therapierichtungen soll sie komprimiert und praxisorientiert vorstellen, was die systemische Welt im Hinblick auf bestimmte Störungsbilder zu bieten hat. Innerhalb der Systemtherapie steht sie für eine neue Phase im Umgang mit dem Konzept von »Störung« und »Krankheit«.
Historisch gesehen war einer ersten Phase mit erfolgreichen Konzepten zu Krankheitsbildern wie Schizophrenie, Essstörungen, psychosomatischen Krankheiten und affektiven Störungen eine zweite Phase gefolgt, die geprägt war von einem gezielten Verzicht oder einer definitiven Ablehnung aller Formen störungsspezifischer Codierungen. In jüngerer Zeit wenden sich manche Vertreter der systemischen Welt wieder störungsspezifischen Konzepten und Fragen zu – und werden von anderen dafür deutlich attackiert. Diese neue Welle ist bedingt durch die Anerkennung der Systemtherapie als wissenschaftliches Heilverfahren, durch den Antrag auf deren sozialrechtliche Anerkennung und nicht zuletzt dadurch, dass viele im klinischen Sektor systemisch arbeitende Kollegen täglich gezwungen sind, sich zu störungsspezifischen Konzepten zu positionieren.
Die systemische Welt hat hierzu einiges anzubieten. Die Reihe Störungen systemisch behandeln will zeigen, dass und wie die Systemtheorie mit traditionellen diagnostischen Kategorien bezeichnete Phänomene ebenso gut und oft besser beschreiben, erklären und mit hoher praktischer Effizienz behandeln kann. Sie verfolgt dabei zwei Ziele: Zum einen soll systemisch arbeitenden Kollegen das große Spektrum theoretisch fundierter und praktikabler systemischer Lösungen für einzelne Störungen zugänglich gemacht werden – ohne das Risiko, die eigene systemische Identität zu verlieren, im besten Fall sogar mit dem Ergebnis einer gestärkten systemischen Identität. Gleichzeitig soll nichtsystemischen Behandlern und Vertretern anderer Schulen das umfangreiche systemische Material an Erklärungen, Behandlungskonzepten und praktischen Tools zu verschiedenen Störungsbildern auf kompakte und nachvollziehbare Weise vermittelt werden.
Verlag, Herausgeber und Autoren bemühen sich, einerseits eine für alle Bände gleiche Gliederung einzuhalten und andererseits kreativen systemischen Querdenkern die Freiheit des Gestaltens zu lassen.
An die Stelle der Abgrenzung und der Konkurrenz zwischen den verschiedenen Therapieschulen ist heute der Austausch zwischen ihnen getreten. Die Reihe Störungen systemisch behandeln versteht sich als ein Beitrag zu diesem Dialog.
Dr. Hans Lieb, Dr. Wilhelm Rotthaus
Vorwort
Angst ist, so schreibt Wilhelm Rotthaus gleich zu Beginn seines Textes, „das vielleicht wichtigste Gefühl, das wir haben“. Gleichzeitig wird die Angst aber, wenn sie übermäßig ist, quälend und lähmend. Viele Kinder und Jugendliche leiden in hohem Maße unter dieser übermäßigen Angst, sodass sie psychotherapeutische Hilfe benötigen. Nun bin ich selber Verhaltenstherapeut, und wir Verhaltenstherapeuten sind ja durchaus zu Recht stolz darauf, bei der Behandlung von Ängsten beachtliche Erfolge erzielen zu können. Zum Glück führt aber das Vorhandensein von Therapiekonzepten, die nachgewiesenermaßen bei einer relevanten Anzahl von Patienten helfen, nicht dazu, dass nicht weitere Bemühungen unternommen werden, noch mehr Patienten noch besser helfen zu können.
Der in dem vorliegenden Buch weit geöffnete Blick auf den Menschen in seinem System hilft dabei zu erkennen, dass die symptomorientierte Behandlung der Angst nur ein Teilaspekt des Vorgehens sein kann; denn in vielen Fällen hat die Angst auch beziehungsregulierende Funktion. Immer ist sie eingebettet in eine spezifische Konstellation von Ressourcen und Problemen des Indexpatienten und aller im System relevanten Personen sowie deren Beziehungen und Interaktionen untereinander. Die Bewältigung der Angst ist eben auch eine Entwicklungsaufgabe für das System, worauf Wilhelm Rotthaus ausführlich hinweist.
Wie bei anderen Störungen auch, so darf bei den Angststörungen nicht vergessen werden, dass die Unterschiede zwischen den Patienten in ihren Systemen mindestens genauso wichtig sind wie die Gemeinsamkeiten. Diese Unterschiedlichkeit führt dazu, dass es eben nicht das eine Vorgehen gibt, welches allen Patienten gleichermaßen hilft. Vielmehr ist es wichtig, ein breites Methodenrepertoire anwenden zu können, um den einzelnen Patienten und ihren Familien bestmöglich zu helfen. Und dabei ist es aus Patientensicht letztlich völlig unerheblich, unter welchem Label (Systemische Therapie, Verhaltenstherapie …) diese Hilfen angeboten werden. Auch wenn sich diese Einstellung im Rahmen unseres Gesundheitssystems noch lange nicht wird durchsetzen können: Gerade aus diesem Grund schreibe ich als ausgebildeter Verhaltenstherapeut besonders gern ein Vorwort für dieses Buch eines renommierten systemisch orientierten Kollegen. Noch sind wir nicht bei einer allgemeinen, schulenübergreifenden Psychotherapie angekommen, aber Bücher wie dieses können ein wichtiger Schritt auf dem Weg dorthin sein.
Auf der einen Seite übernimmt Wilhelm Rotthaus ohne jede Berührungsangst zentrale Aspekte der Verhaltenstherapie (vor allem Exposition; ebenso werden aber auch Gedankenstopp und Selbstverbalisation – originär verhaltenstherapeutische Methoden – erwähnt) in sein Therapiekonzept, weil sie eben auch im Rahmen einer systemisch orientierten Therapie sinnvoll eingesetzt werden können. Andererseits wird eine Fülle von Methoden dargestellt, die systemischen Ursprung haben und systemisch begründet werden, die aber auch im Rahmen verhaltenstherapeutisch orientierter Therapiekonzepte eingesetzt werden können – erwähnt seien hier Reframing, die Einführung von rituellen Handlungen und imaginierten Helfern, Musterunterbrechung, paradoxe Handlungsanleitungen sowie die Techniken der Externalisierung und der Teilearbeit.
Und dann gibt es da noch die Handlungsideen, bei denen systemischer Ansatz und Verhaltenstherapie sich nur graduell zu unterscheiden scheinen. Viele systemische Methoden können auch als kognitive Umstrukturierung verstanden werden und werden auch vom Autor so deklariert. Wilhelm Rotthaus arbeitet an dieser Stelle den Unterschied zur kognitiven Umstrukturierung in der Verhaltenstherapie dahin gehend heraus, dass in seinem Konzept der Therapeut bzw. die Therapeutin nicht mit dem Anspruch arbeite zu wissen, welche Kognitionen für den Patienten die besseren seien, sondern auf viel grundlegendere Art zu selbstbestimmten kognitiven Veränderungen anregen will. Hier könnte man konstruktiv darüber streiten, ob das tatsächlich ein substanzieller Unterschied zwischen den Verfahren ist.
Und schließlich gibt es noch diejenigen Konzepte, die der Autor hier einbaut, die weder der einen noch der anderen Therapieschule zuzuordnen, aber in einer fachgerechten Psychotherapie sicher von besonderer Bedeutung sind. Psychotherapeutische Hilfe – und eben auch das wird in dem vorliegenden Buch deutlich – muss grundbedürfnisorientiert sein. Stets ist nicht nur nach der Funktion des Verhaltens für das System zu fragen, sondern auch nach den Auswirkungen auf die psychischen Grundbedürfnisse (Bindung, Selbstwert, Orientierung/Kontrolle, Lustgewinn/Unlustvermeidung) der Patienten.
Ist also jetzt alles sowieso irgendwie dasselbe? Benötigen wir gar keine schulenspezifischen Therapiekonzepte mehr, und ist das vorliegende Buch ein Beispiel für eine neue, schulenüberwindende Psychotherapie? Nein, soweit sind wir (noch?) nicht, weder im Bereich der Forschung noch im Bereich der Theoriebildung. Es gibt unterschiedliche Herangehensweisen, unterschiedliche Arten, die jeweilige Problemkonstellation erfassen zu wollen, unterschiedliche Schwerpunkte in der Behandlung. Aber es gibt keine Notwendigkeit für rituelle Abgrenzungen voneinander, keine Notwendigkeit, vermeintlich grundsätzliche Unterschiede zu strapazieren. Stattdessen wird hier ein klar systemisch orientiertes Buch vorgelegt, in das aber völlig unaufgeregt Ideen und Konzepte aus anderen Schulen integriert wurden. An der einen oder anderen Stelle scheint die Distanz zwischen den Verfahren so gering zu sein, dass sie fast zu vernachlässigen ist. An anderen Stellen aber gibt es diese Unterschiede, und sie können und müssen auch noch weiterhin Ausgangspunkt für fruchtbare Auseinandersetzungen mit dem Thema der Integration oder gar der Überwindung von Psychotherapieschulen zum Wohle der Patienten sein.
Besonders erhellend sind in dem vorliegenden Buch die Abschnitte zum systemischen Störungsverständnis. Hier wird der Blick – unter anderem – als Erweiterung einer symptomzentrierten Sichtweise sowohl auf beziehungsorientierte Hypothesen als auch auf die Entwicklungsaufgaben gelegt, die Kinder und Jugendliche im Zusammenspiel mit ihren Eltern zu bewältigen haben. Dass Ängste – egal welcher Art – als Signal für anstehende Entwicklungs- und Entscheidungsschritte angesehen werden können, ist plausibel und erweitert das Verständnis für diese Störungen.
Methodisch stellt Wilhelm Rotthaus ein breites Spektrum vor, sodass einzelfallorientiert die hilfreichsten Methoden ausgewählt werden können. Insofern ist dieses Buch kein „Manual“, das für die verschiedenen Patienten die gleiche Vorgehensweise empfiehlt. Das Gegenteil ist der Fall: Die Therapeuten werden nicht aus der Verantwortung entlassen, auf die Besonderheiten des Einzelfalls zu achten und angemessene Therapiemethoden auszuwählen. Hier ist nichts besonders hervorzuheben; denn alles passt – nur eben auf unterschiedliche Patienten.
Ich hoffe, dass dieses Buch eine breite Leserschaft erreicht; denn die hier differenziert unter Berücksichtigung allgemeinpsychologischer Erkenntnisse herausgearbeitete systemische Perspektive kann – wie im ersten Absatz dieses Vorwortes gefordert – dazu beitragen, tatsächlich noch mehr Betroffenen noch besser zu helfen.
Prof. Dr. Michael Borg-LaufsMönchengladbach, im Januar 2015
Zum Geleit
Die Systemische Therapie zeichnet sich durch ein sehr geringes Maß an Vorannahmen und Vorfestlegungen aus. Der Einfluss des Konstruktivismus hat dazu geführt, Ideen von Wahrheit und Objektivität infrage zu stellen. Und linearere Kausalitäten wurden als unangemessene Modelle zur Erklärung menschlichen Erlebens und Verhaltens erkannt, da sie bestenfalls als ein Teilaspekt der Komplexität des Geschehens, mit denen Therapeutinnen1 es zu tun haben, anzusehen sind. Die Systemische Therapie ist deshalb geprägt durch eine hohe Offenheit und große Freiräume, die zugunsten der Patienten und ihrer Angehörigen genutzt werden können.
Demgegenüber sind Diagnosen, die ein wesentliches Kennzeichen des Gesundheitswesens sind, typisierende Beschreibungen menschlichen Verhaltens, die Eingrenzungen und Abgrenzungen vollziehen. Zwar eröffnen sie neben anderen Vorteilen die Chance, therapeutisches Erfahrungswissen zu sammeln und zu sichten und es allen therapeutisch Arbeitenden zur Verfügung zu stellen. Dies ist zweifellos ein wichtiger Beitrag zur Qualitätssicherung. Zugleich aber bergen Diagnosen die Gefahr, den Blick sowohl der Patienten und ihrer Angehörigen als auch den der professionell Tätigen einzuengen, Festlegungen nicht mehr zu hinterfragen, eine Problemfokussierung vorzunehmen und unangemessene Verallgemeinerungen zu vollziehen.
Das hier vorgelegte Buch zur Behandlung der Angststörungen von Kindern und Jugendlichen soll aufzeigen, wie systemische Therapeutinnen mit diesen konträren Positionen umgehen. Es soll deutlich machen, welche störungsspezifischen Ideen systemische Therapeutinnen für die Behandlung dieser Gruppe von Kindern und Jugendlichen entwickelt haben und wie sie trotz des störungsspezifischen Blickes die systemische Offenheit und die systemische Freiheit von einengenden Vorannahmen bewahren. Den Kolleginnen, die ihre »Heimat« in anderen Verfahren haben, sollen mit diesem Buch systemische Vorgehensweisen zur Behandlung von Angststörungen von Kindern und Jugendlichen möglichst anschaulich nahegebracht werden. Systemische Therapeutinnen sollen angeregt werden, eine störungsorientierte Perspektive zu nutzen, ohne sich in ihrer Freiheit des Denkens und Handelns einengen zu lassen. Wie weit das gelungen ist, mögen die Leser entscheiden.
Wilhelm RotthausBergheim, im Januar 2015
1 In diesem Buch wird zwischen der weiblichen und der männlichen Form gewechselt. Personen des jeweils anderen Geschlechts mögen sich gleichermaßen angesprochen fühlen.
1Einleitung
Angst ist das vielleicht wichtigste Gefühl, das wir Menschen haben. Angst ergreift den ganzen Menschen: sein körperliches System, sein psychisches System und sein soziales System. Sie schützt uns vor Gefahr und ist gleichzeitig ein Signal dafür, dass im Laufe der Entwicklung anstehende Entwicklungsschritte bewältigt werden müssen. Ängste und die dadurch ausgelösten Stressreaktionen waren in der Menschheitsgeschichte immer wieder Anstoß zu notwendigen Anpassungsreaktionen. Auch in der individuellen Entwicklung dienen Ängste der Aktivierung vorhandener und der Ausbildung neuer Bewältigungsstrategien. Angst, die therapeutische Unterstützung notwendig macht, unterscheidet sich von »normaler« Angst durch ihre Intensität, ihre Dauer und dadurch, dass sie bei Betrachtung des situativen Kontextes als unangemessen erscheint. Das Kind oder der Jugendliche sieht keine Möglichkeit, die Angst erträglich zu machen oder zu bewältigen, und sowohl seine Lebensqualität als auch seine Entwicklungschancen werden erheblich beeinträchtigt.
Angststörungen gehören im Kindes- und Jugendalter zu den häufigsten psychischen Störungen. Fast jedes zehnte Kind leidet an einer Angststörung, und es ist heute erwiesen, dass sich Angststörungen nicht »von alleine auswachsen«. Vielmehr sind sie über den Verlauf relativ stabil und stellen einen bedeutenden Risikofaktor für die Entwicklung weiterer psychischer Störungen sowohl im Jugend- als auch im Erwachsenenalter dar. Angststörungen sind aber nicht so laut und unmittelbar auffallend wie andere Störungen des Kindes- und Jugendalters, die mit expansiven Verhaltensweisen einhergehen. Deshalb erhalten viele Kinder und Jugendliche – manche Autoren formulieren: die wenigsten Kinder und Jugendlichen –, die die Symptome einer Angststörung zeigen, eine angemessene Behandlung.
Obwohl ich glaube, die systemische Grundhaltung nach 35 Jahren systemischer Praxis recht gut internalisiert zu haben und auch über eine recht gute Vielfalt systemischer Methoden zu verfügen, gehörte die Behandlung von Kindern und Jugendlichen mit Angst- (und Zwangs-)störungen über lange Zeit nicht gerade zu meinen Lieblingsaufgaben. Das hat sich völlig geändert, nachdem ich an einem Seminar zu diesem Thema teilgenommen hatte und dazu angeregt war, mich mit Angst in ihren unterschiedlichsten Erscheinungsformen näher auseinanderzusetzen und in die Literatur zu Angststörungen – vor allem, aber keineswegs nur in systemische Publikationen – einzuarbeiten. Seitdem begegne ich Kindern, Jugendlichen und ihren Angehörigen, die wegen Angst in ihren unterschiedlichen Erscheinungsformen zu mir zur Therapie kommen, mit großer Freude und ebenso großer Zuversicht. Es würde mich freuen, wenn Kolleginnen und Kollegen durch dieses Buch in ähnlicher Weise angeregt werden könnten.
2Klinisches Erscheinungsbild
2.1Vom Phänomen zur Diagnose (und zurück)
2.1.1 Ängste in der Kindheit
Die Kindheit ist eine Zeit der lebhaften Entwicklung. In ihrem Verlauf muss das Kind Vertrautes und Sicherheiten immer wieder aufgeben, um Neues kennenzulernen und zu bewältigen. Deshalb ist Angst in der Kindheit häufig und geradezu ein typisches Merkmal dieser Lebensphase. Im Verlauf seiner kognitiven Entwicklung lernt das Kind, potenzielle Gefahren in seinem Umfeld, das es ständig erweitert, wahrzunehmen und auf ihre tatsächliche Gefährlichkeit zu überprüfen. Dafür bedarf es einer geistigen Reife und eines hinreichenden Erinnerungsvermögens, die es möglich machen, Bekanntes von Unbekanntem zu unterscheiden. Dadurch erklärt sich, dass die Angstobjekte im Verlauf der Kindheit wechseln und somit schwerpunktmäßig einem bestimmten Alter bzw. Entwicklungsstand zugeordnet werden können (Gullone 2000).
Zumindest während der Kindheit ist die Angst vor dem Verlust der Geborgenheit das zentrale, sozusagen »durchlaufende« Thema. Im Alter bis zu sechs Monaten reagieren Kinder auf laute Geräusche häufig mit Angst. Im Alter zwischen sieben und zwölf Monaten zeigen sie Angst vor dem Unbekannten, vor fremden Menschen, fremden Objekten und vor der Höhe. Sie fürchten jetzt die Trennung von den Bezugspersonen, haben Angst vor Verletzungen. Im Alter von zwei bis vier Jahren treten unterschiedliche Ängste auf: Angst vor Tieren, Angst vor Dunkelheit, Angst vor Fantasiegestalten und potenziellen Einbrechern. Sechs- bis achtjährige Kinder fürchten sich vor übernatürlichen Dingen, vor Donner und Blitz, vor dem Alleinsein und zeigen Ängste, die durch Fernsehen und Filme ausgelöst wurden. Im Alter von neun bis zwölf Jahren treten die Angst vor Prüfungen in der Schule in den Vordergrund, wesentlich aber auch soziale Ängste. Letztere sind dann vor allem als Angst vor der Zurückweisung durch Gleichaltrige bei den 12- bis 18-Jährigen häufig. Im höheren Jugendalter sind im Übrigen globale Ängste, etwa vor politischen oder ökonomischen Krisen und Gefahren, anzutreffen.
2.1.2 Die Angst, dein sorgender Freund
Die Fähigkeit, Angst zu produzieren, ist eine wichtige Leistung von Menschen. Angst gehört zum Leben; sie ist ein treu sorgender Freund. Angst sorgt für Entwicklung. Sie tritt auf bei neuen Aufgaben, die das Fähigkeitsprofil der oder des Betroffenen herausfordern oder aber die Weiterentwicklung vorhandener Fähigkeiten verlangen. Das dabei auftretende Erleben von Stress und Anspannung macht die Zufriedenheit und den Stolz nach der Bewältigung der Herausforderungen umso größer. Allerdings kann es auch geschehen, dass die Angst und der damit einhergehende Stress ein so großes Ausmaß erreichen, dass die Handlungsfähigkeit weitgehend blockiert wird und Lösungen nicht mehr gefunden werden.
Wann ist die Angst also gut und förderlich, und wie viel Stress und Angst sind schlecht und hinderlich? Wann ist Angst normal, und wann ist sie pathologisch, sodass sie ernsthaftes Leiden hervorbringt und Entwicklung verhindert? Entscheidbar ist das für den Beobachter, der beispielsweise darauf schaut, wie ein Kind seine Entwicklungsaufgaben bewältigt. Natürlich sind Entscheidungen des Beobachters kulturell geprägt und zudem subjektiv. Da objektive Maßstäbe fehlen und die Grenze zwischen »normal« und »pathologisch« fließend ist, findet unter den Beobachtern in der Regel ein Konsensprozess statt, d. h., die Beurteilung wird durch die Suche nach einer Mehrheitsentscheidung zu untermauern versucht. Dies geschieht im jeweils individuell relevanten Bezugssystem des Kindes durch den Austausch mit Familienangehörigen, Freunden und Bekannten und überindividuell durch die Erarbeitung von Diagnosekriterien, die »gesund« und »krank« zu trennen versuchen. Dabei gilt Heinz von Foersters kluger Satz, dass wir immer nur solche Fragen entscheiden können, die prinzipiell unentscheidbar sind. (Die Frage, ob zwei plus zwei gleich vier ist, können wir nicht entscheiden, weil sie entschieden ist.)
Aber natürlich ist auch der Betroffene selbst an diesem Beurteilungsprozess beteiligt. Als Beobachter seiner selbst trifft er ebenfalls eine Entscheidung, beispielsweise indem er sagt: »Ich habe so viel Angst, wie sie keiner meiner Freunde und Mitschüler zeigt; sie ist unerträglich.« Er redet dann über die Angst, als würde sie nicht von ihm selbst gemacht, als sei sie etwas Fremdes, das über ihn kommt. Die Verbindung mit seinen eigenen Kognitionen stellt er nicht her, zumeist sind ihm die eigenen internen Prozesse nicht bewusst.
Schließlich kann es geschehen, dass der Betroffene selbst seinen eigenen Ängsten überraschend gleichmütig gegenübersteht, selbst wenn er in Reaktion darauf seinen Handlungsspielraum sehr einschränkt. In solchen Fällen hat möglicherweise nur seine Umwelt ein Problem damit.
2.1.3 Diagnose »Angststörung«
In den Fällen, in denen mehrere Beobachter zu der Überzeugung kommen, dass die von einem Betroffenen produzierte Angst ein quantitativ zu hohes, qualitativ zu bedrängendes und zeitlich zu lang andauerndes Ausmaß hat, stellt die professionelle Helferwelt sprachliche Übereinkünfte wie die ICD1 oder das DSM2 zur Verfügung, nach denen Auffälligkeiten im Erleben und Verhalten gemäß genau definierten Kriterien unterschieden und unter dem Oberbegriff »Angststörungen« klassifiziert werden. Unterschiedliche Ausprägungen von Angst im Kindes- und Jugendalter werden dann mit den Diagnosen »Trennungsangst«, »spezifische Phobie«, »soziale Phobie«, »generalisierte Angststörung«, »Panikstörung« und »Agoraphobie« beschrieben. Natürlich sind auch diese Diagnosen – wie alle Diagnosen – nicht trennscharf voneinander abzugrenzen. Es sind typisierende Beschreibungen, die ein häufiges Zusammentreffen bestimmter Symptome schildern. Das ist nützlich für die Therapeutin, da sich ihr damit ein Fragenhorizont eröffnet. In der Realität aber überschneiden sich die einzelnen Angststörungen in weit über 50 % der Fälle. Das spezielle Störungsbild des einzelnen Kindes oder Jugendlichen trägt meist Kennzeichen mehrerer Angststörungen; hinzu treten zudem häufig sogenannte komorbide Störungen, beispielsweise besonders oft depressive Störungen.
2.1.4 Was sagen Diagnosen?
Psychiatrische Diagnosen sind reine Beschreibungen von Auffälligkeiten im Erleben und Verhalten eines Menschen. Sie erklären nichts. Sie geben auch keinerlei Auskunft über die Ätiologie des Beschriebenen. Darin bestand der große Schritt von der ICD-9 zur ICD-10. Die Autorinnen und Autoren der ICD-10 erklärten, man wisse derzeit so wenig über die Ursachen psychischer Störungen, dass man sich entschlossen habe, Überlegungen zu den Ursachen aus den diagnostischen Beschreibungen ganz herauszulassen. Wesentlich aus diesem Grund wählte man auch – wie im Vorwort der ICD-10 ausgeführt – den Begriff »Störung«,
»um den problematischen Gebrauch von Ausdrücken wie ›Krankheit‹ oder ›Erkrankung‹ zu vermeiden.«
Denn ein populärwissenschaftliches Konzept von Krankheit ist traditionell mit der Idee verbunden, dass Symptome Anzeichen für zugrunde liegende Prozesse seien, die behandelt respektive beseitigt werden müssten – eine Vorstellung, die für psychische Störungen kaum als zutreffend angesehen werden kann.
Diese Beschreibungen von auffälligen, symptomatischen Verhaltensweisen, die zu Syndromen zusammengefasst und mit einem diagnostischen Begriff etikettiert werden, basieren auf Unterscheidungen, die ein Beobachter oder eine Gruppe von Beobachtern
»entweder aufgrund beobachteter Veränderungen in einer Zeitspanne oder aufgrund von Vergleichen mit anderen Menschen, stellvertretend auch mit Normen, gemacht hat. Die Beschreibung von Verhalten beruht auf Unterscheidungen im Phänomenbereich des Verhaltens. Verhalten beschreibt Veränderungen eines Wesens in Bezug auf ein Milieu« (Maturana u. Varela 1987, S. 150).
Demgegenüber dienen diese Verhaltensweisen aus der Sicht des Individuums der Verwirklichung seiner Struktur in Koppelung mit seiner Umgebung und sind deshalb für dieses Individuum sinnvoll und angemessen. Es besteht also eine Diskrepanz zwischen der Logik des Beobachters und der Logik des diagnostizierten Individuums (Ludewig 1989, S. 32). Diese Diskrepanz zu berücksichtigen ist für die psychotherapeutische Arbeit von hoher Bedeutung (siehe Abschn. 8.5).
Weil Diagnosen lediglich Beschreibungen des Verhaltens und Erlebens eines Menschen sind, können sie selbstverständlich auch niemals Ursache des beschriebenen Verhaltens sein – wenn man das dennoch annimmt, ist das ein abenteuerlicher Zirkelschluss, der aber umgangssprachlich oft (und leider zuweilen auch von Therapeutinnen und Therapeuten) vollzogen wird, beispielsweise mit Aussagen wie: »Sebastian hat ADHS. Und deshalb verhält er sich so unruhig und unkonzentriert« – Verhaltensbeschreibungen, die zuvor zur Diagnose ADHS geführt hatten. Oder, im selben Zirkelschluss: »Sabine hat Trennungsangst [eine Beschreibung dessen, dass sie sich von ihrer Mutter nicht trennen kann], und deshalb kann sie sich von ihrer Mutter nicht trennen.« Lieb (2014b, S. 25) verweist auf die »sozialwissenschaftlich vertraute Tautologie«, die hier vollzogen wird:
»Sie besteht darin, dass von sichtbarem Verhalten auf ein systeminternes Konstrukt [die Diagnose] geschlossen wird, durch das dieses Verhalten dann wieder erklärt wird.«
2.1.5 Chancen und Risiken von Diagnosen
Psychiatrischen Diagnosen nach ICD oder DSM eröffnen Chancen und Vorteile, die von der systemischen Therapeutin genutzt werden können, wenn sie sich gleichzeitig der Risiken und Gefahren bewusst ist:
•Diagnosen befreien die Klienten aus Diffusität und Unklarheit und bringen deshalb nicht selten Entlastung (»Wir sind lange von einem Fachmann zum anderen gereist. Aber jetzt endlich wissen wir, was unser Kind hat!«). Es gibt einen Namen für das jeweilige Verhalten, und damit ist es gar nicht mehr so schlimm und machtvoll – überhaupt nicht ironisch gemeint: »Rumpelstilzchen-Effekt«; auch Rumpelstilzchen verlor seine Macht, als sein Name schließlich bekannt wurde. Die Betroffenen erleben: Wir sind nicht die Einzigen, die mit einem solchen Problem zu tun haben. Sie entwickeln Hoffnung und Zuversicht, weil sie nicht zu Unrecht annehmen, dass derjenige, der diese Diagnose gestellt hat, dieses auffällige Verhalten kennt und wahrscheinlich mit Menschen, die solche Probleme zeigen, schon gearbeitet und damit Erfahrung hat.
•Das ist insofern richtig, als Diagnosen dafür nützlich sind, für die Therapie relevante Erfahrungen, sei es aus Randomized-Controlled-Studien3, sei es aus Einzelfallstudien, sei es aus störungsorientierten Aufsätzen und Büchern, zu vermitteln.
•Diagnosen werden prognostische Erfahrungen zugeordnet, die teils Erleichterung bringen können, teils aber auch dazu dienen, auf die Notwendigkeit rechtzeitiger, ausreichender und wirksamer therapeutischer Maßnahmen zu verweisen.
•Schließlich sind Diagnosen unerlässlich im professionellen und wissenschaftlichen Diskurs, sei es in der Kommunikation mit der Krankenkasse, sei es als Basis für wissenschaftliche Untersuchungen. So schreibt Ludewig (1996, S. 50): »In der Praxis steht man vor der unvermeidbaren Notwendigkeit, subjektive Beobachtungen zu konventionell brauchbaren Einheiten zu verallgemeinern, um rasche Verständigung zu gewährleisten und geeignete Maßnahmen einzuleiten.«
Psychiatrische Diagnosen nach ICD oder DSM bringen aber auch viele gravierende Risiken und Gefahren.
•So verführen Diagnosen dazu, den Blick auf das Individuum zu lenken, das das auffällige Verhalten zeigt, und die Störung in seiner Person zu verorten. Sie beschreiben die Störung als persönliches Merkmal bzw. als individuelle Eigenschaft, die prinzipiell jedoch schwer zu ändern ist (»Sie ist eine Borderlinerin!«, »Er ist ein ADHSler!«). Systemisch betrachtet, sind die Störungen demgegenüber am einfachsten zu behandeln, wenn man sie in den Beziehungen verortet und wenn man das Verhalten eines Menschen im Kontext seiner wichtigsten Interaktionspartner zu verstehen und zu verändern sucht.
•Diagnosen psychischer Störungen führen zudem zu einer Aufmerksamkeitsfokussierung auf die diagnostizierte Störung und bergen damit die Gefahr der Festschreibung, der Petrifizierung (Versteinerung), der Etikettierung und der sich selbst erfüllenden Prophezeiung in sich.
•Diagnosen orientieren den Blick zudem auf die angeblichen Defizite des Einzelnen und seines zugehörigen Systems und schaffen damit im Sinne von Michael Durrant (1996) einen Kontext des Versagens. Hilfreicher ist demgegenüber der Blick auf die Ressourcen, auf das trotzdem Erreichte und auf die mögliche Lösung in der Zukunft. Die potenzielle Lösung als Thema der Therapie schafft einen Kontext der Kompetenz.
•Diagnosen psychischer Störungen – vor allem verstanden im Sinne von Krankheit (siehe oben) – definieren den Einzelnen als passiv Leidenden (eben im wörtlichen Sinne als »Patienten«), der der Störung ausgeliefert ist. Entsprechend wird dann formuliert: »Sie hat eine Angststörung.« »Er hat eine Störung des Sozialverhaltens.« Systemisch betrachtet, ist der Einzelne demgegenüber ein aktiv Handelnder: »Er verhält sich sozial auffällig (psychotisch, depressiv u. a.).« »Sie zeigt Angst.« Oder: »Sie angstet«, um einen Begriff zu nutzen, den Christoph Thoma (2009) schon im Titel seines Buches Angsten und Entangsten nutzt. Der Patient handelt aus systemischer Sicht in der beschriebenen Art aus »gutem Grund«, denn andernfalls würde der Betroffene nicht so handeln.
•Diagnosen werden von vielen Menschen mit einem traditionellen, eher somatisch geprägten Krankheitsbegriff verbunden, dem zufolge der Patient für die Lösung des präsentierten Problems nicht verantwortlich ist, sie vielmehr im Zuständigkeitsbereich der Therapeutin liegt. Das schafft eine vermeidbare Hürde, da solche Menschen erst davon überzeugt werden müssen, dass nur sie selber – zusammen mit ihren Angehörigen – die gewünschten Änderungen vollziehen können. Die systemische Therapeutin sieht sich lediglich in der Lage, Anstöße zu Selbstorganisationsprozessen im Klientensystem zu geben, die dessen Mitglieder eigenständig verwirklichen.
•Etymologisch betrachtet, bedeutet diagnostizieren: »genau unterscheidend erkennen«. Damit stellt sich die Frage: Wer oder was wird erkannt? Wird der Klient erkannt im Sinne von: »Ich weiß, was du hast und was mit dir los ist!«? Oder wird die Diagnose erkannt im Sinne von: »Ich weiß, was ich therapeutisch machen muss!«? Beide Ideen machen Kommunikation weitgehend überflüssig. Sie verhindern die interessierte, unbefangene Neugierde auf die Art und Weise, wie der Patient seine Welt konstruiert, welche Vorannahmen ihn leiten (und möglicherweise Leid erzeugen) und in welche Verhaltensmuster er eingebunden ist. Es besteht die Gefahr, dass die Störung dann behandelt wird, nicht die Person, die sich als störend bzw. gestört zeigt oder erlebt.
•Diagnosen verleiten zu der Annahme, dass es diese Störung tatsächlich gibt. Diagnosen sind jedoch lediglich typisierende Beschreibungen von Verhalten – eine Landkarte, die Orientierung ermöglicht, mit der Realität aber wenig gemein hat. Das wissen auch die Autorinnen und Autoren des DSM-IV-TR (Sass et al. 2003), die in der Einführung zur deutschen Ausgabe formulieren: »Dabei verführt die Scheinsicherheit einer operationalen Definition, die ja vielfach nichts anderes als das Resultat eines politisch determinierten Konsensusprozesses ist, dazu, den mit einem psychopathologischen Begriff gemeinten, oft komplexen Sachverhalt als Realität zu akzeptieren und nicht mehr genauer zu überprüfen.« Wir sollten immer im Hinterkopf behalten, so schreibt Ludewig (1996, S. 50), »dass wir es bei den ›Krankheitsbegriffen‹ mit Produkten unserer sinnstiftenden Tätigkeit zu tun haben und nicht mit ontischen, von uns Beobachtern unabhängigen Gegebenheiten. Dies dürfte uns davor bewahren, Menschen allzu rasch zu kategorisieren und Standardprozeduren zu unterziehen. Denn so nützlich diese sind, um das weitere Handeln anzuleiten, so leicht können sie den Eindruck des Gegebenen erwecken, zumal diese ›Generalisierungen Kürzel mit hoher Unabhängigkeit gegen die Art und Weise ihres Zustandekommens‹ sind (Luhmann 1984, S. 138). Beim umsichtigen Umgang mit sinnhaften Festlegungen nehmen wir zwar Ungewissheit in Kauf, bewahren uns aber zugleich vor der ›Verführung der Gewissheit‹ und deren Folgen (vgl. Maturana u. Varela 1987).«
•Zudem »passt« die Beschreibung im Einzelfall eigentlich nie. Und für die Therapeutin ist wichtig, dass alles, was beschrieben wird, grundsätzlich – wie Wittgenstein sagt – auch anders beschrieben werden kann. Das heißt für die therapeutische Situation, dass ein Symptom grundsätzlich auch als weniger leidvoll und weniger einschränkend angesehen und erlebt werden kann bzw. könnte.
•Diagnosen können von der Therapeutin als »Herrschaftswissen« missbraucht werden, mit dem er gegenüber seinem Klienten oder Klientensystem eine dominante Position untermauert. Damit würde sie sich weit von einem systemischen Patient-Therapeut-Verhältnis entfernen, das seit der kybernetischen Wende von der Familientherapie zur Systemischen Therapie nicht mehr durch einen hierarchischen, sondern einen kollaborativen Stil und das Bemühen der Therapeutin um eine Begegnung mit seinem Patienten auf Augenhöhe geprägt ist. Die systemische Therapeutin sieht den Patienten oder den »Kunden« als Experten für sich selbst, als »Kundigen«, der allein entscheiden kann, welche der im therapeutischen Gespräch aufscheinenden Lösungen für ihn passend und angemessen ist. Die Therapeutin verstört alte Verhaltensmuster und eröffnet ein Spektrum neuer Perspektiven und Möglichkeiten, vertraut aber darauf, dass der Patient der kompetente Entscheidungspartner ist.
Die Vorteile von Diagnosen unhinterfragt zu nutzen ist ebenso unangemessen wie die Verteufelung von Diagnosen aufgrund der aufgezeigten Risiken und Gefahren. Wichtig ist, dass die Therapeutin in der jeweiligen speziellen Situation weiß, was sie tut. Sie muss jeweils die Vor- und Nachteile bei ihrem Umgang mit Diagnosen in Bezug auf ihren Patienten und seine Angehörigen im Blick haben und die »Fallen« bzw. »Stolpersteine« kennen, in die sie tappen bzw. über die sie stolpern kann.
Manche Familien kommen bereits mit einer festen diagnostischen Überzeugung zum ersten Therapiekontakt. Dann ist es notwendig, genau zu hinterfragen, welche Bedeutung die Diagnose für die einzelnen Familienmitglieder hat, welche Inhalte sie genau mit der Diagnose verbinden und was anders sein würde, wenn die Therapeutin möglicherweise zu einer anderen diagnostischen Einschätzung kommen würde. Dieses »Verflüssigen« von Diagnosen kann der entscheidende Schritt dafür sein, gemeinsam mit dem Patienten und seiner Familie nach für dieses System passenderen Lösungen zu suchen.
Umgekehrt gibt es keinen Grund für die systemische Therapeutin, davor auszuweichen, wenn Eltern eine diagnostische Einschätzung wünschen. Allerdings ist auch in einer solchen Situation zu erfragen, welche Bedeutung eine Diagnose für die einzelnen Familienmitglieder hat und was das für ihre Sicht auf das Kind/den Jugendlichen, für die Prognose des Verhaltens des Kindes und für den weiteren Therapieprozess bedeutet. Der Diskurs über diese Fragen ist ein eminent wichtiges therapeutisches Element, das darüber entscheidet, ob es der Patientin mit ihren Angehörigen und der Therapeutin gelingt, ein gemeinsam getragenes therapeutisches Vorgehen zu entwickeln und das Verhalten des Kindes in seinem Sinne möglichst positiv zu beeinflussen. Spitczok von Brisinski (1999, S. 45) beschreibt mit Hinweis auf Glenn (1984) Diagnosen als soziale Ereignisse und verweist auf die Notwendigkeit, sie als soziale Prozesse anzusehen und nicht als mysteriöse Etikettierungen. Er regt an, die Symptombeschreibungen der möglicherweise infrage kommenden in der ICD-10 aufgeführten Störungen im Gespräch mit der Familie als Einzelhypothesen auf ihr Passen zu explorieren und die dadurch gemeinsam gewonnenen neuen Aspekte für neue Ideen bezüglich des weiteren Vorgehens zu nutzen.
Im Gespräch mit dem Patienten und seinen Angehörigen können beispielsweise folgende Fragen gestellt werden, die hier im Anschluss an Schweitzer und Nicolai (2010, S. 119) formuliert sind:
Fragen beim Verhandeln über Diagnosen
Wirklichkeitsfragen: Wer diagnostiziert was?
•Wer hat bereits eine Diagnose geäußert, und wie hat sich das auf die einzelnen Familienmitglieder ausgewirkt?
•Welche Gedanken, Hoffnungen oder Befürchtungen hat die Diagnose bei allen Beteiligten ausgelöst?
•Ist die Diagnose dem Kind gut bekommen?
Hypothetische Fragen: Nehmen wir einmal an …
•Nehmen wir einmal an, die Diagnose sei nicht gestellt worden. Wem ginge es dann besser, wem schlechter?
•Nehmen wir einmal an, es wäre eine andere Diagnose gestellt worden: Hätte das irgendwelche Auswirkungen auf das Erleben und Verhalten der verschiedenen Familienmitglieder gehabt?
Zirkuläres Fragen: Über die Diagnose sprechen oder schweigen?
•Wenn Ihre Frau Ihren Sohn auf die Diagnose anspricht, bemüht sie sich dann mehr um ein angemessenes Verhalten oder weniger?
•Wenn deine Diagnose im Freundeskreis bekannt würde, hätten die Freunde dann mehr Verständnis für dich oder weniger? Würde der Kontakt zu ihnen enger, oder würden sie sich eher zurückziehen?
•Um eine möglichst präzise diagnostische Einordnung vornehmen zu können, muss man oft zwei oder drei Diagnosen stellen. Würden Sie das eher als eine große Belastung erleben oder eher als sorgfältiges und hilfreiches Bemühen?
•Inwiefern kann der Patient mit der Entscheidung des Diagnostikers gut leben?
•Was soll der Diagnostiker wem (nicht) mitteilen?
•Was will der Patient wem (nicht) mitteilen?
Problem- und lösungsorientierte Fragen: Wozu nützen und was behindern Diagnosen?
•Welche positiven Wirkungen hat die Diagnose (neue Chancen)?
•Welche negativen Nebenwirkungen hat sie (Einschränkungen, Stigmata)?
•Angenommen, die Diagnose könnte verändert werden: Welche Veränderung würde sie »lebbarer« machen?
2.2Angststörungen
2.2.1 Angststörungen generell
2.2.1.1 »Angststörung« als Oberbegriff für unterschiedliche Störungsbilder
Der Begriff »Angst«, eine auf das deutsche und niederländische Sprachgebiet beschränkte Substantivbildung, ist aus dem indogermanischen angh- (»eng«) mit dem Suffix st (»dazugehörig«) entstanden und bedeutet: »Das, was zur Enge gehört.« Der Ursprung des Wortes liegt im lateinischen angustus (»eng«) bzw. angustiae