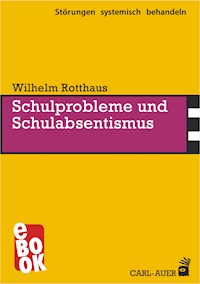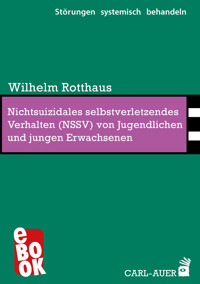
Nichtsuizidales selbstverletzendes Verhalten (NSSV) von Jugendlichen und jungen Erwachsenen E-Book
Wilhelm Rotthaus
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl-Auer Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Störungen systemisch behandeln
- Sprache: Deutsch
Nichtsuizidale Selbstverletzungen erschrecken und befremden nicht nur Angehörige, sondern auch viele Professionelle. Sie wecken Gefühle von Hilflosigkeit, Schuld und Wut, Traurigkeit und Ekel. Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen begegnen dementsprechend nicht selten einer Wand von Unverständnis und Ablehnung, Kritik und Vorwürfen. Dabei ist Selbstverletzung ein Jahrtausende altes, charakteristisch menschliches Verhalten in der Auseinandersetzung mit dem Sinn des Lebens, mit seinen Bedrohungen und Gefahren, mit Unglück und Trauer, mit Mühsal und persönlichem Scheitern. Ziel des Buches ist es, Menschen, die sich selbst verletzen, mit einer Haltung von Gelassenheit und Akzeptanz, Wertschätzung und Respekt begegnen zu können. Wilhelm Rotthaus vermittelt dazu therapeutische Konzepte für Gespräche mit den Betroffenen und ihren Angehörigen und stellt unterschiedliche Vorgehensweisen mit konkreten Anregungen für die Praxis vor. Nicht zuletzt stellt das Buch Kriterien zur Verfügung, die einen möglichen Übergang von der Selbstverletzung zu einem suizidalen Verhalten anzeigen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 271
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Störungensystemischbehandeln
Die Reihe »Störungen systemisch behandeln«
Ursprünglich ein querdenkendes Außenseiterkonzept, hat sich der systemische Ansatz heute in vielen Bereichen der Therapie und der Beratung theoretisch wie praktisch etabliert. Auch Vertreter anderer Schulen bereichert er mittlerweile in ihrer Arbeit. Die Etablierung eines Paradigmas birgt für dieses selbst aber auch Risiken, weil sie stets mit der Verfestigung von Denk- und Handlungsgewohnheiten einhergeht. Die Reihe Störungen systemisch behandeln stellt sich vor diesem Hintergrund zwei Herausforderungen: Nichtsystemischen Behandlern und Vertretern anderer Therapierichtungen soll sie komprimiert und praxisorientiert vorstellen, was die systemische Welt im Hinblick auf bestimmte Störungsbilder zu bieten hat. Innerhalb der Systemtherapie steht sie für eine neue Phase im Umgang mit dem Konzept von »Störung« und »Krankheit«.
Historisch gesehen war einer ersten Phase mit erfolgreichen Konzepten zu Krankheitsbildern wie Schizophrenie, Essstörungen, psychosomatischen Krankheiten und affektiven Störungen eine zweite Phase gefolgt, die geprägt war von einem gezielten Verzicht oder einer definitiven Ablehnung aller Formen störungsspezifischer Codierungen. In jüngerer Zeit wenden sich manche Vertreter der systemischen Welt wieder störungsspezifischen Konzepten und Fragen zu – und werden von anderen dafür deutlich attackiert. Diese neue Welle ist bedingt durch die Anerkennung der Systemtherapie als wissenschaftliches Heilverfahren, durch den Antrag auf deren sozialrechtliche Anerkennung und nicht zuletzt dadurch, dass viele im klinischen Sektor systemisch arbeitende Kollegen täglich gezwungen sind, sich zu störungsspezifischen Konzepten zu positionieren.
Die systemische Welt hat hierzu einiges anzubieten. Die Reihe Störungen systemisch behandeln will zeigen, dass und wie die Systemtheorie mit traditionellen diagnostischen Kategorien bezeichnete Phänomene ebenso gut und oft besser beschreiben, erklären und mit hoher praktischer Effizienz behandeln kann. Sie verfolgt dabei zwei Ziele: Zum einen soll systemisch arbeitenden Kollegen das große Spektrum theoretisch fundierter und praktikabler systemischer Lösungen für einzelne Störungen zugänglich gemacht werden – ohne das Risiko, die eigene systemische Identität zu verlieren, im besten Fall sogar mit dem Ergebnis einer gestärkten systemischen Identität. Gleichzeitig soll nicht-systemischen Behandlern und Vertretern anderer Schulen das umfangreiche systemische Material an Erklärungen, Behandlungskonzepten und praktischen Tools zu verschiedenen Störungsbildern auf kompakte und nachvollziehbare Weise vermittelt werden.
Verlag, Herausgeber und Autoren bemühen sich, einerseits eine für alle Bände gleiche Gliederung einzuhalten und andererseits kreativen systemischen Köpfen die Freiheit des Gestaltens zu lassen.
An die Stelle der Abgrenzung und der Konkurrenz zwischen den verschiedenen Therapieschulen ist heute der Austausch zwischen ihnen getreten. Die Reihe »Störungen systemisch behandeln« versteht sich als ein Beitrag zu diesem Dialog.
Dr. Hans Lieb, Dr. Wilhelm Rotthaus
Wilhelm Rotthaus
Nichtsuizidales selbstverletzendes Verhalten (NSSV) von Jugendlichen und jungen Erwachsenen
Störungen systemisch behandeln
Band 20
Herausgegeben vonHans Lieb und Wilhelm Rotthaus
2023
Mitglieder des wissenschaftlichen Beirats des Carl-Auer Verlags:
Prof. Dr. Rolf Arnold (Kaiserslautern)
Prof. Dr. Dirk Baecker (Witten/Herdecke)
Prof. Dr. Ulrich Clement (Heidelberg)
Prof. Dr. Jörg Fengler (Köln)
Dr. Barbara Heitger (Wien)
Prof. Dr. Johannes Herwig-Lempp (Merseburg)
Prof. Dr. Bruno Hildenbrand (Jena)
Prof. Dr. Karl L. Holtz (Heidelberg)
Prof. Dr. Heiko Kleve (Witten/Herdecke)
Dr. Roswita Königswieser (Wien)
Prof. Dr. Jürgen Kriz (Osnabrück)
Prof. Dr. Friedebert Kröger (Heidelberg)
Tom Levold (Köln)
Dr. Kurt Ludewig (Münster)
Dr. Burkhard Peter (München)
Prof. Dr. Bernhard Pörksen (Tübingen)
Prof. Dr. Kersten Reich (Köln)
Dr. Rüdiger Retzlaff (Heidelberg)
Prof. Dr. Wolf Ritscher (Esslingen)
Dr. Wilhelm Rotthaus (Bergheim bei Köln)
Prof. Dr. Arist von Schlippe (Witten/Herdecke)
Dr. Gunther Schmidt (Heidelberg)
Prof. Dr. Siegfried J. Schmidt (Münster)
Jakob R. Schneider (München)
Prof. Dr. Jochen Schweitzer † (Heidelberg)
Prof. Dr. Fritz B. Simon (Berlin)
Dr. Therese Steiner (Embrach)
Prof. Dr. Dr. Helm Stierlin † (Heidelberg)
Karsten Trebesch (Berlin)
Bernhard Trenkle (Rottweil)
Prof. Dr. Sigrid Tschöpe-Scheffler (Köln)
Prof. Dr. Reinhard Voß (Koblenz)
Dr. Gunthard Weber (Wiesloch)
Prof. Dr. Rudolf Wimmer (Wien)
Prof. Dr. Michael Wirsching (Freiburg)
Prof. Dr. Jan V. Wirth (Meerbusch)
Reihe »Störungen systemisch behandeln«, Band 20
hrsg. von Hans Lieb und Wilhelm Rotthaus
Reihengestaltung: Uwe Göbel
Umschlaggestaltung: B. Charlotte Ulrich
Redaktion: Uli Wetz
Satz: Heinrich Eiermann
Printed in Germany
Druck und Bindung: CPI books GmbH, Leck
Erste Auflage, 2023
ISBN 978-3-8497-0497-1 (Printausgabe)
ISBN 978-3-8497-8456-0 (ePUB)
© 2023 Carl-Auer-Systeme Verlag
und Verlagsbuchhandlung GmbH, Heidelberg
Alle Rechte vorbehalten
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Informationen zu unserem gesamten Programm, unseren Autoren und zum Verlag finden Sie unter: https://www.carl-auer.de/.
Dort können Sie auch unseren Newsletter abonnieren.
Carl-Auer Verlag GmbH
Vangerowstraße 14 · 69115 Heidelberg
Tel. +49 6221 6438-0 · Fax +49 6221 6438-22
Inhalt
1 Einleitung
2 Klinisches Erscheinungsbild
2.1 Beschreibung
2.2 Nicht zum NSSV zählende selbstverletzende Verhaltensweisen
2.2.1 Selbstverletzungen von Kindern im Säuglings- und Kleinkindalter
2.2.2 Selbstverletzungen von Kindern und Jugendlichen mit Autismusspektrumstörung
2.2.3 Selbstverletzungen von Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung
2.2.4 Tätowierungen und Piercings
2.2.5 Selbstverletzungen im Rahmen von Kunstaktionen
2.3 Selbstverletzung und Suizid
2.4 Häufigkeit
2.5 Verlauf
2.5.1 Frühwarnsignale
2.5.2 Langzeitverlauf
2.6 Komorbidität
2.7 Diagnostische Verfahren
3 Selbstverletzendes Verhalten: Ein kulturhistorischer Überblick
3.1 Der Schutz vor weltlichem (erotischen) Begehren und Versündigung
3.2 Bußrituale zur Befreiung von Schuld
3.3 Negativer Affekt und Stress bei als existenziell erlebter Bedrohung
3.4 Streben nach einem veränderten Bewusstseinszustand
3.5 Selbstverletzungen im Rahmen von Kulthandlungen
3.6 Trauer und Verzweiflung
3.7 Selbstverletzendes Verhalten als Übergangsritual
3.8 Steigerung der eigenen Attraktivität
4 Selbstverletzendes Verhalten von Tieren
5 Erklärungsmodelle
5.1 Risikofaktoren
5.1.1 Schwierigkeiten bei Emotionsregulation und Problembewältigung
5.1.2 Familiäre Einflüsse
5.1.3 Konflikte mit Gleichaltrigen und Mobbing
5.1.4 Soziale Ansteckung
5.1.5 Einfluss von Medien
5.1.6 Trauma und sexueller Missbrauch
5.1.7 Störung der Impulskontrolle
5.1.8 Schlafprobleme
5.1.9 Psychische Störungen als Risikofaktor
5.2 Funktionen des nichtsuizidalen selbstverletzenden Verhaltens
5.2.1 Entlastung von einem nicht aushaltbaren Erregungsniveau
5.2.2 NSSV als Selbstfürsorge
5.2.3 Selbstbestrafung
5.2.4 Suizidprophylaxe
5.2.5 Wahrung der interpersonellen Grenzen und Stärkung des Kontrollerlebens
5.2.6 NSSV als eine nonverbale Botschaft
5.2.7 NSSV als »cry for change«
5.2.8 NSSV als Problemlösungsversuch
5.2.9 NSSV als Ritual
5.3 Aufrechterhaltung des selbstverletzenden Verhaltens
5.4 Neurobiologische Erklärungen
6 Generelle Empfehlungen für den Umgang mit selbstverletzendem Verhalten
6.1 »Forderungskatalog« von Menschen, die sich selbst verletzen
6.2 Verhalten von Personen des Umfelds bei akuten Selbstverletzungen
6.3 Wundreinigung und -versorgung
6.4 Weichen stellen während der Wundversorgung
6.5 Die Bill of Rights in der medizinischen und psychologischpsychiatrischen Versorgung von Menschen, die sich selbst verletzen
6.5.1 Präambel
6.6 Ersatzhandlungen für selbstverletzendes Verhalten und rechtzeitige Unterbrechung des Erregungsaufbaus
6.7 Atemübung für mehr Entspannung: Den Atem verlängern
6.8 Die außengerichtete Wahrnehmung fokussieren: Die 5–4–3–2–1–Übung
7 Therapieansätze der verschiedenen Psychotherapieverfahren
7.1 Vorbemerkung
7.2 Therapieansätze der Psychodynamischen Therapie
7.3 Übertragungsfokussierte Psychotherapie im Jugendalter (TEP)
7.4 Psychodynamic Interpersonal Therapy (PIT)
7.5 Therapieansätze der Verhaltenstherapie
7.5.1 Kognitiv-behaviorale Therapie (CBT)
7.5.2 Problemlösetherapie (PST, Problem Solving Therapy)
7.5.3 Dialektisch-behaviorale Therapie (DBT für Erwachsene, DBT-A für Jugendliche)
7.5.4 Das Cutting-Down-Programm (CPD)
7.6 Mentalisierungsbasierte Therapie für Adoleszente MBT-A
7.6.1 Mentalisierungsbasierte Familientherapie (MBFT)
7.7 Die Personal Construct Psychotherapy (PCP)
8 Aspekte eines systemischen Störungsverständnisses
9 Systemtherapeutisches Vorgehen
9.1 Das Erstgespräch/Förderung der Therapiemotivation
9.2 Fragen zur Einschätzung des NSSV
9.3 Hohen Stress und emotionale Belastung bewältigen
9.4 Das soziale Atom
9.5 Therapeutische Gespräche mit den Familienmitgliedern
9.6 Die Wahl des Settings als therapeutische Intervention
9.7 NSSV als Signal für einen anstehenden Entwicklungsschritt
9.8 Das NSSV als eine Entscheidung der Jugendlichen
9.9 Förderung der Mentalisierungsfähigkeit
9.10 Exploration von Widerstand gegen Gewalt durch andere
9.11 Die Bedeutung von Kontroll- und Selbstwirksamkeitserfahrungen
9.12 Die Ressourcen-Timeline
10 Musiktherapie
11 Stationäre Therapie
12 Medikamentöse Therapie
13 Selbstverletzendes Verhalten in der Schule
14 Selbstverletzendes Verhalten in der Jugendhilfe
Literatur
Jugendliteratur
Websites zum Thema NSSV
Über den Autor
1 Einleitung
»Aus einem vielschichtigen Paket wickelt sie sorgfältig eine Rasierklinge heraus. Die trägt sie immer bei sich, wohin sie sich auch wendet. Die Klinge lacht wie der Bräutigam der Braut entgegen. SIE prüft vorsichtig die Schneide, sie ist rasierklingenscharf. Dann drückt sie die Klinge mehrere Male tief in den Handrücken hinein, aber wieder nicht so tief, dass Sehnen verletzt würden. Es tut überhaupt nicht weh. Das Metall fräst sich hinein wie in Butter. Einen Augenblick klafft ein Sparkassen-Schlitz im vorher geschlossenen Gewebe, dann rast das mühsam gebändigte Blut hinter der Sperre hervor.«
Elfriede Jelinek, Die Klavierspielerin (1986, S. 45)
»Mit der Klinge fahr ich langsam meinen Unterarm hinauf, dann ein Schnitt, klein und flach, und die Welt blüht auf …« Refrain: »Das Blut so rot, das Blut so rein, die Zeit heilt meine Wunden nicht. Mein Blut zu seh’n, ist wunderschön. Mein Blut zu sehen tröstet mich.«
Narben, Song der deutschen Gruppe »Subway to Sally«
(Auszug – nach Stegemann et al., Die Funktion von Musik … 2010, S. 826)
Nichtsuizidales selbstverletzendes Verhalten (NSSV) zeigt sich als eigenständige Symptomatik vergleichsweise häufig im Jugendalter und bei jungen Erwachsenen, während es im späteren Erwachsenenalter vorwiegend bei stressassoziierten psychischen Störungen wie beispielsweise Persönlichkeitsstörungen, posttraumatischen Belastungsstörungen, dissoziativen Störungen oder Depressionen in Erscheinung tritt. Deshalb werden beide Altersgruppen, Jugendliche und junge Erwachsene, im Titel dieses Buches angesprochen.
Menschen, die sich selbst verletzen, haben in der Regel ein schweres Leben. Auch wenn Selbstverletzungen kurzzeitig Entlastung schaffen können, vergrößern sie langfristig die Probleme und Belastungen, die am Beginn dieses Verhaltens stehen. Die Zeichen der selbst zugefügten körperlichen Verletzungen verschwinden nicht. Scham und Verzweiflung über den offensichtlich nicht endenden Kreislauf treten hinzu. Die meisten Jugendlichen und jungen Erwachsenen fühlen sich leer, von den Personen ihrer Umgebung unverstanden und missverstanden, viele erleben sich als eine Belastung für die anderen.
Für Eltern, Geschwister, Freunde und andere stellt dieses Verhalten gleichermaßen eine außerordentliche Belastung dar. Kaum ein Angehöriger ist in der Lage, sich in die Motive für dieses Verhalten einzufühlen und es zu verstehen. Es erscheint sinnlos und tief befremdend. Selbst Fachleute sind oft nicht in der Lage, diesem Verhalten mit Gelassenheit zu begegnen. Müssen die Wunden chirurgisch versorgt werden, begegnen diese Menschen oft einer Wand von Unverständnis, Ablehnung, Kritik und Vorwürfen. In den Publikationen von Psychotherapeutinnen spielt das Phänomen der Gegenübertragung eine große Rolle. Frances beschrieb die Situation bereits 1987 (nach Favazza 1987, p. 244) sehr treffend:
»Unter all den verwirrenden Verhaltensweisen von Patienten ist die Selbstverletzung diejenige, die am schwersten zu verstehen und zu behandeln ist. […] Der typische Kliniker (einschließlich meiner selbst) bleibt bei der Behandlung eines Menschen, der sich selbst verletzt, oft zurück mit den Gefühlen von Hilflosigkeit, Entsetzen, Schuld, Wut, mit dem Erleben von Vertrauensmissbrauch, Ekel und Traurigkeit.«
Diese Beschreibung veranschaulicht die große Macht der selbstverletzenden Handlung, der sich kaum ein Mensch entziehen kann. Andererseits ist Selbstverletzung ein Phänomen, das seit Menschengedenken praktiziert wurde und das auch unter den Mitgeschöpfen des Menschen, den Tieren, unter sehr belastenden Bedingungen zu beobachten ist.
Der Aufbau des Buches folgt der Gliederung, die allen Büchern der Reihe »Störungen systemisch behandeln« – angepasst an das jeweilige Thema – zugrunde liegt. Am Anfang steht eine Phänomenbeschreibung nichtsuizidalen selbstverletzenden Verhaltens (NSSV), auf die sich die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nach langen Auseinandersetzungen über die Abgrenzung des nichtsuizidalen selbstverletzenden Verhaltens von suizidalem Verhalten in den letzten Jahrzehnten geeinigt haben. Diese Abgrenzung wird sodann in einem eigenen Kapitel thematisiert mit Hinweisen darauf, wie es zum Übergang vom nichtsuizidalen selbstverletzenden Verhalten zu suizidalem Verhalten kommen kann und auf welche Anzeichen dabei zu achten ist. Es folgen Angaben zur Häufigkeit, zum Verlauf, zu komorbiden Störungen und zur Testdiagnostik.
In Kapitel 3 wird in einem kulturhistorischen Rückblick über selbstverletzende Verhaltensweisen als kulturell sanktionierte Rituale der Körpermodifikation in den unterschiedlichsten Regionen dieser Welt berichtet. Es wurde versucht, aus der Fülle der Darstellungen eine Auswahl zu treffen, damit dieses Kapitel nicht den Eindruck eines Kuriositätenkabinetts erhält. Als Kriterium wurde die offensichtlich dominierende Funktion dieses Verhaltens gewählt, in dem Wissen, dass zumeist vielfältige Intentionen und Funktionen den selbstverletzenden Verhaltensweisen zugrunde liegen. Der wesentliche Sinn dieses Kapitels liegt darin, zu zeigen, dass Selbstverletzungen ein charakteristisch menschliches Verhalten in der Auseinandersetzung mit dem Sinn dieses Lebens, mit seinen Bedrohungen und Gefahren, mit Unglück und Trauer, mit Mühsal und persönlichem Scheitern darstellen. Die Darstellungen sollen den Leserinnen1 die Möglichkeit geben, sich mit den eigenen Gefühlen von Abwehr, Ekel und Unverständnis auseinanderzusetzen. Auf diese Weise wird – so die Hoffnung – ein Boden geschaffen, um einer sich selbst verletzenden Jugendlichen und ihrer Symptomatik mit einer größeren inneren Sicherheit zu begegnen, das Verhalten als Ausdruck großer Not und Verzweiflung zu würdigen und mit der notwendigen wertschätzenden Neugier den Sinn dieses Verhaltens im Einzelfall zu explorieren.
In den folgenden Kapiteln werden, wie in der Reihe üblich, Risikofaktoren für das Auftreten von NSSV dargestellt und Funktionen dieses Verhaltens erörtert. Es folgt die Darstellung des Störungsverständnisses und der Therapieansätze der verschiedenen Psychotherapieverfahren. In Kapitel 7 werden generelle Empfehlungen für den Umgang mit selbstverletzendem Verhalten gegeben. Anschließend wird das systemische Störungsverständnis kurz erörtert. In Kapitel 9 werden systemtherapeutische Vorgehensweisen vorgestellt, die sich in der ambulanten Arbeit und in der stationären Therapie bewährt haben. Den Abschluss bilden Hinweise auf den Umgang mit Jugendlichen, die selbstverletzendes Verhalten in der Schule oder in der stationären Jugendhilfe zeigen.
An dieser Stelle bedanke ich mich bei dem Lektor Uli Wetz, bei meinem Mitherausgeber Dr. Hans Lieb und bei meinem Kollegen Uwe Scheffler für die Durchsicht des Manuskripts und seine wertvollen Anregungen sowie bei Heike Waldhausen, die die Erstellung des Manuskripts – wie auch schon bei meinen vorangegangenen Büchern – mit positiver Kritik und vielen Ideen begleitet hat.
1 In diesem Buch werde ich der besseren Lesbarkeit wegen weitgehend weibliche Geschlechtsbezeichnungen benutzen, da NSSV trotz einer Zunahme dieser Symptomatik bei männlichen Jugendlichen und jungen Erwachsenen doch noch häufiger bei Personen weiblichen Geschlechts auftritt und auch unter Therapeutinnen und Therapeuten die Zahl der Frauen überwiegt. Selbstverständlich sollen sich Personen jeglichen Geschlechts angesprochen fühlen.
2 Klinisches Erscheinungsbild
2.1Beschreibung
Selbstverletzendes Verhalten wird in der derzeit noch gültigen Version der multiaxialen Klassifikation der Weltgesundheitsorganisation (ICD-10) lediglich als Symptom einer emotional instabilen Persönlichkeitsstörung vom Borderline-Typ (F60-31) oder auf der vierten Achse als »vorsätzliche Selbstbeschädigung mit einem scharfen Gegenstand« (X78) aufgeführt. Aufgrund der erheblichen Zunahme selbstverletzenden Verhaltens insbesondere im Kindes- und Jugendalter und einer stetig wachsenden internationalen Literatur wurde jedoch im DSM-5 (American Psychiatric Association 2013) eine eigenständige diagnostische Entität »nichtsuizidales selbstverletzendes Verhalten – NSSV« (engl. nonsuicidal self-injury – NSSI) definiert und in die Sektion der Störungsbilder mit weiterem Forschungsbedarf, also nicht als formal anerkannte Diagnose, aufgenommen. Es wurden folgende Diagnosekriterien formuliert (angelehnt an die Übersetzung von Plener 2015, S. 7 f.):
Die Selbstverletzung erfolgt mindestens an fünf oder mehr Tagen innerhalb eines Jahres.
Die Selbstverletzung geschieht durch eine Schädigung der Körperoberfläche beispielsweise durch Schneiden, Verbrennen, Stechen, Schlagen, Hautaufreiben. Blutungen, Quetschungen und Schmerzen sind wahrscheinlich.
Die Handlung erfolgt in Erwartung eines lediglich kleinen bis moderaten körperlichen Schadens.
Es besteht keine Suizidabsicht.
Erwartet wird durch die Selbstverletzung die Verbesserung eines negativen Gefühls oder gedanklichen Erlebens, die Lösung einer interpersonellen Schwierigkeit oder ein positiver Gefühlszustand.
Durch häufige Wiederholung dieses Verhaltens kann der Eindruck eines Suchtcharakters entstehen.
Es besteht ein Zusammenhang mit interpersonellen Schwierigkeiten oder negativen Gefühlen und Gedanken unmittelbar vor der Selbstverletzung, gedanklicher Beschäftigung mit der Möglichkeit der Selbstverletzung vorab und häufigem Nachdenken über Selbstverletzung (mindestens eine Nennung).
Durch die Selbstverletzung und die resultierenden Konsequenzen entsteht ein klinisch signifikanter Stress oder eine Beeinträchtigung in interpersonellen, ausbildungsrelevanten oder sonstigen wichtigen Funktionsbereichen.
Nicht als NSSV gewertet werden schwach ausgeprägte Formen selbstverletzenden Verhaltens wie Knibbeln an Wunden oder Nägelbeißen, sozial akzeptierte Formen des selbstverletzenden Verhaltens wie Piercings, Tattooing oder Selbstverletzung im Rahmen von Kulthandlungen, Selbstverletzungen, die ausschließlich während psychotischer Zustände, im Delirium, während Intoxikationen oder Substanzentzug auftreten, Selbstverletzungen, die bei Menschen mit einer Entwicklungsstörung im Sinne von wiederholten Stereotypien vorkommen, und selbstverletzendes Verhalten, das durch andere psychische oder medizinische Erkrankungen erklärbar ist.
Auch die International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 11 (ICD-11) greift die Diagnose »Nichtsuizidale Selbstverletzung (MB23.E)« auf und beschreibt sie als eine absichtliche Schädigung des Körpers vorwiegend durch Schneiden, Kratzen, Verbrennen, Beißen oder Schlagen, wobei das Individuum davon ausgeht, dass kein massiver körperlicher Schaden entsteht.
Dadurch, dass die in das DSM-5 (American Psychiatric Association 2013) aufgenommene Definition von NSSV sich im Laufe der letzten Jahrzehnte erst allmählich herausgebildet hat, finden sich in der Fachliteratur unterschiedliche Begriffe, die teils auch unterschiedliche Phänomene zusammenfassen. So wurde im nordamerikanischen Raum der Begriff »Deliberate Self-Harm« (DSH) für selbstschädigende Verhaltensweisen gebraucht, die nicht als suizidal intendiert waren. Dem gegenüber bezeichneten Studien aus England oder Ländern des ehemaligen Commonwealth damit alle selbstschädigenden Verhaltensweisen und unterschieden das mit dem Begriff erfasste Verhalten nicht nach der Frage des Vorliegens einer suizidalen Intention. Teilweise wurde in der Literatur auch der Begriff »Parasuizid« verwendet, dessen Definition ebenfalls nicht einheitlich war. Während in einigen Publikationen die Beschreibung dem Konzept des NSSV weitgehend entsprach, formulierte Linehan 1986 (nach Plener 2015) drei Kategorien des Parasuizids, nämlich: Suizidversuche, ambivalente Suizidversuche und nichtsuizidale Selbstverletzungen.
Wie schon in der Definition des DSM-5 aufgeführt, handelt es sich bei den häufigsten Selbstverletzungen um ein Ritzen und Schneiden der Haut vorwiegend an den Armen, vor allem den Unterarmen, und den Beinen, vor allem den Unterschenkeln, am Bauch, am Kopf und im Gesicht, an der Brust und im Genitalbereich. Benutzt werden dafür Rasierklingen, Messer, Scherben, Scheren und andere scharfe Gegenstände. Zuweilen werden Nadeln in die Haut eingebracht und bestehende Wunden offen gehalten oder verschmutzt. Selbstverletzungen erfolgen auch durch Verbrennungen, häufig mit Zigaretten oder Bügeleisen, und durch Verätzungen der Haut durch Säuren oder Laugen. Auch extremes Nägelkauen und Abbeißen von Fingerkuppen, ein Schlagen oder Quetschen der Haut sowie ein Beißen in Hände oder Lippen kommen vor. Gar nicht so selten werden zerbrochene Rasierklingen und andere scharfe Gegenstände verschluckt.
Charakteristisch für den selbstverletzenden Akt ist ein Spannungsbogen, auf dessen Gipfel die selbstverletzende Handlung durchgeführt wird. Zumeist gehen als belastend erlebte zwischenmenschliche Erfahrungen, aber auch Überforderungserlebnisse und ein sehr geringes Selbstwertgefühl voraus. Wutgefühle, Verzweiflung, dysphorische Verstimmungen, Angst, Hilflosigkeit und Hoffnungslosigkeit dominieren das Selbsterleben. Eine Bewältigung dieser hochgradig negativ getönten Affekte misslingt. Im Zuge eskalierender Selbstvorwürfe kommt es zur Wendung von Hass in Selbsthass. Unter affektivem Druck können Wahrnehmung und Denken dissoziieren.2 Ein immer unabhängiger werdender Wunsch beherrscht das Bewusstsein: sich zu schneiden oder sich zu verbrennen, um dies alles zu beenden. Es kann zur Selbstentfremdung im Sinne von Depersonalisation3 und von Derealisation4 kommen. Die entscheidende Phase der tatsächlichen Umsetzung der Gewebeschädigung wird häufig von Amnesie (Gedächtnisverlust) und Analgesie (Schmerzunempfindlichkeit) begleitet. Während die Haut verletzt wird und gegebenenfalls das Blut rinnt, empfindet die Betroffene ein Gefühl der Erleichterung und des Wohlbefindens. Sie erlebt ein personales Erwachen. Das Spannungsgefühl erscheint momentan wie gelöscht. Schon bald aber bauen sich in zunehmendem Umfang negative Gefühle des Ekels, der Scham und der Schuld wieder auf sowie Angst vor den entstellenden Narben und vor dem negativen Echo der Umgebung. Der Circulus vitiosus wird somit erneut aufgeladen.
Die erstmalige Beschreibung des selbstschädigenden Verhaltens als eigenständiges Syndrom (engl. Deliberate Self-Harm – DSH) geht auf Pattison und Kahan (1983) zurück. Im Verlauf des ersten Jahrzehnts dieses Jahrhunderts setzte sich dann der Begriff des »Nichtsuizidalen selbstverletzenden Verhaltens« (engl. Non-suicidal selfinjury – NSSI) zunehmend durch. Lloyd-Richardson und Kolleg:innen formulierten 2007 als inzwischen übliche Beschreibung die Zerstörung oder Veränderung der Haut des Körpers ohne suizidale Absicht. Dieses Verhalten sei – im Gegensatz beispielsweise zum Piercing – sozial nicht akzeptiert, erfolge direkt (in Abgrenzung zur indirekten Selbstschädigung beispielsweise durch Alkoholmissbrauch) und wiederholt. Es führe zu einer kleinen oder mäßigen Schädigung. In der deutschsprachigen Literatur wurde dieses Konzept aufgegriffen: Plener (2015) beispielsweise definiert NSSV »als freiwillige, selbst zugefügte, repetitive Selbstverletzung der Körperoberfläche, die ohne suizidale Absicht unternommen wird und nicht sozial akzeptiert ist«.
Nach Brunner et al. (2014) lassen sich zwei Gruppen von Jugendlichen unterscheiden, die selbstverletzendes Verhalten ausüben: zum einen Jugendliche, die dieses Verhalten über eine umschriebene Zeit gelegentlich zeigen, und eine zweite Gruppe von Jugendlichen, die dies als repetitives Verhaltensmuster zeigen und daneben auch erhebliche emotionale Probleme aufweisen. Dieser Zusammenhang zwischen der Häufigkeit selbstverletzenden Verhaltens und der Ausprägung des psychopathologischen Bildes wurde auch von anderen Autorinnen beschrieben. Die Häufigkeit der selbstverletzenden Handlungen ist somit als ein wichtiges Kriterium für den Schweregrad der Störung anzusehen.
2.2Nicht zum NSSV zählende selbstverletzende Verhaltensweisen
2.2.1Selbstverletzungen von Kindern im Säuglings- und Kleinkindalter
Nicht selten zeigen Kinder im Säuglings- und Kleinkindalter vorübergehend stereotype Verhaltensweisen, die sie in gleicher Form viele Male wiederholen. Das scheint eine beruhigende Wirkung zu haben. Zu beobachten ist das auch, wenn Kinder nicht ausreichend angeregt werden. So werfen manche Kleinkinder – vor allem in der Einschlafphase – ihren Kopf mit großer Ausdauer rhythmisch hin und her, und das zuweilen so heftig, dass der Kopf regelmäßig wiederkehrend gegen die Seitenwände des Bettes geschlagen und erheblich verletzt wird. Andere Kinder bewegen sich im Stehen oder Sitzen rhythmisch vor und zurück oder rollen sich im Liegen von der einen Seite auf die andere. Auch hierbei kommt es in nicht wenigen Fällen vor, dass sie dabei ständig gegen die Wand oder das Bettgitter schlagen. In extremen Fällen müssen manche Betroffene daran gehindert werden, mit ihren Händen stereotyp in ihren Augen zu bohren.
René Spitz (1996) hat dieses Phänomen als Erster bei Heimkindern beobachtet, die zwar hinreichend ernährt wurden, jedoch einen extremen Mangel an sozialen, sensorischen und emotionalen Erfahrungen erleben mussten. In ähnlicher Weise wurde dieses Verhalten in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts in Kinderheimen in Rumänien und der alten Tschechoslowakei beobachtet. (Dieses Problemverhalten tritt im Übrigen auch bei vereinsamten erwachsenen Menschen auf und bei solchen, die in ihren Bewegungsmöglichkeiten stark eingeschränkt sind. Letzteres dürfte die erhöhte Rate an selbstverletzendem Verhalten bei Gefängnisinsassen erklären.)
Als Hintergrund für die Bewegungsstereotypien wird eine erhöhte intrapsychische Spannung aufgrund eines massiven Mangels an sozialen und motorischen Reizen unterstellt. Durch das monotone Schaukeln, Wackeln, Wiegen oder Wippen scheinen sich die Betroffenen gleichermaßen zu stimulieren und zu beruhigen. Der stark rhythmisierte Charakter dieser Bewegungsmuster hat eine Art Trance zur Folge, die eine Schmerzfreiheit bei den Selbstverletzungen bewirkt. Die Jaktationen dienen in ihrer streng rhythmischen, stereotypen Art der Entlastung und Beruhigung, was manchen Beobachter veranlasst hat, sie als lustvoll zu interpretieren. Tatsächlich sieht man nicht selten, dass Betroffene ärgerlich reagieren, wenn sie in dem Ablauf ihres Bewegungsmusters gestört werden.
2.2.2Selbstverletzungen von Kindern und Jugendlichen mit Autismusspektrumstörung
Viele Kinder und Jugendliche mit stark ausgeprägter Autismusspektrumstörung zeigen eine Fülle von repetitiven (sich wiederholenden) Stereotypien – sogenanntes Stimming (selbststimulierendes Verhalten, engl. self-stimulating behavior) – wie ein Blutigknibbeln der Finger, ein Abkauen der Nägel bis über das Nagelbett, ein Anschlagen des Kopfes an die Bettumrandung oder die Wand, ein Schlagen gegen die Ohren, ein Sichkratzen und Sichbeißen. Dieses selbstverletzende Verhalten tritt nicht selten alternierend mit aggressivem Verhalten auf. Bei den meisten Kindern und Jugendlichen sind neben selbstverletzendem Verhalten auch Stereotypien zu beobachten.
2.2.3Selbstverletzungen von Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung
Auch Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung zeigen nicht selten selbstverletzende Verhaltensweisen (siehe dazu u. a. Petermann u. Winkel 2007; Buscher u. Hennicke 2017, S. 95–104). Dieses Verhalten kann episodischen oder stereotypen Charakter haben. Episodische Selbstverletzungen dauern nur wenige Sekunden bis Minuten an und werden häufig mit einem bestimmten Ziel durchgeführt (z. B. Erhalt von Aufmerksamkeit). Stereotypes selbstverletzendes Verhalten wird dagegen über längere Zeiträume hinweg sehr gleichförmig und häufig mit großer Geschwindigkeit wiederholt. Es tritt beispielsweise in Form von Jaktationen (Schaukeln mit Kopf oder Oberkörper), einem Schlagen mit der Hand an den Kopf, einem Augenbohren, einem Sichkratzen, Sichbeißen, einem Kneten der Hände und einem Zähneknirschen auf. Die Verletzungen sind oft nur oberflächlich. Es kann aber auch zu Verstümmelungen kommen (z. B. durch Beißen auf Finger, Lippen und Zunge). Durch Kopfschleudern und -anschlagen können sich die Kinder ernste, in Einzelfällen sogar lebensgefährliche Verletzungen zufügen. Auch ursprünglich harmlose Verhaltensweisen (z. B. Kneten der Hände, Lutschen an den Fingern) können durch die ständige Belastung des Gewebes zu Verletzungen und Vernarbungen führen. Die Kinder entwickeln dieses Verhalten sehr früh; im Durchschnitt beginnen sie bereits im Alter von 17 Monaten damit, sich selbst zu verletzen. Generell lässt sich sagen, dass die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von selbstverletzendem Verhalten mit dem Ausmaß der geistigen Behinderung ansteigt.
Klauß (2003) hat versucht, der Frage nachzugehen, warum diese Menschen ihren Körper schädigen. Er erarbeitete folgende Funktionen von selbstverletzendem Verhalten bei Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung:
Bewältigung körperlicher Schmerzen und körperlichen Missbehagens
Ablenkung von Überforderung und Reizüberflutung
»Überspielen« von Anspannung, Angst und Unsicherheit
Bewältigung von »Reizmangel«, d. h. von Langeweile und fehlender Beschäftigung
Versuch, zur Geltung zu kommen und Einfluss auf andere Menschen zu nehmen, um etwas zu erreichen
Selbstbestrafung, resultierend aus einem Denken, wonach es bei Misserfolgen, Unglücken etc. immer Schuldige geben muss, die dann zu bestrafen sind.
Am häufigsten werden in der Literatur folgende Einflussfaktoren auf das selbstverletzende Verhalten bei Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung beschrieben:
Beruhigung und Selbststimulation
Die ständige Wiederholung eines vertrauten Bewegungsablaufs scheint beruhigende Wirkung zu haben, selbst wenn die Verhaltensweisen mit Schmerzen verbunden sind. Auch schmerzhafte körperliche Erkrankungen wie Ohrenentzündung oder Zahnschmerzen können das selbstverletzende Verhalten auslösen oder verstärken. Andererseits wird das selbstverletzende Verhalten auch zur Selbststimulation eingesetzt, beispielsweise wenn anregende Außenreize nur unzureichend zur Verfügung stehen. Mitunter können die damit verbundenen rhythmischen Bewegungen zu tranceartigen Zuständen führen. In beiden Fällen tritt der gewünschte Erfolg ohne eine Reaktion seitens der Bezugspersonen auf.
Soziale Verstärkung
Das selbstverletzende Verhalten löst vermehrte Aufmerksamkeit und Zuwendung aus, was auch Reaktionen wie Schimpfen und Strafen mit einschließt. In anderen Fällen führt das selbstverletzende Verhalten zu einer Zurücknahme von Anforderungen, wodurch es negativ verstärkt wird. Je schwerer die geistige Behinderung, desto höher ist das Risiko für selbstverletzendes Verhalten.
2.2.4Tätowierungen und Piercings
Der Begriff Tätowierung geht laut Feige und Krause (2004, S. 246) zurück auf »das Bemalen des Körpers mit einem Tatau« bei den Ureinwohnern Polynesiens. Tätowierungen haben eine jahrtausendealte Tradition in allen Kulturkreisen der Welt. Auch bei dem mehr als 5.000 Jahre alten »Ötzi« wurden Tattoos festgestellt.
Tätowierungen und Piercings haben in den letzten Jahrzehnten nicht nur in Deutschland stark zugenommen. Sie gehören definitionsgemäß – wie oben aufgeführt – nicht zu den nichtsuizidalen selbstverletzenden Verhaltensweisen (NSSV). Während Tätowierungen in den 1970er-Jahren vorwiegend auf eine dissoziale Subkultur verwiesen und vor allem als Teil eines informellen Knastregelwerks galten, war 2016 laut Borkenhagen und Kolleginnen (2019) fast jede fünfte Deutsche (14 Jahre und älter) tätowiert und damit so viele in Deutschland lebende Menschen wie nie zuvor (21,3 % der männlichen und 17,9 % der weiblichen Personen). Im Juli 2021 gaben in einer Umfrage 26 % der 25- bis 34-jährigen Deutschen – das ist die Altersgruppe mit dem höchsten Tattoo-Trend – an, ein oder mehrere Tattoos zu haben (Statista Research Department 2022). 14 % erklärten, keine Tattoos zu haben, sie aber gerne haben zu wollen. 54 % aus dieser Altersgruppe hatten keine Tattoos und erklärten, dass das auch so bleiben solle. 6 % machten keine Angaben. In dieser Entwicklung zeigt sich offensichtlich eine veränderte Einstellung zum eigenen Körper: »Der Körper wird im Zuge individualistischer Lebensstile mehr und mehr zu einem ästhetischen Objekt, das es aktiv und dauerhaft zu gestalten gilt« (Borkenhagen et al. 2019). Allerdings scheinen sich auch erste Hinweise auf ein Ende des Tattooing-Trends zu zeigen (Borkenhagen 2023).
Tattoos und Piercings, aber auch Implants (z. B. Metallkugeln unter der Haut), Brandings (Schmucknarben durch Einbrennen), Elfenohren oder gespaltene Zungen – in der Literatur als »Körpermodifikationen«, in der Szene als »BodyModder« zusammengefasst – sind einerseits wie Schönheitsoperationen zunehmend Teil des Mainstreams unserer Gesellschaft, treten andererseits aber auch bei Personen mit psychischen Störungen auf. »Die Anwendung von Piercings und Tattoos kann sowohl selbstfürsorglich als auch selbstschädigend wirken, manchmal beides zugleich« (Stirn u. Möller 2013, S. 10 f.). 27 % der erwachsenen Personen, die Tattoos und Piercings trügen, hätten in der Kindheit selbstverletzendes Verhalten praktiziert. Im Vergleich zu körpermodifizierten Personen ohne vormaliges selbstverletzendes Verhalten zeichne sich diese Subgruppe durch folgende Merkmale aus: Sie hätten mehr Gewalt- und Schmerzerfahrung in der Vergangenheit erlebt und seien unzufriedener mit ihrem eigenen Leben. Sie würden als Motiv für ihre Körpermodifikationen häufiger den erwarteten Schmerz sowie einen inneren »Drang« dazu angeben und seltener, sich mit Körpermodifikationen etwas Gutes tun zu wollen.
Körpermodifikationen können auch Ersatzhandlungen für andere selbstverletzende Verhaltensweisen sein wie Schneiden und Ritzen. Nach Stirn und Hinz (2008) berichteten in einer Untersuchung von Leserinnen eines Tätowiermagazins 27 % der Teilnehmerinnen, sich in der Kindheit geschnitten zu haben. 13 % hörten auf, sich zu schneiden, als sie anfingen, sich tätowieren oder piercen zu lassen. Diese Untergruppe der körpermodifizierten Personen hatte mehr Piercings als Personen, die kein NSSV zeigten, aber nicht mehr Tätowierungen. Stirn und Hinz (2008) vermuten, dass Körpermodifikationen diesen Personen als Ersatzhandlungen für autoaggressives Verhalten dienen. Insofern komme der Modifikation dann eine quasi-therapeutische Bedeutung zu. Sie zitieren eine 23-jährige Patientin mit den Worten: »Ich würde meine Bilder niemals zerschneiden.« Im Übrigen äußerten die Betroffenen, durch die Körpermodifikation Macht und Kontrolle über ihren Körper zu erleben, und beschrieben sie als »Heilung«. Allerdings entwickeln sie häufiger ein suchtartiges Bedürfnis nach weiteren Körpermodifikationen, sodass die »Heilung« offensichtlich keinen dauerhaften Effekt hat.
In anderen Befragungen werden von den betreffenden Personen durchaus selbstfürsorgliche Aspekte von Tattoos und Piercings hervorgehoben. »Der Körper wird modifiziert, um etwas Gutes für sich selbst zu tun und um die eigene Persönlichkeit auszudrücken. Der Körper wird verschönert, er wird bewusst gestaltet, es wird in ihn investiert, sich ihm zugewandt« (Stirn u. Möller 2013, S. 11). Körpermodifikationen würden durch ihre Kommunikation innerer Werte Kontaktanlass und eine Möglichkeit zur Beziehungsaufnahme bieten sowie helfen, eine Lebenskrise zu überwinden.
Die Motive für das Tragen von Tätowierungen und für Piercings sind vielfältig. Pöhlmann und Kolleginnen (2013, S. 3) sehen in der extremen Zunahme von Körpermodifikationen sowie der Verbreitung in praktisch allen Schichten der Gesellschaft auch ein Modephänomen, »in dem Tätowierungen Accessoires sind, die getragen werden wie Taschen, Hüte oder Schmuck«. Andererseits handelt es sich um dauerhafte Veränderungen des Körpers. Denn die bisher entwickelten Verfahren zur Entfernung von Tätowierungen führen nicht zu einem vollständigen oder spurlosen Verschwinden. Das sei aber den meisten Menschen, die sich dafür entscheiden, sich tätowieren zu lassen, bewusst. Sie würden sich lange mit dem Was, Wo und Wie auseinandersetzen.
Insgesamt werden verschiedene Motivationsbereiche für Körpermodifikationen angenommen, die sich in vielfältiger Weise überschneiden. Auch spielen häufig mehrere dieser Motivationsbereiche gleichzeitig eine Rolle. Als zentrale Bereiche sind anzusehen:
Schönheit, ästhetische Gründe:
Im Vordergrund steht die Verschönerung des Körpers. Dies ist einer der am häufigsten genannten Gründe für Körpermodifikationen. Das Stechen einer Tätowierung wird häufig als Schaffen eines Kunstwerks beschrieben, wobei vor allem die Aspekte des Bildmotivs und die qualitativ hochstehende Durchführung von Bedeutung sind.
Unterstreichen der eigenen Individualität:
Tätowierungen dienen der Selbstdarstellung. Tätowierte möchten ihre Individualität und Einzigartigkeit anzeigen. Der Körper wird durch Tätowierungen zu etwas, das sonst niemand in dieser Art hat. Allerdings muss die Tätowierung »echt« sein, was sie nur ist, wenn sie für immer besteht und unter Schmerzen erworben wurde.
Steigerung des Selbstwertgefühls:
Wiederholte Tätowierungen zielen auf eine Steigerung des Selbstwerts ab. Die sichtbar getragenen Tattoos steigern in einem akzeptierenden Umfeld die eigene Attraktivität. Sie schaffen eine Identifikation mit einer sozialen Gruppe, die den Stolz auf die eigene Leistung, also das Durchhaltevermögen in Bezug auf die Schmerzen beim Stechen der Tattoos, anerkennt. Zudem dienen sie als »Talking Piece«, mit dem man ein Kommunikationsangebot macht.
Provokation und Protest:
In einem anderen Kontext können Tätowierungen auch dazu dienen, sich abzugrenzen. Indem man andere schockiert und provoziert, werden ein Nicht-dazugehören-Wollen und ein Dagegensein ausgedrückt und beispielsweise die Zugehörigkeit zu einer Subkultur wie etwa den Punks verdeutlicht.
Ersatzhandlung für andere selbstverletzende Verhaltensweisen wie Schneiden und Ritzen:
Tattoos und Piercings können eine erfolgversprechende Form der Bewältigung persönlicher Krisen oder Verluste sein. Bei traumatisierten Individuen ähnelt das Vorgehen hingegen eher dem von sich selbst verletzenden Patienten: Der Körper wird zum Objekt gemacht, dem Leid zugefügt wird.
Sensation seeking:
Höhner, Teismann u. Willutzki (2014) berichten aufgrund einer Literaturrecherche, dass »sensation seeking« – also das habituelle Streben nach neuartiger und intensiver Stimulation – bei Modifizierten signifikant stärker ausgeprägt vorliege als bei Nichtmodifizierten. Es gebe deutliche positive Zusammenhänge zwischen Piercings und »risk taking behavior« wie Drogenkonsum, risikoreichen Sexualkontakten und problematischem Spielverhalten.
Sexuelle Gründe:
Tattoos können zuweilen getragen werden in der Absicht, sexuelle Präferenzen oder Orientierungen auszudrücken. Die schon erwähnten Körperveränderungen durch »Schönheitsimplantate« oder »Schönheits-OPs« dienen neben der Steigerung des eigenen Selbstwertgefühls zunehmend auch der sexuellen Attraktivität. Das hat zu einer signifikanten Zunahme von korrigierenden OPs geführt, sodass in einigen Ländern schon ein Verbot für Jugendliche erlassen wurde.
Insgesamt scheint der aktuelle Trend zur Körpermodifikation, der sich in der gesamten Gesellschaft zeigt, Ausdruck der Vereinzelung des Menschen am Ende der Epoche des Individuums zu sein (Rotthaus 2021). In der extrem individualisierten heutigen Gesellschaft dominieren Narzissmus und Selbstbeschäftigung. »Versprengte Individuen«, wie der Soziologe Andreas Reckwitz (2019) es genannt hat, die keine langfristigen Bindungen an Familien, sonstige Gruppen oder politische Milieus mehr kennen, verspüren einen Drang zur Selbstoptimierung. Denn alles hängt heute von einem selbst ab, das Gelingen und das Scheitern.
Hinzu tritt, dass das Individuum hochgradig verunsichert ist. Die Idee, dass alles erreichbar und machbar ist, stößt an ihre Grenzen. Vielfältige Krisen vom Ukraine-Krieg über die Corona-Pandemie bis zum Klimawandel führen zum Gefühl von Ausweglosigkeit und zum Erleben eines Kontrollverlustes. In dieser Situation bleibt dem isolierten Individuum der eigene Körper, der kontrolliert, gepflegt und verbessert werden kann. Hier eröffnet sich noch ein Spielfeld für den Machbarkeitswahn. Doch der kann zu einem Suchtverhalten verleiten, da die Verbesserung und Verschönerung des Körpers angesichts ständig wechselnder Moden und einer nicht zu verleugnenden Alterung des Körpers unerreichbar bleibt.