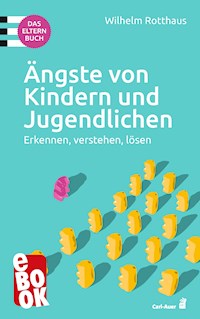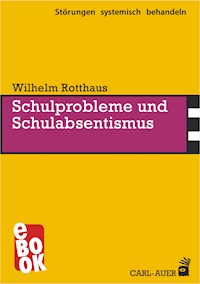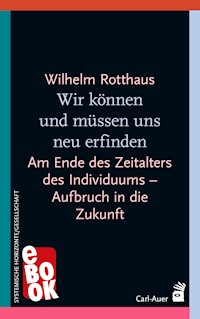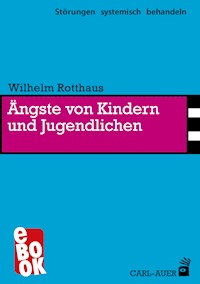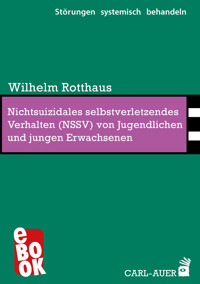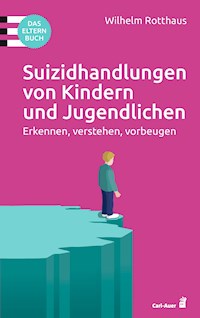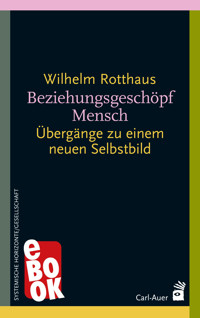
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl-Auer Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Systemische Horizonte
- Sprache: Deutsch
Erfolgsgeheimnis Kooperation Wie kann es gelingen, all die klugen Maßnahmen, die zur Rettung der Erde als Lebensraum erarbeitet werden, auch tatsächlich umzusetzen? Wilhelm Rotthaus geht davon aus, dass die notwendigen Schritte am ehesten erfolgen werden, wenn wir als Bewohner:innen ein neues Selbstbild entwickeln. Solange die Vorstellung besteht, der Mensch sei von Natur aus auf den eigenen Vorteil bedacht, werden wir versuchen, uns und unsere Interessen durchzusetzen. Nehmen wir uns dagegen als Wesen wahr, die erst aus Beziehungen entstehen, werden wir unser Wohlergehen als eng verbunden mit anderen erleben und ein Interesse daran haben, dass es ihnen ebenfalls gut geht. Kooperation und Zusammenhalt in größeren Gruppen bildeten die Grundlage für die Verbreitung des Menschen. Menschen mit einem Selbstbild als Beziehungsgeschöpf ist also zuzutrauen, dass sie weltweit gemeinsame Anstrengungen zur Eindämmung der Klimakrise und zum Erhalt der Biodiversität unternehmen werden. Wilhelm Rotthaus schließt mit diesem Buch unmittelbar an das Plädoyer des Vorgängers "Wir können und müssen uns neu erfinden" an. Hier zeigt er, wie das gehen könnte. Der Autor: Wilhelm Rotthaus, Dr. med.; Studium der Medizin und der Musik; Ausbildungen in klientenzentrierter Gesprächstherapie, klientenzentrierter Spieltherapie und Systemtherapie. 1981–2004 Ärztlicher Leiter des Fachbereichs Psychiatrie und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters der Rheinischen Kliniken Viersen. Buchveröffentlichungen u. a.: "Wozu erziehen" (8. Aufl. 2017), "Systemische Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie" (5. Aufl. 2021), "Ängste von Kindern und Jugendlichen" (2. Aufl. 2021), "Suizidhandlungen von Kindern und Jugendlichen" (2. Aufl. 2023) "Schulprobleme und Schulabsentismus" (2. Aufl. 2022), "Ängste von Kindern und Jugendlichen. Erkennen, verstehen, lösen" (2. Aufl. 2021), "Suizidhandlungen von Kindern und Jugendlichen. Erkennen, verstehen, vorbeugen" (2020), "Fallbuch der Systemischen Therapie mit Kindern und Jugendlichen" (2020), "Wir können und müssen uns neu erfinden. Am Ende des Zeitalters des Individuums – Aufbruch in die Zukunft" (2021).
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 242
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Carl-Auer
Systemische Horizonte – Theorie der Praxis
Herausgeber: Bernhard Pörksen
»Irritation ist kostbar.«
Niklas Luhmann
Die wilden Jahre des Konstruktivismus und der Systemtheorie sind vorbei. Inzwischen ist das konstruktivistische und systemische Denken auf dem Weg zum etablierten Paradigma und zur normal science. Die Provokationen von einst sind die Gewissheiten von heute. Und lange schon hat die Phase der praktischen Nutzbarmachung begonnen, der strategischen Anwendung in der Organisationsberatung und im Management, in der Therapie und in der Politik, in der Pädagogik und der Didaktik. Kurzum: Es droht das epistemologische Biedermeier. Eine Außenseiterphilosophie wird zur Mode – mit allen kognitiven Folgekosten, die eine Popularisierung und praxistaugliche Umarbeitung unvermeidlich mit sich bringt.
In dieser Situation ambivalenter Erfolge kommt der Reihe Systemische Horizonte – Theorie der Praxis eine doppelte Aufgabe zu: Sie soll die Theoriearbeit vorantreiben – und die Welt der Praxis durch ein gleichermaßen strenges und wildes Denken herausfordern. Hier wird der Wechsel der Perspektiven und Beobachtungsweisen als ein Denkstil vorgeschlagen, der Kreativität begünstigt.
Es gilt, die eigene Intelligenz an den Schnittstellen und in den Zwischenwelten zu erproben: zwischen Wissenschaft und Anwendung, zwischen Geistes- und Naturwissenschaft, zwischen Philosophie und Neurobiologie. Ausgangspunkt der experimentellen Erkundungen und essayistischen Streifzüge, der kanonischen Texte und leichthändig formulierten Dialoge ist die Einsicht: Theorie braucht man dann, wenn sie überflüssig geworden zu sein scheint – als Anlass zum Neu- und Andersdenken, als Horizonterweiterung und inspirierende Irritation, die dabei hilft, eigene Gewissheiten und letzte Wahrheiten, große und kleine Ideologien so lange zu drehen und zu wenden, bis sie unscharfe Ränder bekommen – und man mehr sieht als zuvor.
Bernhard Pörksen, Professor für Medienwissenschaft an der Universität Tübingen
Wilhelm Rotthaus
BeziehungsgeschöpfMensch
Übergänge zu einem neuen Selbstbild
2025
Mitglieder des wissenschaftlichen Beirats des Carl-Auer Verlags:
Prof. Dr. Dr. h. c. Rolf Arnold (Kaiserslautern)
Prof. Dr. Wolf Ritscher (Esslingen)
Prof. Dr. Dirk Baecker (Dresden)
Dr. Wilhelm Rotthaus (Bergheim bei Köln)
Prof. Dr. Ulrich Clement (Heidelberg)
Prof. Dr. Arist von Schlippe (Witten/Herdecke)
Prof. Dr. Jörg Fengler (Köln)
Dr. Gunther Schmidt (Heidelberg)
Dr. Barbara Heitger (Wien)
Prof. Dr. Siegfried J. Schmidt (Münster)
Prof. Dr. Johannes Herwig-Lempp (Merseburg)
Jakob R. Schneider (München)
Prof. Dr. Bruno Hildenbrand (Jena)
Prof. Dr. Jochen Schweitzer † (Heidelberg)
Prof. Dr. Karl L. Holtz (Heidelberg)
Prof. Dr. Fritz B. Simon (Berlin)
Prof. Dr. Heiko Kleve (Witten/Herdecke)
Dr. Therese Steiner (Embrach)
Dr. Roswita Königswieser (Wien)
Prof. Dr. Dr. Helm Stierlin † (Heidelberg)
Prof. Dr. Jürgen Kriz (Osnabrück)
Karsten Trebesch (Dallgow-Döberitz)
Prof. Dr. Friedebert Kröger (Heidelberg)
Bernhard Trenkle (Rottweil)
Tom Levold (Köln)
Prof. Dr. Sigrid Tschöpe-Scheffler (Köln)
Dr. Kurt Ludewig (Münster)
Prof. Dr. Reinhard Voß (Koblenz)
Dr. Burkhard Peter (München)
Dr. Gunthard Weber (Wiesloch)
Prof. Dr. Bernhard Pörksen (Tübingen)
Prof. Dr. Rudolf Wimmer (Wien)
Prof. Dr. Kersten Reich (Köln)
Prof. Dr. Michael Wirsching (Freiburg)
Dr. Rüdiger Retzlaff (Heidelberg)
Prof. Dr. Jan V. Wirth (Meerbusch)
Themenreihe »Systemische Horizonte«
hrsg. von Bernhard Pörksen
Reihengestaltung: Uwe Göbel
Umschlaggestaltung: B. Charlotte Ulrich
Redaktion: Veronika Licher
Satz: Drißner-Design u. DTP, Meßstetten
Printed in Germany
Druck und Bindung: CPI books GmbH, Leck
Erste Auflage, 2025
ISBN 978-3-8497-0578-7 (Printausgabe)
ISBN 978-3-8497-8521-5 (ePUB)
© 2025 Carl-Auer-Systeme Verlag
und Verlagsbuchhandlung GmbH, Heidelberg
Alle Rechte vorbehalten
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Informationen zu unserem gesamten Programm, unseren Autoren und zum Verlag finden Sie unter: https://www.carl-auer.de/Dort können Sie auch unseren Newsletter abonnieren.
Carl-Auer Verlag GmbH
Vangerowstraße 14 · 69115 Heidelberg
Tel. +4962216438-0 · Fax +4962216438-22
Inhalt
1 Einleitung
2 Menschenbilder
2.1 Der Mensch verhält sich so, wie er denkt zu sein
2.2 Wie kann der Übergang zu einem neuen Selbstbild gelingen?
Drei Schritte der Transformation: Erschütterung, Öffnung, Neuausrichtung
Ein neues Narrativ über das Selbstbild des Menschen erzählen
2.3 Die Vielfalt der Menschenbilder
2.4 Überzeugungen über das Selbst in unterschiedlichen Kulturen
2.5 Die seltsamsten Menschen der Welt
3 Das Selbstbild des Individuums, seine Zuspitzung und sein Scheitern
3.1 Gesellschaftliche Einflussfaktoren für die Erfindung des Individuums
3.2 Die vier großen Kränkungen des Individuums
3.3 Rettungsversuche für das Menschenbild des Individuums
3.4 Soziales Verhalten stand am Anfang der Entwicklung des Menschen
3.5 Gegenseitige Hilfe in der Tier- und Menschenwelt
3.6 Zuspitzung und Scheitern des Individuums
Exkurs: Vereinsamung
Exkurs: Nation
3.7 Das Selbstbild des Individuums – ein »Ausnahmephänomen« in der Menschheitsgeschichte
4 Übergänge zu einem Selbstbild der Bezogenheit
4.1 Die Notwendigkeit eines neuen Menschenbildes
4.2 Der Mensch als ein Beziehungsgeschöpf
Das Menschenbild der Prozess- oder Figurationssoziologie von Norbert Elias
Das Menschenbild des relational being von Kenneth Gergen
Das Bild der Person als »dynamisches Feld« nach Tim Lomas
Merkmale eines beziehungsorientierten Menschenbildes
4.3 Mitgefühl als Grundlage der Beziehung zu anderen Menschen, den Tieren und der nicht lebenden Natur
Die Mitleidsethik Arthur Schopenhauers
Die Spiegelneurone als neuronale Grundlage des Mitgefühls
Kooperationsverhalten im Wir-Modus
4.4 Ein gutes Leben besteht aus guten Beziehungen
4.5 Zusammenhalt und Solidarität
Exkurs: Solidarische Care-Ökonomie
4.6 Dem Leben einen Sinn geben
4.7 Mitgefühl und Solidarität mit den Mitgeschöpfen
Exkurs: Die Selbstauflösung von zoologischen Gärten
4.8 Die Natur als Rechtssubjekt
4.9 Ideen für ein beziehungsorientiertes Zivilrecht
4.10 Ideen für ein beziehungsorientiertes Deliktrecht
4.11 Ein zukünftiges Konzept von Freiheit
4.12 Bildung für alle in Lernzentren für alle
4.13 Die Universität der Zukunft
4.14 Fairness und Gerechtigkeit
5 Abschluss
Anmerkungen
Literatur
Über den Autor
1 Einleitung
Mit der Erfindung des Individuums im 11. und 12. Jahrhundert wurden die wesentlichen Ideen und Vorstellungen entwickelt, die bis heute das Selbstbild des Menschen der europäisch geprägten, sog. westlichen Welt ausmachen.1 Eine dynamische Entwicklung in nahezu allen Lebensbereichen, insbesondere in Technik und Wirtschaft, wurde dadurch ausgelöst. Allerdings hat das damals entstandene Bild des Menschen als ein souveränes, unabhängiges Individuum, das sich außerhalb der Natur verortet und diese zu seinem Nutzen beherrscht und ausbeutet, auch problematische Auswirkungen gezeitigt. Alexander von Humboldt hat dies bereits in der 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts klar erkannt und beschrieben.2
Seitdem hat sich die Lage in bedrohlicher Weise zugespitzt – seit den 1970er-Jahren in besonderem Ausmaß. Viele Merkmale des Individuums werden heutzutage in einer fast grenzenlosen Übersteigerung nahezu karikierend gelebt. In einer egomanischen Art und Weise orientiert auf Selbstdurchsetzung und die Befriedigung seiner eigenen Bedürfnisse, ist die Suche nach dem eigenen Vorteil und persönlichem Wohlstand ganz in den Vordergrund gerückt. Durch den selbst auferlegten Zwang nach ständigem Wirtschaftswachstum vernichten die Menschen der sog. westlichen Welt ihre Lebensgrundlagen, wirtschaften auf Substanz, verwüsten den globalen Süden, ruinieren die Demokratie, leben in dauernder Hektik und Anspannung, viele in großer Einsamkeit, vermissen Freude und einen Lebenssinn.
Dabei spielt nicht nur der menschengemachte Klimawandel eine große Rolle. Mindestens ebenso bedrohlich ist der Verlust der Biodiversität. Die meisten Menschen übersehen, dass wir von der Artenvielfalt der Erde abhängig sind. »Nehmen wir den Kakao, aus dem Schokolade gemacht wird: Der wird nur von zwei in den Tropen vorkommenden Mückenarten bestäubt … und wenn die aussterben, dann gibt es entweder keine Schokolade mehr oder wir müssen, wie in einigen Regionen Chinas, menschliche Bestäuber mit Pinseln losschicken, was ineffizient und megateuer ist und überdies nicht besonders viel bringt, weil der Ertrag nicht so hoch ist wie bei natürlicher Bestäubung.«3
Angesichts dieser Situation sind in den letzten Jahrzehnten in beeindruckendem Umfang Ideen und Konzepte darüber entwickelt worden, wie der Mensch sein Verhältnis zur Natur neu beschreiben kann, wie eine Wirtschaft aussehen kann, die die Ressourcen der Erde nicht weiter hemmungslos ausbeutet, wie eine Land- und Forstwirtschaft gestaltet werden kann, die von einem Respekt vor den Tieren, den Pflanzen und dem Erdboden getragen wird, wie Transport und Verkehr so organisiert werden können, dass die Umweltbelastung auf ein Mindestmaß reduziert wird, wie Bildung und Ausbildung neu gestaltet werden können und vieles andere mehr.
Zwar gibt es Bereiche, in denen die ökologische Wende durchaus vorankommt. Entgegen allen skeptischen Vorannahmen steigt der Anteil der Erneuerbaren an der Stromproduktion in Deutschland jedes Jahr um rund 6 Prozent und liegt heute bereits bei erstaunlichen 60 Prozent. Der Zukunftsforscher Julian Horx4 hält das Ziel von 80 Prozent im Jahr 2030 für »plausibel erreichbar«. Der Absatz von Elektroautos steigt weltweit rapide – Ausnahmen sind Deutschland und die USA. Zwei Drittel aller Neubauten in Deutschland werden mit Wärmepumpen betrieben. Viele Industrieunternehmen und Konzerne Europas arbeiten an der Dekarbonisierung ihrer Energie- und Produktionsweisen.
Doch in anderen Bereichen gelingt die Umsetzung vieler grundlegender Ideen und Vorschläge zur Minderung der Klimawende kaum. Werden seitens der Politik Maßnahmen beschlossen, die den Einzelnen betreffen, sind Empörung und Widerstand oft hoch. Das rührt nach meiner Überzeugung daher, dass der Mensch, der die ökologische Wende gestalten und die notwendigen Maßnahmen durchführen oder zumindest mittragen soll, kaum zum Thema gemacht wird. Die Auseinandersetzung darüber steht noch weitgehend aus, ist aber dringend erforderlich. Denn der Mensch der westlichen Einflusssphäre dürfte erst dann bereit sein, die erforderlichen Veränderungen zu vollziehen, wenn er ein neues Bild von sich selbst und seiner Beziehung zu seiner Umwelt entwickelt, – ganz im Sinne des Satzes, der Mahatma Gandhi zugeschrieben wird: »Sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt.«
Dabei kann sich der Mensch von seiner eigenen Geschichte anregen lassen. Er kann sich auf das besinnen, was ihn vor etwa 2 Millionen Jahren aus der Reihe der Primaten hat heraustreten lassen und was letztlich zu seiner großen Verbreitung auf dieser Erde geführt hat: die Fähigkeit, mit gemeinsamen Regeln und Normen in großen und weit vernetzten Gruppen zu leben, das heißt: sich sozial zu verhalten und bereitwillig von anderen zu lernen sowie eine gemeinsame Kultur bzw. ein gemeinsames kollektives Gehirn zu entwickeln. Daraus folgte damals die Entwicklung einer für alle Gruppenmitglieder verständlichen Sprache und mit ihr die nahezu unbegrenzte Fähigkeit zur Vorstellung und Reflexion über verschiedene Situationen sowie die Möglichkeit, sich über die von unserem Geist geschaffenen Szenarien mit anderen auszutauschen.
Über etwa 2 Millionen Jahre war die Zugehörigkeit zur eigenen Gruppe, in der Kooperation und gemeinschaftliches Handeln dominierten, der entscheidende Faktor für die Ausbreitung des Menschen (was keineswegs ausschließt, dass es zwischen den Gruppen zu Streit und Auseinandersetzungen kam). Lediglich für die menschheitsgeschichtlich extrem kurze Zeit seit der Erfindung des Individuums ab dem 12. Jahrhundert bis heute entwickelte sich von Europa aus das Selbstbild eines vereinzelten Menschen, der sich selbst gottgleich als Mittelpunkt seiner Lebenswelt betrachtet, über die er zu herrschen bestrebt ist. Sein Denken und Handeln wird von der Überzeugung getragen, dass die gesamte lebende und unbelebte Umwelt lediglich zu seinem Gebrauch und Nutzen existiert. Sein Blick ist konsequent auf den eigenen Vorteil gerichtet, woraus ein beständiges Streben nach Dominanz, Konkurrenz und Kampf erwächst. Seine Selbstverwirklichung und Selbstoptimierung, die Perfektionierung seines Ichs und seines Körpers erlebt er als eine nicht zu hinterfragende zentrale Aufgabe, die ihn unter großen Druck setzt. Für dieses Individuum sind Horrorszenarien über die nach wissenschaftlichen Erkenntnissen zu erwartende Zukunft vielleicht interessant, aber nicht handlungsleitend. Sie lösen eher eine Trotzreaktion aus nach dem Motto: »Ich habe mir meinen SUV verdient, und davon lasse ich mich auch nicht abbringen.« Viele Menschen erkennen rational, dass sich das Individuum zu einem sehr machtvollen Lebewesen entwickelt hat und dass es aktuell diese Macht nutzt, um die eigenen Lebensgrundlagen zu zerstören. Sie befürworten auch politische Maßnahmen, die gegensteuern sollen – aber nur, solange sie in ihrem Bedürfnis nach optimaler Selbstdurchsetzung und Selbstverwirklichung nicht davon betroffen werden.
Was aber kann den westlich geprägten Menschen motivieren, das doch völlig selbstverständlich erscheinende Bild von sich und seiner Beziehung zu seiner Umwelt neu zu denken und darauf aufbauend Veränderungen zu vollziehen? Dazu sollen Zweifel und Verunsicherung im Hinblick auf die Selbstverständlichkeit und Unhinterfragbarkeit des individuumzentrierten Menschenbildes geweckt werden. Deshalb werde ich
mich mit der grundlegenden Bedeutsamkeit des Menschenbildes für das eigene Handeln beschäftigen,
die Stellung des individuumzentrierten Menschenbildes der westlich geprägten Welt im Kontext anderer Menschenbilder aufzeigen und verdeutlichen, wie seltsam und merkwürdig dieses Menschenbild aus der Sicht anderer Kulturen erscheint,
die wissenschaftlichen Hypothesen referieren, welche gesellschaftlichen Entwicklungen zu der Erfindung des Individuums seit Mitte des 11. Jahrhunderts geführt haben,
die vier großen Kränkungen des Individuums im Laufe der vergangenen 9 Jahrhunderte schildern
und darstellen, mit welch großem vorurteilsgeprägtem Einsatz vor allem die Wirtschaftswissenschaft trotz aller gegenläufigen Offensichtlichkeiten das Narrativ des von Natur aus selbstsüchtigen, egoistischen, auf den eigenen Vorteil bedachten Menschen aufgebaut und unter anderem durch Tabuisierung aller gegenläufigen Argumente und Erkenntnisse immer wieder verteidigt hat und verteidigt,
um schließlich auf die aktuelle Zuspitzung der Ideen des Individuums und sein Scheitern einzugehen und
die Hypothese zu verdeutlichen, dass die Epoche des Individuums im Rahmen der Menschheitsgeschichte als ein (in diesem Kontext minimal kurzes) Ausnahmephänomen anzusehen ist.
Unter der Überschrift »Übergänge zu einem Selbstbild der Bezogenheit« werde ich
die Hypothese vertreten, dass ein zukünftiges Menschenbild den Menschen als ein Beziehungsgeschöpf auffassen wird,
und im Detail unterschiedliche, aber prinzipiell ähnliche Konzepte eines solchen beziehungsorientierten Menschenbildes vorstellen.
Sodann wird die Bedeutung von Mitgefühl als Grundlage der Beziehung zu anderen Menschen, zu den Tieren und zu der nicht lebenden Natur erörtert
und dargestellt, wie sehr nach wissenschaftlichen Erkenntnissen ein gutes Leben von guten Beziehungen getragen wird.
Zusammenhalt und Solidarität werden als wichtige Merkmale eines Psyche und Körper stärkenden Menschenbildes erörtert,
und es wird der Frage nachgegangen, wie der Mensch sein Leben mit Sinn erfüllen kann, wenn er erkannt hat, dass das Streben nach immer mehr Besitz ein trügerisches Ziel ist.
Als ein wichtiger Anstoß für eine Transformation des Menschenbildes wird eine neue Sicht auf unsere Mitgeschöpfe, die Tiere, besprochen, wie sie sich in neueren Forschungen immer klarer darstellt, und vorgeschlagen, der Natur als Rechtssubjekt Verfassungsrang einzuräumen.
In weiteren Abschnitten wird ein im Hinblick auf Resozialisation erfolgversprechenderes Deliktrecht erörtert und der Frage nachgegangen, wie ein beziehungsorientiertes Zivilrecht gestaltet werden kann.
Es wird das aktuelle Verständnis von Freiheit problematisiert und alternative Vorstellungen von Freiheit werden erörtert.
Zudem werden Zukunftsentwürfe eines effektiveren Schul- und Universitätssystems vorgestellt sowie Modelle einer Wirtschaft zur Diskussion gestellt, die Fairness und Gerechtigkeit anstrebt und das Ziel eines guten Lebens für alle Menschen verfolgt.
Der zukünftige Mensch, der sich als Beziehungsgeschöpf versteht, wird nicht mehr als isoliertes, konkurrenzorientiertes Individuum, sondern im Bewusstsein einer nicht hinterfragbaren Bezogenheit zu anderen sozusagen als »Konnektivum«I leben. Diese Vision ist verbunden mit dem Versprechen auf einen großen Zugewinn an Wohlbefinden und Lebenszufriedenheit. Sie kann Hoffnung und Zuversicht befeuern, sodass die unvermeidlichen Verzichtsleistungen, die auf die BürgerinnenII der Länder der westlichen Welt zukommen, in ihrer Bedeutung zurücktreten gegenüber dem, was sie mit der Aussicht auf ein gutes und zufriedenstellendes Leben gewinnen können. Hoffnung und Zuversicht aber haben viel mit Handeln zu tun. Sie können die Menschen befeuern, mit dem Blick auf eine bessere Zukunft zu handeln und über dieses Handeln mit anderen möglichst viel zu sprechen. Denn von Hoffnung und Zuversicht getragenes Handeln ist ansteckend.
Gleichzeitig stellt sich die Frage: Was bleibt? Das Individuum erlebt sich als souverän, unabhängig und ungebunden. Es zeichnet sich aus durch eine Freiheit des Denkens und eine Bereitschaft, vermeintliche Wahrheiten zu hinterfragen. Dabei vertraut es auf seine Vernunft und die eigenen Gedanken und Erfahrungen. Der eigene Körper findet große Aufmerksamkeit. Den Gefühlen und Wünschen, die es in diesem Körper verortet, wird hohe Bedeutung zugemessen. Forscherdrang und Kreativität sind wichtige Merkmale. Neugier und Erkenntnissuche sowie eine große Bereitschaft, Zukunftsvisionen zu entwickeln und zu verfolgen, resultieren aus seinem Selbstverständnis. Welche dieser Eigenschaften in wie gearteter Form und in welchem Umfang sich in ein zukünftiges Selbstbild des Menschen als Beziehungsgeschöpf werden integrieren lassen, wie diese Merkmale verändert werden und wie sie die Vorstellungen darüber, dass sich der Mensch erst in der Beziehung zu anderen verwirklicht, ihrerseits verändern, wird eines der großen Themen der Zukunft sein.
Ein »Weiter-so«, ein Festhalten an überkommenen Ideen und Vorstellungen über die »Natur« des Menschen ist keine Option. Die Frage, wie eine neue Sicht des westlich geprägten Menschen auf sich selbst und seine Beziehung zu der Welt aussehen kann, muss deshalb dringend in den Mittelpunkt der gesellschaftlichen Diskussion gestellt werden. Genau diese Frage wurde dem Philosophen Bruno Latour5 in einem Spiegelinterview gestellt und seine Antwort lautete: »Das zu entwickeln wird eine der entscheidenden philosophischen Fragen der kommenden Jahre sein.« Nachgefragt nach seiner Antwort: »Es sprengt meine Vorstellungskraft. Das, worum es hier geht, ist größer als die kopernikanische Wende.«
2 Menschenbilder
2.1 Der Mensch verhält sich so, wie er denkt zu sein
»Denn das Bild vom Menschen, das wir für wahr halten, wird selbst ein Faktor unseres Lebens. Es entscheidet über die Weisen des Umgangs mit uns selbst und mit den Mitmenschen, über Lebensstimmung und Wahl der Aufgaben.«
Karl Jaspers (1948, S. 56)
Menschenbilder bilden das Fundament jeder Gesellschaft. Sie sind macht- und wirkungsvoll. Die Annahmen und Vorstellungen, die der Mensch über sich selbst und seine Beziehung zur Welt hat, beeinflussen entscheidend die Art und Weise, wie er sich selbst wahrnimmt, wie er denkt, fühlt und handelt. Denn der Mensch verhält sich so, wie er denkt zu sein. Er ist »ein Wesen, das offensichtlich darauf angewiesen ist, sich ein Bild von sich selbst zu machen, und das sich durch dieses Bild selbst mitgestaltet«.6 Pico della Mirandola (1463–1494) spricht etwas Ähnliches an, wenn er den Menschen mit einem Chamäleon vergleicht, ohne besondere Eigenart, »dem gegeben ist zu haben, was er wünscht, und zu sein, was er will«.7
Menschenbilder beschreiben die Art und Weise, wie Menschen über sich selbst denken. Diese Annahmen und Vorstellungen beziehen sich auf die Stellung des Menschen in der Welt, auf eine prinzipielle Gleichheit oder Verschiedenheit der Menschen untereinander, auf eine Unabhängigkeit oder Verbundenheit mit anderen, auf die Existenz eines freien Willens und die Möglichkeit von Selbstbestimmung, auf charakteristische menschliche Eigenschaften, auf den Sinn des Lebens sowie Ideen über eine mögliche höhere (göttliche) Macht, der sie unterworfen sind. Das Menschenbild bestimmt auch darüber, wie der Mensch die Welt wahrnimmt und konstruiert, da seine Überzeugungen über sich und andere wesentlich darüber entscheiden, was er bei seinen Beobachtungen der Welt für wichtig und was er für belanglos hält.
Auf die Bedeutung des Selbstbildes des Menschen hat Friedrich Nietzsche bereits hingewiesen und formuliert,
»dass Menschenbilder nicht einfach nur geistige Abbilder des Menschen sind, sondern als geistige Bilder eine formende, prägende Wirkung auf eben diejenige Wirklichkeit haben, deren Abbild sie sein sollen. Sie ›wirken als Reize, entzünden einen Trieb und verführen den Intellekt, ihm zu dienen‹, sie bieten ›einen Antrieb zur Verklärung des eigenen Lebens‹, sie helfen durch ›Erregung und Neid die Zukunft (zu) schaffen‹ und können den Menschen in lichte Höhen, aber auch ›unter ein Mittelmaß‹ absinken lassen. Menschenbilder bilden den Menschen also nicht nur ab, sondern sie bilden ihn mit, d. h., sie sind nicht nur repräsentativ, sondern auch konstitutiv.«8
Es ist nicht weit hergeholt, Menschenbildern die Kraft einer selbsterfüllenden Prophezeiung zuzuschreiben. So hat beispielsweise Thomas Hobbes9 (ohne Beweise dafür vorzulegen) die These vertreten, im Naturzustand des Menschen herrsche ein »Krieg aller gegen alle«. Jeder Mensch betrüge den anderen aus Angst, selbst betrogen zu werden. Bei allem, was er besitze, kenne der Mensch keine höhere Freude als die, dass andere nicht so viel haben. Ein derartiges Menschenbild prägt das Verhalten, und prosoziale, auf Kooperation ausgerichtete Fähigkeiten werden sich kaum entwickeln oder aufrechterhalten.
Aber natürlich könnte eine selbsterfüllende Prophezeiung auch in die entgegengesetzte Richtung wirken. Ein Menschenbild, das die Abhängigkeit des einen vom anderen betont und erkennt, dass die eigenen Interessen am besten verfolgt werden, wenn sie auch dem anderen dienen; ein Menschenbild, das Kooperation für eine unabdingbare Bedingung des Lebens ansieht und den Menschen als gleichberechtigten Teil unter vielen in der Natur betrachtet, lässt einen sozial kompetenten Menschen erwachsen.
Menschen werden in das Menschenbild ihrer Kultur hineingeboren. Vom ersten Tag an lernen sie, wie in dieser Kultur Beziehungen gelebt und Signale gedeutet werden. Mit dem Erwerb der Sprache nehmen sie auf, wie die Menschen in dieser Kultur ihr Bild der Welt konstruieren. Der berühmte Philosoph Hans Georg Gadamer10 hat das in den Satz gefasst, dass es korrekter sei »zu sagen, dass Sprache uns spricht, als dass wir die Sprache sprechen«. Mit der Sprache lernen Menschen die in ihrer Kultur »richtige« Sichtweise. Es gibt nur einen ganz geringen Spielraum für Abweichungen – eine wichtige Voraussetzung dafür, dass man sich überhaupt gegenseitig (im doppelten Wortsinn) versteht.
Zichy11 unterscheidet zwischen einem gesellschaftlichen Menschenbild sowie gruppen- und personengebundenen Menschenbildern. Diese vergleicht er mit Landkarten, die Orientierung geben und die Richtung weisen. Das gesellschaftliche Bild vom Menschen gleicht einer Landkarte, auf der die wichtigsten Orte, Wege und Orientierungspunkte eingezeichnet sind, die für jeden verbindlich gelten und dafür sorgen, dass sich alle zurechtfinden; die Karte sichert auf diese Weise eine funktionierende gesellschaftliche Interaktion. Die Gruppen tragen zusätzlich Markierungen in die Karte ein, die für sie jeweils wichtig sind. Und schließlich ergänzt der Einzelne die Karte mit den eigenen, persönlich bedeutsamen Kennzeichen. Dies führt dazu, dass das Landkartenexemplar jedes Einzelnen sowohl von der gesellschaftlichen Landkarte als auch von denen der Mitmenschen in vielen Details abweicht, sich die Karten aber in den für alle verbindlichen großen Linien gleichen.
Die Beziehungen zwischen dem gesellschaftlichen Bild vom Menschen sowie den gruppenspezifischen und personengebundenen Menschenbildern können durchaus spannungsgeladen sein. So weichen die persönlichen und vor allem auch die gruppenspezifischen Menschenbilder möglicherweise bezüglich einzelner Überzeugungen von dem zu einem bestimmten Zeitpunkt dominierenden gesellschaftlichen Menschenbild ab. Die Gruppe oder der Einzelne können dann versuchen, ihre spezifischen Wertvorstellungen – beispielsweise im Hinblick auf den Beginn und das Ende des menschlichen Lebens – in das allgemeine Menschenbild einzuschreiben und dieses dadurch zu prägen. Das heißt: Veränderungen der gesellschaftlichen Menschenbilder hinsichtlich spezifischer Überzeugungen sind grundsätzlich möglich, nehmen allerdings Zeit und Engagement in Anspruch.
2.2 Wie kann der Übergang zu einem neuen Selbstbild gelingen?
Drei Schritte der Transformation: Erschütterung, Öffnung, Neuausrichtung
Zunächst soll etwas ausführlicher darauf eingegangen werden, wie die anstehende Transformation und der Aufbruch in eine Zukunft gelingen kann, die nach meiner Überzeugung durch ein beziehungsorientiertes Menschenbild gekennzeichnet ist.
Transformationen verlaufen nicht linear, sondern eher spiralförmig sich wiederholend. Sie sind gekennzeichnet durch vielfältige Übergangsprozesse, die mal rasch, abrupt und deutlich erkennbar, mal schleichend, kontinuierlich und unscheinbar verlaufen. Sie vollziehen sich in unterschiedlichen Geschwindigkeiten und sind grundsätzlich unplanbar. Sie können aber angeregt und stimuliert werden, ohne dass sich vorhersagen ließe, welches Ergebnis diese Impulse zur Folge haben. Dieser Verlauf transformativer Veränderungen lässt sich als aktiver Prozess der Erschütterung, Öffnung und Neuausrichtung beschreiben.12
Erschütterung
Mit dem Ziel der Erschütterung wird Bestehendes in seiner historischen Gewordenheit sowie seiner aktuellen Fragwürdigkeit und Fragilität ins Licht eines kritischen Bewusstseins gehoben. Gelingt dies, entstehen Zweifel am Althergebrachten, Unbehagen und Unzufriedenheit. Wünsche nach Veränderung kommen auf.
Bezogen auf das Thema der Entwicklung eines neuen Menschenbildes setzt ein solcher Prozess der Transformation bei den Erfahrungen an, die die bisherigen Sinnhorizonte und selbstverständlichen Vorannahmen über das aktuelle Menschenbild infrage stellen. Dadurch wird die Wahrnehmung des eigenen Selbst und der Welt tiefgreifend verunsichert. Die Bedeutungsperspektiven, die aktuell das Wirklichkeitsverständnis prägen und für das menschliche Handeln sowie die Identität des Einzelnen orientierungsgebend sind, geraten ins Wanken.
Wichtig dabei ist allerdings die Bereitschaft und die Fähigkeit, »die Fragen an die Sinnhaftigkeit der bisherigen eigenen Bedeutungsperspektive nicht einfach zu ignorieren, sondern aktiv zuzulassen und so Reflexionen eigener Zielsetzungen bis in ihre selbst- und weltkonstitutiven Dimensionen anzustoßen.«13 Es wird dann eine Schwelle überschritten, die einen neuen und bisher unzugänglichen Weg eröffnet, über das eigene Menschenbild und ein Menschenbild der Zukunft nachzudenken.
Öffnung
Kreyher und Böhret14 leiten ihren Sammelband mit dem Titel »Gesellschaft im Übergang – Problemaufrisse und Antizipationen« mit den Worten ein: »Es könnte sein, dass wir uns wieder einmal im Übergang in eine andere Gesellschaft befinden. Kann man die vielfältigen Veränderungen – hier und da – überblicken, Zusammenhänge erkennen, Folgerungen für Zukünftiges ableiten? Die Konturen der Gesellschaft ›in Bewegung‹ sind noch unscharf. Die Geschwindigkeit des Übergangs insgesamt ergibt sich aus beschleunigenden und retardierenden Effekten in vielen Einzelbereichen. Manches, was sich da andeutet, wird sich (so) nicht durchsetzen, wie wir es jetzt zu sehen meinen. Einiges wird uns überraschen. Wieder anderes wird nicht mehr existieren, nur vorübergehend ›gewesen sein‹. Es bleibt noch viel Ungewissheit bei aller Wissensfülle, nicht zuletzt wegen der Pluralität von Ort, Zeit und Werten.
Aber gerade deswegen lohnt sich der Blick auf die Vorgänge und auf die Zukünfte als Möglichkeiten. Da sind Problemaufrisse hilfreich, und Antizipationen eröffnen Perspektiven, auch für Veränderungsanstöße. Was lässt sich vorausahnen? Dazu muss man sich von den alltäglichen Zwängen der erlebten Wirklichkeit und von Denkgewohnheiten erst einmal lösen. Warum also nicht einmal ›drauf-los-denken‹? Nach vorn, zurück, in die Breite, und dann wieder weiter nach vorn: Übergänge und Zukünfte finden – als Vorstellung oder als Wunsch – zuerst in den Köpfen statt. Anregend und anstoßend sind die Perioden des erahnten und analytisch erfassten Übergangs immer. Manchmal werden sogar die Wege in die Zukunft (mit)bestimmt.«
Die Wahrnehmung, in einer Zeit des Übergangs zu leben, ist eine gute Voraussetzung, um sich neuen Sinn zu eröffnen und einen Raum vielfältiger, unterschiedlicher Perspektiven zu gewinnen. Das beinhaltet unter anderem die Bereitschaft, andere Sichtweisen, die im Schatten des Althergebrachten stehen, wahrzunehmen und sie unvoreingenommen und vorurteilsfrei auf ihre Tauglichkeit zu betrachten und einzuschätzen.
Graupe und Bäuerle15 verweisen beispielsweise auf die Möglichkeit, »im Rahmen des interkulturellen Dialogs zu erfahren, wie andere Menschen ihre Welt und ihr Selbst auf vollkommen andere Weise wahrnehmen, und aus dieser fremden Perspektive das Eigene und Selbstverständliche als überraschend und im wahrsten Wortsinn frag-würdig wahrzunehmen«. Auf diese Weise kann es gelingen, die sozialen und kulturellen Bedingtheiten der eigenen Bedeutungsperspektiven zu erkennen und zu durchschauen, »wie unterhalb der gewohnten Wahrnehmungsschwelle am Ende gesellschaftliche und kulturelle Sinnhorizonte, Stereotype und Frames das eigene Wahrnehmen, Fühlen, Denken etc. substantiell ausmachen«.16 Dazu kann es auch gehören, Erfahrungen und Errungenschaften, die in Vergessenheit geraten sind, wiederzuentdecken.
Neugierde ist eine wichtige Haltung und Ausgangspunkt für Veränderung. Sie erkundet Erfahrungen von gestern und heute und ermöglicht im Zusammenspiel mit der Fantasie Visionen einer unbekannten Zukunft. Um solche Visionen zu einem wirkmächtigen Kompass des eigenen Handelns werden zu lassen, müssen sie sich, so Schneidewind17, »mit einer transformativen Haltung, mit einer ›Lust auf Veränderung‹ und mit ›Interaktionsfreudigkeit‹ verbinden«. Erst dadurch würden Menschen in die Lage versetzt, sich zu ermächtigen, selbst zu denken und auch widerspenstig zu sein.
Mit dem Begriff der Widerspenstigkeit bezieht Schneidewind sich auf das Buch von Harald Welzer18 »Selbst denken – eine Anleitung zum Widerstand«, dem er die nachfolgenden zwölf Regeln für einen erfolgreichen Widerstand entnommen hat.
Alles könnte anders sein.
Es hängt ausschließlich von Ihnen ab, ob sich etwas verändert.
Nehmen Sie sich deshalb ernst.
Hören Sie auf, einverstanden zu sein.
Leisten Sie Widerstand, sobald Sie nicht einverstanden sind.
Sie haben jede Menge Handlungsspielräume.
Erweitern Sie Ihre Handlungsspielräume dort, wo Sie sind und Einfluss haben.
Schließen Sie Bündnisse.
Rechnen Sie mit Rückschlägen, vor allem solchen, die von Ihnen selbst ausgehen.
Sie haben keine Verantwortung für die Welt.
Wie Ihr Widerstand aussieht, hängt von Ihren Möglichkeiten ab.
Und von dem, was Ihnen Spaß macht.
Nach Schneidewind19 liegt das Besondere der sogenannten »Großen Transformation« im 21. Jahrhundert »im Gegensatz zu den beiden vorgelagerten großen Umbrüchen der Menschheitsgeschichte, der neolithischen und der industriellen Revolution, darin, dass diese nicht alleine durch neue technologische und ökonomische Möglichkeiten angetrieben ist, sondern von einer kulturellen Leitidee getragen wird: nämlich der Vision, ein gutes Leben für weltweit knapp 10 Milliarden Menschen auch innerhalb gegebener planetarer Leitplanken organisieren zu können. Sie nimmt daher einen normativen Kompass als Ausgangspunkt und Maßstab.« … Denn: »Am Ende verändern Ideen und neue Wertvorstellungen die Welt.«
Eine ähnliche Sichtweise vertreten Inkermann und Lage20, wenn sie schreiben:
»Eine andere Lebens- und Produktionsweise ist möglich. Wir nennen diese Lebens- und Produktionsweise, die allen ein gutes Leben ermöglicht, solidarisch. Die solidarische Lebensweise soll es allen Menschen ermöglichen, ihre grundlegenden Bedürfnisse zu befriedigen und gleichzeitig die Mitwelt – Tiere, Pflanzen und die lebendige Natur – zu erhalten. Sie sollten niemanden ausschließen und allen ein Leben ermöglichen, das nicht auf Kosten anderer geht, eben ein gutes Leben für alle. … Solidarische Alternativen setzen auf Zusammengehörigkeit, Kooperationen, Gerechtigkeit und Ökologie.«
Schließlich gehört zur Öffnung auch, unbekannte Zukünfte zu imaginieren und Vorstellungen über mögliche Alternativen des menschlichen Seins in der Welt zu kreieren. Denn: »Imaginationen stoßen die Tür zu einer Zukunft auf, die wir unmöglich kennen können.«21 So werden (Denk)freiräume für neue Perspektiven entfaltet sowie Aufmerksamkeit und Interesse für alternative Lebens-, Einstellungs- und Handlungsmöglichkeiten geschaffen.
Neuausrichtung
Visionen über befriedigendere und erfreulichere Zukünfte befördern eine Neuausrichtung. Dabei geht es darum, diese Vorstellungen über mögliche Alternativen in möglichst konkreter Form zu entwickeln und sie dann in verschiedenen Formen und auf unterschiedlichen Wegen zu verbreiten. Konkret handelnd werden erste Schritte dann von vielen auf ihre Brauchbarkeit überprüft, Bündnispartnerschaften und Allianzen eingegangen, um Transformationsprozesse in Richtung auf eine gute Zukunft für alle zu erreichen.
Letztlich geht es darum, einen Handlungskompass auszubilden, der sich an einem neuen Menschenbild und einem neuen Selbst- und Weltverständnis orientiert. Damit stellen sich dann Fragen wie: Welche Probleme sind in vorderster Linie relevant, und mit welchen kann und will ich in einer neuen Art und Weise umgehen? In welchen Lebensbereichen sehe ich den größten Handlungsbedarf, und wo ist meine Fähigkeit und Bereitschaft zu eigenem Handeln im Sinne eines neuen Menschenbildes am stärksten? So können neue Erfahrungen gemacht