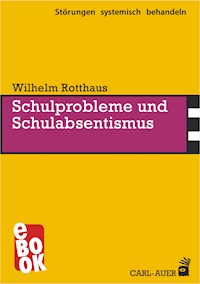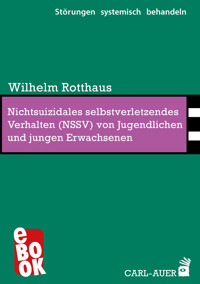Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl-Auer Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Systemische Horizonte
- Sprache: Deutsch
Das Zeitalter des Individuums scheint zu Ende zu gehen. Was ist zu tun? Der zentrale Ansatz dieses Buches lautet: Was wir heute für selbstverständlich halten, ist das Ergebnis von Entwicklungen, Umbrüchen und Entscheidungen; es versteht sich nicht von selbst. Als Systemiker begnügt sich Rotthaus – anders als viele prominente und weniger prominente "Zukunftsforscher" – nicht mit starken Behauptungen und scheinbar unbezweifelbaren Visionen. Er geht zuerst der bedeutenden Frage auf den Grund, wie es vom Mittelalter bis zur sogenannten "Neuzeit" überhaupt dazu kam, dass dem Individuum eine solche Wichtigkeit zugeschrieben wurde und immer noch wird. Die technisch-wissenschaftlichen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgen dieser Entwicklung wurden vielfach als positiv erlebt. Es gibt aber weit mehr dramatische Folgen dieses Wandels. Sie haben zu den massiven Problemen geführt, mit denen wir heute leben und die uns als nahezu unlösbar erscheinen. Unlösbar sind sie aber nur dann, wenn wir sie mit der gleichen Logik angehen, über die wir sie in unsere Welt eingeführt haben. Das heißt: Wir müssen uns von der Ego-Orientierung verabschieden. Wilhelm Rotthaus bringt seine gesamte psychiatrische, wissenschaftliche und historische Expertise in dieses Buch ein. Er zeigt sich dabei nicht nur auf der Höhe der Zeit, sondern bezieht auch wichtige Beiträge und Gedanken von Philosophinnen und Soziologinnen ein, die bislang viel zu wenig Beachtung gefunden haben. Von Kapitel zu Kapitel entsteht so ein neuer Raum des Denkens und Forschens.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 300
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Systemische Horizonte – Theorie der Praxis
Herausgeber: Bernhard Pörksen
»Irritation ist kostbar.«Niklas Luhmann
Die wilden Jahre des Konstruktivismus und der Systemtheorie sind vorbei. Inzwischen ist das konstruktivistische und systemische Denken auf dem Weg zum etablierten Paradigma und zur normal science. Die Provokationen von einst sind die Gewissheiten von heute. Und lange schon hat die Phase der praktischen Nutzbarmachung begonnen, der strategischen Anwendung in der Organisationsberatung und im Management, in der Therapie und in der Politik, in der Pädagogik und der Didaktik. Kurzum: Es droht das epistemologische Biedermeier. Eine Außenseiterphilosophie wird zur Mode – mit allen kognitiven Folgekosten, die eine Popularisierung und praxistaugliche Umarbeitung unvermeidlich mit sich bringt.
In dieser Situation ambivalenter Erfolge kommt der Reihe Systemische Horizonte – Theorie der Praxis eine doppelte Aufgabe zu: Sie soll die Theoriearbeit vorantreiben – und die Welt der Praxis durch ein gleichermaßen strenges und wildes Denken herausfordern. Hier wird der Wechsel der Perspektiven und Beobachtungsweisen als ein Denkstil vorgeschlagen, der Kreativität begünstigt.
Es gilt, die eigene Intelligenz an den Schnittstellen und in den Zwischenwelten zu erproben: zwischen Wissenschaft und Anwendung, zwischen Geistes- und Naturwissenschaft, zwischen Philosophie und Neurobiologie. Ausgangspunkt der experimentellen Erkundungen und essayistischen Streifzüge, der kanonischen Texte und leichthändig formulierten Dialoge ist die Einsicht: Theorie braucht man dann, wenn sie überflüssig geworden zu sein scheint – als Anlass zum Neu- und Andersdenken, als Horizonterweiterung und inspirierende Irritation, die dabei hilft, eigene Gewissheiten und letzte Wahrheiten, große und kleine Ideologien so lange zu drehen und zu wenden, bis sie unscharfe Ränder bekommen – und man mehr sieht als zuvor.
Bernhard Pörksen, Professor für Medienwissenschaft an der Universität Tübingen
Wilhelm Rotthaus
Wir können und müssen uns neu erfinden
Am Ende des Zeitalters des Individuums – Aufbruch in die Zukunft
2021
Mitglieder des wissenschaftlichen Beirats des Carl-Auer Verlags:
Prof. Dr. Rolf Arnold (Kaiserslautern)
Prof. Dr. Dirk Baecker (Witten/Herdecke)
Prof. Dr. Ulrich Clement (Heidelberg)
Prof. Dr. Jörg Fengler (Köln)
Dr. Barbara Heitger (Wien)
Prof. Dr. Johannes Herwig-Lempp (Merseburg)
Prof. Dr. Bruno Hildenbrand (Jena)
Prof. Dr. Karl L. Holtz (Heidelberg)
Prof. Dr. Heiko Kleve (Witten/Herdecke)
Dr. Roswita Königswieser (Wien)
Prof. Dr. Jürgen Kriz (Osnabrück)
Prof. Dr. Friedebert Kröger (Heidelberg)
Tom Levold (Köln)
Dr. Kurt Ludewig (Münster)
Dr. Burkhard Peter (München)
Prof. Dr. Bernhard Pörksen (Tübingen)
Prof. Dr. Kersten Reich (Köln)
Dr. Rüdiger Retzlaff (Heidelberg)
Prof. Dr. Wolf Ritscher (Esslingen)
Dr. Wilhelm Rotthaus (Bergheim bei Köln)
Prof. Dr. Arist von Schlippe (Witten/Herdecke)
Dr. Gunther Schmidt (Heidelberg)
Prof. Dr. Siegfried J. Schmidt (Münster)
Jakob R. Schneider (München)
Prof. Dr. Jochen Schweitzer (Heidelberg)
Prof. Dr. Fritz B. Simon (Berlin)
Dr. Therese Steiner (Embrach)
Prof. Dr. Dr. Helm Stierlin (Heidelberg)
Karsten Trebesch (Berlin)
Bernhard Trenkle (Rottweil)
Prof. Dr. Sigrid Tschöpe-Scheffler (Köln)
Prof. Dr. Reinhard Voß (Koblenz)
Dr. Gunthard Weber (Wiesloch)
Prof. Dr. Rudolf Wimmer (Wien)
Prof. Dr. Michael Wirsching (Freiburg)
Prof. Dr. Jan V. Wirth (Meerbusch)
Themenreihe: »Systemische Horizonte«
Hrsg. von Bernhard Pörksen
Reihengestaltung: Uwe Göbel
Umschlaggestaltung: Heinrich Eiermann
Redaktion: Veronika Licher
Satz: Drißner-Design u. DTP, Meßstetten
Erste Auflage, 2021
ISBN 978-3-8497-0410-0 (Printausgabe)
ISBN 978-3-8497-8345-7 (ePUB)
© 2021 Carl-Auer-Systeme Verlag
und Verlagsbuchhandlung GmbH, Heidelberg
Alle Rechte vorbehalten
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Informationen zu unserem gesamten Programm, unseren Autoren und zum Verlag finden Sie unter: https://www.carl-auer.de/
Wenn Sie Interesse an unseren monatlichen Nachrichten haben, können Sie dort auch den Newsletter abonnieren.
Carl-Auer Verlag GmbH
Vangerowstraße 14 · 69115 Heidelberg
Tel. + 49 6221 6438 - 0 · Fax + 49 6221 6438-22
Inhalt
Vorwort
1Selbstbild und Weltbild des europäischen Menschen im Frühmittelalter
Vorbemerkung
1Das Korsett der aktuellen Sprache beim Beschreiben einer völlig andersartigen Selbst- und Weltsicht des Menschen
2Das Mittelalter – eine Zeit mehrerer, sehr unterschiedlicher Epochen
3Der geringe Umfang des Quellenmaterials
Die ständisch-feudale Gesellschaftsordnung
Allgemeine Charakteristika der Gesellschaft
Das Selbstbild des Menschen
Die Natur, die Dinge, die Umwelt
Die Wissenschaft
Die Sprache
Armut, Reichtum und Handel
Ethik und Recht
Die Zeit
Der Raum
Die Kunst
Malerei
Dichtung
Musik
Zusammenfassung
2Der Umbruch und die Erfindung des Individuums zur Zeit des Hoch- und Spätmittelalters
Die Änderung der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen
Bevölkerungswachstum
Glaubenszweifel
Die Kreuzzüge
Die Begegnung mit einem wissenschaftlich weit entwickelten Islam in Südspanien
Politische Verwerfungen
Folgen des Umbruchs
Auftreten von Besessenheitsepidemien
Das Selbstbild des Menschen
Familie, Kindheit und Erziehung
Die Natur, die Dinge, die Umwelt
Die Wissenschaft
Die Wirtschaft
Gemeinnutz – Eigennutz
Einführung des arabischen Zahlensystems
Ethik
Das Recht
Der Staat
Die Zeit
Der Raum
Die Kunst
Literatur
Musik
Zusammenfassung
3Das Ende des Zeitalters des Individuums
Zeichen des Umbruchs
Das Selbstbild des heutigen Menschen
Erziehung und Bildung
Das Geschöpf Mensch und seine Mitgeschöpfe
Exkurs: »Es war einmal …« – Das Märchen von Herrn Markt
Die Wirtschaft
Die Wissenschaft
Die Zeit
Zusammenfassung
4Aufbruch in eine unbekannte Zukunft – Gedanken zu einem zukünftigen Selbst- und Weltbild des Menschen
Wir müssen uns entscheiden
Der Mensch – ein Beziehungsgeschöpf
Die Unmöglichkeit gezielter Instruktionen
Erziehung und Bildung
Der Mensch als Geschöpf unter gleichartigen Geschöpfen
Die Wirtschaft
Der Staat
Wissenschaft und Ethik
Digitalisierung und künstliche Intelligenz
Das Deliktrecht
Die Zeit
Visionen entwickeln
Interview vom 1. September 2252 mit dem Historiker Professor Dr. Fritz Tabari
Nachwort
Anmerkungen
Literatur
Über den Autor
Vorwort
Wir, die von der europäischen Kultur geprägten Menschen der sogenannten westlichen Welt, befinden uns in einer Zeit des tiefgreifenden Umbruchs. Die Epoche des Individuums, die ausgehend von Europa über etwa neun Jahrhunderte das Denken und Handeln in weiten Teilen der Welt geprägt hat, geht zu Ende. Damit stellt sich eine Jahrtausendaufgabe: Wir werden ein neues Bild unserer selbst erfinden müssen, das neue Vorstellungen über unsere Beziehung zu unseren Mitmenschen, zu der uns umgebenden Natur, zu Raum und Zeit, zur Wirtschaft und zur Verteilung von materiellen Gütern umfasst, was sich in einem angepassten Rechtssystem spiegelt.
Ein »Weiter so« ist nicht mehr möglich. Das Bewusstsein dafür, dass wir uns in einer multiplen Krise befinden, wächst, was sich unter anderem an den weltweiten, von Schulstreiks begleiteten Demonstrationen und an einer steigenden Zahl an Publikationen zu diesem Thema ablesen lässt. Nicht nur mit der Flutkatastrophe in unserem Land im Sommer 2021 und zeitgleich extremen Hitzewellen in Südeuropa und Nordamerika zeigen sich die Auswirkungen eines Klimawandels, der ganz offensichtlich nicht durch leichte Kurskorrekturen zu lösen ist, sondern tiefgreifende Veränderungen in allen Bereichen unseres Lebens erfordet.
Gleichzeitig ist in unserer Gesellschaft unübersehbar eine Zunahme an Egozentrik, egoistischen und hyperindividualistischen Verhaltensweisen zu beobachten. Grenzen der Selbstverwirklichung, der Selbstbereicherung und Selbstdurchsetzung werden zunehmend weniger akzeptiert. Sie kennen das Phänomen: In grotesker Weise werden beispielsweise Rettungskräfte, die sich um das Leben eines Verunglückten bemühen, körperlich angegriffen, nur weil sie mit ihrem Einsatz den Verkehr blockieren und das Weiterkommen eines Einzelnen stören. Polizeibeamte, die Ordnungsmaßnahmen des Staates durchzusetzen versuchen, werden immer häufiger unflätig beschimpft und auch körperlich attackiert. In Idar-Oberstein erschießt ein 49 Jahre alter Mann einen 20-jährigen Verkäufer in einer Tankstelle nach dessen Hinweis auf die Maskenpflicht, weil er die Corona-Maßnahmen ablehnt. Gewalt zur Durchsetzung der individuellen Interessen wird häufiger, die Gesellschaft insgesamt rabiater. Der Bielefelder Sozialpsychologe Andreas Zick kommentiert dies mit den Worten: »Das sollte uns aber nicht überraschen. Schließlich wird auf allen gesellschaftlichen Ebenen seit Jahren vor allem Durchsetzungsfähigkeit und Eigeninteresse gepredigt.«1
Die Parteiendemokratie vermag vor allem in den USA schon seit Längerem, spätestens aber seit der Wahl von Donald Trump 2016 nicht mehr ein Gefühl von Sicherheit zu vermitteln. Die Globalisierung ebenso wie die ungezügelte Datenflut im Rahmen der Digitalisierung verstärken die Verunsicherung. Das Vertrauen in unser Wirtschaftssystem ist nicht erst seit der großen Weltfinanzkrise 2018/2019 ins Wanken geraten. Selbst in Ländern wie Deutschland ist ein erschreckendes Ausmaß an Armut und prekären Arbeitsverhältnissen zu beobachten. Die Plastikvermüllung der Meere hat ein unglaubliches Ausmaß angenommen. Anzeichen, dass der Klimawandel mit seinen Folgen – unter anderem: Anstieg des Meeresspiegels, Artensterben, Extremwetterereignisse, Wüstenbildung durch Übernutzung und Dürre – noch substanziell zu mildern ist, sind nicht oder kaum zu erkennen. Da besonders die ärmeren und wirtschaftlich eher schwachen Länder von den Folgen betroffen sein werden, muss mit zunehmenden Konflikten und Verteilungskämpfen um die knapper werdenden Ressourcen unseres Planeten gerechnet werden. In der Folge sind gewaltige Migrationsbewegungen zu erwarten, die das, was wir bisher erlebt haben, weit übertreffen werden. Für die bereits 1972 von D. L. und D. H. Meadows veröffentlichte MIT-Studie Die Grenzen des Wachstums wurden Berechnungen durchgeführt, die besagen, dass unter den Bedingungen des Standard Run, d. h. der Annahme, dass die Menschheit einfach so weitermacht wie bisher, die menschliche Zivilisation notwendigerweise zusammenbrechen muss – und zwar innerhalb der nächsten 100 Jahre. Göpel2 berichtet, die Studie sei immer wieder aktualisiert und überprüft, aber nicht grundsätzlich widerlegt worden.
Die dargestellten Befunde sind nur ein kleiner, allgemein bekannter Ausschnitt und könnten noch in vielfältiger Weise ergänzt werden. Sie sind keineswegs neu und für niemanden überraschend. Seit Jahrzehnten liefern die Wissenschaften dramatische Ergebnisse und Prognosen, die sich alle im Wesentlichen bestätigt haben. Auch ist weitgehend unbestritten, dass durchgreifende Änderungen getroffen werden müssen, um die Folgen des Klimawandels zumindest einzugrenzen. Selbst darüber, welche Maßnahmen vordringlich zu ergreifen sind, gibt es kaum einen gravierenden Dissens. Das Überraschende ist nur: Diese Maßnahmen werden von der Politik – wenn überhaupt – nur sehr zögerlich angegangen, und es gibt nur kleine Gruppen in der Bevölkerung, die Druck machen, während andere eher bremsen. Die meisten Menschen ignorieren aber schlicht die Befunde und auch die nicht mehr zu übersehenden Signale, auch wenn das zunehmend schwieriger wird.
Warum ist das so? Zunächst bietet sich die naheliegende Überlegung an, dass niemand gerne deutliche Änderungen in seinem Lebensstil vollzieht, wenn er sich nicht dazu gezwungen fühlt. Und dieser Zwang wirkt zumeist erst dann, wenn die Folgen des Nichtdarauf-Reagierens unmittelbar vor Augen stehen. Auch sind alle Szenarien, die mit dem Erleben von Verlust und Einschränkungen verbunden sind, verständlicherweise nicht besonders verlockend. Und schließlich löst das Bedrohungsszenario Gefühle der Hilflosigkeit aus, die bekanntlich oft durch Verdrängungsmechanismen »bewältigt« werden. Andererseits: Für ihre Kinder und Enkel setzen sich die Menschen heutzutage in der Regel bereitwillig und oft sehr engagiert ein und sorgen sich um deren Wohlergehen und Zufriedenheit. Und doch zeigen sie kaum eine Bereitschaft, sich für den Schutz unseres Planeten einzusetzen, damit dieser ihren Kindern und Enkeln noch ein gutes Leben ermöglichen kann.
Dieses auch von anderen Autoren wahrgenommene Gesamtphänomen muss einen tieferen Grund haben, ohne den das Verhalten des heutigen Menschen nicht erklärbar ist. Und der liegt meines Erachtens in dem anthropozentrischen Selbst- und Weltbild des Menschen, das die offensichtlich zu Ende gehende Epoche des Individualismus geprägt hat. Die Idee des Individuums, mit der es sich – Gott gleich – mehr und mehr zum Maßstab aller Dinge machte, hat der europäische Mensch etwa im 12. Jahrhundert erfunden. Er hat den Auftrag des Alten Testamentes aufgegriffen, sich die Erde und alles, was darauf »kreucht und fleucht«, untertan zu machen. Dieses Menschenbild, das im weiteren Verlauf dieses Beitrags noch näher skizziert werden soll, hat außerordentliche Kräfte freigesetzt und eine imposante technische Entwicklung möglich gemacht. Sein linear-kausales Denken wurde zum dominanten Modell; denn es war sehr erfolgreich.
Ein ökologisches Denkmodell demgegenüber, das Zusammenhänge und wechselseitige Abhängigkeiten wahrnimmt und berücksichtigt, ist dem Menschen mit einem individuumzentrierten Weltbild fremd. Er ist dafür sozusagen blind. Auch Ideen von Zusammenleben und Kooperation gerieten im Verlauf der neun Jahrhunderte in den Hintergrund zugunsten des spätestens im letzten Jahrhundert zunehmend vorrangig in Erscheinung tretenden Ziels der Selbstverwirklichung. Hinzu kam, dass der Mensch in der Epoche des Individualismus den gleichmäßig und unerbittlich voranschreitenden linearen Zeitstrahl zum einzig gültigen Zeitkonzept erkor. Aufgrund dessen fühlt sich der sich selbst verwirklichende Mensch heute stetig angetrieben, dem obersten Ziel, seinem individuellen Glück, hinterherzulaufen und ja nichts zu verpassen, denn das Verpasste kommt ja nicht wieder. Dieser Mensch hat keine Zeit und darf nicht verweilen. Zweifel an dem Sinn seines Tuns und die Wahrnehmung der Folgen seines Verhaltens würden ihn nur aufhalten, sodass er sein Glück verfehlen könnte.
Solange der Mensch sich von diesem individuumzentrierten Selbst- und Weltbild dominieren lässt, wird er nicht in der Lage sein, die anstehenden notwendigen Veränderungen seines Handelns vorzunehmen. Denn er ist ganz auf sich und seinen persönlichen Vorteil konzentriert, hat keinen Blick für übergreifende Zusammenhänge und die Notwendigkeit weltweiter Kooperation. Die primäre, dringend anstehende Veränderung muss also sein, dass der Mensch ein neues Verständnis von sich und seinem Leben in der Welt entwickelt, das heißt, dass der Mensch sich neu erfindet, so, wie er dies vor etwa 900 Jahren schon einmal getan hat.
Um die vielfältigen Dimensionen dieses gesellschaftlichen Umbruchs besser verstehen zu können, lohnt ein Blick zurück. In der Zeit vom 11. bis zum 13. Jahrhundert n. Chr. haben unsere Vorfahren in Europa eine ähnliche Transformation geleistet, als sie die Idee des Individuums erfanden, mit der Konstruktion von Räderuhren eine lineare Zeitvorstellung zum dominanten Modell von Zeit machten, als sie den dreidimensionalen Raum und die Perspektive entdeckten und den länderübergreifenden Handel mit Gütern zu einem Wirtschaftssystem ausbauten, das im Verlauf der Jahrhunderte zu der die Gesellschaft bestimmenden Kraft wurde.
Demgegenüber hatte der Mensch im Frühmittelalter, also in der Zeit etwa von 450 bis 1050 n. Chr., ein völlig anderes Verständnis von sich und der Welt, in der er lebte. Sein Blick war geprägt durch eine – wie wir es heute formulieren würden – ganzheitliche ökologisch-systemische Perspektive. Der Einzelne erlebte sich als Teil einer größeren Ordnung und Gemeinschaft, von der er abhängig war, die seinem Leben und seinen Handlungen Sinn verlieh und die seine Verhaltensmöglichkeiten bestimmte.
Dieser Blick zurück soll deutlich machen, dass unser heutiges Menschenbild und die Art, wie wir die Dinge betrachten, wie wir Raum und Zeit verstehen, die materiellen Güter verteilen, die Wirtschaft und unser Rechtssystem organisieren, keinesfalls so selbstverständlich sind, wie wir das unterstellen. Das heißt: Es soll erkennbar werden, dass der Mensch und seine Beziehung zur Umwelt auch völlig anders gedacht werden kann.
Dieser Idee folgt der Aufbau des Buches:
In Teil 1 wird die Andersartigkeit des Welt- und Selbstbilds des frühmittelalterlichen Menschen geschildert. Trotz der nahezu unüberwindlichen Fremdheit soll versucht werden, zumindest eine Ahnung vom Denken und Erleben des Menschen in der damaligen Zeit zu wecken. Damit soll deutlich werden, dass das heutige Verständnis des Menschen von sich und der Welt keineswegs unverrückbar und selbstverständlich ist. Das heißt: Wir können uns neu erfinden.
In Teil 2 wird auf diesem Hintergrund die Dramatik der epochalen Wende im 11. bis 13. Jahrhundert geschildert, die sich mit der Erfindung des Individuums vollzog. Es werden die wichtigsten Aspekte des Umbruchs im Selbst-Bewusstsein der Menschen aufgeführt, um zu verdeutlichen, wie damals in einer relativ kurzen Periode die Grundideen unserer heutigen Sicht auf uns selbst und auf die Welt erfunden wurden.
In Teil 3 wird dargestellt, dass sich auch heute die typischen Kennzeichen einer Umbruchphase zeigen, die nach meiner Überzeugung nur dann erfolgreich bewältigt werden kann, wenn der Mensch ein neues Bild von sich und seiner Beziehung zu der Welt, in der er lebt, entwickelt. Nur dann wird er bereit und in der Lage sein, die notwendigen Schritte zum Erhalt einer lebensfreundlichen Umwelt auf unserem Planeten zu machen. Das heißt: Wir müssen uns neu erfinden.
In Teil 4 werden schließlich einige aktuelle Ideen und Konzepte erörtert, die nach meiner Überzeugung Teil eines neuen Selbst- und Weltbildes werden sollten oder zumindest den notwendigen Weg dahin bahnen können.
Den Menschen im 11. bis 13. Jahrhundert ging es wie uns heute: Sie erlebten den Zusammenbruch des bis dahin dominierenden Weltbildes und standen vor der Aufgabe, eine neue Idee von sich und ihrer Beziehung zur Welt zu entwickeln, die die eigenen Vorstellungsmöglichkeiten überstieg und für die es auch noch keine Sprache gab. Die Leistung, die damals gelungen ist, hat eine außerordentliche kulturelle, technische und wirtschaftliche Entwicklung ermöglicht. Sie hat aber auch viele Schattenseiten mit sich gebracht: Klimakrise, soziale Ungerechtigkeit und gesellschaftliche Spaltung sind nur die offensichtlichsten Stichworte. Wir sind heute aufgerufen, ein neues Bewusstsein unserer selbst und der Beziehung zu unserer Lebensumwelt zu entwickeln, ohne genau zu wissen, wie das aussehen wird. Wir müssen in eine unbekannte Zukunft navigieren, deren Umrisse sich jedoch in Teilen bereits abzeichnen.
1Selbstbild und Weltbild des europäischen Menschen im Frühmittelalter
Vorbemerkung
Im Folgenden soll ein Eindruck davon vermittelt werden, wie die Menschen in Mitteleuropa zur Zeit des Frühmittelalters sich selbst in ihrem Bezug zu ihrer Umwelt gesehen und verstanden haben. Die Darstellung erfolgt gegliedert nach unterschiedlichen Komponenten dieses Selbst- und Weltbildes wie: »das Selbstbild des Menschen«, »die Sicht auf die Natur, die Dinge, die Umwelt«, »die Wissenschaft«, »Ethik und Recht«, »das Erleben der Zeit« und »das Erleben des Raums«. Diese Darstellungsform widerspricht im Grunde genommen dem wichtigsten Charakteristikum der frühmittelalterlichen Kultur, die sich dadurch auszeichnet, dass alles mit allem verbunden ist und sich das eine durch das andere, das andere durch das eine erklärt. Sie ist trotzdem gewählt worden, weil sie sich an die in unserer heutigen Kultur verwurzelten Leserinnen und Leser wendet, die umfangreichere Darstellungen leichter erfassen, wenn das Ganze in unterschiedliche Aspekte gegliedert und diese getrennt voneinander analysiert werden. Sie dient – so die Hoffnung – dem besseren Verstehen seitens des durch die Epoche des Individualismus geprägten Adressaten.
Grundsätzlich stößt die Darstellung des frühmittelalterlichen Selbst- und Weltbildes auf drei nicht geringe Schwierigkeiten:
1Das Korsett der aktuellen Sprache beim Beschreiben einer völlig andersartigen Selbst- und Weltsicht des Menschen
Es ist nicht leicht, über eine Kultur zu sprechen und zu schreiben, in der die Menschen ein anderes Selbst- und Weltbild hatten. Um einer solchen Zeit gerecht zu werden, setzt das voraus, die eigene Sichtweise und die eigenen Wert- und Bewertungsmaßstäbe zurückzustellen und sich für die Beschreibung einer anderen Art und Weise zu öffnen, sich selbst, die anderen und die Dinge der Umwelt wahrzunehmen. Das ist nicht zuletzt auch deshalb schwierig, weil unsere Sprache nicht ein neutrales Werkzeug ist, sondern unsere heutigen Perspektiven und Maßstäbe in sich trägt und unser Denken und Wahrnehmen prägt. Kriz verweist auf »die mit der Sprache ›selbstverständlich‹ vermittelten Bedeutungsbilder, Prinzipien, Regeln, Verstehensweisen, Appelle, Lebens- und Handlungsanweisungen«. Und er fährt fort:
»Doch obwohl diese innerhalb einer bestimmten Kultur typisch sind und zwischen unterschiedlichen Kulturen … stark differieren können, werden sie im Alltag üblicherweise nicht nur nicht hinterfragt, sondern meist auch gar nicht bemerkt.«3
Mit dieser Problematik setzt sich auch Gurjewitsch zu Beginn seines Werkes über das Weltbild des mittelalterlichen Menschen intensiv auseinander und formuliert:
»Das uns innerlich fremde System von Ansichten und der uns fremde Gedankenaufbau, die in jener Epoche herrschten, sind nur mit Mühe dem modernen Bewusstsein zugänglich. … Wenn wir die Vergangenheit, ›wie es eigentlich gewesen‹, begreifen wollen, dann müssen wir danach streben, an sie mit den ihr adäquaten Kriterien heranzugehen, sie immanent zu studieren, ihre eigene innere Struktur zu erschließen, und uns davor hüten, ihr unsere modernen Auffassungen und Einschätzungen aufzuzwingen.«4
Ein unzureichendes Bemühen, die eigenen Denkmuster und Wertmaßstäbe zumindest zunächst einmal zurückzustellen und dem Andersartigen mit möglichst vorurteilsfreiem Interesse und Neugier zu begegnen, sieht er als wesentlichen Grund dafür, dass gerade das Frühmittelalter in vielen Darstellungen als dunkle und eher primitive Epoche abgewertet wird und viele Berichte über das Leben dieser Zeit dem damaligen Weltbild in keiner Weise gerecht werden.
Aber obwohl sich Gurjewitsch dieses Problems bewusst ist und er es auch im Verlauf seines Buches wiederholt thematisiert, finden sich doch auch bei ihm immer wieder Formulierungen, die aus der Sicht des heutigen Beobachters (und Beurteilers) als Negativ-Beschreibungen formuliert sind, beispielsweise: »Der [frühmittelalterliche] Mensch ist offensichtlich noch nicht in der Lage, … [sich selbst als ein sich entwickelndes, einzigartiges Wesen zu erkennen]« oder: »So ist das Verhältnis des Menschen zur Natur im Mittelalter nicht … [das Verhältnis des Subjekts zum Objekt]« oder »Der Mensch erkannte sich nicht … [als autonome Individualität]«.
In ähnlicher Weise spiegelt sich das Problem der Sprache in der Formulierung von der Entdeckung des Individuums (so beispielsweise der Titel der Monografie von van Dülmen 1997) im Hoch- und Spätmittelalter. Denn mit dieser sprachlichen Wendung vom »Entdecken« wird implizit ausgedrückt, dass da etwas schon lange oder bereits immer Bestehendes gefunden, aufgespürt oder ausgegraben wurde. Man »entdeckt« beispielsweise bislang noch nicht bekannte Vogelarten oder aber alte Siedlungsreste, die lange im Boden verborgen waren.
Derschka problematisiesrt diesen Begriff der Entdeckung des Individuums in dieser Epoche, der sich in der Geschichtswissenschaft durchgesetzt hat, in ähnlicher Weise, wenn er schreibt:
»Das deutsche Wort ›entdecken‹ bedeutet … das (Wieder-)Auffinden eines Gegenstands oder eines Sachverhaltes, der bislang existent, aber der erkennenden Aufmerksamkeit verborgen war. Entdeckungen dieser Art können auftreten, wenn ein noch unerforschter Urwald nach Insekten durchsucht oder ein besonders starkes Teleskop auf den Sternenhimmel gerichtet wird; mithin kommen sie geläufig im Kontext normaler naturwissenschaftlicher Forschung vor. Für Entdeckungen dieser Art ist es bezeichnend, dass sie nicht unerwartet kommen und dass ihre Klassifikation keine allzu großen Schwierigkeiten bereitet. Daneben kennt die Wissenschaftsgeschichte eine Reihe ›großer‹ Entdeckungen, durch welche nicht nur die Welt der Objekte vermehrt, sondern ganz besonders unser Blick auf die Dinge verändert wurde, etwa die Entdeckung des Nikolaus Kopernikus, dass die Sonne und nicht die Erde den Mittelpunkt unseres Sonnensystems bildet.«5
Die Geschichtswissenschaft hat lange Zeit die Entwicklung der Wissenschaft als ein ständiges Voranschreiten durch eine Aneinanderreihung derartiger kleiner und großer Entdeckungen dargestellt, die kumulativ den modernen Wissensbestand aufgebaut haben. Dieser Sicht liegt unser heutiges lineares Fortschrittsmodell zugrunde, das die Idee von der »Entdeckung des Individuums« nahelegt. Viele heutige Wissenschaftler gehen eher unreflektiert und »selbstverständlich« davon aus, dass ein komplexeres Weltbild auf einem einfachen, »primitiven« Erkennen und Denken aufbaut, und sehen eine solche Entwicklung als nahezu zwangsläufig an. In der Betrachtung eines anderen Selbst- und Weltbildes, einer anderen Kultur, wird unterstellt, dass beispielsweise unsere heutige Sicht auf den Menschen als ein Individuum nicht nur selbstverständlich, sondern auch »richtig«, im Grunde die einzig mögliche ist.
Der Begriff des »Entdeckens« wird aber dem von den Geschichtswissenschaftlern geschilderten Geschehen im 12. und 13. Jahrhundert nicht gerecht. Er ist auch dann nicht zutreffend, wenn man wie Derschka zwar eine einfache Entdeckung verneint, diesen Begriff aber offensichtlich für sinnvoll zur Bezeichnung eines längeren Prozesses hält, »in dessen Verlauf sich Menschen ihrer und ihrer Mitmenschen Individualität bewusst wurden und diesen Zustand zu artikulieren begannen«.6 Denn auch mit dieser Formulierung wird unterstellt, dass es da – offensichtlich unbewusst – etwas gegeben hat, das ins Bewusstsein aufsteigen und dann ausgesprochen werden konnte. Damit gerät man jedoch in den Bereich willkürlicher Spekulationen.
Denn bei Betrachtung des Menschen- und Weltbildes im Frühmittelalter wird man – wie noch zu zeigen sein wird – keine Ansätze entdecken können, die im Hochmittelalter nur weiterentwickelt werden mussten. Vielmehr traten in dieser Zeit Ideen auf, die nicht vorgeprägt waren und die grundsätzlich auch ganz anders hätten ausfallen können. Die oftmals vertretene Kontinuitätsidee einer Entwicklung des Selbst- und Weltbildes vom Frühmittelalter bis in die Gegenwart ist eben ein typisches Merkmal unseres heutigen Denkens. Dies ist – wie schon gesagt – entscheidend geprägt durch die Vorstellung, dass sich alle Komponenten einer Kultur vom Einfachen zum Komplexen, vom Primitiven zum Hochstehenden entwickeln und dass die ganze Welt durch diesen ständigen Fortschritt geprägt wird.
Eine deutliche Gegenposition zu dieser Annahme im Hinblick auf die Rechtsgeschichte vertritt Viktor Achter in seinem Buch Geburt der Strafe:
»Wenn allerdings die Meinung vertreten wird, dass es von Anbeginn des uns bekannten germanischen (und später frühmittelalterlichen) Rechts bereits Ansätze zu einer Strafe im heutigen Sinn* gegeben habe, dass sich aus ersten Anfängen dieser Begriff allmählich in steigendem Maße ›entwickelt‹ habe, wer insoweit also hinsichtlich des Rechts ›entwicklungsgläubig‹ ist, dem muss ich vorweg meine grundsätzlich andere Ansicht bekennen. Weder sehe ich solche ›Ansätze‹, noch eine ›Entwicklung‹. Ich sehe vielmehr eine Zeit, in der es eine Strafe nicht gab, auch keine Ansätze zu ihr. Das Recht war damals etwas grundsätzlich anderes, als es später wurde. Und weiter sehe ich eine Zeit, in der das Recht anders geworden ist** und dann allerdings schon viele Ansätze zeigt, die sich im heutigen Recht wiederfinden. In jener Zeit sehe ich auch den Begriff der Strafe. Aber zwischen dem einen und dem anderen gibt es keine ›Entwicklungsreihe‹. Das Neue ist etwas grundsätzlich anderes, ein aliud.«7
Ganz offensichtlich wurde im Hochmittelalter eine neue Idee über das Wesen des Menschen entwickelt und ein neues und bis dahin zumindest in Mitteleuropa nicht bekanntes Selbst- und Weltbild des Menschen geschaffen und konstruiert, das sich in alle Bereiche des Alltagslebens auswirkte, ebenso wie es das Recht und die Wissenschaft prägte. Es wurde die Vorstellung des einzelnen Menschen als eines autonomen Subjekts erdacht, das sich von den ihn umgebenden Dingen distanziert und sie getrennt von seiner Person als Objekte betrachtet. Das heißt: Es wurde die Idee des Menschen als Individuum erfunden.
Diese sprachliche Differenz zwischen »Entdecken« und »Erfinden« ist von nicht unerheblicher Bedeutung: Etwas »Entdecktes« ist für ewige Zeiten offengelegt und wird weiterbestehen. Demgegenüber kann etwas »Erfundenes« durch etwas ersetzt werden, was man neu erfindet, beispielsweise weil das Bisherige sich als Auslöser für viele unerwünschte und gefährliche Entwicklungen erwiesen hat. Und genau von dieser Aufgabe des Menschen, sich neu zu erfinden, handelt dieses Buch.
Dass im Hochmittelalter ab dem 12. Jahrhundert nichts Selbstverständliches erfunden wurde, soll der Anthropologe Clifford Geertz bezeugen, der nach Derschka »die abendländische Vorstellung von der autonomen Person (für) eine kulturelle Ausnahmeerscheinung«8 hält. In dem Kapitel »Aus der Perspektive des Eingeborenen« seines Buches Dichte Beschreibung formuliert er:
»Die abendländische Vorstellung von der Person als einem fest umrissenen, einzigartigen, mehr oder weniger integrierten motivationalen und kognitiven Universum, einem dynamischen Zentrum des Bewusstseins, Fühlens, Urteilens und Handelns, das als unterscheidbares Ganzes organisiert ist und sich sowohl von anderen solchen Ganzheiten als auch von einem sozialen und einem natürlichen Hintergrund abhebt, erweist sich, wie richtig sie uns auch scheinen mag, im Kontext der anderen Weltkulturen als eine recht sonderbare Idee. Statt zu versuchen, die Erfahrungen anderer in den Rahmen unserer Vorstellung einzuordnen …, müssen wir, um zu einem Verstehen zu gelangen, solche Vorstellungen ablegen und die Erfahrungen anderer Leute im Kontext ihrer eigenen Ideen über Person und Selbst betrachten.«9
2Das Mittelalter – eine Zeit mehrerer, sehr unterschiedlicher Epochen
Das Mittelalter ist eine Periode in der mitteleuropäischen Geschichte, die nicht als eine einheitliche Epoche aufgefasst werden kann, sondern in drei sehr unterschiedliche Zeitspannen zu gliedern ist. Die ersten ca. 600 Jahre von der Mitte des 5. Jahrhunderts n. Chr. bis zur Mitte des 11. Jahrhunderts werden heute als Frühmittelalter bezeichnet. Zwei bedeutsame Ereignisse gehen dem voraus: zum einen die Völkerwanderungen, zum anderen der Zerfall des Römischen Reichs mit der Absetzung des letzten römischen Kaisers im Jahre 476. Damit wurde das Christentum in Mitteleuropa zur einzigen ordnenden Kraft. Und man kann wohl sagen, dass das Christentum dafür sorgte, dass sich während der gesamten Zeit des frühen Mittelalters Entwicklungen und Veränderungen vergleichsweise langsam vollzogen und die Menschen über ein stabiles Selbst- und Weltbild verfügten.
Die zwei darauffolgenden Jahrhunderte von ca. 1050 bis 1250 werden als Hochmittelalter bezeichnet. Es ist die Zeit, in der nahezu im gesamten Abendland ein großer Umbruch und ein tiefgreifender Wandlungsprozess stattfanden. Er erfasste alle Lebensbereiche und führte zu einer Veränderung der frühmittelalterlichen Gesellschaft, die sich in neuen Lebens- und Bewusstseinsformen zeigt. Das Hochmittelalter war eine Zeit großer Verunsicherungen und Unruhen, die sich unter anderem in den sogenannten Besessenheitsepidemien äußerten; zugleich lösten neue Ideen und ein neues Selbstverständnis zunächst Einzelner eine sehr dynamische Entwicklung aus.
Im Zusammenbruch der Herrschaft der Staufer in der Mitte des 13. Jahrhunderts (1250) sieht die Forschung dann den Übergang vom Hochmittelalter zum Spätmittelalter, in dem der Bewusstseinswandel einen Großteil der Bevölkerung erfasste und die Idee vom »neuen Menschen«, vom Individuum, sich weiter ausbreitete und ausdifferenzierte, eine Idee, die dann zum Träger der Entwicklung bis in unsere heutige Zeit wurde. Es ist diese Zeit des Spätmittelalters mit seinen Städten und Ritterburgen, die heute das Bild vom Mittelalter prägt und an die die meisten zeitgenössischen Menschen denken, wenn über diese Epoche gesprochen wird.
Obwohl das Mittelalter diese ganz unterschiedlichen Zeitspannen umschließt, werden in vielen historischen Darstellungen diese Epochen nicht deutlich unterschieden. Es werden vielmehr oft Aussagen über das Mittelalter gemacht, was zwangsläufig zu verschwommenen und in sich widersprüchlichen Darstellungen führt. Zudem wecken die Zeiten des Hochmittelalters und des Spätmittelalters aufgrund ihrer größeren Dynamik und der vielen, damals neu aufkommenden Ideen häufig ein deutlich größeres Interesse der Forscher als das Frühmittelalter, was diese Unklarheiten noch verschärft, sodass die unterschiedlichen Weltbilder der Menschen im Mittelalter nicht klar herausgearbeitet werden.
3Der geringe Umfang des Quellenmaterials
Der Umfang der uns aus dem Frühmittelalter überkommenen Schriften ist gering. Das hängt damit zusammen, dass nur ein verschwindend geringer Teil der Menschen dieser Epoche das Lesen und Schreiben beherrschte. Selbst unter den Adligen und den Klerikern waren diese Fähigkeiten nicht weit verbreitet, am ehesten noch unter den Mönchen, von denen die meisten die Klosterschulen besuchten. Zudem wollen viele Texte, beispielsweise die verbreiteten Heiligenviten, das Idealbild eines gottgefälligen Lebens darstellen und sind damit nur bedingt geeignet, eine Vorstellung von dem tatsächlichen Leben der Menschen im frühen Mittelalter zu vermitteln.
Die ständisch-feudale Gesellschaftsordnung
In der folgenden Darstellung wird versucht, auf alle Formulierungen zu verzichten, die Vergleiche mit dem beinhalten, das als Neues in der Umbruchphase des Hoch- und Spätmittelalters erfunden wurde und die Basis für unser aktuelles Menschen- und Weltbild ausmacht. Diese Darstellungsweise führt zwar zu deutlich eingeschränkten Beschreibungen, nicht zuletzt bei den Zitaten aus der Literatur. Sie geschieht aber in der Hoffnung, dass es dadurch gelingt, ein Bild der Eigenständigkeit dieser Zeit zu entwerfen, was nur schwer möglich ist, wenn das Charakteristische durch Vergleiche mit unserer heutigen Weltsicht herausgearbeitet wird. Vielleicht gelingt es dem Leser dann zumindest für kurze Zeit, den vergleichend wertenden Blick zurückzustellen, der leicht zu einer vorwiegend defizitorientierten Sicht auf das Menschen- und Weltbild des Frühmittelalters führt.
Die frühmittelalterliche Gesellschaft ist eine Ständegesellschaft. Sie ist hierarchisch geordnet. Jeder bekommt durch die Geburt seinen ihm zustehenden Platz zugewiesen. Es gibt drei Stände: den Klerus, den Adel und die Bauern. Innerhalb dieser Stände bestehen wiederum hierarchisch geordnete Binnendifferenzierungen.
Die Kirche bestimmt umfassend über das Leben der Bevölkerung. Der Glaube ist für die Menschen extrem wichtig, denn sie fürchten sich sehr vor dem Tod und dem Fegefeuer. Die höheren Vertreter der Kirche sind der Papst, die Erzbischöfe und die Bischöfe. Dem niederen Klerus gehören die Dorfpfarrer, die Prediger und die Wanderprediger, zudem die Mönche und die Nonnen an.
Der Adel ist ein sozial, rechtlich und politisch privilegierter Stand. Seine Rechte gründen sich auf Geburt, Besitz und zuweilen auch besondere Leistungen. Die adlige Führungsschicht ist sehr klein. Königsnähe und Besitzumfang spielen für das adelige Standesbewusstsein eine wichtige Rolle. Ebenso wie die höheren Kleriker gestalten die Adligen ihr Leben zumeist sehr prunkvoll.
Die Epoche des frühen Mittelalters ist geprägt durch die Agrarwirtschaft. Der Anteil der Bauern an der Bevölkerung liegt bei etwa 90 Prozent. Ihre Arbeit bildet die Lebensgrundlage der Gesellschaft.
Diese ständische Struktur der Gesellschaft ist für das Frühmittelalter sehr charakteristisch und wird von keiner Seite hinterfragt.
»Der Begriff der Gliederung der Gesellschaft in Stände durchdringt im Mittelalter alle theologischen und politischen Betrachtungen bis in ihre Fasern. Er beschränkt sich durchaus nicht auf die übliche Dreizahl Geistlichkeit, Adel und dritter Stand. Der Begriff Stand hat nicht nur einen größeren Wert, sondern auch eine viel umfassendere Bedeutung. Im Allgemeinen wird jede Gruppierung, jede Funktion, jeder Beruf als ein Stand angesehen, so dass neben der Einteilung der Gesellschaft in drei Stände eine in zwölf vorkommen kann. Denn Stand ist Zustand, ›estat‹, oder ›ordo‹; es liegt darin der Gedanke einer von Gott gewollten Seinsweise. … In dem schönen Bild, das man sich von Staat und Gesellschaft machte, wurde jedem der Stände seine Funktion zugewiesenen, nicht seiner erprobten Nützlichkeit, sondern seiner Heiligkeit oder seinem Glanz und Schimmer entsprechend. Man konnte dabei die Entartung der Geistlichkeit, den Verfall der ritterlichen Tugenden bejammern, ohne darum das Idealbild auch nur im mindesten preiszugeben; mögen auch die Sünden der Menschen die Verwirklichung des Ideals verhindern, so bleibt es dennoch Grundlage und Richtschnur des gesellschaftlichen Denkens. Das mittelalterliche Bild der Gesellschaft ist statisch, nicht dynamisch.«10
Im Verlauf der Jahrhunderte differenziert sich ein zweites Ordnungssystem der frühmittelalterlichen Gesellschaft heraus: der Feudalismus. Der Begriff leitet sich ab von dem lateinischen Wort feodum, einem zum Lehen (also zur Leihe) übertragenen Land, dem beneficium. Der Monarch (der Kaiser oder König), der Adel und die Kirche sind die Grundbesitzer. Sie geben bestimmte Rechte und Land (sogenannte Lehen) an Untertanen für treue Dienste weiter. Die Untertanen des Königs, die die Lehen erhalten, nennt man Vasallen. Sie dürfen das Land nutzen, müssen dafür dem König ergeben sein. Sie müssen bereit sein, zum Beispiel mit dem Feudalherrn (dem Lehnsherrn) in den Krieg zu ziehen. Den Grundherren wiederum sind die Bauern untertan. Diese bestellen das Land und schulden dafür dem Grundherren Abgaben (die Fron), sowohl in Form von Arbeitsleistungen auf dem direkt vom bzw. für den Grundherren bestellten Land (Salland) als auch in Form von Naturalabgaben, die aus demjenigen Stück Land aufgebracht werden müssen, das sie selbst bewirtschaften (Zehnt).
Die Bauern sind an die Scholle (das zu bestellende Land) gebunden (glebae adscripti) und haben nicht das Recht, sie zu verlassen, weil sie als Bestandteil der Wirtschaftsgüter des Lehnsgutes gelten. Sie müssen genügend Überschüsse erwirtschaften, um nicht nur die eigene Familie, sondern ebenfalls den Grundherren zu ernähren, der ein aufwendiges Leben führt. Die Herrschaft der Grundherren bildet den Kern der staatlichen Ordnung; der Grundherr ist oft der einzige Bezugspunkt des Bauern. Die in der Grundherrschaft zusammengeschlossenen Hörigen werden als familia des Grundherrn bezeichnet.
Nach Götz11 leben im Frühmittelalter schätzungsweise mehr als 90 Prozent der Gesamtbevölkerung auf dem Land. Das Land ist Ernährungsquelle und Existenzgrundlage sowohl der Bauern, die es bearbeiten, als auch der adligen und geistlichen Herren, die es besitzen. Das Landleben ist dementsprechend die normale, typische Lebensform, und agrarische Denkformen sind allen Schichten gemeinsam. Als Karl der Große z. B. für die Monate deutsche Namen einzuführen versucht, orientiert er diese an der landwirtschaftlichen Saison: Beispielsweise nennt man den Mai Winnemonat (Wiesenmonat), den Juni Brachmonat (zum Umbrechen des Brachlandes), den Juli Hewimonat (Heumonat).
Die Herrschaftsgebiete sind räumlich nicht exakt lokalisiert. Die Grenzen sind durchlässig und unklar. Nicht selten überschneiden sie sich. Manche Autoritäten üben im selben Gebiet gleichzeitig Herrschaft aus, die Zuständigkeiten sind häufig nicht eindeutig geklärt. Es gibt viele lokale rechtliche Teilsysteme, die sich sehr voneinander unterscheiden. Sie sind relativ eigenständig und wenig in umfassende politische und gesellschaftliche Einheiten integriert. Oft gibt es in mittelalterlichen Dörfern gleichzeitig mehrere Lehensherren. Die Könige haben keine feste Residenz, sondern zunächst mehrere sedes regiae. Man spricht von einem »Reisekönigtum«. Sie üben ihre Herrschaft, die neben Kriegszügen vor allem in der Abhaltung von Reichsversammlungen und Synoden besteht, an wechselnden Orten aus: »Der Hof« ist ständig unterwegs. Auch ihr Zuständigkeitsbereich hat eher fließende Grenzen. Westliche und geistliche Gewalt überschneiden sich: Den Königen wird eine sakrale Stellung zugestanden, den Bischöfen das Recht auf Herrschaft. Kirchenfeste werden oft für politische Handlungen genutzt.
Die Klöster bilden ein weiteres Element in der Struktur der frühmittelalterlichen Gesellschaft. Das Klosterleben stellt die bedeutendste Form des religiösen Lebens des Frühmittelalters dar, zumal es großen Einfluss auf die übrige Gesellschaft hat. Die Klöster sind weitverbreitet und voll in das gesellschaftliche Leben integriert. In einer Zeit, die große Ernährungsprobleme hat, leistet man sich Mönche, die selbst wenig produzieren und zusätzlich ernährt werden müssen, damit diese für die anderen Menschen beten. Deshalb genießt der Mönch – und in geringerem Maße auch die Nonne – ein hohes soziales Ansehen, das Klosterleben gilt weithin als die vollkommenste Lebensform überhaupt. Die Klöster sind zudem die Bewahrer der Kultur und Zentren der Bildung. Kulturelle Arbeiten werden nahezu ausschließlich in Klöstern gefertigt, etwa Kopien alter Bücher. Auf diese Weise werden bedeutende Kunst- und Kulturgüter geschaffen. Ausbildung, die weithin auf Kleriker sowie Mönche und Nonnen beschränkt ist, findet vor allem in Klosterschulen, zusätzlich noch in wenigen Domschulen der Bischofskirchen statt.
»Die Rolle der Klöster griff zwangsläufig über den Bereich des Religiösen hinaus, weil die Religion weit stärker in das Alltagsleben integriert war als heute; das Mönchtum des Mittelalters war nicht nur Bestandteil der Kirche, sondern auch der ›Welt‹, vor allem der herrschaftlichen Welt. … Auch das Kloster konnte sich, entgegen der ursprünglichen Absicht, nicht der für das Mittelalter so typischen Verschmelzung von Weltlichem und Geistlichem entziehen. Mittelalterliches Mönchtum war gewissermaßen das Herrenleben in seiner religiösen Ausprägung. … Dieser weltliche Aspekt (widersprach) dem ursprünglich religiösen Ziel und führte tatsächlich immer wieder auch zu Konflikten.«12
Es gibt unterschiedliche Gründe, in ein Kloster einzutreten. Die meisten allerdings werden – so Götz13 – nicht aus eigenem Entschluss Nonne oder Mönch, sondern bereits als Kinder von ihren Eltern in ein Kloster gegeben und dort erzogen, unter Aufsicht (custodia) und in Zucht (disciplina)