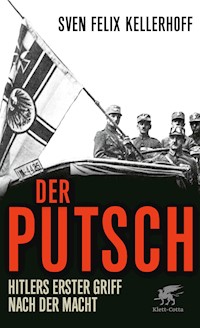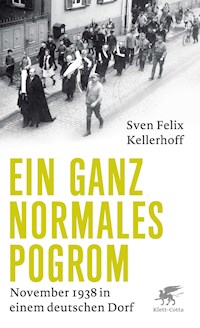19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Konrad Theiss Verlag GmbH
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Olympische Spiele 1972: Als der internationale Terrorismus nach Deutschland kam Ein »Fest des Friedens« begeistert die Weltöffentlichkeit: Deutschland ist erstmals seit 1936 wieder Ausrichter der Olympischen Sommerspiele und präsentiert sich modern und weltoffen wie nie. Die Stimmung ist ausgelassen - bis zu jenem schicksalhaften 5. September: Palästinensische Terroristen bringen mehrere israelische Mannschaftsmitglieder in ihre Gewalt. Was folgt, ist ein stundenlanges Geiseldrama, das in einem Blutbad mündet. Rund 50 Jahre nach dem Attentat in München enthüllt der Historiker und Journalist Sven-Felix Kellerhoff bislang verborgen gebliebene Details. Wie konnte es zur Katastrophe kommen, die später mit zur Gründung der legendären Spezialeinheit GSG 9 führte? - Minutiöse wie extrem packende Rekonstruktion der Geiselnahme von 1972 - Anschlag aus heiterem Himmel? Wieso der 5. September ´72 zur historischen Tragödie wurde - Neueste Erkenntnisse aus Quellen des Hauptstaatsarchivs München und bislang nicht ausgewerteten Stasi-Akten - Mit Original-Bildmaterial von der Berichterstattung und Aussagen von Augenzeugen - Von Sven-Felix Kellerhoff, Sachbuchautor und Kenner der deutschen ZeitgeschichteHätte das Olympia-Attentat verhindert werden können? Eine Chronik des Versagens Für seine minutiöse Darstellung der Ereignisse wertet Kellerhoff neue Quellen aus und bringt Licht in die Geschehnisse rund um den Terroranschlag der Gruppe »Schwarzer September«. Warum existierte, trotz vorausgegangener RAF-Aktionen, nur ein ungenügendes Sicherheitskonzept? Welche Rollen spielten die Einsatzkräfte und Entscheidungsträger während des Geiseldramas und der gescheiterten Befreiungsaktion am Fliegerhorst Fürstenfeldbruck, die 17 Menschenleben forderte? Wie reagierte der israelische Geheimdienst Mossad auf das Attentat? Erschütternd detailliert schildert Kellerhof die nervenaufreibenden Stunden des Anschlags von München 1972 und liefert neue Antworten auf die Frage nach Schuld und Versäumnissen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 302
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Die Rechtschreibung wurde durchgängig den aktuell gültigen Regeln des Duden angepasst, auch in wörtlichen Zitaten.
Die angegebenen Webseiten wurden alle mit Stand 22. August 2021 überprüft.
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über www.dnb.de abrufbar.
Das Werk ist in allen seinen Teilen urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung in und Verarbeitung durch elektronische Systeme.
wbg Theiss ist ein Imprint der wbg.
© 2022 by wbg (Wissenschaftliche Buchgesellschaft), DarmstadtDie Herausgabe des Werkes wurde durch die Vereinsmitglieder der wbg ermöglicht.
Lektorat: Kristine Althöhn, Mainz
Abb. auf S. 2: Gepanzerte Polizeifahrzeuge fahren am 5. September 1972 ins Olympische Dorf; picture-alliance/dpa
Besuchen Sie uns im Internet: www.wbg-wissenverbindet.de
ISBN 978-3-8062-4420-5
Elektronisch sind folgende Ausgaben erhältlich:
eBook (PDF): ISBN 978-3-8062-4452-6
eBook (epub): ISBN 978-3-8062-4453-3
Menü
Buch lesen
Innentitel
Inhaltsverzeichnis
Informationen zum Buch
Informationen zum Autor
Impressum
Inhalt
04:20 bis 5:22 Uhr: Überfall
VORSPIEL
1965 bis 1970: Hoffnung
1970 bis 1972: Sicherheit
26. August bis 4. September: Freude
DRAMA
05:25 bis 08:15 Uhr: Forderung
08:35 bis 11:15 Uhr: Verhandlung
11:20 bis 17:21 Uhr: Zeitgewinn
17:23 bis 21:35 Uhr: Täuschung
21:36 bis 22:34 Uhr: Falle
22:35 bis 01:32 Uhr: Katastrophe
01:45 bis 03:45 Uhr: Schock
NACHSPIEL
6. bis 18. September: Trauer
1972 bis 1981: Vergeltung
1972 bis 2022: Gedenken
Bilanz
ANHANG
Zu diesem Buch
Dank
Pläne
Personenübersicht
Abbildungsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Anmerkungen
Quellen- und Literaturverzeichnis
bis
Überfall
Die Morgendämmerung hat gerade erst begonnen – bis zum Sonnenaufgang in Oberbayern dauert es am 5. September 1972 noch etwas mehr als eine Stunde.1 Der Dienstag verspricht schön zu werden, es ist wolkenlos und windstill, die Temperatur hat nachts die 14 Grad nicht unterschritten und soll tagsüber auf angenehme 22 bis 24 Grad steigen. Neonlaternen erleuchten den Weg entlang des knapp zwei Meter hohen Maschendrahtzauns um das Olympische Dorf in Münchens Norden. Als kurz vor halb fünf Uhr einige Beamte des Olympia-Postamtes auf dem Weg zur Frühschicht hier entlang gehen, fallen ihnen junge Männer in Sportkleidung auf, die über den Zaun am verschlossenen Tor 25a klettern. Heinz-Peter Gottelt schätzt, dass es etwa zwölf Personen sind; seine Kollegen Arno Th. und Klaus-Dieter Sch. erinnern sich an sieben bis acht, Hans La. an zwei Gruppen von jeweils vier bis fünf Mann. Die Postbeamten denken sich dabei wenig – es handelt sich wohl wieder um Sportler, die nach einer langen Nacht zurück zu ihren Quartieren streben und nicht an einem der nachts geöffneten, aber kontrollierten Eingänge auffallen wollen.2
Ungefähr zur gleichen Zeit bereiten sich im Revier des Ordnerdienstes Gertrud Lau. und ihr Kollege Johannes Lu. auf ihre nächste Fußstreife vor. Die 36-jährige Kriminalobermeisterin und der wenig ältere Kriminaloberkommissar haben Nachtschicht. Sie tragen hellblaue Kleidung und weiße Baskenmützen; bewaffnet sind sie nicht. Beides ist Teil des Sicherheitskonzeptes für die XX. Sommerspiele, das jede Erinnerung an die martialischen Uniformparaden der Spiele von Berlin 1936 vermeiden soll. Fast alle Angehörigen des rund 2000 Personen starken Ordnerdienstes auf dem Olympia-Gelände sind erfahrene Polizeibeamte und aktive Polizeisportler. Doch sie sollen nicht wirken wie Sicherheitskräfte und sind für die Dauer der Spiele formal auch nicht dem Münchner Polizeipräsidenten unterstellt, sondern dem Ordnungsbeauftragten des Organisationskomitees. Einen Unterschied bedeutet das nicht, denn beide Funktionen übt in Personalunion derselbe Mann aus, der Jurist Manfred Schreiber. Jede Fußstreife hat ein tragbares Funkgerät bei sich. Gegen halb fünf Uhr morgens machen sich Gertrud Lau. und Johannes Lu. auf den Weg durch das Olympische Dorf.3
Die beiden Beamten bekommen nicht mit, dass wenige Minuten später acht junge Männer das Treppenhaus zum Haus Connollystraße 31 betreten, in dem drei Viertel der Olympia-Delegation Israels untergebracht sind. Die Trainingsanzüge, in denen sie zuvor über den Zaun geklettert sind, haben sie gegen mitgebrachte Straßenkleidung ausgetauscht; aus den Sporttaschen hat jeder ein Sturmgewehr vom Typ Kalaschnikow genommen. Sie schleichen zuerst die Treppen hinauf bis in den zweiten Stock, stellen dort aber an den Namensschildern an einem Apartment fest, dass hier offensichtlich Asiaten wohnen (es handelt sich um Sportler aus Hongkong). Die Bewaffneten kehren um und lesen am Apartment Nr. 1 links im Erdgeschoss jüdisch klingende Namen. Die Tür ist nur zugezogen, nicht verriegelt.4
Was Tuvia Sokolsky aus dem Schlaf reißt, kann er nicht genau sagen. Jedenfalls sieht der Trainer der israelischen Gewichtheber gegen 4:45 Uhr noch aus seinem Bett, wie sich Josef Gutfreund, als Kampfrichter im Ringen ebenfalls Mitglied der Delegation, von innen gegen die Wohnungstür stemmt. Sokolsky springt auf, schlüpft in eine herumliegende Hose und flüchtet, als sich ein Gewehrlauf durch den Türspalt schiebt, über die rückseitige Terrasse aus der Wohnung. „Freunde, haut ab!“, hört er Gutfreund noch rufen, dann fallen Schüsse und jemand schreit.5 Der 30-jährige Trainer rennt in Richtung eines erleuchteten Fensters und eine Treppe hinab.
Plötzlich stößt der kleine, kompakte Mann mit jemandem zusammen – es ist der Wehrpflichtige Raoul Lei., der schon seit etwa einer halben Stunde in der Connollystraße wartet. Er ist als Fahrer der Olympia-Mannschaft der Bahamas zugeordnet und soll an diesem Morgen zwei Sportler abholen, um sie zum Flughafen München-Riem bringen, wo sie die Frühmaschine nach London nehmen wollen; doch die beiden haben sich offensichtlich verspätet. Lei. strauchelt, hat aber keine Zeit für Ärger, denn schon hört er eine schreckerfüllte Stimme, die stammelt: „Schießen, schießen, mein Freund tot! Polizei rufen!“ Raoul Lei. eilt mit Tuvia ins nächstgelegene Haus und klingelt dort einen Bewohner aus dem Bett – hier wohnen südkoreanische Sportler. Einer lässt ihn ans Telefon, um den Notruf der Polizei zu wählen. Dann geht er die wenigen Meter zurück zum Haus Connollystraße 31 und öffnet die Tür zum Treppenhaus. Sofort tritt ihm ein Mann mit Sturmgewehr entgegen und sagt in gebrochenem Englisch etwa: „Stehen bleiben, nicht hereinkommen, raus, raus!“6 Raoul Lei. sieht, dass er nichts tun kann, und zieht sich ins Nachbarhaus zurück, um noch einmal mit der Polizei zu telefonieren. Plötzlich knallt es wieder, und Tuvia Sokolsky schließt sich verängstigt in die Toilette der Koreaner ein.
Im israelischen Quartier haben inzwischen mehrere Bewaffnete die Bewohner des Apartments Nr. 1, neben Gutfreund die Trainer Moshe Weinberg, Kehat Shorr, André Spitzer und Amitzur Shapira sowie den Gewichtheber-Richter Yaakow Springer, unter ihre Kontrolle gebracht. Sie zwingen den an der linken Wange angeschossenen Weinberg, sie zu weiteren israelischen Sportlern zu führen.7 Irgendwie schafft er es, die Angreifer zur Wohnung der Schwerathleten zu lenken, dem Apartment Nr. 3 – hier schlafen die Gewichtheber Josef Romano, David Mark Berger und Zeev Friedman sowie die Ringer Eliezer Halfin, Mark Slavin und Gad Tsabari.8 In der Wohnung Nr. 2 sind sechs weitere Athleten aus Israel untergebracht, je zwei Schützen und Fechter sowie ein Schwimmer und ein Geher; an ihrer Tür laufen die Terroristen vorbei, ebenso wie am Apartment der beiden Mannschaftsärzte.
Tsabari schreckt auf, als er lautes Knallen hört sowie direkt danach ein Klingeln, und schaut auf seinen Wecker – es ist 4:56 Uhr. Er greift sich seine Kleidung und tritt auf den Flur der Wohnung, wo er einen Araber mit Gewehr in der Hand sieht. Zusammen mit seinen Mannschaftskameraden muss er sich der Gewalt beugen und wird ins Treppenhaus geführt. Plötzlich überschlagen sich die Ereignisse. Moshe Weinberg stürzt sich auf einen der Angreifer, der sofort das Feuer eröffnet und den Trainer tötet. Tsabari erkennt seine Chance zur Flucht: Er steht den abwärts führenden Stufen zum Ausgang am nächsten und hastet auf einmal mit gesenktem Kopf hinunter. Er schafft es im Untergeschoss auf den Fahrweg hinaus und rennt die Connollystraße nach links. Hinter sich hört er noch zwei Salven, doch kann er nicht sagen, ob sie in seine Richtung abgegeben werden. Etwa gleichzeitig wirft sich im rückwärtigen Schlafzimmer des Apartments Nr. 1 der Mittelgewichtler Josef Romano mit seiner ganzen Kraft auf einen der Bewaffneten und wird erschossen – vielleicht sind es diese Kugeln, die Tsabari hört.9 Seit er aufgewacht ist, sind drei, höchstens vier Minuten verstrichen.
Die Schüsse lassen in Apartment Nr. 2 den Sportschützen Zelig Shtorch aus dem Schlaf fahren.10 Er zieht seinen Trainingsanzug an und öffnet die Tür der Unterkunft zur Connollystraße. Dort sieht er einen Mann in hellem Anzug und mit weißem Hut. Shtorch wundert sich, denn er weiß: „Der wohnt hier gar nicht. Was macht der um diese Zeit hier?“ Zwei Meter vor dem Israeli bleibt der Mann stehen und fragt auf Deutsch: „Wo ist Polizei?“ Shtorch antwortet: „Ich weiß es nicht.“ Dann sieht er sich sein Gegenüber genauer an – und ihm fällt auf, dass Handgranaten an seinem Gürtel baumeln. In diesem Moment wird dem Sportschützen klar: „Das ist ein Terroranschlag!“ Shtorch kann sich nicht umdrehen, solange ihm der Mann gegenübersteht, denn auf dem Rücken seines Trainingsanzugs steht in Großbuchstaben Israel.11
Um 4:52 Uhr ist der Notruf von Raoul Lei. bei der Notzentrale der Münchner Polizei eingegangen, und drei Minuten später informiert der diensthabende Beamte nach Rücksprache mit seinem Vorgesetzten die Kriminalwache im Olympischen Dorf, die während der Spiele für alle Straftaten hier zuständig ist. Fast gleichzeitig verlässt die Kriminalbereitschaft mit drei Streifenwagen das Polizeipräsidium; bei sich haben die sechs Beamten zwei kugelsichere Westen und eine Maschinenpistole. Doch sie müssen sechs Kilometer teilweise durch die Innenstadt zurücklegen; selbst mit Blaulicht und an einem frühen Morgen ein Weg, der mehr als zehn Minuten dauert. Schneller vor Ort in der Connollystraße ist deshalb ein Kriminalobermeister der Olympia-Wache, der – was nur während der Nachtschicht ausnahmsweise zulässig ist – mit seiner Pistole ins Dorf eilt. Um 5:02 Uhr betritt der Beamte wie zuvor Raoul Lei. das Treppenhaus des Hauses und wird wie er von einem Bewaffneten angeschrien: „Weg da!“12
Gegenüber des Hauses 31 in der Unterkunft der DDR-Mannschaft kann der Gewichtheber Stefan Grützner kaum schlafen. Er hat am Abend zuvor im Schwergewicht die Bronzemedaille gewonnen – sein bisher größter Erfolg. Gegen fünf Uhr hört er „auf der Straße Geschrei, darunter Laute in gebrochenem Deutsch. Dann knallt es, als ob einer laut Türen zuwirft.“ Als das Geschrei nicht aufhört, sieht Grützner hinaus, wird jedoch „von drüben aufgefordert, sofort zu verschwinden“.13 In einem anderen Zimmer des DDR-Quartiers schreckt der Fußballer Frank Ganzera auf, schaut aus dem Fenster und sieht „einen der Attentäter mit vermummtem Kopf und einem Maschinengewehr in der Hand“ auf dem offenen Weg zu den Wohnungen im zweiten Stock des Hauses Connollystraße 31 stehen.14
Inzwischen treffen reihenweise weitere Notrufe aus dem Olympischen Dorf bei der Polizei ein; ins Einsatztagebuch wird unter anderem geschrieben: „Es wird geschossen“ sowie „Drei Araber schießen auf Israelis in deren Unterkunft“, außerdem: „Mehrere Araber haben die Unterkunft der israelischen Sportler gestürmt, einen erschossen und einen weiteren schwer verletzt“ und schließlich: „Mehrere Geiseln befinden sich in der Hand der Terroristen.“ Damit ist klar: Es liegt ein Notstand vor. Der Schichtleiter schickt um 5:06 Uhr alle verfügbaren Streifenwagen zum Olympischen Dorf und informiert die Einsatzzentrale des Landeskriminalamtes. Anschließend gibt er die Weisung, Polizeipräsident Schreiber und dessen Stellvertreter Georg Wolf aus den Betten zu klingeln.15
Ungefähr um 5:08 Uhr erreichen Gertrud Lau. und Johannes Lu. zu Fuß das Haus Connollystraße 31; Raoul Lei. sieht sie, als er noch einmal einen Blick aus dem Nachbarhaus wagt.16 Dann geht die Haustür auf; ein Mann mit hellem Anzug, weißem Hut und seltsam verschmiertem Gesicht schaut heraus, sieht die in Hellblau gekleidete Frau und winkt sie zu sich. In der Hand hat er vier dicht mit Schreibmaschine auf Englisch beschriebene Seiten, die er Gertrud Lau. übergibt.17 Ihr ist sofort klar, dass es sich um ein Ultimatum handelt, über das die Einsatzzentrale so schnell wie möglich informiert werden muss. Da eine Frau weniger bedrohlich wirkt als ein Mann, verständigt sie sich mit ihrem Vorgesetzten Johannes Lu. darauf, dass er sich darum kümmert und sie mit dem Handfunkgerät vor dem besetzten Haus bleibt. Tatsächlich fordert der Mann mit Hut nun, dass alle Männer aus der Umgebung verschwinden sollen: Er wolle keine Polizei. Überrascht stellt die Kriminalbeamtin fest, dass er gut Deutsch spricht, mit einem nur leichten Akzent. Schleppend kommt ein Gespräch mit dem Mann zustande, der sich selbst Issa nennt. Auf die Frage von Gertrud Lau., warum während der Olympischen Spiele so ein Angriff stattfinde, antwortet er: „Revolution muss dort gemacht werden, wo sie nötig ist.“18 Es ist 5:22 Uhr.
VORSPIEL
1965 bis 1970
Hoffnung
Der Termin war ganz kurzfristig verabredet worden. Durchaus unüblich hatte Willi Daume, seit 1961 Präsident des Nationalen Olympischen Komitees Deutschlands, telefonisch um ein baldiges Treffen mit Hans-Jochen Vogel gebeten, dem sozialdemokratischen Oberbürgermeister von München. Am 28. Oktober 1965 kam der Besucher ins Münchner Rathaus, um das Stadtoberhaupt für seinen Plan zu gewinnen: Die bayerische Metropole solle sich um die Austragung der Sommerspiele 1972 bewerben. Vogel, der in den gut fünfeinhalb Jahren seiner bisherigen Amtszeit eine Modernisierung der Stadt wie nie zuvor eingeleitet hatte, „verschlug es zunächst einmal den Atem“. Dann fragte er Daume, ob dieser nicht wisse, „dass in München im Grunde keine einzige der Einrichtungen vorhanden sei, die man für Spiele brauche“? Dem IOC sei der Bau neuer Anlagen ohnehin lieber als die Modernisierung bestehender Stadien, lautete die entwaffnende Antwort.1
Doch die notwendigen Gebäude waren keineswegs das einzige Problem: Gerade erst drei Wochen zuvor hatte das IOC auf seiner Sitzung in Madrid beschlossen, dass es künftig zwei Nationale Olympische Komitees in Deutschland geben dürfe, das bisherige NOK und zusätzlich ein „Ostdeutsches NOK“. Der politische Druck des Ostblocks, die politische Realität zweier verschiedener Staaten auf deutschem Boden anzuerkennen, war zu groß geworden. Der gleichzeitige Beschluss, dass zwar zwei deutsche Teams an den nächsten Olympischen Spielen in Mexiko 1968 teilnehmen sollten, jedoch unter einer gemeinsamen Flagge in Schwarz-Rot-Gold mit den fünf olympischen Ringen und mit Beethovens „Ode an die Freude“ als Hymne, enttarnte den Kompromiss, der dahintersteckte.2
In der Bundesrepublik, die zu dieser Zeit noch den Anspruch erhob, international für ganz Deutschland zu sprechen, war diese Entscheidung als Niederlage empfunden worden; im Vorfeld war sogar für den Fall einer Anerkennung der DDR über einen Boykott der Spiele 1968 durch bundesdeutsche Sportler nachgedacht worden.3 Das konnte durch den Kompromiss immerhin vermieden werden. Daume hatte seine Niederlage offen eingestanden und den Blick gleich wieder nach vorne gerichtet: „Es gibt Wichtigeres als die gesamtdeutsche Olympia-Mannschaft, zum Beispiel den gesamtdeutschen Sportverkehr für alle“, hatte er noch in Madrid gesagt.4 Doch er hatte noch mehr vor: Der NOK-Präsident wollte den Ärger der Unterstützer seiner Position nutzen, um die Sommerspiele 1972 in die Bundesrepublik zu holen. Westdeutschland habe im IOC viele Freunde, gerade nach der Niederlage in Madrid. Sie wollten etwas für das Land tun. Und zudem läge auch sonst keine ernsthafte Bewerbung vor.
Seinen Gesprächspartner Vogel überraschte Daumes Sicht; er bezweifelte, dass „auch nur die geringste Aussicht bestehe, die Spiele in die Bundesrepublik – und dazu noch in die ehemalige ,Hauptstadt der Bewegung‘ zu bekommen“.5 München vom Stigma zu befreien, Gründungsort und bis 1945 Sitz der Zentrale der NSDAP gewesen zu sein, gehörte zu den international herausforderndsten Aufgaben des mit gerade einmal 39 Jahren noch jungen Oberbürgermeisters. Schon 1962 hatte er deshalb mittels eines Bürgerwettbewerbs einen Image-Slogan suchen und finden lassen: „München – Weltstadt mit Herz“.6 Vogel glaubte auch nicht an einen Erfolg, weil die Entscheidung des IOC bereits bei der nächsten Sitzung in Rom Ende April 1966 anstand; die Frist für die Abgabe von Bewerbungen endete sogar schon am 30. Dezember 1965. Das hieß: Gerade einmal 63 Tage, um ein Konzept zu entwickeln und politische Unterstützung zu organisieren.
Weil dem Juristen Vogel jedoch die für viele Absolventen seines Studienfachs typische Neigung zur Bedenkenträgerei völlig abging, machte er sich ans Werk. Mit Daume hatte er vereinbart, nur möglichst wenige Menschen von dem Vorhaben zu informieren, um ein vorzeitiges Zerreden des Planes durch Presse und Fernsehen zu vermeiden. Am folgenden Tag beriet er sich mit den wichtigsten Mitgliedern der Stadtregierung und erhielt das „Münchner Jawort“.7 Anschließend flog Vogel nach Berlin, um mit dem Regierenden Bürgermeister und SPD-Vorsitzenden Willy Brandt zu sprechen, denn gegen das Votum des Senates der geteilten Stadt würde es eine Bewerbung nicht geben können. Doch Brandt wusste, dass die in der Öffentlichkeit immer wieder diskutierten Pläne für eine gemeinsame Bewerbung von West- und Ost-Berlin politisch irreal waren; daher sagte er dem Besucher aus München volle Unterstützung zu. Zwei weitere Gespräche musste Vogel noch führen, bevor die Bewerbung öffentlich werden durfte: mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Alfons Goppel und mit Bundeskanzler Ludwig Erhard. Den CSU-Politiker gewann der dynamische Oberbürgermeister schnell, und auch in Bonn zeigte man sich offen für die Idee. Am 29. November 1965, gerade einen Monat nach Daumes überraschendem Angebot, kam es zum Treffen im hochmodernen Kanzler-Bungalow. Vogel, Goppel und der NOK-Chef stellten den Plan vor, der inzwischen vertraulich im Münchner Rathaus erarbeitet worden war und Gesamtkosten von 550 Millionen Mark vorsah, die zwischen Stadt, Land und Bund gedrittelt werden sollten. Doch jetzt stieß das Vorhaben auf die Bedenken eines Juristen, denn der Kanzleramtschef wehrte sich entschieden gegen eine Olympia-Bewerbung: „Ludwig Westrick widersprach lebhaft, bezweifelte die Kostenschätzungen und erinnerte den Bundeskanzler daran, dass er in einer Stunde im Bundestag eine schwere Auseinandersetzung über die Reduzierung von Leistungen zu bestehen habe, die vor den Wahlen versprochen worden seien.“ Erhard schwankte zunächst, doch ein erneutes Plädoyer von Daume und Vogel beeindruckte ihn. Als Westrick ihn daraufhin am Ärmel zupfte und durch Gesten zu verstehen gab, der Regierungschef möge keinerlei Zusagen machen, reagierte der Kanzler unwillig auf dieses Zaudern und sagte sinngemäß, „man könne nicht immer nur Trübsal blasen und dem Volk Unerfreuliches ankündigen, es müsse auch einmal etwas Erfreuliches geschehen“.8 Deshalb sei er gerade jetzt für die Olympischen Spiele. Die Bundesregierung werde ihren Kostenanteil innerhalb von sechs Jahren wohl aufbringen können.
Am selben Abend verkündete Vogel die Bewerbung Münchens auf einer Pressekonferenz – und erntete vor allem Skepsis bis Ablehnung. Sieben Ruhrgebiets-Städte meldeten eine gemeinsame Kandidatur an, Hannover zeigte gleichfalls Interesse, und Gerhard Stöck, Leiter des Sportamtes der größten westdeutschen Stadt Hamburg, lehnte das Projekt rundheraus ab: „Die deutsche Bewerbung um die Spiele von 1972 überrascht mich sehr, mit Münchens Antrag hatte ich nie gerechnet. Für mich ist nur Berlin als einzige deutsche Stadt olympiareif.“ Dahinter steckte wohl die Sorge, dass die Hoffnung der Hansestadt auf eine eigene Bewerbung für die Sommerspiele 1976 oder 1980 unterminiert werden könnte. Ganz richtig erkannte Stöck, selbst Olympiasieger 1936 sowie bei den Spielen 1956 und 1960 Chef der gesamtdeutschen Teams, was Vogels längerfristiges Ziel war: „Ich habe allerdings auch den Verdacht, dass man sich in der bayerischen Metropole bei einer solchen Bewerbung endlich die Einrichtung repräsentativer Sportanlagen mit einem Schlag verspricht.“9
Immerhin endete diese Diskussion im Wesentlichen wenige Tage später, als Erhard seinen Sprecher klarstellen ließ, dass Bonn ausschließlich die Kandidatur der bayrischen Landeshauptstadt unterstützen werde: „Die Bundesregierung, das Land Bayern und die Stadt München sind der Auffassung, dass die Austragung der Olympischen Spiele auf deutschem Boden eine dem nationalen Prestige dienende Aktion ist, die die weite Unterstützung der Bevölkerung findet.“10
Damit war aber lediglich die erste Hürde genommen, denn nun galt es noch, das IOC von Münchens Bewerbung zu überzeugen. Die Chancen stiegen jedoch, als Wien im Januar 1966 seine in Aussicht gestellte Bewerbung zurückziehen musste – die österreichische Regierung hatte sich nicht in der Lage gesehen, das notwendige Geld zur Verfügung zu stellen.11 Damit gab es nur noch drei ernsthafte Konkurrenten: Montreal, Madrid und Detroit. In der dritten April-Woche 1966 kam es in Rom zum Showdown – und München punktete mit Vogels Vision, die „Olympische Spiele der kurzen Wege, im Grünen und der Einheit von Körper und Geist“ verhieß.12 Während Montreal bei der Präsentation seiner Pläne am Nachmittag des 25. April überzog, hielten sich der Oberbürgermeister und Daume bei ihren anschließenden Ansprachen bewusst knapp; lieber zeigten sie den Kurzfilm „München. Eine Stadt bewirbt sich“. Danach gingen die Deutschen zum gemeinsamen Abendessen – und unterwegs gabelte die „Gruppe erregt diskutierender Männer, ein paar Damen waren auch dabei“, den bekannten Filmstar Joachim Fuchsberger auf, der gerade seinen Drehtag beendet hatte und in einem römischen Straßencafé einen Espresso genoss. Der ging gern mit und fragte Vogel gleich zur Begrüßung: „Darf ich gratulieren, Herr Oberbürgermeister?“ Vogel blieb jedoch vorsichtig: „Ja und Nein. Die Präsentation hätte nicht besser ankommen können, und trotzdem werden wir die Spiele nicht bekommen.“13 Das Stadtoberhaupt rechnete mit vehementer Ablehnung seitens des Ostblocks, denn die DDR-Presse hatte umgehend eine „aggressive Kampagne“ gegen Münchens Bewerbung gestartet.14
Am 26. April 1966 stimmte das 61-köpfige IOC ab. Die Bekanntgabe des Ergebnisses war für 18 Uhr angesetzt, und vorher überschlugen sich die Gerüchte. München sei im dritten Wahlgang geschlagen worden, hieß es, und als das kanadische IOC-Mitglied den Bürgermeister von Montreal umarmte, gab Vogel das Rennen schon verloren. Doch dann verkündete IOC-Präsident Avery Brundage: „The games are awarded to Munich.“15 Tatsächlich war die Entscheidung deutlich ausgefallen: Schon im ersten Wahlgang führte München mit 21 Stimmen vor Montreal und Madrid mit je 16 und Detroit mit acht Stimmen. Im zweiten Wahlgang reichte es dann für Bayerns Landeshauptstadt mit 31 Stimmen zur absoluten Mehrheit. Die Freude war groß, doch das Hamburger Abendblatt, der deutschen Bewerbung gegenüber nach wie vor skeptisch, kommentierte: „München fehlt im Augenblick ja außer dem guten Willen und Plänen beinahe alles, was man für Olympische Spiele benötigt.“16
Das war übertrieben. Tatsächlich verfügte München mit dem früheren Exerzier- und späteren Flugplatz Oberwiesenfeld rund fünf Kilometer nordwestlich der Innenstadt über ein geeignetes Areal, das auch bereits als Stadtentwicklungsfläche ausgewiesen war. Auf dem südlichen Teil hatten Arbeiter seit 1946 einen der drei großen Trümmerschuttberge Münchens aufgeschichtet, aus rund zehn Millionen Kubikmetern nicht mehr verwertbarer Gebäudereste. Außerdem waren hier bereits ein Eissportzentrum sowie der Fernseh- und Fernmeldeturm im Bau, die beide völlig unabhängig von der Olympia-Bewerbung projektiert worden waren. Außerdem gab es Überlegungen für den Bau eines neuen Großstadions mit 75 000 Zuschauerplätzen, denn das Stadion an der Grünwalder Straße genügte als reines Fußballstadion den Erwartungen an eine moderne Sportstätte nicht mehr und war wegen umlaufender Verkehrsachsen auch nicht erweiterbar. Auf dem Oberwiesenfeld sollten ferner mehrere Tausend Wohnungen gebaut werden, ebenso auf westlich angrenzenden Grundstücken. Um die absehbar zunehmenden Verkehrsströme zu bewältigen und dem Irrweg der „autogerechten Stadt“ zu entkommen, der in den Jahren des Wiederaufbaus nach 1945 als Maßstab der Stadtentwicklung gegolten hatte, waren ein S-Bahn-Tunnel unter der Innenstadt in West-Ost-Richtung und eine U-Bahn in Nord-Süd-Richtung geplant. Das weitgehend zur Fußgängerzone umgestaltete Stadtzentrum sollte künftig ein Schnellstraßenring umschließen. All das folgte aus dem Entwicklungsplan, der bereits im Juli 1963 beschlossen worden war. Vogel stand nun vor der Aufgabe, die projektierte Bauzeit für diese Vorhaben von zwölf auf weniger als neun Jahre zu reduzieren – im Frühjahr 1972 musste alles fertig sein.
Die wichtigste Herausforderung aber war eine andere: Wie konnte Münchens Versprechen wahr werden, „Olympische Spiele der kurzen Wege, im Grünen und der Einheit von Körper und Geist“ zu realisieren?
Das Olympisches Dorf kurz vor der Fertigstellung. Die ausgedehnten Grünanlagen im Süden hin zum Stadion fehlen noch.
Der wesentliche Schritt gelang im Oktober 1967: Das Organisationskomitee (Vorsitzender: Willi Daume, Stellvertreter: Hans-Jochen Vogel) entschied gegen ein klassisches Stadion und für offene, von zeltartigen Plexiglasdächern überspannte Wettkampfstätten auf dem Oberwiesenfeld. Nach der Kür gab es natürlich Widerstand von Bedenkenträgern: Der Entwurf sei zu teuer.17
Die Bundesregierung war München in dieser Phase keine besonders große Hilfe, denn sie verfolgte zwei einander ausschließende Ziele – einerseits „in der augenblicklichen Haushaltssituation von Bund, Ländern und Gemeinden die durch die Ausrichtung der XX. Olympischen Spiele 1972 hervorgerufenen Belastungen der öffentlichen Haushalte so gering wie möglich zu halten“ und andererseits die „günstigsten Bedingungen für einen reibungslosen Verlauf der Olympischen Spiele zu schaffen“. Denn „die Sportjugend der Welt soll das demokratische und friedliebende Deutschland kennenlernen“.18
Die 1965 geschätzten Gesamtkosten von 550 Millionen Mark, das war klar, würden nicht ausreichen. Anfang 1969 wurde schon mit 992 Millionen Mark gerechnet, von denen der Steuerzahler 436 Millionen Mark tragen sollte.19 Doch auch das reichte nicht, denn das IOC und seine Fachverbände verlängerten ihre Wunschzettel immer weiter: Eine 2,2 Kilometer lange künstliche Ruderstrecke kostete wegen der Sonderwünsche statt vorgesehener zehn schließlich 69 Millionen Mark. Das Reitstadion samt Stallungen verschlang mit 51 Millionen mehr als das Zehnfache des eingeplanten Betrages; die Halle für die Volleyballwettbewerbe musste nach Baubeginn wegen einer Regeländerung um zweieinhalb Meter tiefergelegt werden, damit genügend Luftraum für hoch gespielte Bälle vorhanden war. Das Olympische Dorf sollte statt 9000 Athleten, Trainern und Funktionären nun ein Drittel mehr Menschen beherbergen können, nämlich 12 000. Ganz neu hinzu kamen eine 23 Millionen Mark teure Halle für die Basketballspiele, eine Anlage für die Sportschützen für 24 Millionen Mark und eine für die Ringer, für 25 Millionen Mark.20
Schließlich wurden die Gesamtinvestitionen für die Spiele in und um München auf 1350 Millionen Mark geschätzt, einschließlich des Stadions, des Olympischen Dorfes und der separaten Pressestadt für rund 4000 Journalisten, großer Teile der U- und S-Bahn sowie zahlreicher neuer Straßen. Für die Segelwettbewerbe vor Kiel plante man weitere 95 Millionen Mark Investitionskosten ein, vor allem für das neue Olympiazentrum Schilksee mit fast 800 Wohnungen, Hotels und einem eigenen Yachthafen. Die reinen Veranstaltungskosten an beiden Orten taxierte das Organisationskomitee auf 527 Millionen Mark. Das war jedoch eine grobe Schätzung, die wenig mit konkreten Kalkulationen zu tun hatte, sondern dazu führte, dass die Gesamtkosten sich auf den symbolischen Betrag von 1972 Millionen Mark summierten.21
Ein gutes Drittel davon, 686 Millionen Mark, sollte die öffentliche Hand aus Steuermitteln bezahlen, davon der Bund 333,40 Millionen Mark, Bayern und München je knapp 170 Millionen, Schleswig-Holstein und Kiel je gut sieben Millionen Mark. Einen deutlich größeren Teil würden eine Olympia-Lotterie (Ertrag: 250 Millionen Mark) und Sammler weltweit durch die Ausgabe spezieller Olympia-Sammelmünzen aus Silber (Überschuss: 639 Millionen Mark) tragen. Den Rest sollte das Organisationskomitee beisteuern, das von Einnahmen von 350 Millionen Mark ausging, die vor allem durch Eintrittsgelder, Übertragungsrechte und Mieten erzielt werden sollten.22 Diese Schätzung erwies sich als zu optimistisch, sodass ein gemeinnütziger Verein zur Förderung der Spiele mit Bar- und Sachspenden in Höhe von rund 40 Millionen Mark einspringen musste; auch die Stadt München schoss dem Organisationskomitee noch 24 Millionen Mark zu.23
Da 93 Millionen Mark des Bundesanteils als Investitionen für reguläre Aufgaben der Bundesförderung verbucht werden konnten, nämlich den Ausbau von öffentlichen Verkehrsmitteln und von Studentenwohnheimen, betrug die echte Mehrbelastung des Bundeshaushaltes durch die Sommerspiele 1972 vergleichsweise geringe 240 Millionen Mark.24 Dem standen schon vor Beginn der Spiele Steuermehreinnahmen in Höhe von rund 200 Millionen Mark gegenüber; hinzukommen sollten vorab schwer zu kalkulierende direkte und indirekte Steuern durch die Besuchermassen.
Den absehbaren Gewinn für seine Stadt fasste Hans-Jochen Vogel einige Monate vor der Eröffnung der Spiele zusammen: Außer den 16 festlichen Tagen, „in denen München im Mittelpunkt des Interesses der ganzen Welt stehen wird und sich eine Unzahl neuer Freunde erwerben kann“, blieben 4,2 Kilometer U-Bahn, 27,5 Hektar neue Straßen, mehr als tausend Sozial- und rund 5000 frei finanzierte Wohnungen, Quartiere für 1800 Studenten, drei neue Schulgebäude, ein Stadion, vier moderne Hallen und vieles Weitere. Er bilanzierte: „Die Anstrengungen haben sich gelohnt; München hat seine Chance genutzt.“25
1970 bis 1972
Sicherheit
Während die meisten Veranstaltungsorte der künftigen Spiele bereits im Rohbau waren, begannen sich die bayerischen Behörden Gedanken um die Sicherheit zu machen. Im Dezember 1969 erhielten die deutschen Botschaften in Rom, Tokio und Mexiko City den Auftrag, die Ausrichter der vergangenen drei Olympischen Sommerspiele um polizeiliche Erfahrungen zu bitten. Der Rücklauf war jedoch enttäuschend. Aus Rom meldete zunächst ein Diplomat eher allgemeine Erkenntnisse. Ihnen zufolge hatten Soldaten der italienischen Armee 1960 den Schutz der Olympia-Stätten übernommen, allerdings – damit es nicht zu martialisch wirkte – nicht in normalen Uniformen, sondern in spezieller Kleidung des Organisationskomitees. Das bestätigte ein nachgereichter Bericht der römischen Polizei.1 In Mexiko City hatte es 1968 derartige Zurückhaltung nicht gegeben, sondern im Gegenteil eine starke Militärpräsenz; nur zehn Tage vor Eröffnung der Spiele hatte das mexikanische Militär eine Demonstration linksgerichteter Studenten gewaltsam aufgelöst und dabei mindestens 25, nach anderen Angaben auch bis zu 300 Menschen getötet.2 Die umfangreichste Hilfe leistete die Polizei in Tokio, die der deutschen Botschaft einen Bericht übergab. Demnach waren die Sicherheitsmaßnahmen für die Spiele 1964 bereits vier Jahre vor Eröffnung geplant worden, sogar noch vor den Spielen in Rom. Es war eine eigene Behörde eingerichtet worden, die den Schutz organisiert hatte, freilich unter Leitung des Polizeipräsidenten, um Kompetenzkonflikte zu vermeiden. Insgesamt hatten während der Spiele in Tokio täglich rund 11 000 Polizisten in einem festen Dreischichtsystem Dienst, zuzüglich einer nicht genau bezifferten Zahl von Soldaten, die für die Sicherheit im Olympischen Dorf sorgten; die reguläre Polizei hatte dort nur in Ausnahmefällen Zutritt.3
Die bayerischen Behörden zogen aus den Erfahrungen der drei vorangegangenen Austragungsorte mehrere Schlüsse: Erstens war nun für die Vorbereitung – Polizeiangelegenheiten gehören laut Grundgesetz zu den Obliegenheiten der einzelnen Bundesländer – ein Sicherheitsbeauftragter im bayerischen Staatsministerium des Inneren zuständig, während der eigentliche Verantwortliche für die Sicherheit der Olympia-Stätten der Münchner Polizeipräsident als assoziiertes Mitglied des Organisationskomitees sein sollte. Die reguläre Polizei sollte im Olympischen Dorf lediglich in Form einer Kriminalwache mit Zivilbeamten präsent sein und sich um die Aufklärung der zu erwartenden kleineren Delikte kümmern. Um Erinnerungen an die von Hitler-Deutschland martialisch inszenierten und propagandistisch genutzten Spiele in Berlin 1936 zu vermeiden, würden Soldaten der Bundeswehr als Sicherheitskräfte keine Rolle spielen – sie waren lediglich als klar gekennzeichnete Fahrer, Helfer und Streckenposten vorgesehen.4
Zweitens sollten auch für den Schutz der Veranstaltungsorte und des Dorfes nicht uniformierte Polizeibeamte zuständig sein, sondern ein eigens gegründeter Ordnungsdienst, der im Auftrag des Organisationskomitees das Hausrecht auf dem Olympia-Gelände wahrnehmen sollte. Der Dienst sollte aus erfahrenen Polizisten bestehen, vor allem Polizeisportlern, denen man am meisten Verständnis für die Bedürfnisse der Athleten zutraute. Die Freiwilligen aus allen Bundesländern sollten in einem überlappenden Dreischichtsystem organisiert werden: Die eine Hälfte der Tagschicht arbeitete von sieben Uhr morgens bis 19 Uhr abends, die andere von acht bis 20 Uhr. Die Nachtschicht war von 19 oder 20 Uhr bis sieben oder acht Uhr im Dienst; nach jeweils zwölf Stunden Einsatz folgten 24 Stunden Ruhe.5 Dieses Modell, das vier Tage vor der Eröffnungsfeier beginnen und drei Tage nach der Schlussfeier enden, also insgesamt gut drei Wochen dauern sollte, führte zwar zu einer großen Zahl an Überstunden, hielt aber dennoch die Belastung der Ordner in erträglichen Grenzen, zumal die Mitglieder des Ordnungsdienstes zum großen Teil am Rande des Olympischen Dorfes untergebracht werden würden. Da in München anders als in Tokio die meisten Anlagen nahe beieinander lagen, schienen knapp 2000 Mann und 40 Frauen für die Sicherheit der Athletinnen als Stärke des Ordnerdienstes ausreichend.6
Drittens setzte das Organisationskomitee auf maximale Deeskalation. Die Mitglieder des Ordnungsdienstes sollten grundsätzlich unbewaffnet sein und möglichst fröhlich wirken, weshalb sie eigens entworfene Uniformen in hellblau mit weißen Hemden und Mützen erhielten. Ferner übten sie polizeiuntypische Taktiken: potenzielle Störer durch Klamauk verunsichern, mit Süßigkeiten beschießen oder sie im Falle eines Falles umringen und sanft abdrängen.7
Während Bayerns Behörden dieses Konzept erarbeiteten, änderte sich die Sicherheitslage jedoch erheblich. 1968/69 hatte es erstmals zwei Flugzeug-Entführungen durch palästinensische Terroristen gegeben; beide waren vom Flughafen Rom ausgegangen. Am 10. Februar 1970 kam diese Form politischer Kriminalität in Deutschland an: Während der Zwischenlandung einer Linienmaschine der israelischen Gesellschaft El Al in München-Riem auf dem Flug nach London versuchten drei bewaffnete Palästinenser, im Transitraum und im Zubringerbus Passagiere in ihre Gewalt zu bringen. Doch der Pilot, ein Hüne von 1,98 Meter, wehrte sich, und auch andere Israelis verwickelten die Angreifer in einen Kampf. Bevor die Attentäter festgenommen wurden, warfen sie noch mehrere Handgranaten. Eine davon, die einer der Entführer in den gefüllten Flughafenbus schleuderte, tötete einen 32-jährigen Mann, der sich auf sie geworfen hatte, um seine Mitreisenden zu retten. Eine weitere verwundete den Flugkapitän sowie eine Passagierin schwer.8 Insgesamt gab es elf Verletzte; die drei Täter konnten von Beamten der bayerischen Grenzpolizei, die auf dem Flughafen zuständig waren, überwältigt werden. Die Presse schrieb von der „ersten Schlacht des Nahostkrieges auf deutschem Boden“ und dass „die Guerillas (…) ihren Krieg gegen Israel sogar bis nach Europa getragen“ hätten.9
Eine Woche später wurden ebenfalls in Riem drei Araber festgenommen, bevor sie bewaffnet in den Transitraum gelangen konnten; dort befanden sich abermals Passagiere der Linienmaschine von Tel Aviv nach London. Diese drei hatten einen Zettel mit dem Befehl bei sich: „Wir verlangen sofortige Startfreiheit, oder wir jagen das Flugzeug mit Handgranaten in die Luft.“10 Für beide Anschläge, den versuchten und den rechtzeitig verhinderten, übernahm eine Gruppe namens „Aktionsgemeinschaft zur Befreiung Palästinas“ die Verantwortung.
Die Anschlagswelle ging weiter. Gleich 47 Tote forderte die Explosion einer Bombe im Laderaum eines Swissair-Jets am 21. Februar 1970; eine zweite, fast zeitgleiche Explosion an Bord einer Austrian-Airlines-Maschine ging glücklicherweise ohne Opfer ab. Die Bomben hatten sich in Luftpostpaketen nach Israel befunden und waren in Frankfurt und Zürich versehentlich nicht wie geplant in El-Al-Maschinen, sondern in Jets aus Österreich und der Schweiz geladen worden. Verantwortlich war abermals eine Zelle palästinensischer Terroristen in Deutschland; offiziell bekannte sich das „PFLP-Generalkommando“ zu den Anschlägen.11
Das Bundesamt für Verfassungsschutz schloss in seinem Bericht über das Jahr 1971: „Die radikalsten palästinensischen Widerstandsgruppen versuchen nach wie vor, sich durch Terroranschläge außerhalb des nahöstlichen Krisengebietes neue Publizität zu verschaffen und ihren zum Teil verloren gegangenen Einfluss bei den Palästinensern wieder zurückzugewinnen.“ Es gebe auch, nach einem zeitweiligen Rückgang, „Anzeichen für eine Reaktivierung des palästinensischen Widerstandes im Bundesgebiet“.12
Die intensive Aktivität antiisraelischer Gewalttäter in Mitteleuropa war nicht die einzige neue Entwicklung parallel zu der Vorbereitung der Münchner Sommerspiele. Mitte Mai 1970 wurde in West-Berlin der Linksextremist Andreas Baader gewaltsam aus der Haft befreit; wenige Wochen später setzte er sich zusammen mit Gesinnungsgenossen in den Nahen Osten ab, und Ende September 1970 zeigten drei gleichzeitige Banküberfälle wieder in der geteilten Stadt, dass nun auch mit einem potenziell mörderischen Terrorismus deutscher Provenienz zu rechnen war. Unter dem selbst gewählten Namen „Rote Armee Fraktion“ überzogen diese Aktivisten die Bundesrepublik fortan mit Straftaten.
Nicht nur vermeintlich politisch motivierte Gewalt, sondern ebenso rein kriminelle Täter setzten die Polizei unter Druck. Am 4. August 1971 stürmten kurz vor 16 Uhr zwei maskierte Bewaffnete die Filiale der Deutschen Bank in der Prinzregentenstraße 70 im Münchner Stadtteil Steinhausen und nahmen Bankangestellte wie Kunden als Geiseln.13 Sie nannten sich „Rote Front“, was die Polizei aber nur verwirren sollte, forderten zwei Millionen Mark Lösegeld bis 22 Uhr und drohten, andernfalls die Bank mit den Geiseln zu sprengen. Die Polizei sperrte die direkte Umgebung ab, besorgte das verlangte Lösegeld und einen Fluchtwagen.
Die Einsatzleitung vor Ort zog, obwohl Polizeipräsident Schreiber und sein Vize Georg Wolf anwesend waren, ein forscher Oberstaatsanwalt an sich; er setzte darauf, die Täter beim Verlassen der Bank ausschalten zu lassen. Doch die Münchner Polizei verfügte nicht über entsprechend ausgebildetes Personal. Also wurden mehrere als Jäger bekannte Beamte in eine Kiesgrube beordert und übten dort mit den im Präsidium vorhandenen Sturmgewehren des Bundeswehr-Typs G-3, für die sie immerhin Zielfernrohre hatten.14 Am späten Abend lagen sechs derartig fortgebildete Beamte auf Positionen rund um die Bank bereit. Kurz vor Mitternacht erschien einer der beiden Täter, prüfte das Lösegeld und ging auf den Fluchtwagen zu, in dem bereits eine junge Frau als Geisel saß.
Der Plan hatte vorgesehen, ihn dabei kampfunfähig zu schießen und unmittelbar danach die Bank gleichzeitig von vorne und von hinten zu stürmen, um den zweiten Geiselnehmer zu überwältigen. Doch das Blitzlichtgewitter der anwesenden Fotografen (die Absperrung betraf nur die beiden nächstgelegenen Nebenstraßen; auch waren die Häuser gegenüber der Bank nicht evakuiert worden) blendete die Schützen, die zudem keinen Funkkontakt untereinander hatten und deshalb wenige Sekunden lang orientierungslos waren. Erst als der Täter an der Autotür stand, fiel ein Schuss, und er ließ sich getroffen auf den Sitz fallen. Daraufhin begann eine wilde Schießerei auf den Wagen, während der fast 200 Patronen abgefeuert wurden. Der Täter und die Geisel erlitten dabei so schwere Verletzungen, dass sie wenig später starben.15
Auch der Sturm auf die Bank geriet zu einem Fiasko: Das Kommando im Hof brauchte mehrere Minuten, um die Tür zur Bank aufzubrechen, und für die Männer auf der Prinzregentenstraße erwies sich die stabile Scheibe der Filiale als fast unüberwindlich. Glücklicherweise nutzte der zweite Täter in der Bank die Gelegenheit nicht, auf die noch in seiner Gewalt verbliebenen Geiseln zu schießen.16