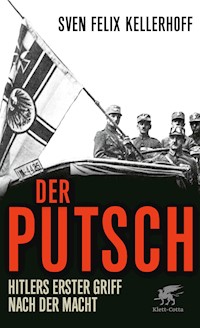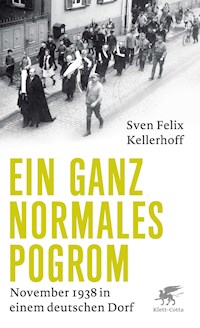
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Im November 1938 geht im ganzen Deutschen Reich die Saat des Hasses auf. In Hunderten Gemeinden demütigen Einwohner ihre jüdischen Nachbarn. Sven Felix Kellerhoff zeigt am Beispiel des rheinhessischen Weindorfes Guntersblum, wie der Hass wucherte, ausbrach und welche Folgen er hatte. Das heutige Bild des Novemberpogroms 1938 wird von den Vorgängen in Berlin und einigen anderen großen Städten wie München oder Essen dominiert. Doch das eigentlich Schockierende an den antisemitischen Übergriffen der »Reichskristallnacht« war, dass sie anders als frühere organisierte Pogrome tatsächlich reichsweit und bis in die Provinz hinein stattfanden. Die Novemberpogrome sind die Zäsur zu einer neuen Qualität und Intensität der Verfolgung. Gerade der Blick in ein ganz normales Dorf macht die erschreckende Normalität des Judenhasses greifbar und unmittelbar einsichtig. Hier kannten sich Opfer und Täter tatsächlich, lebten eng zusammen. Sven Felix Kellerhoff erzählt von den ergreifenden Schicksalen der Betroffenen in Guntersblum. Er zeigt, wie das Gift des Antisemitismus sich ausbreitete, wie die Situation ab 1933 eskalierte, was im November 1938 genau geschah und wie die Vergangenheit den Ort bis heute nicht loslässt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 283
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Sven Felix Kellerhoff
EIN GANZ NORMALES POGROM
November 1938 in einem deutschen Dorf
Klett-Cotta
Impressum
Die Rechtschreibung wurde den aktuell gültigen Regeln des Dudens angepasst, auch in wörtlichen Zitaten.
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Klett-Cotta
www.klett-cotta.de
© 2018 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung
Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle Rechte vorbehalten
Cover: Rothfos & Gabler, Hamburg
Unter Verwendung eines Fotos von © Landesarchiv Speyer (LASp), Bestand X 3, Nr. 111
Karten: Isabell Bischoff
Datenkonvertierung: Kösel Media GmbH, Krugzell
Printausgabe: ISBN 978-3-608-98104-9
E-Book: ISBN 978-3-608-11026-5
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Inhalt
Erschrecken
Unerwünschte Aufmerksamkeit
Exemplarisch und einzigartig
»Kristallnacht« oder Pogrom?
Spannungen
Fremdherrschaft
Ein durchschnittliches Dorf
Die jüdische Gemeinde
Hochburg
Konkurrenz
Gründung der Ortsgruppe
Ungeeigneter Statthalter
Ideologie
»Politisch-agitatorischer Kampf«
Erfolg
Ausgrenzung
Triumph
Offene Rechnungen
Schikanen
Anlass
Kampf gegen Synagogen
Abschiebung
Attentat
Eskalation
Auftakt
Willkommener Märtyrer
»Volkszorn«
Demütigung
Festnahmen
Schandmarsch
»Freudenfeuer«
Plünderung
Willkommene Chance
Verwüstung
Nachtwache
Unfreiwillige Schenkung
Ermittlungen I
Zynische Bilanz
Vernehmungen
Faktische Amnestie
Deportation
Ausverkauf
»Unbekannt verzogen«
Kriegsende
Ermittlungen II
Verbrechen gegen die Menschlichkeit
Prozess
Entnazifizierung
Gnade vor Recht
Aufarbeitung
Beredtes Beschweigen
Entschädigung
Spätes Gedenken
Stolpersteine
Bedeutung
Anhang
Dank
Abbildungsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Anmerkungen
Quellen- und Literaturverzeichnis
Karten
Bildteil
Erschrecken
Unerwünschte Aufmerksamkeit
Idyllisch schmiegen sich alte Kelterhäuser an sanft ansteigende Weinberge. Die meisten Bruchsteinfassaden sind penibel gepflegt, viele der halbrunden Doppeltore frisch lackiert. Manche stehen offen und erlauben durch Glas den Blick in kleine, sorgfältig eingerichtete Probierstuben. Der Kellerweg ist der ganze Stolz der rheinhessischen Gemeinde Guntersblum zwischen Worms und Mainz; nur hin und wieder stört eine Bausünde aus den 1960er- und 1970er-Jahren das Idealbild eines wohlhabenden Weindorfes. Nirgendwo in Deutschland haben sich mehr alte Weinbereitungs-Gebäude in Reih und Glied erhalten. Zwar wird hier längst kein Most mehr vergoren, denn die Häuser am Kellerweg sind zu niedrig für moderne Gärtanks und die Tore zu schmal für heutige Lastwagen, aber viele Kelterhäuser sind umgebaut zu begehrten Wohnungen; andere stehen leer und erwachen nur bei den regelmäßigen Weinfesten zum Leben, vor allem beim traditionellen und überregional beliebten Kellerwegfest im August. Produziert wird der Guntersblumer Wein schon längst zu Füßen des Kellerwegs, bei knapp einem Dutzend mittlerer und größerer Winzer; Traubenduft hängt in der Luft. Auf Weinbergen in den weitläufigen Hügeln des Guntersblumer Löß und auf einigen Feldern in der Ebene bis zum drei Kilometer entfernten linken Rheinufer wachsen Hektar um Hektar wertvolle Reben. Manche kleinere Parzelle liegt innerorts, in Gärten hinter Einfamilienhäusern oder vor dem mit 60 Betten einzigen größeren Hotel.
Die Gemeinde sonnt sich in ihrer mehr als 1100-jährigen Geschichte. Auf fast 50 eingetragene Kulturdenkmäler kommt der Ort mit seinen heute gerade einmal knapp 4000 Einwohnern. Darunter sind gleich zwei barocke Grafenschlösser und die romanische Kirche St. Viktor mit den in Mitteleuropa nur an vier anderen Orten erhaltenen Sarazenentürmen, deren Form heimkommende Ritter des ersten Kreuzzuges inspiriert hatten. In manchen Straßen steht ein historisches Haus neben dem anderen; einige schmale, teilweise gerade einen Meter breite Gässchen haben sich seit dem Mittelalter kaum mehr verändert. Sogar der alte Befestigungsgraben ist am südwestlichen Rand des Ortskerns noch erhalten, als baumgesäumte Promenade. Guntersblum ist eine selbstbewusste Gemeinde, die mit ihren Reizen nicht geizt und Gäste freundlich empfängt. Besonders zu Weinfesten und zahlreichen Winzerabenden zeigt sich der Ort von seiner besten Seite.
Die Idylle bekam Anfang November 2008 schlagartig tiefe Risse. Denn kurz vor dem 70. Jahrestag der als »Reichskristallnacht« bekannten antisemitischen Ausschreitungen von 1938 veröffentlichte die Berliner Tageszeitung Die Welt unter der Überschrift »Öffentlich gedemütigt« zwei erschütternde Bilder.1 Sie zeigen fünf Männer meist fortgeschrittenen Alters, die im Gänsemarsch über das Kopfsteinpflaster der Hauptstraße von Guntersblum schlurfen. Ihre Gesichter sind wie versteinert; sie tragen schwarze Talare mit festgeknoteten hellen Schals und schleppen große Rollen mit Griffen. Vorneweg läuft als sechster ein etwas jüngerer Mann im Kittel mit einer seltsamen Mütze auf dem Kopf, der den Zug mit einer Schelle ankündigt. Mehrere Uniformierte mit Hakenkreuzbinden und ein paar Arbeiter in Kluft begleiten die Männer. Außerdem laufen viele Kinder mit; manche schieben Fahrräder. Ein paar Schuljungs zeigen mit den Fingern auf die sechs traurigen Marschierer und grinsen. Ein Mädchen rennt fröhlich an den Männern entlang, andere tuscheln. An den Fenstern der Häuser stehen nur wenige Erwachsene, bei anderen Gebäuden sind die Vorhänge vorgezogen. Auf einem Foto ist zu erahnen, dass die schlurfenden Männer mit Sand oder kleinen Steinen beworfen werden, auf einem weiteren sieht man, wie der vorneweg gehende Mann von einem Uniformierten hart am Arm gepackt wird. Es sind Bilder des Grauens, aufgenommen am 10. November 1938. Sie zeigen die öffentliche Demütigung der Guntersblumer Juden anlässlich der schlimmsten antisemitischen Ausschreitungen in Mitteleuropa seit mehreren hundert Jahren.
In der örtlichen Ausgabe der Allgemeinen Zeitung aus Mainz griff ein Lokalreporter den Bericht der Welt umgehend auf. »Samt Thora-Rollen durchs Dorf getrieben« war sein Aufmacher überschrieben, der den Artikel des überregionalen Blatts zugespitzt zusammenfasste und vor allem auf die Rolle von Carl Rösch einging, des in der Welt namentlich überhaupt nicht genannten Bürgermeisters und NSDAP-Ortsgruppenleiters im Jahr 1938.2 Rösch hatte bis zu seinem Tod sechseinhalb Jahrzehnte später als geachteter Bürger in Guntersblum gelebt. War er die treibende Kraft hinter der Demütigung gewesen – oder unbeteiligt? Der Artikel schreckte den beschaulichen Ort auf, denn einerseits waren die eindeutig dort entstandenen Fotografien von 1938 bis dahin völlig unbekannt. Andererseits brachte der Lokalreporter die abgebildeten Ereignisse in Zusammenhang mit einem fremdenfeindlichen Übergriff beim Kellerwegfest 2007 mit mutmaßlich rechtsextremistischem Hintergrund, der bundesweit für Aufsehen gesorgt und sogar den Innenminister von Rheinland-Pfalz beschäftigt hatte. Der Mainzer Landtag diskutierte den Angriff, den Bürger durch couragiertes Eingreifen beendet hatten und der juristisch geahndet werden konnte.3
Es gab keinerlei Zusammenhang zwischen den in der Welt dokumentierten Ereignissen von 1938 und dem Übergriff 69 Jahre später. Dennoch reagierten viele im Ort tief verunsichert: »Inzwischen geht in Guntersblum die Frage um, ob das Bild des Bürgermeisters der damaligen Zeit aus der ›Ehrenleiste‹ im Sitzungssaal des Rathauses entfernt werden sollte«, stand in der Lokalzeitung.4 Selbst aufgeklärte, um die Geschichte Guntersblums verdiente Bürger wie der pensionierte evangelische Pfarrer wurden ausfallend: »Unsachlich und beleidigend« sei der Welt-Artikel gewesen, behauptete er, meinte jedoch gar nicht diesen Text, sondern die zugespitzte und verfälschte Berichterstattung darüber in den Lokalzeitungen.5 Das örtliche Gemeindeblatt hatte die Debatte im Ort zusätzlich angeheizt, indem es die möglichen Profiteure der Judenverfolgung ins Spiel brachte: »Bis in die Gegenwart hinein wurden und werden die Täter von damals in diesen Gemeinden geschont. Es ist immer noch ein Tabu zu hinterfragen, wer eigentlich in jenen Jahren der Nazi-Diktatur in den Besitz des jüdischen Eigentums kam.«6
Wie um dieses jahrzehntelange Wegschauen zu bestätigen, tauchte in Guntersblum umgehend ein »Entlastungsdokument« für Bürgermeister Rösch auf, das im Lokalblatt unwesentlich gekürzt abgedruckt wurde.7 Es stammte aus dem Jahr 1947, aus der Zeit der Entnazifizierung, war von einem örtlichen Kommunalbeamten namens Karl Kipp verfasst und las sich wie ein klassischer »Persilschein«: ein Gefälligkeitszeugnis unter Bekannten. Demnach hätte der Guntersblumer Bürgermeister, zur Zeit des Demütigungsmarsches 1938 ein junger Mann von 31 Jahren, »die Judenaktion« als »unmenschlich und beschämend für die deutsche Nation abgelehnt. Er stellte sich bewusst gegen die Anweisung der Parteiführung und sagte zu mir wörtlich: ›Da mache ich nicht mit‹«, hieß es in dem angeblichen Entlastungszeugnis. Allerdings konnte es nicht erklären, warum Rösch trotzdem in seinem Parteiamt blieb und weiter als Bürgermeister tätig war. Laut Kipps Darstellung hätte er in Guntersblum »keine Machenschaften gegen die Juden« ausgelöst. Im Gegenteil sei ihm seine Zurückhaltung negativ ausgelegt worden: »Nachdem in der Umgegend bekannt wurde, dass man gegen die Juden in Guntersblum nichts unternahm, kamen auswärtige Gliederungen wie SA und SS aus Osthofen und demolierten die Wohnungseinrichtungen der Juden. Guntersblumer SA-Angehörige beteiligten sich hieran ebenfalls, nachdem die Befehlsgewalt von Herrn Rösch während dieser Aktion an den späteren Ortsgruppenleiter Peter Fießer abgegeben wurde.« Laut Kipps Erklärung verließ Rösch Guntersblum an diesem 10. November 1938 für »eine Reise«, während er selbst an diesem Tag seinen Dienst unterbrach, aus dem Gemeindehaus ging und seine Wohnung aufsuchte: »Ich wollte kein Zeuge dieser Affäre sein und dokumentieren, dass ich hiermit nichts zu tun haben will. Ich bin Zeuge dafür, dass man den Bürgermeister und Ortsgruppenleiter Rösch dieses Verhaltens wegen mit dem Ausdruck ›Judenknecht‹ belegte.« Um zu bestätigen, dass die Guntersblumer Juden von Carl Rösch und der Ortsverwaltung eigentlich gut behandelt worden seien, fügte der ehemalige Gemeindesekretär hinzu: »Während der Auswanderungszeit wurden die Juden bevorzugt, das heißt, sie wurden auch außerhalb der Amtsstunden abgefertigt und die Hindernisse zur Auswanderung aus dem Wege geräumt.«8
Auf die Erregung im Ort reagierte der 2008 amtierende Guntersblumer Bürgermeister erstaunlich abgewogen und angemessen. Bohrende Nachfragen des lokalen Journalisten, ob denn Rösch aus der Ehrengalerie früherer Ortsvorsteher verschwinden werde, beantwortete Rolf Klarner mit einem fraglos richtigen Hinweis. Er habe das Porträt nicht aufhängen lassen; daher werde er dieses Foto nicht einfach entfernen: »Wenn dieses Bild weg soll, dann will ich dafür einen Mehrheitsbeschluss des Gemeinderates«.9
Exemplarisch und einzigartig
Die nach 70 Jahren unerwartet aufgetauchten Fotos des demütigenden Marsches jüdischer Männer durch Guntersblum 1938 werfen Fragen auf. Beileibe nicht nur an den Ort selbst und seine Umgebung, also Rheinhessen, sondern an alle Gegenden in Deutschland. Fragen, die lange verdrängt worden sind. Fragen nach dem Wissen und der Beteiligung ganz normaler Deutscher an der von Rassenwahn motivierten Ausgrenzung und Verfolgung von Juden, die meist nur wenige Jahre zuvor geachtete Mitbürger und Nachbarn gewesen waren. Denn was in Guntersblum am 10. November 1938 geschah, war keineswegs eine Ausnahme.
In rund tausend Städten und Dörfern im gesamten Dritten Reich gab es mehr oder minder ähnliche Übergriffe. Binnen weniger Stunden wurden geschätzt 1400 Synagogen und Betsäle verwüstet, angezündet oder gleich abgerissen.10 Randalierer durchwühlten und plünderten sicher deutlich mehr als die offiziell angegebenen rund 7500 Geschäfte jüdischer Eigentümer sowie eine nicht einmal ansatzweise zu schätzende, auf jeden Fall deutlich fünfstellige Zahl von Privatwohnungen. Rund 31 000 jüdische Männer wurden in die Konzentrationslager Buchenwald, Dachau und Sachsenhausen verschleppt; hunderte von ihnen überlebten die Torturen dort nicht. Insgesamt kamen mehr als tausend Menschen durch Mord, indirekte Folgen der Übergriffe oder Freitod ums Leben. Nach dem November 1938 gab es praktisch keine jüdische Kultur mehr in Deutschland. Kaum überschaubar sind die publizierten Zeitzeugenberichte; naturgemäß liegen mehr Erinnerungen zu Übergriffen in Großstädten wie Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Königsberg oder München vor als zu kleinen Gemeinden wie beispielsweise dem hessischen Bensheim, dem südbadischen Ihringen oder Esens in Ostfriesland.11 Doch handelt es sich fast immer um Beobachtungen verschiedener Ereignisse; nur selten gibt es mehr als zwei oder drei Zeugnisse über denselben konkreten Vorfall. Das macht diese Erinnerungen keineswegs unglaubwürdig, aber es schränkt naturgemäß die Möglichkeit ein, die genauen Umstände des jeweiligen Übergriffs durch den Vergleich verschiedener, voneinander unabhängiger Berichte präziser zu beschreiben.
Neben den Zeitzeugenberichten existiert eine Fülle von Fotos, die meist einen relativ schmalen Bogen von Motiven abdecken: Einerseits zeigen sie eingeschlagene Schaufensterscheiben in den Tagen nach den Übergriffen, andererseits brennende oder auf andere Art beschädigte und geschändete Synagogen.12 Aus Magdeburg, Königsberg, München und Berlin stammen die wohl bekanntesten Bilder zerstörter Geschäfte, die in vielen Schulbüchern abgedruckt sind. Geradezu als Ikonen der Zeitgeschichte gelten Aufnahmen der brennenden Synagogen am Frankfurter Börneplatz, in Bielefeld und an der Bergstraße in Hannover. Das Gleiche gilt für die große Gemeindesynagoge an der Berliner Fasanenstraße, während ausgerechnet das seit Jahrzehnten vermutlich am häufigsten in verschiedenen Medien veröffentlichte Bild einer brennenden Synagoge, nämlich jener in der Berliner Oranienburger Straße, eine Fotomontage ist, bei der Flammen in ein Foto der kriegszerstörten Kuppel kopiert wurden. Gerade dieses Gotteshaus brannte nicht im November 1938 aus, sondern erst im Krieg durch Bombenangriffe.13
Deutlich weniger häufig zu finden sind dagegen publizierte Bilder aus durchwühlten Gemeindebüros oder von Hausrat, der aus jüdischen Wohnungen oft mehrere Stockwerke hinab auf die Straße geworfen wurde. Meist erst fünf oder mehr Jahrzehnte später haben Historiker in Kommunalarchiven, privaten Sammlungen oder Ermittlungsakten gezielt nach solchen Aufnahmen gesucht und sie der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. In der Regel finden sich die Ergebnisse solcher Recherchen lediglich in lokalgeschichtlichen Dokumentationen oder wissenschaftlicher Spezialliteratur und werden deshalb der breiten Öffentlichkeit nicht bekannt.14
Sehr selten sind schließlich Aufnahmen, die während der eigentlichen Ausschreitungen entstanden, auf denen man also Opfer und Täter sehen, manchmal sogar identifizieren kann. Weil nur sehr wenige solcher Bilder bekannt sind, werden immer wieder dieselben Aufnahmen in Büchern, Zeitschriften und Zeitungen abgedruckt oder im Fernsehen und in Online-Medien gezeigt. Fast unvermeidlich begegnet man, sobald es um die Übergriffe im November 1938 geht, zum Beispiel der Serie eines Berufsfotografen aus Baden-Baden. Er soll ein NS-Gegner gewesen sein und die 22 Bilder nicht aus Voyeurismus, sondern aus Abscheu über die Demütigung seiner jüdischen Mitbürger gemacht haben; nachprüfbar ist das nicht.15 Zu sehen sind rund 80 männliche Juden, die in Reih und Glied durch die mondäne Kurstadt zur Synagoge getrieben wurden. Der Mann an der Spitze der Kolonne musste einen überdimensionalen Davidstern mit der zynischen Aufschrift »Unser Gott verlässt uns nicht« tragen. Im Gotteshaus wurden die Männer gezwungen, Passagen aus Hitlers Mein Kampf und anderen antisemitischen Schmähschriften vorzulesen sowie NSDAP-Lieder zu singen; danach wurden sie vor hunderten Schaulustigen durch die Stadt geführt und anschließend überwiegend ins Konzentrationslager Dachau abtransportiert.
Eine weitere Bilderserie ist aus Regensburg überliefert. Hier hielt ein Fotograf der örtlichen NSDAP-Zeitung fest, wie etwa 25 jüdische Männer gezwungen wurden, auf einen »Schandmarsch« durch die Innenstadt zu gehen. Sie mussten dabei eilig gemalte Schilder mit der Aufschrift »Auszug der Juden« tragen und wurden von bewaffneten Männern in den Uniformen verschiedener NSDAP-Gliederungen begleitet, die feixten und die Situation offensichtlich genossen. Ein weiteres Bild aus demselben Bestand zeigt mehr als zehn Personen, die teilweise nackt durch Schlamm robben mussten. Auch bei dieser Serie ist auf dem letzten Bild der Abtransport der Juden ins KZ zu sehen.16
Die insgesamt sieben Bilder der öffentlichen Demütigung der Guntersblumer Juden sind ohne Zweifel eine wichtige Ergänzung der bislang bekannten Aufnahmen aus anderen Orten. Das Beispiel des rheinhessischen Weindorfes reicht aber weit über diese Fotografien hinaus. Ebenso über die Tatsache, dass durch sie ein weiterer Erniedrigungsmarsch dokumentiert ist – neben Regensburg und Baden-Baden waren bisher schon ähnliche Demütigungen in Saarbrücken, Saarburg, Sinzig, Kehl am Rhein, Offenburg und Meppen im Emsland bekannt, außerdem im hessischen Felsberg, in Leiwen an der Mosel, Bad Lippspringe und Sonneberg in Thüringen.17 Weder die Übergriffe am helllichten Tag an sich noch die Existenz von Fotos davon heben Guntersblum grundsätzlich ab von anderen Kommunen.
Besonders, ja wahrscheinlich einzigartig ist gerade dieses Exempel, weil es ausgesprochen gut dokumentiert ist. Denn überdauert haben nicht nur die beiden in der Welt veröffentlichten sowie fünf weitere erschreckende Fotos. Bekannt sind die Namen aller sechs am 10. November 1938 durch den Ort getriebenen Männer, einschließlich ihres weiteren Schicksals: Vier von ihnen wurden 1941/1942 »nach Osten« deportiert und dort ermordet, zwei konnten Deutschland noch rechtzeitig verlassen. Es gibt zudem rund 150 Zeugenaussagen von Beteiligten oder Zuschauern dieser öffentlichen Demütigung: Schon zwei Wochen nach den Ausschreitungen hatte die örtliche Gendarmerie rund 60 Aussagen von Augenzeugen aufgenommen. Das Ziel der Ermittlungen war es, festzustellen, wer sich nicht auf das beabsichtigte Zerstören jüdischen Eigentums beschränkt, sondern entgegen ausdrücklicher Verbote von Geheimer Staatspolizei und NSDAP geplündert, sich also bereichert hatte. In der unmittelbaren Nachkriegszeit berichteten die zwei Überlebenden über den Marsch. Sie lösten mit ihren Schilderungen umfangreiche Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mainz aus, in deren Verlauf weitere mehr als 50 Aussagen protokolliert wurden; teilweise von denselben Personen, die schon Ende November 1938 befragt worden waren. Das Urteil des Landgerichts Mainz von 1948 gegen vier Haupttäter der Ausschreitungen bezog sich auf diese Ermittlungen, freilich kaum auf die Berichte der beiden Überlebenden, die nur schriftlich vorlagen; um juristisch in das Verfahren eingehen zu können, hätten sie in der Hauptverhandlung wiederholt werden müssen. Parallel dazu kamen die Ereignisse des 10. November 1938 bei den Vernehmungen Guntersblumer Nationalsozialisten im Zuge ihrer Entnazifizierungsverfahren zur Sprache. Nach dem Aufschrei, den 2008 der Welt-Artikel ausgelöst hatte, berichtete rund ein Dutzend Augenzeugen, die alle schon in sehr fortgeschrittenem Alter waren, wie sie die Ausschreitungen erlebt hatten; hinzu kamen einige nachgeborene Guntersblumer, die erzählten, was ihre Eltern und Großeltern gesagt hatten. Die meisten von ihnen wollen nicht mit Namen genannt werden, weil sie bei den Nachbarn negative Reaktionen auf ihre Offenheit befürchten – angesichts der Reaktionen im November 2008 eine durchaus nachvollziehbare Sorge. Neben diesen Archivalien und Zeugnissen gibt es für eine Reihe einflussreicher Bewohner die Unterlagen aus der einstigen Zentralkartei der NSDAP. Außerdem ist Guntersblum eine der ganz wenigen Kommunen, aus denen wenigstens einige Aktenbestände der Ortsgruppe erhalten sind.18 Schließlich hat der Heimatforscher Volker Sonneck die Berichterstattung der Lokalzeitung Landskrone über den Ort in den 1920er- und 1930er-Jahren mustergültig erschlossen und aufgearbeitet.
Die ungewöhnlich gute Quellenlage zu Guntersblum und der Verfolgung der dortigen Juden konnte dank großzügiger Unterstützung durch verschiedene Archive ausgewertet werden. Sowohl die Ermittlungs-, Gerichts- und NSDAP-Akten im Landesarchiv Speyer als auch Unterlagen zur Entnazifizierung mehrerer Täter im Landeshauptarchiv Koblenz sowie die Papiere zu ihrer Parteimitgliedschaft im Bundesarchiv Berlin konnten für die Recherchen uneingeschränkt und ungeschwärzt genutzt werden. Im Gegenzug mussten in diesem Buch die Namen aller Personen unkenntlich gemacht werden, die entweder nach 1917 geboren wurden oder an den November-Ausschreitungen nur am Rande beteiligt waren. Ihre echten Namen wurden durch deutlich veränderte Pseudonyme in kursiver Schrift ersetzt; in den Anmerkungen wird jeweils zusätzlich auf die Änderung des Namens hingewiesen. In gleicher Weise unkenntlich gemacht wurden die Namen der meisten Zeitzeugen, die Erinnerungen beisteuerten. Nicht betroffen sind von diesen datenschutz- und archivrechtlich erforderlichen Eingriffen alle Inhaber staatlicher Funktionen und von Parteiämtern der NSDAP.
»Kristallnacht« oder Pogrom?
Gemessen an dem, was den Guntersblumer Juden und ihren Geschäften, Wohnungen sowie ihrer Synagoge 1938 angetan wurde, unterscheidet sich das rheinhessische Weindorf gerade nicht grundsätzlich von mehr als tausend anderen Gemeinden in Deutschland – im Gegenteil: Zynischerweise waren solche Schändungen, Zerstörungen und Plünderungen für den antisemitischen Alltag im Dritten Reich normal.
Handelte es sich um ein Pogrom? Wörtlich bedeutet dieses aus dem Russischen stammende Lehnwort so viel wie »Unwetter« und übertragen »Verwüstung«.19 Der Duden definiert den Begriff sehr vage als »Ausschreitungen gegen nationale, religiöse oder ethnische Minderheiten«.20 So verstanden, handelte es sich im November 1938 auf jeden Fall um Pogrome: Juden in Deutschland waren, bei seinerzeit etwas unter 0,7 Prozent Anteil an der Gesamtbevölkerung und sinkender Tendenz, in jedem Fall eine religiöse, wenn auch weder eine nationale noch eine ethnische Minderheit21. Ihnen wurde in Form von Übergriffen ganz offen Gewalt angetan. Ihr Eigentum wurde zerstört oder geraubt; sie wurden verletzt und in die Rechtlosigkeit gestoßen, verhaftet und in hunderten Fällen sogar getötet.
Gleichwohl sträuben sich manche Historiker, den Begriff für die antisemitischen Ereignisse von 1938 zu verwenden, und führen dafür nachvollziehbare Gründe an: Sie verstehen Pogrome als Ausschreitungen, zu denen langsam anwachsende ethnische Konflikte, oft aus lokalen Anlässen, spontan eskalieren. Das Wort enthalte »Elemente der Spontaneität und suggeriert damit, dass hinter dem Terror die ›kochende Volksseele‹ steckte«, befand zum Beispiel der Geschichtsjournalist Friedemann Bedürftig: »›Pogrom‹ hat etwas von Naturereignis und anonymisiert die Verbrecher.«22 Die Historiker Ulrich Baumann und François Guesnet schrieben, das Wort entspreche nicht den »realen Umständen der Judenverfolgung im NS-Regime«: Wesentliche Elemente pogromartiger Gewalt fehlten im November 1938 und seien ersetzt worden durch staatliche Anweisungen.23
Die seit langem in Deutschland wie international am häufigsten verwendeten Begriffe »Reichskristallnacht« oder »Kristallnacht« sind mindestens genauso problematisch wie das Wort Pogrom. Wer genau diese Wortschöpfung in Umlauf gebracht hat, ist unklar. Aus der Zeit vor 1945 lässt sich das Wort bislang genau ein einziges Mal belegen, in einer auf Tonband mitgeschnittenen Rede des NSDAP-Funktionärs Wilhelm Börger aus dem Juni 1939: »Die Sache geht als Reichskristallnacht in die Geschichte ein.«24 Die erste nachgewiesene gedruckte Verwendung datiert vom 11. November 1945, als die Berliner Zeitung das Wort »Kristallnacht« benutzte, und zwar in Anführungszeichen.25 Schon wenige Tage zuvor hatte der Tagesspiegel darauf hingewiesen, dass die judenfeindlichen Ausschreitungen 1938 »im Volksmund die ›Kristallwoche‹ genannt« worden seien.26 Beide Formulierungen glaubten die Autoren der Artikel nicht weiter erläutern zu müssen; vermutlich, weil sie annehmen durften, dass ihre Leser damit keine Verständnisprobleme haben würden.
In regimekritischen Aufzeichnungen aus dem November 1938 ist der Begriff nicht zu finden; weder in den Berichten der Exil-SPD noch etwa im Tagebuch von Ruth Andreas-Friedrich, einer Berliner Journalistin und erklärten Hitler-Gegnerin. In der offiziellen Propagandasprache der NSDAP tauchte das Wort so wenig auf wie in internen Berichten der Gestapo; hier war meist von der »Judenaktion« die Rede.27 Der Dresdner Romanist Victor Klemperer, als verfolgter Jude jeder Sympathie für die Nazis unverdächtig, verwendete in seinem Tagebuch 1938 und erneut 1943 die Formulierung »Grünspan-Affäre«.28 Nicht einmal der Politikwissenschaftler und Publizist Dolf Sternberger, der unmittelbar nach 1945 begonnen hatte, die Deutschen über menschenverachtende Formulierungen »Aus dem Wörterbuch des Unmenschen« aufzuklären, vermochte den Ursprung des Wortes zu ermitteln: »Mir ist in Gesprächen gelegentlich die Vermutung begegnet, die Täter selbst hätten das Wort erfunden, und es ist wahr, man könnte auch ein Interesse am Euphemismus heraushören.« Doch das überzeugte den Sprachforscher nicht: »Das Verwegen-Lustige daran und das ›Kristall‹-Interesse wäre dem Göring’schen Milieu zwar durchaus zuzutrauen, nicht aber der Jux mit dem ›Reich‹. Diese Zusammensetzung hat ja auch eine höhnische Note, indem sie das parteiamtliche und das reichseinheitlich Durchorganisierte des Vorgangs blitz- und witzhaft kenntlich macht.« Sternberger schloss: »Die Vermutung spricht am ehesten für den anonymen Volkswitz, zumal den berlinischen.«29
Dagegen ist der Begriff »Pogrom« in einer Fülle von zeitgenössischen Zeugnissen belegt. Etwa bei verstörten bis schockierten Augenzeugen. So schrieb der Lehrer, spätere Wehrmachtsoffizier und Judenretter Wilm Hosenfeld schon am 12. November 1938 in sein Tagebuch: »Judenpogrome in ganz Deutschland. Es sind fürchterliche Zustände im Reich, ohne Recht und Ordnung, dabei nach außen Heuchelei und Lügen.«30 Der Diplomat und Hitler-Gegner Ulrich von Hassell verwendete knapp zwei Wochen später ganz selbstverständlich das Wort »Pogrom«.31 Ebenso viele Betroffene: Der jüdische Religionsphilosoph Martin Buber, dessen Haus im hessischen Heppenheim an der Bergstraße von Randalierern verwüstet worden war, schrieb nach seiner Flucht dem Finanzamt in seiner ehemaligen Heimatgemeinde aus Jerusalem, er könne verlangte Steuerschulden nicht begleichen, weil sein Eigentum bei den »Pogromen im November« zerstört worden sei.32
Im Ausland war dieses Wort ohnehin fast selbstverständlich, wenn es um die Ereignisse im Dritten Reich ging: Die Neue Zürcher Zeitung sprach von einem »wirklichen Pogrom«.33 Die im Exil zusammengestellten Deutschland-Berichte der SPD verwendeten die Wortbildungen »Pogromtage« und »Dauerpogrom«, sprachen außerdem von den »grauenvollsten Pogromen, die das nationalsozialistische Regime bisher inszeniert hat« und vom »Terror gegen die Juden«.34
Selbst wenn das Wort »Pogrom« streng betrachtet tatsächlich die Ereignisse in Deutschland im November 1938 nicht ganz trifft, so ist es doch genauer als jeder andere Begriff. Von »Unruhen« zu sprechen, würde der Dramatik der Ereignisse nicht gerecht. Das Wort »Reichskristallnacht« wiederum wird zwar international verstanden, hat jedoch drei Nachteile: eine unklare Herkunft, mindestens zum Teil Tätersprache zu sein und die Ereignisse auf die Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 zu reduzieren. Für Guntersblum und viele andere Orte in Deutschland gilt: Bei helllichtem Tag ereignete sich ein ganz normales Pogrom.
Spannungen
Fremdherrschaft
Das Ende des Ersten Weltkriegs traumatisierte ganz Deutschland; Rheinhessen und die anderen linksrheinischen Regionen traf es besonders hart. Bis Ende September 1918 hatten die meisten Bewohner hier wie im gesamten Reich noch an einen Sieg geglaubt, unterstützt von den zensierten Zeitungen und den Versprechungen der Beamten, Pfarrer und anderen Honoratioren vor Ort. Eine Niederlage galt als undenkbar – obwohl es eigentlich seit dem Frühsommer unübersehbar war, dass die Ressourcen Deutschlands auf allen Gebieten zur Neige gingen, die große Offensive des Frühjahrs steckengeblieben war und die Truppen des kaiserlichen Heeres inzwischen einen Rückschlag nach dem anderen erlitten.
So kam Anfang Oktober 1918 die offizielle Bitte der Reichsregierung an US-Präsident Woodrow Wilson, einen Waffenstillstand zu vermitteln, überraschend. In atemloser Geschwindigkeit brachen in den folgenden zwei Monaten jahrzehntelang selbstverständliche Gewissheiten zusammen: Am 9. November dankte Kaiser Wilhelm II. ab und floh ins niederländische Exil; Deutschland wurde Republik. Zwei Tage später akzeptierte eine Abordnung aus Berlin die Bedingungen des Waffenstillstandes. In den nächsten vier Wochen zogen erst mehrere Millionen deutsche Soldaten aus den Kampfgebieten in Belgien und Ostfrankreich über den Rhein nach Osten; ihnen folgten zwischen dem 7. und dem 11. Dezember die Verbände der französischen 10. Armee, die Rheinhessen besetzen sollte. Die Bewohner verfolgten ihren Einmarsch laut den Berichten der kommandierenden Offiziere »teilnahmslos«.1 Es begannen fast zwölf Jahre Fremdherrschaft – ein zusätzlicher Schock.
»Zusammenbruch. Das Furchtbare ist wahr geworden. Wir haben nach jahrelangem tapfersten Ringen die Waffen nicht nur niedergelegt, sondern abgeliefert, sind wehrlos geworden und werden ehrlos werden. Revolution. Kaisersturzpolitik«, notierte der nationalkonservative evangelische Pfarrer Karl Knab aus Rheinhessen, der selbst als Feldgeistlicher gedient hatte: »Ich fürchte schauerlichsten Untergang. Ich kann und will über das Schauerliche, das ich in diesen Tagen erlebe, nicht viel schreiben, nichts sagen von den entsetzlichen seelischen Kämpfen, die mich fast dem Wahnsinn nahebringen.«2 Ähnlich war die Stimmungslage bei vielen Einwohnern der linksrheinischen Gebiete: »Verräter, Lumpen und Halunken trieben ihr Unwesen und machten unser Vaterland zu einem politischen Trümmerhaufen«, erinnerte sich 1934 der Nationalsozialist Fritz Keppner; sein Parteigenosse Arthur Hessler schrieb: »Die Verräter rissen die Regierungsgewalt an sich, lösten die bestehenden Wehrorganisationen auf und vernichteten, was in 40-jähriger Aufbauarbeit Deutschland einst groß gemacht hatte.«3
Offiziell sollte die Besatzung der linksrheinischen Gebiete durch Frankreich, Großbritannien, Belgien und anfangs die USA garantieren, dass die Bedingungen des Waffenstillstandes eingehalten würden. Mindestens ebenso wichtig war, dass zwischen der Ostgrenze Frankreichs und dem Deutschen Reich eine Pufferzone entstand, in der sich keine deutschen Truppen aufhalten durften. Mittel- bis langfristig strebten zudem wenigstens manche Strategen in Paris wie im französischen Hauptquartier in Mainz an, einen separaten Rheinstaat zu gründen. Der kommandierende General der 10. Armee forderte deshalb seine Soldaten auf, sich so zu verhalten, dass sich die Einwohner Rheinhessens bei einer eventuellen Volksabstimmung für einen Anschluss an Frankreich oder zumindest die Unabhängigkeit von Deutschland entscheiden würden.
Dieses Ziel konterkarierten viele der Maßnahmen, die sofort in Kraft traten: Um die Sicherheit der Besatzungssoldaten zu gewährleisten, erließ die für die Verwaltung und vor allem die Koordination in den verschiedenen Besatzungszonen zuständige Hohe Interalliierte Rheinlandkommission umfassende Reisebeschränkungen und Ausgangssperren. Nur wer eine Genehmigung der in vielen größeren Orten eingerichteten alliierten Posten erhielt, durfte die nähere Umgebung seiner Heimatkommune verlassen; die einzigen automatischen Ausnahmen galten für die Beamten von Reichspost und Reichsbahn. Hingegen mussten selbst katholische Pfarrer, die für mehrere kleine Kirchengemeinden in weiterem Umkreis zuständig waren, sich bei der Besatzungsverwaltung um eine Sondergenehmigung bemühen – die nicht immer gewährt wurde. Noch unmittelbarer spürbar war das Verbot, vor sechs Uhr die Häuser zu verlassen, denn demnach durften die rheinhessischen Bauern nicht mehr wie üblich frühmorgens auf ihre Felder; viele Frühgottesdienste, zum Beispiel im Mainzer Dom, mussten ausfallen. Um organisierte Proteste und koordinierte Aktionen gegen die Besatzungstruppen zu erschweren, blieb der Telefonverkehr zwischen den besetzten und den unbesetzten Gebieten ebenso untersagt wie die private Korrespondenz; Telegramme mussten alliierten Kontrolleuren vorgelegt werden. Zulässig war nur Geschäfts- und Verwaltungspost, die jederzeit überprüft werden durfte. Potenzielle Aufrührer wurden besonders drangsaliert, ob es nun einen konkreten Anlass für Verdacht gab oder nicht: »Die Franzosen hatten eine so genannte Delegation errichtet, bei der ich mich wöchentlich zweimal melden musste, weil ich deutscher Offizier gewesen war«, erinnerte sich Fritz Daemrich. Er fühlte sich ausgeliefert und wurde dadurch zum Nationalisten: »In dieser Zeit begann ich erstmalig ernsthaft über Politik nachzudenken.«4 Wer tatsächlich tätig wurde gegen die Besatzung, konnte jederzeit mit seiner gesamten Familie aus den besetzten Gebieten ausgewiesen oder inhaftiert werden.
Ökonomisch verheerend wirkte sich auf Rheinhessen der fast völlige Abbruch des Warenverkehrs zwischen den besetzten und den unbesetzten Gebieten aus. Die linksrheinischen, vielfach vom Weinbau geprägten Gebiete verloren einen wesentlichen Teil ihrer traditionellen Absatzmärkte; viele Winzer bekamen ihre Fässer nicht rechtzeitig vor der Ernte 1919 leer, weil sie einfach keine Abnehmer fanden. Ähnlich ging es Bierbrauern und Hopfenbauern. Mehrere Essig-, Senf- und Konservenfabriken mussten ihre Produktion einschränken oder unterbrechen, weil linksrheinisch nicht so viel verbraucht werden konnte, wie hergestellt wurde. Umgekehrt fehlte der Holzwirtschaft in Rheinhessen der Nachschub, der traditionell aus den waldreichen Gebieten auf der anderen Seite des Stroms stammte. Ein besonderes Problem lähmte die Zementwerke: Ihnen fehlten Säcke für die Abfüllung, denn sie konnten nicht mehr wie früher üblich nach der Leerung auf Baustellen gesammelt per Postpaket zurückgeschickt werden.
Die Versorgung mit Lebensmitteln litt ebenfalls unter den Beschränkungen der Besatzungsverwaltung. So lagerten in Rheinhessen im Frühjahr 1919 große Mengen Zuckerrüben, die nicht über den Rhein transportiert werden durften und deshalb »bei Frost und Nässe der Fäulnis ausgesetzt« waren.5 Umgekehrt fehlten Getreide und Kartoffeln, die gewöhnlich von rechtsrheinischen Höfen geliefert wurden. Zwar durften Züge in diese Richtung über den Fluss fahren, wurden jedoch von bürokratischen Vorschriften behindert. Die alliierten Militärbehörden reagierten mit der Ausgabe eigener Lebensmittelkarten, die nicht zu einer effektiven Verteilung führten, sondern nur den Mangel auf andere Art verwalteten; Rheinhessen hungerte.
Gleichzeitig unterstützten die französischen Besatzungsbehörden separatistische Gruppen. Schon 1919/1920 gab es vereinzelte Aktionen profranzösischer Bürger, die das linksrheinische Gebiet für unabhängig vom übrigen Deutschland erklären wollten. Doch sie fanden in der Verwaltung und bei den Menschen wenig Rückhalt, wie eine einstimmig verabschiedete offizielle Entschließung vom März 1920 zeigte: »Der Provinzialtag der Provinz Rheinhessen lehnt als Vertreter aller Interessen der Heimat jede Bewegung, die unter Umgehung der Verfassung eine Loslösung oder Sonderstellung der rheinischen Länder will oder doch zur Folge haben kann, entschieden ab und bekennt sich aus nationalen, wirtschaftlichen und kulturellen Gründen zur unlöslichen Verbindung mit dem Deutschen Reiche.«6 Allein die Anwesenheit der Franzosen habe das »Aufkommen der separatistischen Bewegung ermöglicht«, befand ein junger Pfälzer; ein anderer, anderthalb Jahrzehnte älter, schrieb: »Dazu der Feind im Lande. Weißt Du noch, Kamerad, wie der Franzose landfremdes Gesindel in die Heimat brachte, Separatisten genannt, die uns feige und gemein die heilige Erde stehlen wollten?«7
Für besondere Erbitterung sorgte die Anwesenheit französischer Kolonialtruppen; ungefähr jeder fünfte Soldat der 85 000 Mann starken Besatzungstruppe stammte aus Nord- oder Schwarzafrika, weitere aus Indochina. Sowohl offizielle deutsche Stellen wie die nationalistische Presse rechts des Rheins beschimpften diese Männer als »Schwarze Schmach«. Die Kolonialtruppen seien ein »primitiver Schandfleck« im Herzen des zivilisierten Europa, brutale und weitgehend sexuell gesteuerte »Wilde«, die das deutsche Volk »rassisch verseuchen« sollten.8 Bei vielen Bewohnern kam die Propaganda an; Paul Moschel zum Beispiel dachte mit Schrecken an »die Besatzung durch Franzosen, Gelbe und Schwarze« zurück, »die in unserer Heimat ihr Unwesen trieben« und angeblich unzählige »Frauen und Mädchen schändeten«.9 Die Kinder, die aus solchen Vergewaltigungen hervorgingen, schmähte man »Rheinlandbastarde«. Freilich drang nicht durch, dass es sich nur um wenige Fälle handelte; tatsächlich hatte nur die Mutter eines einzigen der nachweislich 385 in ganz Deutschland registrierten Kinder afrikanischer Väter angegeben, zum Geschlechtsverkehr gezwungen worden zu sein.10 Weitaus mehr uneheliche Kinder deutscher Frauen wurden bei Vergewaltigungen durch hellhäutige Besatzungssoldaten gezeugt. Doch diese Verbrechen spielten in der öffentlichen Wahrnehmung kaum eine Rolle; sie wurden als Nebeneffekt jeder militärischen Besetzung hingenommen.
Anfang 1923 eskalierte die Lage. Deutschland war mit seinen Reparationslieferungen im Rückstand, bei Steinkohle um nur zehn Prozent, bei Holzstämmen für Leitungsmasten hingegen um zwei Drittel. Französische und belgische Truppen marschierten daraufhin am 10. Januar 1923 in das Ruhrgebiet ein, um Druck auf die Regierung in Berlin auszuüben und die Lieferung der vereinbarten Sachwerte zu erzwingen. Natürlich trat das Gegenteil ein: Durch Deutschland fegte eine Welle nationalen Protestes. Schlagartig endeten alle Reparationsleistungen; Beamte in den besetzten Gebieten sollten jede Zusammenarbeit mit fremden Truppen vermeiden. Die Reichsregierung um Kanzler Wilhelm Cuno rief die gesamte Bevölkerung zum passiven Widerstand auf; selbst der Reichspräsident Friedrich Ebert, ein pragmatischer Sozialdemokrat, sprach vom Kampf »für die deutsche Freiheit, für die deutsche Zukunft«.11 Bald fanden die französischen und belgischen Truppen, die den Abtransport von Holz und Kohle über die Grenzen überwachen sollten, keine Arbeiter mehr, die ihre Anweisungen befolgten. Daraufhin schloss die Besatzung zahlreiche Zechen und Fabriken. Die Reichsbahn stellte den Betrieb in den besetzten Gebieten gänzlich ein, die französischen und belgischen Truppen richteten einen rudimentären Ersatzverkehr ein, den immer wieder bewusst herbeigeführte Schäden an Weichen oder Gleisen behinderten. Um die Kosten ihres Einsatzes zu decken, beschlagnahmten die Besatzungsoffiziere öffentliche Mittel und die Barbestände von Firmenkassen. Die Reichsregierung zahlte allen Deutschen im Ruhrgebiet und links des Rheins, die wegen passiven Widerstandes ihre Arbeit verloren hatten, Überbrückungslöhne – das trieb die ohnehin schon grassierende Geldentwertung in astronomische Höhen. Wer sich offen weigerte, Befehle der Besatzungstruppen zu befolgen, wurde ausgewiesen; insgesamt betraf diese Sanktion bald 180 000 Menschen, die bei Verwandten oder in großen Sammellagern rechts des Rheins unterkommen mussten. Zusammenstöße mit deutschen Demonstranten oder Unfälle führten im Rheinland und im Ruhrgebiet 1923/1924 zu rund 140 Toten sowie mehr als 600 Verletzten. Radikale Nationalisten griffen mit Bomben die Besatzungstruppen an oder schossen aus dem Hinterhalt auf sie.
Am 12. April 1923 wies die französische Verwaltung zum ersten Mal Einwohner aus Guntersblum aus; bis Ende Juli betraf das insgesamt 22 Familien. Doch damit konnte die Front der Arbeitsverweigerer nicht aufgebrochen werden. Am 2. August verfügte die Besatzungsmacht deshalb eine Massenausweisung: 89 Familien hatten ihre Heimat zu verlassen, die Männer sofort, ihre Frauen und Kinder binnen drei Tagen. Beim Abschiedsgottesdienst für sie predigte der deutschnationale evangelische Pfarrer Ludwig von der Au über Psalm 126: »Herr, bringe uns zurück unsere Gefangenen.« Mit Kutschen, Leiterwagen und Autos fuhren die ausgewiesenen Familien zur nächstgelegenen Rheinbrücke nach Worms: »Der Tag glich der Mobilmachung bei Kriegsbeginn. Viel Jammern, lautes Weinen und Klagen.« Die Franzosen sperrten, möglicherweise als zusätzliche Schikane, die Brücke zeitweise, sodass sich die Wagen mit den ausgewiesenen Familien in Worms stauten. Acht Tage später mussten weitere zehn Familien Guntersblum verlassen, diesmal durchweg Angehörige von Beschäftigten der Reichsbahn. »Ungefähr 500 bis 600 Glieder hat die ganze Gemeinde einstweilen verloren. Wann werden sie zurückkommen?«, schrieb von der Au in seine Pfarrchronik – jeder fünfte Einwohner also.12 Erst nach rund einem Jahr durften die ausgewiesenen Guntersblumer wieder nach und nach zurückkehren; zu ihrer Begrüßung predigte der Pfarrer abermals über Psalm 126.