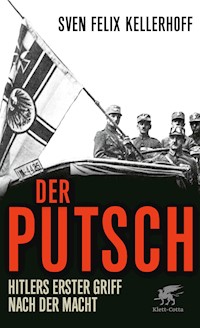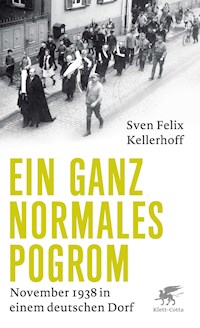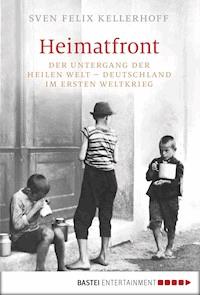
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Materialschlachten und das Massensterben an den Fronten des Ersten Weltkriegs sind vielfach dokumentiert. Frauen, Kinder und alte Menschen erlebten die "Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts" jedoch zu Hause. Sven Felix Kellerhoff gibt ihnen jetzt, hundert Jahre nach Kriegsbeginn, eine Stimme. Anhand von Tagebüchern, Heimatchroniken, Akten und Briefen schildert er ihr Leben, Denken und Fühlen im "Großen Krieg" daheim - zum Beispiel in Viersen am Niederrhein und im ostpreußischen Landkreis Lötzen, in der Garnisonsstadt Hildesheim, der Universitätsstadt Freiburg im Breisgau, in der Residenzstadt München und natürlich in der Hauptstadt des Reiches, Berlin.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 450
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Sven Felix Kellerhoff
HEIMATFRONT
Der Untergang der heilen Welt – Deutschland im Ersten Weltkrieg
Das Leiden der Kinder kennt im Krieg keine nationalen Grenzen: So, wie auf dem Schutzumschlagfoto die Jungen 1917 in Wien ihr mageres Essen von der öffentlichen Suppenküche holen müssen, haben auch viele Kinder in Deutschland unter den Folgen des Krieges gelitten.
Die Orthografie der Zitate wurde angepasst an die Regeln der neuen deutschen Rechtschreibung.
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Originalausgabe
Copyright © 2014 by Quadriga Verlag, Berlin und Sven Felix Kellerhoff in der Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Magnus Enxing, Münster
Umschlaggestaltung: fuxbux, Berlin
Umschlagmotiv: © INTERFOTO / IMAGNO / Sammlung Hubmann
Datenkonvertierung E-Book: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
ISBN 978-3-8387-5621-9
Sie finden uns im Internet unter
www.luebbe.de
Bitte beachten Sie auch: www.lesejury.de
INHALT
Heimatfront
Sommerfrische
Augusterlebnis
Ernüchterung
Kriegswirtschaft
Totaler Krieg
Rübenwinter
Revolution
Dolchstoß
ANHANG
Anmerkungen
Quellen und Literatur
Bildnachweis
Dank
Über den Autor
HEIMATFRONT
»Wie viele Stimmen haben für diesen Herbst den Frieden prophezeit, wie oft hörte man sagen: Es ist ja unmöglich, einen vierten Kriegswinter zu überstehen – und nun denkt kein Mensch mehr an Frieden, und jeder macht sich auf den Kriegswinter gefasst.«
Aus dem Tagebuch von Charlotte Herder,
Freiburg, 6.Oktober 1917
GENAU 1563 TAGE. Eine überschaubare Zeit, die doch unendlich lang sein kann. 1563 Tage dauerte der Erste Weltkrieg für Deutschland, von der Mobilmachung im kraftstrotzenden wilhelminischen Kaiserreich am 1.August 1914 bis zur Unterzeichnung des Waffenstillstandes durch Vertreter der eben erst ausgerufenen demokratischen Republik am 11.November 1918. In diesen gerade einmal viereinviertel Jahren veränderte sich das Antlitz Mitteleuropas total. Fast zehn Millionen Soldaten kostete der Konflikt das Leben, außerdem mindestens fünf Millionen Zivilisten. Wie hoch die Zahl der dauerhaft Versehrten war, wurde nie erhoben – die geläufige Angabe von 20Millionen Verwundeten ist nur ein grober Anhaltspunkt, weil darunter sowohl leicht- wie schwerstverletzte Männer fielen, psychische Schäden aber oft nicht registriert wurden.
Die politischen Folgen dieses massenhaften Tötens und Sterbens sind bekannt. Oft wird der erste moderne Großkrieg in Europa nach einer Formulierung des US-Diplomaten GeorgeF. Kennan als »Urkatastrophe des 20.Jahrhunderts« bezeichnet. Das ist durchaus zutreffend, denn ohne den Konflikt von 1914 bis 1918 hätte das 20.Jahrhundert einen radikal anderen Verlauf genommen. Auch den Schrecken des Graben- und Stellungskampfes, des industrialisierten Maschinenkrieges, haben Bücher wie Im Westen nichts Neues oder In Stahlgewittern schon früh eindringlich im kulturellen Bewusstsein verankert; beide Titel sind Teil des kollektiven Gedächtnisses der Deutschen. Lange verdrängt waren die Ereignisse an der Ost- und der Südfront, an denen ebenfalls in vorher unvorstellbarem Maße getötet und gestorben wurde; inzwischen werden diese Aspekte des Ersten Weltkrieges etwas stärker wahrgenommen.
Dagegen wird bis heute kaum beschrieben, wie die Menschen daheim den Ersten Weltkrieg erlebten, in den Städten und Dörfern zwischen Schleswig und Oberbayern, zwischen Breisgau und Ostpreußen. Wie nahmen Frauen und Kinder, die Alten und die Millionen Männer zwischen 18 und 60Jahren, die aus verschiedensten Gründen nicht an die Front einberufen worden waren, die Kämpfe wahr? Welche Rolle spielte der Krieg in ihrem Alltag? Wie veränderte sich ihr Leben?
Obwohl nur zwei kleine Randgebiete Deutschlands – zwischen Vogesen und Oberrhein im Westen sowie südlich und östlich von Königsberg im Osten – von den Kampfhandlungen überhaupt direkt betroffen waren und der Großteil der Gefechte französisches und belgisches, österreichisches und italienisches, am meisten aber polnisches und russisches Gebiet verwüstete, gab es eine Heimatfront. Der Krieg wurde hier ebenso geführt wie in den Schützengräben, nur mit anderen Methoden. Als Waffen dienten nicht Schrapnellgranaten und Maschinengewehre, sondern Kriegsanleihen und Propagandaplakate; das Leben wurde nicht bestimmt von monatelanger Langeweile in den Schützengräben und den kurzen, aber im wörtlichen Sinne lebensgefährlichen Angriffen der Gegner auf die eigenen Stellungen oder eigenen Attacken auf feindliche Befestigungen. In Deutschland bestand die größte Herausforderung spätestens ab dem Winter 1915/16 vielmehr im Kampf um das tägliche Brot. Um Positionen in den Schlangen vor Butterhandlungen oder Fleischereien rangen hungrige, oft verzweifelte Mütter und Kinder kaum weniger verbittert als ihre Männer, Brüder, Söhne oder Väter. Im Hungerwinter 1916/17 starben Hunderttausende Deutsche an Unterernährung; noch viel mehr entkamen diesem Schicksal nur um Haaresbreite.
Das Wort Heimatfront selbst etablierte sich erst in diesen viereinhalb Jahren. In der sechsten Auflage von Meyers Enzyklopädie, erschienen 1906 bis 1909, war es noch nicht gelistet; in der politischen Publizistik der frühen 1920er-Jahre dagegen taucht der Begriff häufig auf. Ähnliches gilt übrigens für das englische und das italienische Pendant. Obwohl diese Entente-Staaten anders als Deutschland nicht unter einer effizienten Seeblockade litten, sondern in großem Umfang Lebensmittel und Rohstoffe aus Übersee importieren konnten, setzten sich 1914 bis 1918 auch bei ihnen die Wortschöpfungen home front und fronte interno durch. Im Französischen dagegen gab es keine Entsprechung. Das überrascht nur auf den ersten Blick. Weil der zwar flächenmäßig relativ kleine, ökonomisch aber äußerst wichtige Nordosten des Landes rund vier Jahre lang von deutschen Truppen besetzt war, fand der Krieg aus französischer Perspektive wesentlich auf eigenem Territorium statt – also in der Heimat. Für eine Trennung zwischen Front und Heimatfront war entsprechend kein Raum.
Die grundsätzlichen sozialen Entwicklungen in Deutschland zwischen 1914 und 1918 sind schon vor Jahrzehnten substanziell beschrieben worden. Jürgen Kocka beleuchtete sie 1973 in seiner methodisch bahnbrechenden Arbeit Klassengesellschaft im Krieg, einem der Marksteine in der Differenzierung der klassischen Geschichts- zur historischen Sozialwissenschaft. Drei Jahrzehnte später bilanzierte Kockas langjähriger Bielefelder Kollege Hans-Ulrich Wehler die Ergebnisse dieser Unterdisziplin im vierten Band seiner gewaltigen Deutschen Gesellschaftsgeschichte. Doch beide Arbeiten, Standardwerke bis heute, berührten eine entscheidende Frage nur am Rande: Wie fühlte sich der Krieg in der Heimat an?
Für ganz Deutschland lässt sich eine solche Frage schlechterdings nicht in nur einem Buch beantworten – man muss zwangsläufig auswählen. In meinem 2011 erschienenen Band Berlin im Krieg über die Reichshauptstadt zwischen 1939 und 1945 habe ich mich regional bewusst stark konzentriert. Für den Ersten Weltkrieg kam eine solche regionale Beschränkung nie infrage. Studien zu einzelnen Orten, oft aktengestützt, gibt es durchaus. So wenig wie diese hätte auch eine lokale Untersuchung die leitende Fragestellung beantworten können, wie die Situation in Deutschland insgesamt war. Aber wie wählt man die Orte aus, die man genauer betrachtet? Und welche Quellen legt man einer solchen Arbeit zugrunde? Die scheinbar unterschiedlichen Probleme erwiesen sich als untrennbar miteinander verbunden. So viele Quellen inzwischen auch ediert oder in anderer Form zugänglich sind – repräsentativ sind nur wenige von ihnen. In der Konzeptionsphase dieses Buches wurde mir daher klar, dass ich außer auf Zeitungsartikel aus deutschen und internationalen Blättern vor allem auf ausgewählte Selbstzeugnisse zurückgreifen musste.
Zwei Orte standen von vornherein fest: Die Reichshauptstadt Berlin war unverzichtbar, ebenso die bayerische Residenzstadt München. Hier konzentrierte sich 1914 bis 1918 das politische Geschehen, erreichte die Revolution in den letzten Kriegstagen ihren ersten Höhepunkt. An Quellen herrscht für beide Städte kein Mangel: Hinsichtlich Berlins sind etwa das brillante Kriegstagebuch des zu Unrecht nur noch als Namensgeber eines Journalistenpreises in der Öffentlichkeit präsenten Chefredakteurs des Berliner Tageblatts, Theodor Wolff, sowie die Aufzeichnungen der expressionistischen Künstlerin Käthe Kollwitz zu nennen. Ergänzend kamen die Stimmungsberichte des Berliner Polizeipräsidenten hinzu, das Tagebuch der Fürstin Blücher, einer gebürtigen Britin, und weitere Zeugnisse. Für München stellen die bis 1917 überlieferten Tagebücher des Anarchisten und Bohemiens Erich Mühsam die wichtigste Quelle. Für die letzten Monate des Krieges sind die reflektierten Aufzeichnungen des Gymnasiallehrers Josef Hofmiller ausschlaggebend, außerdem die Memoiren der großbürgerlichen Frauenrechtlerin Constanze Hallgarten.
Welche Regionen jenseits Berlins und Münchens sollten und mussten einbezogen werden, um ein Bild von »Deutschland im Ersten Weltkrieg« zeichnen zu können? Ich entschied mich für Freiburg im Breisgau, das Hauptziel der im Ersten Weltkrieg noch recht seltenen und ineffizienten Luftangriffe. Charlotte Herder, die Ehefrau des Verlegers Hermann Herder, hat das Leben dort in ihrem weitgehend vergessenen Kriegstagebuch beschrieben. Außerdem wählte ich die Garnisonsstadt Hildesheim, zu der es nicht nur die detaillierte, zeitnah entstandene Heimatchronik von Adolf Vogeler gibt, sondern auch das aus gewissermaßen externer Perspektive geschriebene Tagebuch von Annie Dröege, der britischen Ehefrau eines Deutschbriten, der 1914 bis 1917 als »feindlicher Ausländer« interniert war, obwohl seine Familienverhältnisse nicht anders als bei Kaiser WilhelmII. waren: deutscher Vater und britische Mutter mit Lebensmittelpunkt auf dem ererbten Besitz in Deutschland.
1914 lebte nur ein gutes Drittel aller Deutschen in Groß- und Mittelstädten, die Mehrheit aber in Kleinstädten und auf dem Land. Auch diese Regionen sollten vertreten sein. Ich entschied mich daher einerseits für das Dreistädtegebiet Viersen–Dülken–Süchteln am Niederrhein in Grenznähe zu den 1914 bis 1918 neutralen Niederlanden, und zwar aus zwei Gründen: Erstens hatte Peter Stern, Oberbürgermeister von Viersen, schon bald nach dem Krieg eine materialreiche, wenngleich sehr nüchterne Broschüre über Kriegszeit und Kriegswirtschaft in Viersen veröffentlicht. Zweitens hat das rührige Viersener Stadtarchiv vor Kurzem eine umfangreiche Ausarbeitung über das Dreistädtegebiet im Ersten Weltkrieg vorgelegt, in der in großem Umfang Archivmaterialien verarbeitet sind. Daneben musste auch Ostpreußen vertreten sein – 1914/15 als einzige Region von russischen Truppen besetzt. Über diese Erfahrung erschienen früh schon eine ganze Reihe von Broschüren, etwa vom durch den russischen Ortskommandanten zeitweilig eingesetzten deutschen Zivilgouverneur von Gumbinnen, einem Gymnasiallehrer. Vor allem aber existiert – ein absoluter Glücksfall – das Tagebuch der Haushaltshilfe Henriette Schneider, die im ostpreußischen Landkreis Lötzen und ab 1918 im noch weiter südöstlich gelegenen Lyck lebte. Private Aufzeichnungen von Menschen aus weniger gebildeten Schichten, wenn sie überhaupt überliefert sind, beschränken sich oft auf kaum aussagekräftige Beschreibungen oder die Wiedergabe der jeweils aktuellen Propaganda. Bei Henriette Schneider ist das anders: Ihr Tagebuch enthält auch viele für die politische und ökonomische Situation aussagekräftige Eintragungen.
Mit diesen sechs Orten von der Metropole bis zur Provinz lässt sich repräsentativ beschreiben, wie die Deutschen den Ersten Weltkrieg erlebten. Wie in fast allen meinen Büchern erzähle ich auch in Heimatfront Geschichte in Geschichten. Die große Politik kommt eher am Rande vor, ebenso Wirtschaftsstatistiken und Gesetze. Viel spannender als die offiziell vorgesehenen Kaloriensätze sind doch Empfehlungen von Behörden, Saatkrähen oder Sperlinge zu Geflügelsuppe zu verarbeiten. Wo haben Mülltrennung und Sommerzeit ihren Ursprung? Natürlich im Ersten Weltkrieg!
1914 ging nach 43Jahren voller Frieden die heile Welt des langen 19.Jahrhunderts zu Ende; es folgte das kurze 20.Jahrhundert mit zuvor unvorstellbaren Verbrechen und Gewalttaten. Seit der Einheit Deutschlands 1990 findet dieses Land langsam wieder zurück zu der Rolle, die es seiner Geografie und Größe entsprechend zu spielen hat. Vor hundert Jahren haben die damaligen Deutschen wie auch die anderen Völker Europas beim Zusammenwachsen des Kontinents viele Fehler gemacht, die in eine doppelte Katastrophe mündeten. Wenn überhaupt, dann kann die Menschheit meiner festen Überzeugung nach nur aus Erfahrungen lernen, also aus der Vergangenheit. Dazu ist Geschichte unverzichtbar, also das Bild, das eine Gesellschaft sich von der eigenen vergangenen Wirklichkeit macht. Nie wieder sollte eine allen Schwächen und Mängeln zum Trotz eben insgesamt doch heile Welt zugunsten vager bis kategorisch abzulehnender Verheißungen aufgegeben werden.
SOMMERFRISCHE
ANTEILNAHME IST FLÜCHTIG. Sie kommt schlagartig, aber vergeht fast genauso rasch. Am frühen Nachmittag des 28.Juni 1914, eines warmen Frühsommersonntags, liefen in Deutschland die Telegrafendrähte heiß. Von Station zu Station gaben Beamte der Reichspost verwirrende, oft widersprüchliche Nachrichten weiter – und erzählten sie unmittelbar danach Bekannten und Verwandten. Fast genauso schnell wie Telegramme Hunderte Kilometer überwanden, verbreiteten sich in den größeren Städten des wilhelminischen Kaiserreichs Gerüchte. Von einem oder gleich mehreren Attentaten auf den Thronfolger der österreich-ungarischen Doppelmonarchie war die Rede; Franz Ferdinand sei in Sarajevo mit einer Bombe beworfen oder aber beschossen worden. Einigen Meldungen nach habe der 50-jährige Neffe Kaiser Franz Josephs den Angriff unverletzt überstanden, anderen zufolge sei er schwer verwundet worden. Manchmal hieß es, der Thronfolger habe den Besuch in der bosnischen Regionalhauptstadt fortgesetzt, sich sogar auf den Weg gemacht, um Verletzte des misslungenen Bombenanschlags aufzusuchen; dann wieder, er sei selbst tödlich getroffen ins örtliche Regierungsgebäude gebracht worden. Paradoxerweise trafen diese widersprüchlichen Nachrichten alle zu – zur jeweiligen Zeit ihrer Entstehung.
Erst kurz nach 15Uhr gab der Hof in Wien eine offizielle Mitteilung heraus: Beim Besuch des Thronfolgers in Sarajevo hatte es tatsächlich zwei Angriffe auf Franz Ferdinand und seine Frau Sophie gegeben. Zuerst, kurz vor halb elf Uhr, war eine Bombe auf ihr Auto geschleudert worden. Aber der Chauffeur hatte instinktiv beschleunigt, weshalb die Granate hinter dem Wagen detoniert war und einige Männer des Begleitkommandos verwundet hatte. Den für 10:30Uhr geplanten Empfang im Rathaus von Sarajevo brach Franz Ferdinand kurzerhand ab und befahl, ins Krankenhaus zu fahren, um den Verletzten der Explosion beizustehen. Der Weg seiner Fahrzeugkolonne dorthin führte an einem weiteren Attentäter vorbei, Gavrilo Princip, einem schmächtigen jungen Mann. Etwa 20Minuten nach dem ersten Anschlag bog der offene Wagen des Thronfolgers zufällig keine zwei Meter entfernt von Princips Standort langsam ab. Das ließ sich der Attentäter, ein bosnisch-serbischer Nationalist, nicht entgehen: Er zog seine Pistole und drückte zweimal ab. Die eine Kugel durchschlug das Schlüsselbein Franz Ferdinands und blieb in seiner Wirbelsäule stecken, die andere traf Sophie in den Unterleib. Sofort gab der Chauffeur Gas und erreichte binnen weniger Minuten den Dienstsitz des habsburgischen Gouverneurs, wo schon mehrere Ärzte warteten. Doch Franz Ferdinand war bereits bewusstlos und starb kurz darauf.1
In Berlin war die Innenstadt wegen des warmen, schönen Wetters relativ ruhig; viele Bewohner vergnügten sich bei Freiluftkonzerten oder spazierten durch Parks und Wälder in der Nähe. Als die Gerüchte über die Ereignisse in Sarajevo sich am Nachmittag zur Gewissheit verdichteten, spielte manche Kapelle spontan und unter stürmischem Applaus die habsburgische Hymne »Gott erhalte Franz, den Kaiser«, um darauf ihren Auftritt zu beenden.2 Kaum dass sie von den umlaufenden Gerüchten gehört hatten, machten sich Redakteure, Setzer und Drucker auf in ihre Verlagshäuser. Da die Zeitungen sonntags keine regulären Abendausgaben herausbrachten, waren die Redaktionen im Presseviertel beiderseits der Kochstraße weitgehend verwaist. Doch das Hörensagen über ein Attentat in Sarajevo, per Telefon und Mundpropaganda weiterverbreitet, sorgten dafür, dass bald genügend Personal für schnelle Sonderausgaben anwesend war. Mitunter waren es sogar die Verlagschefs selbst, die sich auf den Weg machten. Rudolf Ullstein, einer der fünf Teilhaber des größten Verlags Europas, reagierte am schnellsten. Wie seine vier Brüder war er aus der Nachrichtenzentrale des Verlagshauses telefonisch informiert worden und ließ sich umgehend ins Zeitungsviertel chauffieren. Vorher aber schickte er noch eine Depesche: »Bereitet ein Extrablatt vor. Einen Maschinenmeister, sechs Setzer, fünf Drucker und sechs Bleigießer organisieren, 30Transporter im Hof bereitstellen.« Die Telefonzentrale des Verlags bekam zusätzlich den Auftrag, alle verfügbaren Redakteure der drei wichtigsten Ullstein-Blätter, der Vossischen Zeitung, der Berliner Morgenpost und der B.Z. am Mittag, in die Redaktion zu holen. »15Minuten später war Rudolf selbst vor Ort und veranlasste alles Weitere«, erinnerte sich sein jüngster Bruder Hermann: »Er bediente vier oder fünf Telefone gleichzeitig. Seine ganze Mannschaft war im Nu versammelt, um seine Befehle entgegenzunehmen. Als ich eine Viertelstunde später eintraf, hatte Rudolf die Lage so weit unter Kontrolle, dass es wie ein ganz normaler Werktag aussah.«3 Doch es war kein gewöhnlicher Werktag – Tempo zählte an diesem Sonntag noch mehr als im gewöhnlich schon sehr schnellen Zeitungsgeschäft. Um ihre Druckmaschinen möglichst rasch anwerfen zu können, gossen die Setzer in den meisten Verlagshäusern die einlaufenden Depeschen einfach hintereinander in Blei– sogar wenn sie einander direkt widersprachen. Am Nachmittag verteilten Zeitungsjungen erste Extrablätter. »Der österreichische Thronfolger ermordet!«, riefen sie und bestätigten so die umlaufenden Gerüchte.4 Berlin vibrierte.
In den nächsten Tagen war der Anschlag in Sarajevo das beherrschende Thema in Deutschland; zunächst in den Städten, bald auch in der Provinz, schließlich auf dem Land. Doch die Reaktionen waren sehr unterschiedlich. In kaisertreuen, nationalen Kreisen schlug Empörung über den Anschlag und die Provokation des wichtigsten Verbündeten des Deutschen Reichs hoch. In der Garnisonsstadt Hildesheim etwa forderten Mitglieder von Kriegervereinen, Österreich solle wegen des Mordes von Sarajevo mit dem feindlich gesinnten Königreich Serbien »die Sprache der Bajonette und Kanonen« sprechen.5 Der Rechtsreferendar Carl Schmitt notierte in sein Tagebuch: »Als ich nach Hause zurückgefahren war und im Kaiserhof zu Abend aß, kam der Referendar Capelle, der dort mit seinem Verhältnis ebenfalls zu Abend aß, auf mich zu und erzählte mir, dass der Thronfolger von Österreich mit seiner Frau von einem Serben erschossen worden sei. Ich war vernichtet.« Schmitt ging auf sein Zimmer, konnte »nichts arbeiten«, schrieb seiner Verlobten einen »ernsten, innigen Brief, rannte herum und war nur mit den letzten Dingen des Menschen beschäftigt«. Erst nach einiger Zeit fing sich der junge Jurist: »Allmählich kehrte meine Ruhe wieder. Ich las etwas, wurde beinahe frivol und erkannte, mit welcher schauerlichen Zähigkeit ich am Leben hänge.« Einen Tag später erfuhr Schmitt aus den Zeitungen den Namen des Attentäters und notierte zynisch: »Da soll einer nicht grimmig lachen: Der Thronfolger von Österreich und seine Gemahlin werden erschossen von einem 19-jährigen Gymnasiasten, der Princip heißt.«6
Unterschiedlich fiel die Reaktion im liberalen Bürgertum aus, zum Beispiel bei den Professoren der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg. Der Historiker Friedrich Meinecke hielt sich gerade im idyllischen Kurpark Badenweiler auf, als er von dem Attentat erfuhr: »Sofort wurde mir schwarz vor Augen. Das bedeutet Krieg, sagte ich mir.«7 Dem Mathematiker Lothar Heffter zufolge »wusste jedermann: Das bedeutet Krieg«. Auch der Sozialdemokrat Wilhelm Engler, der im Freiburger Stadtrat saß, hatte »das bestimmte Gefühl: Jetzt kommt der Krieg«.8 Anders reagierte der Zoologe Franz Doflein, der von dem Attentat während eines Ausflugs in die linksrheinischen Vogesen erfuhr, die seit 1871 zu Deutschland gehörten: »Noch dachten wir nicht an die Folgen des Attentates, wenn wir auch empfanden, dass in der geladenen Atmosphäre Europas eine kleine Ursache genügen konnte, um große Folgen auszulösen.«9
Gleichgültig zeigten sich sogar der Freiburger Philosophiestudent Ludwig Marcuse und seine Kommilitonen. Für diesen Sonntagabend hatte sich ein Kompagnon seines Vaters angesagt; er lud Ludwig zum Essen im feinsten Lokal der badischen Universitätsstadt ein. Doch Marcuse und einer seiner Freunde konnten die Verzweiflung des leichenblassen Besuchers über das Attentat nicht nachvollziehen. Die beiden jungen Studenten erschütterte die Meldung »mitnichten«. Vielmehr sahen sie sich verständnislos an und fragten sich wortlos, ob und wenn ja, was diese Neuigkeit für sie zu bedeuten habe. Am folgenden Tag erkundigte sich Marcuse bei gleichaltrigen Freunden, ob denn die Nachricht aus Sarajevo wirklich wichtig sei. Er bekam zur Antwort: »Viele alte Leute interessieren sich eben für Politik.«10
Ebenfalls beinahe desinteressiert notierte der Oberschüler Otto Braun einen Tag nach seinem 17.Geburtstag in sein Tagebuch, er habe die Nachricht aus Sarajevo an diesem Sonntagabend »nach Hause gebracht«. Der Sohn der Frauenrechtlerin Lily und des sozialdemokratischen Publizisten Heinrich Braun hielt über das anschließende Gespräch mit seinen Eltern fest: »Eifrig diskutiert. Sehr interessant.«11 Weiter beschäftigte sich der junge Mann allerdings mit den Vorgängen auf dem Balkan und ihren Folgen für die europäische Politik nicht.
In der Provinz, abseits der Städte, dauerte es etwas länger, bis die Neuigkeiten ankamen. Doch die Wirkung war ähnlich: »Wie ein Blitz aus heiterem Himmel« sei die Nachricht aus Sarajevo eingeschlagen, berichtete die Volks-Zeitung aus Viersen am Niederrhein.12 Die Hiobsbotschaft überwand in wenigen Stunden, obwohl es noch kein Radio gab und kaum Telefonleitungen in ländlichen Regionen, Hunderte von Kilometern scheinbar mühelos. Schon am Morgen des 29.Juni 1914 erfuhr die Haushaltshilfe Henriette Schneider im ostpreußischen Landkreis Lötzen, gut hundert Kilometer südöstlich von Königsberg, von einer Bekannten von dem Attentat. In ihr Tagebuch notierte sie: »Erzherzog Franz Ferdinand, Thronfolger von Österreich, ist mit seiner Gemahlin ermordet worden. Der Täter, Serbe, schoss mit seiner Pistole und traf beide tödlich. Mein Gott, welch ein Abschaum von Verworfenheit!«13
Die Meldung bestimmte die Schlagzeilen praktisch aller deutschen Zeitungen. Das in der Reichshauptstadt redigierte SPD-Parteiblatt Vorwärts kommentierte die politischen Risiken: »Das Problem Österreich erhebt sich immer drohender zu einer Gefahr für den Frieden Europas. Soll diese Gefahr nicht zur fürchterlichen Wirklichkeit werden, so müssen wir mit aller Kraft trachten, mit Frankreich und England in freundschaftliches Einvernehmen zu gelangen. Auch für Deutschland bedeuten die Schüsse von Sarajevo eine ernste Warnung.«14 Das Berliner Tageblatt, eine der drei international angesehensten Zeitungen Deutschlands, benannte andere Verantwortliche für die Krise: »Europa hat über Nacht eine der ernstesten Gefahren entdeckt, von denen seine Ruhe, von denen der friedliche Fortbestand aller Verhältnisse dieses Erdteils bedroht ist: die großserbische Bewegung, die im Sinne ihrer Urheber nur durch einen Weltkrieg zu lösen ist.«15
Doch fast so rasch, wie das Attentat in Sarajevo die Gemüter erregt und Anteilnahme mit dem Schicksal des wichtigsten deutschen Verbündeten geweckt hatte, verflüchtigte sich das Thema wieder aus den alltäglichen Gesprächen. Der Mordanschlag hatte keine unmittelbar sichtbaren Folgen; der österreichische Hof stritt augenscheinlich mehr über Fragen des Zeremoniells bei der Trauerfeier für das Thronfolger-Paar als über politische Konsequenzen. Man ahnte nicht, dass in diplomatischen Kreisen längst vertraulich über einen möglichen Krieg gesprochen wurde, in den Europa »von heute zu morgen« verwickelt werden könnte.16 Und weil die meisten Deutschen davon nichts erfuhren, verloren sie in der ersten Juliwoche das Interesse. Manche kluge Menschen fühlten sich sogar genervt, wenn die Rede doch noch einmal auf das Attentat zu kommen schien. So Ludwig Marcuse, der als Gasthörer ein anderes Kolleg besuchte: »Da war immerzu von serbischen Schweinen die Rede. Ich dachte: ›Schon wieder die Affäre Thronfolger.‹ Viel später erfuhr ich, es waren essbare Schweine gemeint.«17
Außenpolitische Ereignisse von sekundärer Bedeutung verdrängten den Mord von Sarajevo auf die hinteren Seiten der Zeitungen, vor allem der Prozess gegen die Sozialistin Henriette Caillaux, die den Chefredakteur der Pariser Zeitung Figaro erschossen hatte, weil er intime Brief von ihr veröffentlichen wollte, und einer von den zahlreichen kleineren Aufständen auf dem südlichen Balkan, diesmal in Albanien. Nur noch einige Zeitungskommentatoren interessierten sich für die Folgen des Attentats; die Hildesheimer Allgemeine Zeitung etwa stellte am 5.Juli 1914 fest: »In ernster Sorge wendet sich der Blick nach dem Balkan. Die großserbischen Ideen können, wenn die Spannung auf die Spitze getrieben und Österreich herausgefordert werden sollte, der Anlass zum Weltbrand werden, vor dem ein gütiges Geschick uns bisher bewahrt hat.«18 Grund für akute Sorgen sah das Blatt aber ebenfalls nicht.
Die deutsche Öffentlichkeit erfuhr freilich nicht, dass Kaiser WilhelmII. inzwischen sehr erregt war und intern forderte: »Mit den Serben muss aufgeräumt werden, und zwar bald.«19 Dem österreichisch-ungarischen Botschafter in Berlin sagte der impulsive Herrscher genau eine Woche nach dem Attentat kurzerhand die »volle Unterstützung Deutschlands« zu, obwohl er sich noch gar nicht mit seinem Reichskanzler beraten hatte.20 Mit baldigen Konsequenzen aus diesem »Blankoscheck« rechnete WilhelmII. aber offenbar nicht, denn er trat wie geplant seine übliche Sommerkreuzfahrt in norwegischen Gewässern an und verließ Berlin am 6.Juli 1914. Überall im Reich sah man das als Bestätigung der eigenen Einschätzung: Wenn der Kaiser in die Ferien fuhr, konnte die Krise wohl nicht besonders gefährlich sein.
Nach der zeitweiligen Aufregung über den Doppelmord in Sarajevo kehrten die meisten Deutschen zum Alltag zurück, und das hieß im Juli wie in jedem Jahr für viele: zum Urlaub. Der ausgezeichnet vernetzte Theodor Wolff, der als Chefredakteur des Berliner Tageblatts zu den einflussreichsten deutschen Journalisten gehörte, fand nichts dabei, Anfang Juli wie geplant mit seiner Familie an die holländische Nordseeküste abzureisen, in den Badeort Scheveningen. In der Umgebung der Reichshauptstadt strömte Jung und Alt bei Temperaturen jenseits von 30Grad zum Wasser; die Strandbäder am Wannsee, Müggelsee und Tegeler See waren überfüllt. Der Zoologische Garten zog mehr Besucher an denn je. Stadtgespräch war ein deutscher Pilot, der vom Flugplatz Johannisthal aus drei Mal innerhalb weniger Tage neue Rekorde im Dauerflug aufgestellt hatte; bei seinem letzten Versuch hielt sich der tollkühne Flieger zwischen Start und Landung genau 24Stunden und elf Minuten in der Luft.
Gleichzeitig machte der heiße Sommer der Metropole zu schaffen: »Auf den Asphalt in den Straßen hat die Hitze bereits derart nachteilig eingewirkt, dass ganze Stellen weich wurden und einfielen. Der Eisverbrauch ist in Markthallen, den Geschäften und im Haushalt jetzt so enorm, dass die Eisfabriken nur schwer imstande sind, alle Nachfragen zu erfüllen«, klagte der Vorwärts.21 Auch führten die hohen Temperaturen in den Seen zu Sauerstoffmangel und damit zu einem verbreiteten Fischsterben. Doch daran störten sich nicht allzu viele Hauptstädter; sie hatten wichtigere Themen zu bereden. Vor allem modebewusste Damen diskutierten, dass immer mehr männliche Bürger bei der schweißtreibenden Wärme ihre Gehröcke daheim ließen und in Hemdsärmeln auf die Straßen gingen. Man konnte sich nicht einigen, ob das schicklich sei.
Für den Gymnasialprofessor Rudolf Müller aus Gumbinnen in Ostpreußen war es selbstverständlich, wie vorgesehen mit seiner Familie ins Rheingau in den Urlaub zu fahren. Am 18.Juli 1914 bestiegen sie von Aßmannshausen aus den Niederwald, zum dortigen Nationaldenkmal hoch über dem Rhein, um die Aussicht zu genießen. In fröhlicher Stimmung sangen die Müllers erst gemeinsam mit einigen jungen Leuten, dann mit einer Schulklasse und ihrem Lehrer. »Da blieb tatsächlich kein Auge tränenleer, und stumm in heiliger Andacht saßen alle ringsum hier, den Blick zum herrlichen Denkmal gerichtet.« Auf dem Rückweg kam man ins Gespräch, gedachte der »glorreichen Zeit, an die wir eben so lebhaft erinnert worden waren«, nämlich den kurzen Deutsch-Französischen Krieg 1870/71, und war »unwillig«, weil Deutschland sich seit Längerem Demütigungen gefallen ließ, »statt wie damals zum Schwerte zu greifen und die frechen Feinde niederzuschmettern«. Weitere Gedanken machte sich die Gruppe nicht. »Wir ahnten nicht, wie nahe uns der Krieg bevorstünde; wir ahnten nicht, welche furchtbaren Opfer er aus unserer Mitte fordern würde.«22
Derweil bereitete sich Hildesheim auf das traditionsreiche Schützenfest vor, das mit einem großen Umzug durch die Altstadt beginnen sollte. In diesem Jahr war es der Knochenhauer-Gilde gewidmet; eine heimische Künstlerin hatte dafür historische Kostüme in Anlehnung an die Zeit um 1550 entworfen, die nun genäht werden mussten. Die Hildesheimer Allgemeine Zeitung schrieb Mitte Juli 1914: »Wir sollten nicht vergessen, was wir unserem geeinten, starken Vaterlande zu danken haben. Wir können am Frieden uns erfreuen, und in dieser Beziehung sind wir wohl besser daran als unsere Väter.«23 Außerdem fieberte die Bürgerschaft der Stadt mit großem Ernst dem Kongress der Deutschen Anthropologischen Gesellschaft Anfang August entgegen. Mehrere Hundert Teilnehmer hatten sich angemeldet; es sollte das wichtigste Ereignis des Jahres werden, zudem ein gutes Geschäft für die Hildesheimer Gasthäuser und Lokale, die weitgehend ausgebucht waren.
Der Wahlmünchner Thomas Mann brach zu einem Vortrag über Arthur Schopenhauer nach Freiburg auf, der als ein veritabler Erfolg vor vollem Auditorium und dankbar in den örtlichen Zeitungen registriert wurde.24 Bald danach, in der zweiten Juliwoche, begannen für die fast 3200 Studenten der immerhin fünftgrößten Universität Deutschlands die Semesterferien. Bevor sie abreisten, feierten die Kommilitonen aber noch mit einer Fülle von Bällen, Kneipen und Stiftungsfesten das absolvierte Studienjahr. Ruhe kehrte in der Stadt dennoch nicht ein, denn Tausende Gäste aus fast allen Teilen Deutschlands kamen an. Freiburg und seine malerische Umgebung direkt am Rande des Schwarzwalds gehörten zu den liebsten Zielen für eine Städtereise. Derweil stritt sich der Bürgerausschuss um ganz praktische Fragen wie die Verlängerung einer Straßenbahnlinie. Von den Blättern der Universitätsstadt berichtete allein die nationalliberale Breisgauer Zeitung weiter bevorzugt über die internationale Krise und beschrieb, dass die Entwicklungen Auswirkungen für Freiburg haben könnten. Die übrigen Gazetten waren wie die öffentliche Verwaltung und das Militär geradezu »sorglos«.25
Auch in der Provinz kehrte das Leben nach der Aufregung um den Doppelmord in Bosniens Hauptstadt wieder in seine gewohnten Bahnen zurück. Die Berichterstattung über mögliche Hintergründe und Folgen in den Viersener Zeitungen ebbte ab; Themen wie die Unruhen in Albanien rückten in den Vordergrund. Ein Gastbeitrag des prominenten Militärschriftstellers und Generalmajors a.D. Arthur von Loebell allerdings beschrieb die Bedeutung des Luftkampfes in kommenden Konflikten und lobte die deutschen Fortschritte im Festungskrieg; das war ein Beitrag in der Viersener Zeitung zur Stärkung des patriotischen Selbstbewusstseins der Leserschaft. Loebell zufolge würde der Angreifer dem Verteidiger dabei »auf die Dauer« überlegen sein.26 Zwar beschrieb das amtliche Kreisblatt die internationalen Gefahren, sah die Lage aber »nicht so düster«. Konkrete Risiken vermeldete die Zeitung nicht, berichtete wohl aber über eine weitere »Hetzrede in Paris«.27 Die innenpolitische Lage nahm die Redaktion der Zeitung als gefasst und ruhig wahr.
Trotz der unmittelbaren Nähe zur Grenze des Zarenreichs herrschte selbst in Ostpreußen längst wieder Normalität. Zwar wussten die Bewohner, dass durch das Attentat Österreich und Russland einander zunehmend angespannt gegenüberstanden. Doch als unmittelbar drohende Gefahr für sich selbst verstand das kaum jemand. Interessanter war die sommerliche Entenjagd, und Henriette Schneider vermerkte in ihrem Tagebuch verärgert, die Erdbeerernte werde »immer dürftiger«.28 Zwar war in der zweiten Julihälfte gerüchteweise von Umgruppierungen der russischen Truppen jenseits der Grenze zu hören, doch in den Dorfkrug des Grenzortes Osznaggern kehrten weiterhin Offiziere und Mannschaften der zaristischen Armee ein, um sich zu betrinken.
Nicht ganz so ruhig war da der Industriebaron Hugo Stinnes. Er hatte sich mit seiner Frau Cläre zur Kur ins mondäne Karlsbad zurückgezogen. Am 16.Juli 1914 schrieb er an seinen Sohn zwar: »Uns geht es gut, sodass Aussicht besteht, dass wir jung und schön nach Hause kommen.« Jedoch litt er unter Schlafstörungen und wusste auch, warum: »Mich drängt es nach Hause bei der herrschenden Geschäftsunsicherheit.«29 Es war aber nicht die außenpolitische Lage, die ihm Sorgen bereitete. Natürlich wusste er um die Spannungen auf dem Balkan; er las die Zeitungen der böhmischen Stadt und bekam von seinen Mitarbeitern aktuelle Informationen ebenso über die Krise in Albanien wie über die Gefahren, die durch Russlands ehrgeizige großslawische Politik entstehen könnten. Die Lage bei den westlichen Nachbarn Deutschlands beurteilte Stinnes als positiv, denn er hielt die innenpolitischen Streitigkeiten in Frankreich und Großbritannien für einen Vorteil, der den deutschen Interessen eher nutzte als schadete.
Ohnehin setzte er schon seit Längerem auf die Kraft der Wirtschaft, um die starke deutsche Stellung in Europa zur Hegemonie auszubauen: »Lassen Sie noch drei bis vier Jahre ruhiger Entwicklung vergehen, und Deutschland ist der unbestrittene wirtschaftliche Herr in Europa. Die Franzosen sind hinter uns zurückgeblieben; sie sind ein Volk der kleinen Rentner. Und die Engländer sind zu wenig arbeitslustig und ohne den Mut zu neuen Unternehmungen. Sonst gibt es in Europa niemanden, der uns den Rang streitig machen könnte. Also drei oder vier Jahre Frieden, und ich sichere die deutsche Vorherrschaft in Europa im Stillen.«30 Im Vertrauen auf die ökonomische Stärke seiner Firmen wollte Stinnes langfristige Kooperationen mit französischen Unternehmen eingehen, doch die Verhandlungen mit den dafür nötigen deutschen Partnern gestalteten sich schwierig. Außerdem beschäftigte den Unternehmer der mörderische Wettbewerb zwischen den heimischen Kohlegruben, der seine Expansionsstrategie gefährden könnte. Größere Sorgen bereitete ihm zudem die Gefahr eines international organisierten Streiks der Bergarbeiter, der das fragile Konstrukt seiner Geschäfte zum Einsturz bringen könnte. Vor einem unmittelbar bevorstehenden europäischen Krieg jedoch fürchtete sich Hugo Stinnes Mitte Juli 1914 nicht: Er genoss seine Sommerfrische.
AUGUSTERLEBNIS
BEGEISTERUNG IST IRRATIONAL, GENAUSO WIE ANGST. Überschwang aber zeigt sich eher nach außen, Furcht wirkt stärker nach innen. In der dritten Juliwoche verbreitete sich in Deutschland, der allgemeinen Sommerstimmung zum Trotz, Unruhe. Es lag etwas in der Luft, aber was? Knapp ein Monat war seit dem Attentat auf Franz Ferdinand vergangen, ohne dass Nennenswertes passiert wäre– jedenfalls nichts, was der Öffentlichkeit bekannt geworden wäre: kein Ultimatum, keine Kriegserklärung, nicht einmal ein offizieller Protest der Wiener Regierung in Serbien. Dass aber eine Reaktion erfolgen würde und musste, war klar. Spätestens, wenn der Untersuchungsbericht über den Mordanschlag vorliegen würde, an dem österreichische Kriminalbeamte arbeiteten. Man redete wieder öfter über Sarajevo und die möglichen Folgen. Druck baute sich auf.
Hinter den Kulissen jagte eine diplomatische Demarche die vorhergehende. Reichskanzler Theobald von Bethmann Hollweg, wie die meisten Mitglieder der europäischen Regierungen im Urlaub, wurde in seinem Landsitz im brandenburgischen Hohenfinow von Mitarbeitern ständig auf dem Laufenden gehalten. Hohe Beamte ließ er wissen, Deutschland müsse den drohenden Konflikt zwischen Österreich und Serbien »isolieren«. Die »europäische Lage« sei »zurzeit nicht frei von Gefahren«. Andererseits grübelte der Reichskanzler in der relativen Ruhe der Provinz »mit einer gewissenhaften Selbstzermarterung über die möglichen eigenen Fehler«, notierte Kurt Riezler, sein Sekretär und politischer Berater. Der Reichskanzler wollte unbedingt politischen Nutzen aus der Situation ziehen: »Kommt der Krieg aus dem Osten, sodass also wir für Österreich-Ungarn und nicht Österreich-Ungarn für uns zu Felde zieht, so haben wir Aussicht, ihn zu gewinnen. Kommt der Krieg nicht, will der Zar nicht oder rät das bestürzte Frankreich zu Frieden, so haben wir doch noch Aussicht, die Entente über diese Aktion auseinanderzumanövrieren.« Von Bethmann Hollweg hatte längst begonnen, über Vor- und Nachteile eines baldigen Krieges nachzudenken, und war bereit, ein »kalkuliertes Risiko« einzugehen. Riezler fasste ein Gespräch mit seinem Chef am 20.Juli 1914 zusammen: »Abermals über die ganze Lage. Russlands wachsende Ansprüche und ungeheure Sprengkraft. In wenigen Jahren nicht mehr abzuwehren, zumal wenn die jetzige europäische Konstellation bleibt.« War es dann nicht besser, einen Krieg in Kauf zu nehmen, bevor sich das Kräfteverhältnis zu Deutschlands Ungunsten verschob?
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!