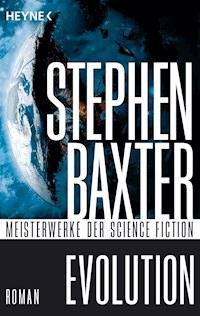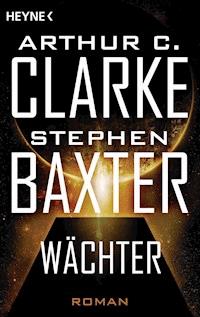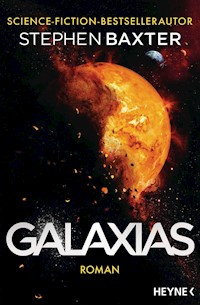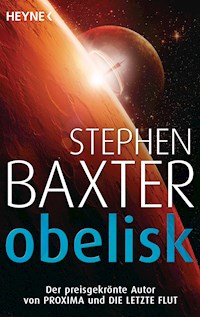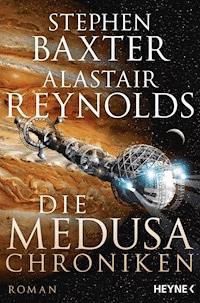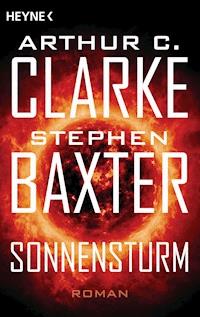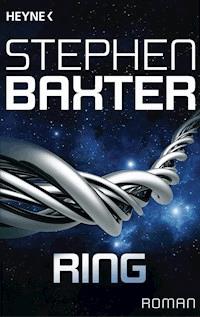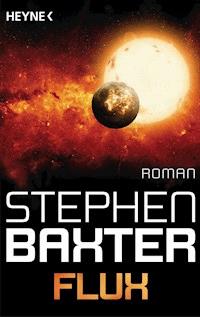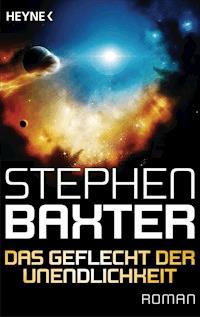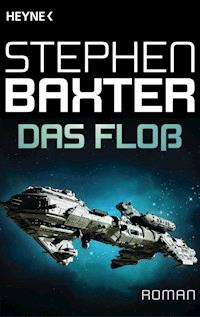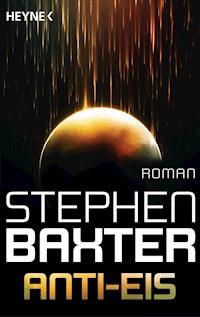9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Artefakt
- Sprache: Deutsch
Seit seiner Kindheit wollte Reid Malenfant Astronaut werden, doch die NASA lehnte ihn ab. Seine Frau Emma ist erfolgreicher: Sie bricht 2004 mit einer Expedition zum Marsmond Phobos auf, um eine Anomalie zu erkunden. Doch ein Jahr später reißt der Kontakt ab, und Emma gilt seither als verschollen. Reid bekommt schließlich doch noch einen Platz als Space-Shuttle-Pilot, stürzt 2019 jedoch bei einem tragischen Unfall ab.
Über vierhundert Jahre Jahre später erwacht Reid Malenfant auf dem Mond. Man hat ihn damals schwerverletzt geborgen und in einen Kälteschlaf versetzt. Dank der fortschrittlichen Medizintechnik konnte er geheilt werden, doch das ist nicht der Grund, warum man ihn aufweckte. Die Erde erhielt einen Notruf – von Emma …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 725
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Das Buch
Seit seiner Kindheit wollte Reid Malenfant Astronaut werden, doch die NASA lehnte ihn immer wieder ab. Seine Frau Emma ist erfolgreicher: Sie bricht 2004 mit einer Expedition zum Marsmond Phobos auf, um eine Anomalie zu untersuchen. Doch ein Jahr später reißt der Kontakt ab, und Emma gilt seither als verschollen. Reid bekommt schließlich doch noch eine Chance als Spaceshuttle-Pilot, aber er stürzt 2019 bei einem tragischen Unfall ab.
Über vierhundert Jahre später erwacht Reid Malenfant auf dem Mond. Man hat ihn schwerverletzt geborgen und in einen Kälteschlaf versetzt. Dank der fortschrittlichen Medizintechnik konnte er geheilt werden, doch das ist nicht der Grund, warum man ihn jetzt aufgeweckt hat. Die von den Folgen des Klimawandels gezeichnete Erde erhielt einen Notruf – von Emma …
Der Autor
Stephen Baxter, 1957 in Liverpool geboren, studierte Mathematik und Astronomie, bevor er sich ganz dem Schreiben widmete. Er zählt zu den international bedeutendsten Autoren wissenschaftlich orientierter Literatur. Etliche seiner Romane wurden mehrfach preisgekrönt und zu internationalen Bestsellern. Stephen Baxter lebt und arbeitet im englischen Buckinghamshire.
Mehr über Stephen Baxter und seine Romane erfahren Sie auf:
www.diezukunft.de
STEPHENBAXTER
artefakt
STERNENPFORTE
Roman
Aus dem Englischen von
Peter Robert
WILHELMHEYNEVERLAG
MÜNCHEN
Titel der Originalausgabe
WORLD ENGINES – DESTROYER
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Deutsche Erstausgabe 06/2020
Redaktion: Ralf-Oliver Dürr
Copyright © 2019 by Stephen Baxter
Copyright © 2020 der deutschsprachigen Ausgabe
und der Übersetzung by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: Nele Schütz, München
Satz: Leingärtner, Nabburg
e-ISBN 978-3-641-25668-5V001
www.diezukunft.de
Für meinen Cousin
Paul Richmond
1969 – 2018
ERSTER TEIL
ÜBER IHRE JUGEND
UND IHRE BEGEGNUNG MIT
MALENFANT
Anmerkung: Die Titel der Abschnitte entstammen Greggson Deirdras Testament, abgefasst in der Edo-Station, Luna, 3451 n. Chr.
1
Ich heiße Reid Malenfant.
Sie kennen mich. Ja, der Kerl, der mit dem Spaceshuttle abgestürzt ist. Aber ich saß eigentlich nur deshalb auf dem linken Sitzplatz der Trägerstufe, weil ich schon immer ein unverbesserlicher Raumkadett war.
Jetzt möchte ich darüber sprechen, warum ich Raumkadett geworden bin.
Angefangen hat es mit einer simplen Frage: Wo sind die denn alle?
Als Kind lag ich nachts oft draußen im Gras, ließ mich vom Tau benetzen und schaute zu den Sternen auf. Zugleich versuchte ich zu spüren, wie sich die Erde unter mir drehte. Ich fühlte mich herrlich lebendig – oder jedenfalls war es herrlich, zehn Jahre alt zu sein.
Aber ich wusste schon damals, dass die Erde nur eine Gesteinskugel am Rand einer unbedeutenden Galaxie war.
Wenn ich da so lag und zu den Sternen emporblickte – die vielen Tausend, die ich mit bloßem Auge zu erkennen vermochte, die Milliarden, die den großen Lichtklecks unserer Galaxis bilden, und die unzähligen Billiarden in den anderen Galaxien –, wollte ich nicht glauben, dass es dort draußen niemanden geben sollte, der auf mich hier unten herabschaute. War es wirklich möglich, dass dies der einzige Ort war, an dem das Leben Fuß gefasst hatte, dass es nur hier Bewusstseinsträger mit Augen gab, die ins All hinausschauen und sich solche Fragen stellen konnten?
Und wenn nicht, wo sind sie dann? Wieso finden wir nirgends Anzeichen außerirdischer Zivilisationen?
Als Kind auf dem Rasen habe ich sie nicht gesehen. Ich schien nur von Leere und Stille umgeben.
Später habe ich mich dann eingehender mit dem Thema befasst. Wie sich herausstellte, wurde dieses Paradoxon erstmals im zwanzigsten Jahrhundert von einem Physiker namens Enrico Fermi formuliert. Für mich war es ein großes Mysterium. Die Widersprüche sind offensichtlich: Leben scheint überall entstehen zu können. Schon eine einzige raumfahrende Spezies hätte sich inzwischen mit Leichtigkeit über die gesamte Galaxis ausbreiten können. Eigentlich hätte es so kommen müssen – aber es ist nicht geschehen.
Die Beschäftigung mit Paradoxa vermittelt dem Menschen Denkanstöße. Mir wurde klar, dass uns das Fermi-Paradoxon etwas Grundlegendes über das Universum und unseren Platz darin sagt.
Oder sagte.
Jetzt ist natürlich alles ganz anders.
Wie sich zeigt, waren sie schon immer hier.
Oder zumindest ihre gewaltigen Maschinen.
Schon immer …
Ich bin ins Flachtrudeln geraten …
2
Hören Sie mich?
Flachtrudeln. Ich bin ins Flachtrudeln geraten …
Beruhigen Sie sich. Das ist jetzt vorbei.
Vorbei? …
Wissen Sie, wer Sie sind?
Ich heiße Reid Malenfant. Sie kennen mich. Ich bin ein unverbesserlicher Raumkadett. Ich – ich heiße … Wo bin ich?
Machen Sie sich darüber vorläufig keine Gedanken.
Bestimmt bin ich wieder in den Besatzungsunterkünften im KSC, habe ich recht? In meinem Zimmer. Im Bett, unter dem großen Ölgemälde von Neil Armstrong beim Handschlag mit Richard Nixon?
Machen Sie sich darüber …
Wo ist Michael? Mein Sohn, Michael? Ist alles in Ordnung mit ihm? Weiß er, wo ich bin?
Michael kann nichts geschehen.
Was soll das denn heißen? Hören Sie, er ist ein erwachsener Mann, aber im Alter von zehn Jahren hat er seine Mutter bei einem Unfall im Weltraum verloren, und jetzt …
Ihm kann nichts mehr geschehen. Glauben Sie mir. Sie müssen sich auf sich selbst konzentrieren.
Auf mich? Dann … ist der Einsatz vorbei? Was ist passiert, habe ich gerade ein derbes Besäufnis hinter mir? Du bist neunundfünfzig Jahre alt, Malenfant, dir sollte doch klar sein, dass du gegen diese Kampfflieger-Sportskanonen aus der Generation Jahrtausendwende keinen Stich mehr machst. Obwohl zumindest mein Sehvermögen sonst nicht unter dem Jack Daniel’s leidet.
Das kommt schon noch. Die Nanomeds …
Nanomeds? Was ist mit dem Vogel, der Constitution?
Die Constitution. Die Spaceshuttle-Trägerstufe, die Sie geflogen haben, bevor … Gut, Colonel Malenfant. Es ist gut, dass Sie sich an so vieles erinnern.
Ach ja?
Es war eine echte Herausforderung für uns, wissen Sie.
Was denn?
Ihre Behandlung.
Welche Behandlung?
Eins nach dem anderen. Sie wissen, wer Sie sind. So viel steht fest.
Ich heiße Reid Malenfant. Und ich weiß, wie ich hierhergekommen bin.
Tatsächlich?
Allgemein gesprochen. Ich … Wie geht’s meiner Pilotin?
Ihrer Pilotin?
Nicola Mott. Ich war Kommandant der Constitution, sie die Pilotin. Zwei Mann Besatzung.
Britin.
Mott ist Britin. Ein junger Hüpfer mit ihren neunundvierzig Jahren, zehn Jahre jünger als ich, blitzgescheit und sehr erfahren. Sie war schon zehn Jahre vor mir bei der NASA, und in den Neunzigern hatte man es dort nicht leicht, wenn man kein Mann, kein Amerikaner und kein Pilot war. Aber Nicola hatte die ersten Shuttle-Flüge schon mit sieben oder acht Jahren gebannt verfolgt und seitdem in den Weltraum fliegen wollen. Also tat sie es. Sie zog in die Staaten, arbeitete bei McDonnell-Douglas in der Raumstationstechnik, ging zur NASA, arbeitete in der Flugleitzentrale und schaffte es schließlich ins Astronautenteam. Wissen Sie, wir haben da so ein Sprichwort bei der NASA: Der Neuling, den du ausbildest, wird dich eines Tages ersetzen. Na ja, Nicola ist keine Anfängerin, aber nicht mehr lange, dann wird sie mich ersetzen …
Nicola.
Wie geht es ihr?
Darüber können wir reden, Colonel Malenfant.
Einfach nur Malenfant. Wie soll ich Sie nennen?
Karla, einfach nur Malenfant. Einfach nur Karla.
Karla …
Sagen Sie uns, wie Sie hierhergekommen sind.
Die lange oder die kurze Fassung?
Wieso, haben Sie’s eilig?
… War das ein Scherz? Ich glaube, wir beide werden gut miteinander auskommen, Karla.
Okay.
Die Lebensgeschichte.
Flugzeuge, der Krieg und die Science-Fiction haben mich hierhergebracht.
Vergessen Sie nicht, ich bin ein Kind der Sechzigerjahre. Samstagvormittags lief Fireball XL5 im Fernsehen, zur Hauptsendezeit gab es Star Trek, und ich verschlang Wells, Clarke, Heinlein und all die anderen.
Und dann war da natürlich der Weltraum. Ich war siebzehn, als das Shuttle zum ersten Mal flog: Armstrong ritt auf der Constitution, John Young hatte das Kommando im Orbiter, Fred Haise im Trägerflugzeug … Tja, damals war ziemlich was los.
Mein Daddy nahm mich das erste Mal zum Fliegen mit, als ich drei war – behauptete er zumindest. Meine Erinnerung reicht nicht so weit zurück. Ich wuchs jedoch in dem Wissen auf, dass er Flieger gewesen war. In Korea. So wie sein Vater im Zweiten Weltkrieg, mit einer P-51 Mustang gegen deutsche Düsenjäger. Höllische Sache. Selbst für einen alten Hasen.
Also habe ich mich mit achtzehn zum ersten Mal bei der NASA beworben. Ich lernte rasch, dass ich noch einen weiten Weg vor mir hatte. Geh aufs College, sagten sie.
Meine Mutter half mir, an der Columbia University die richtige Fächerkombination zu finden, und dann bekam ich einen Job bei Sperry Engineering, wo man viele Kontakte zum Raumfahrtprogramm hatte. Ich arbeitete an meiner beruflichen Laufbahn und profilierte mich allmählich.
Anfang der Achtziger gaben sie dann den Fahrplan für Project Ares, die Marsmission, bekannt, und ich war wieder Feuer und Flamme. Konnte es kaum erwarten. Ich probierte es erneut bei der NASA. Ohne Erfolg.
Also riskierte ich was und ging wieder aufs College. Immerhin hatten vier der ersten zwölf Mondspaziergänger das MIT besucht. Ich ging nach Princeton, so um 1982 war das, weil ich wusste, dass O’Neill dort unterrichtete. Der Typ mit den Weltraumkolonien – »Unsere Zukunft im Raum«. Wow, der hat mir die Augen geöffnet, was man im Weltraum alles machen kann, sobald man erst mal zu vertretbaren Kosten dorthin gelangt.
Lautlos im Weltraum haben wir bestimmt fünfzigmal gesehen.
Ich versuchte es erneut bei der NASA. Wurde wieder abgelehnt. Wie sich herausstellte, wollten sie in dieser Phase eher Piloten als Träumer.
Also ging ich zur US Air Force. Mein Vater und mein Großvater wären stolz auf mich gewesen. Meine Dienstzeit verbrachte ich an der Air Force Academy in Colorado Springs. Das war um 1984 herum; ich war vierundzwanzig Jahre alt. Wie sich zeigte, war ich ein ganz brauchbarer Flieger.
Sie wurden Militärpilot.
Habe schließlich im Zweiten Golfkrieg gedient. Aber damals war ich schon verheiratet, mit Emma.
Emma Stoney.
Ja. Emma Stoney. Hat ihren eigenen Namen behalten, und das fand ich verdammt richtig. Sie war nicht die typische Soldatenfrau jener Zeit und wollte sich nicht mit den damals üblichen miesen Bedingungen in solchen Ehen abfinden: niedriges Gehalt, ständige Umzüge, der Mann in Übersee, während man die Kinder in lausigen Unterkünften auf einer Militärbasis großzieht … Wir waren zusammen aufgewachsen. Obwohl sie zehn Jahre jünger war als ich. Dann hatten wir uns bei einer Hochzeit im Familienkreis wiedergetroffen – der ihrer Schwester. Und nach Michaels Geburt ging sie als Erste zur NASA, vor mir, meine ich.
Sie wurde Missionsspezialistin.
Ja. Sie hat immer behauptet, ich hätte sie dazu inspiriert. Ich war ja ein ganzes Stück älter. Aber ich glaube, ihre Strategie war klüger als meine. Sie ging aufs College und studierte Geologie, Klimatologie und Planetologie – nicht Fliegerei und Ingenieurwesen. Bei der NASA wimmelt es von Piloten und Ingenieuren, aber wie sich herausstellte, herrschte Mangel an Leuten, die über Planeten und Monde Bescheid wussten. All das brachte sie in eine erstklassige Position, als der Phobosflug aufs Tapet kam.
Ein Flug mit dem Ziel, die Anomalien der Umlaufbahn zu untersuchen.
Ja … Phobos, ein Marsmond, verhielt sich sehr seltsam. Er wurde anscheinend zum Planeten hinuntergezogen, wie Skylab, wie eine in geringer Höhe kreisende Raumstation. Aber die Marsluft war zu dünn dafür und Phobos eigentlich zu massiv, sofern er durchgängig aus fester Materie bestand … Jahrzehntelang hatte es seltsame, widersprüchliche Beobachtungen und noch widersprüchlichere Theorien gegeben. In den späten Achtzigern schickte man dann eine Raumsonde hin, die bewies, dass sich die Umlaufbahn tatsächlich verengte, und Carl Sagan und andere begannen sich für eine spezielle bemannte Mission einzusetzen. Emma bekam einen Platz, und den hatte sie wahrhaftig auch verdient.
Doch zu dem Zeitpunkt, als Emma zum Phobos aufbrach, hatten Sie schon einen höheren Bekanntheitsgrad durch Ihre Werbefeldzüge für private Bergbaumissionen zu den Asteroiden erlangt.
Werbefeldzüge? Das war mein Arbeitsgebiet, Lady. Ich habe sogar ein Start-up gegründet, Bootstrap, Inc. Ich glaube, mir ging damals irgendwie ein Licht auf. Was die richtige Einstellung zum Weltraum betraf. Und ich weiß noch genau, wann das war.
Sagen Sie’s mir.
Im Jahr 2003.
Über dem Irak.
Ich war nie ein Kampfflieger.
Ich flog Tankflugzeuge – nun ja, das erwies sich als gute Vorbereitung auf meine spätere Laufbahn als Shuttle-Träger-Flieger. Tatsächlich unterschieden sich die Flugeigenschaften der KC-135 Stratotanker gar nicht so sehr von denen des Trägers: beides sind große, schwere Flugzeuge.
Es war eine höllische Szenerie.
Ich erinnere mich an Bagdad von oben. Es war eine weitläufige, moderne Großstadt, wie L. A. oder Houston. Ganze Viertel wurden dunkel, als die Stromversorgung ausfiel. Die Luftabwehrstellungen erloschen wie ausbrennende Glühbirnen, überall Leuchtspurgeschosse, und die Suchscheinwerfer tasteten den Himmel ab, als befänden wir uns noch im Zweiten Weltkrieg. Die Marschflugkörper kamen angeflogen, und unsere Maschinen schossen im Tiefflug dahin, ihre Bomben explodierten mit gelben Lichtblitzen. SAM-Raketen hinterließen ein graues Gekritzel am Himmel – und hier und dort sah man schwarzen Rauch, wenn jemand ausgeschaltet worden war. Nichts bereitet einen auf die plötzliche Erkenntnis vor, dass es irgendwo da draußen einen anderen Menschen gibt, der einem aktiv nach dem Leben trachtet.
Aber wir standen nicht an vorderster Front. Wir waren Tankerflieger. Unsere Hauptaufgabe war die Unterstützung. Wir brachten Treibstoff für Piloten mit leeren Tanks. Wissen Sie, wie das abläuft? Ein Luftrendezvous mit dem Kampfflugzeug, das von hinten und ein kleines Stück tiefer herankommt, und wir lassen einen Ausleger runter, an dem der Kampfpilot festmacht, wobei er sich an unseren Lichtern orientiert, um die Position zu halten. »Na, was hätten wir denn heute gern, Kumpel, verbleit oder bleifrei?«
Zu unseren Nebenaufgaben gehörte allerdings auch die Erkundung, während wir über dem Kampfgebiet herumflogen und auf einen Kunden warteten.
Also war ich gerade Kundschafter, als das STS-445 eingesetzt wurde, um einen Schlag aus dem Orbit auszuführen.
In Wirklichkeit war es ein Experiment der DARPA. Eine gewaltige technische Leistung. Und ein Wahnsinnsanblick: ein Shuttle-Orbiter, der aus dem Weltraum herunterkommt und eine bunkerbrechende Bombe genau auf Saddams Gebäudekomplex abwirft.
Aber hinterher dachte ich, es müsste eigentlich bessere Einsatzmöglichkeiten für Weltraumtechnik geben.
Und nicht nur das: Falls wir tatsächlich jemals zu den Planeten gelangen sollten, könnten die Energien, über die wir dann verfügen würden, beim Kriegseinsatz ein selbstverschuldetes Auslöschungsereignis zur Folge haben. Rechnen Sie sich’s aus. Wir mussten in den Weltraum hinaus, aber auf friedliche Weise. Auch wenn ich selbst nicht dabei sein würde.
Also haben Sie die Air Force verlassen …
Und mit Bootstrap, Inc., losgelegt.
Ich hatte die Vision und die Kontakte zu Technikern und Ingenieuren.
Und durch die O’Neill-Leute lernte ich einen Burschen namens Frank J. Paulis kennen. Jünger als ich und selbst schon ein Luftfahrtmilliardär, aber mit noch viel größeren Träumen. Zum Beispiel lag er der NASA mit seinen Plänen für eine Mission zum Sonnenbrennpunkt in den Ohren, einer Stelle weit draußen im Weltraum, wo es dank des Gravitationslinseneffekts leichter sein würde, Signale von Außerirdischen zu empfangen … Er sah aus wie John Belushi. Schon mal von dem gehört? Ein dunkler, bulliger Typ. Hat sich benommen wie ein Wall-Street-Rabauke. Aber seine Träume ähnelten denen von Carl Sagan.
Paulis wurde nicht nur der erste große Investor, sondern übernahm praktisch auch die Leitung von Bootstrap, Inc. Ich war nur so eine Art Galionsfigur. Und Paulis hatte selbst hervorragende Kontakte. Er setzte sich mit Ann Reaves in Verbindung, der Multimilliardärin von Shit Cola. Zur damaligen Zeit brachte der Dotcom-Boom einen superreichen Babyboomer nach dem anderen hervor, aber Reaves gehörte zu den wenigen, die tatsächlich etwas produzierten, anstatt nur Informationen hin und her zu schieben. Und sie träumte vom Weltraum. Das war der Moment, als wir richtig viel Spielgeld in die Finger bekamen.
Tja, in diesen ersten paar Jahren, dem ersten Jahrzehnt des neuen Jahrhunderts, ging es rasant voran. Die Shuttles flogen fast wöchentlich, wir brachten Leute auf den Mond und den Mars. Aber O’Neill hatte immer die Ansicht vertreten, dass nur ein kostengünstiger Zugang zum Weltraum die Geschicke der Menschheit verändern würde. Denn dann gäbe es Industrialisierung, Kolonisierung und eine langfristige Zukunft im All. Das Spaceshuttle war ein wunderbares System, aber kostengünstig war es noch nie gewesen. Und das war unser Ansatzpunkt.
Paulis und ich kauften mit Reaves’ Startkapital einen alten Flugplatz aus dem Zweiten Weltkrieg in der Mojavewüste Hauptsächlich versuchten wir, große, billige, wiederverwendbare Trägerraketen zu bauen, um das Shuttle zu unterbieten. Wir suchten sogar den Atlantik nach ausrangierten Triebwerken aus den Apollo-Saturn-Zeiten ab, als man die ausgebrannten Raketenstufen noch einfach im Ozean versenkt hatte. Die Triebwerke waren unbrauchbar, aber eine Fundgrube für Bauteile und Materialien.
Wir hatten einen langfristigen Plan. Einen Einnahmestrom aus Solarenergie-Satelliten bis zum Jahr 2020, bis 2050 eine funktionierende Ökonomie im Weltraum, bis 2100 eine Weltraumwirtschaft, die stärker war als die der Erde. Und falls die Erde in der Zwischenzeit Unterstützung aus dem Weltraum benötigte, beispielsweise bei großen Geoengineering-Programmen zur Bekämpfung des Klimawandels, würden wir auch die anbieten können.
Aber zunächst einmal gerieten wir in die Mühlen der Bürokratie. Die NASA und die Regierung wurden von einem Kartell kontrolliert, einer Hand voll Ausrüster, von Konzernen wie Boeing, Lockheed Martin und Northrop Grumman, und die waren dagegen, dass wir auch nur die Genehmigung für Teststarts bekamen. Und dann waren da auch noch die verschiedenen Weltraumverträge, denen zufolge es schon juristische Probleme aufwarf, wenn man einen Asteroiden oder einen Brocken Mondgestein unter Nutzbarkeitsaspekten auch nur betrachtete. Der Weltraum war das gemeinsame Erbe der Menschheit, wie sie es nannten.
Komisch, dass Sie diesen Ausdruck benutzen …
Ich meine, ich hatte durchaus Verständnis für diesen Standpunkt. Aber es fühlte sich an, als wären wir in einem unentwirrbaren Geflecht aus zynischen Konzernmanagern und blauäugigen Steinbrockenkuschlern gefangen. Trotzdem machten wir in diesen ersten Jahren Fortschritte, wenn auch nur langsam.
Und dann, im Jahr 2004, flog Emma zum Phobos.
Dass sie von dieser Mission nicht zurückkehrte, hat Sie schwer getroffen.
Kann man wohl sagen. Und Michael auch.
Wir erfuhren es von einem Astronauten, der zu uns nach Hause kam. Er hatte den Auftrag, Kontakt zur Familie aufzunehmen – ein sogenannter CACO, ein Casualty Assistance Care Officer, der den Angehörigen des Opfers beistehen soll. Bei der NASA gibt es für alles ein Akronym. Unser CACO war Joe Muldoon, ein Mondspaziergänger aus der Anfangszeit von Apollo, der mit Emma zusammengearbeitet hatte. Trotz meines Kummers war ich fasziniert von ihm.
Wir hielten zu Hause eine Trauerfeier ab, nur im engsten Familienkreis. Natürlich gab es keine Leiche, die man beerdigen konnte. Es war eine Feier wie für jemanden, der auf See geblieben war. Und dann mussten wir zu einem Gedenkgottesdienst nach Houston, anschließend in Washington mit dem Präsidenten und den Angehörigen, und die Astronauten flogen mit ihren T-38-Jets die Missing-Man-Formation. Wie 1969 für Armstrong, nachdem er auf dem Mond ums Leben gekommen war.
Hinterher haben wir uns irgendwie auseinandergelebt. Michael und ich, meine ich. Natürlich habe ich ihn immer unterstützt. Er ging aufs College und studierte Betriebswirtschaft. Strebte eine berufliche Zukunft im Kohlebergbau an – expandierende Branche, kluge Entscheidung, wie es schien.
Ich arbeitete weiter an den Bootstrap-Projekten. Aber inzwischen hatte Emma – oder ihr Verlust oder ihr großartiges Forschungsprojekt – meine Einstellung zum staatlichen Raumfahrtprogramm verändert. Oder mich in ihr bestärkt. Ich dachte mir, ich könnte vielleicht von innen heraus einen Wandel bewirken statt von außen. Auf alle Fälle würde ich so Emmas Andenken ehren.
Aber vielleicht ist das auch bloß eine Rationalisierung. Michael hat mir mal erklärt, dass ich mit dem Verlust seiner Mutter auch meine Fähigkeit zum Träumen eingebüßt hätte. Und Bootstrap war zu diesem Zeitpunkt nichts als ein Traum. Alles, was ich nach Emma wollte, war fliegen. Vielleicht hatte er recht.
Jedenfalls habe ich das dann gemacht. Ich habe mich von Bootstrap zurückgezogen, es noch mal bei der NASA probiert und bin bei der Rekrutierungsrunde von 2008 angenommen worden. So wurde ich schließlich ein besserer Lkw-Fahrer und flog die Constitution … Wo ist Nicola?
Diese Frage haben Sie schon einmal gestellt.
Und Sie haben sie nicht beantwortet. Was, zum Teufel, ist hier eigentlich los? Ich sehe immer noch nichts, wissen Sie.
Dann bleiben Sie ruhig.
Ruhig? Ich war ins Flachtrudeln geraten … Ich erinnere mich, die Wunderkerzen, ich hab’s mit den Wunderkerzen probiert, als wir …
Sie erinnern sich. Gut. Immer der Reihe nach, Malenfant. Erzählen Sie uns, was Sie bei STS-719 erlebt haben. Erzählen Sie uns von Ihrem Einsatz.
Ist das hier eine Nachbesprechung?
So hätten Sie es vielleicht genannt. Zu Ihrer Zeit, mit Ihren Worten. Sie haben Ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen und sich in die Riege der Trägerpiloten eingereiht. Aber Sie sind nie bis in die Umlaufbahn gelangt, nicht wahr? Und dann wurden Sie im Jahr 2019 für die Mission STS-719 eingeteilt.
Erzählen Sie mir von den Wunderkerzen.
Ja … Also, die Wunderkerzen – so nennen wir die Zündvorrichtungen für die Wasserstoffverbrennung.
Sie müssen sich das Spaceshuttle vorstellen, wie es in Cape Canaveral startbereit auf dem Startplatz steht. Ich nehme an, das haben Sie schon mal gesehen. Da ist der Booster oder Träger, ein Raketenflugzeug von der Größe einer 747, mit dem Orbiter auf dem Rücken, der selbst so groß ist wie eine 707. Und das ganze Konstrukt steht senkrecht auf Pad 39-A: zwei auf dem Heck stehende Fluggeräte mit Tragflächen an der Startrampe, eines bäuchlings an den Rücken des anderen geschmiegt.
Unser Booster bei diesem Flug war die Constitution, BV-102, der älteste in der Flotte außer einem Prototyp für den Gleittest. Und der Orbiter war die Advance, OV-106. Stellen Sie sich das vor. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen im Cockpit dieses Trägers, bereit zu einem Raumflug in einem Flugzeug mit den Leistungsmerkmalen der X-15, eines experimentellen Überschall-Raketenflugzeugs, aber größer als jeder Passagierjet der Welt.
Alle Orbiter wurden nach Forschungsschiffen benannt.
Allerdings. Und in diesem Fall passte der Name sehr gut. Die erste Advance war als Rettungsschiff eingesetzt worden, sie folgte der Franklin-Expedition in die Arktis. Unsere Advance war der Orbiter, der bei der Rettungsmission für Skylab zum Einsatz gekommen war und das Shuttle-Programm berühmt gemacht hatte. Ich hab’s gesehen, als ich achtzehn war. Und jetzt, mehr als vierzig Jahre später, transportierte ich eben diesen Vogel in die Umlaufbahn.
Sie hatten gerade von den Wunderkerzen gesprochen. Den Zündvorrichtungen für die Wasserstoffverbrennung – richtig?
Ja, ich schweife ab.
Es ist ein bisschen technisch.
Sehen Sie, die Shuttle-Trägermaschine hat zwölf Raketentriebwerke, zwölf große Glocken, und während der Betankung kann sich da oben eine Menge Wasserstoff fangen, der dort nicht hingehört. Im Innern der Glocken selbst, meine ich. Deshalb setzen wir zehn Sekunden vor dem Start die Wunderkerzen ein, um all dieses überschüssige Zeug wegzubrennen, damit es beim Start eine hübsche, glatte Zündung gibt. Die Wunderkerzen sind am Träger selbst angebracht.
Wie sich herausstellte, spielte das Wunderkerzensystem bei dem, was dann geschah, eine wichtige Rolle.
Ja. Könnte man so sagen.
Ich erinnere mich an die lange Fahrt die Startrampe hinauf. Mott und ich auf dem Weg zum Träger, dazu die acht Besatzungsmitglieder für den Orbiter. Wir tragen unsere Rüstungen: medizinische Sensoren, Druckanzug. Unsere, die der Trägerflieger, sind besonders strapazierfähig, von Lockheed hergestellt. Hellbraun.
Mann, dieser Träger ist ein echtes Monster, wenn man dicht neben ihm hochfährt. Ein Flugzeug mit Deltaflügeln, Spannweite über fünfundvierzig Meter. Sah immer so aus, als würde das verdammte Ding nie vom Boden wegkommen. Aber Sie hätten mal ein paar von den anderen Entwürfen sehen sollen, die die Ingenieure auf dem Weg zu dieser Konfiguration ausgeheckt hatten. Zum Beispiel einen Orbiter, dem Feststoffbooster unter den Bauch geschnallt worden waren.
Unser Vogel ist jedoch ein alter Kämpe und hat schon viele erfolgreiche Flüge wie diesen hinter sich. Und es ist ein schöner Tag. Keine Anzeichen von Problemen. Die Verdampfungswolken, Wasserstoff und Sauerstoff, die in den blauen Himmel von Florida steigen, das Ächzen und Zischen der Tankhüllen und die herumsummenden Hubschrauber über uns … Eigentlich wollte ich gar nicht an Bord der Maschine gehen, mich vor diesem ganzen Spektakel verstecken.
Trotzdem, ins Cockpit.
Der Träger gleicht einem ganz normalen Flugzeug, verstehen Sie, nur in die Senkrechte gekippt. Deshalb müssen wir eine kleine Leiter zu unserem Cockpit in der Nase hinaufsteigen und uns dann rücklings auf unseren Liegesitzen niederlassen. Wir legen unsere Gurte und Fußmanschetten an, setzen unsere Helme auf und machen uns an die Arbeit mit den Stichwortkarten und Checklisten und mit den Updates, die über die Bildschirme in der Kabine laufen. Wissen Sie, beim ersten Shuttle-Flug gab es ungefähr zweitausend Schalter in der Kabine; die Innenflächen waren wie mit einer Korallenkruste überzogen. Aber wir kennen uns aus, Nicola und ich, wir haben beide schon etliche Flüge absolviert.
T minus sieben Minuten. Der Zugangsarm fährt mit einem dumpfen Laut zurück, und wir sitzen da oben fest. Abgesehen von ungefähr fünf Abbruchsoptionen, heißt das. Der überschüssige Treibstoff und Sauerstoff verdampfen. Wir gönnen unseren Steuerflächen ein letztes Fitnesstraining; man kann die Klappen knarren hören.
T minus einunddreißig Sekunden, und die Computer übernehmen die Regie.
Zehn Sekunden, die Wunderkerzen.
Bei sechs Sekunden startet das Haupttriebwerk. Und in diesem Moment …
Ja?
Gibt es einen Knall.
Ich schaue Nicola an, und sie erwidert meinen Blick. Für uns hat es sich wie ein Stoß in den Rücken angefühlt. Wir schauen auf unsere Displays und auf die Bilder von dem Brennvorgang, der am unteren Ende des Fahrzeugs schon begonnen hat: die Dampfwolken, die Schockdiamanten. Alles sieht normal aus, und die Launch Control hat nichts zu sagen. Wir lassen sie hochsteigen.
Aber Sie haben es beide gespürt.
Ja. Das hat man in beiden Maschinen gespürt, schätze ich …
Das Ereignis wurde von den Systemen nicht ordnungsgemäß in Echtzeit registriert, und die Aufzeichnungen zeigen, dass hinterher eine sorgfältige Analyse erforderlich war, um die folgenden Geschehnisse zu entwirren.
Die Aufzeichnungen? Wo bin ich? Wo findet dieses Gespräch statt? Wann findet es statt?
Das Ereignis, Malenfant. Bleiben wir bei dem Ereignis.
Ja. Aber Sie wissen mehr als ich, stimmt’s? Also sagen Sie’s mir.
Na schön. Bei der Zündung gab es einen kleinen Fehler in einer der Triebwerkspumpen des Trägers. Sie lieferte für einen winzigen Moment eine zu große Menge Treibstoff an ihre Brennkammer, und darum zündete ein Triebwerk mit übermäßig hohem Schub. Danach funktionierte dieses Triebwerk wie auch alle anderen Triebwerke und Pumpen jedoch reibungslos. Dieser zusätzliche Schub war der »Knall«, den Sie gespürt haben. Der Impuls war auf den Monitoren der Launch Control zu erkennen, aber es gab keine unmittelbaren Anzeichen für einen Schaden, und so entschied die an diesem Tag verantwortliche Flugleiterin in den Sekunden, die ihr blieben, um grünes Licht zu geben oder nicht, den Start nicht abzubrechen.
Aber es gab einen Schaden, nicht wahr? Anzeichen hin oder her.
In der Tat. Die ganze Shuttle-Konfiguration … erbebte. Das System geriet unter Belastung. Und in der Nase des Trägers kam es in diesem Moment zu einem weiteren nicht entdeckten Defekt. Eine Verstrebung brach.
Eine Verstrebung?
Sie trug einen Oxidatortank für die Korrekturtriebwerke des Trägers …
Das Reaction Control System. RCS.
Ja. Als die Verstrebung brach, war dieser Tank nicht mehr fest verankert. Im späteren Verlauf des Fluges löste er sich dann vollständig und kollidierte mit einer Treibstoffzuleitung, die dabei leckschlug. Das Wasserstoffperoxid sickerte langsam heraus. Aber …
Aber das hatte Folgen. Wir würden dieses RCS brauchen. Eins führt zum anderen, verdammt noch mal. Na, jetzt wird mir alles klar.
Erzählen Sie uns, wie es aus Ihrer Sicht abgelaufen ist.
Die Sache mit diesem Stoß vergaßen wir bald.
Alles lief gut.
Es ist ein höllischer Ritt, wissen Sie. Wir entfernen uns vom Turm und drehen uns; dabei klammert sich dieses Orbiterküken weiter an Mamas Rücken fest. Nach ungefähr einer Minute erreichen wir max q, den maximalen aerodynamischen Druck, eine Kombination aus zunehmender Geschwindigkeit und Luftdichte, die maximale Belastung, der wir ausgesetzt sein werden. Die Triebwerke drosseln ihre Leistung. Währenddessen erreichen wir Überschallgeschwindigkeit, die zwölf großen Triebwerke des Trägers gehen wieder auf volle hundert Prozent Leistung, und der Flug ist butterweich.
Dann kommt die Trennung.
Uns geht schon der Treibstoff aus; wir sind im Begriff, zum Gleiter zu werden, und nützen der Advance nichts mehr. Ungefähr zweieinhalb Minuten nach dem Start, in ungefähr vierzig Meilen Höhe und vierzig Meilen Entfernung vom Startgelände, trennen wir uns – Sprengbolzen lassen die ganze Konfiguration erzittern – und geben das Küken frei. Die Stufentrennung, wie wir es nennen.
Die Advance ist wohlbehalten in die Umlaufbahn gelangt.
Ja, und wir wussten es. Wir haben die Telemetriedaten verfolgt, während sie ihre eigenen Flugphasen durchliefen. Nach vier Minuten, in einer Höhe von zweiundsechzig Meilen, sind sie offiziell im Weltraum. Die Triebwerke schalten sich ab, wenn sie in hundertfünfzehn Meilen Höhe im Orbit sind, und sie zünden die Triebwerke ihres orbitalen Manövriersystems, um ihre Umlaufbahn zu zirkularisieren.
Was für Sie alles von rein akademischem Interesse war.
Ja. Plötzlich befanden wir uns nämlich in einer nicht nominalen Situation.
Das ist NASA-Sprech für eine Notlage.
Also, die Stufentrennung erfolgt in einer Höhe von zweihundertdreißigtausend Fuß, wo es kaum noch eine Spur von Luft gibt, und wir fliegen mit Mach zwölf, das heißt mit zwölffacher Schallgeschwindigkeit. Tatsächlich ist das ein schöner Moment, weil wir antriebslos den höchsten Punkt unserer Flugbahn erreichen. Wir befinden uns nämlich selbst in der Schwerelosigkeit, verstehen Sie; wir fallen und fallen. Nur für ein paar Sekunden.
Dann machen wir uns wieder an die Arbeit.
Drei Minuten lang waren wir eine Rakete; jetzt werden wir ungefähr zehn Minuten lang ein Überschallgleiter sein und dann neunzig Minuten lang ein Unterschallflugzeug auf dem Weg nach Hause. Wir haben zwei luftatmende Triebwerke an Bord, aber die können wir erst einsetzen, wenn wir in dichtere Luft hinunterkommen.
Also müssen Sie im Gleitflug sinken.
Und unterwegs die überschüssige Geschwindigkeit loswerden. Genau. Aber für mich ist das der angenehme Teil. Wir fallen vom Orbiter weg, und ich fliege mein Schiff. Ich habe meinen RHC – den Rotational Hand Controller, meinen Steuerknüppel. Mit dessen Hilfe gehe ich jetzt in eine Neunzig-Grad-Rolle. Auf diese Weise wollen wir eine Abfolge sogenannter S-Kurven durchlaufen, weiträumige Sinkflugmanöver, die uns durch die dichter werdende Atmosphäre nach unten bringen. Dabei verlieren wir dank der Luftreibung permanent Energie. Jede Minute sollten wir tausend Meilen pro Stunde langsamer werden und dabei zwanzigtausend Fuß an Höhe verlieren. Man spürt es, wenn es funktioniert, eine starke Bremsverzögerung, die uns in unsere nebeneinanderstehenden Liegesitze presst.
In dieser Höhe, am Rand der Lufthülle, setzt der Vogel auf meine Bewegungen des Knüppels hin sowohl das RCS-System ein – unsere kleinen Korrekturtriebwerke, als wäre er ein Raumschiff im Vakuum – als auch die Steuerflächen, als wäre er ein ganz normales Flugzeug. Man bekommt eine Mixtur von Reaktionen, während man in die Tiefe stürzt; dabei dominiert anfangs das RCS, das dann aber immer weniger Wirkung zeigt, und später, in der dichteren Luft, sind es vor allem die Steuerflächen. Bis wir tief genug sind, dass die luftatmenden Triebwerke zum Einsatz kommen können.
Theoretisch.
Ganz recht. Aber jetzt sagen Sie mir, dass dieses verdammte RCS-System in der Nase des Schiffes die ganze Zeit Treibstoff verloren hat.
Zunächst geht alles gut. Wir sind auf hundertachtzigtausend Fuß gesunken und gehen in eine weitere S-Kurve. Hundertzwölftausend Fuß, wir sind runter auf Mach 5, nur noch fünfmal so schnell wie der Schall. Und in dem Moment fällt mir das RCS-System aus. Einfach so. Zu dem Zeitpunkt hatte ich keine Ahnung, was los war.
Jetzt weiß ich es.
Wir sind schon so tief, dass die dichter werdende Luft eine spürbare Wirkung hat, sie drückt gegen uns, aber die RCS-Triebwerke spielen immer noch eine Rolle. Wir hätten sie erst bei fünfundvierzigtausend Fuß abgeschaltet. Aber jetzt haben wir sie verloren.
Und während das alles geschieht, bringe ich sie noch immer durch die letzte S-Kurve.
Die Systeme gleichen den Verlust des RCS zu stark aus.
Wir geraten ins Flachtrudeln.
Flachtrudeln?
Wenn der Vogel mehr oder weniger waagerecht liegt, sich jedoch um eine senkrechte Achse, sein Schwerkraftzentrum, dreht. Wie ein Spielzeugflugzeug mit einer Nadel im Bauch. Nichts, was ich tue, hilft, die Steuerflächen klemmen und machen alles noch schlimmer, und das RCS ist aus. Wir sind jetzt sowieso schon zu tief unten in der Luft, als dass diese kleinen Triebwerke noch irgendetwas bewirken könnten.
Das Trudeln wird stärker, wir bekommen diese Beschleunigung, bei der einem die Augäpfel aus den Höhlen treten, und ich merke, dass ich auf eine Ohnmacht zusteuere. Ich kann nicht mal sehen, wie es Mott geht, ich kann den Kopf nicht drehen. Wir schreien beide.
Okay. Mir bleiben nur noch Sekunden, um einen Ausweg zu finden. Ich muss das Trudeln stoppen. Wir können die Schleudersitze erst betätigen, wenn wir uns stabilisiert haben.
Doch selbst dann, wenn wir das Trudeln beenden können, frage ich mich, wo der Vogel runterkommen wird.
Denken Sie daran, er ist nicht dazu konstruiert, den ganzen Rückweg im Gleitflug zurückzulegen. In den letzten Phasen drückt man den Träger nach unten – mit der Nase zum Boden –, sodass er in einen schnellen Sinkflug übergeht, bei dem Luft in die Turbojets, die Luftatmer, gepresst wird, und dann nimmt man eine kontrollierte Landung vor. Er muss nach Hause geflogen und kontrolliert gelandet werden.
Ich kann es mir nämlich nicht erlauben, ihn abstürzen zu lassen.
Wir sind nicht in der Mojavewüste, nicht über der Edwards Air Force Base, wo sie mit den X-15 rumgeflogen sind und wo es nichts als Sonnenschein und einen gigantischen Salzsee gibt, auf dem man so hart und so schnell heruntergehen kann, wie man will. Unser Ziel ist eine Landebahn im Kennedy Space Center, von wo wir gestartet sind. Darum geht es ja gerade beim Shuttle-System, dass man den Träger innerhalb von Wochen, ja sogar Tagen aufpolieren und für die nächste Mission bereit machen kann.
Selbst während wir trudeln, kann ich die Space Coast sehen, ein sechzig, siebzig Meilen langes bebautes Gelände, all diese Startplätze, Raketen und Anlagen. Ich sehe das Vehicle Assembly Building, einen Kasten, in dem man die Cheopspyramide unterbringen könnte. Ganz zu schweigen vom Glitzern zahlloser Windschutzscheiben, an deren Schlangen man die Straßen erkennen kann. Wir starten zwanzigmal pro Jahr, aber trotzdem lockt jeder einzelne Flug die Touristen an.
Ich sehe die Kondensstreifen der NASA-Begleitflugzeuge, und ich sehe die Hubschrauber in der Luft, Vögel der Air Force mit Rettungsfallschirmspringern an Bord, die bereit sind, sofort angeflogen zu kommen, um mich zu bergen, wo und wie auch immer ich runterkomme. Sie sind hier, um mich nach dem Absturz zu retten.
Aber ich darf nicht abstürzen. Nicht hier.
Ich habe simple Prioritäten. Nicola rausschaffen. Das Schiff so weit unter Kontrolle kriegen, dass ich es irgendwo gefahrlos herunterbringen kann, fern vom Raumfahrtzentrum, von den Autobahnen – das Meer als letzte Zuflucht. Oh, und zu guter Letzt mein eigenes Leben retten.
Aber Sie können nichts von alledem tun, solange der Träger im Flachtrudeln ist.
Ich hab’s versucht – ich erinnere mich nur undeutlich –, ich glaube, ich habe alles versucht, was mir einfiel, Sachen aus dem Handbuch und andere, um dieses verdammte Trudeln zu beenden. Bis ich etwas fand, was funktionierte.
Die Wunderkerzen.
Richtig. Unsere Haupttriebwerke sind nicht dazu gedacht, während des Fluges noch einmal gestartet zu werden. Und wir hatten sowieso keinen Treibstoff mehr. Bloß noch Dampf in unseren großen inneren Wasserstofftanks. Aber – ich habe mich gefragt, ob dieser Dampf nicht ausreichen könnte.
Ich weiß, ich kann die Tanks ausblasen, um Dampf abzulassen; ich weiß, ich kann die Wunderkerzen einsetzen, um ihn zu verbrennen. Das gehört zu einer Reihe letzter Mittel, die wir in den Simulatoren erprobt haben, falls wir uns jemals mit einem lecken Tank oder was auch immer auf dem Weg nach unten befänden. Vielleicht würde dieser eine starke Stoß durch explodierenden Dampf genügen, um das Trudeln auszuleiten.
Wir trudeln noch immer. Mir wird zusehends schwarz vor Augen. Bei jeder Armbewegung kämpfe ich gegen die Rotation an. Aber ich mache es trotzdem. Ich finde den richtigen Bildschirm und rufe ein paar Notfallroutinen auf.
Vierzigtausend Fuß. Ich aktiviere die Kommandosequenz. Keine Zeit, sie zu überprüfen.
Dreißigtausend Fuß.
Ich gebe den Startbefehl ein.
Rumms. Ein weiterer gewaltiger Tritt in den Hintern; die ganze Maschine erbebt.
Aber dieser fette, starke Impuls quer zur Rotationsachse treibt uns tatsächlich aus dem Trudeln. Wir stürzen weiter in die Tiefe, aber fürs Erste – ich zerre am Knüppel – kann ich uns wieder in die horizontale Lage bringen. Vielleicht nur für ein paar Sekunden. Das reicht, um die Maschine zu drehen, sodass unsere Nase jetzt zum Meer weist.
Ich denke, dass Nicola das Bewusstsein verloren hat.
Zwanzigtausend Fuß. Fünfzehn, zwölf.
Doch jetzt spüre ich, wie sich dieses verfluchte Flachtrudeln wieder aufbaut. Bevor es zu stark wird, greife ich hinüber und nach unten und ziehe an dem Hebel, der Motts Schleudersitz auslöst. Das Kabinendach wird abgesprengt; sie schießt auf einer Wolke aus glühend heißem Rauch ins Freie. Aber dieser Sitz hat funktioniert, als es nötig war. Gute, solide Lockheed-Technik, Gott segne die Jungs.
Sie hatten also schon Verbrennungen erlitten. Sie selbst, meine ich. Durch die Schleudersitzraketen. Die direkt neben ihnen hochgingen …
Ja, zum Teufel.
Sie hätten ebenfalls aussteigen können …
Nie im Leben.
Ich hab’s weiter versucht.
Sie haben es weiter versucht. Sie hatten bereits Cape Canaveral gerettet. Wahrscheinlich Tausende von Menschenleben. Sie hatten alles getan, was Sie konnten, um Nicola Mott zu retten.
Ah. Daraus entnehme ich, dass sie den Ausstieg nicht überlebt hat.
Tut mir leid, dass Sie es jetzt erfahren mussten. Das war ungeschickt von mir. Aber selbst nachdem Sie wussten, dass Sie selbst nicht entkommen konnten, sind Sie im Cockpit geblieben und haben eine Methode nach der anderen ausprobiert, um das Schiff unter Kontrolle zu bekommen. Und die Aufzeichnung zeigt, dass Sie Mission Control in Houston auf dem ganzen Weg nach unten Bericht erstattet haben.
Das war für die spätere Einsatznachbesprechung. Je mehr Informationen man den Flugleitern gibt, desto eher lässt sich verhindern, dass noch mal derselbe Mist passiert.
Eine Einsatznachbesprechung, bei der Sie wohl kaum mehr dabei sein würden.
Nein. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich überleben würde. Ich weiß, wie hart Wasser sein kann.
Also.
Das ist alles, woran ich mich erinnere.
Was ist als Nächstes geschehen?
Sie haben den Aufprall tatsächlich überlebt.
Aber dann brach ein Feuer aus. Möglicherweise verursacht von dem ausgetretenen Treibstoff der Korrekturtriebwerke, der aus der Nase lief.
Was sagt man dazu? Dieses verdammte lecke RCS! Hat mich also gleich doppelt erwischt.
Sie wurden geborgen. Sogar sehr schnell. Und man fand Sie lebend. Aber mit schweren Verbrennungen.
Wie schwer? Ich kann immer noch nichts sehen. Meine Augen … Sagen Sie’s mir. Hören Sie, ich fliege Versuchsflugzeuge; ich kenne den Anblick von Verbrennungsopfern.
Was war das Schlimmste, was Sie je gesehen haben?
Das Opfer eines Absturzes auf der Edwards Air Force Base. Ein Pilot. Komplett verbrannt. Die Haut schwärzlich braun, schmierig, wie ein … ein verbrannter Thanksgiving-Braten. Das Feuer hatte alles gefressen. Die Kleidung, die Haare, die Ohren, die Hände und Füße – Herrgott, sogar das Gesicht. Und die Arme und Beine waren irgendwie verschrumpelt und vertrocknet und an den Ellbogen und Knien gebeugt …
Ungefähr so schwer.
Scheiße.
Sie haben überlebt. Aber man konnte Sie nicht retten. Damals.
Damals?
Ein Air-Force-Team hat Sie geborgen. Man hat Sie stabilisiert, so gut es ging, und schnurstracks in eine geheime Einrichtung gebracht.
Geheim?
Sie war der damals von der USAF betriebenen Überwachungszentrale in der Lockheed-Fabrik in Sunnyvale angegliedert.
Also alles technisch auf höchstem Stand.
Sie waren einer von ihnen – von der USAF wie auch der NASA. Und nun hatten Sie zwar nicht Ihr Flugzeug, aber dafür das Cape gerettet, und fast auch noch Ihre Co-Pilotin …
Pilotin. Shuttle-Trägerund Orbiter haben Kommandanten und Piloten, keine Co-Piloten.
Verstanden. In den wenigen Minuten Ihres Fluges sind Sie wahrscheinlich der neben den Mars-Pionieren berühmteste Astronaut seit der Shuttle-Crew geworden, die 1978 Skylab gerettet hatte. Und was die Öffentlichkeit betraf, so schadete es vermutlich auch nichts, dass Sie Ihre Heldentat fast genau fünfzig Jahre nach Aldrins und Collins’ heroischer Rückkehr vom Mond ohne ihren Kommandanten vollbracht haben.
Hm. Die Air Force hat mich also unter ihre blauen Fittiche genommen. Und in diese Superklinik gebracht, von der Sie gesprochen haben.
Wie gesagt, retten konnte man Sie nicht, Malenfant. Stattdessen hat man Sie eingefroren. Bis der medizinische Fortschritt es ermöglichen würde …
Hören Sie, Karla. Schluss mit dem Seelenklempner-Herumgedruckse. Sagen Sie’s mir einfach. Wo bin ich …?
Willkommen im fünfundzwanzigsten Jahrhundert, Colonel Malenfant.
Im fünfundzwanzigsten.
Nehmen Sie sich ruhig einen Moment Zeit, um das zu verdauen. Ja, wir befinden uns im fünfundzwanzigsten Jahrhundert. Um genau zu sein …
Warum hat man mich aufgeweckt? Wieso gerade jetzt?
Weil Emma …
Emma? Die 2005 beim Phobos gestorben ist?
Weil Emma Sie um Hilfe gebeten hat.
3
Er dachte, er hätte geschlafen.
Er dachte, er wäre aufgewacht.
Er öffnete die Augen. Diesmal klappte es.
Eine graue Fläche vor ihm. Nein, über ihm. Erhellt von weichem Licht ohne sichtbare Quelle. Sie krümmte sich über ihm, als läge er in einem Ganzkörperscanner.
Medizinische Gerätschaften, was sonst. War er also noch im Krankenhaus?
Er hob den Kopf. Stieß sich die Stirn an einer Fläche, die sich nur Zentimeter über ihm befand.
»Toller Start, Malenfant«, sagte er und ließ sich zurücksinken.
Seine Stimme war gedämpft und leise, wie in einem schalltoten Raum. Er hörte sie jedoch, hörte seine Worte, eine physische Wahrnehmung. Anders als der seltsam körperlose Wortwechsel mit Karla zuvor. Und seine Stirn schmerzte ein wenig, wo er sie an der Fläche über ihm angeschlagen hatte.
Er war wieder real.
Er besaß auch ein umfassenderes Körpergefühl, merkte er jetzt. Die Schwere, die Masse. Er versuchte, sich zu bewegen. Spürte das Gewicht, als er die Arme hob und die Beine verlagerte. Das Rascheln eines losen, papierenen Stoffes, der ihn bedeckte, wie ein Krankenhaushemd. Hin und wieder ein jäher, leichter Schmerz, zum Beispiel in der Schulter, die er sich beim Football auf dem College ausgekugelt hatte, eine Verletzung, die ihn seit seinen Fünfzigern wieder quälte. Nun ja, damit musste man rechnen.
Man musste sogar mit noch viel Schlimmerem rechnen, wenn man einen Shuttle-Absturz hinter sich hatte. An den erinnerte er sich jetzt wieder, mit unangenehmen, lebhaften Details.
»Und ich erinnere mich an dich, Karla«, sagte er.
Als er daran zurückdachte, war es wie ein Traum. Seine Einsatznachbesprechung. Die Stimme, die ihn zu umgeben schien, ein warmes Bad aus Worten. Aber ihm hatte dieses Gefühl von Körperlichkeit gefehlt. Von Eingebettetsein. Als wäre er in einem Floatingtank geschwommen. Vielleicht betäubt, sodass er seinen Körper überhaupt nicht spüren konnte. Nicht einmal die innersten körpereigenen Empfindungen: Sogar die Propriozeption – ein kompliziertes Wort, das jeder Astronaut lernen musste, bevor er in die Mikroschwerkraft geschossen wurde; es bedeutete die Wahrnehmung des eigenen Körpers, seiner Lage im Raum, der relativen Positionen seiner Teile –, auch die hatte gefehlt.
»Na schön, jetzt spüre ich alles«, sagte er leise. »Ich bin wieder da. Schätze ich. Karla? Karla. Sind Sie noch da?«
Keine Antwort.
Er hob die Hände zu diesem neutralen, weder warmen noch kalten Deckel nur Zentimeter über seiner Nase. Drückte dagegen, aber nicht allzu fest. Zwecklos.
Bedächtig ließ er die Hände sinken. Holte tief Luft, Yogaatemzüge, die seinen Bauch füllten. »Ist ja nicht das erste Mal, dass es eng ist«, sagte er sich. »Klaustrophobische Räume. Wie damals, als Mott und ich diese Unterwasser-Bergungsübung absolviert haben.« Sie hatten im Modell einer Shuttle-Trägerkabine auf dem Meeresboden vor Guantanamo gehockt, und die Rettungsteams hatten sie drei Stunden zu spät gefunden. Behaupteten sie zumindest. »Das haben wir auch überstanden, Nicola, oder? Wenn wir das überstanden haben, überstehen wir auch dies hier. Stimmt’s?« Er hob erneut die Hände und zog sie bewusst zurück, bevor er den Deckel berührte. »Aber wer auch immer zuhört, jetzt möchte ich gern raus aus diesem Backofen, glaube ich. Der Truthahn ist durch, okay?«
Ein Knacken ertönte, ein leises Seufzen wie bei einem Druckausgleich – Malenfant spürte eine ganz leichte Abkühlung –, und der Deckel hob sich. In diesem ersten Moment erhaschte Malenfant einen kurzen Blick von einem hellen weißen Licht. Als würde er geboren.
Dann machte er einen sauber wirkenden, ordentlichen Raum aus. An den Wänden hingen Monitore.
Und über ihm ein Gesicht, das Gesicht eines Mannes, weder jung noch alt – in den Dreißigern? Glatt rasiert, kahler Schädel. Er lächelte auf ihn herab. »Ich dachte schon, Sie würden nie fragen. Wir müssen sicher sein, dass Sie so weit sind, verstehen Sie. Der Ausstieg aus einer Kälteschlafkapsel kann beunruhigend sein. Man muss wirklich herauswollen.«
»Ich … ich bin Reid Malenfant. Kennen Sie mich?«
»Nein. Aber ich werde Sie hoffentlich kennenlernen.« Eine ruhige, klare Stimme mit mittelatlantischem Akzent, wie Malenfant es vielleicht genannt hätte: wie von der urbanen amerikanischen Ostküste, aber weicher.
»Karla?«
Das Lächeln wurde breiter. »Nicht Karla. Aber sie wird Sie bestimmt vom Mond aus herzlich grüßen lassen, wenn sie erfährt, dass Sie endlich wach sind. Und dann ist da natürlich die an Sie adressierte Nachricht von Emma Stoney. Wir haben hier eine Kopie.«
Malenfant versuchte, das alles zu verarbeiten. Zu viele Informationen in ein paar Sätzen. »Ich war auf dem Mond …?«
»Allerdings. In einer Kälteschlafanlage unter einem Berg namens Pico, der …«
»Schon gut.« Verwirrt schob er das beiseite. »Emma? Darüber müssen wir reden. Eigentlich ist das unmöglich.«
»Eins nach dem anderen. Ich heiße Bartholomew. Was nicht zufällig auf den Namen dieses Krankenhauses hier in London zurückgeht.«
»London? London in England? Hören Sie …« Malenfant versuchte mühsam, sich zu bewegen. Er fühlte sich bleischwer, als lastete ein Gewicht auf seiner Brust.
»An Ihrer Stelle würde ich es langsam angehen lassen.«
Malenfant ließ es nicht langsam angehen. Er setzte sich auf, der Raum drehte sich, die Welt wich mit einem goldenen Licht und dem Dröhnen von Glocken von ihm zurück.
Und er fiel in eine tiefe Ohnmacht.
Als er wieder zu sich kam, saß er in einem Rollstuhl. Er trug einen Morgenmantel, schwer und warm. Weiche Schuhe an seinen unbestrumpften Füßen, wie Pantoffeln.
Der Raum wurde von einem großen Tank beherrscht, der mit leise summenden Zusatzgeräten verbunden war. Ein offener Deckel. Das Konstrukt hatte wirklich Ähnlichkeit mit einem medizinischen Scanner, sah er jetzt. Dieses weiche blaue Licht im Innern.
»Das ist also die Kiste, in der ich hergekommen bin.« Seine Stimme klang kratzig.
Bartholomew saß auf einem Stuhl und beobachtete ihn. Er trug eine praktisch aussehende grüne Uniform: Hose, weiter, kurzärmeliger Kittel. Im Raum befand sich noch eine andere Person, eine junge Frau, die auf einem weiteren Stuhl saß. Eigentlich noch ein Mädchen. Sie trug eine Art Overall aus einem tiefbraunen, wollähnlichen Stoff und starrte Malenfant mit großen Augen an. Sie war blass, sah er, mit dunklem, kurz geschnittenem Haar.
Es war ihm zutiefst peinlich, dass er sich vor Publikum derart aufgeführt hatte.
Bartholomew kam zu ihm und nahm unterwegs eine Tasse mit einer Flüssigkeit mit. »Trinken Sie das.«
Malenfant nahm die Tasse in der Erwartung entgegen, dass sie aus Plastik bestand, aber sie war aus Keramik. Die Brühe sah wie Hühnersuppe aus. Als er mit kleinen Schlucken davon trank, schmeckte sie nach Kartoffeln und Grünzeug.
An der Wand hing eine Vierundzwanzig-Stunden-Uhr. Es war kurz nach dreizehn Uhr. Und es gab auch so etwas wie einen Kalender, mit zwei Daten oder zumindest Zahlen:
AD 2469
2. Februar
Minus 928
2469 nach Christus. Das fünfundzwanzigste Jahrhundert, wie angekündigt.
Er warf Bartholomew und dem Mädchen einen raschen Blick zu. »Ich glaube, ich habe eine Menge Fragen.«
Bartholomew zuckte die Achseln.
»Fangen Sie an, womit Sie wollen, Mr. Reid«, sagte das Mädchen. »Wir sind hier, um Ihnen zu helfen. Wir beide.«
»Danke. Aber ich heiße Reid Malenfant. Es wäre korrekter, mich ›Mister Malenfant‹ zu nennen.«
Sie nickte. »Ah. Natürlich. Bei Ihnen war der Familienname nachgestellt. In Ordnung. Mister Malenfant.«
»Nur dass ich Colonel der US Air Force bin – oder war?«
Sie runzelte die Stirn. »Ich dachte, Sie wären Astronaut.«
»Na ja, ich war zwar im Astronautenkorps der NASA, aber genau genommen kein Astronaut. Ich habe Shuttle-Trägerstufen geflogen, die nicht bis in den Orbit gelangten. Also bin ich nie in den Weltraum geflogen.«
Bartholomew grinste. »Mittlerweile schon.«
»Richtig. Der Mond. Karla. Darüber müssen wir reden, nicht wahr? Aber zunächst mal – sehen Sie, ich bin Astronaut bei der NASAund Flieger bei der Air Force und Colonel. Also …«
»Also sollte ich Sie mit Colonel Malenfant anreden.«
»Einfach nur Malenfant.«
»Jetzt bin ich verwirrt.«
»Jeder nennt mich Malenfant. Sogar meine Frau. Jedenfalls damals. Bevor sie starb. Allerdings«, und er wandte sich Bartholomew zu, »hat Karla mir erzählt – ebenso wie Sie –, es gäbe eine Nachricht für mich. Von ihr. Das ist unmöglich. Sie ist 2005 gestorben. Das heutige Datum …« Er schaute auf die Wandanzeige. »Mein Träger ist im Jahr 2019 abgestürzt …«
Bartholomew nickte. »Sie stellen Vermutungen über das Datum an, und Sie vermuten richtig. Deshalb hängen wir einen Kalender an die Wand, damit Patienten wie Sie bei ihrer Wiederbelebung solche Informationen in ihrem eigenen Tempo aufnehmen können. Wir schreiben das Jahr 2469. Ich habe mir Ihre damaligen Kalender angesehen, um mich zu vergewissern, dass Ihnen das Datumsformat vertraut ist. Wir zählen die Jahre noch immer nach dem alten christlichen Kalender, obwohl wir in der Regel nicht mehr ›AD‹ oder ›nach Christus‹ sagen.« Er lächelte. »Also sollten Sie zumindest damit zurechtkommen.«
Malenfant grunzte. Nur dass meine Zeit ungefähr vierhundertfünfzig Jahre zurückliegt, dachte er.
Eins nach dem anderen, Malenfant.
Er schaute erneut auf die Anzeige. »Und diese zweite Zahl – die mit dem Minuszeichen?«
Das Mädchen lächelte strahlend. »Ich habe mich ebenfalls mit Ihrer Zeit beschäftigt. Mit Ihrem Astronautenjargon. Ich denke, Sie würden das als Countdown bezeichnen, Mister – ähm, Malenfant.«
»Ein Countdown? Minus neunhundertachtundzwanzig. Neunhundertachtundzwanzig was? Stunden, Tage?«
»Jahre«, sagte Bartholomew sanft. »Neunhundert Jahre und noch ein paar mehr, Malenfant.«
»Bis wann, 3397 nach Christus? Was ist dann?«
»Dann kommt der Zerstörer.«
Das sagte ihm nichts.
Aber es klang nicht gut.
»Wir machen das nicht besonders gut, stimmt’s?« Das Mädchen stand auf und trat an ein Wandgerät, um eine weitere Tasse Brühe zu holen. Dann kam sie zu Malenfant, nahm seine leere Tasse und reichte ihm die neue. »Trinken Sie noch etwas davon.«
Sie trug einen schlichten bronzenen Armreif am Handgelenk, sah er. Er nahm die Tasse und trank einen Schluck. Die Brühe schmeckte genauso wie eben, und er verspürte eine seltsame und unlogische Erleichterung. Ein Stück Kontinuität, von einem Moment zum nächsten: Ein kleiner Winkel dieser neuen Realität ergab Sinn.
Im Hintergrund saß Bartholomew, den Malenfant vorläufig als Pfleger eingestuft hatte, stumm und reglos da und beobachtete ihn. Sehr reglos, dachte Malenfant; es wirkte ein wenig unheimlich.
Das Mädchen zog den Stuhl zu Malenfants Rollstuhl, setzte sich ihm gegenüber und beugte sich vor, die Hände im Schoß gefaltet, mit konzentrierter Miene. Vielleicht spürte sie seine Desorientierung, dachte er sich.
»Ich merke gerade, dass ich Ihnen meinen Namen noch nicht genannt habe.« Sie zupfte an ihrer Kleidung, an handgenähter Baumwolle und Wolle. Ein Hauch Nervosität. »Es ist ein solches Durcheinander, nicht wahr? Für uns ebenso wie für Sie.«
»Das stimmt«, rief Bartholomew dazwischen. »Sie sind bei Weitem der älteste Kälteschläfer, um den ich mich jemals kümmern musste. Und erst recht der berühmteste. Jeder Fall ist einzigartig, aber bei Ihrem waren eine Menge Nachforschungen und sogar experimentelle Probeläufe nötig, bevor man Sie wohlbehalten zurückholen konnte.«
Malenfant versuchte, das zu verdauen. »Ich … Danke.«
Bartholomew grinste. »Na ja, es ist ja nicht so, als hätte ich noch was anderes zu tun.«
Eine seltsame Erwiderung, ein weiterer in der Luft hängender Gesprächsfaden, aber Malenfant ignorierte ihn und konzentrierte sich auf das Mädchen. »Dein Name«, hakte er nach.
»Ja. Verzeihung. Ich heiße Greggson Deirdra. Ähm, ich vermute, Sie würden Deirdra Greggson sagen.«
»Greggson Deirdra«, wiederholte er, um sich den Namen einzuprägen. Er hatte das intuitive Gefühl, dass er in dieser offenkundig seltsamen neuen Welt Verbündete brauchen würde. »Hübscher Name. Ich kannte mal eine Deirdre.«
»Ich habe mir den Namen selbst ausgesucht«, sagte sie fröhlich. »Er bedeutet Wandervogel. Er wurde vor fünf Jahren bestätigt, an meinem zwölften Geburtstag. Die ganze Stadt war dabei.«
Malenfant behielt auch das im Gedächtnis. Sie war noch jünger, als sie aussah. »Okay. Und bist du ein Wandervogel, Deirdra?«
»Ich glaube schon. Der Name kam mir richtig vor. Meine Eltern haben immer gesagt, ich sei schon als Kind ein unsteter Geist gewesen. Oh, meine Aufgaben habe ich immer erledigt. Hausarbeiten, Schularbeiten, städtische Projekte. Ich war gut in der Schule, denke ich. Aber in meiner Freizeit fiel es mir immer schwer, länger bei irgendetwas zu bleiben. Ich hätte nie gern gespielt, hat meine Mutter gesagt. Ich habe ständig nach Projekten Ausschau gehalten.«
»Und was machst du hier?« Er warf Bartholomew einen raschen Blick zu. »Er ist ein Pfleger, nehme ich an. Aber du …«
»Ich habe mich freiwillig gemeldet. Jeder Schläfer, der aus einer der Kälteschlafkapseln kommt, braucht einen Begleiter oder eine Begleiterin. Besonders wenn er sehr lange geschlafen hat …«
»Und, wie gesagt«, warf Bartholomew ein, »niemand hat so lange geschlafen wie Sie, Malenfant. Soweit wir wissen.«
»Das überrascht mich nicht. Im Jahr 2019 gab es schließlich noch gar keine ›Kälteschlafkapseln‹. Jedenfalls nicht, dass ich wüsste.«
Deirdra nickte. »Als ich von Ihrem Fall gelesen habe, war ich einfach fasziniert. Ich meine, Sie werden einen vernünftigen Menschen brauchen, der Ihnen alles zeigt.«
Er grunzte. »Wie man die Nahrungsreplikatoren und Materietransmitter bedient?«
Sie machte ein verblüfftes Gesicht. »Von Materietransmittern habe ich noch nie gehört.«
Bartholomew grinste. »Mach dir nichts draus. Er nimmt dich auf den Arm. Das sind Anspielungen auf Popkulturphänomene, die wahrscheinlich schon zu dem Zeitpunkt, als er mit seinem Raumschiff abgestürzt ist, aus der Mode waren.«
Malenfant musterte ihn. »Ich bin beeindruckt, dass Sie das wissen. Und sogar den Ausdruck ›Popkultur‹ kennen.«
Bartholomew zuckte die Achseln. »Habe ich nachgeschlagen.«
Aber er hatte bloß die ganze Zeit reglos auf seinem Stuhl gesessen, soweit Malenfant erkennen konnte. Er hatte rein gar nichts nachgeschlagen, jedenfalls nicht auf sichtbare Weise. Malenfant behielt auch das im Gedächtnis. Ein weiterer Anhaltspunkt, was diese neue Welt und ihre Menschen betraf: Intelligente Hilfssysteme waren hier offenbar allgegenwärtig.
Und er registrierte auch, dass Deirdra nicht bestritten hatte, schon von Nahrungsreplikatoren gehört zu haben. Es fühlte sich wie ein kleiner Sieg an, wenn auch durch einen Schuss ins Blaue.
Er wandte sich wieder an Deirdra. »Du hast dich also freiwillig bereit erklärt, meine … Helferin zu sein.«
»Sagen wir, sie ist eine Fremdenführerin«, verbesserte Bartholomew. »Sie brauchen keine Helferin. Sie sind ja nicht krank, Malenfant. Die Kälteschlafkapsel hätte Sie nicht freigegeben, wenn Sie nicht gesund genug wären, um einigermaßen zurechtzukommen.«
Er dachte darüber nach. »Trotzdem bin ich ohnmächtig geworden, als ich mich aufgesetzt habe.« Er machte eine Bestandsaufnahme. »Ich habe ein paar Wehwehchen. Meine alte Schulterverletzung …«
»Was erwarten Sie, Malenfant? Sie sind als neunundfünfzigjähriges Wrack reingegangen und als geheilter Neunundfünfzigjähriger rausgekommen. Wir konnten nicht mehr tun, als Sie wieder so hinzukriegen, wie Sie damals waren.«
Malenfant grinste Deirdra an. »Ganz schön schlau für einen Pfleger, was?«
»Ich bin sicher, er macht seine Arbeit gut.«
Bartholomew lachte. »Ein schallendes Loblied.«
»Okay, eine Fremdenführerin«, knurrte Malenfant. »Wisst ihr, ich bin sehr dankbar. Aber meine Zeit liegt vier Jahrhunderte zurück. Nennt mich Captain America.«
Ein weiteres verwirrtes Stirnrunzeln bei Deirdra. »Wer ist das?«
»Noch mehr dem Vergessen anheimgefallene Popkultur, Malenfant?«, sagte Bartholomew.
»Dann eben Frank Poole. Miles Monroe. Rip van Winkle. Ich glaube, ich werde eine Menge Führung brauchen. Ich weiß nichts über die Welt da draußen. Außerhalb dieser vier Wände.«
»Gar nichts?«
»Nun ja, Bartholomew hier hat mir erklärt, dass ich in einem Krankenhaus in London bin, das genauso heißt wie er.«
Ihre Miene hellte sich auf. »Na bitte. Sie sind in London. Auf dem Grund der Themsebucht.«
Malenfant glaubte, nicht richtig gehört zu haben. »Die Themse war damals ein Fluss. Ich bin unter Wasser?«
»Eins nach dem anderen, Malenfant«, mahnte Bartholomew.
»Okay. Na, immerhin kann ich euch verstehen. Eure Sprache hat sich nicht so stark … äh … weiterentwickelt.«
Bartholomew und Deirdra wechselten einen Blick.
»Daraus würde ich keinen allzu großen Trost schöpfen, Malenfant«, sagte Bartholomew sanft. »Sie bekommen eine Menge Hilfe bei der Übersetzung.«
Malenfant verspürte eine seltsame Niedergeschlagenheit. Wieder diese intelligenten Hilfssysteme. »Schon gut. Worauf ich hinauswill, Deirdra: Ich werde vermutlich eine Menge Unterstützung benötigen. Du hast doch sicher dein eigenes Leben, und das wird einen großen Teil davon in Anspruch nehmen.« Er schüttelte den Kopf. »Wo stehst du denn beispielsweise in deiner schulischen Ausbildung? Gehst du aufs College?«
Sie wirkte verunsichert und warf Bartholomew erneut einen Blick zu. Der hob die Schultern.
»Das ist jetzt anders«, sagte Bartholomew. »Heutzutage gibt es erheblich mehr Heimunterricht, wie Sie es wohl genannt hätten. Denke ich.«
»Aber kannst du dir die Unterbrechung denn erlauben?«
Erneut schaute sie verunsichert drein. »Sie stellen Fragen, die keinen Sinn ergeben. Na ja, ich nehme an, das ist der springende Punkt – weshalb Sie mich überhaupt brauchen. Ich kann mir bei meinem Studium so viel Zeit lassen, wie ich will. Mein ganzes Leben lang, wenn ich möchte. Und mit Ihnen zu arbeiten wird selbst schon ein Studium sein. In gewisser Weise.«
»Ja, ja. Grundkurs alter Brummbär. Aber wie steht’s mit deinen Zukunftsplänen? Mit der Arbeit?«
Wieder zeichnete sich in ihrer Miene Verwirrung ab.
»Deirdra«, warf Bartholomew ein, »du darfst nicht vergessen, dass er nicht mal weiß, was ein Stipendium ist. Dieses System gab es seinerzeit noch nicht.«
Sie machte große Augen. »O ja, richtig. Ich hätte gedacht, das System wäre viel älter. Also mussten die Menschen sogar noch Anfang des einundzwanzigsten Jahrhunderts …«
»Ja, sie mussten in der Regel arbeiten, um am Leben zu bleiben, um zu essen. In Malenfants Heimat standen die meisten Menschen wirtschaftlich allerdings etliche Stufen höher, sodass es bei ihnen nicht ganz so krass zuging, aber im Grunde war es so.«
Sie lächelte. »Das wird überaus faszinierend sein, Malenfant.«
Er fühlte sich geschmeichelt, empfand aber auch eine gewisse Nervosität. »Ich bin kein altes Buch, das du studieren kannst, weißt du.«
»Das ist mir klar.«
Aus einem spontanen Impuls heraus nahm Deirdra Malenfants Hände in die ihren. Sie war jung; ihre Hände waren weich und warm, aber kräftig. Im Gegensatz dazu fühlte sich seine eigene Haut zäh und ledrig an. Der Körperkontakt brachte ihn seltsamerweise durcheinander. Ihm kam der Gedanke, dass ihn zum ersten Mal, seit er die Kapsel verlassen hatte, jemand berührte, zumindest während er bei Bewusstsein war.
»Wir müssen viel lernen, Sie und ich«, sagte Deirdra. »Sie fühlen sich bestimmt völlig verloren. Aber Sie denken als Allererstes über mich nach und bringen Ihre Besorgnis darüber zum Ausdruck, welche Auswirkungen Sie auf mich und mein Leben haben könnten. Das zeigt in meinen Augen, dass Sie ein anständiger Mensch sind, Malenfant. Selbstlos.«
»Ich … vielen Dank. Offensichtlich nicht so anständig wie du.«
»Ich habe mir alles gut überlegt, bevor ich die Entscheidung getroffen habe hierherzukommen, um Sie zu treffen.«
Bartholomew hustete. »Das ist alles gut und schön. Aber du wirst deine Mutter davon überzeugen müssen, Deirdra. Die sich bereits gemeldet hat.«
Deirdra schaute genervt drein. »Jetzt schon?«
»Zusammen mit Präfekt Morrel, ja.« Er breitete die Hände aus. »Ich musste ihnen Bescheid sagen, als Malenfant endlich aufgewacht ist. Sie werden ihn selbst kennenlernen wollen.«
»Aha.« Malenfant lehnte sich zurück und ließ Deirdras Hände los. »Das alles hat also doch Auswirkungen auf dein Leben. Deine Leute sind sich nicht sicher, was sie von der Sache halten sollen, stimmt’s? Ebenso wenig wie die Cops. Welches Wort haben Sie benutzt? Präfekt?«
»Präfekte sind keine Cops in dem Sinn, wie Sie es meinen«, sagte Bartholomew. »Sie sind zum Beispiel allesamt Ehrenamtliche mit befristeter Dienstzeit. Aber wenn es bei uns überhaupt so etwas wie Polizisten gibt, dann sind sie es.«
»Und weswegen macht deine Mutter sich nun Sorgen? Geht es um deine Ausbildung?«
»Nein.« Sie wirkte irritiert und frustriert.
Erneut verspürte er diese Ratlosigkeit, als er sich in eine zukünftige Gesellschaft einzufühlen versuchte, über die er nicht das Geringste wusste. »Welchen Schaden könnte es dann anrichten? Welchen Schaden könnte ich anrichten?«
»Ich kann Ihnen einen Hinweis geben«, sagte Bartholomew.
»Was für einen Hinweis?«
Und Bartholomew deutete zur Wand.
Die Countdownuhr. Es war, als hätte Malenfant dieses entscheidende, unerquickliche Detail vergessen. Der Zerstörer.
Er sah die anderen grimmig an. »Dann lasst uns reden, solange wir noch Zeit haben – bevor das FBI anrückt.«
4
Deirdra holte ihm eine weitere Tasse Brühe und sich selbst einen Becher Wasser. Dann setzte sie sich wieder vor ihm hin. »Okay. Reden wir.«
Wo sollte er anfangen?
»Also … das Letzte, woran ich mich erinnere – aus meinem alten Leben –, ist, dass ich versucht habe, das Wrack der Constitution von den Anlagen auf Cape Canaveral wegzumanövrieren.«
»Das ist Ihnen auch gelungen, Malenfant«, sagte Deirdra. »Ihre berühmteste Tat – das ließ sich leicht recherchieren. Außerdem existiert Canaveral noch. Hinter dem Deich, natürlich.«
»Ein Deich? Nein, später. Okay. Die haben mich also zusammengefegt.«
Bartholomew stieß ein bellendes Gelächter aus. »So ungefähr.«
Deirdra runzelte erneut die Stirn. »Sie sagten, damals hätte es noch keine Kälteschlafkapseln gegeben?«