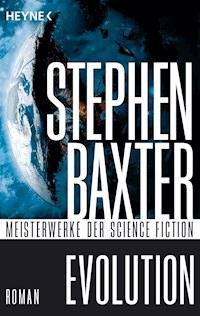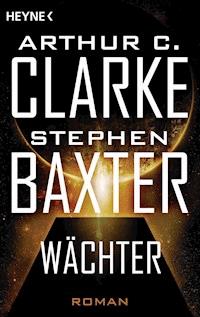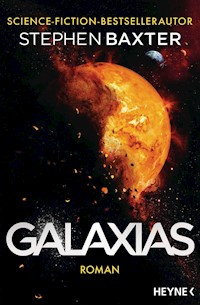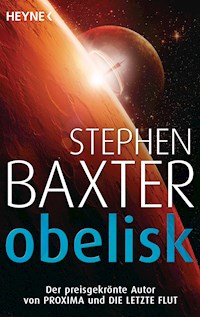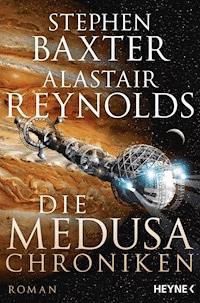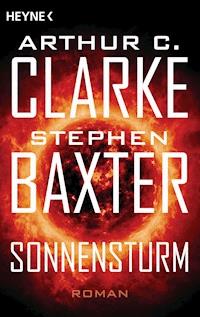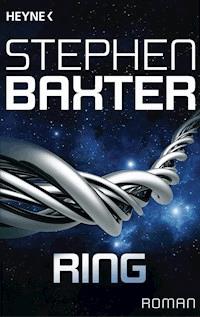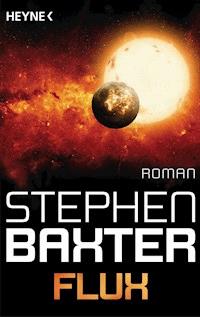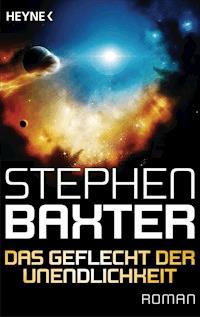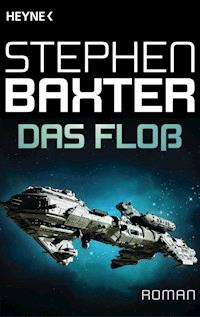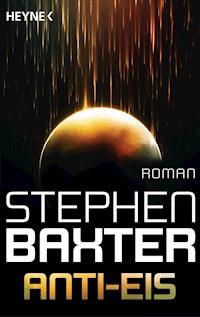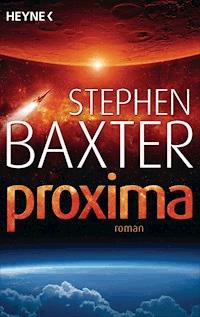13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Im Jahr 2145 bricht John Hacknett mit seinem Raumschiff Perseus zum Andromedanebel auf. Seine Mission: Er soll die Sternkonstellation genauer in Augenschein nehmen, die in ferner Zukunft mit unserer Milchstraße kollidieren wird, und dann zur Erde zurückkehren, um der Menschheit Bericht zu erstatten. Hacknett reist nicht nur durch den Raum, sondern auch durch die Zeit, denn für die Erde werden fünf Millionen Jahre bis zu seiner Rückkehr vergehen. Wird es dann noch eine Menschheit geben, der er Bericht erstatten kann?
Das Jahr 30 in der fernen Zukunft. Melas Erde steht kurz vor dem Untergang, die Erosion frisst immer mehr Land auf, zwingt Menschen und Tiere zur Flucht. Obwohl Mela immer wusste, dass ihre Erde eines Tages untergehen würde, kämpft sie doch gemeinsam mit ihrer Familie ums Überleben – und um die Zukunft der Tausend Erden …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 790
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Das Buch
Im Jahr 2145 bricht John Hacknett mit seinem Raumschiff Perseus zum Andromedanebel auf. Seine Mission: Er soll die Galaxie genauer in Augenschein nehmen, die in ferner Zukunft mit unserer Milchstraße kollidieren wird, und dann zur Erde zurückkehren, um der Menschheit Bericht zu erstatten. Hacknett reist nicht nur durch den Raum, sondern auch durch die Zeit, denn für die Erde werden fünf Millionen Jahre bis zu seiner Rückkehr vergehen. Wird es dann noch eine Menschheit geben, der er Bericht erstatten kann?
Das Jahr 30 in der fernen Zukunft. Melas Erde ist eine von Tausenden – und sie steht kurz vor dem Untergang: die Erosion frisst immer mehr Land auf, zwingt Menschen und Tiere zur Flucht. Obwohl Mela immer wusste, dass ihre Erde eines Tages untergehen würde, kämpft sie doch gemeinsam mit ihrer Familie ums Überleben – und um die Zukunft der Tausend Erden. Ihre Hoffnung ist ein Mann namens Perseus, eine Art Gott, der seit Jahrtausenden verschollen ist …
Der Autor
Stephen Baxter, 1957 in Liverpool geboren, studierte Mathematik und Astronomie, bevor er sich ganz dem Schreiben widmete. Er zählt zu den international bedeutendsten Autoren wissenschaftlich orientierter Literatur. Etliche seiner Romane wurden mehrfach preisgekrönt und zu internationalen Bestsellern. Stephen Baxter lebt und arbeitet im englischen Buckinghamshire.
Mehr über Stephen Baxter und seine Werke erfahren Sie auf:
STEPHEN BAXTER
Die tausend Erden
ROMAN
Aus dem Englischen vonJakob Schmidt
WILHELM HEYNE VERLAGMÜNCHEN
Titel der Originalausgabe:
THETHOUSANDEARTHS
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Deutsche Erstausgabe 07/2024
Redaktion: Ralf Dürr
Copyright © 2022 by Stephen Baxter
Copyright © 2024 dieser Ausgabe und der Übersetzungby Wilhelm Heyne Verlag, München,in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,Neumarkter Straße 28, 81673 München
Covergestaltung: Das Illustrat, München,unter Verwendung des Originalmotivs
Jacket Design © blacksheep-uk.com
Cover image reference: © Depositphotos and Gettyimages
Satz: Schaber Datentechnik, Austria
ISBN 978-3-641-31749-2V004
www.diezukunft.de
Übersicht
Inhaltsverzeichnis
John Hackett
1
2
3
4
Mela
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
John Hackett
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Mela
29
30
31
32
33
34
35
36
37
John Hackett
Mela
John Hackett
62
63
64
65
66
67
Mela
68
69
John Hackett
70
71
72
73
Mela und John Hackett
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
Nachwort
Haben Sie Lust gleich weiterzulesen? Dann lassen Sie sich von unseren Lesetipps inspirieren.
Newsletter-Anmeldung
In Gedenken an meine Mutter, geb. Sarah Marion Richmond (1929–2018),
meine Großmutter, geb. Sarah Elizabeth Moorhead (1885–1977)
und meine Urgroßmutter, geb. Sarah Hackett (1869–1940).
John Hackett
2154 AD
1
Es begann mit einem Ende.
Es endete mit einem Anfang.
Denise Libby hatte den weiten Weg von der Erde bis zum Jupiter zurückgelegt, um ihren Ex-Mann John Hackett zu interviewen.
Nun, allein in einer winzigen automatisierten Fähre, spürte Denise Libby kaum den Druck, hörte kaum das Zischen der Dampfraketentriebwerke, als ihr Schiff langsam von der Oberfläche des Jupitermonds Callisto abhob. »Transparenter Rumpf«, befahl sie.
Die Kabine blieb undurchsichtig. Wie eine Wand aus dummem Stahl.
Sie war bereits darauf hingewiesen worden, dass das hier so Vorschrift war. Nur dauerhafte Einwohner, die hiesige Polizei, Nothelfer und einige andere Privilegierte durften die irrwitzige Aussicht genießen, die sich ihnen beim Start- oder Landeanflug auf den Jupitermond bot. Der Anblick sei zu schwindelerregend für Neulinge, hieß es in der Begründung. Wahrscheinlicher war, dass wegen des aufkeimenden Konflikts zwischen der Erde und ihren Jupiterkolonien niemand etwas nach außen dringen lassen wollte. Möglicherweise hätte sie einen Blick auf eine geheime Waffenplattform erhaschen können. Oder auch nur auf von der Erde nicht genehmigte Bergbauoperationen.
Pah. Sie versuchte es trotzdem.
»Transparenter Rumpf«, wiederholte sie.
Bei seinem Aufenthalt hier ging es John nicht einmal um den Jupiter – und auch nicht um Callisto oder um interplanetare Politik. Zumindest nicht direkt. Schon bald würde er dieses rohstoffreiche Planetensystem verlassen, zusammen mit seiner Crew ähnlich tickender suizidaler Dummköpfe, auf einer Mission Richtung Andromeda-Galaxis, von der es kein Zurück geben würde. Das war schon ein dickes Ding, eine Reise von fünf Millionen Lichtjahren – und fünf Millionen unumkehrbaren Jahren in die Zukunft.
Und sie saß in diesem albernen kleinen Spielzeugraumschiff und musste sich wie ein Baby behandeln lassen.
»Transparenter Rumpf, verdammt noch mal. Transparenter Rumpf. Trans…«
Der Rumpf wurde transparent.
Jetzt hatte sie das Gefühl, in einer Art Umriss eines Schiffs zu fliegen, einer Kiste aus schlanken, aber robust anmutenden Trägern, die die klobige Masse eines Fusionstriebwerks und dicke Treibstofftanks zusammenhielten. Weitere namenlose Apparaturen waren wahrscheinlich Teil des Lebenserhaltungssystems, das ihr das Atmen ermöglichte. All das hing in einem Strebwerk, das seinerseits im leeren Raum schwebte.
Und dort, weit unter ihr, war Callisto, eine braune Kugel, die nur schwach von der fernen Sonne erhellt wurde. Während des Transits von der Erde – hundert Tage bei ständigem Fusionsraketenschub – hatte es für sie nur wenig zu sehen oder zu tun gegeben. Sie hatte die Reise in grimmigem Schweigen zugebracht, ohne Kommunikationsverbindung nach außen. In einem Sonnensystem, das sich anscheinend auf einen Krieg vorbereitete, sausten Schiffe wie das ihre still und stumm durch die interplanetare Nacht.
Doch nun hing Callisto unter ihr am Himmel. Der vom Jupiter am weitesten entfernte seiner vier größten Monde war größer als der Erdmond und von Kratern bedeckt. Für Denise sah er wie eine von Einschusslöchern übersäte Glaskugel aus. Sie wusste, dass die Oberfläche dieses Mondes sich schon seit Ewigkeiten so darbot und manche ihrer Narben ungeheuer alt waren. Seine Geologie unterschied sich deutlich von der des Erdmonds mit seinen oberflächlich ähnlichen Einschlagstellen, denn dieser entlegene Himmelskörper hier bestand der Masse nach mehr als zur Hälfte aus Wassereis. Die Krater waren gefrorene Spritzer, und eben das hatte die Erdregierungen hierhergelockt, vorbei an den abtrünnigen, zerstrittenen, politisch unruhigen unabhängigen Siedlungen im Asteroidengürtel. Das Wasser. Wasser, mit dem sich in Habitaten menschliches Leben erhalten ließ, Wasser als Fusionstreibstoff für Raumschiffe, Wasser, das nicht unter dem Monopol der Bergbauratten im Asteroidengürtel stand, Wasser für eine sich rasend weiterentwickelnde Industrie.
Eine Industrie, die den Bau des ersten bemannten interstellaren Raumschiffs der Menschheit möglich gemacht hatte.
Womit sie wieder bei ihrer bevorstehenden Aufgabe war. Nicht dass schon irgendetwas von John oder seinem Schiff, der Perseus, zu sehen gewesen wäre. Sie drehte sich um sich selbst, blickte angestrengt durch den transparenten Rumpf nach draußen und versuchte, sich anhand der gewaltigen kosmischen Entitäten, die sie umgaben, zu orientieren: hier die Sonne, Callisto, funkelnde Punkte, bei denen es sich um weitere Jupitermonde handelte … aber wo zum Teufel steckte der Jupiter selbst?
Schließlich, als sie sich einmal mehr umdrehte, sah sie einen schmalen Halbmond, in dem wie in einer Wiege ein Kreis aus Dunkelheit lag. Eine dünne Linie, nur ein Bogen rötlichen Lichts, dessen Außenrand vor der dahinterliegenden tieferen Finsternis verschwamm.
Aber der Innenrand zeichnete sich scharf ab. Technologisch. Das war etwas Künstliches.
Und dann begriff sie es mit einem Mal. »Oh. Jetzt verstehe ich. Ich sehe den Jupiter nicht, weil dein verdammtes Schiff so groß ist, dass es den Jupiter verdeckt, Hackett. Zumindest fast.«
»Perseus an Callisto-Fähre.« Johns geschmeidige Stimme erklang aus der leeren Luft.
»Du blöder Angeber. Da müsst ihr euch bei der Navigation ja ganz schön ins Zeug gelegt haben, um diese Nummer abzuziehen. Du hättest mich ruhig warnen können.«
»Hättest du mir denn zugehört? Das wäre das erste Mal gewesen. Du wirst von meinem Andocksystem gesteuert. Halt einfach die Füße still, ich hole dich rein. Und drück nicht auf irgendwelche Knöpfe.«
»Hier gibt es keine Knöpfe …«
»Unser Bussardkollektor für Dunkle Energie ist ziemlich fragil. Bevorzugst du immer noch Pfefferminztee?«
Das tat sie seit Jahren nicht mehr, schon länger, als sie getrennt waren. Sie hatte sogar schon vor dem Tod ihrer Nichte Sarah damit aufgehört, der letztendlich zu ihrer Trennung geführt hatte. Aber im Moment ging es nicht darum, einander eine reinzuwürgen. »Ja, Pfefferminztee«, antwortete sie ruhig.
Stück für Stück kamen die Wolken des Jupiter hinter dem gewaltigen Kollektorsegel zum Vorschein. Der König aller Planeten, von Menschenhand verdunkelt.
»Bis gleich«, sagte Hackett.
Die intelligente Fähre fand ohne Schwierigkeiten den Weg um den Bussardkollektor herum – oder vielmehr hindurch. Aus der Nähe erwies er sich als Gewebe mit weiten Maschen, von denen jede ein ordentliches Sechseck bildete.
Aus Denise’ Perspektive verwandelte er sich während des Anflugs der Fähre allerdings in eine Wand, die sich am Himmel entlangzog. Eine Wand, rief sie sich in Erinnerung, vor der man fünfzehn Planeten von Erdgröße hätte aufreihen können, ohne dabei die Ränder zu erreichen. Und an jedem Knotenpunkt des Gewebes sah sie Technologie, glitzernde Knubbel, deren Komplexität unverkennbar war.
»Ich schätze, das, was ich da sehe, sind die Zugriffspunkte für Dunkle Energie«, murmelte sie, als eines der großen sechseckigen Löcher sich um sie herum auftat.
»Sie sind noch nicht alle im Einsatz«, erwiderte John. »Wir testen das Segel noch. Erst einmal wollen wir herausfinden, wie haltbar es ist und wie gut das intelligente Feedback und die Kontrollen funktionieren. Ich sage wir – aber alle anderen schlafen schon.«
»Die anderen sechs der Andromeda-Sieben. Alle in ihren Schwebetanks?«
»Wo auch ich mich bald zu ihnen gesellen werde. Um fünf Gravitationsschübe und zwölf Jahre zu verschlafen – oder, von außen betrachtet, zweieinhalb Millionen Jahre, dank der Relativität, da wir uns der Lichtgeschwindigkeit annähern werden. Bis zur Andromeda-Galaxis.
Was mich betrifft, es gibt noch ein paar letzte Dinge zu überprüfen, während wir uns auf vollen Schub vorbereiten. An jedem Knotenpunkt des Kollektors haben wir eine Art Teilchenbeschleuniger, der eine bestimmte Art von Neutrino, einen sogenannten sterilen Neutrino, in die höherdimensionale Masse abstrahlt, in der unser Universum treibt – wie eine Membran auf Wasser. Daher kommt die Dunkle Energie. Unser Universum, oder unsere Membran, dehnt sich aus wie ein Ballon, und der Grund dafür sind rätselhafte Strömungen in diesem seltsamen höherdimensionalen Ozean. Die wir nun anzapfen können, als unerschöpfliche Antriebsquelle, wenn du so willst …«
Er sprach in ordentlichen, vorgekauten Absätzen, wie er sie zweifellos schon bei zahllosen Presse- und Regierungskonferenzen heruntergeleiert hatte.
»John, hast du etwa vergessen, dass ich all das weiß? Ich habe mit dir zusammengearbeitet, als du diese Idee mit deinen Geldgebern ausgearbeitet hast, weiß du noch? Ich musste dir helfen, damit sie nach einer Technologie für Langstrecken-Wissenschaftsmissionen klang …«
»Tja, sehr viel längere Strecken als bis zur Andromeda-Galaxie gibt’s nicht so oft …«
»… und nicht bloß nach der praktischen Demonstration einer funkelnagelneuen Technologie, die die Erde aus der Abhängigkeit von den Felsratten im Asteroidengürtel befreit. Ohne Fusionstriebwerk wird auch das kostbare Wasser der Felsratten nicht gebraucht. Das war’s dann mit dem Ressourcenmonopol. Interplanetare Politik eben.«
»Es ist wirklich bedauerlich. In den Zeiten, in denen wir leben, können wir alle nur unser Möglichstes tun … du müsstest den Kollektor inzwischen durchquert haben.«
Schon eine Weile hatte sie nicht mehr nach draußen geblickt, und nun stellte sie fest, dass er recht hatte. Jene gewaltige Konstruktion lag nun hinter ihr, und sie schwebte durch eine Art Himmel voller Fäden und Netze, sanft angestrahlt von der fernen Sonne – und von dem noch schwächeren Schein des großen Jupiter mit seinem trüben, wogenden Wolkenband. In gewisser Weise befand sie sich nun im Innern des ungeheuerlichen Schiffs.
»Siehst du die Habitate?«
Sie ließ den Blick über die Fäden schweifen; es mussten Millionen sein, aber alle Linien kamen in einem weit entfernten Technologieknoten zusammen. Sie berührte einen Bildschirm, zog ein Diagramm zu sich heran, sodass es vor ihr in der Luft hing, und vergrößerte es. Es stellte ein stumpfes Quadrat dar, vier stabförmige Module, die an den Ecken miteinander verbunden waren.
»Ich sehe euch. Hol mich rein, John …«
2
»Willkommen auf der Perseus.«
Er trug einen knallgrünen Overall und weiche Hausschuhe. Auf seiner Brust prangte das UN-Logo.
Sie umarmten sich steif.
Dann trieben sie Seite an Seite schwerelos durch das Schiff.
Die Module, durch die er sie in der Null-Gravitation zügig hindurchgeleitete, bestanden aus der üblichen glänzenden Weltraumtechnologie. Jeder Quadratzentimeter jedes Wandstücks war intelligent, einschließlich der weit auseinanderliegenden Kajüten, in denen Johns sechs Crewmitglieder bereits in ihrem traumlosen, künstlich induzierten Winterschlaf lagen. Ihr fiel auf, dass Grün- und Blautöne vorherrschten – sanfte Farben, die an die Erde erinnerten. Abgesehen davon hätte sie auch in jeder anderen Weltraumanlage sein können, die sie schon besucht hatte, von der unteren Erdumlaufbahn bis hin zum Mond oder den Asteroiden – und nun bis hierher, zum Jupiter mit seinen riesigen wasserreichen Monden, wo wohl der Entscheidungskampf um den Verlauf der nächsten Jahrhunderte der Menschheitsgeschichte ausgetragen werden würde.
John war sehr viel interessanter als solche Abstraktionen im Planetenmaßstab, interessanter als ein interplanetarer Krieg. Das galt für alle Menschen. Denise hätte sich selbst dann für ihn interessiert, wenn er nicht Teil der ersten Crew gewesen wäre, mit der sie zum Neptun geflogen war, dem äußersten Planeten. Selbst, wenn sie nie mit ihm verheiratet gewesen wäre.
»Du hast dir wieder den Kopf kahl rasiert«, bemerkte sie.
»Eine Depilation ist üblich, wenn man sich auf den langen Schlaf vorbereitet. Schlimmer war es, sich die Augenbrauen abzurasieren. Und untenrum …«
»Du hast zugenommen.«
»Das tun wir Kälteschläfer vorher immer. Du nimmst das sicher alles auf, in Wort und Bild – deshalb die offensichtlichen Fragen?«
»Natürlich.«
Er zuckte mit den Achseln. »Es tut mir leid, dass es hier so wenig zu sehen gibt. Genau genommen wird es auch die nächsten zweieinhalb Millionen Jahre lang nicht viel zu sehen geben, bis wir Andromeda vor dem Bug haben.«
Das klang zugegebenermaßen aufregend.
Sie ließ sich von ihm in eine Mensa begleiten, wo tatsächlich Pfefferminztee in Tassen mit Deckeln für Schwerelosigkeit bereitstand. Sie setzten sich nach Astronautenmanier an einen Tisch, die Beine hinter Stangen unter den Stühlen gehakt, um sich zu stabilisieren. Er war inzwischen fünfzig Jahre alt, zwei Jahre älter als Denise. Er war hochgewachsen, schlank, und fühlte sich wohl in seinem für die Mission trainierten Körper. Hübsch war er noch nie gewesen, dachte sie, aber markant – besonders jetzt, mit seinem rasierten Kopf. Trotzdem wirkte er freundlich und immer aufgeschlossen.
»Du hast Fragen«, sagte er ruhig. »Sowohl persönlicher als auch allgemeiner Natur, nehme ich an.«
»Wird alles zu Protokoll gegeben«, antwortete sie ebenso ruhig.
»Schieß los.«
»Alles klar. Was ist der wahre Grund für diese Mission, John? Deiner Meinung nach. Du kannst ganz offen sein: Jetzt zieht dir keiner mehr den Stecker. Und warum bist du so versessen darauf, sie genau zu diesem Zeitpunkt zu unternehmen? Geht es darum, die technologische Überlegenheit der Erde zu demonstrieren, bevor der interplanetare kalte Krieg zwischen der Vesta-Liga und den UN ein heißer wird?«
Gedankenverloren sann er über seine Antwort nach. »Kalter Krieg. Du beziehst dich auf irdische Konflikte, doch die Analogie ist ungenau. Wann war der … der Atomkrieg, zu dem es nie wirklich kam … vor zweihundert Jahren? Zunehmend habe ich den Eindruck, dass unsere gegenwärtigen Spannungen auf weit ältere Modelle der politischen Kontrolle zurückgehen, ältere Machtquellen.«
»Du sprichst von Wasser.«
»Natürlich. Du kennst das Argument. Wasser ist zum Erhalt des Lebens unabdingbar, und es wird für zahlreiche Industrien benötigt. Die Erde ist wasserreich. Im erdnahen Weltraum gibt … gab es allerdings wenig Wasser. Ein paar Kältefallen auf dem Mond und auf den erdnahen Asteroiden, die, wenn man alles zusammengekratzt hätte, die Industrie im Erdmaßstab bestenfalls ein paar Tage am Laufen gehalten hätten. Die Felsratten beuten auf der Jagd nach einem Handelsmonopol wasserreiche Asteroiden aus – insgesamt enthält der Asteroidengürtel etwa ein Fünftel der Wassermenge aller Erdmeere. Aber Abbau und Transport sind kostspielig – und auf die meisten wasserreichen Himmelskörper hat die Erde eine Umweltschutzverordnung geklatscht, mit dem Verweis auf mögliche Spuren von Leben. Da die Erde den Mars kontrolliert, konnten die Felsratten sich also nirgendwohin mehr ausbreiten. Oder zumindest nicht ins Systeminnere.«
»Und wenn man nicht sowieso weiter expandieren will, wie früher in der Trockenzeit, kolonisiert man gar nicht erst irgendwelche Asteroiden.«
»Genau. Sie mussten sich einfach weiter ausbreiten. Weil die Erde inzwischen ein Wasserimperium betrieb. Das meine ich mit politischen Organisationsformen. Das gegenwärtige Regime ähnelt manchen der frühen Reiche, die es auf der Erde in den Trockenzonen des Vorderen Orients oder Eurasiens gab. Wenn man das Wasser anderer Leute kontrolliert, das damals für den Ackerbau benötigt wurde, dann kontrolliert man ihr ganzes Dasein. Und genauso hat die Erde Kontrolle über die Wasserversorgung im Weltraum ausgeübt. Um zu expandieren, richteten die Felsratten den Blick also Richtung Jupiter, wo die großen galiläischen Monde mehr als genug Wasser zu bieten hatten …«
»… und dann ist die Erde mit den UN vorgeprescht und hat all das für sich beansprucht.«
»Genau. Eine Weltraumregion mit den nötigen Wasserressourcen, um Milliarden bequem zu versorgen. Laut mancher Schätzungen sogar Billionen. Und dann ist da noch der Jupiter selbst mit seiner gewaltigen Atmosphäre voller Rohstoffe. Jupiter ist die Zukunft dieses Sonnensystems …«
»Und das Wasserimperium hat ihn sich präventiv geschnappt. Aber sein Griff ist noch nicht gefestigt.«
Er grinste und nickte, wobei das harsche künstliche Licht seiner rasierten Schädelplatte einen Widerschein entlockte. »Die Felsratten haben sich in den Asteroiden festgesetzt, und sie kennen sich im Weltraum aus. Die nächsten ein oder zwei Jahrzehnte lang haben sie noch Gelegenheit, sich gegen die Ansprüche der Erde zur Wehr zu setzen. Bisher gibt es zumindest noch keine Kämpfe«, fügte er hinzu. »Dankenswerterweise.«
Denise trank einen Schluck Pfefferminztee. Er schmeckte gut, aber sie hätte trotzdem lieber etwas anderes gehabt. »Aber beide Seiten haben den Finger am Abzug. Genauso, wie die Russen und Amerikaner im Kalten Krieg.«
»Letztendlich haben sie von einem globalen Konflikt Abstand genommen. Wahrscheinlich, weil es genug kluge Köpfe auf beiden Seiten gab, die begriffen, welche Folgen das nach sich gezogen hätte. Heutzutage würde ein interplanetarer Krieg ebenfalls gewaltigen Schaden anrichten. Im Weltraum ist alles … fragil. Wenn man einen großen Felsbrocken auf ein Weltraumhabitat wirft, platzt es wie eine Seifenblase. Wenn man einen großen Felsbrocken auf die Erde wirft – und das könnten die Felsratten mit eben der Technologie bewerkstelligen, die wir entwickelt haben, um Felsbrocken von der Erde abzulenken –, dann …«
»Gäbe es ein Massensterben«, sagte sie.
»So ist es. Ich glaube, es handelt sich um einen Krieg, den die UN gewinnen müssen. Aber ohne einen Kampf.«
Obwohl sie diese Ansichten nicht zum ersten Mal hörte, wollte sie eine kleine Vorstellung für die Aufnahme liefern. »Das Wasserimperium sollte gewinnen? Sind das nicht die Bösen, die die heldenhaften kleinen Felsratten-Pioniere in den Staub treten?«
»Nein. Denn selbst, wenn wir uns bei alldem nicht selbst auslöschen, wissen wir, dass die unregulierte Expansion irgendwo ein Ende haben muss. Das exponentielle Wachstum geht einfach immer weiter, löscht alles aus, jeden verfügbaren Rohstoff. Die Planeten, die Monde, die Kometen – in nur ein paar Jahrtausenden könnten sie alle der Vergangenheit angehören. Und wo stehen wir dann?« Er schüttelte den Kopf. »Wir können nicht einfach immer weiterwachsen. Wir brauchen Regulierung, ob es uns nun passt oder nicht. Und das Wasserimperium der UN ist zur Regulierung in der Lage – zumindest derzeit.«
Sie betrachtete ihn. »Und das hier«, sie wedelte mit der Hand, »ist deine Antwort. Eine … kulturelle Antwort auf den neuen kalten Krieg?«
»Wenn man so will. Eine Zurschaustellung weitreichender Ziele. Wir zeigen damit, dass wir zu mehr in der Lage sind als bloß dazu, einander zu bekämpfen.«
»Aber warum bis nach Andromeda fliegen?«
Er spreizte die Finger auf der Tischplatte zwischen ihnen. Ihr fiel auf, dass selbst seine Handrücken in Vorbereitung auf den Kälteschlaf enthaart waren.
»Weil wir es gerade so weit schaffen«, sagte er. »Weil wir von Orten berichten werden, an denen nie zuvor ein Mensch gewesen ist. Weil wir, wenn auch nur auf dem denkbar längsten Zeitstrahl, mit wahrhaft aufsehenerregenden wissenschaftlichen Ergebnissen zurückkehren werden. Unsere eigene Galaxis, von außen betrachtet. Ein Blick auf Andromeda, aus der Nähe. Wusstest du, dass in etwa fünf Milliarden Jahren die Milchstraße und Andromeda aufeinanderprallen werden? Was für ein Spektakel – und jede denkbare Zukunft wird davon geprägt sein. Je früher wir uns eine Vorstellung von diesem Ereignis machen können, desto besser.«
Sie konnte sich ein Lächeln nicht verkneifen. »Du denkst in großen Maßstäben, was?«
»Tja, in den Sechzigerjahren des zwanzigsten Jahrhunderts hat Präsident Kennedy sein Land vor eine im damaligen Kontext nicht weniger schwere Aufgabe gestellt: Es sollte innerhalb eines Jahrzehnts den Mond erreichen. Und jetzt hat Generalsekretär Bandanik ein vergleichbares Ziel ausgegeben: Andromeda zu erreichen.«
Sie nickte. »Die Parallelen sind offensichtlich. Damals Projekt Apollo, heute Projekt Perseus … warum übrigens Perseus?«
»Tja, im Mythos war er der Sohn des Zeus, dem obersten der griechischen Götter. Ein echter Held, noch vor Herakles. Unter anderem hat er Andromeda vor dem Seeungeheuer Cetus gerettet. Danach, welche Bedeutung dieses Mythenfragment in unserem Zusammenhang hat, kannst du mich fragen, wenn wir zurückkommen.«
»In fünf Millionen Jahren …« Sie sah ihm in die Augen. »Wir waren einmal verheiratet. Ich kenne dich immer noch nicht. Mal ganz abgesehen von der fragwürdigen Logik dieser Mission, warum du? Warum musst du gehen? Du hast als Erster den Planeten Neptun betreten. Genügt dir das nicht?«
»Nachdem ich bis an den Rand des Sonnensystems vorgedrungen bin, reicht es mir eben nicht mehr, einen Frachter nach Callisto zu fliegen.«
»Wir wissen beide, dass mehr dahintersteckt.«
Er wandte den Blick ab, als suchte er nach den richtigen Worten. Oder als wollte er sie vermeiden. »Du fragst nach Sarah? Vor Publikum?«
»Ich muss es tun, John. Wenn du nämlich nicht jetzt darüber sprichst, wird niemand jemals dich verstehen – und warum du das tust.«
»Selbst, wenn es nichts mit meinem Entschluss zu tun hat, diese Mission durchzuziehen?«
»Selbst, wenn dem so wäre, was ohnehin kaum jemand glauben wird.«
Er senkte den Blick, sah auf seine um die Tasse geschlossenen Finger, auf die Tischplatte. »Du willst, dass ich das Geschehene zusammenfasse? Für deinen Beitrag. In meinen eigenen Worten?«
Das Geschehene. »Nein, John«, sagte sie sanft. »Sag mir einfach, was du empfindest.«
Sie wussten beide, was damit gemeint war, dessen war Denise sich sicher.
3
Sarah war ihre Nichte gewesen, die Tochter von Denise’ Schwester, ihrem einzigen Geschwisterkind.
John hatte keine Geschwister. Und er war steril aufgewachsen, dank einer Genwaffen-Attacke, die London getroffen hatte, als er noch ein Junge gewesen war. Deshalb war Sarah ihrer gesamten erweiterten Familie teuer gewesen – und das hatte anscheinend besonders für John gegolten, der sonst so introvertiert und emotional unterentwickelt war. Zumindest empfand seine Frau Denise ihn so.
Sarah war bei einem höchst unwahrscheinlichen Unfall ums Leben gekommen.
Sie hatten Urlaub in dem Nationalforst gemacht, der im zweiundzwanzigsten Jahrhundert einen Großteil Nordenglands bedeckte. Eines Abends, während sie ihr Nachtmahl zubereiteten, streifte die sechsjährige Sarah allein umher.
Und dann hatte der Boden unter ihr nachgegeben. Sie war tief gestürzt und hatte benommen in einer Pfütze Grundwasser gelegen, die tief genug gewesen war, um darin zu ertrinken, bevor sie erwachte.
Es war eine Doline, stellten die Geologen schließlich fest. Sie war entstanden, weil das Grundwasser langsam eine Gipsschicht im Grundgestein aufgelöst und dabei eine Höhle gebildet hatte – eine Höhle, deren Dach irgendwann nachgegeben hatte.
Das war vor zehn Jahren gewesen. Denise hatte den Eindruck, dass John den Verlust nie verwunden hatte. Und das sagte sie ihm jetzt.
Er zuckte mit den Achseln: »Die Vorstellung, dass ein Mensch so einfach verwindet, trifft nicht zu …«
»Du spricht in der dritten Person von dir, wenn von solchen Dingen die Rede ist. Nein, nicht mal das – du sprichst von Vorfällen und Gefühlen, als seien sie dir völlig äußerlich. Als würdest du ein fehlerhaftes Triebwerksteil beschreiben.«
Er wirkte überrascht. »Tja, tief in meinem Innern bin ich Ingenieur und Wissenschaftler. Ich … es war diese völlige Zufälligkeit.«
»Deshalb schmerzte es besonders?«
»Ich habe nachgelesen. Du weißt das … aber ich sage es für die Aufnahme. Die Doline. Wie sich herausstellte, war sie ein Phänomen, das in die Tiefen der Zeit zurückreicht. Diese Gipsschicht war die Hinterlassenschaft eines ausgetrockneten Meeres, das es dort gab, als das ganze Gebiet im Herzen eines Superkontinents namens Pangäa lag. Das war vor einer Viertelmilliarde Jahren, wenn nicht mehr. Die ganze Zeit über hätte diese Stelle nachgeben können, in jeder dieser Zehntausend Milliarden Sekunden – aber es musste genau in der einen Sekunde passieren, in der Sarah darüberging, über diese urzeitliche Höhle.« Er sprach die Worte ruhig und gelassen.
Sie streckte die Arme aus und nahm seine Hände, in denen er immer noch die Tasse hielt. »Darum also«, sagte sie. »Darum fliegst du in die ferne Zukunft davon. Weil Sarah von etwas getötet wurde, das in die Tiefen der Zeit zurückreicht. Bist du dir sicher, dass du dadurch wieder in Ordnung kommst?«
»In Ordnung?« Er sah sie an. »Hör mal, nenn es, wie du willst. Ich will mich einfach nur an sie erinnern. Ich will, dass sich irgendjemand an sie erinnert. So lange wie technisch machbar.«
Sie überlegte. »Die Leute sagen, dass diese Reise eine Art sublimierter Selbstmord ist …«
»Nein. Ich betrachte sie als eine Erweiterung des menschlichen Bewusstseins, des menschlichen Angedenkens, in die ferne Zukunft. Sogar des menschlichen Mitgefühls. Ein neuer Schritt in der Evolution, wenn man so will. Und was Sarah betrifft – solange ich lebe, werde ich sie nie vergessen.«
Sie nickte. »Wir werden sie nie vergessen. Und was kommt dann?«
»Man wird sich ihrer so lange erinnern, wie die Sonne scheint.«
»Und was dann?«
»So lange, wie die Sterne leuchten.«
»… und was dann?«
Er grinste nur.
»Und ich, John? Wirst du dich an mich erinnern?«
Er zog die Hände weg und nahm einen Schluck von seinem Getränk.
»Auf ewig«, sagte er. »Du bist meine Andromeda. Nun ja, jetzt sollte ich dir den Kontrollraum zeigen …«
4
Sie kehrte zur Erde zurück und sah John Hackett nie wieder.
Und dann, nach Jahren, in denen nur Routineberichte eintrafen, hörte sie genau eine wichtige Neuigkeit über ihn.
Es geschah etwa zehn Jahre und fünf Monate nach der Abreise der Perseus, als das Schiff zehn Lichtjahre von der Erde entfernt war –für Hackett waren nur achtzehn Monate vergangen, so massiv häufte sich die relativistische Zeitdilatation an. Natürlich hatte die Nachricht weitere zehn Jahre gebraucht, um im Schleichtempo die Erde zu erreichen. Es waren also über zwanzig Jahre seit seiner Abreise vergangen.
Man hatte Hackett für kurze Zeit wieder aufgeweckt, wie alle sechs Monate während der langen Reise seines Schiffs, um neben automatisierten Checks auch eine menschliche Überprüfung zu gewährleisten.
Er stellte fest, dass alle seine sechs Crewmitglieder tot waren.
Eine rasche Untersuchung verschaffte ihm die Gewissheit, dass die Ursache Sabotage war – wahrscheinlich, berichtete er, durch politische Gegner der Mission entweder außerhalb oder sogar innerhalb der UN.
Aber warum hatte man nicht alle sieben umgebracht? Es gab Spekulationen darüber, dass Hackett selbst, Opfer seiner eigenen komplexen Beweggründe, der Mörder sein könnte – oder vielleicht, dachte Denise finster, hatte er seinen suizidalen Impulsen schließlich doch nachgegeben.
Aber die Schiffsaufzeichnungen, die als Download zur Erde geschickt wurden, zeigten Spuren tief im Betriebssystem verankerter Malware, die offensichtlich schon lange vor dem Abflug des Schiffs installiert gewesen war, Malware, die sich nicht mit Hackett in Verbindung bringen ließ und die keinerlei Handlungen seinerseits während des Flugs erfordert hatte. Hackett wies jede Verantwortung von sich, und offenbar glaubten die meisten Menschen ihm. Denise glaubte ihm auch.
Hackett mutmaßte, dass man ihn am Leben gelassen hatte, damit er vom Tod der anderen berichtete – und in der Annahme, dass er die Mission im Alleingang nicht zu Ende bringen könne.
Aber dem war nicht so, verkündete er.
Als er sich von seiner Entdeckung erholt hatte, schickte er die Leichen seiner Crewmitglieder, konserviert in ihren Schlaftanks, mit entsprechenden Kennzeichnungen und Informationen über ihre Herkunft, in sechs verschiedene Richtungen los. Jeder von ihnen flog als Pionier in neue Raumgefilde. Auch darüber berichtete er.
Und dann schloss er seinen Bericht mit den Worten: »Also allein. Perseus Ende.«
Mela
Jahre 30 bis 22
5
Jahr 30
Am Abend vor der Bestattung ihrer Großtante Vaer und dreißig Jahre vor dem Ende der Welt nahm Mela ihre Zwillingsschwester Ish mit nach draußen, um die Erden zu zählen.
Gemeinsam folgten sie dem Weg von ihrem Haus am Stadtrand zu einem niedrigen Hügel in einem Park, wo die beiden schon seit Kleinkindertagen am liebsten zusammen spielten. Tja, überlegte Mela, während sie den grasbewachsenen Hang hochstiegen, zumindest spielten sie am liebsten hier, seit ihr großer Bruder Tabor festgestellt hatte, dass es ihm mehr Spaß machte, mit den Jungsbanden in der Stadt herumzuziehen, als seine kleinen Schwestern zu triezen, sobald ihre Eltern außer Sicht waren. Nun waren sie hier sicher.
Es war ein gleichmäßiger Anstieg, und der Weg war im diffusen Licht, das vom wolkenlosen Himmel schien, leicht zu finden. Ein rötliches Band von Sternen bildete den Hintergrund für die regelmäßig angeordneten tausend Erden: helle blaugrüne Edelsteine, als sei der Himmel eine Schmuckschatulle, dachte Mela manchmal, wie die große gemeinsame Dose ihrer Eltern, eine faszinierende Ansammlung von Ohrringen und Clips und Anstecknadeln und Broschen, an die Mela und Ish, die beide zwölf waren, noch nicht herandurften.
Unter jenem Himmel lernte Mela zu genießen, wie die Aussicht ringsum sich während ihres Aufstiegs langsam entfaltete. Sie sah die Dächer der Häuser und Gaststätten und Läden und die breite glitzernde Ader des Flusses, der sich durch Procyon schlängelte. Natürlich waren der Fluss, die Stadt, dieses Zuhause, von dem sie sich mit ihren Eltern noch nie weit entfernt hatte, nur ein Zwischenhalt, das wusste sie inzwischen. Nur einer der vielen Orte, an denen der Fluss auf seiner zwölfhundert Kilometer weiten Reise von den Bergen des Kernlands in der Mitte dieser Erde vorbeikam, bis zum Perimeter im Süden, wo, so hieß es, der Strom sich in der Flut verflüchtigte, ein Wasserfall, in dem das Licht am Ende der Welt funkelte.
Und als sie von der Stadt her stromabwärts blickte, sah sie, dass der Fluss heute Abend von einer Art Lichtband gespiegelt wurde, das etwa zwanzig Meter vom Wasser entfernt seine sanften Windungen nachvollzog. Sie wusste, dass es sich um eine Karawane handelte, Immigranten, Tausende aus einer Stadt weiter im Süden. Sie waren auf der Flucht vor der Tide, vor dem heranrückenden Perimeter, das sich stetig stromaufwärts verlagerte.
Die Immis hatten wohl ihr Nachtlager aufgeschlagen, dachte Mela, und was sie sah, war der Schein ihrer Lampen und Feuer. Morgen Abend sollten sie die Stadt bereits wieder hinter sich gelassen haben.
Morgen war der Tag von Tante Vaers Bestattung, weshalb Mela und Ish unten am Friedhof sein würden, nicht weit vom Fluss, wo die Immigranten vielleicht vorbeiziehen würden. Mutter – und in gewissem Maße auch Vater – hatten die Mädchen und wahrscheinlich auch Tabor bereits in strengem Ton ermahnt, einen sicheren Abstand zu den Immigranten zu wahren und die Stadtwache ihre Arbeit machen zu lassen, falls es Ärger gab.
Während sie die Aussicht in sich aufnahm, ließ Mela nie ganz Ish aus den Augen, die bei dem Aufstieg wie immer hinter ihr zurückblieb. Der Weg war steiler, als es den Anschein hatte. Sie beide atmeten schwer, als sie die Hügelkuppe erreichten.
Hier gab es ein paar Bänke und Spielgerüste, und andere Spaziergänger hatten Müll im Gras hinterlassen. Ish ließ sich am Fuß eines hölzernen Spielgerüsts zu Boden fallen und lehnte sich an einen Balken. Anstatt sich auf den kalten Boden zu setzen, wäre Mela lieber in das Gerüst geklettert. Sie hätte sich kopfüber hinhängen und so tun können, als würde sie ihre ganze Welt wie einen riesigen Teller über sich halten, während sie die elektrisierende Aussicht auf einen ewigen Sturz in das Meer der Sterne und Erden genoss. Aber Ish war nur selten für so etwas zu haben – und heute Abend ganz sicher nicht. Also setzte Mela sich im Schneidersitz neben sie auf einen Flecken nackter Erde, wo kein taufeuchtes Gras wuchs.
Ish zählte bereits die Erden. »Fünfzehn. Sechzehn.« Sie deutete auf jede einzelne, auf jede leuchtende Scheibe am Himmel.
Mela kniff die Augen zusammen. »Ich weiß nie, auf welche du gerade zeigst.«
Obwohl die hinter den Erden ausgestreuten roten Sterne erstere an Zahl bei Weitem übertrafen und die Erden in regelmäßigen Abständen vor der Sternenwolke am Himmel verteilt waren, wirkten sie in ihrer Masse überwältigend. Es sah aus, als hingen sie an unsichtbaren Fäden, jeder blaue Punkt umgeben von einem kaum greifbaren silbrigen Schimmer.
Die Lehrer in der Schule versuchten, ihnen den Himmel zu erklären. Bei den kleinen Schülern fingen sie mit Babykram an, und bei den größeren gingen sie mehr ins Detail – bis hin zu Diagrammen und Zahlen.
Mela wusste, dass man sich eine riesige Kugel vorstellen musste, an deren Innenseite all die Erden, einschließlich dieser, ihrer Heimatwelt, wie flache Scheiben befestigt waren. Sie wusste schon seit Langem, dass sie nie so gut in Geometrie sein würde wie in Dingen, die mit Büchern, Geografie und konkreten Dingen, die mit Menschen zu tun hatten, aber im Großen und Ganzen verstand sie den Gedanken.
Hier saß sie also, blickte zur Innenfläche dieser großen, eingebildeten Kugel empor, während sie selbst auf einer der Scheiben lag, und sah all die anderen Scheibenwelten, die ihre umgaben. Manche waren näher, andere – nahe dem Scheitelpunkt des Himmels – weiter weg, sodass sie kleiner erschienen.
In Wirklichkeit waren die Erden alle gleich groß – so groß wie ihre. Je näher sie ihnen waren, desto heller erschienen sie also. Aber selbst bei den nächsten ließen sich keine Einzelheiten ausmachen, wie man sie auf einer Karte hätte sehen können, nicht mit bloßem Auge, und sei es auch nur, weil diese Welten nahezu auf einer Ebene mit ihrer lagen und deshalb nur vom Rand zu sehen waren. In der Schule hatte Mela gelernt, dass sich auf den ferneren Welten mithilfe von Teleskopen ein paar Einzelheiten erkennen ließen.
Noch spektakulärer wurde der Anblick dadurch, dass einige der Welten dunkler waren und andere heller. Sie durchliefen ihre eigenen Tag-Nacht-Zyklen, während das Tageslicht über ihre Landmassen und Meere kroch und dann wieder von der Nacht fortgespült wurde – genau wie auf der Erde, ihrer Erde, der von Mela und Ish. Und wahrscheinlich war auch ihre Erde für einen Bewohner einer jener anderen Erden nur ein blauer Punkt, verloren zwischen den Wolken.
Trotzdem zählte Ish sie jedes Mal, wenn sie hierherkamen, um herauszufinden, wie viele der legendären Tausend sie ausmachen konnte.
Sie waren Zwillinge, aber nicht eineiig, und ihre Eltern hielten es anscheinend für wichtig, das den Leuten immer wieder zu erklären. Ish war seit jeher kleiner, ruhiger und schüchterner als ihre Schwester. So wie Mela auf den Hügel vorangegangen war, entschied Mela normalerweise auch, was sie spielen oder welches Buch sie lesen sollten. Mela las ihrer Schwester Bücher vor, wenn sie kränkelte, und nicht andersherum, und Mela war diejenige, die Ish vor Tabors gelegentlichen Gemeinheiten in Schutz nahm. Der Arzt sagte, dass Ish nichts fehlte. Vater sagte, dass Ish kostbar sei und Mela edel. Wenn Mutter gelegentlich von ihrer Arbeit aufblickte – ihr ständiges Kaufen und Verkaufen, Kaufen und Verkaufen –, bezeichnete sie Ish als Hosenschisserin.
Wie dem auch sei, erst jetzt, mit zwölf Jahren, wagte Ish sich anscheinend langsam aus der Deckung und fand ihre eigenen Interessen, ihren eigenen Weg. Zum Beispiel, indem sie Erden zählte.
»Zweiundfünfzig«, flüsterte sie jetzt, während sie unmerklich den Kopf hin und her bewegte. »Dreiundfünfzig. Vierundfünfzig.«
Mela nahm ihre Hand. »Ich kapiere nicht, wie du es so weit schaffst.«
Ish nickte. »Zum Anfangen suche ich mir immer eine, die ich mir gut merken kann. Zum Beispiel die große helle da. Siehst du?«
Mela sah sie; eine Erde, die hell genug war, um den Hausdächern unter ihnen einen Widerschein zu entlocken.
»Und dann arbeite ich mich von dort einfach auswärts vor. Wie ein … so ein Wirbelding. Du weißt schon.«
»Eine Spirale?«
»Jetzt habe ich wegen dir den Faden verloren. Egal, ich fange von vorne an. Einmal habe ich es bis hundertvierundzwanzig geschafft.« Sie lächelte.
Mela erwiderte ihr Lächeln. »Einschließlich unserer Erde. Der Erde.«
»Ich weiß. Die zähle ich mit. Dort oben gibt es neunhundertneunundneunzig – und hier unten eine! Eines Tages schaffe ich die Tausend, du wirst schon sehen.«
»Nein, schaffst du nicht, Blödkopf.«
Das war Tabors Stimme.
Mela blickte sich um und sah ihren Bruder den Hügel zu ihnen hochstapfen. Anscheinend zog er mit Absicht die Füße nach, um die Abdrücke zu verwischen, die die Mädchen im taufeuchten Gras hinterlassen hatten. Als wollte er ihre Spuren auslöschen. Er wirkte launisch und angespannt.
Offenbar suchte er nach einer Beschäftigung.
Mela wurde es ein wenig schwer ums Herz. Wachsam behielt sie ihn im Auge.
»Mutter sagt, dass ihr nach Hause kommen sollt, um eure Anzüge für die Beerdigung anzuprobieren.«
Mit seinen fünfzehn Jahren – drei Jahre älter als die Zwillinge – hatte er etwa die gleiche dunkle Hautfarbe wie die Mädchen, aber er war sehr viel größer, und seine Stimme war bereits tief wie die eines Mannes, fand Mela. Aber jetzt klang sie weinerlich. »Ach, so eine Hektik ist das.«
Mela schnaubte. »Wer soll das sein, Mutter oder Vater?«
Er verzog das Gesicht. »Wer soll das sein? Wer soll das sein? Du hältst dich wohl für oberschlau, was? Du bist genauso dumm wie sie.«
Ish runzelte die Stirn, und ihr Gesichtsausdruck war im verworrenen Erdenlicht unverkennbar. »Ich bin nicht dumm, du …«
»Ach, lass sie doch in Ruhe«, sagte Mela.
»Lass sie in Ruhe«, äffte Tabor sie nach. »In Ruhe was tun? Bis zehn zählen, vergessen, welche Zahl als Nächstes kommt, und von vorne anfangen?«
Ish sah ihn finster an und wandte sich ab.
Mela empfand einfach nur … Müdigkeit. So war Tabor immer, zumindest, wenn ihre Eltern nicht in der Nähe waren, und manchmal sogar dann – insbesondere, wenn es sich um Mutter handelte, die mit sehr viel geringerer Wahrscheinlichkeit etwas davon mitbekam oder eingriff. Normalerweise tat einem Tabor nichts. Er ließ nur einfach nicht locker. Es war jeden Tag das Gleiche.
»Es gefällt mir, ihr beim Zählen zuzuhören«, sagte sie. »Was interessiert es dich?«
Er grinste. »Mir gefällt es einfach, euch beiden beim Dummsein zuzuhören, weiter nichts. Die Erden zu zählen ist echt dumm.«
»Nein, ist es nicht …«, wandte Ish ein.
»Ist es. Weil die Erden nicht wichtig sind. Das sagt Mutter auch. Sie sagt, dass die Sterne viel wichtiger sind, dass sie einander Sachen zudenken, und wenn man ihre Gedanken sehen könnte, dann hätte man etwas, das sich zu zählen lohnt.«
Mela runzelte voller Unbehagen die Stirn.
Tabor versuchte mal wieder, eine alte Wunde aufzureißen, einen der vielen Makel ihrer Familie bloßzulegen. Und zwar aus reiner Grausamkeit.
Mutter und Vater hingen verschiedenen Glaubensbekenntnissen an, sie war Stellaristin, er Perseide. Manchmal arbeiteten die beiden großen Religionen zusammen, und manchmal bekämpften sie einander. »Sie ergänzen sich«, hatte ihr Vater gesagt, »sie sind komplementär«, und dann hatte er das Wort für sie buchstabiert. »In beiden geht es um dasselbe … Universum. Um dieselbe Menschheit, dasselbe Wir und unserem Platz im Universum. Dieselben Sterne, dieselben Erden, dieselbe Geschichte. Sie vertreten nur unterschiedliche Ansichten darüber, auf welche Teile dieses Ganzen es ankommt.«
Aber Mela hatte gelernt, dass die Unterschiede zwischen diesen Glaubensrichtungen zu früheren Zeiten schon Kriege ausgelöst hatten, und manchmal lösten sie auch bei ihnen zu Hause Kriege aus. Zum Beispiel, wenn es um die Bestattung von Tante Vaer ging, wie sie sie nannten – genau genommen war sie Mutters Tante. Was für eine Totenfeier sollte es sein – nüchtern-stellar oder menschelnd-perseidisch? Tabor war alt genug, um die kaum verhohlenen Differenzen zwischen ihren Eltern als Munition für Boshaftigkeiten zu verwenden, weil eben diese Differenzen seinen Schwestern Angst machten.
»Jedenfalls ist es dumm, Erden zu zählen«, sagte er.
Bislang wirkte Ish noch recht gelassen. »Nein, das ist es nicht. Man kann die Sterne nicht zählen, und viele Sterne kann man nicht einmal sehen, ob sie nun denken oder nicht. Sie sind nichts weiter als rote Punkte, und manche sind so weit weg, dass man sie ohne Teleskop nicht mal sehen kann. Aber die Erden kann man sehen. Alle, wenn man wartet, während es hell wird. Ich werde sie zählen, und wenn es Wochen dauert.«
Tabor stieß ein schnaubendes Lachen aus. »Nein, das wirst du nicht, du Baby.« Mit geschürzten Lippen stand er da, als überlegte er, wie er weitermachen sollte. »Selbst, wenn du es schaffen würdest, wäre es völlig sinnlos. Soll ich dir sagen, warum? Es ist etwas, was sie den Großen in der Schule erzählen, nicht solchen Kleinkindern wie euch …«
»Hör auf, Tabor«, sagte Mela hastig. »Bitte.« Dafür sind wir sicher noch nicht bereit. Was immer das ist, was er uns erzählen will. Wir sind zu klein. Es war wie vor ein paar Jahren, als er ihnen in allen Einzelheiten erläutert hatte, was Sex war. Aber er erzählt es uns sowieso. »Bitte …«
»Es ist sinnlos, Erden zu zählen, weil Erden sterben. Genau wie Menschen.«
Ish wirkte wie vor den Kopf gestoßen. »Wie Tante Vaer?«
»Wie Tante Vaer, diese elende Alte. Wie ihr auch eines Tages sterben werdet.«
Ish zuckte sichtlich zusammen.
»Erden sterben«, sagte Tabor mit ausdrucksloser Stimme. »Ganze Welten voller Menschen und Flüsse und Tiere und so weiter machen einfach puff!, und dann sind sie weg. Das wurde schon beobachtet. Seit eurer Geburt hat es aber noch keine sterbende Erde gegeben, die man mit bloßem Auge hätte sehen können. Die Astro…, Astro…, die Leute, die sich die Erden und Sterne ansehen …«
»Astronomen«, sagte Mela mit schwacher Stimme.
»Ja, die. Sie haben schon gesehen, wie Erden explodiert sind. Oder zusammengebrochen oder was auch immer. Zumindest früher. Vorher. Welten, die sich in Wolken von …« Offenbar versagte seine Fantasie. »Schrott. Müll. Der einfach im Raum rumfliegt, und auch Leute und Tiere. Besonders oft kommt das nicht vor. Seit wir auf der Welt sind, gab es das nicht. Und man kann auch nichts davon sehen, indem man einfach hinschaut, die sind zu weit weg. Aber es gab welche. Es gibt Aufzeichnungen darüber.«
Ish hatte entsetzt zugehört. Nun schien sie in sich zusammenzufallen. Sie legte sich neben dem Klettergerüst auf den Boden, zog die Beine an den Körper, steckte den Kopf zwischen die Knie, schlang die Arme um den Kopf und hielt sich Ohren und Augen zu. »Erden sterben? Wird unsere Erde sterben?«
Grinsend ging Tabor auf sie zu.
Entsetzt und selbst tief erschüttert trat Mela vor, um ihm den Weg zu versperren. Doch Tabor war bereit für den Todesstoß. Er stieß Mela beiseite und baute sich über Ish auf.
»Natürlich stirbt unsere Erde. Eben das ist die Tide. Sie frisst das Perimeter auf. Wir leben auf einer sterbenden Welt. Unsere Erde stirbt, Stück für Stück für …«
Ish blickte zu ihrer Schwester auf. »Ist das wahr, Mela? Erreicht die Tide irgendwann auch uns?«
»Nein«, sagte Mela, auf der verzweifelten Suche nach irgendetwas Tröstlichem – obwohl sie selbst keine Ahnung hatte, wie die Dinge sich in Wahrheit verhielten. Das Perimeter, das die heimatlos Gewordenen unerbittlich vor sich hertrieb, gab es jedenfalls wirklich, aber es war weit weg und lag für sie in einer fernen Zukunft. So war es immer gewesen. »Nein. Selbst wenn, dann können wir – weiterziehen. Nach Norden.«
»Sind wir dann so was wie Immigranten?«
»Ja. Nein. Nicht wie sie. Mutter und Vater sind wichtige Leute. Man wird uns aufnehmen, wir ziehen nach Sirius City, ins Kernland, wo wir sicher sind.«
Tabor beugte sich mit hämischer Miene vor. »Solche wie dich lassen sie da wohl kaum rein. Nicht nach Sirius, wo die Reichen leben. Wo die Kaiserin lebt. Ich gehe dort eines Tages hin, um in der Armee zu kämpfen. Aber so ein jämmerliches Ding wie dich werden sie nicht wollen …«
»Lass sie in Ruhe, Tabor.«
Ihre Reaktionen stachelten ihn anscheinend nur weiter an. Er begann zu singen: »Sie sterben, sie sterben, eine nach der andern, nur ein Knall am Himmel – sie sterben, sie sterben – nur ein Knall am Himmel …«
Es reicht. Mela ballte die Faust, streckte den Arm aus und wirbelte auf die Art herum, die ihr Vater ihr beim Diskuswerfen gezeigt hatte.
Ihre Faust und ihr Unterarm knallten ihrem Bruder genau an die Schläfe.
Tabor wankte verblüfft und fiel fast hin.
Mela taumelte rückwärts.
Tabor hob eine Hand an die Wange und sah Blut daran kleben. Er straffte sich und marschierte mit geballten Fäusten auf Mela zu, eine Hälfte seines Gesichts eine rote Maske. »Dafür sollte ich dich umbringen. Ich sollte euch beide umbringen. Das sage ich Mutter.«
Mela rannte zu Ish, die immer noch zusammengekauert war, und schlang die Arme um ihre Schwester, um sie mit ihrem Leib zu schützen. Sie wartete auf die Schläge. Fragte sich, ob er sie bei Mutter verpetzen würde, bevor oder nachdem er sie umgebracht hatte, und hatte dabei albernerweise den Drang zu lachen. Selbst wenn er uns umbringt, dachte sie hoffnungslos, wird Mutter sagen, dass wir selbst schuld waren, weil wir Feiglinge sind.
Ein Atemzug, zwei.
Aber es kam kein Schlag.
Ein Tropfen warmen Blutes fiel ihr ins Gesicht.
Vorsichtig hob sie den Kopf. Ish verharrte in ihrer zusammengerollten Haltung.
Tabot stand über ihnen, ein Schattenriss vor dem Licht der Tausend Erden, die Fäuste geballt. Seine Zähne grinsten weiß aus seiner Maske aus Blut hervor.
Als er sprach, war seine Stimme ruhig. »Ich sage euch, was sie uns noch erzählt haben. In der Schule.«
Erneut grub sich ein tiefer Schrecken in Melas Herz. »Nein, Tabor.«
»Etwas, das ihr eigentlich erst mit vierzehn erfahren sollt.«
»Nein, bitte …«
»Die Erden sterben. Erinnert ihr euch daran, dass ich euch das erzählt habe, ihr Dummis? Und unsere Erde ist nur eine von vielen Erden in der Wolke. Nicht wahr? Alle Erden in der Wolke werden eines Tages sterben. Und unsere auch.«
»Jeder muss mal sterben. Tantchen Vaer …«
»Tante Vaer war alt. Und diese Erde ist auch alt«, sagte Tabor verschlagen. »Und wisst ihr was? Die Lehrer haben gesagt, dass sie wissen, wie alt. Sie wissen, wann sie sterben wird. Wann sie euch unter euren blöden Füßen wegexplodieren wird.«
Mela spürte, wie Ish sich in ihren Armen anspannte, zu einer Kugel aus Angst und Schrecken wurde.
»Und wollt ihr wissen, wann sie sterben wird? Sie wissen es, die Ast… Astronomen. Die Lehrer wissen es. Ich wette, Mutter und Vater wissen es auch.«
»Tabor, bitte …«
»In dreißig Jahren. Ha! Mehr nicht. Nur noch dreißig Jahre, dann platzt die ganze Welt wie ein Spuckebläschen, und ihr treibt durch den Raum wie ein Fisch am Flussufer und schnappt nach Luft. Stellt euch das mal vor. Mal sehen, ob ihr mit diesem Wissen heute Abend einschlafen könnt! Es ist alles wahr, die Lehrer haben es uns erzählt. Ihr werdet schon sehen. Ihr werdet mit zweiundvierzig sterben. Alle beide. Stellt euch das vor.« Er wischte sich übers Gesicht und betrachtete seine blutige Hand. »Ich gehe jetzt nach Hause, so, wie ich aussehe, und sage Mutter, was ihr getan habt.«
»Du lügst«, sage Ish weinend.
Aber Mela wusste, dass er die Wahrheit sagte. Mit einem Mal begriff sie es. Natürlich ist es wahr. Warum sonst sollte man dieses Jahr das Jahr dreißig nennen, und das letzte das Jahr einunddreißig, und das davor … Warum habe ich mich nie zuvor gefragt, was diese Zahlen bedeuten? Natürlich sagt er die Wahrheit.
Ish befreite sich aus Melas Umarmung. Sie klang mit einem Mal sehr viel älter, als sie wütend zu Tabor emporstarrte. »Du machst uns Angst. Aber kapierst du nicht, du – du Dummkopf –, dass du auch stirbst, wenn wir sterben?«
Er grinste. »Ja. Aber ich bin älter als ihr. Ich kann noch mehr machen. Sex haben und so. Und ich werde länger gelebt haben, als ihr jemals gelebt habt, drei Jahre länger. Ha! Ihr habt verloren.« Und damit ging er.
Als er fort war, ruhten sie sich für eine Minute aus. Dann stand Mela auf und half Ish hoch. Mela sah, dass das Gesicht ihrer Schwester ebenso sehr mit Tränen verschmiert war wie das von Tabor mit Blut. Sie mussten sich alle waschen, bevor sie nach Hause gingen.
Die Mädchen stiegen den Hügel hinab.
Unterwegs störten sie einen Schwarm Vögel auf, kleine Geschöpfe, die mit ihrem graubraunen Gefieder schwer auszumachen waren. Die Vögel stoben vor ihnen auseinander, sausten dicht über dem Boden davon. Einer blieb mit einem gebrochenen Stummelflügel zurück.
6
Wieder zu Hause, erwartete Mela nicht der Sturm an Zurechtweisungen, den sie angesichts des Zustands, in dem sie sich allesamt befanden, erwartet hatte.
Mutter schnalzte missbilligend mit der Zunge und runzelte die Stirn, ignorierte sie ansonsten aber weitgehend und beugte sich wieder über ihren von Papieren übersäten Schreibtisch.
Vater kümmerte sich um sie und zeigte sich dabei für seine Verhältnisse harsch. Er zog sie alle ins Licht eines Klarholzfensters und besah sich die beeindruckende Schwellung über Tabors Wangenknochen. Mela stand daneben, erfüllt von einer köstlichen Mischung aus Scham und Erfolgsgefühl. Mela war schmutzig und blutverschmiert, aber unverletzt.
Tabor brummte irgendetwas davon, dass er in eine Prügelei mit Immigrantenjungs geraten wäre. Jeder auch nur halbwegs schlaue Erwachsene hätte die Lüge sofort durchschaut, das wusste Mela. Sie hatte schon vor langer Zeit gelernt, dass durchziehende Immigranten und ihre Kinder in Procyon immer die Sündenböcke waren, wenn etwas schiefging – und ihr kam der elende Gedanke, dass das wahrscheinlich in allen Städten entlang des Flusses so war, dass es immer die Immigranten auf ihrer Flucht flussaufwärts vor dem heranrückenden Perimeter traf, egal, woher sie kamen und wohin sie gingen.
Tja, Mela hielt den Mund und Tabor ebenfalls, und falls ihr Vater einen Verdacht hegte, ließ er es sich nicht anmerken.
Oder er und Mutter waren einfach zu beschäftigt – und zwar wegen der Immigranten, das wusste Mela. Ihrer beider Arbeit hatte nämlich mit dem nie versiegenden Strom von Menschen zu tun.
Mela sah, dass Mutter offenbar mit letzten Vorbereitungen für die morgige Bestattungsfeier beschäftigt war – obwohl sie immer wieder verstohlene Blicke auf einen Haufen anderer Arbeit auf ihrem Schreibtisch warf. Ordner mit Aufschriften wie Investment-Portfolio-Projekte: Jahr minus 25 bis minus 20. Dicke Bücher, die, wie Mela gelernt hatte, in enger Handschrift Einträge über Geldsummen enthielten, mit Plus- und Minuszeichen und Gewinnen und Verlusten hinter dem Komma.
Mela wusste, dass all das mit den Immigranten zu tun hatte, aber nicht wirklich, wie. Sie begriff nur, dass es eine Art Verbindung zwischen den gegenwärtigen und den zukünftigen Immigrantenströmen und dem Einkommen, dem Wohlstand ihrer Familie gab. Mela war sich ziemlich sicher, dass man von ihr erwartete, in die Fußstapfen ihrer Mutter zu treten und das Geschäft, mit dem ihre Familie ihr Geld verdiente, fortzusetzen – angesichts des Umstands, dass Tabor, der Älteste, kein besonders intellektueller Typ und offensichtlich ungeeignet für diese Aufgabe war, während Ish zwar auf ihre Art klug war, aber nicht über die nötige Konzentrationsfähigkeit und das Organisationstalent verfügte.
Nicht, dass der Gedanke Mela gefallen hätte, nicht, wenn diese Arbeit sie so übellaunig und unglücklich machen würde, wie das anscheinend bei ihrer Mutter der Fall war. Es reichte schon, wenn man sie kurz bei der Arbeit störte, damit ihr der Kragen platzte. »Zieh nicht so ein Gesicht«, knurrte Mutter dann immer. »Findest du das vielleicht langweilig? Damit verdiene ich das nötige Geld, um mir euch drei zu leisten. Und die Hälfte zahle ich an Steuern und Zöllen und humanitären Leistungen. Euch drei und euren Vater …«
Bei Vaters Arbeit ging es auch um die Immigrantenzüge. Er fuhrwerkte außer Haus mit anderen Ordnern herum, die Tabellen mit Überschriften wie Altersprofil, Prozentuales Geschlechterverhältnis, Qualifikationsübersicht, Verfügbare Mittel enthielten – Mela wusste, dass letzteres Geld bedeutete, Bargeld. Die Arbeit eines Magistrats bestand im Großen und Ganzen darin, dafür zu sorgen, dass die Stadt mit dem Immigrantenstrom zurechtkam. Dazu gehörte, Wachpatrouillen zu koordinieren, damit sie in der Stadt für Sicherheit sorgten, während die Immigranten durchzogen – und vielleicht auch, den Immigranten Unterstützung zukommen zu lassen, Nahrung oder Medizin. Vielleicht aber auch nicht. Wie Mela vor Kurzem erfahren hatte, musste Vater entscheiden oder zumindest bei der Entscheidung darüber mitwirken, welche Immigranten dauerhaft in Procyon bleiben durften, weil sie Geld hatten oder über nützliche Fähigkeiten verfügten, zum Beispiel Ärzte oder Lehrer – und welche schließlich stromaufwärts würden weiterziehen müssen. Weiter stromaufwärts, nach Norden ins Hinterland und damit tiefer ins Kerngebiet des Kaiserreiches, wo, wie ihr Vater düster feststellte, sie erst recht keine Zuflucht finden würden. Und zu Melas Verwirrung entschied er auch mit darüber, welche Immis zu einer dritten Klasse von Menschen gehörten und überhaupt nicht durch die Stadt ziehen durften. Was aus denen wurde, wollte Vater ihr nicht sagen.
All das wurde mithilfe der kostbaren Genehmigungsscheine reguliert, die er an die Umherziehenden, die hier strandeten, ausgeben konnte oder auch nicht. Genehmigungen entschieden über Leben und Tod, das hatte Mela mittlerweile begriffen.
Und langsam begriff sie auch, dass ihm jeder einzelne Fall, der auf seinem Schreibtisch landete, etwas bedeutete, ob er ihn nun passieren ließ oder abwies.
Deshalb waren ihre Eltern heute Abend ganz und gar mit ihrer Arbeit beschäftigt.
»Wir können von Glück sagen, dass sie gerade so viel zu tun haben«, sagte Mela im Bad zu Ish, während sie sich schrubbten. »Heute war ziemlich schlimm. Ich meine, es war Tabors Schuld, aber wenn wir uns streiten, bekommen wir alle was zu hören. An jedem anderen Tag hätten wir ohne Abendessen ins Bett gemusst, mindestens.«
»Wir haben vielleicht Glück.«
Ish sah sie wie aus weiter Ferne an – als zählte sie in Gedanken immer noch Erden, dachte Mela plötzlich.
»Aber Tantchen Vaer hatte nicht so viel Glück, stimmt’s? Oder diese armen Immigranten.«
Mela erschrak. Arme Immigranten. Das sagte sonst niemand. Immigranten waren einfach … Immigranten. Es war eher so, als seien sie gar keine Menschen. Eher eine Art Abwasser; ein Gezeitenstrom, der den Fluss hochkommt und mit dem man fertigwerden muss. Selbst diejenigen, die in der Stadt bleiben durften – selbst, wenn sie für Jahre blieben – selbst sie behandelte man nie wie normale Leute, wie Leute, die hierzur Welt gekommen waren.
Sie betrachtete ihre Schwester auf einmal mit anderen Augen. Vielleicht war Ish von ihnen beiden diejenige, die mehr ihrem Vater ähnelte, wenn sie so über die Immigranten dachte. Wenn sie sie bemitleidete, ihre Gefühle nachempfand. Während Mela selbst … wie war sie? Mehr wie ihre Mutter? Streng, unterkühlt, kurz angebunden, eine Person, für die Menschen Dinge waren, die gehandelt wurden, wie Schuhe oder Feuerholz – und die trotzdem, wie Mela wusste, für ihre Familie sorgte? Sie hoffte, dass es nicht so war. Vielleicht konnte sie ja auch nur die guten Eigenschaften ihrer Mutter haben, ohne die unglücklichen, herzlosen.
Und wenn dem so war, dachte sie, wenn Ish wie Vater war und Mela wie Mutter, was blieb dann noch für Tabor? Aus welchen Teilen ihrer Eltern bestand er? Sie lachte mit der Zahnbürste im Mund.
Ish bedachte sie mit einem seltsamen Blick. »Wir sollten ins Bett gehen.«
»Ja, Vater.«
7
In jener Nacht fand Mela schwer in den Schlaf. Vielleicht lag es an dem, was sie durchgemacht hatte. Oder daran, dass am nächsten Tag Vaers Bestattung sein würde, ein seltsamer Anlass. Oder an der Unruhe, die ihre schrecklich beschäftigten Eltern im ganzen Haus verströmten.
Oder, dachte sie verdrossen, vielleicht lag es daran, dass ihr grausamer Bruder ihr erzählt hatte, dass die Welt in dreißig Jahren untergehen würde. Aus reiner Boshaftigkeit.
Sie war zwölf Jahre alt. Sie konnte sich nicht vorstellen, jemals erwachsen zu sein, wie Vater und Mutter. Wenn sie es versuchte, sah sich selbst als eine Art lang gezogenes Kind, das Alte-Leute-Kleider trug und sich als Erwachsene ausgab. Mit irgendeinem ganz normalen, langweiligen Job? Mit Kindern? Tief in ihrem Innern fand sie, dass dreißig Jahre sich nicht von einer Ewigkeit unterschieden. Zumindest im Moment.
Und außerdem, wie ihr Vater oft sagte, wenn eine kleinere Katastrophe drohte: »Vielleicht ergibt sich ja noch eine Lösung.«
Aber was für eine?
Sie war alt genug, um zu begreifen, dass sie sich ein Erwachsenenleben noch nicht vorstellen konnte. Aber sie wusste sehr wohl, was Zukunftsangst war.
Am Tag der Bestattung erwachte sie vor dem Morgengrauen. Sie zog sich einen Mantel über und ging ans kleine Fenster ihres Zimmers. Wenn sie sich auf einen Stuhl stellte, hatte sie einen guten Blick auf den Himmel – auf die tausend Erden – und den Fluss. Sie sah zu, wie der Tag anbrach. Das samtene Nachtblau des Himmels, der im Osten hinter einem blassrosafarbenen Nebelschleier lag, geschmückt von den tausend Erden und den verstreuten roten Sternen, wich langsam einem noch tieferen Scharlachrot, das am Horizont emporstieg und dabei stetig heller wurde, um schließlich am Scheitelpunkt des Himmels zu einem blassen Blau zu werden – wenn die Wolken den Blick darauf freigaben, wie jetzt. Es gab keine herausgehobene Lichtquelle am Himmel, nur ein sanftes Aufhellen der Nacht zum Tage. Als wäre die ganze Welt ein Zimmer mit Wänden und einer Decke, die durchsichtig werden konnten, wie Smartholz.
Einmal hatte ihr Tabor noch etwas anderes über die Erde verraten, was jüngere Kinder nicht wissen sollten. Er hatte gesagt, dass laut Ansicht mancher Philosophen die Erde, diese Erde, ihre Erde, wie alle Erden, eine Maschine war. Es gab sie nicht von Natur aus. Sie waren hergestellt worden. Daran dachte Mela mit einem Mal, während sie den Sonnenaufgang betrachtete. Wahrscheinlich stimmte es. Und sie hatte keine Ahnung, was sie davon halten sollte. Nicht besonders viel, wenn diese Maschine in dreißig Jahren in die Brüche gehen würde.
Sie hörte Schritte, ein Gähnen und dann Mutters Stimme, die Tabor in harschem Ton weckte. Der Tag begann.
Anscheinend war es einer der letzten Wünsche von Großtante Vaer gewesen, in den frühen Morgenstunden bestattet zu werden.
»Das war ihre liebste Tageszeit«, hatte Mutter gesagt und klang dabei verärgert und ratlos. »Wenn die Welt noch frisch ist. Wer hätte das gedacht?«
Vater hatte die Brauen gehoben. »Du hättest es wissen können, wenn du gelegentlich zuhören würdest.«
Mutter zuckte mit den Schultern. »Jetzt macht es auch keinen Unterschied mehr für sie.«
Also frühstückte die Familie rasch – Smartkulturen, die sie im Garten gesammelt und auf einer Herdplatte erhitzt hatten, und dazu für jeden einen Becher Tee. Es war eine schweigsame Angelegenheit, die Erwachsenen waren mit ihren eigenen Gedanken beschäftigt, und die Stimmung der Kinder war gedrückt.
Mela erwischte sich dabei, wie sie auf den Heizstab des Kochers starrte, eine Metallstange von der Dicke eines Handgelenks. Sie wurde im Boden versenkt, um die Hitze aus dem Tiefenschacht der Stadt anzuzapfen. Angeblich reichte er bis hinab ins Substrat.
Es war der Tiefenschacht, in den man Tante Vaer in ein paar Stunden hinablassen würde.
Sie brachten die Mahlzeit rasch hinter sich und zogen sich für die Bestattungsfeier um. Tabor stolzierte in seiner Wachkadetten-Uniform vor dem Spiegel herum.
Die Mädchen trugen förmliche Kostüme aus lilafarbenem Stoff mit sternförmiger Spitze. Mela wusste, dass die Muster den Glauben ihrer Mutter an die lebenden Sterne repräsentierten und nicht die perseidische Erziehung ihres Vaters. Obwohl Tante Vaer auch Perseidin gewesen war – in der Familie ihrer Mutter gab es unterschiedliche Glaubensbekenntnisse –, weshalb Perseidengrün vielleicht passender gewesen wäre. Mela war immer davon ausgegangen, dass sie eher zur menschlichen Wärme der Perseidenlehre neigte als zur kosmischen Nüchternheit der Stellaristen – ohnehin hatte man ihnen in der Schule nur wenig über die beiden Glaubensrichtungen beigebracht –, aber sie musste zugeben, dass ihr die Muster und Farben der Stellaristen verglichen mit dem langweiligen Grün der Perseiden seit jeher besser gefielen, und ehrlich gesagt war sie ganz hingerissen von dem wogenden Sternenkleid, das ihre Mutter heute trug.