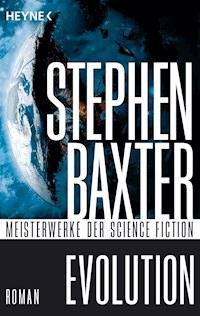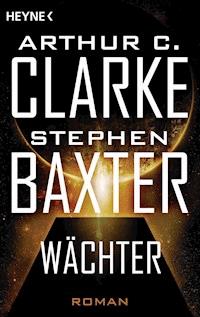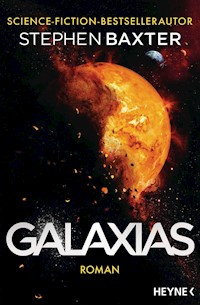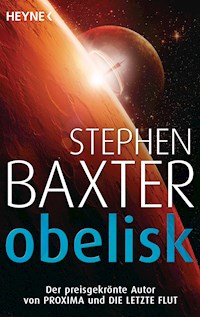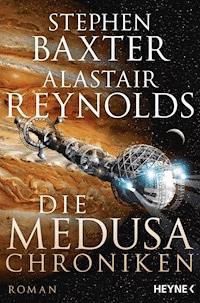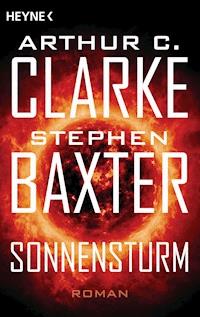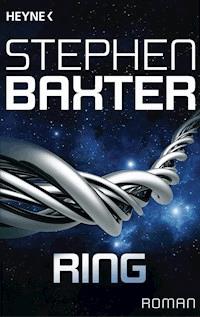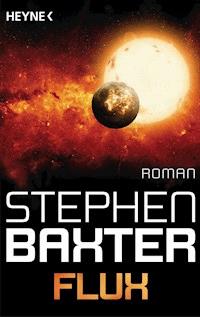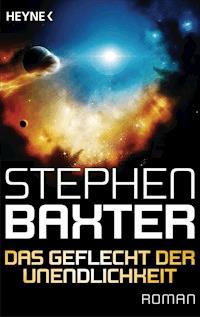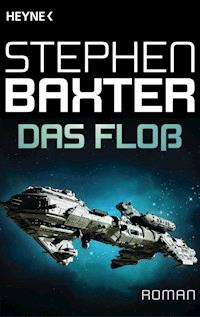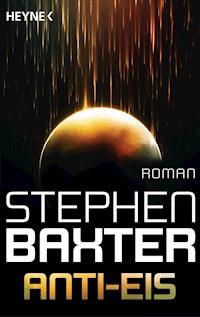7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Wer die Zukunft verändern will, muss die Vergangenheit beherrschen
Britannien, 607 n. Chr.: Ein Komet zieht über den Himmel und versetzt die Sachsen in große Angst. Der Krieg gegen die Angeln fordert ebenfalls seinen Tribut. Da erfährt ein junger Krieger von einer Prophezeiung und reist zum Hadrianswall, dem Ursprung der Verse. Teile der Prophezeiung scheinen sich zu erfüllen, als wilde Horden aus dem Osten in das Land einfallen, und so geraten immer mehr weise Männer in den Bann der Vorhersage. Alles deutet darauf hin, dass sich in der Zukunft auch die letzten Verse erfüllen sollen: Ein zehntausendjähriges Arierreich wird kommen …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 566
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
DAS BUCH
Britannien, im Jahre 607 n. Chr.: Ein Komet zieht über den blassen Himmel. Voller Aberglauben halten sich die Sachsen fern von den alten Städten der Römer. Doch es herrscht nicht allein die Angst vor den Geistern der Vergangenheit – Germanen und Angeln sind in heftige kriegerische Auseinandersetzungen verstrickt. Da erfährt der junge Wuffa, ein sächsischer Krieger, von einer alten Prophezeiung, erbracht von der seligen Isolde. Er reist in den Norden zum Hadrianswall, dem Ursprung der rätselhaften Verse, die von Isoldes Nachfahren Ambrosias gehütet werden, dem »letzten Römer«. Voller Zweifel hört er die Worte, die Britannien vor dem Wolf des Nordens – den Germanen – und Drachenklauen aus dem Osten warnen. Und tatsächlich: Als der Komet aufs Neue erscheint, fallen Wikinger aus dem Osten mit ihren Drachenbooten auf der Klosterinsel Lindisfarena ein und besetzen das Land. Mehr und mehr geraten die Weisen und Mächtigen in den Bann der Prophezeiung. Feuerfluten und neues Land, Bruderkriege und Kreuzzüge – vorausgesagt von einem schwangeren Mädchen in einem einsamen Kastell … Doch was ist die Prophezeiung in Wirklichkeit? Ein Blick in die Zukunft, auf die Fäden des Webers der Zeit? Oder eine gigantische Beeinflussung der Geschichte, um auch den letzten Vers zu erfüllen: ein Arierreich für zehntausend Jahre?
DER AUTOR
Der Engländer Stephen Baxter, geboren 1957, zählt zu den weltweit bedeutendsten Science-Fiction-Autoren. Aufgewachsen in Liverpool, studierte er Mathematik und Astronomie und widmete sich dann ganz dem Schreiben. Baxter lebt und arbeitet in Buckinghamshire. Zuletzt sind im Wilhelm Heyne Verlag erschienen: Evolution, Der Orden, Sternenkinder und Transzendenz.
Inhaltsverzeichnis
ORTSNAMEN:
Ad-Gefrin, Yeavering
Aescesdun, Ashdown
Aethelingaig, Athelney
Armorica, Bretagne
Banna, Birdoswald
Bebbanburh, Bamburgh
Brycgstow, Bristol
Caldbec Hill, Hastings
Cippanhamm, Chippenham
Eoforwic, Eburacum, Jorvik, York
Escanceaster, Exeter
Ethandune, Edington
Foul Ford, Fulford
Haestingaceaster, Hastings
Hagustaldasea, Hexham
Hamptonscir, Hampshire
Lindisfarena, Lindisfarne
Lunden, Lundenwic, Lundenburh, Londinium, London
Maeldubesburg, Mamesbury
Pefensae, Anderida, Pevensey
Reptacaestir, Rutupiae, Richborough
Sandlacu, Senlac Ridge
Snotingaham, Nottingham
Stamfordbrycg, Stamford Bridge
Sumorsaete, Somerset
Wealingaford, Wallingford
Westmynster, Westminster
Wiltunscir, Wiltshire
FLÜSSE:
Sabrina, Severn
Tamesis, Themse
ZEITTAFEL
MENOLOGIUM ISOLDEI BEATI
DAS MENOLOGIUM DER SELIGEN ISOLDE
(FREIE ÜBERSETZUNG AUS DEM ALTENGLISCHEN UNTER BEIBEHALTUNG DES AKROSTICHONS)
PROLOG
1066 N. CHR.
Nach einem Jahr unablässiger Kriege war Lunden eine zornige Stadt. Unter einem eisengrauen Dezemberhimmel wagte sich niemand allein in die engen Gassen. Der König hatte sogar einen Ring aus Soldaten um Westmynster legen müssen.
Die Stimmung in der kalten, höhlenartigen Abteikirche war ebenso fiebrig. Männer bewegten sich mit ihrem Gefolge in dichten Pulks; ihre Waffen waren sichtbar, die Blicke verstohlen und misstrauisch.
Es war der erste Weihnachtstag des Jahres 1066. Der Tag, an dem der König von England denen, die für ihn gekämpft hatten, und denen, die ihn immer noch als blutbesudelten Usurpator betrachteten, seine Krone zeigen würde.
In dieser Atmosphäre traf Orm auf Sihtric.
Der listige kleine Priester schaute Orm ins Gesicht. »Orm, der Wikinger.«
Sihtrics ausdruckslose blaue Augen hatten genug Ähnlichkeit mit denen seiner Schwester, dass Orm an Godgifu denken musste – und daran, wie er sie auf Sandlacu Ridge niedergestreckt hatte, auf dem Höhepunkt der »Schlacht von Haestingaceaster«, wie die Leute sie nannten. Es schnürte ihm das Herz zusammen. »Ich hatte nicht erwartet, dich hier zu sehen«, sagte er ausweichend.
»Aber ich dachte mir, dass ich dich treffen würde«, erwiderte Sihtric. »Du hast dich gut geschlagen in der Schlacht, Orm, und auch im seitherigen Rachefeldzug. Deine Zahlmeister sind gewiss sehr zufrieden mit dir.«
Orm richtete sich kerzengerade auf. »Ich werde mich nicht vor dir rechtfertigen, Priester. In einem Jahr wie diesem muss man versuchen, am Leben zu bleiben, so gut man kann.«
»Oh, ich verurteile dich nicht«, sagte Sihtric leise. »Ich schließe auch meine Kompromisse mit den Siegern. Wenn ich mit den Bischöfen zusammenarbeite, kann ich vielleicht das Leid lindern, das den Menschen zugefügt wird, die immerhin meine Schäfchen sind. Aber ich bin nicht stolz darauf«, sagte er. »Wir begegnen uns in Schande, du und ich.«
Orm lächelte dünn. »Obwohl du einem ständig mit deiner Prophezeiung in den Ohren lagst.«
»Das Menologium der Isolde. Ein Vierhundertjahresprogramm zur Beeinflussung der Geschichte, das auf Sandlacu Ridge seinen Höhepunkt fand – alles zum Zwecke der Geburt eines arischen Reiches.«
»Ich habe nie verstanden, wer deine ›Arier‹ waren.«
»Nun, du warst schon immer ein Dummkopf. Wir, Orm! Engländer und Nordmänner zusammen. Ein zehntausendjähriges Reich – so hat es der Weber des Zeitteppichs jedenfalls gewollt …«
Es gab ein Durcheinander, ein erwartungsvolles Raunen. Die Menge teilte sich und machte Platz.
Der König schritt den Mittelgang der Abteikirche entlang. Erzbischof Ealdred ging vor ihm her, prachtvoll anzusehen in seinen reich verzierten Seidengewändern und dem Purpurmantel; er trug die neue Krone Englands, einen goldenen, juwelenbesetzten Reif. Orm schloss aus dem schweren Gang des Königs, dass er unter seinem goldenen Umhang ein Kettenhemd trug. Selbst hier fürchtete er sich vor Attentätern.
Mit seinen schleppenden Schritten und der steifen Haltung wirkte der König nach seinem Kriegsjahr erschöpft. Aber auf dem Weg zum Altar schaute er mit funkelndem Blick nach links und rechts. Keiner der Adligen wagte es, ihm in die Augen zu sehen.
»Ich wünschte, deine Zukunft wäre wahr geworden, glaube ich«, sagte Orm aus einem Impuls heraus. »Ich wünschte, ich würde ein Langschiff bereit machen, um im Frühjahr nach Vinland zu fahren, mit Godgifu an meiner Seite und meinem Kind in ihrem Bauch.«
»Ja«, murmelte Sihtric. »Das wäre mir auch lieber. Das hier ist falsch. Wir sind in der falschen Zukunft, mein Freund. Und nun werden wir sie nicht mehr los.«
»Hätte es denn anders kommen können?«
Sihtric schnaubte. »Du warst doch dabei, Wikinger. Du weißt, wie wenig gefehlt hat …«
ERSTER TEIL
SÖLDNER 607 N. CHR.
I
Es bereitete Wuffa großes Vergnügen, in der toten Stadt Fenster einzuwerfen.
Er ging durch die leeren Straßen nach Norden, die Steinschleuder in der Hand, mehrere Messer im Gürtel, und pfiff ein trauriges Lagerfeuerlied über die Kürze des Lebens vor sich hin. Es war später Nachmittag, und in der tief stehenden Sonne im Süden warfen die Trümmerhaufen lange Schatten. Es würde noch eine ganze Weile dauern, bis die Dunkelheit hereinbrach, aber der haarige Stern war schon jetzt zu sehen; sein langer Schweif zog sich wie ein Banner über den blassen Frühlingshimmel. Er erschreckte Kaninchen, Ratten, Mäuse und ein paar Vögel, die in kahlen Ruinen nach Futter pickten. Die Stadt war so alt, dass sie nicht einmal mehr einen Geruch besaß, abgesehen von dem Grünzeug, dem Unkraut und Gras, das sich seinen Weg zwischen den Pflastersteinen hindurchbahnte.
Der Komet – der haarige Stern – beunruhigte viele Menschen. Die Sachsen hatten sich stets von den alten Steinstädten fern gehalten. Hier hatten sie am Ufer des Flusses westlich der Stadtmauern eine neue Handelssiedlung errichtet. Wuffas Brüder würden es gewiss nicht riskieren, zu einer solchen Zeit Wodens Auge auf sich zu lenken, indem sie allein in den von Geistern heimgesuchten Ruinen einer uralten Stadt herumliefen. Aber Wuffa dachte pragmatisch. Die Welt war groß, und Woden würde Wichtigeres zu tun haben, als sich um einen einsamen Jungen zu kümmern, der ein bisschen Spaß haben wollte.
Wie sich herausstellte, war das ein Irrtum. Wuffas Leben sollte sich an diesem Tag von Grund auf verändern. Später fragte er sich immer wieder, ob er die Götter der Stadt oder des Himmels nicht doch verärgert hatte; vielleicht war aber auch der kalte Blick des Webers auf ihn gefallen, der Menschenleben wie Fäden auf seinem eisernen Webstuhl verwob.
Dort. Eine hohe Mauer, die nach Süden zum Fluss zeigte – der einzige Überrest eines eingestürzten Gebäudes, ein merkwürdiges Relikt, das irgendwie dem Wetter trotzte. Und im Licht der tief stehenden Sonne zeichnete sich ein goldenes Quadrat ab, ein Fenster mit einer noch unversehrten Glasscheibe, hoch oben, aber nicht außerhalb seiner Reichweite. Genau das Richtige.
Er wählte einen losen Pflasterstein und nahm seine Lederschlinge. Dann trat er vor die gezackte Mauer, schaute mit zusammengekniffenen Augen nach oben und schleuderte den Stein. Der schlug vielleicht eine halbe Armeslänge unter dem Fenster gegen die Mauer. Vögel flatterten von freiliegendem Gebälk auf. Wuffa hob einen weiteren Stein auf und versuchte es erneut. Diesmal zersplitterte das Glas mit einem leisen Klirren, das von den Mauerresten widerhallte.
Zufrieden hielt er Ausschau nach einem neuen Ziel.
Natürlich hätte er bei der Arbeit sein sollen. An diesem Tag war viel zu tun gewesen, denn eine ganze Flotte von Nordmännerschiffen war den großen Fluss heraufgefahren gekommen und hatte angelegt, um entladen zu werden. Wuffas Vater Coenred arbeitete für Aethelberht, den Oberkönig von Kent, dem die Stadt gehörte; er überwachte den spärlichen Handelsverkehr, der über die riesigen alten Gussgesteinkais am Fluss abgewickelt wurde. Von dem zwanzigjährigen Wuffa, dem zweiten Sohn von Coenreds dritter Frau, wurde erwartet, dass er das Seine dazu beitrug. Aber das Handelsgewerbe langweilte ihn. Am meisten verabscheute er den trostlosen Gestank der Sklavenpferche. Kürzlich hatten Hunderte von Sklaven verschifft werden müssen, römische Briten, die den germanischen Königen bei ihren Feldzügen im Westen und Norden in die Hände gefallen waren.
Und er brannte darauf, sich in den Kampf zu stürzen. Die Ringkämpfe mit seinen Brüdern genügten ihm nicht mehr. Es gab keinen Frieden in Britannien; da würde es nicht schwer sein, ein geeignetes Heer und einen aussichtsreichen Krieg zu finden und ein Vermögen zu machen, obwohl er dafür von zu Hause weggehen musste.
Einstweilen wollte er jedoch nur ein weiteres Fenster zerschlagen. Er bückte sich, um einen neuen Stein aufzuheben.
Dabei sah er eine Bewegung. Auf der anderen Straßenseite, hinter einer niedrigen Mauer: groß, schwer, ein Aufblitzen goldener Haare. Ohne nachzudenken, wirbelte Wuffa herum, schleuderte den Stein und hörte, wie er mit einem befriedigenden dumpfen Laut auf Fleisch klatschte.
»Au!« Der Getroffene richtete sich auf. Er trug einen Lederkittel und eine Hose und hatte einen zottigen Schopf blonder Haare. In der einen Hand hielt er einen Spaten, mit der anderen umklammerte er seine Hoden. Er sah Wuffa wütend an und kam mit großen Schritten zu ihm herüber, ein Riese mit Muskeln, die seine Ärmel spannten. Er spie Beschimpfungen in einer nordischen Sprache aus, von denen Wuffa nur zwei Worte verstand: »Blödes Arschloch!«
Wuffa war ein sächsischer Krieger, der Sohn von Coenred, und er wich keinen Fußbreit zurück. Seine Hand schwebte über dem Heft seines Sax, seines Messers mit dem Knochengriff.
Der große Nordmann blieb keine Armeslänge von Wuffa entfernt stehen. Er war ungefähr in Wuffas Alter, um die Zwanzig, und sie waren beide blond und hellhäutig und trugen ähnliche Kleidung, Lederkittel und Hose. Aber Wuffa trug sein Haar auf sächsische Art, an der Stirn kurz geschoren und lang im Nacken, während die gelbe Mähne des Nordmanns lose und zottig herabhing.
Wuffa erkannte den Mann. »Ich kenne dich«, sagte er in seiner eigenen Sprache. »Du bist von der Flotte am Kai.«
Der Nordmann spie ihm weitere Beleidigungen entgegen.
Wuffa versuchte es erneut, auf Lateinisch. »Ich kenne dich.«
Zumindest unterbrach er damit den Strom der Schimpfwörter. »Na und, Arschloch?«
Britannien war eine Insel, die von römischen Briten, Germanen und Iren bevölkert war, und vom Kontinent kamen ständig Händler herüber. Die meisten Erwachsenen konnten ein wenig Lateinisch, ein Relikt des Imperiums, die einzige gemeinsame Sprache. Dieser junge Nordmann war keine Ausnahme. Obwohl er offensichtlich das lateinische Wort für »Arschloch« nicht kannte.
»Ich bin Coenreds Sohn. Wir entladen eure Boote …«
Der Nordmann kickte einen losen Stein weg. »Und so begrüßt ihr eure Handelspartner, mit einem Steinwurf in die Eier?«
Wuffa hielt seinem Blick stand. Sie wussten beide, dass sie die Wahl hatten; sie konnten die Sache entweder im Kampf austragen oder ihre Differenzen beilegen. »Ich müsste eigentlich bei der Arbeit sein«, sagte Wuffa. »Selbst wenn du mich nicht umbringst, wird es mein Vater für dich erledigen.«
Der Nordmann lachte. Aber er warnte: »Du musst es aussprechen.«
»Na schön. Ich entschuldige mich.«
Der Nordmann grunzte. »In Ordnung. Dein mädchenhafter Wurf hat mir sowieso nicht wehgetan.«
Damit war die Sache erledigt.
»Ich bin Wuffa, Sohn von Coenred.«
Der Nordmann nickte. »Ulf, Sohn von Ulf.« Er spähte mit zusammengekniffenen Augen zu der Mauer hinauf. »Was machst du, wenn du nicht gerade auf der Jagd nach den Eiern von Nordmännern bist?«
»Fenster einwerfen«, sagte Wuffa ein wenig beschämt. Er hob seine Schleuder. »Um meine Zielgenauigkeit zu verbessern.«
»Natürlich.«
»Und du?«
Ulf zeigte ihm seinen Spaten. »Nach Münzen suchen. Manchmal vergraben die Briten ihre Schätze, weil sie hoffen, dass sie eines Tages zurückkehren werden.«
»Das tun sie aber nie.«
»Und wenn, wären sie enttäuscht, denn Ulf der Schatzsucher war schon vor ihnen da. Also, Arschloch. Willst du weiter Steine werfen wie ein Kleinkind, oder wirst du mir beim Graben helfen?«
Er hatte es mit einem Geistesverwandten zu tun, dachte Wuffa und steckte seine Schleuder ein. »Graben wir. Aber hör auf, mich ›Arschloch‹ zu nennen. Woher weißt du, wo du suchen musst? …«
Ulf hob die Hand. »Pst. Hörst du das?«
Es war Gesang, Stimmen, die sich zu einer Melodie vereinigten; hoch und klar wie der Himmel, wehte sie auf der Nachmittagsbrise herbei.
Die jungen Männer wechselten einen Blick. Sie verschoben die Schatzsuche auf später und machten sich auf den Weg durch die zerstörte Stadt, neugierig, ehrgeizig, unbeeindruckt von den monumentalen Ruinen um sie herum, in ihrer eigenen Gegenwart lebend.
II
Sie gingen durch die Stadt zu den Ruinen der Festung in der südöstlichen Ecke der umlaufenden Stadtmauer. Der Gesang drang aus einem massiven Steinbau mit rotem Schindeldach unweit der Mauer. Seine riesigen Holztüren standen weit offen, und das Licht der untergehenden Sonne fiel tief in die langen Gänge.
Vor den offenen Türen hatte sich eine Gruppe von Menschen versammelt, Männer, Frauen und Kinder; es mussten vier-, fünfhundert Leute sein, dachte Wuffa. Sie hatten sich zu einer lockeren Kolonne aufgereiht und gingen langsam die Straße zum Hafen hinunter. Ein Mann in farbenprächtigen Gewändern führte sie an; er trug einen spitzen Hut und hielt eine Art Hirtenstab in der Hand. Die Kolonne wurde von Gruppen von Sachsen flankiert – Krieger, offenbar zum Schutz der Pilger angeheuert. Die Sachsen unterhielten sich miteinander, kauten auf Wurzelstücken herum und musterten die hübscheren Frauen.
Die Pilger waren Briten; Wuffa erkannte es an ihrer Kleidung und ihrer Haartracht. Die Männer trugen das Haar alle kurz und waren sauber rasiert. Die Frauen hatten ihr Haar zu ordentlichen Zöpfen und Knoten geflochten. Sowohl die Männer als auch die Frauen trugen Umhänge mit ärmellosen Kitteln darunter und waren mit Armbändern, Armreifen und Halsketten geschmückt. Ein oder zwei Männer hatten sogar eine Toga angelegt, lange Stoffbahnen, die über den staubigen Boden schleiften. Aber die meisten waren reisefertig gekleidet und mit Gepäck beladen. Selbst kleine Kinder, die schon laufen konnten, trugen Bündel auf Rücken und Kopf. Sie sahen abgespannt, unglücklich, furchtsam und unsicher aus.
Höchstwahrscheinlich waren sie alle Christen. Unter ihnen befanden sich Geistliche mit Tonsuren im britischen Stil, wobei die vordere Hälfte des Kopfes von einem Ohr zum anderen kahl geschoren war, während das Haar hinten lang herabhing. Der Mann, der sie anführte, trug jedoch eine römische Tonsur mit kreisrund geschorenem Scheitel. Und auf ihrem Weg sangen die Pilger und erzeugten eine durchdringende, unirdische Musik, die zum Himmel emporstieg, wo der haarige Stern noch heller leuchtete.
Ulf beäugte das alles mit offenem Mund. »Was ist dieses große Gebäude? Ein Lagerhaus?«
»Nein, eine Kirche. Eine Kathedrale, wie sie es nennen.« Die Kathedrale war jünger als die Stadt. Man hatte sie aus wiederverwendeten Steinen erbaut; wo der Blendstein fehlte, sah man Stücke von Säulen und Statuen, die zerbrochen und als Füllung benutzt worden waren. Aber die wiederverwendeten Dachziegel waren geborsten, das Glas in den Fenstern war zerschlagen. Nichts hier war neu, dachte Wuffa; es gab nur verschiedene Altersstufen.
»Hat euer Großkönig diese Kirche erbaut?«, fragte Ulf.
»Nein, Aethelberhts Kirche ist dort.« Wuffa zeigte nach Norden.
»Wozu braucht ihr zwei Kirchen?«
»Der König ist ein Anhänger des römischen Christentums. Augustins Bischöfe haben ihn bekehrt. Diese Kirche ist von britischen Christen errichtet worden.«
Ulf dachte darüber nach. »Das verwirrt mich noch mehr.«
»Die Fußgänger sind alle britische Christen. Glaube ich. Ihr Anführer ist ein Römer, ein Bischof.«
»Und warum folgen sie ihm, wenn er keiner der Ihren ist?«
»Ich …« Wuffa breitete die Hände aus. Er wusste so gut wie nichts über die Christen. Er beobachtete ihr Verhalten nur von außen, als wären sie exotische Vögel. »Sie gehen endgültig weg. So was passiert ständig. Schau.« Wuffa zeigte hin. »Siehst du den Schmuck? Sie tragen ihre Reichtümer am Körper. Das sind die Leute, die deine Münzschätze vergraben. Ihre Kirche organisiert die Flucht.«
»Wohin wollen sie?«
»Vielleicht nach Westen, oder übers Meer nach Gallien.«
»Weg von euch Sachsen.«
Wuffa grinste. »Weg von uns, ja.«
»Wenn sie all diese Reichtümer so offen zur Schau tragen, sind sie leichte Beute.«
Sie wechselten einen weiteren Blick. Aber dann wandten sie sich ab, ohne den Gedanken zu Ende zu führen. Offenbar war keiner von ihnen ein geborener Dieb, dachte Wuffa.
Mitten auf der Straße brannte ein Feuer, und die Hymnensänger mussten ausweichen, um daran vorbeizukommen. Zwei Sachsen plünderten gerade ein verlassenes Haus; sie waren von gröberem Schlag als die angeheuerten Krieger, welche die Flüchtlinge begleiteten. Die Plünderer hatten offenkundig nicht viel Glück. Sie warfen alte Kleider und zerbrochene Möbelstücke aus dem Haus und ins Feuer – und Bücher, aufgerollte Pergamentrollen, abgeschabtes Leder und Haufen hölzerner Täfelchen, die sich kräuselten und knackten, während sie schwarz wurden. Die meisten Pilger gingen mit abgewandtem Blick an dieser Szenerie vorbei.
Doch ein alter Mann, dem die Toga um den knochigen Körper flatterte, löste sich aus der Kolonne und versuchte, den Sachsen die Bücher abzunehmen. Sein Geschrei war eine holprige Mischung aus Britisch und Latein: »Oh, ihr heidnischen Rohlinge, ihr analphabetischen Barbaren, müsst ihr auch noch unsere Bücher vernichten?« Eine junge Frau rief ihn zurück, aber Freunde hielten sie fest.
Die beiden Plünderer sahen den zeternden Alten verdutzt an. Dann beschlossen sie, sich einen kleinen Spaß zu gönnen. Sie schubsten den Alten, sodass er auf den staubigen Boden fiel, hoben ihn dann an seinen dürren Armen und Beinen hoch und streckten ihn wie ein Schwein am Spieß. Die schmutzige Toga fiel in Stoffschlingen vom Körper des alten Mannes und gab den Blick auf einen schmuddeligen Kittel und eine Art Lendenschurz frei.
Die junge Frau brüllte die angeheuerten Krieger an, etwas zu unternehmen, aber die zuckten nur die Achseln. Der Alte hatte die Plünderer provoziert; es war seine eigene Sache. Selbst der Bischof marschierte weiter, aus voller Kehle seine Hymnen singend, als wäre nichts geschehen.
Jetzt hoben die Plünderer den Alten hoch und hielten ihn übers Feuer. Die Flammen der brennenden Bücher züngelten zu dem losen Togastoff hinauf, und die Schreie des alten Mannes verwandelten sich in schmerzerfülltes Gewimmer.
Wuffa warf Ulf einen Blick zu. »Sie werden ihn töten.«
»Das geht uns nichts an«, sagte Ulf.
»Du hast recht.«
»Ich nehme den linken. Wenn du dir den Alten greifen kannst …«
»Auf geht’s.«
Die beiden stürmten auf die Plünderer los. Ulf senkte seine massigen Schultern und rannte in den Mann zur Linken hinein. Der Alte wäre in die Flammen gefallen, aber Wuffa sprang übers Feuer, fing ihn mit beiden Armen auf und ließ ihn zu Boden gleiten. Wuffa wusste, dass der zweite Plünderer im Nu über ihm sein würde, darum ballte er die Faust und schwang sie noch in der Drehung herum. Knöchel krachten mit einem dumpfen Schlag, bei dem Wuffas ganzer Arm schmerzte, gegen Schädelknochen, und der Mann stürzte der Länge nach hin.
Wuffa setzte sich auf ihn, zog ein Messer aus seinem Gürtel und drückte es dem Sachsen an den Hals. Der benommene, wütende Plünderer war schwerer und stärker als er. Doch als Wuffa ihm den Hals mit der Klinge ritzte, ergab er sich und sank keuchend wieder zu Boden.
Wuffa schaute zu Ulf hinüber. Der große Nordmann hatte seinen Gegner mit dem Gesicht zu Boden gedrückt und schlug ihm mit der Faust immer wieder auf den Hinterkopf.
»Ich glaube, du hast deinen Standpunkt klar gemacht«, rief Wuffa.
Ulf hielt schwer atmend inne; seine Faust blieb in der Luft stehen. »Na schön.«
Mit einer geschmeidigen Bewegung rollte sich Wuffa vom Oberkörper des Plünderers herab und kam auf die Beine. Der offenkundig benommene Mann rappelte sich auf, ging zu seinem Gefährten hinüber und schleifte ihn weg. Wuffa wischte das Blut des Sachsen von seinem Messer und steckte es wieder in den Gürtel. Sein Herz pumpte; in solchen Augenblicken fühlte er sich so lebendig wie nie.
Inmitten dieser Aufwallung von Blut und Triumph begegnete er Sulpicia zum ersten Mal.
III
»Oh, Vater, du hättest getötet werden können!«
Der alte Mann atmete schwer, war jedoch nicht ernsthaft verletzt. Er versuchte sich aufzusetzen, während seine Tochter die Falten der Toga um seine dünnen Beine zurechtzog.
Nachdem der Kampf nun vorbei war und keine Gefahr mehr bestand, kam der Bischof mit seinem hohen Hut und seinen leuchtenden Gewändern herbei. »Orosius! Ist alles in Ordnung mit dir?«
»Ja, Ammanius. Aber ich komme mir vor wie ein Narr, wie ein richtiger Narr.«
Der Bischof – Ammanius – legte seinen Hirtenstab weg und half dem Alten, sich aufzusetzen. »Ich würde dich nie einen Narren schimpfen, tapferer Orosius. Doch es gibt viele Bücher in Armorica und nur einen wie dich, alter Freund.«
»Aber ich konnte einfach nicht mit ansehen, wie diese heidnischen Rohlinge die Bibliothek derart verwüsteten.«
»Sie werden nie wissen, was sie vernichtet haben«, sagte Ammanius. »Wir sollten sie bemitleiden, nicht verachten.«
Ammanius warf Wuffa und Ulf einen raschen Blick zu. Wuffa sah, wie der Blick des Bischofs über Ulfs muskulöse Beine wanderte. Ammanius war vielleicht vierzig Jahre alt. Sauber rasiert wie seine britischen Schützlinge, besaß er ein volles, wohlgenährtes Gesicht, eine so glatte Haut, dass sie geölt wirkte, und Augenbrauen, die möglicherweise ausgezupft waren. Sein Latein hatte einen starken Akzent. Vielleicht kam er vom Kontinent.
»Und es scheint«, sagte Ammanius zu Orosius, »dass du zwei anderen ›heidnischen Rohlingen‹ dein Leben verdankst.«
»Ja, ich danke euch beiden«, sagte die Tochter atemlos.
Ihre Augen waren groß. Sie mochte etwa zwanzig Jahre alt sein; ihr Gesicht war von Sorgen gezeichnet, aber sie war auf eine dunkle, britische Art hübsch, fand Wuffa.
»Beherrscht ihr die lateinische Sprache?«, fragte Ammanius.
»Wir sprechen sie«, sagte Ulf wachsam.
»Dann versteht ihr, was man zu euch sagt. Der alte Orosius ist dankbar, dass ihr euch eingemischt habt …«
Der alte Mann hustete und ergriff das Wort. »Leg mir keine Worte in den Mund, Bischof.« Er musterte die jungen Männer von oben bis unten. »Innerhalb der Stadtmauern trägt man keine Waffen. Das ist ein Stadtgesetz.«
Wuffa runzelte die Stirn. »Nicht unter König Aethelberht.«
»Die Autorität eines heidnischen Königs erkenne ich nicht an.«
Die Tochter seufzte.
»Nehmt es ihm nicht übel«, versuchte Ammanius Wuffa zu besänftigen. »Es ist ein schwerer Tag für Orosius. Diese Leute verlassen ihre Heimat – die Stadt, die ihre Vorfahren vor Jahrhunderten erbaut haben. Aber ihr interessiert euch wenig für Geschichte, ihr Sachsen, nicht wahr?«
»Ich bin Sachse«, sagte Wuffa. »Er ist Nordmann, ein Däne. Sein Name ist Ulf. Ich bin Wuffa.«
Das Mädchen sah ihn an. Ihre braunen Augen waren klar. »Und ich bin Sulpicia.«
»In meiner Sprache bedeutet mein Name ›Wolf‹.« Wuffa grinste und zeigte seine Zähne.
Kühl erwiderte sie seinen Blick. Dann beugte sie sich über ihren Vater. »Bischof Ammanius, diese beiden, Ulf und Wuffa, haben meinen Vater gerettet. Während wir weggeschaut haben. Aber sie sind Heiden. Ist das nicht ein Beweis dafür, dass alle Seelen durch Jesu Licht erlöst werden können?«
Ammanius schaute Wuffa in die Augen. »Hast du wirklich Güte in dir, mein Junge? Und dein nordischer Freund auch?«
Wuffa trat einen Schritt zurück und hob die Hände. »Ich bin nicht darauf aus, zu eurem toten Gott bekehrt zu werden, Bischof.«
»Nein? Aber viele von deiner Sorte kommen zu Christus. Deshalb hat Augustin uns hierher geführt. Ihr Sachsen seid leicht zu bekehren, ihr seid so ein trübsinniger Haufen! Eure Lieder sind eine endlose Leier des Verlusts. Du weißt es nicht, aber deine germanische Seele sehnt sich nach dem Licht der Ewigkeit, Wuffa.«
Ulf lachte. »Die Ewigkeit kann warten.«
»Heiden hin oder her«, sagte Sulpicia, »diese beiden haben sich heute als erheblich nützlicher erwiesen als die Söldner, die wir zu unserem Schutz angeheuert haben.«
»Nun ja, das stimmt.« Der Bischof strich sich über die lange Nase. »Vielleicht sind sie zu gebrauchen.«
Ulf und Wuffa wechselten einen Blick. Womöglich bot sich ihnen hier eine Gelegenheit. »Was soll das heißen?« , fragte Ulf.
Ammanius deutete auf seine Pilgerschar. »Ist euch klar, was hier geschieht? Ich führe diese Leute zu Schiffen, die sie flussabwärts zum Hafen von Rutupiae bringen – bei euch heißt der Ort Reptacaestir, vielleicht kennt ihr ihn. Von dort fahren sie übers Meer nach Armorica. Aber ich werde sie nicht begleiten. Mein Erzbischof hat mir einen anderen Auftrag erteilt. Ich muss in den hohen Norden dieser heruntergekommenen Insel. Dort soll ich eine Prophezeiung suchen, die angeblich viele hundert Jahre alt ist und von einer gewissen Isolde stammt …«
Die römische Kirche versuchte, ihr britisches Gegenstück zu assimilieren. Ein Element ihrer Strategie bestand darin, alle bewahrenswerten britischen Heiligen, Reliquien und mit religiöser Bedeutung aufgeladenen Dinge zu übernehmen. Zu den Kandidaten gehörte auch eine seltsame Prophezeiung der fernen Zukunft, die diese »Isolde« angeblich vor Jahrhunderten von sich gegeben hatte.
»Sie wird von jemandem bewacht, den man den ›letzten Römer‹ nennt«, sagte Ammanius. Dieser Ausdruck faszinierte Wuffa. »Es wird eine lange und gefährliche Reise werden. Da brauche ich Begleiter, auf die ich mich verlassen kann. Ihr beiden habt eine heidnische Seele, und dennoch habt ihr heute aus freien Stücken das Leben eines alten Mannes gerettet, den ihr noch nie gesehen habt. Vielleicht besitzt ihr die Eigenschaften, die ich suche. Was meint ihr – wollt ihr mit mir kommen? Natürlich bezahle ich euch dafür.«
Wuffa würde mit seinem Vater sprechen müssen. Aber Ulf grinste ihn an. Solch ein exotisches Abenteuer konnte man sich kaum entgehen lassen.
Ammanius hob seinen Stab auf. »Wenn ihr Interesse habt, treffen wir uns in sieben Tagen in Reptacaestir.«
Sulpicia half ihrem grummelnden Vater auf die Beine. »Welch ein Abenteuer«, sagte sie sehnsüchtig. »Ich wünschte, ich könnte euch begleiten!«
Ulf ergriff die Gelegenheit beim Schopf. »Dann komm doch mit.«
Das schien sie durcheinanderzubringen. »Ich kann nicht. Mein Vater …«
»Tu etwas für dich, nicht für ihn«, sagte Ulf. »Du wirst uns schon finden.« Und er drehte sich zu Wuffa um, ohne ihr weitere Einwände zu gestatten.
»Das wird vielleicht eine Reise werden«, meinte Wuffa. »Banditen auf der Straße, der Bischof, der hinter unserer Seele her ist …«
»Und die reizende Sulpicia, die dir an den Hintern fasst! Ich habe gesehen, wie sie dich angeschaut hat, Wolfsjunge.«
Der alte Mann, Orosius, rief ihnen nach: »Wisst ihr überhaupt, wie die Stadt heißt, die eure Leute ausplündern, ihr Barbaren? Wisst ihr, wo ihr hier seid?«
Wuffa schaute sich um. »Dies ist Lunden. Na und? Wen interessiert’s?«
Der alte Brite, den sie gerettet hatten, schimpfte laut weiter, aber die jungen Männer gingen davon.
IV
Am letzten Tag vor Wuffas Aufbruch nach Reptacaestir kam ein Skop, ein wandernder Dichter, in sein Heimatdorf. Coenred hieß den abgerissenen Wanderer willkommen, bewirtete ihn mit Fleisch und Bier und befahl dem kostbaren einzigen Sklaven des Dorfes, für sein Wohlergehen zu sorgen.
Das Dorf selbst war heimelig, ein dicht gedrängter Haufen von Pfostenhäusern, aus deren Strohdächern Rauch emporstieg. Zum Fauchen des Blasebalgs aus der Schmiede gingen die Leute ihren täglichen Aufgaben nach, unterhielten sich in ernstem Ton über geschäftliche Angelegenheiten und liefen hinter Kindern und Hühnern her. Die massiveren Häuser besaßen mit Schnitzereien verzierte Türpfosten, die aus dem alten Land übers Meer hierher gebracht worden waren, eine Erinnerung an die Heimat. Um die Hallen herum standen primitivere Hütten mit tiefer liegenden Böden, Werkstätten, in denen Tuch gewoben, Eisen bearbeitet oder Zimmermannstätigkeiten ausgeführt wurden, und dahinter lagen die Pferche für die Hühner, Schafe und Schweine. Es gab keine Straßenplanung, wie Wuffa sie in den Ruinen von Lunden gesehen hatte; die Häuser wuchsen, wo sie wollten, wie Pilze.
Das Dorf von Coenred und seiner Sippe war eine von Hunderten solcher Ansiedlungen, die sich in einen großen Gürtel um Lundens Mauern zogen. Durch die alten Hafenanlagen und den neuen Handelsbezirk namens Lundenwic strömten immer noch genug Reichtümer herein, um Lunden für Aethelberht und seine Unterkönige wertvoll zu machen. Dazu kam das Ansehen, den riesigen Kadaver der ehemals wertvollsten Stadt in Britannien zu besitzen. Lunden zog die Menschen an; sie wollten hier leben und arbeiten.
Als der Abend nahte, füllte sich die größte Halle des Dorfes. Ein Feuer loderte im Kamin, und die Menschen versammelten sich auf Bänken und aufgeschüttetem Stroh; im Feuerschein glänzten ihre Gesichter wie römische Münzen. Viele hatten sich anlässlich des Skop-Besuchs besonders herausgeputzt und trugen saubere, bunte, mit Fibeln verzierte Kleider, dazu Halsketten aus Bernstein und Stücken alten römischen Glases sowie silberne Fingerringe. Die Männer hatten ihre Saxe an der Hüfte, jene Messer mit dem Knochengriff, die dem Volk seinen Namen gaben. Viele der Älteren bogen und streckten arthritische Finger und Gelenke. Mit seinen vierundvierzig Jahren war Coenred einer der ältesten.
Wuffa war mit fast jedem der Anwesenden verwandt; dies war seine Familie.
Das Bier kreiste, und die Stimmung heiterte sich auf; hier und dort war Gelächter zu vernehmen. Schließlich erhob sich der Skop mit seiner traditionellen Aufforderung: »Hört mich an!« Er wirkte ein bisschen unsicher auf den Beinen, doch als er sprach, war seine Stimme kräftig und klangvoll. »Hört mich an, ihr Götter! Sehnsucht und Reue drücken mich nieder. Ich erwache in nebelschwangerer Luft und bestelle den Boden eines trostlosen Landes. Denn ich bin meinem Herrn übers Meer gefolgt, und meine Heimat ist weit entfernt. Die Felder meiner Väter versinken im Meer. Meine Kinder verkümmern in trübem Dunkel. Denn ich bin meinem Herrn übers Meer gefolgt, und meine Heimat ist weit entfernt …« Während er sich in sein Thema hineinsteigerte, ein typisch sächsisches Klagelied von Verlust und Reue, stimmten die Erwachsenen, die sanft zu den Rhythmen seiner Rede schunkelten, in den Kehrreim ein.
Dieser Bischof hatte recht, dachte Wuffa. Die Sachsen waren ein trübsinniger Haufen. Dann begann das Bier auch bei ihm seine Wirkung zu tun, und seine Gedanken wurden milder. Er ließ sich von der tröstlichen, düsteren Stimmung in der Halle erfassen, murmelte zusammen mit den anderen Männern den traurigen Kehrreim des Skops und träumte von den blassen Schenkeln des britischen Mädchens, Sulpicia.
Als die Nacht hereinbrach, kam das unheimliche Weiß des Kometen zum Vorschein wie Gebein nach dem Verwesen des Fleisches, und sein unirdisches Licht drang in die Wärme der Halle.
V
Reptacaestir war ein römisches Kastell mit gewaltigen Mauern und runden Türmen, angelegt nach einem kalten Plan. Es ähnelte einem Steingrab. Einen größeren Kontrast zu Coenreds warmem Dorf konnte man sich kaum vorstellen.
An Ulfs Seite führte Wuffa sein Pferd vorsichtig in die geschäftige Hafenstadt hinein. Hier, nahe der Ostküste, lag das Land völlig flach unter einem riesigen, verwaschenen Himmel. Wuffa roch das Meer. Sie stiegen ab und standen unsicher inmitten Scharen nordischer und germanischer Händler. Dicht gedrängte Gruppen britischer Flüchtlinge hockten schweigend auf dem Boden und warteten auf ihre Schiffe.
»Ah, da seid ihr ja.« Bischof Ammanius kam auf sie zu, ein wohl kalkuliertes Lächeln in seinem breiten, gut genährten Gesicht. Er trug praktischere Kleidung als in Lunden: einen groben Kittel, eine Lederhose, feste Stiefel, einen Umhang. Begleitet wurde er von zwei jungen, mit schwerem Gepäck beladenen Mönchen; ihre geschorene Kopfhaut glänzte rosa. Ammanius bezeichnete sie als »Novizen« und schenkte ihnen kaum einen zweiten Blick.
Außerdem war das britische Mädchen namens Sulpicia bei ihm. Wuffa konnte den Blick nicht von ihr wenden. Die robuste, beinahe männliche Kleidung, die sie an diesem Tag trug, unterstrich die zarte Schönheit ihres Gesichts. Sie sah stark aus, fand er, stark und gelenkig. Sie war eine Britin, eine Christin, sie war anders – aber sein Körper scherte sich dennoch nicht im Geringsten darum.
Er trat auf sie zu. »Du bist also doch gekommen«, sagte er.
Sie erwiderte seinen Blick. »Mein Vater ist wohlbehalten unterwegs nach Armorica. Ich besitze einige Fertigkeiten im Lesen und Schreiben; ich glaube, ich werde dem Bischof von Nutzen sein.«
»Und du wirst fünfzig Tage bei uns sein, vielleicht auch noch länger. Welch ein Glück für mich.«
»Wir haben eine heilige Mission zu erfüllen«, sagte sie mit leisem Spott. »Das sollte für uns an erster Stelle stehen.«
»Mag sein, aber ich bin kein Christ.«
»Dann haben wir einander nichts mehr zu sagen.« Sie wandte sich ab. Die sanfte Brise vom Meer wehte ihr die Haare ins Gesicht. Sie lächelte.
Das Spiel ist eröffnet, dachte er mit einem warmen Gefühl im Bauch.
Ammanius bestand darauf, ihnen die Hafenstadt zu zeigen. Innerhalb der Mauern des alten römischen Kastells standen Holzhäuser auf den Grundmauern zerstörter Steinbauten. Auf einem niedrigen Hügel im Zentrum des Kastells deutete er auf eine komplizierte Abfolge von Fundamenten und Mauerresten. »Hier haben sie einen Bogen gebaut, um Claudius’ Triumph zu feiern. An diesem Ort sind die Römer zum allerersten Mal gelandet.« Er sog die scharfe, salzige Luft tief in die Lungen. »Damals hatten sie Christus noch kaum vom Kreuz abgenommen. Später wurde der Triumphbogen abgerissen, weil man Baumaterial für die Mauern des Kastells brauchte, um euch arschhaarige Räuber und eure mückenstichartigen Angriffe auf die Küste abzuwehren. Aber ihr seid trotzdem gekommen. Und dann hat ein König namens Vortigern hier an dieser Stelle eine große Schlacht gegen euch ausgetragen und gesiegt …«
Britannien war eine römische Diözese mit Londinium als Hauptstadt gewesen. Die Briten hatten das kaiserliche Joch aus eigener Kraft durch eine Rebellion abgeworfen. Die Diözesanverwaltung war zusammengebrochen, aber die vier Unterprovinzen hatten überdauert. Die Provinzstaaten waren erfolgreich. Die alten Städte und Landgüter funktionierten weiter; es wurden nach wie vor Steuern eingetrieben. Die des Lesens und Schreibens kundigen christlichen Briten hatten ihre römische Kultur sogar bis an den äußersten Rand Britanniens exportiert, in den Westen und Norden und nach Irland, an Orte, wo der Legionsadler niemals geflogen war.
Doch in dem entstandenen Machtvakuum nutzten starke Männer ihre Gelegenheiten. Hier im Südosten kämpfte sich ein Mann namens Vitalinus an die Spitze eines Haufens von Stadträten und Militärbefehlshabern. Geleitet von dynastischen Erwägungen, heiratete er die Tochter von Magnus Maximus, einem der vielen damaligen Anwärter auf das kaiserliche Purpur. Bald nannte er sich »Vortigern«, ein Wort, das so etwas wie Oberkönig bedeutete. Er war der Aethelberht seiner Zeit gewesen.
Da ihm jedoch gut ausgebildete Soldaten fehlten, heuerte Vitalinus sächsische Söldner zum Schutz an. Die Sachsen schlugen Angriffe der Pikten aus dem Norden zurück. Doch als Südbritannien von einer Seuche heimgesucht wurde und Vitalinus’ Steuereinnahmen rasant schrumpften, rebellierten die um ihren Sold betrogenen Sachsen.
»Anfangs hat Vitalinus sich gut geschlagen«, sagte Ammanius. »Sein Sohn, Vortimer, hat hier bei Reptacaestir jenen großen Sieg errungen. Das war, oh, vor ungefähr hundertfünfzig Jahren. Dein Ururgroßvater hat vielleicht an dieser Schlacht teilgenommen, Wuffa! Ich bezweifle, dass eure Dichter Lieder über die Niederlagen singen. Aber der Triumph der Britannier konnte nicht von Dauer sein …«
Binnen fünf Jahren brachen die Sachsen aus ihrer Insel-Enklave aus. Und neue Wellen von Einwanderern trafen ein. In Wuffas Dorf sangen die Skops noch immer von den großen Überfahrten jener, deren Gehöfte im alten Land im Wasser versanken, Geschichten am Rande des Vergessens, die von den Großvätern der Großväter erzählt wurden. Das waren keine Söldnertruppen gewesen, sondern ein Volk auf Wanderschaft.
»Die Briten haben ihr Land verloren, Schritt für Schritt. Und nun sind sie hier, Flüchtlinge, die aus dem Land ihrer Ahnen fliehen. Und im letzten Jahrzehnt ist eine neue Welle von Eindringlingen durch Reptacaestir geflutet.«
»Wovon sprichst du?«, fragte Wuffa.
Der Bischof brachte sie zu einer kleinen Kirche, die aus römischem Stein erbaut war. »Diese Kapelle ist Augustin geweiht. Der Erzbischof ist erst vor zehn Jahren hier gelandet – mit dem Auftrag des Papstes, euch heidnische Kinder zu dem einen wahren Glauben zu bekehren. Und das ist eine Invasion Britanniens, die kein Ende nehmen wird.«
Wuffa ließ den Blick über die ramponierten Mauern, das Gewimmel der nordischen und germanischen Händler und die Gruppen der britischen Flüchtlinge schweifen. Inmitten dieser komplizierten, vielschichtigen Ruinen spürte er die Vergangenheit, als hätten sich die Türen einer riesigen, verlassenen Halle für ihn geöffnet. Es war faszinierend und beunruhigend zugleich.
Doch als er Sulpicia einen Blick zuwarf, erfüllte ihn nur die helle Gegenwart, wie das diffuse Licht vom Meer, das die Schatten der verrottenden Mauern des Kastells bannte.
VI
Wuffa und Ulf begleiteten Ammanius einige Tage lang zu anderen Hafenstädten im Südosten, wo der Bischof die Ausreise weiterer Flüchtlingsgruppen zum Kontinent beaufsichtigen musste. Viele dieser Häfen besaßen massive alte römische Befestigungsanlagen wie die von Reptacaestir. Der einzige Ort, von dem Wuffa gehört hatte, war Pefensae, das der Bischof Anderida nannte. Nach den Römern war hier innerhalb der Mauern eine britische Stadt entstanden, aber vor einem Jahrhundert waren die Sachsen gelandet und hatten die Briten bis zum letzten Mann niedergemacht, ein kühner Schlag, von dem die Skops noch immer sangen.
Nachdem Ammanius’ Pflichten erfüllt waren, brachen die sechs in den hohen Norden auf, um nach der Sage von Isolde zu suchen.
Auf ihrer Reise folgten sie größtenteils den von den Römern hinterlassenen, unterschiedlich gut erhaltenen Straßen. Ulf und Wuffa ritten ihre Pferde, während der Bischof, Sulpicia und die Novizen in einem robusten sächsischen Karren fuhren. In Britannien wimmelte es von Kleinkönigreichen, aber es gelang Ammanius mit Hilfe von Briefen seines Erzbischofs, die er bei sich trug – und mittels der puren Kraft seiner Persönlichkeit, dachte Wuffa –, ihnen den Schutz eines Reiches nach dem anderen zu sichern.
Sie übernachteten in alten Römerstädten, Wehrbauten auf Hügelkuppen oder Landhäusern. Umgeben von hastig errichteten Mauern, ähnelten die Städte eher schäbigen Festungen, in denen zwischen reetgedeckten Häusern aus Lehm und Stroh ein paar mächtige Steinbauten aufragten. In den römisch-britischen Herrschaftsgebieten boten die Städte in schlechten Zeiten Schutz, fungierten in guten als Märkte und waren Orte, wo Könige und andere kleine Herrscher ihre Steuern eintrieben.
Die Hügelfestungen fand Wuffa interessanter, weil sie so anders waren als alles, was er bisher gesehen hatte. Sie waren nicht mit Steinmauern befestigt wie die Städte, sondern mit Erdwällen und hölzernen Palisaden. Ammanius, der Wuffas wachsende Neugier bemerkte, erklärte ihm, diese Anlagen hätten schon lange, bevor die Caesaren gekommen seien, brütend auf ihren Hügeln gestanden. »Und später sind die Britannier dann allmählich wieder in die Wehrbauten ihrer Vorväter zurückgekehrt. Es schien, als wären die Römer gar nicht hier gewesen …«
Ammanius zog es vor, in den Landhäusern zu übernachten. Die imposanten alten Gutshöfe, die früher einmal reichen römischen Briten gehört hatten, waren nach dem Zusammenbruch des römischen Systems entweder aufgegeben oder in stark eingeschränkter Form weiter genutzt worden. Und später, als das britische Christentum sich ausbreitete, wandelte man sie in Klöster um.
An solchen Orten, umgeben von Mönchen, die ruhig ihrer harten Arbeit nachgingen, fühlte Bischof Ammanius sich offenkundig wohl. Und wenn er sich entspannte, trank er. Er mochte ein heiliger Mann sein, aber er liebte seinen Wein.
Und je stärker ihm der Alkohol zu Kopfe stieg, desto mehr schienen ihn Ulf und Wuffa zu faszinieren. Ammanius unterhielt sich öfter mit Wuffa. Er sagte, er sehe den »leeren Geist zweier heidnischer Jungen« als Gefäß, das mit der Wahrheit seines Gottes gefüllt werden müsse. Doch wenn sich der große Nordmann bewegte, folgten ihm die Augen des Bischofs, als wäre Ulf ein faszinierendes Tier.
Eines langen Abends saßen die vier in einem vom Feuerschein erhellten Raum tief im Innern eines windgepeitschten Landhaus-Klosters. Sie waren allein, bis auf einen Novizen, der ihnen Speisen und Getränke brachte. An den Wänden hingen Wandteppiche, und auf dem Boden lag ebenfalls ein dicker Teppich. Dies sei das triclinium des römischen Gutshauses gewesen, erklärte der Bischof, ein Wort, das Wuffa nichts sagte; offenbar bezeichnete es eine Art Wohnraum. Den Mönchen zufolge dienten die Teppiche und Wandbehänge dazu, die heidnischen Symbole an den Wänden und auf dem Boden vor frommen Blicken zu verbergen und zugleich ein Gemach zu wärmen, dessen Bodenheizungssystem schon längst nicht mehr funktionierte.
Ulf und Sulpicia spielten ein kompliziertes Spiel mit vom häufigen Gebrauch abgenutzten Würfeln und Spielfiguren, die von den ursprünglichen Besitzern des Landguts zurückgelassen worden waren und sich jetzt bei den Novizen großer Beliebtheit erfreuten. Sulpicia saß auf ihrer Liege nah bei Wuffa: ihre Tunika fiel lose um die weiche Haut ihres Halses. Wuffa registrierte jedes leise Lachen, in das Ulf und sie einstimmten; er sah, wie Ulfs zerzauste goldene Haare ihre dunkle britische Stirn streiften, wie ihre Finger sich über der schmutzigen Oberfläche des hölzernen Spielbretts berührten.
Seit ihrer Begegnung an jenem entscheidenden Tag in Lunden hatte Wuffa geglaubt, eine Abmachung mit Ulf zu haben, dass Sulpicia ihm gehörte oder es doch zumindest ihm vorbehalten war, es als Erster bei ihr zu versuchen. Aber konnte man Ulf trauen? War er raffinierter als Wuffa, arbeitete er im Stillen daran, sich einen Vorteil zu verschaffen? Wuffa war verwirrt und hatte das Gefühl, ins Hintertreffen geraten zu sein.
Und so wie Wuffa Sulpicia beobachtete, beobachtete Ammanius Ulf.
Ammanius beugte sich nah zu Wuffa, und der Sachse konnte den schalen Wein in seinem Atem riechen. »Ihr Germanen fasziniert mich«, sagte er. »Ihr errichtet keine Weltreiche. Ihr kennt keine Werte außer der Loyalität zur Halle eures Häuptlings, wo eure Kriegsherren herumsitzen und sich betrinken. Eure Gesetze – sofern ihr überhaupt welche habt – sind außerordentlich brutal. Bei euch hat das Leben eines Mannes sogar einen Preis, nicht wahr? Eine Strafe, die man bezahlen muss, wenn man es ihm nimmt?«
»Wir nennen es wergild.«
»Nichts als eine Rationalisierung der barbarischen Blutfehde. Und ihr verschafft euren Gesetzen Geltung, indem ihr Menschen zu Krüppeln macht, indem ihr Augen ausstecht, Zungen herausschneidet und Gliedmaßen abhackt. Ich habe gesehen, was dabei herauskommt! Eure Gesellschaft ist durchsetzt von Gewalt; sie wird von ihr beherrscht. Ihr habt keine nennenswerte Medizin; die Kranken, Behinderten und Alten schickt ihr in den Tod.«
»Glaube nicht alles, was du von unseren Feinden hörst«, sagte Wuffa in ruhigem Ton.
»Selbst eure Religion ist nur ein wüstes Sammelsurium von Mythen und Sagen. Eure Geschichten von Woden, von eurer Erdmutter Frig … Jesus Christus.« Er nahm einen weiteren tiefen Schluck aus seinem Weinkelch, den ein nervös dreinschauender Novize erneut füllte. »Und dennoch«, sagte Ammanius, das Kinn rot glänzend von vergossenem Wein, »und dennoch habt ihr viel Beneidenswertes. O ja! Die Leidenschaft eines Kriegervolkes, die primitive Vitalität. Eure gutturale Sprache ist voller Wörter für ›Liebe‹, für ›Ehre‹ – so anders als die kalte Förmlichkeit des Lateinischen …« Er rülpste, beugte sich noch weiter vor, fiel von seiner Liege und landete schwer auf dem mit einem Teppich bedeckten Boden.
Der Novize kam eilig und mit resignierter Miene herbei. Wuffa und er fassten den Bischof jeweils unter einem Arm, zerrten ihn mühsam auf die Beine und führten ihn aus dem Raum.
»Die Liebe zwischen Kriegern«, rief Ammanius. »Das Band zwischen starken Männern! Gibt es ein solches Band zwischen dir und deinem Nordmann, Wuffa? …« Aber er würgte, und sie schafften es nur mit knapper Not, ihn zur Tür hinauszubringen, bevor er sich heftig erbrach und weindunkle Galle über den Teppich verspritzte.
Ulf und Sulpicia hatten während dieses Wortwechsels geschwiegen. Sie setzten ihr Spiel fort; die abgenutzten Steine tappten über das uralte Spielbrett.
VII
Am folgenden Tag brachen die Reisenden wieder auf. Ihr Weg führte sie stetig nach Norden. Bischof Ammanius war kein angenehmer Reisegefährte; er musterte alles und jeden mit finsterem Blick, stank immer noch nach Alkohol und Erbrochenem und ließ seinen Zorn an den unglücklichen Novizen aus.
Endlich erreichten sie die ehemals nördlichste Provinz Britanniens, die Ammanius Flavia Caesariensis nannte, und schlugen den Weg zur Hauptstadt ein. Eoforwic – Eburacum, wie die römischen Briten sie genannt hatten – erwies sich als eine spektakuläre römische Stadt; umgeben von massiven Mauern, lag sie auf einer Anhöhe mit Blick auf einen Fluss. Beherrscht wurde sie von einem imposanten Steinbau, dessen Ziegeldach und Säulengänge noch heil waren. Dies sei das Hauptquartier des alten römischen Kastells gewesen, sagte Ammanius, die principia.
Doch als die Reisenden sich der Stadt näherten, sah Wuffa, dass die Mauern Breschen und Brandspuren aufwiesen. Im Innern der Stadt herrschte rege Aktivität; die Mauern wurden ausgebessert, und Händler und Zuwanderer strömten herein. Diese geschäftigen Menschen waren weder Römer noch Briten. Eburacum befand sich nun in den Händen der Germanen.
Nach dem Abzug der römischen Verwaltungsmacht hatte ein römischer Oberbefehlshaber — der Dux Brittaniarum – mit Hilfe dieser Legionsstadt und der Kastelle im Wall die Herrschaft über die alte Nordprovinz an sich gerissen. Das Gemeinwesen hatte alles gut überstanden, trotz der Überfälle auf die Ostküste, wo im Verlauf der Jahrzehnte ein germanisches Volk, die Angeln, in mehreren großen Einwanderungswellen gelandet war. Eine Zeit lang war es den Briten gelungen, die Angeln in einer Küstenfestung namens Bebbanburh einzuschließen und sie noch weiter zurückzudrängen, auf eine Insel vor der Küste, die den Namen Lindisfarena trug. Aber die Angeln kamen immer wieder und waren schon längst von dort ausgebrochen. Jetzt breitete sich ihr Königreich über den Norden Britanniens aus, und erst in den letzten Jahren hatten sie Eoforwic eingenommen.
Und heute wurde unter dem Säulengang der principia Vieh gehalten, und germanische Häuptlinge stolzierten über ihren Marmorboden. Ammanius versuchte, dem widerstrebenden Wuffa deutlich zu machen, was er bei diesem Anblick empfand: ein Gefühl des Verlusts, des Bedauerns, den Eindruck, außerhalb seiner Zeit geboren zu sein.
Sie blieben nur eine Nacht in der Stadt, bevor sie zum Zentrum des neuen anglischen Königreichs an der Ostküste weiterreisten. Bebbanburh war auf einem Stück harten schwarzen Felsgesteins erbaut worden, das unnachgiebig über einer Dünenreihe aufragte. Sie mussten in den Stein gehauene Stufen zum Gipfel hinaufsteigen. Die Festung war primitiv, nur eine Hand voll Holzhütten mit einer Hecke darum herum. Früher einmal war dieser Felsbrocken der ganze Besitz der Angeln gewesen. Jetzt war er das Herz eines Königreichs, das sich über Nordbritannien erstreckte.
Er war nach der Gemahlin eines anglischen Königs benannt. Die Briten hatten ihm einmal den Namen Dinguardi gegeben, aber niemand kümmerte sich darum.
Die müden Reisenden wurden von einem Thegn des örtlichen Königs empfangen und in einer kleinen, beengten Halle untergebracht. In diesem typisch germanischen Gebäude fühlte sich Wuffa mehr zu Hause denn je, seit er Coenreds Dorf verlassen hatte. Auch dies war ein spektakulärer Ort; er ragte über ein unruhiges Meer auf, über dem der Komet sein geisterhaftes Licht verbreitete. Aber die Stimmung des Bischofs verfinsterte sich bald, denn als er die Berater des Königs um Informationen bestürmte, wie er Isoldes Prophezeiung aufspüren könnte, erfuhr er, dass ihm eine weitere Reise bevorstand – diesmal nach Westen, an der Linie des alten römischen Walls entlang. Der »letzte Römer«, so der Thegn abergläubisch, sei angeblich ein Nachfahre von Isolde selbst und spuke in einem Wallkastell namens Banna herum.
Wuffa, dem das alles gleichgültig war, suchte sich eine Ecke, wo er sich auf nach Vieh riechendem Stroh zusammenrollte und in einen tiefen Schlaf sank.
In stockdunkler Nacht wurde er von schwerem, nach Wein riechendem Atem geweckt, und eine Hand fummelte ungeschickt unter seiner Decke herum. Ohne nachzudenken, hob er das Knie, rammte es in einen fetten Bauch und schlug mit der Faust zu. Ammanius wich mit einem Grunzen zurück; natürlich war er es.
Wütend rappelte Wuffa sich von seinem Strohlager hoch, ging zur Tür und stieß sie mit dem Fuß auf. Im Licht des Kometen sah er den Bischof, der ausgestreckt auf dem Rücken lag; ein dunkler Blutfleck breitete sich auf seinem Kittel aus. »Im Namen deines an seinen Baum genagelten Gottes, was tust du, Ammanius?«
Der Bischof betastete sein Gesicht. Das Gurgeln von Blut übertönte seine gedämpften Worte. »Ich glaube, du hast mir die Nase gebrochen.«
»Ich hätte dir deinen betrunkenen Hals brechen sollen. Warum bist du in mein Bett gekommen?«
»Weil sie in seinem liegt«, sagte der Bischof verzweifelt.
Es dauerte eine Weile, bis Wuffa, immer noch benommen von der Unterbrechung seines Schlafs und dem Schock, verstanden hatte, was geschehen war. Offenbar hatte der Bischof Signale von Ulf, die es womöglich nur in seiner Einbildung gab, falsch gedeutet und war zu dem Nordmann ins Bett gestiegen – wo er Sulpicia vorfand. Aus Verzweiflung und Verlangen war er dann zu Wuffa gekommen.
Nun waren also die Spannungen, die sich während dieser ganzen langen Reise zwischen ihnen allen aufgebaut hatten, in einem einzigen makabren Augenblick zum Ausbruch gekommen, dachte Wuffa düster. Er hätte eigentlich Zorn empfinden sollen, war aber zu betäubt dafür. Er schaute zur Tür hinaus, auf den Kometen, der über den Ozean segelte.
Der Bischof zappelte wie ein gestrandeter Fisch auf dem Boden herum. »Wir sind betrogen worden, Wuffa, wir sind beide betrogen worden!«
VIII
Um zur Linie des Walls zu gelangen, mussten sie sich in südlicher Richtung halten; auf dem Weg an der Küste entlang nach Norden waren sie an der alten Befestigungsanlage vorbeigekommen. Sie durchquerten ein unbemanntes, längst verlassenes und verfallenes Torkastell. Dann gelangten sie zu einer Straße in halbwegs gutem Zustand, die neben einem mit Abfall gefüllten Graben an der Südseite des Walls verlief. Sie ritten diese Straße entlang und folgten der Linie des Walls nach Westen in Richtung Banna.
Man merkte dem Wall sein Alter an. Hier und dort war er seiner säuberlich zurechtgehauenen Blendsteine beraubt worden, sodass ein gröberer Kern aus Schutt und Zement freilag, aber es gab auch lange Strecken, wo er noch gut erhalten war, und man sah sogar Spuren von Tünche und roter Farbe, die Jahrhunderte alt sein mussten. In regelmäßigen Abständen standen Torkastelle und Türme, die von höher gelegenem Gelände aus wie Entfernungsmarkierungen wirkten. Obendrein schmiegten sich auch noch mehrere große Kastelle an den Wall: Festungen von den Ausmaßen kleiner Städte. Einige wurden noch genutzt, allerdings nicht mehr von Soldaten, sondern von teils britischen, teils germanischen Bauern. Sie wohnten in bescheidenen Holzhallen, die sich in den Windschatten der großen Bauwerke der Vergangenheit kauerten.
Je länger sie unterwegs waren, desto mehr beeindruckte Wuffa die schiere Größe des Walls. Er zog sich einfach quer durch die Landschaft und ließ sich weder von Höhenrücken noch von Flüssen aufhalten. Er überspannte die schmalste Stelle dieses Insellandes von Osten nach Westen, von Küste zu Küste, friedete den gesamten südlichen Teil der Insel ein, von Eoforwic über Lundenwic bis nach Reptacaestir, und schützte all diese angreifbaren Orte vor den Raubzügen der Barbaren, die weiter im Norden gelebt hatten. Und trotz seiner Baufälligkeit war er so riesig, dass sie vom einen Ende zum anderen vier Tage brauchten. Wuffa hatte noch nie zu denen gehört, die voller Ehrfurcht Ruinen angafften. Doch als ihm die Dimensionen des Walls allmählich bewusst wurden, glaubte er einen Blick auf die maßlosen, unmenschlichen Ambitionen von Kaisern erhascht zu haben, die mit einem einzigen Federstrich ein Land in zwei Teile zerschneiden konnten.
Und im Schatten des mächtigen Walls waren die vier noch immer in ein Gewirr aus Rivalität und Begehren verstrickt.
Seit Bebbanburh war Wuffas ehemalige Freundschaft zu Ulf von Neid zerfressen worden. Ulf schien ihm nun verschlagen, manipulativ und falsch zu sein – und er hatte Sulpicia erobert, was Wuffa maßlos ärgerte. Sulpicia wiederum schien seinen Zorn als Kränkung zu empfinden. Soweit es sie betraf, gehörte sie sich selbst und war keine Sklavin, um die man sich zankte.
Doch im weiteren Verlauf der Reise verschlechterte sich ihr Gesundheitszustand. Sie versuchte es zu verbergen, aber Wuffa sah, wie sie sich den Bauch hielt, und hörte, wie sie sich morgens erbrach. Hatte Ulf ihr seinen nordischen Samen eingepflanzt? Wenn ja, machte es sie nicht glücklich. Wuffa glaubte kaum, dass ihre Leute sie mit einem Barbarenbalg an der Brust wieder bei sich willkommen heißen würden.
Und Ulf zog sich von ihr zurück. Jetzt, wo er sie erobert hatte, wo sie krank war, zeigte er kein Interesse mehr an Sulpicia. Seine Kälte machte Wuffa noch wütender. Er würde sich nicht so verhalten, wenn das Kind seinen Lenden entstammte, wenn Sulpicia sein wäre.
Die unter der Oberfläche brodelnde Gewalt wirkte sich auf sie alle aus. Wuffa und Ulf gerieten sogar einmal mit den Fäusten aneinander; Anlass war ein belangloser Streit über den besten Weg, einen Fluss bei einer zerstörten Römerbrücke zu überqueren.
Schließlich nahm Ammanius Wuffa und Ulf beiseite. »Ich habe euch beide wegen eurer Muskelkraft angeheuert, aber dabei schwebte mir kaum vor, dass ihr aufeinander losgeht. Vergesst nicht, dass ich euch bezahle. Versucht, mit dem Kopf zu denken und nicht mit dem Schwanz.«
Allerdings hatte der Bischof selbst am meisten zu den Spannungen in der Gruppe beigetragen. Mit seiner übel zugerichteten, blutigen und schmerzenden Nase schrie er die Novizen, Wuffa und Ulf und sogar die Pferde an, wenn sie scheuten. Wuffa erkannte, dass Ammanius eigentlich wütend auf sich selbst war, wegen seines Verhaltens in jener Nacht in Bebbanburh. Aber wie alle Menschen war er ein Gefangener seiner eigenen Schwächen, dachte Wuffa.
So näherte sich die kleine, meist schweigsame Gruppe schließlich Banna. Hier, nicht weit von seinem westlichen Ende, verlief der Wall über einen hohen Kamm, von dem aus Wuffa das hügelige Land im Norden erkennen konnte, und im Süden schlängelte sich ein Fluss durch ein tiefes, bewaldetes Tal.
Ein kleines, schäbiges Dorf anglischer Bauern kauerte sich ein Stück vom Kastell entfernt an den Nordhang. Gleich nach ihrer Ankunft führte Ammanius seine Gruppe zu dem Dorf, rief furchtlos den Häuptling herbei und verlangte zu erfahren, ob der Mann etwas über diesen »letzten Römer« wisse. Wuffa und Ulf hatten stockend für ihn übersetzt, denn diese Angeln verstanden kein Latein, und Ammanius konnte mit Sicherheit kein Germanisch.
Ja, sagte der anglische Bauernkrieger, er wisse alles über Ambrosias, den letzten Römer. Tatsächlich hätten er und seine Leute den alten Mann jahrelang am Leben erhalten.
Die Angeln waren von ihren Königen ermuntert worden, sich hier anzusiedeln. Sie hatten sich entschieden, nicht in dem alten Kastell zu leben, pflegten es aber nach zurückgelassenem Werkzeug, Münzen und sogar Schmuckstücken zu durchstöbern, dem Abfall der Jahrhunderte.
Und in Banna hatten sie Ambrosias gefunden. Die Familie des alten Mannes hatte generationenlang in der Stadt gelebt, die in den Ruinen der Festung entstanden war. Bei der Ankunft der Angeln hatten seine Angehörigen ihre Siebensachen gepackt und waren fortgegangen; der Bauer wusste nicht, wohin, und es interessierte ihn auch nicht. Der störrische alte Mann war allein hier geblieben, wo er im Erdreich einer kleinen Landparzelle innerhalb der Mauern der Festung scharrte. Er war großartig, auf seine zerbrechliche Weise. Er hatte sogar seinen rostigen Handpflug erhoben und gedroht, jedem stämmigen Angeln, der ihn aus seiner Festung zu vertreiben versuchte, den Schädel einzuschlagen.
Aus irgendeinem Impuls heraus duldeten die Angeln den alten Mann. Sie teilten sogar ihr Bier mit ihm. Als Ammanius das hörte, gratulierte er den Bauern zu einer christlichen Großzügigkeit, die bei einem »arschhaarigen Heiden« überraschend sei. Wuffa wusste jedoch, dass man angesichts der mächtigen Ruinen der Römer leicht Ehrfurcht empfinden konnte. Vielleicht war der alte Mann vom Wall den zum Teil gerade erst übers Meer gekommenen Angeln wie ein Relikt vergangener Zeiten erschienen, ein lebendiger Geist. Möglicherweise hatten sie sogar versucht, die Götter des Walls günstig zu stimmen, indem sie ihn am Leben erhielten.
Aber das gehe nun schon seit fünfzehn Jahren so, murrten die stämmigen Bauern, und der alte Mann wolle noch immer nicht sterben.
Sie betraten das Kastell. Es war ein sehr altes Bauwerk, überwuchert von Gras und Unkraut. Auf den ordentlichen rechteckigen Fundamenten verschwundener Steinbauten hatte man Hallen aus Holz und Flechtwerk errichtet, aber selbst diese späteren Hütten waren bereits wieder im Erdreich versunken, aus dem sie entstanden waren. Das Kastell war jedoch nicht völlig verlassen.
Ambrosias war hager, vielleicht siebzig Jahre alt und in einen dicken wollenen Umhang mit Kapuze gekleidet, obwohl das Frühlingswetter nicht kalt war. Jedoch trug er sein silbergraues Haar kurz geschnitten und war rasiert, trotz der Stoppeln auf seiner ledrigen Haut. Früher einmal musste er gut ausgesehen haben, dachte Wuffa, mit einer stolzen Nase und einem starken Kinn. Jetzt aber wirkte sein Gesicht eingefallen, und sein Körper war verhutzelt.
Dies war der »letzte Römer«, der von des Lesens und Schreibens unkundigen anglischen Bauern wie eine Art Haustier gehalten wurde.
Und als Ammanius auf ihn zutrat, ignorierte Ambrosias den Bischof und wandte sich an Ulf und Wuffa. Er war lebhaft und voller Eifer, und Wuffa wich vor seiner Intensität zurück. »Ich habe euch erwartet«, sagte Ambrosias auf Lateinisch.
IX
Als der Abend hereinbrach, war der Komet, der am dunklen Nordhimmel hing, heller und spektakulärer denn je.
Während die Novizen in einem Stall in dem anglischen Dorf schliefen, beharrte Ambrosias darauf, dass die vier Gäste die Nacht im Kastell verbrachten. Er bereitete eine Mahlzeit zu. »Esst und trinkt«, sagte er. »Wenn ein Römer eines ist, dann gastfreundlich.« Er schlurfte mit einem Teller voll klein geschnittenem Fleisch und einen Krug Bier umher. »Natürlich bin ich meinen neuen anglischen Nachbarn unten am Hügel dankbar, aber ich wünschte, sie würden ein wenig guten kontinentalen Wein in die Hände bekommen statt dieses dreckige germanische Bier. Wisst ihr, ich habe mal versucht, hier ein paar Weinreben zu züchten, an der Südmauer des Kastells. Sind im ersten harten Winter verwelkt und eingegangen. Ach, was soll’s …«
Ambrosias’ vier Gäste, Ammanius und Sulpicia, Ulf und Wuffa, ruhten auf Liegebetten. Dies war die römische Art, seine Mahlzeiten einzunehmen: im Liegen. Sie befanden sich in einem Raum in den Ruinen der alten principia des Kastells, des ehemaligen Hauptquartiers. Es war eine kleine römische Insel mit Mosaiken auf dem Fußboden, Fresken, Geschirr und Besteck sowie Amphoren, die an den Wänden einer winzigen Küche lehnten. Auf dem Boden häuften sich Schriftrollen und Blöcke aus Holztäfelchen, und an den Wänden standen lauter Schränke. Das ursprüngliche Dach der principia existierte längst nicht mehr, aber dieser eine Teil war mit verrottendem Stroh überdacht.
Alles war abgenutzt und alt, die Tonwaren mehrfach ausgebessert, das Besteck so oft geschärft, dass die Messerklingen dünn wie Herbstblätter waren, und der Raum selbst war ein Loch aus Staub und Ruß.
Ammanius kam rasch auf das Thema Isolde zu sprechen. »Hast du schon einmal von ihr gehört? Falls sie überhaupt je existiert hat …«
»Oh, sie hat existiert«, sagte Ambrosias. »Und ich bin der lebende Beweis dafür!«
»Du?«