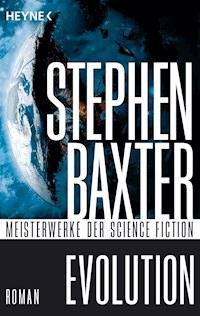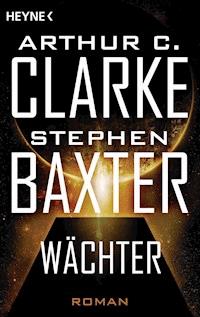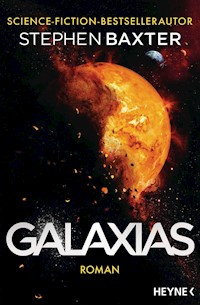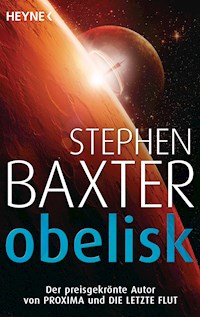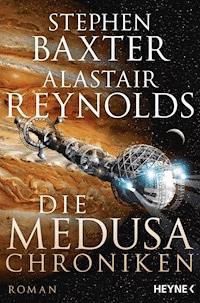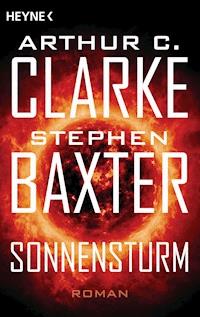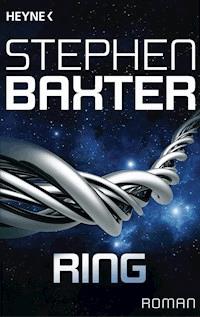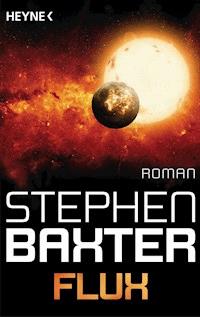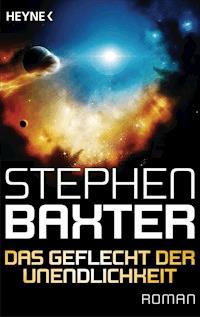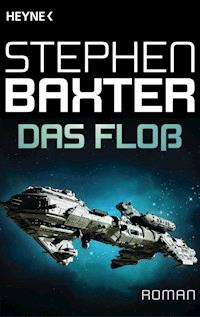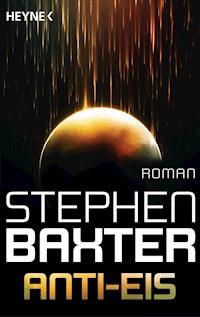13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Vierzehn Jahre sind vergangen, seit die Invasion der Marsianer Englands Städte in Schutt und Asche legte. Vierzehn Jahre, seit die Angreifer vom roten Planeten an den Mikroben der Erde zugrunde gingen. Seitdem herrschen Frieden, Wohlstand und Fortschritt. Als man erneut den Start von Marsraketen beobachtet, macht sich daher keiner Sorgen – bis auf Walter Jenkins. Und er hat recht. Denn die Marsianer kommen zurück. Und sie wollen nur eins: Rache.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 813
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
STEPHEN BAXTER
DAS ENDE
DER MENSCHHEIT
ROMAN
Eine Fortsetzung von
Der Krieg der Welten
von H. G. Wells
Aus dem Englischen übersetzt
von Peter Robert
WILHELM HEYNE VERLAG
MÜNCHEN
Das Buch
Vierzehn Jahre sind vergangen, seit die Marsianer auf der Suche nach neuen Wasser- und Rohstoffquellen zur Erde kamen. Seit sie mit den Hitzestrahlen ihrer dreibeinigen Kampfmaschinen die Städte Englands in Schutt und Asche legten. Und seit sie an den Mikroben der Erde zugrunde gingen. Vierzehn Jahre, in denen nun Wohlstand und Fortschritt in England herrschen – die Gefahr aus dem All ist gebannt.
Nur Walter Jenkins, der einst selbst im Krieg gegen die Marsianer kämpfte und in seinem Bestseller »Die Aufzeichnungen« die Schrecken der Invasion festhielt, traut dem Frieden nicht. Sie werden wiederkommen, davon ist Jenkins überzeugt. Und sie werden aus ihrer Niederlage gelernt haben. Doch niemand glaubt ihm. Er wird belächelt, bemitleidet und als traumatisierter Kriegsveteran abgestempelt.
Aber dann kommt der Tag, an dem die ersten Geschützfeuer am Himmel gesichtet werden. Und diesmal ist nicht nur England betroffen. Berlin, San Francisco, Tokio – die Marsianer landen überall auf der Erde. Das Ende der Menschheit hat begonnen …
Mit Das Ende der Menschheit hat Stephen Baxter eines der modernsten und packendsten Science-Fiction-Epen der Gegenwart geschrieben – und H. G. Wells ein literarisches Denkmal errichtet.
Der Autor
Stephen Baxter, 1957 in Liverpool geboren, studierte Mathematik und Astronomie, bevor er sich ganz dem Schreiben widmete. Er zählt zu den weltweit bedeutendsten Autoren wissenschaftlich orientierter Literatur. Etliche seiner Romane wurden preisgekrönt und zu internationalen Bestsellern. Stephen Baxter lebt und arbeitet im englischen Buckinghamshire.
Mehr über Stephen Baxter und sein Werk erfahren Sie auf:
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Titel der englischen Originalausgabe
The Massacre of Mankind
Deutsche Erstausgabe: 11/2017
Redaktion: Ralf Dürr
Copyright © 2017 by Stephen Baxter
Copyright © 2017 der deutschsprachigen Ausgabe
by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Zitatnachweis Seite 5: H. G. Wells: Der Krieg der Welten,
aus dem Englischen übersetzt von Hans-Ulrich Möhring,
Frankfurt/M. 2017
Umschlaggestaltung: Nele Schütz Design, München,
Jacket design and illustration © blacksheep-uk.com/Orionbooks
Image reference: © Shutterstock
Satz: Christine Roithner Verlagsservice, Breitenaich
ISBN: 978-3-641-20492-1V001
www.diezukunft.de
ZUM GELEIT
»Niemand hätte im ausgehenden neunzehnten Jahrhundert geglaubt, dass das Treiben auf der Erde scharf und genau von Wesen beobachtet wurde, die intelligenter waren als die Menschen und doch nicht minder sterblich; dass die Menschen bei allem, was sie so emsig betrieben, akribisch überwacht und erforscht wurden, vielleicht fast genauso akribisch, wie ein Mensch mit einem Mikroskop die kurzlebigen Kreaturen erforscht, die in einem Tropfen Wasser wimmeln und sich mehren …«
Mit diesen Worten beginnt einer der berühmtesten Romane der Literaturgeschichte: H. G. Wells’ Der Krieg der Welten von 1898. Und so faszinierend er beginnt, so faszinierend geht er auch weiter: Denn die »Wesen«, von denen hier die Rede ist, entpuppen sich als Bewohner des Planeten Mars. Sie haben die Ressourcen ihrer Welt erschöpft und auf der Suche nach einer neuen Nahrungsquelle beschlossen, die Erde zu erobern, um die menschliche Spezies zu Nutztieren zu degradieren. Ihre spektakuläre Ankunft auf der Erde ist der Auftakt zu einem Krieg von wahrhaft planetarem Ausmaß.
H. G. Wells verarbeitete in Der Krieg der Welten sowohl die wissenschaftlichen Spekulationen seiner Zeit über die Beschaffenheit des Mars als auch die Ängste der viktorianischen Epoche vor einem Angriff einer fremden Macht auf Großbritannien. Damit gelang ihm eine beklemmende Antizipation des modernen Krieges, wie er 1914 über Europa hereinbrechen sollte. Gleichzeitig legte er mit dieser damals gänzlich neuartigen Geschichte einer Invasion von einem anderen Planeten nicht nur den Grundstein für eines der erfolgreichsten Genres unserer Zeit, die Science-Fiction, sondern er schuf auch ein Narrativ, das inzwischen zum festen Bestandteil der populären Kultur gehört. Selbst wenn man Der Krieg der Welten nicht gelesen hat, hat man doch die spektakulären Motive und Bilder des Romans vor Augen, die in zahlreichen Filmen und Hörspielen (1938 löste die Hörspiel-Adaption von Orson Welles bekanntermaßen eine Massenpanik aus) immer wieder neu aufbereitet wurden: die dreibeinigen Kampfmaschinen der Marsianer, die mit ihren Hitzestrahlen auf alles schießen, was sich bewegt; Tausende von Menschen, die vor den Invasoren durch eine apokalyptische Landschaft fliehen; der unaufhaltsame Zerfall der menschlichen Zivilisation und der Rückzug der Überlebenden in Keller und entlegene Verstecke; und natürlich das überraschende Ende des Krieges: der Tod der Außerirdischen, verursacht durch einen allzu irdischen Mikroorganismus.
Aber sind die Marsianer am Ende von Der Krieg der Welten tatsächlich besiegt? Wells’ Erzähler schließt seinen Bericht über die Invasion mit einem »bleibenden Gefühl des Zweifels und der Unsicherheit«. Das Leben auf der Erde geht zwar weiter, die Menschen kehren in die Städte zurück, und die zerstörten Kampfmaschinen der Marsianer werden zur Touristenattraktion. Doch nichts kann die Außerirdischen davon abhalten, aus ihrer Niederlage Lehren zu ziehen und eine neue Invasion zu planen – härter und vernichtender als zuvor.
H. G. Wells hat diese Geschichte vom »Zweiten Krieg der Welten« zu seinen Lebzeiten nicht aufgeschrieben, doch sie war in seinem großen Roman DerKrieg der Welten immer angelegt. Denn die von ihm erdachten Wesen – »intelligenter als die Menschen und doch nicht minder sterblich« – werden nicht ruhen, ehe sie nicht ihr Ziel erreicht haben: die vollständige Eroberung des Planeten Erde und ...
DAS ENDE
DER MENSCHHEIT
Für
H. G. WELLS
diese Weiterführung seiner Idee.
Und für die H. G. Wells Society.
»Wenn die Astronomie etwas lehrt, dann, dass der Mensch nur ein Detail in der Entwicklung des Universums ist und dass er unweigerlich damit rechnen muss, in der Vielzahl der Himmelskörper um ihn herum auf ähnliche, wenn auch unterschiedlich geartete Details zu stoßen. Zwar wird er wohl nirgends einen exakten Doppelgänger antreffen, aber er begreift, dass es ihm bestimmt ist, in den Weiten des Weltalls jede Menge Verwandte zu finden.«
Percival Lowell, Mars, 1895
»Mir schien, dass die Menschheit gerade im Begriff stand, zu einem tief greifenden Verständnis ihres Platzes im Kosmos zu gelangen. Die geistige Welt war von Spekulationen und Hoffnungen erfüllt. Dann kamen die Marsianer zurück.«
Walter Jenkins, Aufzeichnungen aus den Kriegengegen die Marsianer, 1913 und 1928
ERSTES BUCH
DIE RÜCKKEHR DER MARSIANER
1
DER RUF
Für diejenigen von uns, die ihn überlebt haben, war der Erste Krieg gegen die Marsianer Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts eine verheerende Katastrophe. Und doch ist dieser Konflikt jenen Wesen, die weitaus intelligenter sind als wir und sogar noch älter als die Marsianer, Wesen, die unsere Welt von den kalten, fernen Regionen des Weltalls aus betrachten, gewiss belanglos und unwürdig erschienen.
Je weiter eine Welt von der Sonne entfernt ist, desto älter und kälter muss sie sein. Folglich ist die Erde älter als die heiße, fruchtbare Venus; und der Mars, karg und frostig, ist wiederum älter als unser wohltemperierter Erdball. Die äußeren Welten, Saturn, Uranus und Neptun, sind dagegen uralt und im Stillstand von Zeit und Eis gefangen. Doch der Jupiter – der König der Planeten, massereicher als alle anderen zusammen, älter als der Mars, so wie dieser älter ist als unsere Welt, und von seinem eigenen inneren Feuer erwärmt – beherbergt ohne Zweifel die größten Intellekte. Wir wissen mittlerweile, dass diese Jovianer uns schon lange beobachten – die Menschheit, die Marsianer, sogar die unschuldige Venus. Was mögen sie wohl von unserem Krieg gehalten haben? Die zarten Funken auf ihrem Flug durch die Nacht, die auflodernden Flammen auf der grünen Haut unseres Planeten, die tintenschwarzen Rauchflecken – die Schwärme der hilflosen Erdenbewohner … Die Jovianer blickten auf all dies wie ein schweigender Gott auf seine fehlerhaften Geschöpfe, mit unvorstellbaren Gedanken und tiefer Missbilligung.
Und doch, behauptet Walter Jenkins, dieser große Chronist des Ersten Krieges, bilde dieser prüfende kosmische Blick den Kontext, in dem wir, die wir uns einst für die Herren der Schöpfung hielten, unser belangloses Leben verbringen müssten. Walter hatte recht. Dieser gewaltige Kontext sollte nicht nur den Zweiten Krieg umfassend prägen, sondern auch den wichtigsten Augenblick meines eigenen Lebens.
Andererseits denke ich wie die meisten Menschen für gewöhnlich nicht über diese Dinge nach, um nicht den Verstand zu verlieren.
Und da wir gerade von einem prüfenden Blick sprechen: Während ich mit diesen meinen eigenen Memoiren beginne, muss ich nolens volens anerkennen, welch langen Schatten jenes Grabmal von einem Buch wirft, das jeder als Die Aufzeichnungen kennt, die Geschichte des Ersten Krieges, niedergeschrieben von Walter, meinem hochgeschätzten Schwager – falls ich ihn nach meiner Scheidung von Frank, seinem Bruder, noch so nennen kann –, ein Werk, das, wie Walters Therapeut Freud vielleicht sagen würde, mit der Intensität eines Hitzestrahls ein bestimmtes Bild des Ersten Krieges gegen die Marsianer ins öffentliche Unterbewusstsein eingebrannt hat. Ich möchte die Leser deshalb von Anfang an warnen: Falls Sie auf die Erhabenheit des Kosmos Wert legen, auf eine Darstellung in der hochfliegenden Prosa eines Mannes, der einst dafür bezahlt wurde, solche Sachen zu schreiben, sollten Sie sich einen anderen Berichterstatter aussuchen. Wenn Sie jedoch eine ehrliche, sachliche Schilderung meiner eigenen Erlebnisse wünschen – einer Frau, die den Ersten Krieg gegen die Marsianer überstand und deren Leben im Zweiten in Stücke gerissen wurde –, dann lege ich Ihnen in aller Bescheidenheit dies hier vor, meine Sicht der Geschichte.
Obwohl es zugegebenermaßen eine Ironie ist, dass meine Erlebnisse im zweiten Konflikt mit einer komplizierten Abfolge von Telephonanrufen von Walter persönlich begannen, lange bevor ein Marsianer wieder einen Fuß auf diese Erde setzte. Die Anrufe kamen aus einem Hospital in Wien. Ich, die ich mir gerade geduldig ein neues Leben in der Neuen Welt aufbaute, wollte eigentlich nichts mit all dem zu tun haben. Aber ich war schon immer ein pflichtbewusster Mensch. Deshalb folgte ich dem Ruf.
Eine Klapsmühle, beim Jupiter! Es war von Anfang an eine verworrene Geschichte.
2
EIN VETERANENTREFFEN
Die erste Ahnung des heraufziehenden Sturms befiel mich in New York, genauer: beim Woolworth Building, wohin mich Major Eric Eden (i. R.) bestellt hatte, um mir, wie er sagte, eine Nachricht von Walter Jenkins zu überbringen.
Mein junger Kollege Harry Kane bestand darauf, mich zu begleiten. Harry gehörte zu jener Sorte dreister amerikanischer Journalisten, denen alles Europäische generell verdächtig ist – eine Einstellung, die er auch schon vor dem Schlieffen-Krieg hatte, denke ich. Harry kam vor allem zur moralischen Unterstützung mit, aber auch aus einer professionellen Neugier in Bezug auf den Krieg gegen die Marsianer, der für ihn nur ein fernes Spektakel seiner Jugend gewesen war.
Also machten wir uns auf den Weg. Es war ein frischer Märztag im Jahr 1920. Manhattan hatte, wie jedermann hoffte, den letzten Schneesturm des Jahres erlebt, obwohl sich als Hauptgefahr an diesem Morgen die Matschhaufen am Rand der Bürgersteige erwiesen, die stets bereit waren, einen unachtsamen Knöchel einzuweichen. Ich erinnere mich an diesen Morgen: das fröhlich-übellaunige Verkehrsgewimmel, die elektrischen Reklametafeln, die im Grau des Tages leuchteten – die pure, unschuldige Vitalität einer jungen Nation –, in jenen letzten Stunden und Minuten, bevor ich wieder in die Angelegenheiten des düsteren, verwundeten alten Englands hineingezerrt wurde.
Schließlich schoben Harry und ich uns durch die Türen ins Woolworth hinein. Die aufgeheizte, von Düften erfüllte Luft in der Eingangshalle traf mich wie ein Schlag ins Gesicht. Zu jener Zeit hatten es die Amerikaner gern sehr warm in ihren Innenräumen. Ich öffnete den Mantel, löste mein Kopftuch, und wir gingen über einen Boden aus poliertem griechischem Marmor, der von geschmolzenem Schnee und Straßenschmutz befleckt war. In der Eingangshalle herrschte reger Betrieb. Harry sagte über den Lärm hinweg mit seinem üblichen Gehabe amüsierter Distanz – ein attraktiver Zug bei einem ein paar Jahre jüngeren Mann, auch wenn es nicht so klingt: »Dein Major Eden kennt sich in der Stadt offenbar nicht so gut aus.«
»Das weißt du schon, ohne ihm jemals begegnet zu sein?«
»Klar doch. Welchen Treffpunkt hätte er sonst wählen sollen? In London würde sich ein Amerikaner bei St. Paul’s verabreden – das ist die Kathedrale mit dem Loch in der Kuppel, stimmt’s? Und ein Brite in New York – nun, hier sind wir, im höchsten Gebäude der Welt!« Er zeigte auf jemanden. »Und da ist er übrigens auch.«
Der Mann, auf den er deutete, stand abseits der Menge. Er war schlank, nicht sehr groß und trug einen Cutaway, der keineswegs billig, im Vergleich zu der pfauenbunten Kleidermode um ihn herum jedoch unansehnlich wirkte. Wenn dies Eden war, sah er jünger aus als seine achtunddreißig – er war sechs Jahre älter als ich.
»Und das muss Eden sein, weil …«
»Weil er der Einzige ist, der sich die Ornamente ansieht.«
Tatsächlich schaute der Mann zur Decke hinauf, die (hatte ich das schon jemals bemerkt?) mit römisch, vielleicht auch byzantinisch aussehenden Mosaiken überzogen war. Typisch für die Amerikaner: In diesem neuen Denkmal für den Triumph des Mammons verspürten sie das Bedürfnis, auf ihre ausrangierte europäische Vergangenheit zurückzugreifen.
Harry setzte sich in Bewegung. »Und könnte er noch mehr wie ein Engländer im Ausland aussehen?«, sagte er leise. »Wenn er sich nicht besser an seine Umgebung anzupassen versteht, ist es kein Wunder, dass ihn die Marsianer erwischt haben.«
Ich prustete los, während ich ihm folgte. »Pst. Du bist schrecklich. Der Mann ist ein Held.« Eric Eden war immerhin der einzige lebende Mensch, der einen funktionstüchtigen marsianischen Zylinder von innen gesehen hatte – ’07 war er schon in den ersten Tagen in Gefangenschaft geraten, als das Militär in seiner Ignoranz die erste Landegrube bei Woking untersucht hatte. Eric, der am Leben erhalten worden war, vielleicht als Versuchskaninchen für spätere Untersuchungen, hatte sich praktisch mit bloßen Händen aus dem Weltraumzylinder herausgekämpft und war letztlich mit unschätzbar wertvollen Informationen über die marsianische Technologie zu seiner Einheit zurückgekehrt.
Held hin oder her, Eric wirkte ziemlich nervös, als wir auf ihn zusteuerten. »Mrs. Jenkins, nehme ich an …«
»Ich ziehe Miss Elphinstone vor. Seit meiner Scheidung.«
»Verzeihung. Sie haben mich vermutlich von den Plakaten in den Fenstern der Buchhandlungen wiedererkannt.«
Harry grinste. »So ungefähr.«
»Es ist eine gut vorbereitete Lesereise. Momentan nur Bert Cook und ich, aber in Boston sollen wir auf den alten Schiaparelli treffen – den Entdecker der Kanäle, Sie wissen schon –, er ist jetzt in den Achtzigern, aber noch immer gut in Form …«
Ich stellte Harry rasch vor. »Wir arbeiten beide für die Post.«
»Ich habe Ihr Buch nicht gelesen, Sir«, gab Harry zu. »Ist nicht so ganz mein Gebiet. Ich kämpfe gegen Tammany Hall, nicht gegen Marsmenschen.«
Eric schaute verblüfft drein, und ich fühlte mich genötigt, zu dolmetschen. »Tammany Hall ist der große politische Apparat der Demokraten in der Stadt. Bei den Amerikanern hat alles gewaltige Dimensionen, auch die Korruption. Und das waren keine Menschen in diesem Zylinder, Harry.«
»Allerdings«, fuhr Harry unbeeindruckt fort, »mische ich selbst auch ein bisschen im Buchgeschäft mit. Mein Genre sind Sensationsromane, aber ich habe ja auch keine heroische Vergangenheit, mit der ich hausieren gehen könnte.«
»Seien Sie froh«, sagte Eric ziemlich leise. Ein Satz, der auf mich wie der Inbegriff britischen Understatements wirkte! »Miss Elphinstone, Walter Jenkins hat mich schon vorgewarnt, dass Sie wahrscheinlich … äh … wenig Neigung verspüren würden, sich erneut in seine Angelegenheiten hineinziehen zu lassen. Nichtsdestotrotz hat Mr. Jenkins mir nachdrücklich klargemacht, wie wichtig seine Nachricht für Sie und den Rest seiner Familie ist. Offenbar hat er die Verbindung zu Ihnen allen verloren. Deshalb musste er wohl auf solch umständliche Weise versuchen, über mich mit Ihnen in Kontakt zu treten.«
»Ach wirklich?« Harry grinste. »Ist das nicht alles ein bisschen meschugge?« Er drehte einen Finger an seiner Schläfe hin und her. »Der Mann muss also mit seiner ehemaligen Gattin sprechen, und das kann er nur, indem er Kontakt zu jemandem auf der anderen Seite der Welt aufnimmt, den er kaum kennt, bei allem Respekt, Sir, in der Hoffnung, dass er mit der ehemaligen Gattin seines Bruders reden kann …«
»So ist Walter nun mal.« Ich verspürte den seltsamen Drang, den Mann zu verteidigen. »Er war schon immer ein bisschen neben der Spur.«
»Und wahrscheinlich nicht erst, seit er wochenlang von Marsianern durchs Land gehetzt wurde«, sagte Eric grimmig.
Harry, jung und selbstbewusst, hatte durchaus Mitgefühl, aber ich sah, dass er es nicht verstand. »Ich wüsste auch nicht, welche Gefälligkeiten Jenkins Ihnen erwiesen hat, Major Eden. Ich habe das Interview mit Ihnen in der Post gelesen. Darin haben Sie ihn angegriffen, weil er behauptet hat, mehr als irgendein anderer Augenzeuge von den Marsianern gesehen zu haben, als diese in England noch frei herumliefen. Wie Sie sagten, Sie haben garantiert Dinge gesehen, die er nie gesehen hat.«
Eric hob höflich die Hand. »Tatsächlich habe ich das nicht gesagt, oder zumindest nicht so. Ihr Reporter hat es in seinem Text etwas aufgebauscht – nun ja, Zeitungen müssen sich verkaufen, nehme ich an. Aber ich finde eher, dass wir Veteranen … zusammenhalten sollten. Und außerdem hat Jenkins mir auf längere Sicht sehr wohl einen Gefallen getan. Man kann nicht leugnen, dass es seine Memoiren sind, die seit ihrem Erscheinen die öffentliche Wahrnehmung des Krieges am stärksten geprägt haben. Und er erwähnt mich, wissen Sie.«
»Ach wirklich?«
»O ja. Erstes Buch, achtes Kapitel. Obwohl er irrtümlich von mir behauptet, ich sei ›als vermisst gemeldet‹. Nur für kurze Zeit!«
Ich schnaubte. »Der Mann steht im Lexikon unter ›unzuverlässiger Erzähler‹.«
»Aber er hat nie etwas über meine Abenteuer erzählt, wie zum Beispiel über die von Bert Cook, sodass ich die Chance hatte, selbst davon zu erzählen – und meine Verleger konnten es als ›bislang unbekannte Geschichte‹ etikettieren.«
Harry lachte. »Letztendlich geht es also bloß ums Geschäft? Dafür habe ich wirklich vollstes Verständnis. Na schön, wie soll’s nun weitergehen, Major Eden? Wollen wir den ganzen Tag hier herumstehen und Fresken anstarren?«
»Eigentlich sind es Mosaiken. Verzeihung. Mr. Jenkins möchte mit Ihnen sprechen, Miss Elphinstone. Ich meine, er möchte Sie anrufen.«
Harry stieß einen Pfiff aus. »Aus Wien? Ein Transatlantikgespräch? Das wird mehr als nur ein paar Pennys kosten. Ich weiß, wir sind alle ganz aus dem Häuschen wegen des neuen Seekabels und so weiter, aber trotzdem …«
Eric lächelte. »Nach meiner Kenntnis mangelt es Mr. Jenkins nicht an Pennys, dank des Erfolgs seines Buches. Ganz zu schweigen von den Erlösen aus den Rechten für die Filmversionen.« Er warf einen raschen Blick auf seine Armbanduhr. »Jedenfalls wird Jenkins in unserer Hotelsuite anrufen – das heißt, in der von Bert und mir. Falls Sie nichts dagegen hätten, mich dorthin zu begleiten …«
»Welches Hotel?«
Eric schaute ein wenig verlegen drein. »Das Plaza.«
Harry lachte schallend.
»Ich selbst wäre ja mit einer bescheideneren Unterkunft zufrieden gewesen, aber Bert Cook …«
»Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen«, sagte ich. »Aber …« Ich schaute Eric in die Augen und erkannte etwas von mir selbst darin – etwas, was ich niemals mit Harry teilen konnte, so gutherzig er war. Den Blick des Kriegsveteranen. »Warum will er anrufen? Könnte es sein, dass sie zurückkommen? Und warum gerade jetzt? Das passt doch zeitlich gar nicht, oder?«
Eric zuckte nur die Achseln, aber er wusste, was ich meinte.
Ich war keine Astronomin, aber seit dem Krieg gegen die Marsianer hatten wir alle etwas vom Tanz der Planeten aufgeschnappt. Der Mars und die Erde jagen einander um die Sonne wie Rennwagen auf der Brooklandsstrecke. Die Erde auf der Innenbahn bewegt sich schneller und überholt den Mars in regelmäßigen Abständen. Und in diesen Momenten des Überholvorgangs, die man als Opposition bezeichnet (weil sich die Sonne und der Mars dann am Erdhimmel gegenüberstehen), kommen sich der Mars und die Erde am nächsten. Aber die Umlaufbahn des Mars ist elliptisch, ebenso wie die der Erde, wenn auch in geringerem Grad – das heißt, sie beschreiben keine perfekten Kreise. Darum variiert ihre Entfernung bei dieser größten Annäherung von einer Begegnung zur anderen, von rund sechzig Millionen Meilen oder mehr bis zu weniger als vierzig Millionen – die allergrößte Annäherung nennt man perihelische Opposition. Auch da gibt es einen Zyklus. Die maximalen perihelischen Annäherungen finden etwa alle fünfzehn Jahre statt: 1894, dann 1909 und erneut 1924 …
»Bis zur nächsten perihelischen Opposition sind es noch vier Jahre«, zitierte ich aus dem Gedächtnis. »Der Angriff von 1907 fand zwei Jahre vor dem letzten Perihel statt. Also kommen sie, wenn überhaupt, frühestens in zwei Jahren. Aber falls sie das Muster durchbrechen und doch schon dieses Jahr kommen, sind sie vielleicht schon unterwegs. Dieses Jahr tritt die Opposition am 21. April ein …«
»Und wie jedes Blatt einschließlich unseres eigenen heraustrompetet hat«, warf Harry ein, »würde das auf ein Startdatum am 27. Februar zurückverweisen: vor ein paar Wochen.«
Weitere grimmige, im Gedächtnis gespeicherte Logik. 1907 war das Oppositionsdatum – der Zeitpunkt der größten Annäherung beider Welten – der 6. Juli gewesen. Die Landungen hatten genau drei Wochen und einen Tag davor begonnen, und die riesigen Geschütze auf dem Mars hatten wiederum vier Wochen und vier Tage davor zum ersten Mal gefeuert.
Aber wir wussten alle: Selbst wenn die Astronomen irgendetwas Unheilvolles auf dem Mars gesehen hatten, so hätte dennoch keiner von uns etwas davon erfahren. Seit dem Krieg gegen die Marsianer hatten die Regierungen einen Mantel des Schweigens über die Arbeit der Astronomen gebreitet. Angeblich sollte das dazu dienen, der Panik während der Oppositionen von 1909, 1911 und 1914 Einhalt zu gebieten, törichtem Alarmgeschrei, das dem Geschäftsklima abträglich gewesen war und so weiter, ohne dass auch nur ein einziger Marsianer aus seinem Zylinder hervorgelugt hätte – aber es hatte zumindest in Großbritannien dazu geführt, dass der Besitz eines nicht angemeldeten astronomischen Teleskops ein Straftatbestand war. Ich konnte die Logik nachvollziehen, aber in meinen Augen führte eine solche Geheimniskrämerei nur zu noch mehr Angst und Unsicherheit.
Es war also möglich, dass die Zylinder jetzt gerade durch den Weltraum schwebten – auf dem Weg zu uns! Warum sonst hätte sich Walter auf diese Weise an uns wenden sollen? Aber Walter war Walter, ein Mensch, der niemals ohne Umschweife zur Sache kam; ich wusste, dass eine Zeit der Ungewissheit vor mir lag, bevor sich diese jähe Anspannung wieder lösen würde.
»Na, dann wollen wir uns mal anhören, was er zu sagen hat«, erklärte ich so tapfer, wie ich konnte. Ich hängte mich bei Eric ein; Harry nahm meinen anderen Arm; und so verließen wir zu dritt die Eingangshalle. »Ich glaube, ein oder zwei Stunden Luxus im Plaza könnte ich aushalten.«
»Und ich«, sagte Harry, »freue mich schon darauf, diesen Cook zu treffen. Wirklich ein schräger Vogel, wenn auch nur die Hälfte von dem stimmt, was er sagt!«
3
EIN ARTILLERIST IN NEW YORK
Wir nahmen ein Taxi zu dem Hotel Ecke 58th Street und 5th Avenue. Wer es nicht weiß: Der Haupteingang liegt zur Grand Army Plaza hin, die früher einmal dem Andenken an die Heldentaten des Unionsheeres im Bürgerkrieg gewidmet war. Seit ’22 sind Denkmäler für einen anderen Konflikt hinzugekommen. Aber zu jener Zeit bot sie einen großartigen Anblick.
Erics Suite war so komfortabel und luxuriös wie erwartet, mit Polstermöbeln und einem grandiosen Ausblick auf die Plaza draußen. Eine Flasche Champagner stand entkorkt auf einem niedrigen Glastisch. Die Luft war von den blechernen Klängen einer Ragtime-Combo erfüllt, die aus einem Radioapparat strömten – nicht aus einem jener kompakten, vom Staat gestellten Volksempfänger, die allseits unter dem Namen »Marvins Megaphon« bekannt waren und die man damals in jedem britischen Haushalt gefunden hätte, sondern aus einem großen, klobigen amerikanischen Gerät in einem Walnussholzschrank.
Und in dieser Szenerie lümmelte Albert Cook auf einem Sofa und blätterte müßig in der Farbbeilage einer Zeitschrift. Bei meinen ersten Aufenthalten in amerikanischen Hotels war ich geradezu überwältigt gewesen von solchen Annehmlichkeiten wie einem eigenen Bad, einem Zimmertelephon und Cerealien zum Frühstück. Aber Cook schien sich bei all dem ganz in seinem Element zu fühlen.
Cook war ein wenig älter als Eric, vielleicht vierzig Jahre alt; er hatte ordentlich geschnittenes schwarzes, von grauen Strähnen durchzogenes Haar und eine bläuliche Narbe in der unteren Gesichtshälfte (später kamen mir allerdings Gerüchte zu Ohren, er schminke sie der Wirkung halber nach). Und während von Erics Werk nichts zu sehen war außer einem einzelnen, ziemlich ramponierten Leseexemplar des Buches auf einer Anrichte, wurde der Raum von einem Plakat auf einem Ständer beherrscht: eine Photographie von Cook in zerrissener Uniform, eine Art Knüppel schwingend, mit der Aufschrift:
MEMOIREN EINES ARTILLERISTEN
Eric machte uns rasch miteinander bekannt. Cook stand nicht auf. Er bedachte Harry mit einem Grunzlaut und musterte mich von oben bis unten, offenbar enttäuscht, eine schicklich mit einem Hosenanzug bekleidete Frau vor sich zu sehen. Was mich betrifft, so war der Blick, den ich ihm zuwarf, hoffentlich vernichtend. Nach dem Ersten Krieg hatte ich beschlossen, auf jegliche Kleidung zu verzichten, in der ich nicht bequem Fahrrad fahren konnte, und ich mochte auch die aufgehübschten modischen Anzüge nicht, sondern die robusten Versionen, die die Munitionettes und andere trugen, ob es Cook nun gefiel oder nicht.
Er wandte sich wieder seiner Zeitschrift zu. »Also, noch eine halbe Stunde bis zu diesem verdammten Anruf, Eric?«
Eric nahm die Champagnerflasche aus dem Sektkühler; sie war nur noch zu einem Drittel gefüllt. Er warf mir einen entschuldigenden Blick zu. »Wenn Sie möchten, dass ich noch welchen bestelle …«
Harry und ich lehnten beide ab.
»Bitte setzen Sie sich, geben Sie mir Ihre Mäntel …«
»Und lassen Sie sich von mir nicht stören«, sagte Cook träge. »Ich verschwinde, sobald der Prof aus seiner Ballaballaburg im Ausland anruft. Ich habe dem nichts zu sagen. Ich habe ihm schon seit Putney nichts mehr zu sagen, als er meinen Schnaps getrunken, mich im Schach besiegt und sich verdrückt hat, bevor die Arbeit losging.«
Harry lachte. »Wir haben das Buch alle gelesen, Mann. Welche Arbeit? Sie hatten ja noch gar nicht richtig angefangen, diesen großartigen Tunnelbau- und Sabotageplan, von dem Sie da geträumt haben, in die Tat umzusetzen …«
»So erzählt er das. Dieser aufgeblasene Akademikerschnösel. Ich hätte ihn verklagen sollen.«
»So, wie Sie wohl auch Charlie Chaplin verklagen werden.«
Cook machte ein finsteres Gesicht, denn das war ein wohlbekannter wunder Punkt bei ihm. Chaplin verdankte seinen Ruhm als Filmstar großenteils dem Erfolg einer Figur, dem »kleinen Soldaten«, ein komischer, gutherziger Kanonier mit schlecht sitzender Uniform, der ständig davon träumte, ein General zu sein, während seine Geschütze in Wolken von rußigem Rauch explodierten. Man hätte weitaus dickere Haut haben müssen als Albert Cook, um nicht zu erkennen, woher das stammte. Aber Cook war schließlich bloß Kutscher gewesen.
Im Versuch, Harrys mangelndes Taktgefühl zu überdecken, warf ich rasch ein: »Ich bezweifle, dass auch nur einer von uns in Walters Buch gut weggekommen ist. Ich habe es jedenfalls nie ganz verwunden, wie er mich der Welt vorgestellt hat.« Die Worte, mit denen Walter geschildert hatte, wie sein Bruder meiner Schwägerin und mir auf unserer Flucht vor den Marsianern geholfen hatte, Räuber abzuwehren, waren in meine Seele eingebrannt. »›Zum zweiten Mal an diesem Tag legte das Mädchen ein Probe seiner Unerschrockenheit ab.‹ Das Mädchen! Und so weiter. Ich hätte von den Suffragetten ausgestoßen werden können, bevor sie verboten wurden.«
Aber Cook hörte nicht zu, eine Eigenschaft, die, wie ich noch feststellen sollte, typisch für ihn war. »Hätte ihn verklagen sollen, egal, was die Anwälte sagen.«
Eric schüttelte den Kopf. »Seien Sie kein Narr. Er hat Sie zum Helden gemacht! Ungewollt, das gebe ich zu. Ich habe Sie vor Publikum sprechen sehen – Sie wissen, wie die Leute auf Details reagieren –, wie Sie, als die Meute vor den Marsianern floh, ganz allein auf sie zugerannt sind, weil Sie dachten, dass es dort noch etwas zu essen gäbe …«
Ich erinnerte mich natürlich an diesen Passus. »›Wie der Spatz zu den Menschen.‹«
»Ja, so bin ich.« Bert sah mich jetzt an, als wollte er Eindruck schinden. »Obwohl ich kein Spatz bin. Ich habe gründlich nachgedacht, verstehen Sie. Wie damals, so auch jetzt. Und heute will er aus heiterem Himmel ein bisschen mit Ihnen plaudern, hm? Und worüber möchte er reden? Wie es für ihn ist, von Sigmund Freud täglich einen Einlauf verpasst zu kriegen, weil er seit 1907 Muffensausen hat?« Sein Blick wurde aufmerksamer. »Oder geht’s um den Mars? Bald kommt es zu einer weiteren Opposition, das weiß jeder. Was ist – weiß er irgendwas? Ich nehme an, er ist in der Lage, solche Dinge rauszufinden.«
Ich wandte mich Cook zu. »Sie verabscheuen ihn, weil er gebildet und belesen ist und weil Sie sein Verhalten als Schwäche auslegen, und trotzdem wollen Sie die Informationen, die er besitzt?«
»Wenn es darum geht, dass die Marsianer es noch mal probieren, habe dann nicht gerade ich das Recht, es zu erfahren? Gerade ich? Hm?« Er stand ein wenig unsicher auf, packte die Champagnerflasche am Hals und trottete zu einer Tür. »Die Show geht … wann los, Eden?«
»Um sechs. Ein Buchladen auf dem Broadway, der …«
Cook rülpste laut und zwinkerte mir lüstern zu. »Und hinterher werden wir ja sehen, was Sache ist – hm? Jede Menge gesunder, junger Amerikanerinnen, die sich zu einem ausgewiesenen Überlebenskünstler wie mir hingezogen fühlen – tja, nur die Stärksten überleben, hm? ›Wie der Spatz zu den Menschen.‹ Ha!«
Ich glaube, wir waren alle erleichtert, als er die Tür hinter sich schloss.
Dann folgte eine Verlegenheitspause, während wir auf Walters Anruf warteten. Wir gestatteten Eric, Kaffee für uns zu bestellen, der mit einem Haufen zuckriger Kekse auf einem Tablett kam.
»Also, Miss Elphinstone – Julie.«
»Ja, Major, so heiße ich.«
»Kurzform für Julia? Juliet?«
Harry schnaubte.
»Kurzform für gar nichts. Mein Taufname ist Julie. Ich bin ’88 geboren. In diesem Jahr lief Strindbergs ›Fräulein Julie‹ in allen Theatern, und meine Mutter war begeistert davon.«
Er nickte. »Dann waren Sie ’07, als die Marsianer kamen, neunzehn Jahre alt.«
Ich zuckte die Achseln. »Ich war erwachsen.«
»Ich war selber erst fünfundzwanzig. Man hatte mich zu früh in einen zu hohen Rang befördert, um die Wahrheit zu sagen. Viele meiner Männer waren älter als ich. In der Army folgen sie ihren Sergeants, nicht ihren Offizieren. Ist vielleicht auch am besten so. Aber im Schlieffen-Krieg hat es weitaus jüngere Rekruten gegeben. Sie wurden von den Russen und auch von den Deutschen einberufen, als die Kämpfe sich in die Länge zogen.«
Ich fragte mich, woher er das wusste. Es hatte immer Gerüchte über britische »Berater« an der Seite der Deutschen auf den großen Schlachtfeldern im Osten gegeben, die dort neue Taktiken und Waffen ausprobierten – von denen einige, dunklen Andeutungen zufolge, auf erbeuteter marsianischer Technologie beruhten.
»Es war gut, dass wir uns da rausgehalten haben«, fuhr Eric fort. »Eine schnelle K.-o.-Niederlage für die Franzosen.« Er mimte eine Links-rechts-Kombination. »In der Schule war ich ein ziemlich guter Boxer. Bin natürlich nicht dabeigeblieben …«
Harry brach in Gelächter aus, dann entschuldigte er sich rasch.
Schließlich klingelte zu unserer allgemeinen Erleichterung das Telephon.
Harry und ich ließen Eric mit der Kette der Telephonistinnen sprechen, von der hoteleigenen Telephonzentrale über die neuen transozeanischen Vermittlungen bis zu den Wienerinnen mit ihrem »starken deutschen Akzent, aber wunderschöner Artikulation«, wie Eric sich ausdrückte. Endlich reichte er mir den Hörer.
Zu meiner Überraschung hörte ich nicht Walter, sondern eine andere englische Stimme, kräftig und kultiviert.
»Mrs. Jenkins?«
»Ich ziehe Miss Elphinstone vor.«
»Äh … ja, jetzt sehe ich es, da ist eine Anmerkung in der Akte Ihres Schwagers. Ich bitte um Verzeihung. So eine ungeheuer lange Verbindung und dann unterläuft mir gleich zu Beginn ein derartiger Fauxpas!«
»Mit wem spreche ich? Wo ist Walter?«
»Ich muss mich nochmals entschuldigen. Mein Name ist Charles Samuel Myers. Ich bin einer der Spezialisten, die Mr. Jenkins in den letzten Jahren wegen seiner Neurasthenie behandelt haben.«
Ich runzelte die Stirn. »Neurasthenie?«
Eric Eden schnitt eine Grimasse. »Die einfachen Soldaten, die den Marsianern gegenüberstanden – sie nannten es Hitzschlag. Oder Hitzekoller, sagt Bert. Oder Schwitzerei …«
Harry drehte erneut einen Finger an seiner Schläfe hin und her. »Du sprichst mit einem Irrenarzt, Julie!«
4
EIN UNZUVERLÄSSIGER ERZÄHLER
Hitzschlag. Hitzekoller. Schwitzerei. Grässlicher Soldatenjargon für ein noch grässlicheres Leiden.
Später sollte ich erfahren, dass mein Schwager solche Begriffe in einem Militärhospital im Craiglockhart-Komplex nahe Edinburgh kennengelernt hatte, wohin er im Herbst 1916, ganze neun Jahre nach dem Krieg, zu seiner ersten Konsultation bei Dr. Myers verlegt worden war.
In einem staubigen Sprechzimmer, das früher einmal ein Rauchsalon gewesen sein mochte, hatte Myers mit einer Reihe von Büchern gesessen, die für Walter wie Exponate wirkten: lauter Erinnerungen an den Krieg gegen die Marsianer, darunter Walters eigene sowie der erste von Bert Cooks selbstverliebten Schmökern. Auf dem Schreibtisch häuften sich jedoch auch meist auf Deutsch verfasste Aufzeichnungen aus einem anderen Konflikt: Berichte von der Ostfront des noch immer nicht beendeten Schlieffen-Krieges.
»Hitzschlag«, sagte Myers. »Ein Wort, das nach unserem Krieg gegen die Marsianer geprägt wurde. Aber das Leiden war vorher schon andeutungsweise identifiziert worden; britische Militärärzte berichteten von den Nachwirkungen des Geschützfeuers im Zweiten Burenkrieg auf die Männer. Noch früher war es aus dem amerikanischen Bürgerkrieg bekannt. Und seit ’14 haben sich die Deutschen im Osten und deren russische Feinde natürlich ihre eigenen Bezeichnungen ausgedacht. Geschützfurcht. Kanonenangst. Granatschock. Ich selbst habe das Phänomen als Erster in einer Publikation mit von Fachkollegen geprüften Beiträgen erwähnt, dem Lancet.«
»Gratuliere«, sagte Walter nervös. Zu jenem Zeitpunkt war er fünfzig Jahre alt und fühlte sich, wie er selber eingestand, seit dem Krieg nicht mehr stark und robust. Stattdessen litt er noch immer unter seinen Brandwunden, vor allem unter denen an seinen Händen. Nun hatte er bereits das Gefühl, in der Falle zu sitzen, wie er mir später erzählte. »Ich verstehe nicht, was das mit mir zu tun hat.«
»Aber das habe ich Ihnen doch erklärt«, sagte Myers geduldig. »Ich glaube, dass die Geschützfurcht der Deutschen, psychologisch gesehen, ein ähnliches Phänomen ist wie Cooks Schwitzerei. Und was es mit Ihnen zu tun hat, Sir, ist der Inhalt Ihrer Memoiren.«
Walter warf verächtlich den Kopf zurück. »Ich habe viel Kritik wegen meiner ›Unzuverlässigkeit‹ einstecken müssen, wie Parrinder es genannt hat. Dabei sollte das Buch eine ehrliche Darstellung meiner Kriegserlebnisse und meiner seitherigen Überlegungen sein, denn ich glaube, ich war in einer einzigartigen …«
»Ja, ja«, schnitt Myers ihm das Wort ab, »aber das wirklich Einzigartige daran ist, Mann, dass Sie im Gegensatz zu den Verfassern einiger anderer Darstellungen des Krieges, die man so gelesen hat – Churchills Heldengeschichten von den Jungs, die in jeder Situation Haltung bewahren, oder die Selbstheroisierung von Leuten wie Albert Cook –, einen überaus ehrlichen Bericht über Ihre eigenen seelischen Gebrechen vorgelegt haben. Sehen Sie das nicht? Gebrechen, an denen Sie in gewissem Maße schon vor Ihren Kriegserlebnissen gelitten haben. Und auch nach den Kämpfen hatten Sie eindeutig Probleme: Ihre Ehe ist zerbrochen …«
»Ich gebe zu, dass mir meine Kriegserlebnisse arg zu schaffen gemacht haben. Kein halbwegs intelligenter und empfindsamer Mensch dürfte von solchen Narben verschont geblieben sein. Aber – eine psychologische Störung davor? Das kann ich nicht akzeptieren, Doktor.«
»Aber es steht alles hier drin. In Ihren eigenen Worten. Erstes Buch, siebtes Kapitel. ›Vielleicht bin ich jemand, der ungewöhnlichen Stimmungen unterliegt.‹ Ja! Die Ihren sind in der Tat ungewöhnlich. Sie beschreiben ein Gefühl der Distanz zur Welt, ja sogar zu sich selbst, als wären Sie ein außenstehender Beobachter … Vor dem Krieg haben Sie Ihr Leben mit Träumen von Utopien verbracht, nicht wahr? Von der Verbesserungsfähigkeit einer wie von außen betrachteten Welt und einer Menschheit, der Sie sich schon damals nur marginal zugehörig fühlten.
Doch als die Marsianer kamen – schauen Sie sich Ihre eigene Darstellung Ihrer Reaktion auf den Krieg an, von Anfang an. Sie sagen, Sie seien voller Panik von jener ersten marsianischen Grube auf dem Horsell Common weggelaufen, aber dann haben Sie im Handumdrehen Ihr inneres Gleichgewicht wiedergefunden.« Er schnippte mit Fingern und Daumen. »Im Handumdrehen! Sie haben eine eigentümliche Mischung aus Neugier und Angst an den Tag gelegt; Sie wurden von Furcht verzehrt, und doch konnten Sie dem Spektakel, dem Rätsel … dem Neuen nicht fernbleiben. Einmal schildern Sie sogar, wie Sie einen marsianischen Landeplatz in konstantem Abstand umrunden – wie haben Sie’s ausgedrückt, ›in einem weiten Bogen‹? Ha! Ein Kreis, eine Ortslinie, erzeugt von zwei in völligem Gleichgewicht befindlichen Kräften, die in Ihnen im Widerstreit lagen: Neugier und Furcht. Und was Ihre Distanz zur Menschheit betrifft, so konnten Sie ganz schön rücksichtslos sein, nicht wahr? Um Ihre Frau zu retten, nahmen Sie das Jagdgig eines, eines …«
»Eines örtlichen Gastwirts.«
»Ja! Sie haben den Mann, der zu diesem Zeitpunkt weniger über die Lage wusste als Sie, sterben lassen. Sie haben seine Leiche gesehen, stimmt’s? Und später haben Sie eigenhändig getötet, nicht wahr? Den Geistlichen, den Kuraten, wie Sie ihn nannten – haben Sie sich je die Mühe gemacht, in Erfahrung zu bringen, wie er hieß und welches Amt er bekleidete? Sein Name war Nathaniel …«
»Dieses Wissen ist für mich ohne Bedeutung! Und ich glaube, dass ich, was diese … Tat im Verlauf einer dunklen Nacht der Seele auf dem Höhepunkt des Krieges betrifft, meinen Frieden geschlossen habe.«
»Ihren Frieden geschlossen? Mit wem? Mit Gott? Ihnen selbst? Dem Kuraten? Selbst diese ›Dunkle Nacht‹-Metapher stammt von einem mittelalterlichen Mystiker. Die Wahrheit ist, Sie haben Gott angerufen, obwohl Sie einmal ein komplettes Buch darauf verwendet haben, seine Existenz zu widerlegen!«
Walters Nervosität wuchs. »Dennoch bin ich im riesigen, verwesenden Kadaver dieser uralten Religion aufgewachsen. Ich musste mich sogar konfirmieren lassen, um meine erste Stellung als Lehrer zu bekommen. Und wenn man mit dem Unvorstellbaren konfrontiert ist, mit Dingen jenseits bekannter Kategorien, greift man vielleicht nach den Insignien vertrauter Mythen …«
»War Mord für Sie unvorstellbar, bevor Sie einen begingen? Sie werden vermutlich sagen, die Marsianer hätten Sie dazu getrieben.«
»Mich dazu getrieben, ja, so ist es. Ich habe ihn schließlich nicht vorsätzlich begangen.«
»Wirklich nicht? Sind Sie sicher? Denken Sie daran, Sie sind ein Mensch, der immer ein wenig über den Dingen steht – und manchmal auch ganz den Kontakt zur Realität verliert.«
»Wovon reden Sie?«
»Ich beziehe mich auf die späteren Passagen Ihres Buches. Sie beschreiben den gewaltigen existenziellen Schock der von den Marsianern und ihren Waffen angerichteten Zerstörungen in der englischen Landschaft: ›eine Ahnung, entthront zu sein‹, so haben Sie’s formuliert, glaube ich. Na gut. Aber am Ende des Krieges – als Sie eingestandenermaßen nicht als Erster entdeckten, dass die Marsianer den Seuchen zum Opfer gefallen waren –, da hatten Sie einen dreitägigen Aussetzer, Mann! Die klassische Fugue. Und später – Sie haben dieses Buch im Jahr ’13 geschrieben, sechs Jahre nach Kriegsende – schildern Sie Visionen und Erinnerungen, die Sie selbst zu dieser Zeit noch befallen. Lebendige Menschen kommen Ihnen wie Geister der Vergangenheit vor – ›Phantasmen in einer toten Stadt‹. Und so weiter und so fort.« Er sah Walter mit größerem Mitgefühl an. »Ihre Ehe ist zerbrochen, Jenkins. Was meinen Sie, woran das liegt?«
Das traf Walter bis ins Mark. »Aber ich habe einen großen Teil des Krieges damit verbracht, nach meiner Frau zu suchen.«
»Das behaupten Sie.« Er tippte auf die Memoiren. »Das behaupten Sie hier drin. Aber – schauen Sie sich an, was Sie getan haben! Sie sind nach Weybridge und London gegangen, aber nicht nach Leatherhead, wo Ihre Frau Zuflucht gesucht hatte: nach Norden zu den Marsianern, nicht nach Süden zu Ihrer Familie. Das ist es, was Sie getan haben.«
»Aber die Marsianer – es gab Hindernisse. Der dritte Zylinder war bei Pyrford niedergegangen, zwischen Woking und Leatherhead, und ich …«
»Ach, kommen Sie, deshalb wäre doch kein Umweg über die Londoner Innenstadt nötig gewesen! Und ist Ihnen bewusst, dass Sie Ihre Frau in diesem Buch nie beim Namen nennen? Kein einziges Mal?«
»Mich selbst doch auch nicht. Ebenso wenig wie meinen Bruder. Oder Cook, den Artilleristen. Das war ein Stilmittel, mit dem …«
»Ein Stilmittel? Sie nennen den Hofastronomen beim Namen, Mann. Sogar den Lordoberrichter! Aber nicht Ihre Frau! Was denken Sie wohl, wie sie das fand? Und sind Ihre Haare nicht ergraut? Binnen weniger Tage, während des Krieges.«
»Aber … aber …«
»Es könnte kaum ein auffälligeres Zeichen körperlichen und seelischen Leidens geben.« Myers lehnte sich zurück. »Ich behaupte, Sir – und das habe ich auch schon in meiner Abhandlung für den Lancet geschrieben –, dass Sie an einer Form der Neurasthenie leiden: der Schwitzerei, dem Hitzschlag, der Geschützfurcht. Zu den Symptomen gehören Ticks, Mutismus, Lähmungserscheinungen, Albträume, Tremores, Lärmempfindlichkeit, Fugue, Halluzinationen. Kommt Ihnen das bekannt vor? Was Sie von dem normalen Soldaten der Ostfront unterscheidet, ist Ihre Zungenfertigkeit, Ihre Intelligenz, Ihre Selbstwahrnehmung – ja sogar Ihr höheres Alter. In Verbindung mit Ihrem Bericht macht Sie das zu einem faszinierenden Referenzpunkt. Unsere eigene Regierung, Sir, insbesondere die Militärbehörden …«
»Ha! Wo ist denn da der Unterschied unter unserem gepriesenen Ministerpräsidenten Marvin?«
»… haben mich darin bestärkt, Sie behandeln zu lassen. In diesem Krankenhaus hier wie auch in anderen in Deutschland, wo man die Geschützfurcht erforscht. Sind Sie bereit, an meiner Studie teilzunehmen? Die Behandlung sollte Ihnen zuträglich sein und könnte zum Wohl der Allgemeinheit dienen: der wirksameren Behandlung traumatisierter Soldaten aller Nationalitäten.«
»Habe ich denn eine Wahl?«
»Aber das«, erklärte mir Walter, seine Stimme ein Flüstern, durchsetzt vom Knacken und Knistern der langen, dünnen Drähte, die uns verbanden, »war die einzige Frage, die er nicht beantworten wollte. Wohl auch nicht beantworten konnte, denn Myers hielt sich für einen anständigen Menschen. Natürlich hatte ich keine Wahl.«
Ich sah Harry an, der zusammen mit Eric Eden zuhörte, die Köpfe am Hörer des zweiten Telephons im Raum aneinandergelegt, und verdrehte die Augen. Ich wusste nicht recht, was ich sagen sollte. Trotz Myers’ Bemühungen, uns vorzubereiten, war das Gespräch, als wir schließlich zu Walter selbst durchgestellt wurden, verwirrend gewesen.
»Walter«, versuchte ich es, »ich würde diesen Quatsch mit Carolyne nicht allzu ernst nehmen. Also, ich habe mich von Frank getrennt, weißt du noch? Und der hat nicht mal ein Buch geschrieben!«
»Ja, aber ich glaube, mein Bruder hat mehr von mir, als ihm guttut. Eine Zielstrebigkeit, die ihn manchmal seine Menschlichkeit vergessen lässt, ja sogar seine nächsten Angehörigen …«
»Und die Behandlung? Wie war sie?«
1916 waren die Deutschen, mitten in ihrem europäischen Eroberungsfeldzug, zwangsläufig Pioniere bei der Behandlung dieser Krankheit gewesen, der »Geschützfurcht«, wie sie sie nannten. Aber ihre Einstellung dazu war von ihrer eigenen Kultur geprägt. Die Furcht, niedergestreckt zu werden, war unehrenhaft und schändlich. Darum bestand ihr Behandlungsprogramm, die sogenannte »Kaufmann-Methode«, aus psychologischem Druck und – für mich unglaublich – der Zufügung von Schmerzen.
»Ich wurde einem Arzt namens Yealland überstellt, einem Briten, aber auch Kaufmann-Anhänger, der eine Technik namens Faradisation anwandte. Der Einsatz von Elektrizität zur direkten Bekämpfung von Symptomen. Wenn man beispielsweise die Sprache verloren hatte, kam man in einen verschlossenen Raum, damit man nicht weglaufen konnte, man wurde auf einen Stuhl geschnallt, und dann wurden Zunge und Kehlkopf unter Strom gesetzt, bis man schließlich doch sprach.«
»Lieber Gott. Und das funktioniert?«
»Ja! Sie sagen, die Genesungsquote sei ›mirakulös‹. Allerdings verschweigen sie, dass die Rückfallquote noch höher ist.«
»Und in deinem Fall …«
»Yealland hat versucht, die unerwünschten Erinnerungen zu ›behandeln‹. Du weißt bestimmt noch, dass ich während des Krieges schlimme Verbrennungen davongetragen habe, besonders an den Händen. Und manchmal, wenn ich Albträume habe, in denen ich eingesperrt bin oder fliehe, oder wenn ich die Geister der Vergangenheit in den heutigen Londoner Straßen sehe, tun meine alten Wunden weh, wie aus Mitgefühl. Yealland hat mir absichtlich Schmerzen in dieser verletzten Haut zugefügt, um die Verbindung zwischen den Erinnerungen und dem physischen Schmerz zu trennen, so wie er es sah, und dadurch die Auswirkungen Ersterer auf mich zu verringern.«
»Und das Ergebnis …«
Er sagte nur: »Nach ein paar Sitzungen habe ich beschlossen, die Behandlung abzubrechen.«
»Gut gemacht, alter Knabe«, meinte Eric mitfühlend.
»Ich würde eher eine Brunnenkur empfehlen«, sagte Walter trocken.
Danach hatten Myers und ein Kollege namens William Rivers, die, skeptisch gegenüber der »Faradisation« und ähnlichen Techniken, Anhänger von Freud und dessen Schule geworden waren, Walter wieder zurückgebracht.
»Jetzt befinde ich mich in der weitaus angenehmeren Umgebung von Wien, und statt mit Stromstößen werde ich von Freud und seinen Anhängern mit Wortschwällen traktiert. Wir reden und reden, und die Ärzte versuchen dabei zu verstehen, welche Verbindungen zwischen einem Trauma, das tief in einer verletzten Seele sitzt, und dem äußeren Verhalten bestehen. Ich denke, da ist durchaus was dran – aber ich bin wie die britischen Ärzte auch skeptisch, was Freuds Behauptung betrifft, jeder menschliche Impuls sei im Grunde sexueller Natur. Die Marsianer sind schließlich ein Gegenbeispiel! Wie wir wissen, gibt es bei den Marsianern überhaupt keinen Sex – wir haben konkrete Beweise dafür, dass sie sich asexuell fortpflanzen –, was nützt die Freudsche Analyse also einem Marsianer? Und doch sind sie mit Bewusstsein begabte Wesen, sie verfügen offenkundig über Motivation …«
Ich sah meine Gefährten an und verdrehte die Augen; ich fand, wir sollten allmählich zum Thema kommen. »Jetzt vergiss mal die Marsianer, Walter. Tut mir leid, von deinen Problemen zu hören. Ich fühle wirklich mit dir. Du weißt wahrscheinlich, dass ich Großbritannien nach den Wahlen im Jahr ’11 verlassen habe, als Marvin und seine großspurigen Gorillas an die Macht kamen – und Soldaten in Khaki hinter King Georges Krönungskutsche hermarschierten … denen möchte ich nicht in die Hände fallen, so wie es dir ergangen ist … Aber du hast mich doch aus einem bestimmten Grund angerufen.«
»Ich wollte unbedingt Kontakt aufnehmen. Nicht nur mit dir, sondern auch mit Frank und Carolyne … Mir ist kein anderer Weg eingefallen als durch dich, Julie. Ich konnte dich in New York nicht aufspüren, deshalb habe ich Major Eden gebeten, dir eine persönliche Nachricht zu überbringen. Hoffentlich wirst du’s verstehen. Du warst schon immer …«
»Ein unerschrockenes Mädchen, wie du in deinen Memoiren geschrieben hast?«
»Tut mir leid! Hör zu – ich schlage vor, dass du nach England zurückkehrst. Noch ist Zeit. Nimm einen Dampfer – ich verfüge über die erforderlichen finanziellen Mittel. Hol die Familie zusammen, dann rufe ich noch einmal an. Vielleicht in der Nähe von Woking – das Haus, in dem ich mit Carolyne gewohnt habe, ist längst verkauft, aber …«
»Was ist los, Walter? Sag mir irgendwas.«
So begann für mich eine außergewöhnliche Reise, die mich von der Eingangshalle des höchsten Gebäudes in New York zum Fuß einer marsianischen Kampfmaschine in London führte. Und noch viel weiter.
Aber zu diesem Zeitpunkt sagte er nur: »Ich habe schlimme Nachrichten vom Himmel.«
5
MEINE RÜCKKEHR NACH ENGLAND
Als ich mich nach einer Passage umsah, stellte ich fest, dass die Lusitania sich gerade zur Überfahrt bereit machte. Warum also nicht stilvoll reisen, mit Walters Geld im Hintergrund? Ich brauchte nicht lange, um Tickets für mich, Eric Eden und Albert Cook zu besorgen, die nach Walters dunklen Andeutungen beide beschlossen, ihre Lesereise in den Staaten abzubrechen (mit einer Entschuldigung an Professor Schiaparelli). Ihr ganzes Leben war vom Krieg gegen die Marsianer geprägt; natürlich würden sie mitkommen.
Nicht, dass ich darauf aus gewesen wäre, die Reise zu diesem Zeitpunkt zu unternehmen. Und mein tapferer Held Harry Kane war es noch weniger. »Als Amerikaner sollte man derzeit nicht in England sein«, erklärte er mir. »Es heißt, wenn man dort den Mund aufmacht und wie ein Yankee spricht, bläst einem irgendein Cop gleich den Marsch. Und inzwischen lassen sie deutsche Soldaten beim Buckingham-Palast Wache stehen. Was soll das?«
»So ist das nun mal mit der Politik.«
Er grunzte. »In meinen Augen sind die Marsianer schuld. Weißt du, auf dieser Seite des Teichs hat euer Krieg damals zwar einiges Aufsehen erregt, es gab hier mehrmals falschen Alarm, Ausbrüche von Panik und dergleichen – aber als alles vorbei war, tja, da war er wie eine ferne Naturkatastrophe, ein Vulkan, der in Yorkshire oder sonst wo seine Kuppe abgesprengt hat.«
»Weißt du überhaupt, wo Yorkshire ist?«
»Der nächste Selbstmörder, der von der Brooklyn Bridge sprang, hat euch schon von den Titelseiten verdrängt. Und euer Krieg hat den deutschen Kaiser nicht davon abgehalten, seine Zinnsoldaten über die gesamte Landkarte Europas marschieren zu lassen, nicht wahr? Aber was euch Briten betrifft – manchmal könnte man meinen, ihr wärt nie drüber weggekommen.«
Ich musste nicken. »Verblüffend scharfsichtig. Du willst dich also von meinem Schwager nicht zu einer Woche auf einem Kreuzfahrtschiff einladen lassen?«
»Ein andermal, Süße.«
Wir sagten uns flüchtig Lebewohl – aber wie sich herausstellte, sollte es sehr lange dauern, bis ich Harry Kane wiedersah.
Zwei Tage nach Walters Anruf war es Zeit zum Aufbruch. Ich brauchte nicht lange, um zu packen. Ich bin immer mit leichtem Gepäck gereist seit jenem schrecklichen Morgen im Juni ’07, als ich bei meinem Bruder George und seiner Frau Alice in Stanmore zu Besuch war und er, ein Chirurg, mit einem Haufen Neuigkeiten über das Vorrücken der Marsianer von einem Hausbesuch in Pinner zurückkam. Er packte uns in eine Chaise und versprach uns, beim Bahnhof von Edgware zu uns zu stoßen, nachdem er die Nachbarn geweckt hatte. Es war ein ziemliches Abenteuer für uns, das Walter aus zweiter Hand, aber einigermaßen akkurat in seinen Aufzeichnungen wiedergegeben hat – denn wir stießen auf seinen Bruder, meinen zukünftigen Gatten Frank, und gerieten infolgedessen ins Blickfeld der Öffentlichkeit. Aber es ist typisch für Walters Nachlässigkeit im Umgang mit den menschlichen Details, dass er sich nicht die Mühe machte, diesen Teil seiner Geschichte mit einem Bericht über den Verlust von George Elphinstone, meinem Bruder, zu vervollständigen, den wir nie wiedersahen.
Ich traf mich mit Cook und Eric am Kai. Die RMS Lusitania war ein schwimmendes Hotel mit elektrischen Fahrstühlen und Telephon in jeder Kabine. Der »Greyhound des Meeres« würde uns geschwind über den Ozean tragen; wir sollten schon in weniger als sechs Tagen anlegen. Zur damaligen Zeit gab es natürlich keinen schnelleren Weg; die riesigen Zeppeline flogen die Transatlantikrouten nicht mehr, und es war erst ein Jahr her, dass Alcock und Brown als Erste mit einer treibstoffgefüllten Variante jener Kriegsflugzeuge über den Atlantik geflattert waren, die sich an der Ostfront des Schlieffen-Krieges so rasch entwickelt hatten.
Zunächst war ich verärgert, weil wir einen zusätzlichen Tag im Hafen bleiben mussten, während die Hafenmeister einen Konvoi zusammenstellten, rund zwanzig Fahrzeuge einschließlich unseres eigenen als größtem Passagierschiff, einer Reihe von Handelsschiffen und zweier Zerstörer der US Navy, die mit Echoloten und Wasserbomben ausgerüstet waren, um mit jeglicher Bedrohung durch die »U-Boote« fertigzuwerden. Seit den ersten Wochen des Schlieffen-Krieges im Jahr 1914 hatte kein amerikanisches Schiff auch nur einen Kratzer von einem deutschen Torpedo abbekommen, und es sagt eine Menge über die damaligen Spannungen zwischen den Nationen aus, dass man solche Vorkehrungen dennoch für nötig erachtete. Aber die Sache hatte auch einen Vorteil für uns: Der Konvoi würde nach Southampton fahren statt nach Liverpool, dem üblichen Hafen der Lusitania, und uns dadurch näher bei London absetzen.
Während der Überfahrt verbrachte ich einen großen Teil meiner Zeit in der Bordbibliothek, während Eric die Sporthalle frequentierte und Cook die First Class Lounge mit ihren Buntglasfenstern, Marmorsäulen und vornehmen, flattrigen Frauen. Unter den Passagieren gab es viel schwarzen Humor. Wir hätten Glück, hieß es, dass die Titanic der White Star Line nicht zu unserem Konvoi gehörte; sie galt vielen als Schiff, auf dem ein Fluch lag, seit sie auf ihrer Jungfernfahrt mit einem Eisberg kollidiert und nur von einer Rumpfpanzerung aus hochwertigem Aluminium marsianischer Güte gerettet worden war.
Kaum hatten wir in Southampton angelegt, kamen auch schon Einheiten der Grenzpolizei in ihren schwarzen Uniformen an Bord, begleitet von einem Trupp regulärer Soldaten in Khaki. Wir drei britischen Staatsbürger, deren ordnungsgemäße Papiere bereits auf der Lusitania überprüft worden waren, durften rasch von Bord gehen, während Amerikaner und andere Ausländer wie von Harry erwartet zurückgehalten wurden, um näher in Augenschein genommen zu werden. Unmittelbar nach dem Entladen wurde das umfangreiche Gepäck meiner beiden Mitreisenden zu unserem Hotel in London vorausgeschickt.
Wir drei selbst wurden sodann außerhalb des Passagierterminals von Philip Parris abgeholt. Philip war Walter Jenkins’ Vetter. Damals in den Fünfzigern, war er ein stämmiger Bursche mit Hängebacken, das grau-schwarze Haar mit Pomade an die Kopfhaut gekleistert und gewohnheitsmäßig in einen schweren Anzug gekleidet, zu dem grundsätzlich eine triste schwarze Krawatte und eine Weste mit dicker Uhrenkette gehörten. Er sah von Kopf bis Fuß aus wie ein Geschäftsmann, wie ein vermögender und vor allem tüchtiger Mann, dem jemand wie Walter Jenkins das Wohlergehen dreier transatlantischer Heimatloser wie uns anvertrauen würde, so wie er ihm einst im Chaos des Krieges gegen die Marsianer die Sicherheit seiner Frau anvertraut hatte, während er selbst den Marsianern durch die englische Landschaft gefolgt war wie eine Fliege dem Pferd. Ich erinnere mich, dass Walter in seinen Memoiren Philip als einen recht tapferen Mann bezeichnet hatte, aber als niemanden, der eine Gefahr schnell erkannte und ihr prompt begegnete. Ha! Ich hätte lieber einen Mann wie Parris an meiner Seite gehabt als einen wie Jenkins.
Philip führte uns raschen Schrittes zum Parkplatz und erklärte uns seinen Plan. Er würde uns der Annehmlichkeit der Hotels halber nach London bringen und uns dann ein paar Tage später nach Woking fahren, zu Walters Familientreffen. »Ich hoffe, Sie hatten keine Probleme mit den Wichtigtuern von der Grenzpolizei.«
Eric Eden schüttelte den Kopf. »Ich denke, die machen nur ihren Job. Aber als sie in so großer Zahl an Bord kamen – ich habe nicht mehr so viele Uniformen auf einem Haufen gesehen, seit ich die Inkerman-Kaserne verlassen habe.«
Philip schnaubte. »Warten Sie, bis Sie London sehen. Für mich trägt Marvin die Schuld daran – er steht auf viel zu gutem Fuße mit dem Kaiser, wenn Sie mich fragen.«
Wir gelangten zu seinem Wagen, einem der neuen Bentleys; die Karosserie, größtenteils aus Aluminium, glänzte im wässrigen Licht der Märzsonne.
Cook stieß einen Pfiff aus und strich mit einem Finger über die eleganten Linien der Motorhaube. »Was für eine Schönheit.«
Philip erwiderte das Lächeln. »Ja, nicht wahr? Englisches Aluminium oder vielmehr marsianisches, osmanisches Benzin im Tank und das beste Leder von den preisgünstigen französischen Märkten. Und kein reines Luxusgefährt. Ich mache derzeit in Aluminium und muss für die Waren werben. Wir fahren nach Osten und nehmen die Portsmouth Road nach London. Halten Sie Ihre Papiere bereit. Wir kommen nämlich durch den Surrey-Korridor – ich dachte, das würden Sie gern sehen –, aber an den Sicherheitsschranken sind sie manchmal ein bisschen nervös …«
Der Surrey-Korridor? Sicherheitsschranken? Ich war lange weg gewesen, aber ich erinnerte mich noch an eine Zeit, in der man nicht einmal dann Papiere oder Pässe gebraucht hatte, wenn man internationale Grenzen in Europa überqueren wollte, geschweige denn, um in England umherzufahren.
Er verfrachtete uns in den Wagen, dessen Inneres nach poliertem Leder roch.
In der Nähe von Portsmouth bog Philip auf Cooks Bitte hin von der Hauptstraße ab und hielt auf einer Anhöhe, von der aus wir einen Blick auf die Stadt und den dahinter liegenden Hafen hatten. Portsmouth war schon immer der größte Stützpunkt der Royal Navy gewesen, und an diesem Tag sahen wir, dass es im Ärmelkanal nur so wimmelte von Schiffen – graue Schemen im Märznebel. In der Brise strömten schwarze Rauchfahnen aus ihren Schornsteinen.
Cook und Eric, beide Militärs, waren von dem Anblick fasziniert. »Da ist irgendwas im Gange«, sagte Cook leise. »Ziemlich viel los da unten.«
»Ich wünschte, ich hätte mein Vogelbeobachtungs-Fernglas mitgebracht«, sagte Philip. »Ist einer von euch Army-Leuten ein Schiffegucker? Nicht alle diese Fahrzeuge da draußen sind unsere. Einige sind deutsch – und ein paar sogar französisch, beschlagnahmt nach dem Ende des Schlieffen-Krieges an der Westfront.« Er schaute sich fast verschwörerisch zu ihnen um. »Es gibt Spannungen mit den Amerikanern. Das Gerücht, das in meinem Club die Runde macht … also, angeblich wird der Kaiser, der rittlings auf ganz Europa hockt, schon wieder unruhig. So, wie sie den Europäischen Krieg im Westen angefangen haben, um Frankreich rasch auszuschalten und freie Hand für den Feldzug gegen Russland zu haben, bevor es mobilmachen konnte, denken die deutschen Strategen jetzt daran, sich Amerika vorzuknöpfen, bevor es so groß wird, dass man nicht mehr mit ihm fertigwürde. Wie Sie wissen, hat Amerika eine brauchbare Marine, aber nur ein sehr kleines stehendes Heer und obendrein Probleme mit seinem Nachbarn Mexiko. Falls die Deutschen ihre Flotte über den Atlantik kriegen und falls sich die Mexikaner dazu bewegen lassen, die Grenze zu überqueren …«
»Wahnsinn«, murmelte Eric. »Zu viele verdammte Kriegsgerüchte. So was macht alle nervös.«
»Und sorgt dafür, dass man sie unter Kontrolle behalten kann«, warf ich ein.
Cook nickte. »Aber eins muss man dem Kaiser lassen. Er trägt in seinem Krieg gegen einen ganzen Kontinent den Sieg davon, weil er kühn ist. Vielleicht schafft er das noch mal. Warum nicht?«
Ich hatte dieses ganze Kriegsdrama aus der Ferne beobachtet. In gewissem Sinn war alles eine Folge des Krieges gegen die Marsianer gewesen. Die britische Navy, die beste der Welt, hatte sich gegen eine Streitkraft, die vom Himmel auf uns herabfiel, als so gut wie nutzlos erwiesen. Frank und ich hatten bei unserer Flucht zum Meer die Kanalflotte vor der Themsemündung liegen sehen, während die Marsianer wüteten: »Kampfbereit und doch außerstande, etwas zu unternehmen«, wie Walter es ausdrückte. Folglich hatte es nach dem Krieg eine gründliche Neuausrichtung gegeben; die finanziellen Mittel für das Heer waren erhöht, die für die Marine zusammengestrichen worden, alles unter bitterer Rivalität innerhalb der Streitkräfte und großem Händeringen wegen des Verlusts der Tradition und so weiter. Ein Teil der Strategie hatte darin bestanden, im Jahr 1912 einen ziemlich schäbigen Nichtangriffspakt mit dem Kaiser zu schließen, um einen Rüstungswettlauf zur See zu vermeiden.
All dies hatte im Jahr 1914 schließlich zum Verrat an unseren Alliierten geführt.
Philip rieb sich das Kinn. »Was immer man von den nationalen Interessen und so weiter halten mag, viele von uns schämten sich dafür, dass wir tatenlos zusahen, wie die Deutschen einen mechanisierten Krieg gegen Belgien und Frankreich vom Zaun brachen, vor allem weil wir genau so einem Angriff vom Mars ausgesetzt gewesen waren. Kein Wunder, dass die Amerikaner empört waren.«
Cook grinste zynisch. »Wir hatten damals alle Hände voll damit zu tun, die Iren fertigzumachen. Aber was die Deutschen gegen die Yanks betrifft: Vielleicht kommen die Marsianer ja zurück und stoppen das Ganze, bevor es losgeht.«
Und da hatte man das Paradox von Albert Cook. Er war kein auf konventionelle Weise intelligenter Mensch und auf jeden Fall ziemlich ungebildet, aber er hatte auf seine durchtriebene Art einen Sinn für Strategie, für die globalen Dimensionen. Denn wie sich herausstellte, sollte er mit dieser letzten scherzhaften Vorhersage natürlich recht behalten.
Philip ließ den Wagen an. »Fahren wir weiter. In Petersfield gibt’s einen anständigen Pub, in dem wir zu Mittag essen können …«
6
DER SURREY-KORRIDOR
Am frühen Nachmittag fand ich heraus, was Philip mit dem Surrey-Korridor gemeint hatte.
Wir durchquerten gerade Guildford. Unmittelbar jenseits der High Street und noch vor der Einmündung in die London Road stießen wir auf eine Straßensperre, die einer Bahnschranke glich. Philip fuhr langsamer, während wir uns in die kleine Fahrzeugschlange einreihten. Die Schranke wurde gehoben und wieder heruntergelassen, um jedes Gefährt einzeln durchzulassen.
Als wir an der Reihe waren, trat ein Polizist an Philips Fenster. Er trug eine reguläre Uniform, soweit ich erkennen konnte, hatte jedoch einen Revolver in einem Holster an seiner Taille und keine Nummer am Kragen. Philip hatte uns aufgefordert, unsere Papiere bereitzuhalten. Unsere Dokumente wurden in ein kleines Häuschen am Straßenrand gebracht und ausführlich inspiziert. Ich wurde rasch ungeduldig wegen der Warterei, aber Eric und Cook, die mehr Erfahrung mit dem modernen England hatten als ich, saßen die Sache stoisch aus.
Dann kam ein neues Abenteuer. Einer nach dem anderen wurden wir drei vom Wagen in das Häuschen geführt. Eric und Cook wurden rasch wieder entlassen, und Cook kehrte lächelnd zum Wagen zurück. »Bobby da drin hat ein Exemplar meines Buches. Ich musste es ihm signieren. Ha!«
Ich gönnte es ihnen. Doch als ich an die Reihe kam, wurde ich in Gewahrsam genommen. Der diensthabende Beamte war ein kleiner, abweisender Mann mit einem langen, traurigen Schnurrbart, der für mich etwas Germanisches hatte – in London sollte ich noch zahlreiche weitere Exemplare sehen. »Tut mir sehr leid, Miss, aber ich muss Sie einstweilen hierbehalten.«
Ich rief nur: »Philip!«
Philip Parris war ein vermögender Mann, selbst in General Marvins Großbritannien. Sobald er bei mir war, fragte ich erneut, weshalb ich festgehalten wurde.
Der schnurrbärtige Polizist warf einen Blick in seine Unterlagen. »1908 sind Sie Mitglied einer verbotenen Organisation geworden, Miss, nämlich der Women’s Social and Political Union …«
Philip lachte schallend. »Das ist es also! Du bist eine Suffragette!«
»War ich«, sagte ich. Und berichtigte mich dann: »