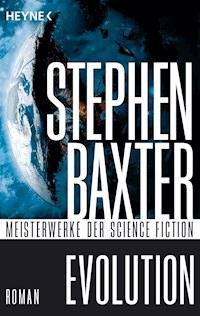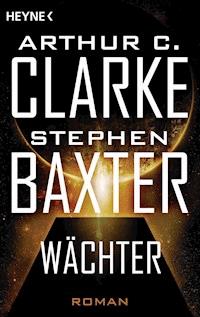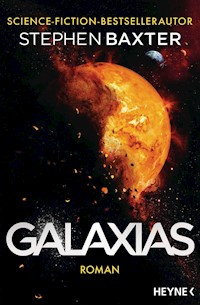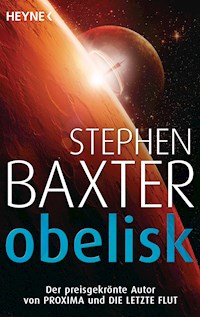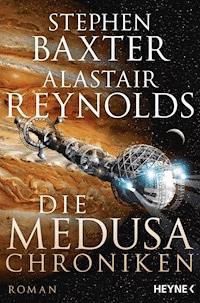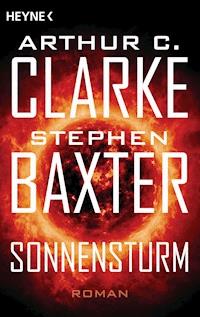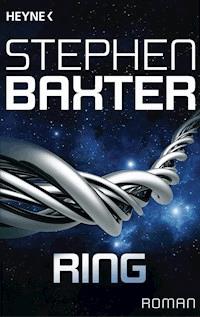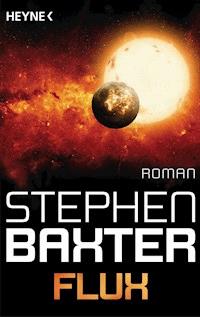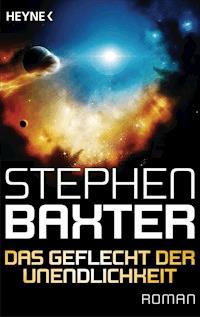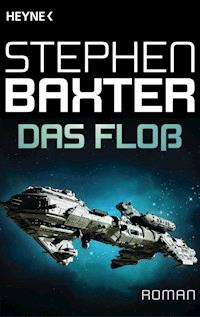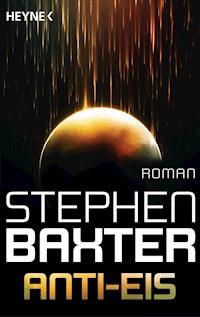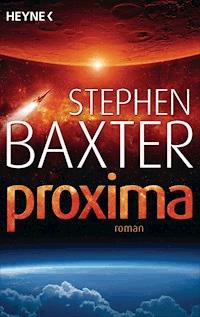2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft
Nach dem Tod seines Vaters findet George Poole in dessen Nachlass Dokumente, die darauf hindeuten, dass er eine Zwillingsschwester hat, die er jedoch nie kennenlernte: Sie wurde in die Obhut eines Marienordens gegeben. George, von Einsamkeit und Verwirrung getrieben, macht sich auf die Suche nach ihr. Die Spur führt nach Rom, wo er einem jungen Mädchen begegnet, das sich aus den Fängen des „Ordens der Heiligen Maria“ befreien will. Gemeinsam mit seinem Freund Peter McLachlan, einem Verschwörungstheoretiker, kommt George einem erschütternden Geheimnis auf die Spur, das tief in die Vergangenheit reicht – und weit in unsere Zukunft!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 922
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
www.diezukunft.de
Das Buch
Die Gegenwart: George Poole, ein fünfundvierzigjähriger Computerfachmann, reist nach Manchester, um den Haushalt seines verstorbenen Vaters aufzulösen. Dabei stößt er auf Hinweise, denen zufolge er eine Zwillingsschwester hatte – Rosa –, die als Kind in die Obhut eines Marienordens gegeben wurde. George, von Einsamkeit und Verwirrung getrieben, macht sich auf die Suche nach ihr.
Die Vergangenheit: Im Britannien des fünften Jahrhunderts bricht für die siebenjährige Regina, ganz in der römischen Tradition erzogen, von einem Tag auf den anderen die Welt zusammen. Ihr Vater begeht Selbstmord, die Mutter flieht nach Rom. Einige Jahre später bringt sie eine Tochter zur Welt und reist mit ihr ebenfalls nach Rom, um dort ihre Mutter ausfindig zu machen. Die Spur führt sie zum »Orden der Heiligen Maria, Königin der Jungfrauen«.
Die Gegenwart: Auch George Poole gelangt auf der Suche nach seiner Schwester nach Rom, wo er einem jungen Mädchen begegnet, das sich aus den Fängen des immer noch existierenden »Ordens der Heiligen Maria« befreien will. Und gemeinsam mit seinem Freund Peter McLachlan, einem brillanten Verschwörungstheoretiker, kommt er einem erschütternden Geheimnis auf die Spur …
Der Autor
Der Engländer Stephen Baxter, geboren 1957, zählt zu den weltweit bedeutendsten Autoren naturwissenschaftlich-technisch orientierter Science Fiction. Aufgewachsen in Liverpool, studierte er Mathematik und Astronomie und widmete sich dann ganz dem Schreiben. Baxter lebt und arbeitet in Buckinghamshire.
Eine Liste der im WILHELM HEYNE VERLAG erschienenen Bücher von Stephen Baxter finden Sie am Ende des Bandes.
Inhaltsverzeichnis
Für Neil,Ann, Katherine, Annaund Clare Baines
1
Mittlerweile bin ich in Amalfi gelandet. Ich kann mich nicht dazu durchringen, nach England zurückzukehren – noch nicht –, und nach dem fremdartigen Ameisenhaufen, auf den ich in Rom gestoßen bin, ist es geradezu eine Wohltat, hier zu sein.
Ich habe mir ein Zimmer in einem Haus an der Piazza Spirito Santo genommen. Unten ist eine kleine Bar, wo ich im Schatten des Weinlaubs sitze und Cola Light oder manchmal auch den hiesigen Zitronenlikör trinke; er schmeckt wie die mit Zitronenbrause gefüllten Bonbons, die ich mir als kleiner Junge in Manchester immer gekauft habe, nur zermahlen und mit Wodka gemischt. Der knurrige alte Barmann kann kein Wort Englisch. Schwer zu sagen, wie alt er ist. Die Blumenschalen auf den Tischen draußen sind mit Zweigbündeln gefüllt, die in meinen Augen verdächtig nach fasces aussehen, aber ich bin zu höflich, um ihn danach zu fragen.
Amalfi ist eine kleine Stadt, die sich in ein Tal auf der sorrentinischen Halbinsel schmiegt. Schwalbennestern gleich wurden die Ortschaften an der Küste in die steil aufragenden Kalksandsteinfelsen gebaut. Die Menschen haben sich daran gewöhnt, an einer senkrechten Fläche zu leben: Über öffentlich zugängliche Treppenwege gelangt man bis zum nächsten Ort. Nichts in Italien ist neu – im Mittelalter war Amalfi eine Seerepublik –, und doch fehlt hier jene Aura des ungeheuren Alters, die in Rom so bedrückend wirkte. Aber dennoch – vieles von dem, was den Horror in Rom ausmachte, ist auch hier, überall um mich herum.
In den engen Kopfsteinpflasterstraßen herrscht ständig reger Verkehr; es wimmelt von Autos und Bussen, Lastwagen und schnellen Mofas. Italiener haben einen anderen Fahrstil als Nordeuropäer. Sie fahren einfach drauflos: Sie wuseln durcheinander, wie Peter McLachlan gesagt hätte, eine Vielzahl von Individuen, die sich darauf verlassen, dass sie dank der ungeschriebenen Gesetze der Masse schon irgendwie durchkommen werden.
Und dann sind da die Menschen. Direkt gegenüber von meiner Bar ist eine Schule. Wenn die Kinder gegen Mittag entlassen werden – nun, auch sie wuseln durcheinander; es gibt wirklich kein anderes Wort dafür. Aus Leibeskräften schreiend, strömen sie in ihren hellblauen, kittelartigen Uniformen auf die Piazza. Aber das ist rasch wieder vorbei. Wie Wasser, das durch ein Sieb rinnt, verschwinden sie nach Hause oder in die Cafés und Bars, und der Lärm verebbt.
Und natürlich die Familien. Vor denen gibt es in Italien kein Entrinnen.
Amalfi war einmal ein Zentrum der Hadernpapierherstellung, eine von den Arabern übernommene Technik. Früher standen hier sechzig Papiermühlen. Heutzutage gibt es nur mehr eine, aber die beliefert noch immer den Vatikan, sodass jeder päpstliche Erlass für die Ewigkeit auf säurefreiem Hadernpapier aufgezeichnet werden kann, das inzwischen sogar fein genug für Computerdrucker ist. Und diese übrig gebliebene Amalfi-Mühle wird nun bereits seit neunhundert Jahren ununterbrochen von derselben Familie betrieben.
Die wuselnden Menschenmengen, die gedankenlose Ordnung der Masse, die kalte, starke Hand alter Familien: Selbst hier sehe ich die Koaleszenten vor meinem geistigen Auge, wohin ich auch schaue.
Und ich sehe wieder diesen ungewöhnlichen Krater, der mitten auf der Via Cristoforo Colombo entstand und über dem noch immer die Wolke grauschwarzen Kalktuffstaubs hängt. Angestellte aus den umliegenden Büros und Geschäften – Handys, Kaffeetassen und Zigaretten in der Hand – spähten in das Loch, das sich plötzlich in ihrer Welt aufgetan hatte. Und die Drohnen strömten nur so aus dem Krater, in verblüffender Zahl, zu hunderten und tausenden. Inmitten der Staubwolke sahen sie alle identisch aus. Selbst jetzt haftete ihnen eine gewisse Ordnung an – aber niemand führte sie. Die Frauen am Rand drängten ein paar Schritte nach vorn, sahen die glotzenden Büroangestellten um sie herum verständnislos an, drehten sich dann um, verschwanden wieder in der Menge und wurden von anderen ersetzt, die ihrerseits nach vorn drängten. Als die hervorströmende Menge den Straßenrand erreichte, zerfiel sie, bildete Stränge, Ranken und Linien von Menschen, die vorstießen, sich auflösten und neu zusammenfanden und wimmelnd und forschend in Türöffnungen und Gassen eindrangen. Im staubigen Licht schienen sie zu einer einzigen wogenden Masse zu verschmelzen, und selbst in der strahlenden Helligkeit des römischen Nachmittags sonderten sie einen moschusartigen Gestank ab.
Wahrscheinlich versuche ich zu kompensieren. Ich verbringe einen Großteil meiner Zeit allein, in meinem Zimmer oder auf Spaziergängen in den Hügeln, die über den Dörfern und Städten aufragen. Aber ein Teil von mir verspürt noch immer eine überwältigende Sehnsucht danach zurückzukehren, erneut in die warme, taktile Ordentlichkeit der Koaleszenten einzutauchen. Es ist eine unerfüllte Sehnsucht, die mir vermutlich bleiben wird, bis ich sterbe.
Wie seltsam, dass mich die Suche nach meiner eigenen Familie zu solchen Mysterien führte – und dass sie mit dem Tod begann und auch endete.
2
Es begann wahrhaftig in einer für jedermann seltsamen Zeit. Die Meldung von der Kuiper-Anomalie, dem sonderbaren neuen Licht am Himmel, war soeben erschienen. Man muss in London sein, wenn so eine Story herauskommt, eine jener bedeutsamen Nachrichten, die das Leben verändern und die man mit seinen Freunden an den Trinkwasserspendern im Büro, in den Pubs und Coffee Bars besprechen und bis ins Kleinste durchkauen will.
Aber ich musste heim, nach Manchester. Familiäre Pflichten. Ich hatte meinen Vater verloren. Ich war fünfundvierzig.
Das Haus meines Vaters – mein Elternhaus – stand in einer kurzen Straße identischer Vororteigenheime: eine nette, kleine Doppelhaushälfte mit einem Fleckchen Rasen vorn und hinten. An einem strahlend hellen Septembermorgen stand ich in der Auffahrt und gab mir Mühe, mich nicht von meinen Gefühlen überwältigen zu lassen; ich versuchte, wie ein Fremder zu denken.
Als diese kleinen Häuser in den Fünfzigern gebaut worden waren, nicht lange vor meiner Geburt, mussten sie den Menschen im Vergleich zu den Rücken an Rücken stehenden Reihenhäusern der Innenstadt begehrenswert erschienen sein, und tausendmal besser als die Hochhausblocks, die in ein paar Jahren folgen würden. Aber jetzt, im ersten Jahrzehnt des neuen Jahrhunderts, wirkte das Mauerwerk schnell hingehauen und billig, die kleinen Rabatten waren eingesunken, und die Außenanlagen, wie zum Beispiel die verputzten Ytongsteine am Rand der Auffahrten, zerbröckelten teilweise. Vom ursprünglichen Charakter der Straße war nicht mehr viel übrig geblieben. Es gab doppelt verglaste Kunststofffenster, neu gedeckte Dächer und wieder aufgemauerte Schornsteine, Zimmer mit Flachdach über den Garagen, und an der Vorderseite des Hauses gegenüber waren sogar zwei kleine Wintergärten angebaut, um die Südsonne einzufangen. Nach beinahe fünfzig Jahren waren die Häuser mutiert und hatten sich auseinander entwickelt.
Auch die Menschen hatten sich verändert. Früher einmal war dies eine Straße voller junger Familien gewesen, wo wir Kinder uns Spiele ausgedacht hatten, die wir nur unterbrachen, wenn hin und wieder einmal ein Auto von der Hauptstraße einbog. Ein Wagen pro Haus damals, Morris Minors, Triumphe und Zephyre, die gut in die kleinen Garagen passten. Jetzt war alles voller Autos; sie verstopften jede Auffahrt und parkten in zwei Reihen am Straßenrand. Mir fiel auf, dass man einige der kleinen Gärten umgegraben und asphaltiert hatte, um noch mehr Platz für die Autos zu schaffen. Nirgends war ein Kind zu sehen, überall nur Autos.
Aber mein Zuhause, mein altes Zuhause, unterschied sich von den anderen.
Unser Haus hatte noch die originalen Ziehharmonika-Garagentüren aus Holz und die kleinen Holzfenster, ja sogar den Erker an der Stirnseite des Hauses, in dem ich immer gesessen und meine Comics gelesen hatte. Aber das Holz war abgesplittert und rissig, vielleicht sogar verrottet. Der alte Efeu, ein extravagantes grünes Gekritzel auf der Vorderseite des Hauses, war längst verschwunden, aber ich sah die verwitterten Narben im Mauerwerk, wo er sich festgeklammert hatte. Wie schon zu Lebzeiten meiner Mutter – sie war vor zehn Jahren gestorben – hatte mein Vater nur die allernotwendigsten Renovierungsarbeiten erledigt. Er war fast sein ganzes Leben für die Baubranche tätig und somit der Ansicht gewesen, er habe die Woche über schon genug mit Bauen und Renovieren zu tun gehabt.
Eine der wenigen Verbeugungen vor den modernen Zeiten, die ich sah, war das silberne Kästchen einer Alarmanlage, das auffällig an der Stirnseite des Hauses klebte. Der letzte Einbruch bei Dad lag schon ein paar Jahre zurück. Er hatte ihn erst einige Tage später bemerkt – das säuberlich aufgebrochene Schloss der Garagentür, das eingeschlagene Fenster des Wagens, den er selten fuhr, und die hübsch gerundete Kackwurst auf dem Fußboden. Kinder, hatte die Polizei gesagt. Panikreaktionen. Mein Vater war kein ängstlicher Mensch gewesen, aber es hatte ihm Kummer bereitet, dass seine Kräfte nachließen und er sich nicht mehr so wie früher gegen die grausame Selbstsucht anderer wehren konnte. Ich hatte die Alarmanlage gekauft und einbauen lassen, muss aber zu meiner Schande gestehen, dass ich sie an diesem Tag zum ersten Mal wahrnahm.
Alarmanlage hin oder her, in der Haustür gähnte eine kaputte und noch nicht reparierte Fensterscheibe.
»George Poole. Du bist George, hab ich Recht?«
Ich drehte mich überrascht um. Vor mir stand ein massiger Mann mit schütterem Haar. Seine Kleidung wirkte irgendwie unpassend, vielleicht zu jugendlich für ihn – leuchtend gelbes T-Shirt, Jeans, Turnschuhe, ein klobiges Handy in der Brusttasche. Trotz seiner bärengleichen Statur wirkte er schon auf den ersten Blick irgendwie schüchtern; er hatte die Schultern hochgezogen, als wollte er seine Größe kaschieren, und seine vor dem Bauch verschränkten Hände zupften aneinander.
Und trotz der ergrauenden Haare, der hohen Stirn und seiner schwabbelig gewordenen Hals- und Kinnpartie erkannte ich ihn sofort.
»Peter?«
Er hieß Peter McLachlan. Wir waren gleichzeitig eingeschult worden, hatten meist sogar dieselbe Klasse besucht. In der Schule war er immer Peter gewesen, nie Pete oder Petie, und daran hatte sich wohl auch nichts geändert.
Er streckte mir die Hand hin. Sie war kalt und feucht, sein Händedruck zaghaft. »Ich habe dich parken sehen. Du bist bestimmt überrascht, mich hier anzutreffen.«
»Eigentlich nicht. Mein Vater hat öfters von dir gesprochen.«
»Hübscher Dufflecoat«, sagte er.
»Was? … O ja.«
»Erinnert mich an die Schulzeit. Wusste gar nicht, dass man die Dinger noch kriegt.«
»Er stammt aus einem speziellen Kleiderladen für stilistisch Zurückgebliebene.« Das stimmte.
Wir standen einen Moment lang verlegen herum. Ich hatte mich in Peters Gegenwart schon immer unwohl gefühlt, denn er war einer jener Menschen, die sich in Gesellschaft anderer nie entspannen konnten. Und etwas an seinem Gesicht war anders; ich brauchte ein paar Sekunden, um dahinter zu kommen: Die dicke Brille fehlte, die er als Kind in den Siebzigern immer hatte tragen müssen. Ich sah auch keine Vergrößerung der Pupillen, jenes verräterische Kennzeichen von Kontaktlinsen; vielleicht hatte er eine Laseroperation vornehmen lassen.
»Tut mir Leid, dass ich eure Fensterscheibe zerbrochen habe«, sagte er.
»Du warst das?«
»Ja, in der Nacht, als er gestorben ist. Dein Vater kam nicht an die Tür, als ich ihm seine Abendzeitung brachte. Ich dachte, ich schaue lieber mal nach ihm …«
»Du hast ihn gefunden? Das wusste ich nicht.«
»Ich hätte ins Haus gemusst, um das Fenster zu reparieren, und das wollte ich nicht, bevor du … du weißt schon.«
»Ja.« Sein Zartgefühl bewegte mich, und ich fühlte mich auf unbestimmte Weise schuldig, weil keiner von uns daran gedacht hatte, ihn zur Beerdigung einzuladen. Ich klopfte ihm behutsam auf die Schulter und spürte die Muskeln unter seinem Ärmel.
Aber er wich zurück. »Tut mir Leid, das mit deinem Vater«, sagte er.
»Mir tut’s Leid, dass du ihn finden musstest.« Ich wusste, dass er noch mehr erwartete. »Und danke, dass du nach ihm gesehen hast.«
»Hat ihm leider nicht viel genützt.«
»Aber du hast es versucht. Er hat mir erzählt, dass du dich immer um ihn gekümmert hast – Rasenmähen …«
»War nicht der Rede wert. Immerhin kannte ich ihn von klein auf.«
»Ja.«
»Du warst noch nicht drin, oder?«
»Das weißt du doch, wenn du mich parken gesehen hast«, sagte ich ein bisschen spitz.
»Soll ich mit reinkommen?«
»Ich will dir nicht noch mehr Umstände machen. Überlass das nur mir.«
»Es macht mir keine Umstände. Aber ich will mich nicht aufdrängen …«
Immer noch verlegen, drehten wir uns im Kreis. Am Ende nahm ich sein Angebot natürlich an.
Wir gingen die Auffahrt hinauf. Sogar der Asphalt war verwittert, bemerkte ich beiläufig; er knackte leise unter meinem Gewicht. Ich brachte einen Schlüssel zum Vorschein, den mir das Krankenhaus zusammen mit der Todesnachricht geschickt hatte, steckte ihn in das Yale-Schloss und stieß die Tür auf.
Ein lautes Piepsen ertönte. Peter langte an mir vorbei und gab einen Code in ein Steuerkästchen ein, das sich in einem offenen Schrank auf der Veranda befand. »Er hat mir den Code gegeben«, sagte er. »Für die Alarmanlage. Falls es mal einen Fehlalarm gab, weißt du. Deshalb konnte ich sie abschalten, als ich das Fenster eingeschlagen hatte, um reinzukommen. Nur falls du dich fragst, wieso … Ich hatte auch einen Schlüssel. Aber an der Tür gibt’s ein Zusatzschloss mit Sicherheitskette, und deshalb musste ich das Fenster einschlagen …«
»Ist schon gut, Peter«, sagte ich ein wenig ungeduldig. Halt den Mund. Er hatte nie gewusst, wann es an der Zeit dazu war.
Er verstummte.
Ich holte tief Luft und ging hinein.
In diesem Haus hatte ich meine Kindheit verbracht, und es war alles noch genauso wie damals.
In der Diele ein Garderobenständer mit muffigen Mänteln, ein Telefontisch mit einem Handapparat aus den Siebzigerjahren und einem Haufen hingekritzelter Namen, Nummern und Notizen, die sich in einer Pappschachtel stapelten, Notizen in Dads Handschrift. In einer von Dad selbst gefertigten Wandnische eine kleine, grazile Statue der Jungfrau Maria. Im Erdgeschoss das Esszimmer mit dem narbigen alten Tisch, die kleine Küche mit dem schmuddeligen Herd und dem Resopaltisch, das Wohnzimmer mit den Bücherregalen, der abgenutzten Polstergarnitur und einem verblüffend neuen Fernseher samt Videorecorder und DVD-Player. Die schmale Treppe – genau fünfzehn Stufen, wie ich als Kind gezählt hatte – zum Treppenabsatz im Obergeschoss mit dem Badezimmer, dem Elternschlafzimmer, drei kleinen Zimmern und der Luke zum Dachboden. Die Tapete war schlicht, sah aber nicht so schäbig aus, wie ich erwartet oder befürchtet hatte. Dad musste also nach meinem letzten Besuch vor fünf oder sechs Jahren renoviert haben – oder renoviert haben lassen, vielleicht von Peter, der groß und klobig hinter mir auf der Fußmatte stand. Ich wollte ihn nicht danach fragen.
Es erschien mir alles so klein, so verdammt klein. Vor meinem geistigen Auge sah ich mich als Riesen wie Gulliver, gefangen in dem Haus; meine Arme steckten im Wohnzimmer und in der Küche, die Beine in den Schlafzimmern.
Peter betrachtete die Jungfrau. »Immer noch ein katholisches Haus. Pater Moore wäre stolz.« Der Gemeindepfarrer aus unserer Kindheit, freundlich, aber Furcht erregend; er hatte uns die Erstkommunion erteilt. »Gehst du noch zur Kirche?«
Ich zuckte die Achseln. »Ich würde mit Dad zur Weihnachts- und Ostermesse gehen, wenn wir zusammen wären. Ansonsten könnte man wohl sagen, ich bin vom Glauben abgefallen. Und du?«
Er lachte nur. »Da wir so wenig über das Universum wissen, kommt mir die Religion ein bisschen albern vor. Aber mir fehlt das Ritual. Es war tröstlich. Und die Gemeinschaft.«
»Ja, die Gemeinschaft.« Peter entstammte einer irisch-katholischen, ich einer italoamerikanischen Familie. Beide waren wir auf unsere Weise Klischeefiguren, dachte ich und starrte zum Gipsgesicht der Jungfrau Maria hinauf, das in einem Ausdruck schmerzerfüllter Freundlichkeit erstarrt war. »Als Kind war ich wahrscheinlich an dieses ganze Zeug gewöhnt. Gesichter, die von der Wand auf mich runterschauen. Jetzt finde ich es irgendwie bedrückend.«
Peter musterte mich aufmerksam. »Alles in Ordnung mit dir? Wie fühlst du dich?«
Eine Aufwallung von Ärger. »Gut«, fauchte ich.
Er zuckte zusammen und drückte den Zeigefinger an die Stelle zwischen den Augen, und ich erkannte, dass er eine imaginäre Brille zurechtschob.
Auf einmal schämte ich mich. »Tut mir Leid, Peter.«
»Nicht nötig. Ich bin nicht hier, um dir Schuldgefühle zu machen. Dieser Augenblick gehört dir.« Er spreizte die großen Hände. »An alles, was du jetzt tust, wirst du dich dein Lebtag erinnern.«
»Herrje, du hast Recht«, sagte ich bestürzt.
Ich ging die paar Schritte zur Küchentür. Sie war offen. Es roch muffig. Auf dem Tisch standen eine Tasse mit Untertasse und ein Teller, daneben lag Besteck. Eine kalte Fettschicht mit ein paar vertrockneten Bröckchen drin, die wie Frühstücksspeck aussahen, überzog den Teller. Auf einer kleinen Pfütze am Boden der Tasse trieben grüne Bakterienkolonien; ich wich zurück.
»Ich habe ihn in der Diele gefunden«, erklärte Peter.
»Das hat man mir gesagt.« Dad hatte eine Reihe schwerer Schlaganfälle erlitten. Ich nahm die Tasse, die Untertasse und den Teller und trug sie zur Spüle.
»Ich glaube nicht, dass er sich beim Hinfallen verletzt hat. Er sah friedlich aus. Er lag direkt da drüben.« Peter zeigte zur Diele. »Von diesem Telefon aus habe ich das Krankenhaus angerufen. Den Rest des Hauses habe ich nicht betreten. Nicht einmal, um aufzuräumen.«
»Das war sehr rücksichtsvoll«, sagte ich leise.
Ich schaute aus dem Küchenfenster in den kleinen Garten. Das Gras musste gemäht werden, bemerkte ich zerstreut; mitten im Grün ragten die hellen Gipfel von Ameisenkolonien auf. In einer Ecke des Gartens standen Azaleen, der Stolz und die Freude meines Vaters. Er hatte sie jahrelang – du lieber Himmel, jahrzehntelang – gehegt und gepflegt.
Ich schaute in die Spüle. Sauberes, staubig aussehendes Geschirr stapelte sich darin, und aus dem Abfluss stieg ein schaler Geruch empor. Ich drehte die Wasserhähne auf und kippte den Schimmel aus der Tasse in den Abfluss. Der kalte Tee floss hinein, und die grünen Bakterienklümpchen glitten lautlos davon, aber die Tasse starrte trotzdem noch vor Dreck. Ich suchte nach einem Spülmittel, fand aber keins, nicht einmal in dem kleinen, voll gestopften Schrank unter der Spüle. Ich nahm die Tasse wieder aus der Spüle und schaute hinein. Ich kam mir töricht vor, unnütz, gefangen.
Peter stand in der Küchentür. »Ich bring dir ein Spülmittel rüber, wenn du willst.«
»Scheiß drauf«, knurrte ich, trat auf das Pedal des Abfalleimers im Schrank und warf die schmutzige Tasse hinein. Aber der Abfalleimer war halb voll und stank ebenfalls, vielleicht nach verfaultem Obst. Ich kniete mich hin und wühlte in dem Schrank, schob Pappschachteln und vergilbte Plastiktüten beiseite.
»Was suchst du?«
»Müllbeutel. Das ist ja vielleicht ein Saustall hier.« Alles wirkte alt, sogar die Dosen und Plastikflaschen mit den Reinigungsmitteln im Schrank – alt, schmutzig, klebrig und halb aufgebraucht, aber nie weggeworfen. Meine Suche wurde rabiater; ich warf alles Mögliche auf den Fußboden.
»Immer mit der Ruhe«, sagte Peter. »Lass dir ein bisschen Zeit.«
Er hatte natürlich Recht. Ich zwang mich aufzustehen.
Er – mein Vater – hatte das stehen lassen, diese paar Teile schmutzigen Geschirrs. Er war nicht mehr zurückgekommen, um den Tee auszutrinken. Er hatte einfach aufgehört zu existieren, sein Leben war abgerissen wie ein Filmstreifen. Jetzt musste ich hier sauber machen, eine Aufgabe, die ich als Kind immer gehasst hatte: Nie hatte er hinter sich aufgeräumt. Aber wenn ich fertig war, würde es damit endgültig vorbei sein, keine schmutzigen Tassen und kein fettiges Geschirr mehr, nie wieder. Zimmer für Zimmer würde ich mich durchs Haus arbeiten und dabei überall eine Unordnung beseitigen, die er nie wieder anrichten würde.
»Es ist, als würde er ein bisschen mehr sterben«, sagte ich. »Nur weil ich das mache.«
»Du hattest doch eine Schwester. Sie war älter als wir, oder?«
»Gina, ja. Sie ist zur Beerdigung rübergekommen, aber schon wieder zurück nach Amerika geflogen. Wir verkaufen das Haus, und jeder kriegt eine Hälfte vom Erlös, wie es Dads Wille war …«
»Amerika?«
»Florida.« Mein Großvater mütterlicherseits, ein Italoamerikaner, war als GI im Krieg für kurze Zeit in Liverpool stationiert gewesen. Während dieses Aufenthalts war meine Mutter gezeugt worden, ein uneheliches Soldatenkind. Nach dem Krieg hatte der GI sein Versprechen, nach England zurückzukommen, nicht eingelöst. All das erzählte ich nun Peter. »Aber es gab ein Happy End«, sagte ich. »Irgendwann in den Fünfzigern hat mein Großvater noch einmal Kontakt zu uns aufgenommen.«
»Schuldgefühle?«
»Nehme ich an. Er war nie ein richtiger Vater. Aber er hat Geld geschickt und Mum und Gina ein paarmal in die Staaten geholt, als Gina noch klein war. Dann haben wir ein Haus in Florida geerbt. Ein Verwandter, den meine Mutter dort getroffen hatte, hinterließ es ihr. Gina ging rüber, um sich einen Job zu suchen, übernahm schließlich das Haus und gründete eine Familie. Sie arbeitet in der Werbebranche. Tut mir Leid, ist eine komplizierte Geschichte …«
»Das sind Familiengeschichten immer.«
»Episodenhaft. Keine ordentliche Erzählstruktur.«
»Und das bereitet dir Unbehagen.«
Solch eine scharfsichtige Bemerkung hätte ich von dem Peter, den ich kannte, nicht erwartet. »Ja, wahrscheinlich. Es ist alles ein ziemlicher Wirrwarr. Wie ein Spinnennetz. Ich dachte, ich hätte mich daraus befreit, indem ich mir in London eine Existenz aufgebaut habe. Aber jetzt werde ich wieder darin verstrickt.« Und das ärgerte mich, erkannte ich, noch während ich versuchte, diese wenigen letzten Pflichten für meinen Vater zu erledigen.
Peter fragte: »Hast du Kinder?«
Ich schüttelte den Kopf. Mir wurde bewusst, dass ich Peter noch keine einzige Frage gestellt hatte, die ihn selbst betraf – was er nach der Schule gemacht hatte, seine gegenwärtigen Lebensumstände. »Und du?«
»Ich habe nie geheiratet«, sagte er schlicht. »Ich war Polizist – wusstest du das?«
Ich grinste unwillkürlich. Peter, der Schultrottel: ein Bulle?
Offenbar war er diese Reaktion gewohnt. »Es lief prima. Hab’s bis zum Detective Constable gebracht und mich dann vorzeitig pensionieren lassen.«
»Warum?«
Er zuckte die Achseln. »Hatte was anderes zu tun.« Ich sollte später herausfinden, was dieses »andere« war. »Hör mal, lass dir helfen. Schau dir den Rest des Hauses an. Ich erledige das hier. Ich kann dir einen Müllbeutel voll machen.«
»Musst du aber nicht.«
»Ist schon okay. Ich würd’s gern tun, für Jack. Wenn ich was Persönliches finde, lasse ich die Finger davon.«
»Du bist sehr feinfühlig.«
Er zuckte die Achseln. »Du würdest für mich dasselbe tun.«
Ich war nicht sicher, ob das auch nur andeutungsweise der Wahrheit entsprach, und spürte, wie sich eine weitere Schicht Schuldgefühle auf ohnehin schon komplizierte Schichten häufte. Aber ich sagte nichts mehr.
Ich ging nach oben. Hinter mir hörte ich ein leises Piepsen, das Kükengeschrei von Peters Handy, das seine Aufmerksamkeit einforderte.
Das Schlafzimmer meines Vaters.
Das Bett ungemacht, die Laken zerknittert, eine Delle im Kissen, wo sein Kopf gelegen hatte. Ein hüfthoher Korb, fast voll mit Schmutzwäsche. Auf dem Schränkchen am Bett brannte eine elektrische Lampe; daneben lag ein aufgeschlagenes Taschenbuch, die offenen Seiten nach unten. Eine Churchill-Biografie. Es sah so aus, als wäre mein Vater erst vor einem Moment hinausgegangen, aber dieser Moment war irgendwie eingefroren und wich nun erbarmungslos in die Vergangenheit zurück, ein verblassendes Standbild in einem kaputten Fernseher.
Ich schaltete die Lampe aus und klappte das Buch zu. Lustlos durchstöberte ich das Zimmer. Ich wusste nicht so recht, was ich tun sollte.
Die Frisierkommode vor dem Fenster war immer die Domäne meiner Mutter gewesen. Selbst jetzt sahen die aufgereihten Familienfotos – die Überreichung meines Abschlusszeugnisses, lächelnde amerikanische Enkel – genauso aus wie damals, als ich sie zum letzten Mal gesehen hatte, vielleicht wie sie sie hinterlassen hatte. Die Staubschicht hinter den Fotos war dicker, als hätte Dad diese Ecke seit Mutters Tod kaum angerührt. Auf der Platte lag etwas Post – ein paar Rechnungen, eine Karte aus Rom.
Der Krebs hatte meine Mutter dahingerafft. Sie war immer eine junge Mutter gewesen, gerade neunzehn bei meiner Geburt. Selbst am Ende ihres Lebens war sie mir noch jung erschienen.
In seiner letzten Nacht hatte mein Vater hier seine Taschen ausgeleert. Er würde sie nie wieder füllen. Ich warf ein schmutziges Taschentuch in den Wäschekorb und fand ein paar Münzen und Notizen, die ich geistesabwesend einsteckte. Durch den Stoff meiner Tasche fühlten sich die Münzen schwer und kalt an. Seine Brieftasche – dünn, nur eine einzige Kreditkarte darin – nahm ich ebenfalls an mich.
In der Kommode waren zwei kleine Schubladen. In einer lag ein Bündel Post in geöffneten Umschlägen – Briefe meiner Schwester, meiner Mutter, meines jüngeren Ichs. Ich legte sie wieder zurück, eine Aufgabe für später. Die andere Schublade enthielt ein paar Scheckabschnitte, zwei Sparbücher sowie ordentlich abgeheftete Kontoauszüge und Kreditkartenabrechnungen. Ich nahm alles heraus und stopfte es in meine Jackentasche. Ich wusste, dass ich in meiner Prioritätensetzung ein Feigling war: Die abschließende Regelung der finanziellen Angelegenheiten meines Vaters würde mich keinerlei Mühe kosten, das konnte ich auf Autopilot machen, ohne meine Komfort-Zone zu verlassen.
Im Kleiderschrank hingen Anzüge. Als ich sie durchsah, stieg mir der Geruch von Staub und Kampfer in die Nase. Sie waren für Dads fassförmigen Körper geschneidert und hätten mir nicht gepasst, auch wenn sie nicht betagt, an Ärmeln und Schultern abgewetzt und vom Stil her auf undefinierbare Weise altmännerhaft gewesen wären. Die Hemden hatte er immer ordentlich zusammengelegt und in den flachen Schubladen des Kleiderschranks gestapelt, und dort waren sie nun. Unten im Schrank lagen Lack- und Wildlederschuhe wahllos übereinander: Er hatte seine Hausschuhe getragen, als sie ihn ins Krankenhaus gebracht hatten. Weitere Schubladen waren mit Unterwäsche, Pullovern, Krawatten, Krawattennadeln, Manschettenknöpfen und sogar ein paar Ärmelbändern mit Gummizug gefüllt.
Ich untersuchte alles, berührte es zögernd. Es gab wenig, was ich behalten wollte: ein Paar Manschettenknöpfe vielleicht, Dinge, die ich mit ihm verbinden würde. Ich wusste, dass ich das ganze Zeug einsammeln, in große Beutel packen und zu einem Oxfam-Shop bringen sollte. Aber nicht heute, nicht heute.
Gina hatte bereits erklärt, sie wolle nichts von diesem alten Kram haben. Ich ärgerte mich darüber, dass sie nicht hier war, dass sie wieder in die Sonne von Miami Beach geflohen war und mich mit diesem Mist allein ließ. Aber sie hatte sich immer aus dem Familientrubel herausgehalten. Peter McLachlan war ein besserer Sohn als sie eine Tochter, dachte ich bitter.
Ich war alles andere als fertig, aber für den Moment reichte es mir. Ich machte, dass ich hinauskam.
Die Wände über dem Treppenabsatz waren mit weiteren katholischen Ziergegenständen, weiteren Marien geschmückt – sogar mit einem Heiligen Herz Jesu, einer Statue von Jesus mit entblößter Brust, die sein brennendes Herz zeigte, die Darstellung eines besonders schaurigen mittelalterlichen »Wunders«. Ich fragte mich, was ich mit all den katholischen Paraphernalien machen sollte. Es wäre mir respektlos, wenn nicht gar als ein Sakrileg erschienen, sie einfach in den Müll zu werfen. Vielleicht konnte ich sie zur Gemeindekirche bringen. Zu meiner Bestürzung wurde mir klar, dass ich keine Ahnung hatte, wer der Pfarrer war; zweifellos war er Jahrzehnte jünger als ich.
Ich schaute zu der Luke hinauf, durch die man auf den Dachboden gelangte. Sie war nicht mehr als ein kleines, rechteckiges, aus der Decke geschnittenes Paneel. Wenn ich dort hinaufwollte, sollte ich mir lieber eine Leiter suchen.
Zur Hölle damit. Ich stützte mich an der Wand des Treppenhauses ab, schaffte es, einen Fuß aufs Geländer zu stellen, und drückte mich hoch. So war ich als Kind immer auf den Dachboden geklettert. Ich sah Spinnennetze und kleine Unregelmäßigkeiten im Deckenanstrich, die im Licht des Fensters auf dem Treppenabsatz feine Schatten warfen. Ich drückte gegen die Klappe. Sie war schwerer, als ich sie in Erinnerung hatte, und da sie offenbar schon lange nicht mehr geöffnet worden war, hatte sie sich verzogen. Aber sie löste sich mit einem leisen, reißenden Geräusch.
Ich steckte den Kopf in den Dachboden. Es roch staubig, aber sauber. Ich langte nach oben zu einem Schalter, der an einem Querbalken angebracht war; das Licht einer Glühbirne, die von einem Dachsparren baumelte, war hell, reichte aber nicht sehr weit.
Ich legte die Hände auf den Rand des Rahmens. Als ich den letzten Schritt probierte – ich stieß mich vom Geländer ab und drückte mich mit den Armen hoch –, wurde ich mir auf einmal meiner größeren Körpermasse und meiner schwächeren Muskeln bewusst; ich war kein Kind mehr. Eine Sekunde lang glaubte ich, ich würde es nicht schaffen. Aber dann erwies sich mein Bizeps als der Beanspruchung gewachsen. Ich hievte meinen Bauch durch die Luke und setzte mich schwer atmend auf einen Balken, der quer durch den Dachraum lief.
Schachteln und Kisten erstreckten sich in die Schatten wie die Gebäude einer düsteren Miniaturstadt. Ein scharfer, verbrannter Geruch breitete sich aus, als der Staub auf der Glühbirne zu Asche wurde. Der Blick nach unten ins helle Haus war wie die Vision eines umgekehrten Himmels. Als Kind wurde mir nur selten erlaubt, hier heraufzukommen, und selbst als Teenager hatte ich meine Absicht, den Dachboden in so etwas wie meine Bude zu verwandeln, nicht verwirklichen dürfen. Aber das Gefühl der Abgeschiedenheit, das mich überkam, wenn ich durch die Haut des Hauses in diese andere Welt überwechselte, hatte ich immer geliebt.
Ich schwang die Beine herauf. Das Dach war niedrig; ich musste über die Dielen krabbeln, die ich in meinen Zwanzigern über die Dachdämmung genagelt hatte, als sich herausgestellt hatte, dass Glasfaserdämmung nicht gerade gesundheitsfördernd war. Bald waren meine Hände schmutzig, und meine Knie begannen zu schmerzen.
Die meisten Schachteln enthielten Dads Sachen – er war Buchhalter gewesen und hatte sich später selbstständig gemacht; ich fand Akten seiner diversen Arbeitgeber und sogar ein paar muffige alte Buchhaltungslehrbücher. Es war wohl kaum nötig, etwas von diesem Zeug zu behalten; er war vor über acht Jahren in den Ruhestand gegangen. In einer Schachtel fand ich ein kleines, rotes Buch mit Leineneinband, einen alten, ramponierten und viel benutzten Satz Logarithmentafeln: »Knotts Mathematische Tafeln (vierstellig)«. Der Einband des kleinen Buches war richtiggehend ausgefranst. Und da war auch eine schmale Pappschachtel mit einem hölzernen Rechenschieber darin, dessen Skalen mit aufgeklebtem Papier markiert waren. Ich konnte die winzigen Ziffern kaum erkennen, aber das Plastik des Läufers war gelb und rissig. Ich legte den Rechenschieber wieder in die Schachtel und stellte sie zusammen mit den Logarithmentafeln beiseite, weil ich sie später mit hinunternehmen wollte.
Ich kroch tiefer in den Dachboden hinein und entdeckte eine Schachtel mit der Aufschrift »Weihnachtsschmuck – Wilmslow, 1958 – Wilmslow, 1959 – Manchester, 1960 …« und so weiter, durch die Jahre, bis zum Todesjahr meiner Mutter, wie ich sah. In einer Kiste mit allerlei Krimskrams fand ich zwei Briefmarkenalben und eine halb volle Schachtel mit Ersttagsausgaben, Brettspiele aus Plastik in hässlichen Siebzigerjahre-Boxen – und ein Sammelalbum mit Bildern, Originalzeichnungen, geduldig aus Zeitschriften ausgeschnittene Fotos und Comics, alle auf dickes graues Papier geklebt. Das Album meiner Schwester, aus ihren Kinderjahren. Es war die zusammengestoppelte bildliche Darstellung einer Familienlegende, der Geschichte eines Mädchens namens Regina, von Großvätern und Großtanten erzählt. Angeblich war sie zur Römerzeit in Britannien aufgewachsen und nach dem Niedergang Britanniens nach Rom geflohen. Und wir waren Reginas ferne Nachfahren, hieß es in der Geschichte. Ich hatte sie geglaubt, bis ich etwa zehn gewesen war. Ich legte das Album beiseite; vielleicht würde Gina es gern wieder haben.
Dann fiel mir eine weitere Schachtel ins Auge. »TV21s« stand auf dem Etikett, und »(George)«. Mit einigem Eifer zerrte ich sie ans Licht und öffnete sie. Im Innern fand ich einen Haufen Comic-Zeitschriften – »TV Century 21, Abenteuer im 21. Jahrhundert – jeden Mittwoch – wöchentlich.« Sie waren ordentlich gestapelt, von einer sehr schmutzigen und brüchigen Nummer eins an abwärts. Die Zeitschrift war nach Gerry Andersons Science-Fiction-Marionetten-Serien in den Sechzigern entstanden – und ein kolossal wichtiger Bestandteil meines jungen Lebens gewesen. Ich hatte gedacht, meine Eltern hätten den ganzen Stapel mit meiner unsicheren jugendlichen Einwilligung verbrannt, als ich ungefähr zwölf gewesen war.
Ich schlug aufs Geratewohl eine der großformatigen Ausgaben auf. Das abgegriffene Papier war dünn, empfindlich und am Rücken beinahe durchgescheuert. Aber die durchgängig farbigen Comics im Innern waren noch so leuchtend bunt wie 1965. Ich befand mich in Band 19, wo der Kaplan, der Führer der Astraner – Außerirdische, die eine seltsame Ähnlichkeit mit riesigen Geleebonbons aufweisen – im JFK-Stil ermordet wird, und Colonel Steve Zodiac, Kommandant des mächtigen Raumschiffs Fireball XL5, den Auftrag erhält, die Mörder zu finden und einen Raumkrieg abzuwenden.
»Mike Noble.« Es war Peter; er hatte den Kopf durch die Luke gesteckt.
»Entschuldige, ich war schon wieder ganz woanders.«
Er reichte mir einen Becher Tee. »Mein Becher, mein Tee, meine Milch. Ich dachte mir, du nimmst keinen Zucker.«
»Stimmt. Mike wer?«
»Noble. Er hat Fireball für TV21 gezeichnet – und später Zero X und Captain Scarlet. Wir mochten ihn immer am liebsten.«
Wir …? Aber ja, ich erinnerte mich, dass das gemeinsame Interesse an den Anderson-Serien und später an allem, was mit Science Fiction und Weltraum zu tun hatte, ein früher Berührungspunkt zwischen Peter und mir gewesen war, ein Band, das stärker war als meine Abneigung, mit dem Schulspinner in Verbindung gebracht zu werden. »Ich dachte, meine Eltern hätten die alle verbrannt.«
Peter zuckte die Achseln. »Wenn sie dir gesagt hätten, dass sie hier oben sind, hätten sie dich gar nicht mehr vom Dachboden runtergekriegt. Wie auch immer, vielleicht wollten sie sie dir irgendwann zurückgeben und haben es einfach vergessen.«
Das sähe Dad ähnlich, dachte ich verdrießlich.
»Hast du da eine komplette Serie?«
»Ich glaube schon«, sagte ich unschlüssig. »Ich glaube, ich habe sie bis zum Ende gekauft.«
»Bis zu welchem Ende?«
»Hm?«
Er kletterte ein wenig höher herauf – ich sah, dass er eine Trittleiter mitgebracht hatte –, hockte sich auf den Rand der offenen Luke und ließ die Beine baumeln. »TV21 durchlief ein paar Veränderungen, als der Absatz sank. 1968 – bei Band 192 – wurde die Zeitschrift mit einem anderen Titel namens TV Tornado zusammengelegt und brachte mehr Material, das nicht von Anderson stammte. Dann, nach Band 242, wurde sie mit dem Joe90-Comic vereinigt, und so begann eine zweite Serie mit Nummer eins.«
»Bei der letzten Ausgabe, an die ich mich erinnere, war George Best auf dem Titel. Woher weißt du das alles?«
»Ich habe mich damit beschäftigt.« Er hob die Schultern. »Man kann sich die Vergangenheit wieder aneignen, weißt du. Sie kolonisieren. Es gibt immer neue Sachen herauszufinden. Um die Erinnerungen zu strukturieren.« Er seufzte. »Aber für TV21 ist es mit der Zeit immer schwerer geworden. In den Achtzigern gab’s mal eine Welle des Interesses …«
»Als unsere Generation in die Dreißiger kam.«
Peter grinste. »Schon alt genug für Nostalgie, noch jung genug für irrationale Begeisterung und wohlhabend genug, um etwas zu unternehmen. Aber jetzt sind wir schon in den Vierzigern und …«
»Und entwickeln uns zu abgefuckten alten Arschlöchern, und niemand interessiert sich mehr für solche Sachen.« Und, dachte ich, wir werden einer nach dem anderen von der Demografie abgeschossen wie von einem erbarmungslosen Heckenschützen. Ich schaute die Comics durch, betrachtete die knallbunten Panels, die futuristischen Fahrzeuge und leuchtenden Uniformen. »Das einundzwanzigste Jahrhundert ist ganz anders geworden, als ich es mir vorgestellt habe, so viel steht fest.«
Peter sagte zögernd: »Aber es ist ja noch nicht vorbei. Hast du das hier gesehen?« Er hielt sein Handy hoch, ein komplexes neues Spielzeug von Nokia, Sony oder Casio. Ich kannte es nicht; ich interessiere mich nicht für solche technischen Spielereien. Aber auf dem Bildschirm leuchtete ein helles Bild, eine Art Dreieck. »Ist gerade reingekommen. Das Neueste über den Kuiper-Gürtel. Die Anomalie.«
Zwei Tage nach der Entdeckung wusste wahrscheinlich jeder Mensch auf Erden, der einen Fernsehapparat in Reichweite hatte, dass der Kuiper-Gürtel eine lose Wolke aus Kometen und Eiswelten ist, die das Sonnensystem umgibt; sie erstreckt sich vom Pluto fast bis zum nächsten Stern. Und eine Gruppe von Astronomen hatte diese eisige Region mit Radar oder dergleichen untersucht und dabei etwas Ungewöhnliches entdeckt.
Peter erklärte mit ernster Miene, das Bild auf seinem Schirm sei kein echtes Bild, sondern aus komplizierten Radarechos rekonstruiert worden. »So wie man die DNA-Struktur aus der Beugung der Röntgenstrahlung rekonstruiert.«
Der kleine Monitor schimmerte hell in der Dunkelheit des Dachbodens. »Es ist ein Dreieck.«
»Nein, es ist dreidimensional.« Er tippte auf eine Taste, und das Bild drehte sich.
»Eine Pyramide«, sagte ich. »Nein – vier Flächen, allesamt Dreiecke. Wie nennt man das?«
»Ein Tetraeder«, sagte Peter. »Aber es ist so groß wie ein kleiner Mond.«
Im kalten Halbdunkel überlief mich ein Schauer. Ich kam mir sonderbar abergläubisch vor. Es war ohnehin schon eine ziemlich schreckliche Zeit für mich, und jetzt gab es auch noch seltsame Lichter am Himmel. »Ein künstliches Gebilde?«
»Was sonst? Die Astronomen sind völlig aus dem Häuschen geraten, weil sie gerade Kanten entdeckt haben. Und jetzt sehen sie das hier.« Seine hellen Augen leuchteten und spiegelten den blauen Lichtschein des kleinen Bildschirms. »Natürlich sind nicht alle derselben Ansicht. Einige meinen, es sei nur ein Artefakt der Signalverarbeitung und es gebe dort nichts als Echos … Es heißt, dass man eine Sonde hinschicken will. Wie Pluto Express. Aber sie könnte Jahrzehnte brauchen, um dorthin zu gelangen.«
Ich schaute auf die Comics hinunter. »Sie sollten die Fireball schicken«, sagte ich. »Steve Zodiac wäre in ein paar Stunden da.« Auf einmal legte sich ein Schleier vor meine Augen, und ein großer, schwerer Tropfen klatschte von meiner Nase auf ein farbiges Panel. Ich wischte ihn hastig weg. »Scheiße. Entschuldige.« Aber jetzt bebten meine Schultern.
»Ist schon gut«, sagte Peter ruhig.
Ich rang um Selbstbeherrschung. »Verdammt, ich hatte nicht damit gerechnet, dass ich weinen würde. Nicht wegen eines verdammten Comics.«
Er nahm meinen noch vollen Becher und ging die Treppe hinunter. »Lass dir Zeit, so viel du willst.«
»Ach, verpiss dich«, sagte ich, und das tat er.
Als ich meinen Weinkrampf überwunden hatte, kletterte ich mühsam vom Dachboden hinunter. Ich nahm nur den Rechenschieber und die Logarithmentafeln mit. Eigentlich hatte ich in der tröstlichen Gewissheit in mein Hotel im Stadtzentrum zurückfahren wollen, dass ich zumindest die Sperre durchbrochen hatte, zumindest im Innern des Hauses gewesen war und dass nichts, was ich noch zu Tage fördern würde, mich dermaßen quälen konnte.
Aber Peter hatte noch eine weitere Überraschung für mich parat. Als ich die Treppe herunterkam, sah ich, wie er sich mit einer Pappschachtel unter dem Arm eilig zur Tür hinaus verdrücken wollte.
»Hey«, blaffte ich.
Er blieb stehen, schaute auf komische Weise schuldbewusst drein und versuchte tatsächlich, die verdammte Schachtel hinter seinem Rücken zu verbergen.
»Wo willst du damit hin?«
»Tut mir Leid, George. Ich wollte nur …«
Sofort wurde mein eingewurzeltes Misstrauen gegen Peter, den Schulspinner, wieder wach. Vielleicht wollte ich auch nur knallhart erscheinen, nachdem ich vor ihm geweint hatte. »Du hast gesagt, du würdest keine persönlichen Dinge anfassen. Was ist das da, Diebstahl?«
Er schien zu zittern. »George, um Himmels willen …«
Ich schob mich an ihm vorbei und riss ihm die Schachtel aus den Händen. Er sah nur zu, als ich den Deckel abnahm.
Die Schachtel enthielt einen Stapel Pornohefte. Sie waren vergilbt und gehörten zu den munteren Nudistenblättern wie Health and Efficiency. Ich sah sie rasch durch; manche waren zwanzig Jahre alt, aber die meisten stammten aus der Zeit nach dem Tod meiner Mutter.
»O verdammt«, sagte ich.
»Das hätte ich dir gern erspart.«
»Er hat sie in der Küche versteckt?«
Peter zuckte die Achseln. »Wer wäre auf die Idee gekommen, dort zu suchen? Er war schon immer clever, dein Dad.«
Ich grub tiefer in der Schachtel. »Clever, aber ein geiler alter Bock. Das sind alles Pornos – Moment mal.«
Zuunterst lag ein gerahmtes Bild. Es war ein Farbfoto, sehr alt und so billig, dass die Farben verblichen waren. Es zeigte zwei Kinder von drei oder vier Jahren, die nebeneinander standen und aus einem längst vergangenen, sonnigen Tag heraus in die Kamera lächelten. Der Rahmen war ein billiges Holzgestell, wie man es auch heute noch bei Woolworth bekommt.
Peter kam zu mir, um es sich anzusehen. »Das ist das Haus. Ich meine, dieses Haus.«
Er hatte Recht. Und die Gesichter der Kinder waren nicht zu verkennen. »Das bin ich.« Das Mädchen war eine weibliche Ausgabe von mir – die gleichen Züge, das blonde Haar und die rauchgrauen Augen, aber zarter und hübscher.
Peter fragte: »Und wer ist das?«
»Keine Ahnung.«
»Wie alt ist deine Schwester noch gleich?«
»Drei Jahre älter als ich. Wer immer das sein mag, Gina ist es nicht.« Ich ging mit dem Foto ans Tageslicht und betrachtete es lange und eingehend.
In Peters Stimme lag eine gewisse Schärfe. Vielleicht rächte er sich auf subtile Weise für meinen Vorwurf des Diebstahls. »Dann hat dein Vater wohl mehr vor dir verborgen als nur deine Comics.«
Aus dem Wohnzimmer kam ein Klicken. Es war der Videorecorder. Die Maschinerie des Hauses arbeitete weiter, Uhren und Timer klickten und surrten hirnlos, eine belebte Hülle um den leeren Raum, wo mein Vater gewesen war.
3
Die Nacht, als das seltsame Licht am Himmel erschien, war der Wendepunkt in Reginas bisher so angenehmem Leben. Im Nachhinein wunderte sie sich oft darüber, wie sehr die großen Ereignisse am stillen Himmel mit den Angelegenheiten der Erde, dem Blut und dem Schmutz des Daseins verbunden waren. Ihr Großvater hätte die Bedeutung eines solchen Omens erkannt, dachte sie. Aber sie war zu jung gewesen, um es zu verstehen.
Und dabei hatte der Abend so schön, so heiter begonnen.
Regina war erst sieben Jahre alt.
Als sie hörte, dass ihre Mutter sich für ihr Geburtstagsfest ankleidete, ließ Regina ihre Puppen liegen und rannte jubelnd durch die Villa. Sie hüpfte um drei Seiten des Hofes herum, von dem kleinen Tempel mit dem lararium – wo ihr Vater den drei matres, den Familiengöttinnen, mit verärgerter Miene seinen täglichen Tribut aus Wein und Nahrungsmitteln entrichtete – durchs Hauptgebäude mit dem alten, ausgebrannten Badehaus, das sie auf gar keinen Fall betreten durfte, bis zum Zimmer ihrer Mutter.
Als sie dort eintraf, saß Julia bereits auf ihrem Sofa und hielt sich einen silbernen Spiegel vors Gesicht. Sie strich sich eine helle Haarlocke aus der Stirn und sagte ein paar leise, gereizte Worte zu Cartumandua, die mit Kämmen und Haarnadeln in den Händen von ihrer Herrin zurücktrat. Die fünfzehnjährige Sklavin war dünn wie ein Schilfrohr, mit schwarzen Haaren, tiefbraunen Augen und einem breiten, dunklen Gesicht, das an diesem Tag jedoch leichenblass war und vor Schweiß glänzte. Zwei weitere Sklavinnen standen mit bunten Parfüm- und Ölfläschchen daneben, aber Regina kannte ihre Namen nicht und ignorierte sie.
Sie lief ins Zimmer. »Mutter! Mutter! Lass mich deine Haare machen!«
Cartumandua zog den Kamm weg und murmelte mit ihrem starken, ländlichen Akzent: »Nein, Kind. Du verschandelst sie nur. Und wir haben keine Zeit …«
Genauso hatte sie mit Regina gesprochen, als diese noch ein Kleinkind gewesen war und Cartumandua als Gefährtin und Beschützerin bekommen hatte. Aber von einer Sklavin brauchte Regina sich das nicht gefallen zu lassen. »Doch!«, fauchte sie. »Gib mir den Kamm, Cartumandua. Gib schon her!«
»Sch-sch.« Julia drehte sich um und nahm die kleinen Hände ihrer Tochter in ihre zarten, manikürten Finger. Sie trug eine schlichte weiße Tunika, die bald von der eleganten Abendkleidung ersetzt werden würde. »Was machst du denn für ein Geschrei! Willst du unsere Gäste verscheuchen?«
Regina schaute ihrer Mutter in die grauen Augen, die so sehr ihren eigenen glichen – die Familienaugen, Augen voller Rauch, wie ihr Großvater immer sagte. »Nein. Ich will deine Haare machen! Aber Cartumandua sagt …«
»Und sie hat Recht.« Julia zog an Reginas widerspenstigem blonden Schopf. »Sie versucht, mir das Haar zu richten. Ich will ja auf meinem Geburtstagsfest nicht aussehen, als wäre ich den ganzen Tag an den Knöcheln aufgehängt gewesen, nicht wahr?« Das brachte Regina zum Lachen. »Ich sag dir was«, fuhr Julia fort. »Wenn Carta mit meinem Haar fertig ist, kannst du mir beim Schmuck helfen. Wie wäre das? Du hast so ein gutes Händchen bei der Auswahl der richtigen Ringe und Broschen.«
»O ja, ja! Nimm den Drachen.«
»Einverstanden.« Julia lächelte und küsste ihre Tochter. »Ich werde den Drachen tragen, nur für dich. Und jetzt setz dich da drüben hin und sei still …«
Also setzte Regina sich hin, Julia wandte sich wieder ihrem Spiegel zu, und Cartumandua arbeitete weiter an den Haaren ihrer Herrin. Es war eine kunstvolle Frisur: Die Mitte wurde zu einem Zopf geflochten, nach hinten gezogen und aufgewickelt, während eine weitere geflochtene Partie direkt von Julias Stirn emporstieg und über den Kopf nach hinten geführt wurde. Die schweigenden Kammerfrauen salbten das Haar mit Parfüm und Ölen, und Cartumandua befestigte es mit schwarzen Nadeln, die sich dunkel gegen Julias goldenen Schopf abhoben.
Regina schaute hingerissen zu. Es war eine komplizierte Frisur, die Zeit, Sorgfalt und die konzentrierte Aufmerksamkeit einer ganzen Riege von Dienerinnen erforderte – und vor allem deshalb trug Julia sie, so hatte Regina ihre Mutter bei einem jener Erwachsenengespräche sagen hören, die sie nicht richtig verstand. Andere Leute mochten ihr Geld im Familienmausoleum begraben, aber sie würde den Reichtum der Familie zur Schau stellen, damit jeder ihn sah. Außerdem war diese Frisur auf dem Festland gerade in Mode, das schloss sie jedenfalls aus den Bildern auf den neuesten Münzen, die aus den kontinentalen Münzstätten nach Britannien kamen. Julia war fest entschlossen, mit der Mode zu gehen, selbst wenn sie hier in der südwestlichen Ecke Britanniens festsaß, ungefähr so weit von Rom entfernt, wie es nur ging, ohne dass man vom Rand der Welt fiel.
Natürlich liebte Regina Feste, wie jede andere Siebenjährige auch. Und Julia veranstaltete sehr viele Feste – üppige Lustbarkeiten, bei denen die Villa am Rand von Durnovaria in helles Licht getaucht war. Am meisten aber – sogar noch mehr als die Feste selbst – liebte Regina die umständlichen Vorbereitungen: die feinen Gerüche, das leise Klirren der Fläschchen in den Händen der stummen Sklavinnen, das Geräusch, mit dem die Kämme durchs Haar ihrer Mutter fuhren, und die je nach Bedarf mit leiser oder fester Stimme erteilten Anweisungen, mit denen Julia ihren kleinen Stab sachkundig befehligte.
Während die Frisur weiter in Form gebracht wurde, lächelte Julia Regina zu und fing leise zu singen an – nicht in ihrer britannischen Muttersprache, sondern auf Latein, ein altes, seltsames Lied, das ihr Vater ihr beigebracht hatte. Es erzählte von geheimnisvollen, verschwundenen Göttern, doch der Text stellte Regina noch immer vor ein Rätsel, obwohl sie auf das Drängen ihres Großvaters hin sporadische Versuche unternahm, die Sprache zu erlernen.
Endlich war Julias Frisur fertig. Cartumandua erlaubte den Kammerfrauen, mit ihren Parfüm- und Cremefläschchen wieder näher zu treten. Diese Fläschchen waren zum Teil kunstvoll gestaltet; am liebsten mochte Regina ein Balsarium in Form eines kahlköpfigen Kindes. Julia wählte eine Gesichtscreme aus Sandelholz und Lavendel auf der Basis von tierischem Fett, ein wenig Bleiweiß für die Wangen, Ruß, um ihre Augenbrauen auffällig mit ihren blonden Haaren kontrastieren zu lassen, und eines ihrer kostbarsten Parfüms, das angeblich aus einem fernen Land namens Ägypten kam. Es war Regina strengstens verboten, mit diesen Dingen zu spielen, weil sie mittlerweile schwer zu bekommen waren; bis sich alles wieder normalisiert habe und die großen Handelswege, die das Imperium umspannten, wieder offen seien, sagte ihre Mutter, sei dies ihr gesamter Besitz an wundervollen Dingen, und sie seien zudem kostbar.
Schließlich war es an der Zeit, den Schmuck auszusuchen. Während Julia sich Ringe mit kostbaren Steinen und Gemmen an alle Finger steckte, verlangte Regina, ihrer Mutter die Drachenbrosche bringen zu dürfen. Es war ein sehr altes britannisches Motiv, aber im römischen Stil ausgeführt, ein silberner Wirbel, so groß, dass Regina ihn kaum in ihren kleinen Händen halten konnte. Sie kam auf Julia zu und streckte ihr die wunderschöne Brosche entgegen, und ihre Mutter lächelte; das Bleiweiß auf ihren Wangen schimmerte wie Mondlicht.
Es war der Tag der Sommersonnenwende, und der Nachmittag war lang. Der Himmel war blau wie ein Dohlenei und wolkenlos, und er blieb hell, auch als die Sonne schon längst untergegangen war.
Im langsam schwindenden Licht trafen die Gäste ein – zu Fuß, hoch zu Ross oder in ihren Einspännern. Die meisten kamen aus Durnovaria, der nächsten Stadt. Manche standen in der linden Sommerluft im Hof um den Brunnen herum, der noch nie funktioniert hatte, so lange Regina zurückdenken konnte, andere saßen auf Liegesofas oder in Korbsesseln. Sie unterhielten sich, tranken und lachten und nahmen sich dann von den Speisen, die auf den niedrigen Steintischen bereit standen. Es gab runde, frisch gebackene Brotlaibe, Schalen mit einheimischen Früchten wie Himbeeren, Walderdbeeren und Holzäpfeln, gesalzenes Fleisch, aber auch jede Menge Austern, Miesmuscheln, Herzmuscheln, Schnecken und Fischsoße – und, für teures Geld beschafft, ein paar Feigen und etwas Olivenöl vom Festland. Die Höhepunkte waren prächtige kulinarische Extravaganzen: mit Honig und Mohn beträufelte Haselmäuse, Würste mit Damaszenerpflaumen und Granatäpfeln, Pfaueneier in Teig.
Lauthals bewunderten die Gäste Julias neue Dekoration. Die verputzten Wände in der großen Halle waren mit purpurroten und grauen, blau geäderten Blöcken bemalt, und die untere Wandverkleidung trug ein elegantes Muster aus kleinen, grün umrandeten Rechtecken. Regina hatte erfahren, dass die alte Wandgestaltung – von der Natur inspiriert, mit Marmorimitat, Blumengewinden und Kandelabern, verziert mit gelben Gerstenähren – auf dem Festland jetzt völlig aus der Mode war. Ihr Vater hatte laut und lang über die Kosten der neuen Wandbemalung gejammert und sich darüber beklagt, wie schwer es heutzutage sei, Arbeiter zu finden. Ihr Großvater hatte nur die dicken Augenbrauen hochgezogen und dann durchklingen lassen, wie absurd es sei, eine Hälfte einer Villa zu bemalen, wenn die andere Hälfte niedergebrannt sei und man es sich nicht leisten könne, sie wieder aufzubauen …
Aber für Reginas junge Augen sah die neue Wandbemalung viel schöner aus als die alte, und nur darauf kam es an.
Das Unterhaltungsprogramm begann gleich nach der Ankunft der ersten Gäste. Julia hatte einen Geschichtenerzähler engagiert, einen betagten Mann, vielleicht fünfzig Jahre alt, mit einem gewaltigen, wilden, grauschwarzen Bart. Er erzählte – ganz und gar aus dem Gedächtnis – eine lange, weitläufige Geschichte, in der es darum ging, wie der Held Culhwch um die Hand der Tochter des Riesen Ysbadden angehalten hatte. Es war eine Geschichte aus der Zeit der Vorväter, bevor die Caesaren gekommen waren. Nur wenige Leute hörten ihm zu – selbst Regina war zu aufgeregt, um lange in seiner Nähe zu bleiben, obwohl sie wusste, dass es eine gute Geschichte war –, aber der alte Mann würde sie geduldig die ganze Nacht hindurch immer wieder erzählen, und wenn die Getränke im weiteren Verlauf des Festes ihre Wirkung taten, würde seine tiefe Stimme dann auch mehr Aufmerksamkeit erregen. Zu Beginn des Abends waren die Musikanten jedoch beliebter. Sie spielten eine Mischung britannischer und kontinentaler Instrumente, Knochen- und Panflöten, Harfen, Kitharas und Tibias, und ihre fröhliche Musik wehte wie Rauch durch die reglose Luft.
Julias Vater – Reginas Großvater – war da. Aetius, ein baumlanger Soldat, war nach Abenteuern im Ausland jetzt an einem geheimnisvollen, magisch klingenden fernen Ort namens der Wall stationiert. Nachdem er zum fünfundzwanzigsten Geburtstag seiner Tochter quer durch die ganze Diözese Britannien angereist war, stampfte er nun in der Villa herum und schimpfte laut über all die Ausgaben. »Es ist, als wäre der Rhein nie zugefroren«, lauteten seine mysteriösen Worte.
Marcus, Reginas Vater, war ein dünner, ungelenker Mann mit schlicht geschnittenem dunklem Haar und abgespanntem, nervösem Gesicht. Er trug seine Toga. Es erforderte einiges Geschick, dieses formelle Kleidungsstück zu tragen, denn es war sehr schwer, und man musste sich auf die richtige Weise bewegen, damit die Falten natürlich fielen. Da Marcus jedoch nicht daran gewöhnt war, lief er langsam und gewichtig herum, als trüge er einen Anzug aus Blei. Ganz gleich, wie bedachtsam er jeden Schritt tat – und er wagte es nicht, sich hinzusetzen –, die kostbare Toga schleifte über den Fußboden, schlug ihm gegen die Beine und flatterte oder klaffte auf und gab den Blick auf die weiße Tunika darunter frei.
Aber Marcus trug stolz seine phrygische Mütze mit der nach vorn zeigenden Spitze, die ihn als Anhänger des altmodischen, in der Region jedoch beliebten Kybele-Kults auswies. Vierhundert Jahre nach Christi Geburt war das Christentum die Religion des Imperiums. In den Provinzen blieb es jedoch ein Kult der Städte und Villen; die Menschen auf dem Land, die den größten Teil der Bevölkerung stellten, hingen weiterhin ihren uralten, heidnischen Bräuchen an. Sogar in der Elite hielten sich die älteren Kulte. Kybele selbst, eine Muttergottheit, stammte aus Anatolien und war im Gefolge eines Eroberungsfeldzugs nach Rom eingeführt worden.
Wenngleich Marcus in feiner Gesellschaft immer unbeholfen sein würde, so war Julia durch und durch die Gastgeberin. Über einem langärmeligen Hemd trug sie eine in der Taille gegürtete stola. Der dicke Stoff des leuchtend blauroten Gewands fiel in schweren Falten, und der Überwurf über ihrer Schulter wurde von der wunderschönen Drachenbrosche gehalten. Kein Haar schien am falschen Platz zu sein, und für Regina erhellte sie jeden Raum mehr als alle Bronzelampen und Kerzenständer zusammen.
Was Regina selbst betraf, so huschte sie durch die Räume und über den Hof, wo die Öllampen und Kerzen wie herabgefallene Sterne glommen. Cartumandua, die strikte Anweisungen hatte, was Regina essen und trinken durfte (erst recht seit dem berüchtigten Vorfall mit dem Gerstenbier), folgte ihr auf Schritt und Tritt. Wohin Regina auch kam, überall bückten sich Leute, um sie zu begrüßen. Die Gesichter der Frauen waren von einer dicken Puderschicht überzogen, die der Männer schmierig vom Schweiß und den Wirkungen von Wein oder Bier, aber alle lächelten und machten ihr Komplimente über ihre Haare und ihr Kleid. Sie saugte all die Aufmerksamkeit auf, während sie ihre lateinischen Verse oder Gebete an Christus vortrug und zur Musik tanzte. Eines Tages, das wusste Regina, würde sie eine ebenso vornehme und elegante Dame sein wie ihre Mutter; sie würde ihr eigenes Gefolge von Sklavinnen haben – keine derart ungeschickten und bleichen wie Cartumandua, so viel stand für sie fest – und bei ihren eigenen Festen selbst im Mittelpunkt stehen. Diese Feste würden mindestens genau so üppig sein wie die ihrer Mutter und vielleicht sogar in dieser Villa stattfinden. Und als der Abend nun in die Nacht überging, wünschte sie nur, sie könnte die Sonne wieder über den Horizont zerren, um die gefürchtete Stunde des Zubettgehens noch ein wenig hinauszuschieben.
Doch dann nahm ihr Großvater sie beiseite. Er ging mit ihr durch die Falttür am Ende des Speisesaals hinaus auf die Terrasse inmitten der Reihen von Apfelbäumen und Himbeersträuchern. Der geflieste Boden bröckelte, aber der Blick über die Landschaft war wunderschön. Der Himmel wurde dunkler, und die ersten schwachen Sommersterne bohrten sich durchs Blau; der blasse Sternenfluss, der sich zu dieser Jahreszeit über das Himmelsdach zog, war gerade eben zu erkennen. Regina hatte gelernt, dass das lateinische Wort villa »Landgut« bedeutete; sie konnte die Umrisse der Scheune, des Getreidespeichers und der anderen Nebengebäude ausmachen, ebenso die Felder, auf denen tagsüber das Vieh weidete. In den wogenden Hügeln jenseits der Grenzen der Villa blinkte eine einzelne Ansammlung von Lichtern. Es war eine herrliche Nacht.
Aber Aetius’ Miene war streng.
Aetius war ein großer, schwerer Mann, ein regloser Fels der Kraft, der in diesem glitzernden Rahmen deplatziert wirkte. Sie hatte damit gerechnet, dass er in seiner Rüstung zum Fest kommen würde. Doch er trug eine schlichte Tunika aus ungebleichter Wolle mit farbigen Streifen am Saum und an den Ärmeln. Seine Schuhe waren allerdings die eines Soldaten: dicke Holzsohlen, mit Lederstreifen an die gewaltigen Füße gebunden. Er führte zwar keine Waffe mit sich, aber Regina sah die tiefen Narben im muskulösen Fleisch seines Armes.
Marcus hatte ihr erzählt, dass Aetius im Heer gedient und vier Jahre in Europa verbracht hatte – unter dem Kommando von Constantius, einem britannischen Militärbefehlshaber, der mit seinen Truppen das Meer überquert hatte, um den kaiserlichen Purpur zu erringen. Constantius war besiegt worden. Seine Truppen waren aufgelöst oder in andere Einheiten eingegliedert worden und nie zurückgekehrt – bis auf einzelne Soldaten wie Aetius, der jetzt bei den Grenztruppen diente. Marcus hatte verdrossen über all diese Dinge und den geschwächten Zustand des Heeres in Britannien gemurrt. Aber Regina verstand kaum etwas davon und hatte ohnehin eine sonnigere Lebenseinstellung als ihr mürrischer alter Vater; außerdem fand sie die Geschichte von Constantius ziemlich aufregend. Ein Kaiser aus Britannien! Doch als sie Aetius nach seinen Abenteuern fragte, sah er sie nur an. Seine blassgrauen Augen lagen tief in den Höhlen und waren dunkel.
Nun hockte er sich vor Regina auf die Fersen und nahm ihre kleine Hand in seine riesige Tatze.
»Hab ich was angestellt?«, stammelte sie nervös.
»Wo ist Cartumandua?«
Regina schaute sich um und merkte zum ersten Mal, dass die junge Sklavin nicht an ihrem gewohnten Platz war, ein paar Schritte hinter ihr. »Ich weiß nicht. Ich bin ihr nicht weggelaufen, Großvater. Es ist nicht meine Schuld. Ich …«
»Ich will dir sagen, wo sie ist«, sagte er. »Sie ist in ihrem Zimmer. Und übergibt sich.«
Regina bekam es mit der Angst. Ein Rüffel von Aetius war viel schlimmer als jede Ermahnung ihrer Mutter oder gar ihres Vaters; wenn man von Aetius erwischt wurde, saß man wirklich in der Patsche. »Ich hab nichts getan«, jammerte sie.
»Ganz bestimmt nicht? Ich weiß, was du früher immer getan hast«, sagte er. »Du hast ihr befohlen, im Kreis zu laufen, bis ihr schwindlig wurde. Deine Mutter hat es mir erzählt.«
Das stimmte, wie sie zu ihrer Schande gestehen musste. »Aber das ist lange her. Es muss – ach, es muss Monate her sein! Da war ich ja noch ein kleines Mädchen!«
»Und warum ist Carta dann übel?«
»Ich weiß es nicht!«, protestierte Regina.
Er kniff die Augen zusammen. »Ich frage mich, ob ich dir glauben soll.«
»Ja!«
»Aber du sagst nicht immer die Wahrheit. Oder, Regina? Ich fürchte, du wirst ein verzogenes und eigensinniges Kind.«
Regina kämpfte mit den Tränen. Sie wusste, dass Aetius Weinen als Zeichen der Schwäche betrachtete. »Meine Mutter sagt, ich bin ein braves Mädchen.«
Aetius seufzte. »Deine Mutter liebt dich sehr. So wie ich. Aber Julia ist nicht immer … vernünftig.« Sein Griff um ihre Hand lockerte sich. »Hör zu, Regina. Du kannst dich einfach nicht so benehmen. Das Leben geht nicht so weiter wie bisher, wenn du groß bist. Die Dinge werden sich ändern – ich weiß nicht, wie, aber ändern werden sie sich, so viel steht fest. Und ich glaube, Julia versteht das nicht immer. Deshalb bringt sie es dir nicht bei.«
»Sprichst du von Constantius?«
»Von diesem Hanswurst? Ja, unter anderem.«
»Niemand sagt mir was. Ich weiß nicht, was du meinst. Und es ist mir auch egal. Ich will nicht, dass die Dinge sich ändern.«
»Was wir wollen, zählt wenig in dieser Welt, meine Kleine«, sagte er ruhig. »Jetzt zu Carta. Du darfst nicht vergessen, dass sie ein Mensch ist. Eine Sklavin, ja, aber ein Mensch. Weißt du, dass sie den Namen einer Königin trägt? Ja, den Namen einer Königin der Briganten, einer Königin, die vielleicht sogar Kaiser Claudius persönlich gegenübergestanden hat!« Die Briganten waren ein Stamm der alten Zeit, wie Regina gelernt hatte, und Claudius hatte Britannien vor langer, langer Zeit ins Imperium eingegliedert. »Aber jetzt«, sagte Aetius, »ist diese königliche Familie so arm, dass sie ihre Kinder in die Sklaverei verkaufen musste.«
»Meine Eltern haben Carta für mich gekauft.«
»Ja, so ist es. Aber Carta ist trotzdem die Tochter einer Prinzessin. Und du hast Glück, dass du überhaupt eine Dienerin hast. Früher einmal gab es für alles Sklaven. Man hatte sogar einen Sklaven, der die Zeit ausrief – ein menschliches Stundenglas! Aber jetzt glauben nur noch deine Mutter und ein paar andere, dass sie sich Sklaven leisten können. Jedenfalls darfst du Carta nicht schlecht behandeln.«
»Tu ich doch gar nicht!«
»Und dennoch ist sie krank.«
Regina dachte zurück und entsann sich, wie blass Carta bei Julias Ankleidezeremonie gewesen war. »Aber sie war schon vor dem Fest krank. Ich hab sie gesehen. Geh zu ihr und frag sie, was los ist.«