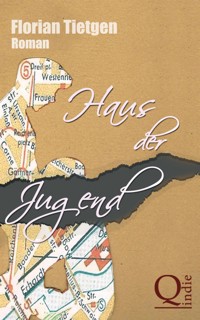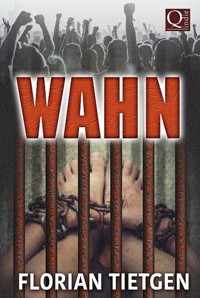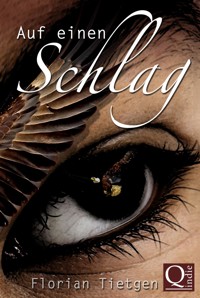
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Warum jetzt? Ich bin doch viel zu jung zum Sterben. Der 15-jährige Benjamin ist stinksauer. Gerade hat er seinen ersten Kuss bekommen, als er sich plötzlich in einen Adler verwandelt. Er soll dem gleichaltrigen Pavle helfen, sich nach einem beim Fußballspiel erlittenen Schlaganfall zurück ins Leben zu kämpfen. Gleichzeitig soll sich Benjamin um Pavles schizophrene Mutter und den überlasteten Großvater kümmern. Der Adler fühlt sich hoffnungslos überfordert.
Qindie steht für qualitativ hochwertige Indie-Publikationen. Achten Sie also künftig auf das Qindie-Siegel!
Für weitere Informationen, News und Veranstaltungen besuchen Sie unsere Website: qindie.de
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Auf einen Schlag
Mein besonderer Dank geht an Tobias Hirt, der mir geduldig meine Fragen beantwortet hat und dessen Geschichte unter http://www.darknumina.de/ nachzulesen ist. Ihm wünsche ich auf diesem Wege weiterhin alles Gute.BookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenAuf einen Schlag
Auf einen Schlag
Florian Tietgen
Qindie steht für qualitativ hochwertige Indie-Publikationen.
Achten Sie also künftig auf das Qindie-Siegel!
Für weitere Informationen, News und Veranstaltungen besuchen Sie unsere Website.
http://www.qindie.de
Über den Autor
Florian Tietgen, Jahrgang 1959, hat seit 2003 mehrere Kurzgeschichten und 2007 seinen ersten Roman veröffentlicht. Inzwischen hat er seine eigene Edition bei der Knaurtochter neobooks, veröffentlicht sowohl als Verlagsautor als auch im Selfpublishing und unterstützt das Autorennetzwerk Qindie.
Website
Danksagungen
Mein besonderer Dank geht an Tobias Hirt, der mir geduldig meine Fragen beantwortet hat und dessen Geschichte unter http://www.darknumina.de/ nachzulesen ist. Ihm wünsche ich auf diesem Wege weiterhin alles Gute.
Ebenfalls danke ich Anne Aichner, die mir zu jeder Frage zu Therapieansätzen zehn Gegenfragen stellte und so für die notwendige Genauigkeit sorgte.
Impressum:
Copyright der E-Book-Ausgabe © 2014 Florian Tietgen
Covergestaltung: Jacqueline Spieweg
Unter Verwendung einer Fotografie von Brian Kushner und einer Fotografie von monkeybusinessimages Dreamstime
Printausgabe beim Verlag Driediger:
Alle Rechte liegen beim Autor.
Florian Tietgen
Kontakt:
E-Mail: [email protected]
1
Benjamin lacht im Gegenwind. Er tritt in die Pedale seines knallroten Fahrrads. Seine Jacke bläht sich nach hinten auf und bremst wie ein Fallschirm ein bisschen die Fahrt. Aber das beeindruckt Benjamin nicht.
Yvonne hat ihn geküsst. Zum ersten Mal hat sie sich zu ihm gebeugt, ihm gesagt, er sei süß, und ihm einen dicken Schmatzer auf den Mund gegeben.
Da fliegen die Beine noch schneller, vor lauter Übermut treibt ihn das Herz zu neuen Geschwindigkeitsrekorden. Yvonne. Schon der Name schmilzt im Mund wie Vanilleeis, der Geschmack rinnt die Speiseröhre hinunter und taucht in sein Blut. Ihr dunkles Haar schimmert im Glanz der Sonne, ihre braunen Augen fangen die Wärme und geben sie ab, wie ein Lagerfeuer, an dem man gemeinsam sitzt und singt.
Sogar Frank ist hinter ihr her, dieser Angeber, der meint, alle Mädchen der Welt würden nur auf ihn warten.
Aber sie hat Benjamin geküsst.
Soll Frank doch grün werden vor Neid! Soll er vor lauter Boshaftigkeit weiter über Benjamins Hautfarbe lästern oder behaupten, dass normale Menschen so hartes, strohiges und gelocktes Haar, wie er es auf dem Kopf hätte, höchstens schamhaft in der Unterhose trügen.
Yvonne hat sich zu ihm, zu Benjamin gebeugt, ihm die Arme um den Hals gelegt und …
Benjamin bekommt sich gar nicht wieder ein, rast durch den Park nach Hause, möchte den Kuss auskosten und kann doch nicht anders als fliegen.
Die Sonne scheint auf seine braune Haut, auf seine Locken. Der Wind wirbelt den Sand ein bisschen auf und weht ihn in Benjamins Gesicht. Doch alles ist egal. Was ist schon ein bisschen Sand, wenn das Leben so großartig ist? Hummeln schwirren von Hagebuttenblüte zu Hagebuttenblüte, Mücken um Benjamins verschwitzten Kopf. Und etwas Größeres als ein Sandkorn fliegt ihm ins linke Auge. Benjamin sieht es als kurzen, dunklen Blitz auf sein Gesicht zukommen, kann aber die Lider nicht mehr rechtzeitig zukneifen und die Wimpern nicht mehr als schützenden Vorhang schließen.
Ein stechender, feuchter Schmerz treibt ihm Tränen ins Gesicht und zwingt Benjamin, anzuhalten. Der Junge reibt sich das Auge von außen nach innen, immer zur Tränendrüse hin, wie er es gelernt hat. Aber der dicke Klumpen, der auf seiner Netzhaut brennt, will nicht verschwinden. Benjamin drückt das Auge zu. Er kann es beim besten Willen nicht offen halten. Immer wieder reibt er daran, auch als er sein Fahrrad an die Hand nimmt wie einen kleinen Bruder und es langsam nach Hause schiebt. Jetzt müsste er doch rasen, um seine Mutter so schnell wie möglich bitten zu können, in sein Auge zu schauen und das Insekt, das ihm hineingeflogen ist, zu entfernen wie ausgefallene Wimpern. Doch während das Glück ihn rasen ließ, lässt der Schmerz ihn der möglichen Hilfe entgegenkriechen. Vielleicht hat Benjamin ja Glück und die Tränen verrichten ihren Dienst, spülen den Fremdkörper einfach fort?
Benjamins Mutter ist nicht da. Auf dem Küchentisch liegt ein Zettel, den der Junge nicht lesen kann. Ein Schleier aus feuchten Wimpern lässt die Zeilen verschwimmen. Sie wird einkaufen oder bei einer Freundin sein. Benjamin stellt sich vor den Spiegel im Bad, zerrt die Haut an seiner Wange nach unten, um in sein Auge sehen zu können. Unter den Lidern ist die Haut rot gereizt. Aber er kann keinen dunklen Fleck erkennen, keine Wimper, kein Insekt. Er sieht nichts.
Am besten setzt er sich vor den Fernseher und wartet, bis seine Mutter kommt. Langsam gewöhnt er sich an den Schmerz, die Tränen werden weniger und er kann das Auge sogar wieder öffnen. Das Feuer darin erlischt. Nur ein kleiner Druck bleibt, wie der Schorf einer Wunde. Wahrscheinlich haben die Tränen schon längst ihren Dienst getan, lediglich die Nerven sind noch in gereizter Abwehrhaltung.
Das Gefühl schmeckt nach, so wie er am Mund noch die Lippen von Yvonne spürt. Das Bild des Fernsehers erscheint Benjamin auf einmal nicht mehr verschleiert, sondern gestochen scharf wie eine Postkarte. Er zappt durch die Kanäle, schaltet in den Videotext, der sich flimmerfrei wie die Seiten eines Buchs lesen lässt.
An dem Gerät kann es nicht liegen. Auch die zart gestanzten Beschriftungen und Zeichen der Schaltelemente kann Benjamin so deutlich erkennen, als säße er direkt davor. Er schaut sich im Zimmer um, betrachtet die Bilder unbekannter Künstler an der Wand, deren Signaturen ihm zum ersten Mal auffallen. Die Titel auf den Buchrücken im Regal – jeden einzelnen kann er vom Sofa aus lesen.
In der Küche sieht er auf den Zettel. Wie gedruckt teilt ihm seine Mutter mit, sie sei mit Papa in der Stadt. Jetzt kneift Benjamin nicht vor Schmerz die Augen zu, sondern um auszuschließen, dass er träumt. Bestimmt eine ganze Minute hält er sie geschlossen, tastet sich währenddessen am Küchentisch vorbei zum Fenster.
Als er die Augen wieder öffnet, kann er von dort auf die Scheiben gegenüber sehen. Sie spiegeln den Glanz der untergehenden Sonne, blenden Benjamin. Deshalb wandert sein Blick über die Backsteinmauer des Hauses, die Regenrinne entlang, an der sich vertrocknete Wassertropfen bräunlich vom glatten Grau des Plastiks abheben. Mücken schwirren um den Dachfirst, ein Marienkäfer krabbelt über den Kunststoff, bevor er sich zu einem Blatt des Flieders im Vorgarten begibt.
Wieder schließt Benjamin die Augen, versucht, ganz ruhig Luft zu holen, zählt bis zwanzig jeden Atemzug mit, bevor er im Flieder auf der anderen Straßenseite den Marienkäfer sucht. Er findet ihn sogleich auf dem Blatt. Sechs Punkte hat er auf seinem Panzer, auf jeder Seite drei.
Ein Kuss von Yvonne, so schnell vergessen, das feuchte Brennen auf der Netzhaut ist verschwunden. Wieder und wieder schließt Benjamin die Augen, mal gleichzeitig, mal abwechselnd. Immer neue Objekte sucht er: Die Mücken am Dachfirst, die weit entfernten Straßenschilder, die Hausnummern, Blüten – alles kann er erkennen.
Er greift nach dem Schlüssel, setzt sich noch einmal auf das Fahrrad. Die parkenden Autos erscheinen so nah, als überrollten sie ihn die Fußgänger wirken, als liefen sie in ihn hinein, wenn er sie nicht weitflächig umkurvte. Leicht zittert er, drosselt das Tempo. So unsicher tritt er in die Pedale, als säße er das erste Mal auf einem Rad, fährt so langsam, dass er kaum die Balance halten kann und schließlich absteigt und das Rad schiebt.
Was ist ihm ins Auge geflogen, das seine Sehkraft so verändert?
Als er wieder zu Hause ankommt, sind seine Eltern zurück. Im Flur sticht ihm die Papiertasche einer edlen Boutique ins Auge. Er schreckt zurück, als sein Vater noch einen Meter von ihm entfernt steht.
»Du hast ja noch gar nichts zu essen gemacht«, stellt die Mutter mit einem Blick auf die ordentliche Küche fest.
»Ich wollte auf euch warten.« Wenn er krank wäre und Fieber hätte oder wenn er immer noch das Insekt in seinem Auge spürte, hätte er es den beiden erzählen können. Aber wie soll er erklären, was gerade in ihm vor sich geht? Benjamin ertastet wie blind die Tassen und Teller, als er den Tisch für das Abendbrot deckt. Die neuen Abstände sind noch ungewohnt. Er streicht mit der Hand über die Platte, um die Teller nah genug an den Rand zu stellen.
»Was machst du da?«, fragt sein Vater. »Geht es dir nicht gut?«
»Doch, alles bestens. Mir ist vorhin nur etwas ins Auge geflogen.«
Benjamins Mutter stellt den Brotkorb ab, setzt ihren Sohn auf einen Stuhl und hält seinen Kopf nach hinten. »Lass mich mal nachschauen.« Sie zieht das Lid nach unten. »Ein bisschen rot ist es noch. Aber es scheint nichts mehr …«
Einen kurzen Moment lang stockt ihr der Atem. »Setz dich bitte ans Fenster.« Ruhig und beherrscht klingen ihre Worte, als hätte sie etwas Unglaubliches entdeckt. Sie wartet ab, bis Benjamin den Stuhl verschoben und sich wieder gesetzt hat, beugt sich noch einmal über ihn und schaut ihm in das linke Auge. »Das ist ja komisch. Es sieht aus, als hättest du Kontaktlinsen.«
Der Vater stellt sich ins Licht. Auch er beugt sich über seinen Sohn, sieht ihm offenen Mundes ins Auge.
2
Du kannst gar nicht anders, als die Arme zum Jubel hochzureißen, fühlst weder Muskeln noch Erschöpfung, weder das Ziehen in den Zähnen noch das in der Lunge. Die Endorphine überschütten dich mit solcher Macht, dass du sie in Bewegung umsetzen musst. Raus an die Spielfeldlinie, hin zur Eckfahne, dich in frenetischen Schreien des Publikums sonnen, Purzelbäume schlagen und dich von den Mannschaftskameraden zu Boden drücken und küssen lassen.
Dafür bist du gelaufen, über Grätschen gesprungen, hast dir an das Schienbein treten und in den Oberarm schlagen lassen, bis du allein vor dem Torwart warst, die Angst in seinen Augen, das Zucken in seinen Gliedern gesehen hast.
So heiß dein Herz auch klopfte, so kalt hast du geschossen.
Während du die Spannung aus dir herausschreist und eine Faust ballst, fliegen dir die Gefühle eines Stadions zu. Menschen lachen, brüllen, weinen, jubeln, und du bist es, der sie steuert. Dein Treffer setzt Emotionen frei.
Ich hatte noch nie Sex, aber er kann kaum großartiger sein.
Wenn ich trainiere, habe ich keine Zeit für Gedanken und keinen Platz für Angst. Es gibt meinen Körper und mich. Schmerzende Muskeln, Atem, der sich wie Säure durch die Luftröhre frisst, Wind, der wie Ameisen über den Schweiß in meinem Gesicht läuft. Jede Faser spüre ich, jede Pore. Es ist, als öffnete sich alles in mir, um aus mir hinauszuströmen.
Ich denke nicht an meinen Vater, der irgendwo in München eine neue Frau kennengelernt und Mama und mich vergessen hat. Ich denke nicht an meine Mutter, die ihren Kummer darüber in eine Klinik getragen hat.
Wenn ich trainiere, gibt es sie nicht. Ich brauche einen Ball, meine Füße, meine Lungen, meine Muskeln und meine Augen.
Ich brauche Willy, der mir und den anderen Anweisungen über den Sportplatz brüllt, uns faule Hunde oder Drecksäue nennt und uns anherrscht, uns zu überwinden. Die inneren Schweinehunde sind wir selbst.
Wenn ich spiele, ist es ein Rausch aus Schmerzen und Glück, aus Schweiß und Ekstase, auch ohne Publikum im Stadion.
Bei uns stehen nur Verwandte am Spielfeldrand, um uns anzufeuern. Aber ich kann sie schon hören, die Massen im Stadion. Irgendwann werden sie mir zujubeln, mit mir leiden und sich mit mir freuen. Dafür trainiere ich.
Nach dem Training stehen wir matt unter dem heißen Strahl der Duschen, nicht in der Lage, zu reden. Mühsam waschen wir uns den Schweiß aus den Haaren und vom Körper, lehnen uns mit geschlossenen Augen an das Wasser.
»Wenn ihr noch herumalbern könnt, habt ihr nicht genug trainiert«, sagt Willy immer. Aber nach seinem Training ist niemandem danach, herumzualbern.
Das Handtuch um die Hüften gewickelt, gehe ich zu meinem Spind, hole die frische Wäsche aus der Sporttasche und ziehe mich an.
»Du warst gut heute, Pavle. So möchte ich dich beim Spiel am Sonntag sehen.« Willy steht vor mir. Sein Lob sichert mir einen Platz in der Startaufstellung zu. Ich bedanke mich nickend und immer noch erschöpft. Ein Lächeln bringe ich zustande, während ich mich umdrehe und meine schweißnassen Sachen in die Sporttasche stopfe.
»Geht klar, Willy.«
Er klopft mir auf den Rücken, bevor er zum nächsten Spind geht und einen weiteren Spieler glücklich macht.
Pavle haben meine Eltern mich genannt, weil meine Mutter in einen Pavle verliebt gewesen ist. Er war groß und loyal, eigentlich kein Mann, in den Frauen sich verlieben, eine Nebenfigur, ähnlich wie Sam aus dem Herrn der Ringe, der durch beharrliche Treue zum Helden geworden ist. Und auch der Pavle meiner Mutter stammte aus einem Roman und einer Fernsehserie. Er wurde im mutigen Kampf mit einem Luchs verletzt und war der ruhende Ausgleich zwischen Branko, Duro und der roten Zora. Dieses Buch liebt meine Mutter heute noch so sehr, dass ich es ihr ins Krankenhaus bringen musste.
Dominik strahlt. Das Duschwasser tropft noch aus seinem dunklen Haar, der Rücken ist feucht und sein Handtuch liegt auf dem Fußboden. Nackt sitzt er auf der Bank vor seinem Schrank, die Tasche zu seinen Füßen, und sieht Willy ins Gesicht, während er das Lob für seinen Einsatz entgegennimmt.
»Danke«, sagt er, wühlt mit den Händen nach einer sauberen Unterhose und wendet sich zu mir. »Hey, am Sonntag werden wir sie fertigmachen.«
»Mach mal schneller. Mein Opa wartet mit dem Abendessen.« Ich bin schon angezogen, während Dominik in seine Klamotten trödelt. Nach und nach kommen die anderen, finden ihre Stimme wieder, freuen sich auf das Spiel am Wochenende und warten, ob Willy sie einsetzen wird.
Dominik sucht jedes Kleidungsstück einzeln aus seiner Tasche, bevor er es anzieht. »Am Sonntag sollen wieder Späher kommen. Und Willy hat mich aufgestellt.«
Ich muss grinsen. Seit ich die Einladung zu einem Sichtungstraining erhalten habe, gibt es immer wieder solche Gerüchte. Vielleicht kommt jemand vorbei, vielleicht auch nicht. Mich hatte der Brief ganz unerwartet erreicht.
»Wäre das nicht cool, wenn wir zusammen dorthin könnten und das Training rocken würden?«
Ich grinse immer noch. »Ja, das wäre es.«
Hätte ich nicht ein Spiel für dieses Training absagen müssen, hätte ich wohl nichts davon erzählt, sondern mich mit Opa gemeinsam gefreut. Ich kam mir ätzend vor, stolz auf den Erfolg, glücklich über die riesige Chance, aber wie ein Angeber und Verräter, der vor lauter Arroganz abhebt und seine Mannschaft im Stich lässt. Ich traute mich kaum, Willy ins Gesicht zu sehen, als ich ihm den Brief vom Hamburger Sportverein zeigte. In meinem Magen grummelte es, meine Schultern hingen nach unten und mein Blick war auf das Linoleum der Umkleidekabine gerichtet. Willy hatte nichts Besseres zu tun, als die Einladung gleich in die Höhe zu halten und sie der ganzen Mannschaft vorzulesen.
»Ich wusste immer, dass unser Pavle Talent hat!«, rief er enthusiastisch durch den Raum. »Und ich wusste immer, dass ich als Trainer gut genug bin, ihn zu fördern.«
Die Mannschaft murrte zustimmend. Nacheinander kam jeder auf mich zu. Jungen in Boxershorts oder mit einem Handtuch um die Hüften klopften mir auf die Schultern oder reichten mir die Hand. Dominik stand nur in Socken vor mir, schlug mir auf den Oberarm und forderte mich auf, ein gutes Wort für ihn einzulegen. Jeder Glückwunsch demütigte mich. Ich sollte sie für ein Spiel im Stich lassen und sie freuten sich für mich.
Seitdem legten sie sich bei den Spielen besonders ins Zeug. Immer glaubten sie, jemand wäre da, um mich zu beobachten, und hofften auf die Chance, selbst aufzufallen.
»Wenn ich den Brief nicht wirklich erhalten hätte, hätte ich ihn fälschen müssen«, sage ich, während Dominik endlich den Reißverschluss seiner Sporttasche schließt.
»Ist er etwa gefälscht?« Dominik lacht und schubst mich zum Ausgang.
3
»Es ist ein Bussard«, behauptet Benjamins Vater und schaut dabei ganz tief in das linke Auge seines Sohnes.
»Nein, ein Adler.« Benjamins Mutter drängt ihren Mann zur Seite und drückt wieder den Kopf des Jungen nach hinten, hält sein Gesicht ins Licht. Ganz klein ist das Abbild eines Vogels, das die beiden in seinem Auge entdeckt haben.
»Wo hast du das her?«
Benjamin zuckt mit den Schultern. Sein Magen knurrt, auf dem Tisch liegen Brot und Mettwurst, ein Glas Gewürzgurken steht verlockend da, das Auge hat sich längst von dem Fremdkörper, der hineingeflogen ist, erholt, aber seine Eltern haben nichts Besseres zu tun, als sich darüber zu streiten, welchen Vogel sie nun auf seinen Pupillen sehen. Als Benjamin vorhin in den Spiegel geschaut hat, konnte er gar nichts erkennen. Seine Eltern haben wohl selbst einen Vogel.
Die Mutter packt ihren Sohn an der Schulter und schaut ihm ins Gesicht. »Woher hast du diesen Vogel?«
»Ich weiß es nicht. Mir ist nur etwas ins Auge geflogen, als ich mit dem Rad unterwegs war.« Das Gesicht seiner Mutter ist so nah bei Benjamin, dass es ihm vorkommt, als krieche sie gleich in ihn hinein. Jede Pore, jeden Mitesser kann er sehen. Bisher war ihm nie aufgefallen, dass auch seine Mutter ganz feine Härchen im Gesicht hat. Viel zu wenig, um sich rasieren zu müssen, aber doch fast so braun wie die auf ihrem Kopf. Sie müssen also immer sichtbar gewesen sein. Auch die zarten blauen Linien in den grünen Augen hatte Benjamin bisher nie bemerkt. Aber die waren wirklich so dünn, dass er dazu wohl ein Mikroskop oder die Liebe benötigt hätte. Yvonne hat auch so zarte Linien, nur sind ihre leicht gelb.
Benjamin reißt sich von seiner Mutter los und setzt sich auf einen Stuhl. Unwillkürlich hält er den Daumen ins Glas, als er sich Cola eingießt. Er muss ein bisschen tasten, um eine Scheibe Brot zu erwischen und sie auf den Teller zu legen, der fast auf seinem Schoß zu liegen scheint.
»Hast du Schmerzen?«, fragt der Vater. Auch er setzt sich endlich an den Tisch.
»Nein. Es juckt nur noch ein bisschen.«
»Morgen gehst du zum Augenarzt.« Die Mutter ist die Letzte, die Platz nimmt. »Vielleicht hat dir das Insekt die Netzhaut verletzt. Bist du wieder so schnell gefahren?«
Benjamin schüttelt den Kopf und streicht sich Butter auf das Brot.
Er hatte seinen Eltern von Yvonne erzählen wollen. Stattdessen regen sie sich über eine Lappalie auf. Besser, er erzählt ihnen nicht davon, wie scharf er auf einmal sehen kann. Sie würden sich nur unnötige Gedanken machen.
»Es ist gut, Dagmar«, sagt Benjamins Vater. »Lass uns in Ruhe essen.« Leicht kann der Junge in dessen Gesicht jedes einzelne Barthaar ausmachen, das sich durch die vom Nassrasierer gereizte Haut kämpft.
In Ruhe essen? Benjamin ist hungrig. Aber seine Eltern haben ihn auch neugierig gemacht. Was haben sie gesehen? Gern würde er ins Bad laufen, um dort im Spiegel noch einmal selbst in sein Auge zu schauen. Doch das würde nur zu neuen Diskussionen führen. Er isst etwas hastiger als sonst, trinkt seine Cola aus, die ihm viel klebriger und süßer als gewöhnlich erscheint. Die Krümel auf seinem Teller pickt Benjamin auf seinen Zeigefinger und leckt sie davon ab. Er geduldet sich sogar, bis sein Vater die Teller zusammenräumt und seine Mutter ihren Stuhl vom Tisch rückt und sich erhebt, bevor er die Treppe hinaufstürmt.
Mit jedem Schritt drei Stufen – hat er jemals so viele geschafft? In der gleichen euphorischen Geschwindigkeit, mit der er am Nachmittag Fahrrad gefahren ist, läuft er nach oben. Es scheint, als setze er die Füße nur noch auf, um sich zu einem neuen Flug abzustoßen.
Benjamin muss nicht nah an den Spiegel heran. Er muss das Auge auch nicht mehr mit den Fingern offen halten.
Fremd scheint ihm das Bild, das er sieht. Die Nase kennt er nicht. Sie ist größer und gebogener als er sie in Erinnerung hat. Eklig möchte Benjamin diese Nase finden, sich fragen, wie Yvonne solch ein Gesicht küssen konnte. Aber es gelingt ihm nicht.
Wenn er sich nicht täuscht, stehen die Augen weiter auseinander und sind runder geworden. Sie befinden sich fast an der Seite seines Gesichts. Warum ist seinen Eltern das nicht aufgefallen? Auch die Farbe hat sich geändert. Die Iris ist fast gelb, nicht mehr braun. Eine Figur in der Pupille kann Benjamin nicht entdecken. Weder einen Falken noch einen Adler. Worüber haben sich seine Eltern gestritten?
Auf seiner dunklen Haut fallen ihm weiße ganz zarte Härchen auf, die das Gesicht überziehen.
Und obwohl er in den Spiegel schaut, sieht er, als sich im toten Winkel die Badezimmertür öffnet und seine Mutter hereinkommt.
»Ich sehe keinen Vogel«, sagt er, noch ehe seine Mutter fragen kann.
»Bestimmt war es nur eine Spiegelung in der Scheibe. Das Licht spielt uns manchmal solche Streiche.«
Die Mutter stellt sich hinter ihren Sohn, dreht ihn zu sich, sodass sie ihm ins Gesicht schauen kann. »Du siehst ganz normal aus. Nur etwas blass.« Sie legt ihm die Hand auf die Stirn. »Wirst du krank?«
»Nein«, sagt Benjamin. »Ich fühle mich bestens. Als ob ich fliegen könnte.«
Sie muss doch die Veränderungen sehen. Warum sagt sie nichts dazu? Sie lächelt, gibt Benjamin einen Kuss auf den Höcker seiner Nase und wünscht ihm eine gute Nacht. »Bleib nicht mehr so lange auf. Sonst bekomme ich dich morgen früh wieder nicht wach.«