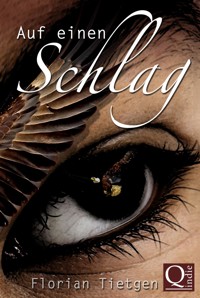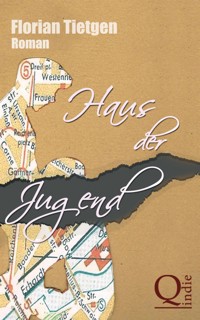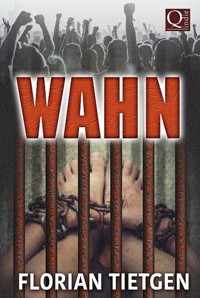3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Für Henrik gibt es viele Gründe, sich vor der Welt und dem Leben zu verstecken. Da ist sein Hang, zuzuschlagen, wie sein Vater es bei ihm getan hat. Da ist seine beste Freundin Michi, die behauptet, er könne mit seinem Atem Knochenbrüche heilen und da ist eine Zeitung, der zufolge er ein totes Kind zum Leben erweckt haben soll. Da ist Jan, den er am liebsten küssen würde. Und da sind die Farben, die wie Nieselregen die Menschen umgeben, die aber außer ihm niemand sieht. Haben die mit dem Kästchen zu tun, das ihm seine Großmutter vor ihrem Tod mit den Worten in die Hand gab, er solle es behüten. Und erst öffnen,
... wenn es Zeit ist ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
... wenn es Zeit ist ...
Für meinen Urgroßvater, der mit seinem Glauben Menschen heilen konnte.BookRix GmbH & Co. KG81371 München... wenn es Zeit ist ...
Qindie steht für qualitativ hochwertige Indie-Publikationen.
Achten Sie also künftig auf das Qindie-Siegel!
Für weitere Informationen, News und Veranstaltungen besuchen Sie unsere Website.
http://www.qindie.de/
Über den Autor
Florian Tietgen, Jahrgang 1959, hat seit 2003 mehrere Kurzgeschichten und 2007 seinen ersten Roman veröffentlicht. Inzwischen hat er seine eigene Edition bei der Knaur-Tochter neobooks, veröffentlicht sowohl als Verlagsautor als auch im Selfpublishing und unterstützt das Autorennetzwerk Qindie.
Website
Impressum:
Copyright © 2013 Florian Tietgen
Covergestaltung: Jacqueline Spieweg
Coverfoto: Aeroplane© gracel21 - Fotolia.com
Lektorat: Satzklang
Alle Rechte liegen beim Autor.
Kontakt:
E-Mail: [email protected]
1.Buch
Was war, das ist
Von Veränderung (1976)
Michi scheint noch nicht da zu sein. Kurz schaue ich auf die dunkel getäfelten Holzwände, die Bilder von Charly Parker und Louis Armstrong und die ausgemusterten Instrumente. Die meisten Tische sind von Berufstätigen besetzt, die gerade ihre Mittagspause machen. Es ist ein schöner Luxus, mitten in der Woche jetzt erst zu frühstücken. An einem Tisch sitzt eine junge Frau in elegantem Kostüm, das kurz geschnittene Haar mit hellen Strähnen versehen. Sie lächelt mich an. Vom Gesicht her …
»Henrik!«, ruft die junge Frau und winkt. Ich gehe auf den Tisch zu und erkenne langsam Michis vertraute Gesichtszüge.
»Was für ein Imagewandel«, begrüße ich sie und bücke mich für einen Kuss.
»Morgen beginne ich schließlich meine Ausbildung. Ich muss mich an dieses Zeug gewöhnen.«
»Ich mich auch«, sage ich, als ich Platz nehme und meine Zigaretten auf den Tisch lege. »In Jeans und Motorradjacke gefällst du mir besser.«
Von roher Gewalt, vom Kennenlernen und von Verunsicherung (1973)
Kein Pardon. Immer rein in die Fresse und ihm das Knie in den Magen rammen.
»Hör auf, Michi! Er hat genug.« Hilflos hockte ich auf dem Bürgersteig des Ratsmühlendamm, hörte Autos vorbeifahren, meine Stimme, Michis Stimme.
»Das Dreckschwein soll sehen, wie es ist«, keuchte sie, während sie weiter auf den Jungen einprügelte. Den Arm drehte sie ihm um, immer weiter, bis die Knochen knackten. Schweiß lief mir hinunter. Michi musste doch umkommen in ihrer dicken schwarzen Motorradjacke. Aus den Linden über uns nieselte klebrig süßer Saft. »Vergreifst du dich jemals wieder an Kleineren?«
»Nein«, winselte der Junge, »ehrlich nicht.«
»Michi!«, brüllte ich, stand auf, versuchte, sie an der Schulter fortzuziehen aus ihrem Rausch. Sie holte mit dem Ellenbogen aus, schlug ihn mir auf die Nase. Erneutes Knacken, Blut tropfte, ein spitzer Schmerz trieb mir Tränen in die Augen.
»Nein!«, kreischte der Junge. »Nein!«
Unter der Himmelsglocke standen die Autoabgase, hing der Geruch von Benzin. Den Geruch von Blut bildete ich mir sicher nur ein. Blut kann man nicht riechen.
Ein letzter Schrei, ein letztes Wimmern, als sie den Jungen von sich stieß. »Verpiss dich!«
Er raste davon, ohne sich nach seiner Schultasche und seinem Messer zu bücken. Michi hob auf, was er liegen gelassen hatte, pfiff ihm hinterher. Und tatsächlich drehte er sich noch einmal um.
»Du hast etwas vergessen!«, rief Michi ihm nach, folgte ihm langsam, schmiss das Messer in die Schultasche, die der Junge mit dem rechten Arm entgegen nahm.
Sein linker Arm hing hinunter, ein Veilchen zierte das rechte Auge, Schürfwunden im Gesicht. Er sah jämmerlich aus, aber auch sanft, gar nicht so, als bedrohte er kleinere Kinder. Sein dunkles Haar war gelockt und die Augen leuchteten braun und warm. An der linken Wange hatte er ein kleines Muttermal.
Kein Wort des Dankes, nur den Ranzen nehmen und so schnell wie möglich abhauen. Die Frau war lebensgefährlich.
Ich hockte auf dem Bürgersteig, hielt mir die Nase, hätte schreien können vor Schmerzen.
»Alles in Ordnung?«, fragte Michi, als sie sich zu mir umdrehte.
»Du hast mir die Nase gebrochen!« Schmecken konnte man das Blut, wenn es einem über die Lippen lief und man es mit der Zunge ableckte.
»Zeig mal her!«
Willig ließ ich mir die Hände vom Gesicht ziehen, hielt sie nach unten, während Michi mit ihrem Zeigefinger über das Nasenbein strich. Wieder der spitze Schmerz, wieder die dadurch ausgelösten Tränen. Ganz nah kam sie mir mit ihrem Gesicht, pustete sacht, gab mir einen Kuss, dort wo es geknackt hatte, als sie mit dem Ellenbogen dagegen gestoßen war.
»Quatsch. Die ist nicht gebrochen.«
»Ist sie doch.«
Einfach laufen, die eine Hand vor das Gesicht, in der anderen das soeben gerettete Portemonnaie, froh, noch im Besitz meiner Schuhe und meiner Jeans zu sein, aber laufen. Kein Dank, nur Erschrecken.
Ab und zu stelle ich es mir so vor. Dabei war es genau anders herum. Michi wurde bedroht und ich habe erbarmungslos zugeschlagen, ihre Nase erwischt und hinterher gepustet, wie es meine Großmutter bei mir immer getan hatte.
Ich an Michis Stelle wäre nicht geblieben. Ich wäre geflohen, dankbar für die Hilfe, doch zu entsetzt über die Gewalt
Nicht so Michi. Sie bedankte sich und blieb.
»Machst du das immer so?«, fragte sie, hielt sich ein Papiertaschentuch vor die Nase und sah mich mit Augen an, die so rund und hell waren wie der Vollmond.
»Nein.«
Warum schnappte sie sich nicht die geretteten Sachen und verschwand? Sie stand auf dem Bürgersteig, ich spürte ihren Blick, während ich die Gehwegplatten anstarrte.
»Aber wenn sich jemand an Schwächeren vergreift, muss er dafür bezahlen.«
Michi blieb immer noch stehen, antwortete nicht. Was uns verband, stand zwischen uns, tötete die Worte, die sie hätte sagen können. Der Junge, der eben mit gebrochenem Arm davon gelaufen war.
Ich kannte ihn nicht. Ich schätzte ihn drei Jahre älter als mich. Ich war dreizehn. Er hatte mit einem Messer vor dem Gesicht eines Mädchens gefuchtelt, das ihm zaghaft und ängstlich ihr Portemonnaie in die Hand gedrückt und anschließend den Reißverschluss ihrer Motorradjacke runterzogen hatte.
Ich hatte kein Wort gehört, nur etwas gesehen, das gereicht hatte, einzugreifen. »Kennst du den Jungen?«
Michi nickte. »Er geht auf unsere Schule. Hast du ihn noch nie dort gesehen?«
»Wie bitte?« Langsam sickerten die Worte in mein Gehirn, rissen mich aus der einen Realität in die andere, und als Michi den Satz wiederholte, begriff ich, dass ich ihn doch gehört und verstanden hatte.
»Scheiße.«
»Warum?«
»Ich werde von der Schule fliegen.«
»Ich weiß, wo er wohnt. Du könntest es wie mit meiner Nase machen.«
Kurz schaute ich auf. Daran, wie sie lachte, konnte ich erkennen, wie blöde ich gerade aussehen musste.
»Du könntest ihm den Arm küssen.«
»Und was soll das bringen?«
Sie sah mich mit einem Blick an, der jede Verarschung ausschloss, ernst, eindringlich, mir direkt in die Augen. »Ob du es glaubst oder nicht. Die Nase war gebrochen. So etwas spürt man.«
»Du spinnst.«
Michi schüttelte den Kopf. »Ich muss los. Vielleicht überlegt Herr Blatz es sich noch mal, wenn ich ihm erzähle, was passiert ist.«
Der Verkehr kam zurück in mein Bewusstsein. Ich hörte die Autos wieder, hörte klackende Absätze und einen Jungen an der Hand seiner Mutter schreien.
»Bis morgen«, verabschiedete Michi sich lächelnd.
Endlich konnte ich gehen und verzweifelt darüber sein, was ich getan hatte, grübeln, was passierte, wenn ich von der Schule flog, weil ich mal wieder drauf losgeprügelt hatte. »Bis morgen«, antwortete ich pflichtschuldigst und wusste, wir würden wieder nur Schüler in Parallelklassen sein.
Ich trottete in den Garten, der unser Zuhause war. Doch anstatt zu grübeln, pustete ich mir auf den Arm, um zu sehen, ob ich irgendetwas feststellen konnte. Er wurde nur heiß, was bei dem Wetter kein Wunder war. Im Schuppen atmete ich gegen den kleinen Spiegel, der dort hing. Er beschlug wie bei jedem anderen, aber der Sprung in der Ecke blieb. Ich versuchte es mit einer Teekanne, deren Henkel abgebrochen war, doch weder schmolz das Porzellan zu einer weichen klebrigen Masse noch fügten sich die Teile wie durch ein Wunder zusammen. Michi hat sich etwas eingebildet. Am nächsten Morgen erwartete sie mich am Tor zum Schulhof. So habe ich Michi kennengelernt. Dadurch, mich zu vergessen und außer Kontrolle zu geraten.
Deutschland und die DDR waren der UNO beigetreten, die USA haben den Krieg gegen Nord Vietnam eingestellt und das deutsche Fernsehen hat den Film ›Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Gesellschaft, in der er lebt‹ ausgestrahlt. Alles scheint damals begonnen zu haben.
Von Erster Hilfe und beruhigendem Atem (1976)
Ich bestelle amerikanisches Frühstück ohne Frischkäse. Den kann ich nicht ausstehen.
Michi bestellt sich Leberkäse mit Spiegelei und Bratkartoffeln. »Ich habe schließlich schon gefrühstückt. Bin ja nicht solch eine Schlafmütze wie du.«
Als ich nichts erwidere, sondern nur die Zigarette ausdrücke, fährt sie fort. »Außerdem musste ich zum Friseur, Klamotten und die neuen Ohrringe kaufen, um in dem Hotel einen netten Eindruck zu machen. - Schade, dass es dir nicht gefällt.«
»Wann fängst du an?«, frage ich sie.
»Du vergisst aber auch alles«, beschwert sie sich. »Morgen. Schließlich bringt es Unglück, eine neue Stelle an einem Montag zu beginnen. – Sagt mein Vater wenigstens.«
Die Jacke ihres Kostüms scheint sie eher nach ihrem gewünschten Maß gekauft zu haben, vielleicht auch als Ansporn für eine Diät, die sie gar nicht nötig hätte. Aber so, wie Michi immer wieder an dem Stoff zieht, scheint die Jacke eng und unbequem zu sein. Neu ist auch die leicht schräge Haltung, in der meine Freundin mit übereinandergeschlagenen Beinen am Tisch sitzt. »Hast du dich wenigstens ordentlich gelangweilt oder hast du die Liebe deines Lebens kennengelernt?«
Ich grinse nur. Was hatte ich in den Ferien getan? So wenig, wie ich über die letzten sechs Wochen weiß, kann es nicht viel gewesen sein.
»Ach wo«, antwortet Michi sich gleich selbst. »Dazu hättest du ja mal die Wohnung verlassen müssen. Weißt du eigentlich, wie blass du bist? Bestimmt hast du die ganze Zeit nur gelesen.«
»So in etwa«, räume ich ein.
Michi bestreitet das Gespräch, vielleicht, weil sie es nicht aushält, zu schweigen. Ich kann gut stumm mit ihr im Restaurant sitzen und dabei den stark befahrenen Einbahnstraßenteil der Fuhlsbütteler Straße betrachten, über den sich der Verkehr aus der Innenstadt in Hamburgs Norden quält und über den immer wieder Fußgänger wie beim Slalomlauf mit vollen Plastiktüten von Geschäft zu Geschäft eilen. Ich kann Michi zuhören, die darüber klagt, wie wenig Lust sie auf die Ausbildung habe, die sie machen müsse, weil sie mal das Hotel ihrer Eltern übernehmen solle, während ich die Frau auf der anderen Straßenseite winken sehe und durch das Gestrüpp um die Bäume auf dem Bürgersteig den Jungen, der ohne nach rechts zu schauen, einfach los läuft.
Erst, als Bremsen kreischen und der Körper des Jungen nach dumpfem Aufprall über die Fahrbahn fliegt, kann ich Michi nicht mehr hören. Ich starre nach draußen und bin zu keiner Regung fähig. Nur langsam sickern die Geräusche wieder zu mir durch und ich nehme die Kellnerin wahr, die an unseren Tisch getreten ist, die Teller mit unserem Essen in den Händen hält, aber nicht abstellt. Sie schaut genau so geschockt aus dem Fenster wie Michi und ich.
»Geh raus!«, schreit Michi mich an. »Halte ihm die Hand, puste ihm über die Knochen. Tu irgendetwas!«
Ich schiebe die Kellnerin etwas zur Seite, um an ihr vorbeizukommen. Mein Geist folgt mechanisch, aber mein Körper scheint sich ganz normal zu bewegen. Eine Menschentraube hat sich um das Fahrzeug gebildet, beschimpft eine junge Frau, sie sei zu schnell gefahren.
Der Junge liegt auf dem Asphalt, die Frau, die ihm gewunken hat, kniet bei ihm, weint, streichelt seinen Kopf. Und auf der anderen Fahrspur rauscht der Verkehr vorbei als sei nichts geschehen.
»Wie oft habe ich dir schon gesagt, du sollst erst nach rechts und links schauen, bevor du über die Straße läufst«, schimpft die Frau zwischen ihren Tränen. »Das hast du jetzt davon. Was soll ich denn ohne dich tun?« Aus Sorge hingeschleuderte Wut, aus Liebe erwachsene Beschimpfungen der Hilflosigkeit.
Ich knie mich zu ihr. Die Augen des Jungen sind geschlossen. Er weint nicht, er schreit nicht vor Schmerzen. Ganz friedlich sieht er aus. Nicht einmal der Schrecken der letzten Sekunden ist ihm anzusehen. Ich halte meine Hand über seinen Mund. Er atmet nicht. Vorsichtig strecke ich den Kopf des Jungen nach hinten, nähere ich mich seinen Lippen, puste hinein. Warum hat die Mutter das nicht längst getan?
Die Fahrerin wird endlich aus ihrem Auto gelassen oder traut sich durch die Beschimpfungen. Sie steht auf einmal neben mir, fragt, ob sie mir helfen könne.
»Haben Sie eine Decke im Wagen?«
»Ja. Ich hole sie.« Wieder setze ich meine Lippen an den Jungen, beatme ihn gleichmäßig, bis er sich plötzlich aufbäumt, sich spannt wie eine Angelsehne.
»Ich wusste, du schaffst es«, höre ich Michi hinter mir. In der Ferne nehme ich einen Krankenwagen wahr. Hat irgendjemand einen gerufen?
»Das hätte jeder geschafft«, antworte ich, ohne mich umzudrehen. Der Junge öffnet die Augen, als gerade ein schwerer Laster auf der anderen Fahrbahn steht, dessen Auspuffgase zu uns herüber ziehen.
»Oh mein Junge, Gott sei Dank.« Die Mutter des Jungen drängt mich ein kleines Stück zur Seite, küsst ihren Sohn, bedeckt ihn mit ihren Tränen, erdrückt ihn fast mit ihrer Erleichterung.
Die Frau, vor deren Auto er gelaufen ist, bringt die Decke, legt sie über den Jungen.
»Danke«, sage ich und lächle sie an. Doch der Blick der Mutter ist hasserfüllt.
»Er ist einfach losgelaufen …«
»Später. Das ist jetzt nicht wichtig.«
Ich lege meine Hände auf die Brust des Jungen, spüre die Atmung, die er wieder übernommen hat, fühle seinen Herzschlag.
»Wie heißt du?«, frage ich ihn. Die Sirenen des Krankenwagens werden lauter.
Der Junge schaut mich an, sein Gesicht bleibt ganz ruhig, keine Tränen, kein Jammern. »Martin.«
Menschen stehen um uns herum, reden, diskutieren, schimpfen, aber was sie sagen, bekomme ich nicht mit. Es ist als filtern meine Ohren automatisch, was wichtig ist. Der Laster ist weiter gefahren. Der Verkehr nebenan fließt wieder schneller.
»Tut dir etwas weh, Martin?«, frage ich und blicke ihm ins Gesicht.
»Mein Bein.«
»Sonst nichts?«
Er schüttelt den Kopf. Wir scheinen in einer Glocke der Stille zu sein, er und ich. Weder die Mutter, die immer noch neben uns kniet noch der Verkehr oder die Menschen greifen ein, berühren uns oder stören unsere Verbindung.
»Wie viele Finger habe ich hier?«
»Drei«, antwortet er richtig und grinst ganz leicht dabei, als wolle er mir sagen, ›du hältst mich wohl für blöd.‹
»Welches Bein tut denn weh, das linke oder das rechte?«
Der Junge hebt einen Arm und zeigt auf das linke Bein. »Ich weiß doch noch nicht, wo links und rechts ist.«
»Das macht nichts. Du hast es mir ja gezeigt.«
Der Krankenwagen scheint jetzt so nah, dass die Mutter des Jungen aufsteht und Ausschau hält, ob sie ihn schon sieht. Michi tritt von hinten an mich heran, legt mir die Hand auf die Schulter. Das spüre ich. Aber mein Blick bleibt ganz bei dem Jungen.
»Soll ich es mir anschauen?«, frage ich und zeige dabei auf sein Bein. Er nickt. Wäre die Mutter nicht aufgestanden, könnte sie jetzt wenigstens seine Hand halten, während ich das Gesicht des Jungen aus den Augen lasse und vorsichtig das Hosenbein nach oben schiebe. Was möchte ich da überhaupt sehen? Ich kann doch gar nichts erkennen. Nur den schiefen Winkel, in dem das Schienbein steht, eine leichte Erhebung, dort, wo es sich knickt.
»Tut es dort weh?« Ganz sacht drücke ich auf die Erhebung und schaue dem Jungen wieder ins Gesicht.
»Ja.« Er verzieht den Mund ein bisschen, beißt aber die Zähne zusammen. Noch immer weint er nicht. Die Mutter reckt sich neben uns, winkt.
»Entschuldigung«, sage ich zu dem Jungen und nehme seine Hand. »Der Krankenwagen ist gleich da. Soll ich so lange pusten?«
Vom Trost der Großmutter (1960 bis 1967)
Ich weiß nicht einmal, wie alt ich damals war, nur, dass wir bei der Großmutter lebten. Mama und Papa teilten sich ein Zimmer, ein kleines mit Fenster zum Erdkampsweg bekam ich und Oma eines nach hinten zu den Gärten.
Ich habe keine Erinnerung daran, wann Papa begann, uns zu schlagen, aber ich bin sicher, er tat es nie, wenn meine Oma dabei war.
Denke ich an sie, sehe ich mich meistens auf ihrem Schoß sitzen. Sie hatte stets eine Schürze um, ihr Haar war zu einem Dutt gebunden, und sie roch nach Kartoffeln. War ich traurig, hatte mich gestoßen oder mir beim Sturz mit dem Roller eine Schürfwunde zugezogen, strich sie mir durchs Haar, tröstete mich und fragte: »Soll ich pusten?«
Nickte ich – und das tat ich jedes Mal - blies sie mir ganz vorsichtig ihren Atem auf die Beule, die aufgescheuerte Stelle oder die Augen, damit ich den Schmerz nicht mehr spürte und die Tränen nachließen.
So pustete meine Oma mir die dunklen Wolken aus meinem jungen Leben, zart und mitfühlend, als wüsste sie immer genau, wo mein Kummer lag.
.Vom Trost aus Hilflosigkeit (1976)
Martin nickt.
»Gut«, sage ich. »Ich setze mich zu deinen Füßen, damit du sehen kannst, was ich mache.« Wieder nickt der Junge, während Michi meine Schulter loslässt. Ich wechsle den Platz, schaue in Martins Augen, lächle ihn an und beuge mich über die Erhebung an seinem Schienbein. »Keine Angst«, versuche ich, ihn zu beruhigen, »es tut nicht weh. Ich fasse es nicht mehr an.« Ganz leicht blase ich über die Stelle, puste. Ich höre ein Auto bremsen und Türen, die zugeschlagen werden. Ich spüre, die Menschen treten zur Seite. Eine Trage wird neben dem Jungen abgesetzt. Ich nehme alles und nichts wahr, so über Martins Bein gebeugt. Ich fühle mich einfach nicht angesprochen, als eine herrische Männerstimme fragt: »Was zur Hölle machen Sie denn da?« Erst als Michi mir in die Schultern kneift, blicke ich auf. »Ich puste nur, um den Jungen zu beruhigen.«
Der Mann, in dessen Gesicht ich schaue, schüttelt den Kopf. »Okay, okay. Jetzt sind wir ja da.« Er schubst mich zur Seite, wechselt einen kurzen Blick mit seinem Kollegen, bevor sie Martin auf eine Trage verfrachten.
»Lass uns gehen«, sagt Michi.
»So ein Bekloppter«, murmelt der Sanitäter zu seinem Kollegen, schüttelt wieder den Kopf und imitiert mich: »Ich puste.«
Der Kollege lacht. Ich balle meine Hände. Läge Martin nicht auf der Trage, spränge ich den Typen von hinten an und schlüge ihm die Faust ins dreckige Lachen. Was bildet der sich ein?
»Lass uns gehen«, sagt Michi erneut und zerrt mich am Arm durch die Zuschauer. Ich habe die Polizei nicht bemerkt, die inzwischen gekommen ist. Erst jetzt sehe ich die Beamten, von schimpfenden Augenzeugen umringt, die alle dasselbe sagen: »Die ist doch viel zu schnell gefahren. – Wie kann man nur so rasen? – Unverantwortlich so was. – Der sollten sie den Führerschein für immer wegnehmen.«
»Das ist doch gar nicht wahr!«, brülle ich dazwischen. »Der Junge ist einfach über die Straße gerannt!« Michi reißt mich weiter. Einer der Polizisten kommt hinter uns her, fragt, was ich gesehen hätte und nach meinem Namen.
Im ›Restaurant stehen kalter Kaffee, kalter Leberkäse und kaltes Rührei, als wir uns wieder setzen. Ich zünde mir eine Zigarette an, Michi stochert lustlos in ihrem Essen.
Die Kellnerin kommt an den Tisch und bittet: »Warten Sie. Ich lasse es Ihnen noch einmal neu machen.«
Vor dem Fenster löst sich die Menschenmenge gerade auf. Der Krankenwagen ist davon gefahren, der letzte Polizist hat sich in den Wagen gesetzt, der Alltag greift wieder um sich. In zehn Minuten wird nichts mehr an den Unfall erinnern.
Von ernsten Worten (1973)
Gleich in der zweiten Stunde wurde ich zum Direktor bestellt. Und irgendwie nahm ich das mit großer Gelassenheit zur Kenntnis. Ich dachte weder daran, was Mama sagen würde noch darüber nach, wie es überhaupt weitergehen sollte. Mein Herz schlug nicht schneller, als ich an die offene Tür des Direktorats klopfte und Frau Stahnke, die Sekretärin sagte, Herr Blatz wartete schon.
»Komm rein!« Er blieb sitzen, schaute mich nicht unfreundlich an, sondern wartete, bis ich mich auf den Stuhl vor seinem Schreibtisch gesetzt hatte. Nichts lag hier einfach herum, kein Zettel lose auf dem Pult, kein Buch, in dem er vielleicht etwas nachschlagen müsste. Alle Stifte waren säuberlich in einem schwarzen Behältnis, das auch eine Schere, einen Zirkel und ein Lineal enthielt. »Du weißt, warum du hier bist?«
»Ich kann es mir denken.« Ich sah ihm direkt in die Augen. ›Wenn du es ehrlich meinst, schau mich an.‹
Es tat mir leid, aber ich konnte nicht reumütig auf den Boden schauen und eine Entschuldigung stammeln. Herr Blatz hielt meinem Blick stand, kratzte sich am Kinn und schüttelte den Kopf bedächtig. Er verstand es, mir ein schlechtes Gewissen zu machen. Erst diese Haltung ließ mein Herz in die Hose sinken.
»Es sind schon ein paar Jahre vergangen, seit du Frau Junge geohrfeigt und Jochen krankenhausreif geprügelt hast. Aber wir haben dir damals deutlich gesagt, so etwas dürfte nicht wieder vorkommen.«
Von Spinat und vom Hunger (1970)
In Deutschland herrschte Entspannungspolitik und wurde Demokratie gewagt. Das Demonstrationsrecht wurde liberalisiert und Andreas Baader mit einer Gewalttat aus dem Gefängnis befreit. Die RAF wurde geboren und der Warschauer Vertrag unterzeichnet.
Ich war zehn Jahre alt und gerade auf die Realschule gekommen, versuchte mich zwischen den wenigen bekannten und den vielen unbekannten Mitschülern zu orientieren, als die Beherrschung mich das erste Mal in der Schule verließ.
Es ging um Spinat. Frau Junge hatte das Pech, als Referendarin eine fünfte Klasse in Englisch unterrichten zu müssen, lauter Rabauken, die sich die Zeit im Unterricht damit vertrieben, aus Pusterohren nass gekaute Papierschnipsel an die Tafel zu schießen. Fast jeder von uns hatte zu diesem Zweck einen alten Filzstift auseinander gebaut. Unsere Zungen waren bunt von der Farbe der Minen, die Notizblöcke wiesen angerissene Seiten auf, die wie Kaugummi in unseren Mund bearbeitet wurden. Und irgendwie schaffte es Frau Junge doch, ab und zu eine Vokabel an die Tafel zu schreiben, die von unseren Augen und Ohren wahrgenommen wurde.
Eine dieser Vokabeln war ›spinach‹, das englische Wort für Spinat. Es stand in einem Übungstext, dessen neue Wörter von ihr auf Zuruf durch die Streber der Klasse aufgeschrieben wurden. ›Susan likes spinach, Peter doesn´t like spinach.‹
»Hat jemand von euch eine Vorstellung, was das bedeutet?« Frau Junge hatte das Wort geschrieben – unbeirrt von den schleimigen Papierkugeln an der Tafel - sich zu uns umgedreht und ihre langen roten Haare hinter das Ohr gestrichen. Sie hatte es sogar geschafft, wacker gegen den Lärm in der Klasse anzulächeln.
Niemand antwortete. Dass es trotzdem eine Vorstellung über die Bedeutung gegeben haben musste, zeigten Laute, wie »iiiihhh« und »bäääähhh«.
Ich mochte Spinat. In unserem Gartenhaus konnte Mama leider nie welchen kochen. Immer mussten wir essen, was auf ihren Beeten wuchs.
Schon deshalb habe ich mich nicht an den Ekelbekundungen beteiligt. Aber ich war erkältet und musste husten, hielt mir die Hand vor den Mund und versuchte ein bisschen, den Reiz in der Luftröhre zu unterdrücken. Papa konnte es nie leiden, wenn ich ›bellte wie ein Hund‹.
Frau Junge sah die künstlich würgende Klasse, mein angestrengt rotes Gesicht, die eine Hand vor dem Mund, die andere auf der Brust, hörte die Geräusche der Schüler und meinen Husten. Sie schoss auf mich zu, packte mich am Hals, brüllte: »Was fällt dir ein, so zu würgen, dass du davon husten musst? Es ist Nahrung. Andere Kinder würden sich darüber freuen!«, und bekam von mir eine schallende Ohrfeige.
»Ich habe nicht gewürgt!«, schrie ich, schubste sie von mir, sodass sie das Gleichgewicht verlor und gegen den vor mir sitzenden Axel taumelte, und lief aus der Klasse.