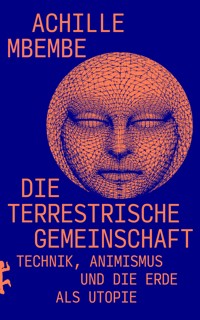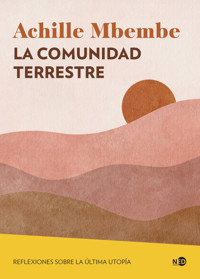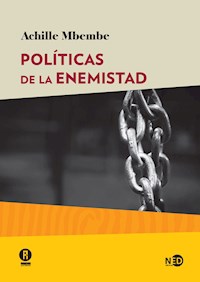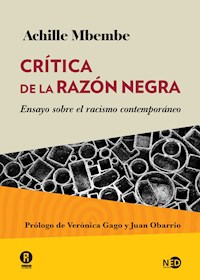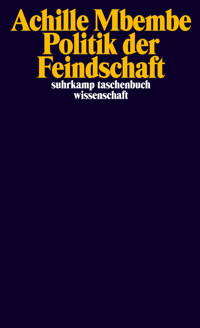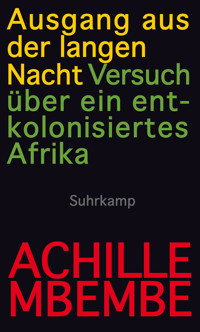
29,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
War die Entkolonialisierung Afrikas nur ein Unfall, ein Kratzen an der Oberfläche, das kurze Aufblitzen einer Zukunft, die zum Scheitern verurteilt war? In seinem mitreißenden Essay zeigt Achille Mbembe, dass jenseits der Krisen und Kriege, die den Kontinent regelmäßig heimsuchen, neue »afropolitane« Gesellschaften entstehen, die sich durch einen anderen Umgang mit Differenzen und mit der Zirkulation von Menschen und Kulturen auszeichnen. Um diese neuen Gesellschaften zu entschlüsseln, zeichnet Mbembe in souveräner Manier und im Rekurs auf seine eigene Lebensgeschichte die afrikanischen Entwicklungen seit dem Beginn der Entkolonialisierung nach. Aber auch die Veränderungen in den postkolonialen Gesellschaften jenseits des Mittelmeers, in Europa, werden in den Blick genommen, denn womöglich haben diese zwar Afrika entkolonialisiert, jedoch nicht sich selbst. Eine solche »Autoentkolonialisierung« ist aber notwendige Voraussetzung, um den Rassismus, die Gewalt und die Ausgrenzung des Anderen zu überwinden. Geschrieben in einer teils kalt-nüchternen, teils glühend-poetischen Sprache, zählt dieses Buch bereits zu den großen Werken des postkolonialen Denkens.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 385
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
1SV
2War die Entkolonialisierung Afrikas nur ein Unfall, ein Kratzen an der Oberfläche, das kurze Aufblitzen einer Zukunft, die zum Scheitern verurteilt war? In seinem mitreißenden Essay zeigt Achille Mbembe, dass jenseits der Krisen und Kriege, die den Kontinent regelmäßig heimsuchen, neue »afropolitane« Gesellschaften entstehen, die sich durch einen anderen Umgang mit Differenzen und mit der Zirkulation von Menschen und Kulturen auszeichnen.
Um diese neuen Gesellschaften zu entschlüsseln, zeichnet Mbembe in souveräner Manier und im Rekurs auf seine eigene Lebensgeschichte die afrikanischen Entwicklungen seit dem Beginn der Entkolonialisierung nach. Aber auch die Veränderungen in den postkolonialen Gesellschaften jenseits des Mittelmeers, in Europa, werden in den Blick genommen, denn womöglich haben diese zwar Afrika entkolonialisiert, jedoch nicht sich selbst. Eine solche »Autoentkolonialisierung« ist aber notwendige Voraussetzung, um den Rassismus, die Gewalt und die Ausgrenzung des Anderen zu überwinden. Geschrieben in einer teils kalt-nüchternen, teils glühend poetischen Sprache, zählt dieses Buch bereits zu den großen Werken des postkolonialen Denkens.
Achille Mbembe, geboren 1957, ist ein kamerunischer Historiker und politischer Philosoph. Nach Stationen an der Columbia University, der University of California in Berkeley, der Yale University und der Duke University lehrt er heute an der University of the Witwatersrand in Johannesburg. Für sein Buch Kritik der schwarzen Vernunft wurde er 2015 mit dem Geschwister-Scholl-Preis ausgezeichnet.
Zuletzt erschienen:
Kritik der schwarzen Vernunft (2014)
3Achille Mbembe
Ausgang aus der langen Nacht
Versuch über ein entkolonisiertes Afrika
Aus dem Französischen von Christine Pries
Suhrkamp
4Die Originalausgabe erschien unter dem Titel Sortir de la grande nuit. Essai sur l‘Afrique decolonisée © Éditions La Découverte, Paris, 2010.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation
in der Deutschen Nationalbibliografie;
detaillierte bibliografische Daten sind im Internet
über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2016
Der vorliegende Text folgt der Erstausgabe, 2016
Erste Auflage 2016
© dieser Ausgabe Suhrkamp Verlag Berlin 2016
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
Zur Gewährleistung der Zitierbarkeit zeigen die grau hinterlegten Ziffern die jeweiligen Seitenanfänge der Printausgabe an.
Umschlaggestaltung: Hermann Michels und Regina Göllner
eISBN 978-3-518-74816-9
www.suhrkamp.de
5
Dem Freund Paul Gilroy, der mir den Weg
zum Imaginären gewiesen hat.
Und zum Gedächtnis zweier Denker des unbegrenzten
Werdens : Frantz Fanon und Jean-Marc Éla.
6
7Inhalt
Vorwort
Einleitung
Ein halbes Jahrhundert
Den ursprünglichen Sinn der Entkolonialisierung rekonstruieren
Wohin gehen wir?
Demokratisierung und Internationalisierung
Neuaufbruch
1 Am Anfang ein Totenschädel : Wege eines Lebens
Erinnerungsfetzen
Das tragische Mahl
Macht des Simulakrums
Entfernung
An der Jahrhundertwende
2 Welterschließung und Aufstieg zum Menschsein
Die Welt als historische Bühne
Haiti und Liberia : zwei Schwachstellen
Rasse und Entkolonialisierung des Wissens
Geburt eines Weltdenkens
Die Doppelstruktur von Unvermögen und Ignoranz
3 Die französische Gesellschaft : Nähe ohne Gegenseitigkeit
Der Niedergang einer erstarrten Nation
Die Leerstelle der Rasse beheben
Plädoyer für geteilte Einmaligkeit und eine Ethik der Begegnung
84 Frankreichs langer imperialer Winter
Lossagung von der Zeit und Ungleichzeitigkeit
Plurale Ausdrucksformen – ein leichtes Rumoren
Haarspaltereien
Provinzialisierungswunsch
Der Kolonialismus und die postumen Krankheiten des Gedächtnisses
5 Afrika : Hütte ohne Schlüssel
Alte und neue Kartographien
Weit entfernt und weit zurückliegend
Informalisierung der Wirtschaft und Zerfall des Politischen
Militarismus und Lumpenradikalismus
6 Zirkulierende Welten : Die afrikanische Erfahrung
Tiefgreifende soziale Neuzusammensetzung
Geschlechterkampf und neue Lebensstile
Afropolitanismus
»Sich etwas anderem zuwenden«
Epilog
9
Jene, die mit jedem Tag ferner lagern dem Ort ihrer Herkunft,
jene, die mit jedem Tag ihr Boot auf andre Ufer ziehn,
die kennen besser mit jedem Tage den Lauf der unlesbaren
Dinge ; und aufwärts folgend den Flüssen ihrer Quelle zu,
zwischen grünen Scheinen, umfängt sie jählings dieser
scharfe Glast, wo alle Sprache die Waffen streckt.
Saint-John Perse, Schnee, IV, in : Exil.
10
11Vorwort
Vor einem halben Jahrhundert lebte der größte Teil der Menschheit unter dem Joch des Kolonialismus – einer besonders primitiven Form rassistischer Herrschaft. Deren Überwindung stellt einen Schlüsselmoment in der Geschichte der Moderne dar. Dass dieses Ereignis im philosophischen Denken unserer Zeit kaum Spuren hinterlassen hat, ist für sich genommen kein großes Rätsel. Nicht aus allen Verbrechen geht zwangsläufig etwas Sakrosanktes hervor. Von manchen historischen Verbrechen blieb nur Schändliches und Profanes – die nachhaltige Sterilität einer verkümmerten Existenz, die es kurz gesagt unmöglich macht, eine »Gemeinschaft zu bilden« und zum Weg der Humanität zurückzufinden. Hat die Kolonialisierung womöglich genau eine solche unmögliche Gemeinschaft vor Augen geführt – tetanisches Zucken und vergebliches Pfeifen zugleich ? Der vorliegende Essay widmet sich dieser Frage nur indirekt ; im Ganzen und im Detail muss ihre Geschichte noch geschrieben werden.
Hauptgegenstand dieses Essays ist die Entkolonialisierungswelle Afrikas im 20. Jahrhundert. Dabei geht es nicht darum, deren Geschichte noch einmal nachzuverfolgen oder sie soziologisch zu untersuchen, geschweige denn typologisch. Diese Arbeit ist erledigt und bis auf einige Details ist ihr nur sehr wenig hinzuzufügen.1 Noch weniger geht es um eine Bilanzierung dessen, was die Unabhängigkeit gebracht hat. Die Entkolonialisierung ist ein Ereignis, dessen grundlegende politische Bedeutung im aktiven Willen zur Gemeinschaft bestand – so wie man früher vom Willen zur Macht gesprochen 12hat. Dieser Wille zur Gemeinschaft ist ein anderer Name für das, was man Wille zum Leben nennen könnte. Er war auf die Verwirklichung eines gemeinsamen Projekts gerichtet : auf eigenen Beinen zu stehen und eine eigene Tradition zu begründen. In jener abgeklärten, von Zynismus und Leichtfertigkeit zutiefst geprägten Zeit, in der alles gleichgültig war, konnten solche Worte nur Hohngelächter hervorrufen. Trotzdem waren damals viele bereit, für die Verteidigung dieser Ideale ihr Leben aufs Spiel zu setzen. Diese Ideale waren nämlich kein Vorwand, sich aus der Gegenwart zurückzuziehen oder sich vom Handeln fernzuhalten. Im Gegenteil : Sie spornten dazu an, die Zukunft selbst in die Hand zu nehmen und in der Praxis eine Neuverteilung der Sprache sowie eine neue Logik des Sinns und des Lebens durchzusetzen. Bei dem Versuch, auf den Trümmern der Kolonialisierung eine entkolonialisierte Gemeinschaft zu errichten, wurde Erstere weder als Schicksal noch als Notwendigkeit wahrgenommen. Wenn man die kolonialen Verhältnisse zerschlägt, so wurde argumentiert, würde der verlorene Name wieder zum Vorschein kommen. Das Verhältnis zwischen dem, was gewesen war, was gerade geschehen war, und dem, was kommen würde, würde sich umkehren und dies würde es möglich machen, eine eigene Schöpfungsmacht und eine eigene Fähigkeit zur Artikulation einer Differenz und einer positiven Kraft zu demonstrieren.
Zum Willen zur Gemeinschaft kamen der Wille zum Wissen und der Wunsch nach Einmaligkeit und Originalität hinzu. Der antikoloniale Diskurs ist im Wesentlichen auch dort für das Modernisierungspostulat und die Fortschrittsideale eingetreten, wo sich in ihm – sei es explizit (wie im Fall von Gandhi) oder implizit – eine Kritik daran abzeichnete. Hinter dieser Kritik stand das Streben nach einer Zukunft, die nicht von vornherein feststehen, sondern übernommene oder ererbte Traditionen, Interpretationen, Experimente und 13Neuschöpfungen mischen sollte, wobei das Wesentliche darin bestand, sich in Richtung auf andere mögliche Welten von dieser Welt wegzubewegen. Den Kern dieser Analyse bildete die Vorstellung, dass die westliche Moderne unvollkommen, unvollständig und unvollendet geblieben war. Der Anspruch des Westens, über die Sprache und die Formen, die das Ereignis des Menschen annehmen kann, zu verfügen, ja sogar ein Monopol auf die Idee der Zukunft schlechthin zu besitzen, war nur eine Fiktion. Die neue, postkoloniale Welt war nicht dazu gezwungen, das zu imitieren und zu wiederholen, was anderenorts erreicht worden war.2 Da der Verlauf der Geschichte jedes Mal wieder einmalig ist, machte eine zukunftstaugliche Politik – ohne die es keine vollgültige Entkolonialisierung geben konnte – die Erfindung neuer Denkbilder erforderlich. Dies war nur möglich, wenn man sich zu einem gründlichen Erlernen der Zeichen und der Modalitäten von deren Zusammentreffen mit der Erfahrung als der Zeit zwang, die den Orten des Lebens eigen ist.3
Zieht die heute herrschende Vermischung der Wirklichkeiten diese Vorsätze in Mitleidenschaft, nimmt sie ihnen die historische Dichte, ja sogar ihre Aktualität ? War die Entkolonialisierung – soweit ein so unscharfer Begriff überhaupt aussagekräftig sein kann – nur ein substanzloses Phantasma ? War sie letztendlich nur ein Zwischenfall, der viel Lärm machte, ein oberflächlicher Riss, ein kleiner äußerer Sprung, das Zeichen einer Zukunft, die dazu prädestiniert ist, in die Irre zu gehen ? Weist die Dualität von Kolonialisierung und Entkolonialisierung nur in eine Richtung ? Spiegeln beide sich als historische Phänomene nicht ineinander wider, setzen sie einander nicht voraus wie die zwei Seiten einer Me14daille ? Dies sind einige der Fragen, um deren Untersuchung sich dieser Essay bemüht. Eine seiner Thesen lautet, dass die Zeit mit der Entkolonialisierung begonnen hat sich in viele verschiedene Formen von Zukunft zu verzweigen, die per definitionem kontingent waren. Die Wege, die die befreiten neuen Nationen einschlugen, ergaben sich teilweise aus den innenpolitischen Kämpfen in den betreffenden Gesellschaften.4 Diese Kämpfe gingen wiederum auf alte, aus der Kolonialzeit stammende soziale Formen und ökonomische Strukturen und auf die Regierungstechnik und -praxis der neuen postkolonialen Systeme zurück. In den meisten Fällen führten sie zum Aufbau einer Herrschaftsform, die manchmal als »Herrschaft ohne Hegemonie« bezeichnet wird.5
Dieser Essay beginnt bewusst erzählerisch und autobiographisch (Kapitel 1). Dabei wird geschildert, inwiefern der eigentliche postkoloniale Moment für viele mit einer Dezentrierungserfahrung einsetzte. Anstatt ein starkes Zeichen zu setzen, das den ehemals Kolonisierten zwang, selbstständig und für sich selbst zu denken, und anstatt der Ort einer Erneuerung des Sinns zu sein, wirkte die Entkolonialisierung – besonders dort, wo sie erzwungen wurde – wie eine Begegnung mit einem in sich selbst zusammenbrechenden Selbst. Nicht wie das Ergebnis eines fundamentalen Freiheitsbegehrens, also wie etwas, das das Subjekt sich nimmt und das zur unverzichtbaren Quelle von Moral und Politik wird, sondern wie eine Äußerlichkeit, eine Aufpfropfung, der offenbar alle Wandlungsfähigkeit fehlte. Danach schlage ich einen Doppelparcours vor : Kapitel 3 und 4 behandeln das, was man wohl eine »ortlose Besatzungsmacht« nennen muss, in diesem Fall das heutige Frankreich. In Form und Gestalt, 15als Akt und Verhältnisbestimmung stellte die Entkolonialisierung in vielerlei Hinsicht eine Koproduktion von Kolonisten und Kolonisierten dar. Zusammen – wenn auch an verschiedenen Positionen – schmiedeten sie eine Vergangenheit. Aber eine gemeinsame Vergangenheit zu haben, heißt nicht notwendig, dass man sie auch teilt. An dieser Stelle untersuche ich die Paradoxien der »Postkolonialität« bei einer früheren Kolonialmacht, die eine Entkolonialisierung zuließ, ohne sich selbst zu entkolonialisieren (Kapitel 3). Die Verwerfungen und Verzweigungen, die aus dieser Haltung resultieren, verdienen auch heute noch Aufmerksamkeit, vor allem wegen der Verzerrungen, die auf die offenkundige Unfähigkeit zurückzuführen sind, auf der Grundlage einer gemeinsamen Vergangenheit eine gemeinsame Geschichte zu schreiben (Kapitel 4).
Kapitel 2 und 5 widmen sich dem, was als Hauptparadox der Entkolonialisierung zu betrachten ist : sterile Verdoppelung und trockene Wiederholung einerseits sowie endlose Wucherung andererseits (wie Gilles Deleuze es ausgedrückt hat6). Denn gemessen an einer bestimmten afrikanischen Erfahrung dürfte einer der Prozesse, die unmittelbar nach der Entkolonialisierung einsetzten, die mal eher schleppende und unterschwellige, mal eher chaotische Zerschlagung der Staatsform und der Institutionen gewesen sein, die zum Erbe der Kolonialisierung gehörten. Als solche ist die Geschichte dieser Zerstörung in ihrer Einmaligkeit noch nicht zur Kenntnis genommen worden. Seither haben die neuen unabhängigen Nationen – in Wahrheit heterogene, auf den ersten Blick unvereinbare und langfristig gemischtgesellschaftliche Versatzstücke – in mehr oder weniger freier Fahrt ihren Weg bei vollem Risiko fortgesetzt. Diese rasante Abfolge – von Dramen, 16unerwarteten Brüchen, absehbarem Niedergang vor dem Hintergrund einer ungeheuren Willensschwäche – setzt sich fort. Dabei nimmt der Wandel hier zunächst ansatzweise die Gestalt einer Wiederholung an, dann die Form eines folgenlosen Wetterleuchtens und daran anschließend den Anschein einer Auflösung und eines Versinkens im Unbekannten und Unvorhergesehenen : die unmögliche Revolution.
Der Wille zum Leben bleibt trotzdem bestehen. So gut es geht, wird auf dem afrikanischen Kontinent derzeit ein gigantisches Flickwerk verrichtet. Es kostet besonders viele Menschenleben und dringt bis in die Strukturen des Denkens vor. Über den Umweg der postkolonialen Krise findet eine geistige Umorientierung statt. Zerstörung und Wiederzusammensetzung sind ohnehin so eng miteinander verwoben, dass diese beiden Prozesse unabhängig voneinander nicht mehr zu verstehen sind. Neben einer Welt in Trümmern und dem, was ich »Hütte ohne Schlüssel« (Kapitel 5) genannt habe, zeichnet sich ein Afrika ab, das seine Einheit durch die Ausklammerung und die Umverteilung der Differenzen zu gewinnen sucht. Die Zukunft dieses zirkulierenden Afrika wird von der Stärke seiner Paradoxien und seiner Unbeugsamkeit abhängen (Kapitel 6). Es geht um ein Afrika, dessen soziale und räumliche Strukturen dezentriert sein werden ; das sich gleichzeitig auf die Vergangenheit und auf die Zukunft hin ausrichtet ; dessen geistige Prozesse eine Mischung aus säkularisiertem Bewusstsein, radikaler Immanenz (Sorge um diese Welt und um den Augenblick) und einer offenkundig nicht göttlich vermittelten Versenkung darstellen ; dessen Sprachen und Klänge zutiefst kreolisch sein werden ; das dem Experimentieren einen zentralen Stellenwert einräumt ; in dem existentielle Bilder und Praktiken keimen, die in erstaunlichem Maße postmodern sind.
Etwas Fruchtbares entströmt dieser Scholle Afrika, diesem riesigen Feld, auf dem Stoffe und Dinge beackert werden – 17etwas, das sich auf ein extensives und heterogenes, grenzenloses Universum, den Kosmos der Pluralität und der Weite, hin zu öffnen vermag. Dieser kommenden-afrikanischen-Welt, deren komplexer und beweglicher Rahmen unablässig von einer Form in die andere übergeht und alle Sprachen und Klangfarben verfremdet, weil er sich kaum noch mit einer Sprache oder reinen Klängen in Verbindung bringen lässt ; diesem Körper in Bewegung, der nie an einem Ort verweilt und dessen Zentrum sich überallhin verlagert ; diesem Körper, der sich durch das gewaltige Weltengebäude bewegt, habe ich einen Namen gegeben : Afropolitanismus. Südafrika ist sein bevorzugtes Labor (Kapitel 6).
Johannesburg, den 4. August 2010
Dieser Essay ist die Frucht langer Gespräche mit Françoise Vergès. Er nimmt teilweise wörtlich Überlegungen wieder auf, die ich in den letzten zehn Jahren zwischen Afrika, Frankreich und den Vereinigten Staaten in Form von Zeitschriftenaufsätzen (für Le Débat, Esprit, Cahiers d’études africaines, Le Monde diplomatique), Vorlesungs-, Seminar- und Arbeitsgruppennotizen oder Beiträgen in der afrikanischen Presse und anderen internationalen Medien entwickelt habe. Ich möchte denjenigen meinen Dank aussprechen, die diese Überlegungen veranlasst, unterstützt, gefördert oder begrüßt haben : Pierre Nora, Olivier Mongin, Jean-Louis Schlegel, Michel Agier, Didier Fassin, Georges Nivat, Pascal Blanchard, Nicolas Bancel, Annalisa Oboe, Bogumil Jewsiewicki, Thomas Blom Hansen, Arjun Appadurai, Dilip Gaonkar, Jean Comaroff, John Comaroff, Peter Geschiere, David Theo Goldberg, Laurent Dubois, Célestin Monga, Yara El-Ghadban, Anne-Cécile Robert, Alain Mabanckou und Ian Baucom.
Dieses Buch wurde während meines langen Aufenthalts am 18Witwatersrand Institute for Social and Economic Research (WISER) in Johannesburg geschrieben, wo ich von der Unterstützung meiner Kollegen Deborah Posel, John Hyslop, Pamila Gupta, Irma Duplessis und Sarah Nuttall profitiert habe. Außerdem habe ich von den im Rahmen des von Kelly Gillespie, Julia Hornberger, Leigh-Ann Naidoo, Eric Worby, Tawana Kupe und Sue van Zyl geleiteten Johannesburg Workshop in Theory and Criticism (JWTC) geäußerten Kritiken profitiert. François Gèze, Béatrice Didiot, Pascal Iltis und Johanna Bourgault vom Verlag La Découverte haben den Entstehungsprozess des Buches ganz fabelhaft begleitet und ihre Meinung ohne zu zögern geäußert.
1 Einen Gesamtüberblick gibt Prasenjit Duara (Hrsg.), Decolonization. Perspectives Now and Then, London : Routledge, 2004.
2 Dilip P. Gaonkar (Hrsg.), Alternative Modernities, Durham : Duke University Press, 2001.
3 Fabien Éboussi Boulaga, La Crise du Muntu, Paris : Présence africaine, 1977.
4 Jean-François Bayart, L’État en Afrique (1989), Paris : Fayard, 2006.
5 Ranajit Guha, Dominance Without Hegemony, Cambridge : Harvard University Press, 1998, und Partha Chatterjee, The Nation and Its Fragments, Princeton : Princeton University Press, 1993.
6 Gilles Deleuze, Logique du sens, Paris : Minuit, 1969, S. 44 f. [dt. : Logik des Sinns, Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1993, S. 51 und S. 52 f.].
19Einleitung
Ein halbes Jahrhundert
Der Kolonialismus war beileibe keine leuchtende Erscheinung. Hinter dem riesigen goldenen Standbild, vor dem die verängstigten oder faszinierten Massen auf die Knie fielen, verbarg sich in Wirklichkeit gähnende Leere. Ein mit prächtigen Juwelen besetztes Stahlgehäuse, das abgesehen davon Teil der siebenköpfigen Bestie und ihres Bockmists war.7 Wie ein schleichendes Inferno, dessen Rauchwolken sich überall verbreiten, versuchte er, sich als Ritus und Ereignis zugleich zu etablieren : als Sprache, als Geste und Weisheit, Märchen und Mythos, Mord und Unfall. Und es lag teilweise an seiner beängstigenden Wucherungs- und Wandlungsfähigkeit, dass er das Leben derjenigen, die sich ihm unterworfen hatten, in einem solchen Maße erschütterte, dass er bis in ihre Träume vordrang, ihre schlimmsten Albträume erfüllte und ihnen alsdann grauenvolle Klagen entlockte.8 Die Kolonialisierung selbst war keine bloße Technologie, auch nicht einfach ein Dispositiv. Sie bestand nicht nur aus Mehrdeutigkeiten.9 Sie war auch ein in sich geschlossenes Ganzes, ein Gerüst sich wechselseitig überbietender trügerischer Gewissheiten : die Macht der Unwahrheit. Natürlich bewegte dieses komplexe 20Gebilde sich hin und her, aber in vielerlei Hinsichten bildete es eine feste, unbewegliche Drehscheibe. Gewöhnlich siegte die Kolonialisierung, ohne im Recht (raison) zu sein, weshalb sie von den Kolonisierten nicht nur verlangte, dass sie ihre Lebensweise (raisons de vivre) änderten, sondern auch ihre Denkweise (raison) – Wesen, die auf ewig im Zwiespalt bleiben würden.10 Und als solche riefen die Sache an sich und ihre Repräsentation bei denen, die unter ihrem Joch lebten, Widerstand hervor : Aufsässigkeit, Entsetzen und Verführung zugleich sowie ein paar heftige Aufstände.
Von der Entkolonialisierung als Aufbruchs- und Erhebungserfahrung handelt denn auch dieses Buch. Es untersucht die entkolonialisierteGemeinschaft. In der damaligen Situation bestand die Erhebung zu weiten Teilen in einer Neuverteilung der Sprache. Das war nicht nur dort der Fall, wo es nötig wurde, zu den Waffen zu greifen. Als seien die Feuerzungen des Heiligen Geistes in sie gefahren, begannen die Kolonisierten, auf verschiedenen Ebenen verschiedene Sprachen anstelle der Einheitssprache zu sprechen. In diesem Sinne stellt die Entkolonialisierung innerhalb der Geschichte der Moderne einen wichtigen Moment der Ent-Kopplung und Verzweigung der Sprachen dar. Von nun an gab es nicht mehr den einen Redner oder die eine Vermittlungsinstanz. Kein Wort mehr ohne Gegenwort. Keine Eindeutigkeit mehr. Jeder konnte sich in seiner eigenen Sprache ausdrücken, und die Adressaten dieser Äußerungen konnten sie in ihrer Sprache empfangen. Als der Knoten erst einmal geplatzt war, blieb nur noch eine riesige sprachliche Palette übrig. Für keinen der Menschen, die sich davon befreit hatten, sollte Entkolonialisierung jemals heißen, die Bilder der Sache an sich und ihrer Substitute in einer 21anderen Zeit noch einmal zu durchleben. Die Loslösung davon verfolgte immer das Ziel, das Intermezzo einer aus zwei Kategorien von Menschen bestehenden Welt – auf der einen Seite die Subjekte, die handeln, auf der anderen die Objekte, auf die man zugreift – ein für alle Mal zu beenden. Sie strebte einen radikalen Wandel der Verhältnisse an. Die ehemaligen Kolonisierten würden von nun an ihre eigene Zeit erschaffen und mit ihr die Weltzeit. Auf dem Boden ihrer Traditionen und ihres Imaginären könnten sie sich jetzt mit ihrer langen Vergangenheit im Rücken im Rahmen ihrer eigenen Geschichte fortpflanzen, die offenkundig wiederum die Geschichte der ganzen Menschheit abbildet. So würde man das Ereignis an der Art und Weise erkennen, wie alles neu begänne. Dem Spiel der unterschiedslosen Wiederholung, den Kräften, die zur Zeit der Knechtschaft versucht haben, alles Dauerhafte zu erschöpfen oder abzuschließen, stünde nun die Zeugungsfähigkeit entgegen. Mit prometheischen Worten hat Frantz Fanon das den Ausgang aus der »langen Nacht« vor dem Leben genannt,11 wohingegen Aimé Césaire den Wunsch nach »einer strahlenderen Sonne und klareren Sternen« heraufbeschwor.12
Den ursprünglichen Sinn der Entkolonialisierung rekonstruieren
Für den Ausgang aus der langen Nacht vor dem Leben müsste man bewusst eine »Provinzialisierung Europas« vornehmen. Es wäre nötig, hat Fanon gesagt, jenem Europa, »das nicht aufhört, vom Menschen zu reden, und ihn dabei niedermet22zelt, wo es ihn trifft, an allen Ecken seiner eigenen Straßen, an allen Ecken der Welt«, den Rücken zu kehren. Von diesem Europa, das niemals aufgehört habe, vom Menschen zu sprechen, fügte er hinzu, wüssten wir heute, »mit welchem Leiden die Menschheit jeden der Siege des europäischen Geistes bezahlt hat«.13 Fanon schlug nicht nur vor, diesem Europa nicht zu »folgen«. Er schlug vor, es zu »verlassen«, weil es endgültig ausgespielt habe. Die Zeit, sich »etwas andere[m]« zuzuwenden, sei gekommen, versicherte er. Das mache es erforderlich, die »Frage des Menschen« wiederaufzunehmen. Doch wie ? Indem man »die ganze Zeit, Tag und Nacht, in Gesellschaft des Menschen marschier[t], in Gesellschaft aller Menschen«.14 Aus der entkolonialisierten Gemeinschaft machte das eine Gemeinschaft auf dem Vormarsch, eine Gemeinschaft von Marschierenden, eine große, universelle Karawane. Anderen zufolge würde diese umfassende, universelle Truppe nicht durch die Loslösung von Europa entstehen, sondern dadurch, dass man es mit Fürsorglichkeit und Mitleid betrachtet und ihm jenen Teil von Menschlichkeit wieder einflößt, den es verloren hat.15
Über das Sammeln von historischen Einzelheiten hinaus gilt es, diese ursprünglichen Bedeutungen des Ereignisses zu rekonstruieren. Sie finden sich im Stoff der Kolonialerfahrung selbst, in der Sprache, den Worten, den Schriften, den Liedern, im Handeln und im Bewusstsein ihrer Protagonisten sowie in der Geschichte der Institutionen, die sie geschaffen haben, ebenso wie in der Erinnerung, die sie diesen Er23eignissen zuteilwerden ließen.16 Man muss sich klarmachen, dass die Erhebung (insbesondere die bewaffnete), die der Kolonialherrschaft und den Rassengesetzen, auf denen sie beruhte, ein Ende setzen sollte, kaum möglich gewesen wäre, wenn die Aufständischen nicht bewusst eine verwunderliche Fähigkeit – sublime Illusion oder schlafwandlerische Sicherheit ? – entwickelt hätten, Tatkraft und Bissigkeit, eine Gefühlslage, die aus Berechnung und Wut, Glauben und Opportunismus, Begehren und Begeisterung, Messianismus, ja sogar Wahnsinn bestand, und wenn dieses Feuer sich nicht in Sprache und Praxis hätte übersetzen lassen, wenn es nicht praktisch ausgebrochen, aufgelodert und zu Tage getreten wäre.17 Die alten Fesseln der Unterwerfung abzustreifen und einen neuen Platz in der Zeit und im Gefüge der Welt zu besetzen : das war der Horizont. Und wenn sich im Laufe dieses Aufstiegs zu den Grenzen eine Auseinandersetzung mit dem Tod nicht mehr vermeiden ließ, wollte man vor allem nicht wie eine Ratte oder ein Haustier sterben, gefangen im Hühnerhof, in den Kuh- oder Pferdeställen, unter dem Schlachtbeil oder einfach im Freien.18
Für viele der damaligen Akteure handelte es sich durchaus um einen manichäischen Kampf.19 Deutung des Lebens, Vorbereitung auf den Tod : Der Entkolonialisierungskampf nahm häufig eine poetisch fruchtbare Gestalt an. Von den Helden des Kampfes – an die besonders die Volkslieder er24innern – verlangte er völlige Selbstaufgabe, eine erstaunliche Fähigkeit zur Askese und in manchen Fällen rauschhaftes Beben. Die Kolonialisierung hatte einen beträchtlichen Teil des Globus mit einem riesigen Netz aus Abhängigkeit und Herrschaft umfangen. Dem Kampf, ihr ein Ende zu setzen, kam deshalb weltweite Bedeutung zu. Die Repotenzialisierungsbewegung stellten sich manche wie ein universelles Befreiungsfest vor, der Mensch würde den höchsten Grad seiner symbolischen Fähigkeiten wiedererlangen, angefangen mit dem Körper insgesamt, dessen Kopf und Glieder durch Gesang und Tanz in Bewegung versetzt werden würden – schallendes Gelächter und überschäumendes Leben. Dies verlieh dem antikolonialistischen Kampf eine sowohl traumtänzerische als auch ästhetische Dimension.
Welche Spuren, Zeichen, Überreste bleiben nach 50 Jahren von dieser Erhebungserfahrung, von der Leidenschaft, die ihr innewohnte, von diesem Übergangsversuch vom Ding-Sein zum Subjekt-Sein, vom Willen, die »Frage des Menschen« wiederaufzunehmen ? Gibt es überhaupt etwas Erinnerungswürdiges oder muss man ganz von vorne beginnen ? Was von vorne beginnen, warum, wie und unter welchen Bedingungen ? In welcher neuen Sprache, was für einer neuen Kultur, mit welchen neuen Worten inmitten des undurchdringlichen Chaos der Gegenwart ? Wenn sich die entkolonialisierte Gemeinschaft anhand ihres Verhältnisses zur Zukunft, der Erfahrung einer neuen Lebensform und einer neuen Beziehung zum Menschsein bestimmen lässt, wie Frantz Fanon gesagt hat,20 wer bestimmt dann jetzt den ursprünglichen Inhalt, für den eine neue Form geschaffen werden muss, neu ? Wenn die außergewöhnliche Reise in eine neue Welt abermals unternommen werden muss : Mit Hilfe welchen neuen Wissens kann das geschehen ? Wie kann man, kurz gesagt, etwas, von 25dem nur noch ein Standbild übrig ist, zu neuem Leben erwecken ? Oder handelt es sich dabei um eine so träge Masse und ein mittlerweile so lästiges Thema, dass man dieses Standbild einfach vom Sockel stoßen sollte ?
Denn was hat man ein halbes Jahrhundert später statt einer wirklichen Wiederinbesitznahme des Selbst und anstelle einer grundlegenden Instanz vor sich ? Einen sichtlich leblosen Klotz, der von allem Möglichen zeugt, nur nicht von einem lebendigen, unbeschwerten Körper – welcher hinter einer dicken Schicht aus Wut und Fetischisierungen verschwindet. Am Boden eines Flusses, der in die falsche Richtung fließt, funkeln einige Gegenstände, und am Rande des Lichtkegels warten schlecht erkennbare Bodenschätze auf ihre Ausbeutung. Warum ist Afrika so durchlöchert und unterhöhlt ? Warum diese satte Schwerfälligkeit und dieser Lärm, der dem Subjekt unablässig vorauseilt und es in einen unsäglichen Zustand zu versetzen scheint ? Und dieser Furor, der die scheinbare Gelassenheit der Dinge umgibt und deren Stummheit im Grunde nur überwindet, um noch weiter in der Leere zu versinken ? Wann wird die Sache angegangen ? Wohin gehen wir bloß ?
Autoritäre Restauration hier, administratives Mehrparteiensystem da, ansonsten dürftige und noch dazu reversible Schritte voran und nahezu überall ein sehr hoher Grad an sozialer Gewalt, ja sogar Abkapselungen, verdeckte Konflikte oder offene Kriege vor dem Hintergrund eines ökonomischen Raubbaus, der auf einer Linie mit der Logik kolonialer Profitgier liegt und der Ausplünderung gute Gelegenheiten bietet : So sieht die Gesamtlandschaft aus. Für die Wahrheit ein verheerender Strudel, egal ob in kleineren Schritten oder plötzlich infolge so vieler Katastrophen. Hinzu kommen zielloser Aktivismus, chronische Improvisation, Disziplinlosigkeit, Vergeudung und Verschwendung sowie ein Maß an Niedertracht, Verachtung und Erniedrigung, das noch schlimmer 26ist als in der Kolonialzeit. Die meisten Afrikaner haben noch nicht einmal die Möglichkeit, ihre Regierung frei zu wählen. Zu viele Länder sind immer noch in der Hand von Satrapen, deren einziges Ziel darin besteht, zeit ihres Lebens an der Macht zu bleiben. Die meisten Wahlen sind denn auch gefälscht. Bei den grundlegenden Verfahrensfragen werden Zugeständnisse an die Mitbewerber gemacht, aber die Kontrolle über die zentralen Schaltstellen des Verwaltungsapparats, der Wirtschaft und vor allem der Armee, der Polizei und der Milizen verbleibt weiter in einer Hand. Da der Sturz der Regierung über den Urnengang praktisch ausgeschlossen ist, kann gegen das Prinzip des unendlichen Festhaltens an der Macht nur mit Hilfe von Attentaten, Aufständen und bewaffneten Erhebungen Einspruch erhoben werden. Mit den Wahlmanipulationen und den Erbfolgen vom Vater auf den Sohn lebt es sich faktisch wie in einem Stammesfürstentum.
Wohin gehen wir?
Fünf beklemmende Entwicklungstendenzen stecken die Zukunft ab, am unmittelbaren Horizont droht ein blutiges Ende. Die erste besteht im Fehlen eines demokratischen Denkens, das die Grundlage für eine wirkliche Alternative zum nahezu überall herrschenden Modell des Raubbaus abgeben könnte. Die zweite ist der Rückgang aller radikalen sozialrevolutionären Aussichten auf dem ganzen Kontinent. Die dritte ist die wachsende Senilität der schwarzen Machthaber. Bei allen Unterschieden im Einzelnen erinnert die Situation an die Verhältnisse, die im 19. Jahrhundert herrschten, als sich die meisten politischen Gemeinschaften in unablässigen Nachfolgekriegen selbst zerstörten, weil sie nicht in der Lage waren, mit dem Druck von außen zum eigenen Vorteil fertigzuwerden. Die vierte ist die Abkapselung gan27zer Gesellschaftszweige und der ununterdrückbare Wunsch von Abermillionen Menschen, lieber irgendwo anders auf der Welt zu leben als bei sich – der allgemeine Wille zu fliehen, davonzulaufen, sich abzusetzen ; Ablehnung der Sesshaftigkeit in Ermangelung eines festen Wohnsitzes, der Ruhepausen erlaubt. Zu diesen strukturellen Dynamiken kommt eine weitere hinzu : die Institutionalisierung von Schutzgelderpressungen und Raubbau, plötzlichem Aufruhr, ziellosen Unruhen, die immer wieder leicht in unkontrollierte Plünderungen umschlagen. Die tragende Schicht dieser Art von Lumpenradikalismus – in Wahrheit Gewalt ohne politische Alternative – sind nicht nur die »Jugendlichen«, deren tragische Symbole der »Kindersoldat« und der »Arbeitslose« aus den Elendsvierteln darstellen. Diese Art blutiger Populismus wird bei Bedarf auch von den gesellschaftlichen Kräften eingesetzt, denen es gelungen ist, den Staatsapparat zu kolonisieren und aus ihm ein Bereicherungswerkzeug für eine Klasse zu machen oder einfach eine private Ressource bzw. eine Quelle für Vorteilsnahmen aller Art. Auch auf die Gefahr hin, dass so der Staat dazu benutzt wird, den Staat, die Wirtschaft und die Institutionen zu zerstören, ist diese Klasse zu allem bereit, um ihre Macht zu erhalten. Die Politik ist in ihren Augen ohnehin nur eine Möglichkeit, den Bürgerkrieg bzw. die Kämpfe der Volksgruppen und Rassen mit anderen Mitteln zu führen.
Die lebhaftesten Veränderungen finden allerdings auf der Ebene der Kultur und des Imaginären statt. Afrika ist kein klar umrissener Raum mehr, dessen Standort man bestimmen kann, in dem sich ein Geheimnis oder ein Rätsel verbirgt oder den man eingrenzen kann. Wenn dieser Kontinent überhaupt noch ein Ort ist, dann handelt es sich häufig und für viele um einen Ort des Übergangs oder der Durchreise. Er ist ein Ort, der dabei ist, sich zugunsten eines Modells aufzulösen, in dessen Mittelpunkt Nomadentum, Transit, Irrfahrten und Asyl 28stehen. Sesshaftigkeit wird dabei tendenziell zur Ausnahme. Wo es noch Staaten gibt, bilden diese mehr oder weniger unzusammenhängende Knotenpunkte, über die man hinwegzugehen versucht ; Drehscheiben und Durchgangsräume. Eine Kultur der Bahnung also, vor allem für diejenigen, die auf dem Weg zu einem anderen Ort sind. In einer mittlerweile von Hecken umgebenen und mit Mauern durchzogenen Welt sind dennoch zahlreiche Hindernisse zu überwinden. Für Millionen von Menschen stellt die Globalisierung keine Zeit uneingeschränkt zirkulierender Verkehrsströme dar, sondern eine Zeit von verschanzten Städten, Lagern und Sicherheitszonen, Zäunen und Einfriedungen, von Grenzen, auf die man stößt und die mehr und mehr als tödliche Hindernisse und Mahnmale fungieren : Die Spur des Todes schreibt sich in den Staub oder die Fluten ein. Fallengelassen, ruht hier das Körper-Objekt im Angesicht der Leere. Afrika wird mittlerweile mehrheitlich von potenziellen Durchreisenden (Passanten) bewohnt. Angesichts von Plünderungen, unzähligen Formen der Habgier, Korruption, Krankheit, Piraterie und zahlreichen Vergewaltigungserfahrungen sind sie bereit, ihrer Heimat den Rücken zu kehren – in der Hoffnung, sich anderswo neu zu erfinden und neue Wurzeln zu schlagen. Im Trott der zum Untätigsein verurteilten lebendigen Kräfte des Kontinents lodert es, brodelt es, versucht ein wahnsinniger Druck angesichts der schrecklichen Alternative zu entweichen : in völliger Abstumpfung dort zu bleiben auf die Gefahr hin, zu bloßem Menschenfleisch zu werden, oder sich wegzubewegen, wegzugehen um jeden Preis.
Mit diesen groben Schilderungen will ich nicht sagen, dass es in Afrika überhaupt kein vernünftiges Streben nach Freiheit und Wohlstand gibt. Es ist jedoch schwer, für diesen Wunsch eine Sprache zu finden, ihn effektiv in die Praxis umzusetzen und ihn vor allem in neue Institutionen und eine neue politische Kultur zu überführen, in denen der Kampf 29um die Macht kein Nullsummenspiel mehr ist. Damit die Demokratie in Afrika Wurzeln schlägt, muss sie von organisierten gesellschaftlichen und kulturellen Kräften getragen werden : von Institutionen und Netzwerken, die direkt aus den geistigen Anlagen, dem Einfallsreichtum und vor allen aus den täglichen Kämpfen der Menschen selbst und deren eigener solidarischer Tradition hervorgehen. Aber auch das reicht noch nicht aus. Man braucht außerdem eine Idee, deren lebende Metapher die Demokratie wäre. Wenn man Politik und Macht mit Blick auf die Kritik der Formen des Todes oder genauer gesagt auf das Gebot, »Lebensreserven« anzulegen, neu formulieren würde, könnte man so zum Beispiel einem neuen, demokratischen Denken auf einem Kontinent den Weg bahnen, auf dem die Macht zu töten nach wie vor so gut wie unbegrenzt ist und Armut, Krankheit und Unwägbarkeiten aller Art das Leben unsicher und prekär machen. Im Grunde genommen müsste ein solches Denken eine Mischung aus Utopie und Pragmatismus darstellen. Es sollte sich unbedingt um ein Denken des Kommenden, des Eintretenden und der Erhebung handeln. Aber diese Erhebung müsste sehr viel weitreichender sein als die antikolonialistischen und antiimperialistischen Kämpfe der Tradition, deren Grenzen im Zusammenhang mit der Globalisierung und im Hinblick auf das, was seit der Unabhängigkeit geschehen ist, inzwischen offenkundig geworden sind.
Bis dahin stehen einer Demokratisierung des Kontinents drei entscheidende Hindernisse entgegen. Erstens eine bestimmte politische Ökonomie. Zweitens ein bestimmtes Imaginäres in Bezug auf Macht, Kultur und Leben. Und drittens soziale Strukturen, deren hervorstechendstes Merkmal darin besteht, ihre äußere Form und frühere Kostümierung beizubehalten, obwohl sie sich innerlich unaufhörlich verändern. Auf der einen Seite hat die Brutalität der ökonomischen Zwänge, die die afrikanischen Länder im Laufe des letzten Viertels des 3020. Jahrhunderts erlebt haben – und die sich unter der Knute des Neoliberalismus weiter fortsetzt –, zur Entstehung einer aus »Anteilslosen« bestehenden Multitude beigetragen, bei deren Auftreten in der Öffentlichkeit es immer häufiger zu Tumulten kommt oder, schlimmer noch, zu Abschlachtungen bei xenophoben Ausbrüchen oder anlässlich von Kämpfen unter den Volksgruppen, vor allem kurz nach manipulierten Wahlen, im Zusammenhang mit Protesten gegen die Teuerungsrate oder aber im Rahmen der Kriege um die Vereinnahmung seltener Bodenschätze. In völliger Ungewissheit, ob sie jemals heiraten oder eine Familie gründen werden, haben diese mehrheitlich deklassierten Schulabbrecher aus den Elendsvierteln objektiv nichts zu verlieren. Überdies sind sie strukturell mehr oder weniger verloren – und können diesem Zustand oft nur durch Auswanderung, Kriminalität und alle möglichen illegalen Umtriebe entgehen.
Sie gehören zur Klasse der »Überflüssigen«, mit denen der Staat (wenn es einen gibt) und sogar der Markt selbst nichts anzufangen weiß. Sie sind Menschen, die man weder als Sklaven verkaufen – wie zu Beginn des modernen Kapitalismus – noch zu Zwangsarbeit verurteilen – wie in der Kolonialzeit und unter der Apartheid – noch auch in Strafanstalten unter Verschluss halten kann wie in den Vereinigten Staaten. Aus der Perspektive der Funktionsweise des Kapitalismus in diesen Weltregionen betrachtet, stellen sie Menschenfleisch dar ; sie ächzen unter dem Gesetz der Verschwendung, Gewalt und Krankheit und sind dem nordamerikanischen Evangelismus genauso ausgeliefert wie den islamischen Kreuzzügen und allen möglichen Phänomenen von Hexerei und Erleuchtung. Auf der anderen Seite hat die Brutalität der ökonomischen Zwänge das demokratische Projekt auch inhaltlich völlig entleert und es auf eine reine Formsache reduziert – auf ein Kunstgebilde ohne Inhalt und ein Ritual ohne symbolische Durchschlagskraft. Wie oben schon ange31deutet, kommt dazu noch das Unvermögen, den Kreislauf von Raubbau und Ausplünderung zu durchbrechen, dessen Geschichte im Übrigen bis vor die Kolonialzeit zurückreicht. Zusammengenommen lasten diese Faktoren schwer auf den Formen, die der politische Kampf in manchen postkolonialen Ländern annimmt.
Zu diesen grundsätzlichen Gegebenheiten kommt das Ereignis hinzu, als das man den starken gesellschaftlichen Verfall betrachten kann, der Anfang der 1980er Jahre einsetzte. Dieser Zerfall der Gesellschaft hat nahezu überall zu einer Informalisierung der sozialen und ökonomischen Verhältnisse, zu einer noch nie dagewesenen Fragmentierung im Bereich von Regeln und Normen und zu einem Desinstitutionalisierungsprozess geführt, der auch den Staat selbst nicht ausgespart hat. Darüber hinaus hat dieser Zerfall eine große Absetzungsbewegung auf Seiten zahlreicher sozialer Akteure hervorgerufen und so neuen Formen des sozialen Kampfes den Weg gebahnt : am unteren Ende der Gesellschaft einem erbarmungslosen Kampf ums Überleben, in dessen Mittelpunkt der Zugang zu den grundlegenden Ressourcen steht ; am oberen Ende einem Privatisierungswettlauf. Die Elendsviertel sind heute zu neuralgischen Punkten für jene neuen Formen der »Abspaltung«, für die keine Revolution vonnöten ist, und für Zusammenstöße geworden, die häufig ohne erkennbaren Anführer auf der Ebene von kleinsten Einheiten und Kleingruppen stattfinden und Elemente des Klassenkampfes, des Kampfes der Rassen, der Volksgruppen, des religiösen Millenarismus und der Hexerei auf sich vereinen.
Davon abgesehen ist die Schwäche der Oppositionsbewegungen allseits bekannt. Machthaber und Oppositionen operieren im Rahmen von kurzen Zeitspannen, die geprägt sind durch Improvisation, informelle und punktuelle Arrangements, verschiedene Kompromisse und Zugeständnisse, das Erfordernis, die Macht unmittelbar zu erobern, bzw. die Not32wendigkeit, sie um jeden Preis zu behalten. Ständig werden Bündnisse geschmiedet und gebrochen. Aber vor allem bleibt Afrika eine Weltregion, in der die wie auch immer beschaffene und von Satrapen ausgeübte Macht automatisch Immunität genießt. Im Grunde liegen die Dinge einfach. Der Potentat ist ein Gesetz für sich. In vielen Fällen besteht sein Gesetz in Raubbau und Vorteilsnahme und unter Umständen in Mord. Als plumpes, überwältigendes und knorriges Knochengerüst besteht seine Funktion darin, zwischen Leben und Schreckensherrschaft ein Trauerband zu knüpfen. Indem er Leben und Tod austauschbar macht und beide in diesem ebenso infernalen wie quasi-dauerhaften Verhältnis belässt, kann er die Ausplünderungszyklen fast nach Belieben wiederholen, von denen jeder Afrika jedes Mal weiter in dem dionysischen Süden versinken lässt, für den bei Bataille die »Verausgabung« steht.
Demokratisierung und Internationalisierung
Die Entkolonialisierung Afrikas war aber nicht nur eine afrikanische Angelegenheit. Sowohl vor als auch während des Kalten Krieges war sie eine internationale Angelegenheit. Ihre Akzeptanz war bei einer ganzen Reihe von äußeren Mächten ein reines Lippenbekenntnis. Einige von ihnen begegneten der gebotenen, mit einer Demokratisierung oder nach dem Beispiel Südafrikas mit einem beträchtlichen Maß an Entrassialisierung einhergehenden Entkolonialisierung mit teilweise vehementer Ablehnung. In seiner Einflusssphäre schreckte Frankreich in den 1950er und 1960er Jahren nötigenfalls auch vor Korruption und Mordanschlägen nicht zurück.21 Noch 33heute ist es zu Recht oder zu Unrecht für die überaus beständige, hinterhältige und durch nichts zu erschütternde Unterstützung bekannt, die es den korruptesten Satrapien des ganzen Kontinents und genau den Regierungen zuteilwerden ließ, die sich nicht um die afrikanischen Belange kümmerten. Dafür gibt es zwei Gründe : zum einen die historischen Umstände, unter denen die Entkolonialisierung erfolgte und das Kopfsteuersystem eingeführt worden ist, das durch die in den 1960er Jahren unterzeichneten, ungleich gewichteten Abkommen »zur Zusammenarbeit und zur Verteidigung« zementiert wurde ; zum anderen die revolutionäre Schwäche, das Unvermögen und die Unorganisiertheit der internen gesellschaftlichen Kräfte. Die Geheimabkommen – in denen bestimmte Klauseln die Eigentumsrechte am Boden, an den Bodenschätzen und am Luftraum betrafen – zielten nicht darauf ab, die kolonialen Verhältnisse aufzulösen, sondern sie vertraglich festzulegen und sie an einheimische Handlungsbevollmächtigte zu delegieren. Diese waren beileibe kein bloßer Spielball in den Händen eines Taschenspielers, sondern verfügten durchaus über relative Autonomie, auf deren Klaviatur sie in einem solchen Maß zu spielen wussten, dass sie ein halbes Jahrhundert später als echte »Klasse« auftreten können, die mittlerweile ihre Fühler transnational ausstreckt.
Die Vereinigten Staaten widersetzen sich der Demokratisierung vielleicht nicht aktiv. Zynismus, Heuchelei und Instrumentalisierung reichen bei weitem – auch wenn abgesehen vom Moralismus, Evangelismus und Antiintellektualismus zahlreiche amerikanische Privateinrichtungen die Konsolidierung der afrikanischen Zivilgesellschaften in vielerlei Hinsicht unterstützen. Ein wichtiger Faktor in den kommenden 50 Jahren wird Chinas Präsenz in Afrika sein. Die Präsenz dieser nichtideellen Macht könnte, wenn schon kein Gegengewicht, so doch zumindest einen Ausweg aus dem unglei34chen Austausch bieten, der für die Beziehungen, die der afrikanische Kontinent zu den westlichen Mächten und zu den internationalen Finanzinstitutionen unterhält, so typisch ist. Im Augenblick geht die Beziehung zu China allerdings nicht über das Modell des ökonomischen Raubbaus hinaus – ein Modell, das zusammen mit der Ausplünderung die materielle Basis der schwarzen Diktaturen darstellt. Man sollte deshalb nicht damit rechnen, dass China bei den kommenden Kämpfen für Demokratie eine große Hilfe ist. Der Einfluss der anderen aufsteigenden Macht, Indien, ist bisher äußerst gering, obwohl im östlichen und im südlichen Afrika gut etablierte indische Minderheiten leben. Was Südafrika anbelangt, so kann es die Demokratie in Afrika nicht ganz alleine voranbringen. Dafür fehlen ihm die Mittel, der Wille und auch die Vorstellungskraft. Außerdem muss es erst die eigene Demokratie vertiefen, bevor es daran denken kann, bei den anderen dafür zu werben.
Angesichts fehlender interner gesellschaftlicher Kräfte, die in der Lage sind, einen radikalen Wandel der sozialen und ökonomischen Verhältnisse nötigenfalls mit Gewalt zu erzwingen, muss man sich andere Wege zur möglichen Wiedergeburt Afrikas einfallen lassen. Sie werden lang und dornig sein. Aber der Druck wächst, auch wenn er mit perversen Reterritorialisierungsformen einhergeht.22 Bald wird es erforderlich sein, die perverse Alternative von Fliehen oder Zugrundegehen zu überwinden. Man müsste auf dem ganzen Kontinent eine Art »New Deal« anstreben, der von den verschiedenen afrikanischen Staaten und den internationalen Mächten gemeinsam ausgehandelt wird – ein »New Deal« für Demokratie und ökonomischen Fortschritt, der das Kapitel der Entkolonialisierung fortschreiben und ein für alle Mal 35abschließen würde. Mehr als ein Jahrhundert nach der berühmten Berliner Konferenz, auf der die Aufteilung Afrikas in die Wege geleitet wurde, würde ein solcher »New Deal« vor allem die ökonomische Rekonstruktion des Kontinents in Aussicht stellen. Er sollte aber auch juristische und strafrechtliche Bestimmungen, Sanktions-, ja sogar Ausschlussmechanismen enthalten, deren Umsetzung multilateral erfolgen müsste. Anregungen dazu könnten aus den jüngsten Änderungen in der Völkerrechtsprechung bezogen werden. Dazu würde gehören, dass in den Fällen, in denen Regierungen sich Verbrechen gegen das eigene Volk zuschulden kommen lassen, diese Regierungen gewaltsam, aber rechtmäßig ihres Amtes enthoben werden dürfen und die Urheber der Verbrechen von der internationalen Gerichtsbarkeit strafrechtlich verfolgt werden können. Das Konzept der »Verbrechen gegen die Menschlichkeit« müsste seinerseits eine breitere Auslegung erfahren, sodass es nicht nur Massaker und schwere Menschenrechtsverletzungen umfasst, sondern auch schwere Fälle von Korruption und Ausplünderung der natürlichen Ressourcen eines Landes. Es versteht sich von selbst, dass derartige Bestimmungen auch für lokale oder internationale private Akteure Geltung besitzen könnten. Es ist wichtig, die Frage der Entkolonialisierung, der Demokratisierung und des ökonomischen Fortschritts in Afrika in Zukunft historisch und strategisch so grundlegend anzugehen. Die Demokratisierung Afrikas ist zwar zuallererst eine afrikanische Frage, die sich natürlich nicht trennen lässt von der Bildung sozialer Kräfte, die in der Lage sind, sie zu stellen, voranzutreiben und zu verteidigen. Aber sie ist auch eine internationale Angelegenheit.
36Neuaufbruch
In den kommenden 50 Jahren wird die Rolle der Intellektuellen, der Gebildeten und der Zivilgesellschaft in Afrika teilweise darin bestehen, einerseits bei der Bildung ebendieser Kräfte von unten zu helfen und andererseits der »afrikanischen Frage« in Weiterführung der Bemühungen Geltung zu verschaffen, die in den letzten Jahren unternommen worden sind, um Sicherheit und Völkerrecht für alle Seiten zugänglich zu machen, und die zur Einrichtung von suprastaatlichen Rechtsprechungsinstanzen geführt haben. Darüber hinaus muss die traditionelle Konzeption von Zivilgesellschaft, die ein direktes Erbe der Geschichte der kapitalistischen Demokratien darstellt, überwunden werden. Einerseits muss dem objektiven Faktor sozialer Vielfalt – vielfältige Identitäten, Treuepflichten, Autoritäten und Normen – Rechnung getragen werden und auf dieser Grundlage müssen neue Formen des Kampfes, der Mobilisierung und der Führerschaft entwickelt werden. Andererseits ist die Notwendigkeit, einen intellektuellen Mehrwert zu erzeugen, noch nie von so großer Dringlichkeit gewesen. Dieser Mehrwert sollte in das Projekt eines radikalen Wandels des Kontinents reinvestiert werden. Für die Schaffung dieses Mehrwerts ist nicht allein der Staat zuständig. Sie ist die neue Aufgabe der afrikanischen Zivilgesellschaften. Um dahinzugelangen, muss man unbedingt der Logik des Humanitarismus, das heißt der Notversorgung und der Versorgung der unmittelbaren Bedürfnisse, entrinnen, die bis heute die Debatte über Afrika beherrscht. Solange die Logik des Raubbaus und der Ausplünderung, die in Afrika die politische Ökonomie der Rohstoffe kennzeichnet, nicht durchbrochen wird – und mit ihr die bestehenden Abbaumethoden der reichen afrikanischen Bodenschätze –, werden keine großen Fortschritte zu verzeichnen sein. Die Art von Kapitalismus, die diese Logik begünstigt, ist aufs Engs37te mit Profitgier, politischen Unruhen, Humanitarismus und Militarismus verwoben. Die Vorboten dieser Art von Kapitalismus ließen sich schon während der Kolonialzeit im System der Konzessionsgesellschaften erkennen. Diese Art von Kapitalismus braucht zum Funktionieren nun aber nichts weiter als befestigte Enklaven, häufig kriminelle Komplizen innerhalb der einheimischen Gesellschaften, so wenig Staat wie möglich und internationale Gleichgültigkeit.
Ohne Demokratie ist die Entkolonialisierung eine ziemlich jämmerliche und fiktive Form der Wiederinbesitznahme des Selbst. Doch wenn die Afrikaner eine Demokratie wollen, dann ist es an ihnen, deren Formen zu entwickeln und den Preis dafür zu zahlen. Niemand wird ihn an ihrer statt bezahlen. Sie werden die Demokratie auch nicht auf Kredit bekommen. Trotzdem werden sie sich auf neue, internationale Solidaritätsnetzwerke stützen müssen, auf eine große überstaatliche moralische Koalition, die all jene auf sich vereint, die glauben, dass unsere Welt ohne ihren afrikanischen Teil nicht nur geistig und menschlich viel ärmer wäre, sondern dass auch ihre Sicherheit mehr denn je auf dem Spiel stände.
7 Yambo Ouologuem, Le Devoir de violence (1968), Paris : Le Serpent à plumes, 2003 [dt. : Das Gebot der Gewalt, München : Piper, 1969].
8 Achille Mbembe, La Naissance du maquis dans le Sud-Cameroun. 1920-1960 : histoire des usages de la raison en colonie, Paris : Karthala, 1996.
9 Caroline Elkins, Imperial Reckoning. The Untold Story of Britain’s Gulag in Kenya, New York : Henry Holt, 2005 ; und David Anderson, Histories of the Hanged. Britain’s Dirty War in Kenya and the End of Empire, London : Weidenfeld & Nicolson, 2005.
10 Cheikh Hamidou Kane, L’Aventure ambiguë (1968), Paris : 10 / 18, 2003 [dt. : Der Zwiespalt des Samba Diallo. Erzählung aus Senegal, Frankfurt am Main : Verlag Otto Lembeck, 1980].
11 Frantz Fanon, Les Damnés de la terre (1961), Paris : La Découverte, 2003, S. 301 [dt. : Die Verdammten dieser Erde, Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1966, S. 239, Übers. leicht modifiziert, d. Ü.].
12 Aimé Césaire, Les Armes miraculeuses, Paris : Gallimard, 1970, S. 15.
13 Frantz Fanon, Die Verdammten dieser Erde, a. a. O., S. 239.
14 Ebd., S. 241.
15 Léopold Sédar Senghor, Chants d’ombre, Paris : Seuil, 1956 [dt. : »Schattengesänge«, in : ders., Botschaft und Aufruhr. Gedichte, Wuppertal : Peter Hammer, 2006, S. 39-59], und Gary Wilder, »Race, Reason, Impasse : Césaire, Fanon and the Legacy of Emancipation«, in : Radical History Review, Nr. 90, Herbst 2004.
16 Achille Mbembe, »Pouvoir des morts et langages des vivants«, in : Politique africaine, Nr. 22, 1982.
17 David Lan, Guns and Rains : Guerillas and Spirit Mediums in Zimbabwe, Berkeley : University of California Press, 1985.
18 Zum Thema eines aus freien Stücken in Kauf genommenen Todes vgl. Nelson Mandela, Long Walk to Freedom (1994), London : Little Brown & Co., 1995 [dt. : Der lange Weg zur Freiheit, Frankfurt am Main : S. Fischer, 1994].
19 Ho Chi Minh, Down with Colonialism, intr. Walden Bello, London : Verso, 2007.
20 Frantz Fanon, Die Verdammten dieser Erde, a. a. O.
21 Georges Chaffard, Les Carnets secrets de la décolonisation, Paris : Calmann-Lévy, 1965.
22 James Ferguson, Global Shadows. Africa in the Neoliberal World Order, Durham : Duke University Press, 2006.
38
391 Am Anfang ein Totenschädel: Wege eines Lebens
»Gleichwohl ist die Weltnacht als ein Geschick zu denken, das sich diesseits von Pessimismus und Optimismus ereignet. Vielleicht geht die Weltnacht jetzt auf ihre Mitte zu. Vielleicht wird die Weltzeit jetzt vollständig zu der dürftigen Zeit. Vielleicht aber auch nicht, noch nicht, immer noch nicht, trotz der unermeßlichen Not, trotz aller Leiden, trotz des namenlosen Leides, trotz der fortwuchernden Friedlosigkeit, trotz der steigenden Verwirrung.« So heißt es bei Heidegger in einem Text mit dem Titel »Wozu Dichter ?«.23
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: