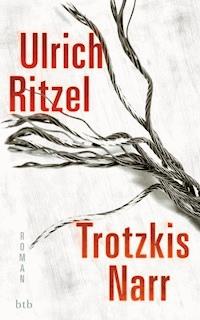Inhaltsverzeichnis
Sommertage
Mittwoch, 13. Februar 2008
Mittwoch, 13. Februar, Abend
Donnerstag, 14. Februar
Donnerstag, 14. Februar, Nachmittag
Donnerstag, 14. Februar, später Nachmittag
Freitag, 15. Februar
Freitag, 15. Februar, Abend
Samstag, 16. Februar
Sonntag, 17. Februar
Montag, 18. Februar
Dienstag, 19. Februar
Mittwoch, 20. Februar
Donnerstag, 21. Februar
Freitag, 27. Juni
Copyright
Sommertage
Tobruk war gefallen, und Kaufmann Hirrle hatte den Laden beflaggt, aber Weckgläser gab es keine. Marianne machte auf dem Absatz kehrt und ging wieder, sie hatte zwei große Kannen Stachel- und Johannisbeeren gepflückt, was wollte sie nun damit! Hirrle hatte ihr noch einen Blick zugeworfen, kommen Sie doch später noch mal, hieß das, wenn sonst keine Kunden mehr da sind, aber sie mochte diese Angebote nicht.
Im Laden war es kühl gewesen, doch draußen auf der staubhellen Dorfstraße stand die Hitze wie eine Wand, und Marianne brach der Schweiß aus auf der Stirne, noch bevor sie auf ihr Rad gestiegen war. Am Lenker baumelten die Kannen voller Beeren, wie nutzlos doch ihre ganze Mühe gewesen war! Sie fuhr los, vornüber gebeugt und beide Hände am Lenker, den Schlaglöchern ausweichend, noch immer ärgerlich und enttäuscht.
Plötzlich schrak sie hoch, Kindergekreisch brach über sie herein, eine Horde von Schulbuben schoss über die Straße, die Ranzen auf dem Rücken, ein strohblonder Junge wäre ihr fast ins Vorderrad gerannt, sie musste abbremsen und kam gerade noch rechtzeitig mit dem Fuß auf den Boden, sonst wäre sie gestürzt. Der Junge warf ihr einen erschrockenen Blick zu und rannte der Horde nach. Marianne atmete tief durch, dann stieg sie wieder auf und fuhr weiter.
Die Kinder waren jetzt, johlend und schreiend, an der Straßenecke weiter vorne stehen geblieben, gegenüber dem Postamt, einige von ihnen sammelten Steine auf. Erst in diesem Augenblick entdeckte Marianne auf der anderen Straßenseite die grauhaarige Frau, die aus dem Postamt gekommen sein musste und die jetzt mit hastigen Schritten der Horde zu entkommen suchte, die Hände abwehrend erhoben.
Wieder sah Marianne den blonden Jungen, der gerade eben einen Schritt auf die Straße hinausgetreten war und mit der Hand ausholte. Marianne schrie noch ein: »Nicht!« oder wollte es schreien, als der Junge mit einer abgezirkelten Bewegung auch schon einen Stein eigentlich nicht warf, sondern fliegen ließ, der Stein traf die alte Frau am Kopf, Staub oder Erdreich lösten sich beim Aufprall und stiegen um den Kopf der Alten auf wie eine lustige kleine Wolke. Einen kurzen Moment verharrte die Getroffene regungslos, dann barg sie das Gesicht in den Händen und krümmte sich, bis sie in sich zusammensank.
Marianne ließ das Fahrrad samt den Kannen auf den Boden fallen und lief zu der Getroffenen, die nun mit angezogenen Knien auf dem Gehsteig hockte. Blut lief ihr über die Hand, mit der sie das Auge schützte. »Ganz ruhig«, sagte Marianne, kniete sich neben sie und überlegte, womit sie die Blutung stillen könnte. »Ich helfe Ihnen, es ist sicher nur eine Platzwunde.«
Beim Niederknien war ihr der Rock hochgerutscht, und der Unterrock lugte hervor. Sie warf einen Blick auf die andere Straßenseite, die Horde hatte zu kreischen aufgehört, plötzlich liefen die ersten Kinder weg. Nur der Steinewerfer starrte noch herüber, dann rannte auch er davon.
Marianne schob den Rock höher und packte mit beiden Händen den Unterrock – zerschlissen war er ohnehin – und riss eine aufgegangene Naht vollends auseinander, bis sie einen Fetzen weißes Baumwollgewebe in der Hand hielt. »Gleich«, sagte sie beruhigend, zog behutsam die Hand der Frau von der Platzwunde und legte den zusammengefalteten Lappen auf.
»Was ist nur geschehen?«, rief in diesem Augenblick eine klagende Stimme. Schritte näherten sich, Marianne blickte auf, ein Mann in einem abgewetzten Anzug hastete heran, am Sakko trug er den Judenstern, auch die Frau, die noch immer auf dem Boden hockte, trug den Stern, warum hatte Marianne nicht darauf geachtet? Dabei hatten die Kinder doch die ganze Zeit »Judensau« geschrien, jetzt, wo sie daran dachte, hatte sie es wieder im Ohr.
»Ein Steinwurf«, sagte sie und stand so rasch auf, dass ihr für einen Moment schwindlig wurde. Der Mann versuchte, die Frau vom Boden hochzuziehen; dabei warf er Marianne einen so hilflosen Blick zu, dass sie sich bückte und der anderen aufhalf.
»Danke«, sagte die alte Frau und stand, zunächst schwankend. Mit der einen Hand hielt sie den Stofflappen an ihre Schläfe. »Sie sind sehr freundlich...« Durch den Lappen drang ein kreisrunder Blutfleck.
Abwehrend schüttelte Marianne den Kopf. »Können Sie sie zu ihrer Wohnung bringen?«, fragte sie den Mann. Dann fiel ihr ein, dass die beiden in dem Altersheim oben an der Wippinger Steige untergebracht sein mussten, das war noch ein gutes Stück, vor allem ein gutes Stück bergauf, aber der Mann meinte, ja doch, das ginge wohl, und Marianne deutete ein Kopfnicken an, kehrte zu ihrem Rad zurück und kniete sich nieder, um wenigstens einen Teil der Beeren wieder aufzusammeln, die aus den Kannen gerollt waren. Sie hatte das Gefühl, das ganze Dorf würde ihr dabei zusehen und hätte vorher schon zugesehen...
Was erst wird Otto sagen, wenn er es erfährt?
Und wenn? Dieses Altersheim hatte doch sie nicht eingerichtet. Sie stieg auf und trat in die Pedale, so gut es eben geht, wenn einem die Knie zittern.
An diesem Abend kam Otto früh zurück, kurz vor sechs Uhr hörte sie den gleichmäßigen raschen Takt, mit dem die beiden Krücken und das eine Bein abwechselnd auf dem Gehsteig aufsetzten, eigentlich hörte man nur die Krücken. Marianne hatte einen Teil der Beeren mit Magermilch und Quark zusammengerührt, den löffelte er eilig, denn er wollte noch am Abend zu einer Rommelfeier der Ortsgruppe, »du weißt doch, Tobruk ist gefallen!«. Während er aß, erzählte sie von ihrem Ärger mit den Weckgläsern, einen ganzen freien Tag habe sie daran gehängt, was solle sie jetzt mit dem Rest der Beeren bloß tun!
»Es ist doch dumm, dass man die nirgendwo bekommt«, sagte sie, »das ist doch nur vernünftig, wenn man Vorräte anlegt, alle sollten das tun können.«
»Vernünftig wäre«, antwortete Otto und schluckte einen Mundvoll Beerenquark hinunter, »dass jeder an seinem Platz das tut, was ihm möglich ist. Nicht vernünftig ist es, wenn sich ständig irgendwo ein kleines Meckerlein meldet und von nichts anderem reden will als davon, dass es gerade das nicht gibt oder jenes nicht.«
Von der Rommelfeier kam er spät zurück, als Marianne schon im Bett lag, und obwohl sie jedes Mal aufwachte, wenn er mit seinen Krücken ins Schlafzimmer holperte, stellte sie sich diesmal schlafend.
Die Nacht brachte nur wenig Abkühlung, und als Marianne am nächsten Morgen zu den Zementwerken radelte, warf die Sonne schon wieder blauschwarze Schatten auf die Dorfstraße. Sie hatte nicht gut geschlafen, irgendwann in der Nacht war ihr eingefallen, dass sie womöglich eine Vorladung bekommen würde, nur wegen dieser alten Frau. Aber sie hatte den Stern nicht gesehen, wirklich nicht, hatte ihn gar nicht sehen können, die Alte lag doch halb auf dem Boden...
Als sie an der Post vorbeifuhr, trat sie rascher in die Pedale, bis das Fabriktor der Zementwerke in Sicht kam. An drei Tagen in der Woche arbeitete sie dort im Personalbüro, lange wollte sie sich das nicht mehr antun. Der Buchhalter hatte als junger Mann im flandrischen Gaskrieg einen Lungenflügel verloren und ertrug die vom Kalkstaub durchsetzte Luft der Zementwerke nicht oder kaum mehr, aber immer fand er jemanden, der ihm dafür büßen musste. An diesem Morgen war es der Lehrling Hannelore, sie hatte vergessen, die neuen Verpflegungssätze für die Polen an die Werkskantine durchzugeben, und stand jetzt mit rotem Kopf da und musste sich die fast ohne Atem geflüsterten Fragen anhören, ob und wann und wie sie diese Verschleuderung von Volksvermögen wiedergutmachen wolle.
Nach einer Weile wurde es Marianne zu viel. »Diese Verpflegungssätze«, sagte sie kühl, »die hab ich zurückgehalten. Da wird nämlich zwischen kriegswichtiger und sonstiger Produktion unterschieden.«
»Und?« Der Buchhalter starrte sie an, und sein Gesicht hatte eine rosa Tönung angenommen.
»Wer hat worauf Anspruch?«, fragte Marianne zurück. »Das muss doch zuerst geklärt werden...«
»Das müssen Sie doch wissen«, flüsterte der Buchhalter, »schon längst müssen Sie das wissen, für Polen gelten grundsätzlich und ausnahmslos die niedrigeren Sätze! Grundsätzlich! Immer!«
»Dann wissen wir es jetzt ja«, gab Marianne zurück, aber weil Otto stellvertretender Ortsgruppenleiter war, wandte sich der Buchhalter nur ab und sagte gar nichts mehr.
Danach war Ruhe, aber wegen der Einweisung zusätzlicher Arbeitskräfte aus dem Generalgouvernement fielen am Nachmittag Überstunden an, so dass Marianne erst am Abend nach Hause kam. Beim Radfahren merkte sie, dass der Tag anstrengender gewesen war als gewöhnlich, und an der Steige zur Siedlung über der Kleinen Lauter wäre sie fast abgestiegen, das war ihr noch nie passiert.
»Wie fährst du eigentlich?«, tönte eine fröhliche Stimme neben ihr, »auf den Felgen oder dem Zahnfleisch?« Die Stimme gehörte Lisbeth, die mit dem 17.45-Uhr-Zug von Ulm gekommen war und sie jetzt auf dem Rad eingeholt hatte. Lisbeth arbeitete als Krankenschwester im Städtischen Krankenhaus Ulm, war aber nach ihrer Heirat aus dem Schwesternheim ausgezogen und hatte in dem Haus neben Marianne und Otto eine Wohnung im Obergeschoss bezogen.
Marianne richtete sich vom Lenker auf und gab sich Mühe, mit Lisbeth mitzuhalten. Es seien neue Leute zugewiesen worden, klagte sie, »aber eine zusätzliche Baracke kriegst du nirgendwo her...«
»Sollen die anderen ein wenig zusammenrücken«, meinte Lisbeth. »Das geht alles. Und sonst?« Sie warf ihr von der Seite her einen prüfenden Blick zu, und Marianne antwortete ausweichend, sonst sei alles gut, gewiss doch, »und bei dir?«.
»Ach!«, meinte Lisbeth. »Ich hab noch eine Flasche Wein, ein Geschenk von einer Patientin, wenn du Lust hast und dein Gemahl dich lässt, komm doch nachher rüber und trink ein Glas mit mir.«
Otto war noch nicht zu Hause und würde so schnell auch nicht kommen, sonst hätte ihn Lisbeth im Zug oder am Bahnhof gesehen. Sie hatten im Finanzamt in letzter Zeit oft solche Besprechungen, manchmal auch Sondereinsätze oder Sonderprüfungen, von denen Otto erst mit dem letzten Zug kam oder von einem Kollegen mit dem Dienstwagen gebracht wurde.
Marianne stellte sich erst einmal vor den Waschtisch und wusch sich den Kalkstaub vom Leib, noch immer hatte ihre Regel nicht eingesetzt, wie viele Tage waren es nun schon über die Zeit? Zehn? Sie zog das grünblaue Sommerkleid an und ging hinüber zu Lisbeth, die schon auf sie wartete: Auf dem kleinen Tisch am Fenster standen die geöffnete Flasche Rotwein und zwei Gläser und dazu – als sei dies die Hauptperson am Tisch – die gerahmte Fotografie eines schwarzlockigen Mannes in dunkler Uniform, mit dem Abzeichen der Luftwaffe auf dem Kragenspiegel. Klaus-Peter sei jetzt vor der Krim eingesetzt, berichtete Lisbeth, als sie einschenk te, »sie sind da unten ziemlich bescheiden untergebracht, jede Menge Mücken, Flöhe und Läuse, und die russischen Weiber sind ziemliche Trampel...« Sie lachte. »Das klingt doch beruhigend, findest du nicht?« Sie hob das Glas und trank Marianne zu.
Dann wollte sie wissen, wie es Otto gehe, und Marianne sagte, dass er noch immer auf seine Prothese warte. Solche Spezialanfertigungen bräuchten nun einmal ihre Zeit, meinte Lisbeth tröstend, und Marianne antwortete, dass sie das ihrem Mann auch immer sage. Aber weil sie nicht gerne über Ottos Unfall sprach, erkundigte sie sich rasch nach Lisbeths Tag in der Klinik...
»Ach«, sagte Lisbeth, »was glaubst du, wer alles zu uns kommt mit irgendwelchen Wehwehs, und wenn du genau hinhörst, geht es nur um ein Attest, damit man nicht zur Erntehilfe muss. Oder...« – sie schlug sich vor die Stirn – »... das war ja heute überhaupt der Gipfel! Du weißt doch, was wir hier im Ort für ein Heim haben, und stell dir vor – von den Leuten dort war jemand bei uns und hat sich als Krankenschwester aufgespielt! Eine Alte hatte sie dabei, die muss gegen einen Türpfosten gelaufen sein, jedenfalls hatte sie sich am Auge eine Platzwunde eingefangen. Es hat gerade noch gefehlt, dass diese angebliche Krankenschwester ›Kollegin‹ zu mir gesagt hat! Verstehst du, von diesen Leuten ist früher niemals jemand zu uns oder zu meinem Chef gekommen, oh nein! Die sind nur zu ihren eigenen Ärzten gerannt, aber jetzt, jetzt tut das Auge weh, und auf einmal sind wir gut genug und sollen einen Spezialisten holen, einen Augenfacharzt...«
Sie nahm die Flasche und wollte Lisbeth nachschenken, aber die hielt ihre Hand über das Glas.
»Ach!«, rief Lisbeth, »was ist denn da im Busch?« Marianne sagte es ihr, und Lisbeth gratulierte und wollte nähere Details wissen und nahm einen kräftigen Schluck auf das Wohl dessen, was im Busch war. Dann erklärte sie Marianne, dass es seit dem Frühjahr neue Bestimmungen zum Schutz werdender Mütter gebe und dass sie sich unbedingt beim Gesundheitsamt danach erkundigen müsse.
So sicher sei sie sich doch noch gar nicht, meinte Marianne, doch Lisbeth legte ihr geschwind die Hand auf den Arm und meinte, ganz gewiss werde es ein Junge, so blühend wie Marianne aussehe...
»Die Frau«, lenkte Marianne ab, »diese Alte, die bei euch war, was ist mit ihr passiert?«
»Wen meinst du jetzt?«, fragte Lisbeth zurück. »Ach, diese Platzwunde! Wir haben sie weggeschickt. Die Dame möge sich an einen Heilkundigen ihrer eigenen Rasse wenden, hat mein Chef ausrichten lassen. Die Dame!, hat er gesagt...«
Am Freitagmorgen hatte Hannelore in der Kaffeepause gefragt, ob Marianne am Wochenende nicht wieder einmal vorbeischauen wolle, die Mutter tät sich arg freuen. Und weil Otto zu einer Dienstbesprechung nach Stuttgart musste, nahm Marianne am Samstag das Rad und fuhr durch das Kleine Lautertal und von dort über die Alte Landstraße hoch zu dem Bauernhof, den Hannelores Mutter betrieb. Es war ein schöner, nicht mehr ganz so heißer Tag, es gab Stachelbeerkuchen und sogar richtigen Bohnenkaffee, Marianne fragte die Bäuerin lieber nicht, wie sie dazu gekommen war. Zwar hätte es Hannelore gerne gesehen, wenn der Besuch über Nacht geblieben wäre, aber Marianne wusste nicht, ob Otto nicht doch schon am Abend zurückkommen würde, und so radelte sie am Nachmittag zurück, mit einem Korb am Lenker, in dem unter zwei Salatköpfen vorsichtig vier Eier, ein geräucherter Schinken und eine Flasche Birnenschnaps verpackt waren.
Unterhalb der Einmündung der Alten Landstraße verläuft der Radweg zwischen grauem Felsgestein und der von Bäumen überschatteten Kleinen Lauter, wobei sich der Fluss zuweilen in einer Schleife vom Weg entfernt, dann aber wieder zu ihm zurückkehrt. Marianne mochte das Tal, und als sie an diesem Nachmittag hier entlangfuhr, ohne Mühe, hoch aufgerichtet, nur eine Hand am Lenker, fühlte sie sich glücklich.
An der Gestalt, die am Wegrand saß und dem über die Steine plätschernden Fluss zuzusehen schien, war sie fast schon vorbei, als ihr bewusst wurde, dass es eine Frau war, die dort saß, und dass diese Frau einen Verband um den Kopf trug. Sie hielt an und stellte das Rad an der von Moos überzogenen Felswand ab.
»Wie geht es Ihnen?«, fragte sie, und während sie es fragte, wunderte sie sich, warum sie nicht gegrüßt hatte. Sie hatte den Gruß einfach vermieden, zur Not geht das ja.
Die Frau hob den Kopf und sah sie aus dem einen Auge an, das nicht unter dem Verband verborgen war. »Danke«, kam die Antwort. »Sie sind die Frau, die mir geholfen hat, nicht wahr? Ich bin froh, dass ich mich noch einmal bei Ihnen bedanken kann...«
»Ist das Auge verletzt?« Noch während Marianne fragte, ärgerte sie sich über sich selbst. Was ging sie das an?
»Ein Augenarzt, ein Freund meines verstorbenen Mannes, kam heute aus Stuttgart und hat es sich angesehen«, kam die Antwort. »Es wird schon werden, hat er gesagt...«
»Ja, das wird es sicher«, meinte Marianne. Weil sie nicht wusste, was sie sonst hätte sagen sollen, ging sie zu ihrem Rad und nahm dabei ihr Kopftuch ab. Sie holte die Salatköpfe aus dem Korb, packte die vier Eier in das Kopftuch und band es zu einem Beutel.
»Hier«, sagte sie und brachte der Frau den Beutel, »nehmen Sie das, Sie können es sicher gebrauchen...«
Die Frau zögerte. »Ich weiß nicht, ob ich das annehmen darf.«
»Nun nehmen Sie schon«, drängte Marianne.
»Und das Kopftuch?«
»Das geben Sie mir irgendwann zurück, das nächste Mal, wenn wir uns sehen.« Marianne zwang sich zu einem Lächeln, wandte sich um und lief zu ihrem Rad. Sie hörte, wie die Frau noch etwas sagte, aber sie hatte schon das Rad angeschoben und war losgefahren.
Otto kam mit dem letzten Zug, er war erschöpft, wirkte aber sehr zufrieden. Es war eine sehr wichtige Besprechung, sagte er, »es geht voran, das merkt man in allem«. Marianne freute sich oder wollte sich mit ihm freuen, das ist doch etwas, dachte sie, dass er bei wichtigen Entscheidungen hinzugezogen wird...Sie brachte den Birnenschnaps und ein Glas und schenkte ihm ein; auf dem Hof der Hannelore hätten sie alte Brennereirechte, sagte sie, und da hätte sie eine Flasche davon bestellt, für drei Reichsmark! Otto trank den Schnaps und war beides zufrieden, den Schnaps und die Auskunft dazu.
»Weißt du«, sagte er dann, »das darfst du alles nicht wissen und vor allem nicht weitererzählen, aber stell dir vor, es ging heute in Stuttgart auch um hier, um diesen Ort, um den Schandfleck oben an der Steige...«
Er reichte ihr das Glas, und sie schenkte nach. »Pass doch auf«, sagte er ärgerlich, »du verschüttest es ja!...Was ich sagen wollte und was du bitte niemandem weitererzählst – es hat sich da droben bald ausgejüdelt, glaub mir das.«
Marianne sah ihn an. »Das sind doch alles alte, klapprige Leute – wo sollen die denn hin?«
»Die bekommen eine nützliche Arbeit, im Osten, weißt du...«
»Arbeit?« Marianne schüttelte den Kopf. »Die können nichts mehr arbeiten.«
»Ich sag dir mal was«, antwortete Otto. »Und merk es dir gut.« Auf seiner Stirn hatte sich eine steile Falte gebildet. »Diese Leute im Heim gehen dich nichts an, die gehen hier im Ort überhaupt niemanden etwas an, und Sorgen brauchst du dir um die gleich zweimal nicht zu machen, die machen sich auch keine Sorgen um dich, das darfst du mir glauben!«
»Trotzdem versteh ich es nicht«, widersprach Marianne.
»Was gibt es da nicht zu verstehen?«, schnitt ihr Otto das Wort ab. »Wenn du wüsstest, was diese Leute zur Seite geschafft haben, in die Schweiz und sonst wohin, und was sie noch immer bei sich haben und was sie alles verstecken und wo! Du würdest Augen machen...«
»Wo verstecken sie was?«
Otto schüttelte unwillig den Kopf. »Ich hab doch gesagt, in der Schweiz und so. Außerdem muss dich das alles nicht kümmern, das ist alles bestens geregelt und angeordnet...«
Marianne wollte ihre Frage wiederholen, aber plötzlich wusste sie, dass sie das besser doch nicht tat.
Am nächsten Abend gingen Marianne und Otto ins Kino, gespielt wurde »Der große König«, und Otto war sehr angetan, vor allem von der Wochenschau, die die Vorstöße der deutschen Panzer in Afrika und an der russischen Front zeigte. Marianne aber ertrug die stickige Luft nur schlecht, sie bekam Kopfweh, vielleicht war auch der Ton zu laut eingestellt. Doch wollte sie Otto den Abend nicht verderben und hielt durch.
Ins Lautertal konnte sie erst am Tag darauf, als die Dämmerung schon einsetzte und Wolken von Westen her über den Himmel zogen. Der Tag war wieder sehr heiß gewesen, die Schwalben flogen tief, und in der Luft lag eine Spannung, als müsse es noch ein Gewitter geben. Marianne fühlte sich seltsam, ein wenig ängstlich sogar, und als die Engstelle am Felsen in Sicht kam, hoffte sie, dass die alte Frau nicht dort sein würde. Aber ihr Kopftuch wollte sie ja doch zurückhaben, es war aus Seide, und Otto hatte es ihr aus dem Osten mitgebracht.
Die Frau saß wieder am Ufer und sah ins Wasser. Marianne stellte das Rad ab und ging auf sie zu. Die Frau sah auf, und als sie Marianne erkannte, hob sie die Hand und hielt ihr das ordentlich zusammengefaltete Kopftuch entgegen. Das Gesicht der Alten – ein schmales, von weißen Haaren eingehülltes Oval, mit scharf eingekerbten Falten von den Nasenflügeln bis zum Mund – schien sich verändert zu haben, das graue Auge betrachtete Marianne anders als zuletzt: ruhig, abwägend.
So kam es Marianne jedenfalls vor.
»Sie haben mein Kopftuch nicht vergessen«, sagte sie, nahm das Tuch, legte es an und knüpfte einen Knoten. »Das ist nett von Ihnen, es ist... es ist aus Paris.«
»Ja«, sagte die Frau, »das glaube ich gerne. Es ist sehr hübsch. Und es steht Ihnen.«
Marianne lächelte kurz und ein wenig verlegen.
»Ich wollte mich noch für die Eier bedanken«, fuhr die Frau fort. Ihre Stimme war leise, aber Marianne konnte sie gut verstehen. »Leider kann ich mich nun gar nicht revanchieren, das ist mir arg, aber ich hätte auch nur einen kleinen Gedichtband für Sie gehabt, aber das sind solche Gedichte, die Sie vielleicht gar nicht lesen dürfen.«
Marianne dachte an Otto und sagte rasch, dass sie für die paar Eier niemals ein Buch angenommen hätte.
»Ich werde in Ihrer Schuld bleiben müssen«, meinte die Frau. »Das ist so... Wir werden morgen weggebracht, und ich glaube nicht, dass wir uns noch einmal sehen werden.«
Marianne erschrak, warum eigentlich? Sie wollte etwas sagen, aber ihr fiel nichts ein.
»Da ist noch etwas.« Die Frau griff in ihre Jackentasche und holte etwas heraus, das Marianne im Zwielicht unter den Bäumen zuerst nicht erkannte. Eine Art Gespinst? Als die Frau es mit beiden Händen hochhielt, sah Marianne, dass es eine Kette war, eine Kette mit einem Anhänger, einem breiten Ring. Aus Gold? Also doch, dachte Marianne. Die Hände der Frau zitterten, und so schaukelte der Ring an der Kette hin und her.
»Er ist über zweihundertfünfzig Jahre alt«, sagte die Frau. »Ich dürfte den Schmuck gar nicht mehr bei mir haben. Dabei war es ein Geschenk von meiner Mutter für mich.« Wieder sah sie Marianne mit einem Blick an, der nicht bittend, sondern abwägend war. »Die hebräischen Zeichen innen im Ring bedeuten Masel Tov, das heißt ›Viel Glück‹ … Und viel Glück soll der Ring Ihnen bringen, wenn Sie sich entschließen könnten, ihn für mich aufzubewahren...«
»Ich glaube nicht...«, setzte Marianne an, aber die Frau sah ihr in die Augen und versuchte ein Lächeln.
»Natürlich müssen Sie Kette und Ring gut verstecken«, fuhr sie fort, »vor allem den Ring. Oder nein: Sie verstecken ihn gar nicht besonders, und wenn jemand danach fragt, sagen Sie... einen Augenblick! Haben Sie einen Großvater oder Urgroßvater gehabt, der Landwirt war? Entschuldigen Sie, wenn ich so frage...«
»Nichts zu entschuldigen«, meinte Marianne, »mein Großvater mütterlicherseits war Bauer, ich hab ihn sehr gemocht. Aber was hat das...?«
»Er lebt nicht mehr?«
»Nein«, sagte Marianne. »Er ist schon zehn Jahre tot.«
»Dann sagen Sie...«, fuhr die Frau fort, und ihre Stimme klang plötzlich, als wäre sie ein Schulmädchen, das mit einer Freundin einen Streich ausheckt, »dann sagen Sie einfach, der Ring sei ganz früher einmal von einem Viehhändler als Pfand zurückgelassen worden, und ihr Großvater habe ihn Ihnen vererbt... Da ist keinerlei Gefahr für Sie, überhaupt nicht, und wenn sich die Zeiten geändert haben und der Krieg vorbei ist, schicken Sie den Schmuck nach London, an meine Tochter...« Sie holte einen Zettel und zwei Zehn-Reichsmark-Scheine aus ihrer Tasche. »Hier finden Sie den Namen und die Adresse, sie ist leicht zu merken, den Zettel sollten Sie dann wohl besser vernichten. Und das Geld – bitte nehmen Sie es für das Porto, Sie sollten es ja dann doch als Einschreiben schicken …«
Eine halbe Stunde später war Marianne wieder zu Hause. Otto saß vor dem Volksempfänger, Marianne ging in die Küche und verstaute die Kette samt dem Ring und die zwanzig Reichsmark dazu in der Dose mit den unbenutzten Gardinenringen. Einen Augenblick überlegte sie, ob sie den Zettel mit der Adresse dieser Alexandra Kahn in South Kensington in eines der Bücher legen sollte, die Otto mit Sicherheit niemals aufschlagen würde. Aber was heißt das schon: mit Sicherheit nicht? Im Wohnzimmer wurde das Radio lauter gestellt, eine Sondermeldung kam, südlich von Kursk hatten deutsche Kampftruppen die russischen Linien durchbrochen und stießen auf Woronesch vor, in einer plötzlichen Anwandlung zerriss Marianne den Zettel und zündete die Papierfetzen in der Spüle an, immer nach nebenan horchend. Aber der Sprecher im Radio sagte, auch Sewastopol stehe vor dem Fall, und so würde
Mittwoch, 13. Februar 2008
Gewiss habe ich Fragen«, sagte Rechtsanwalt Eisholm, erhob sich langsam und löste dabei aus dem Aktenordner, der aufgeschlagen vor ihm lag, eine Klarsichthülle. Er blickte auf, hinüber zu dem Mann auf dem Zeugenstuhl, und über ihn hinweg zu den Zuhörern in den ansteigenden Bankreihen, die Kopf an Kopf im trüben Lampenlicht des späten Winternachmittags ausharrten. »Aber gewiss doch!«
Er trat zu dem erhöhten, mit einer Blende versehenen Tisch, hinter dem die drei Berufsrichter und die beiden Geschworenen saßen, und zeigte eher beiläufig, wie einen längst bekannten Gegenstand, die Fotografie vor, die in die Hülle eingelegt war. Es war ein Schnappschuss und zeigte eine junge Frau, die einen Blick in den Spiegel ihrer Puderdose warf. Sie hatte auffällig kurzes blondes Haar und trug ein schwarzes, tief ausgeschnittenes Kleid, dazu um den Hals eine Goldkette mit einem Ring als Anhänger. Offenbar war die Aufnahme in der Pause einer Tanzveranstaltung entstanden, und die junge Frau schien nicht bemerkt zu haben, dass sie fotografiert wurde.
Der Vorsitzende Richter nickte, Eisholm ging weiter zum Tisch links der Richterbank. Aber weder Staatsanwalt Desarts noch Kugelmann, der Anwalt des Nebenklägers, ließen einen Einwand erkennen. Schließlich wandte sich Eisholm dem Zeugen zu.
»Diese Fotografie hier, die den Akten beigefügt ist – Herr Zeuge, können Sie uns sagen, wen diese Aufnahme zeigt?«
Markus Kuttler, Kriminalkommissar im Dezernat I der Ulmer Polizeidirektion, stand auf, warf erst einen Blick auf Eisholm und dann auf die Fotografie, die dieser ihm hinhielt. Der Strafverteidiger hatte seinen mächtigen grauen Lockenkopf mit der Vogelnase und den hellen Augen schräg gelegt, als sei er Gott weiß welchem Engerling auf der Spur.
»Das ist eine Aufnahme von Fiona Morny.«
»Von der Toten also. Und wo haben Sie diese Fotografie gefunden?«
»Auf dem Schreibtisch von Hauptmann Morny«, antwortete Kuttler und reichte die Fotografie zurück. »Sie lag da unter Schriftstücken und anderer Post.«
»Sie sagen: unter anderer Post... Das klingt, als sei die Fotografie mit der Post gekommen?«
»Das Foto ist im Kongresszentrum entstanden«, erklärte Kuttler. »An Silvester 2006... Bei einem Ball im Kongresszentrum, zu dem das Zweite Korps geladen hatte. Der Fotograf, der es gemacht hat, ist mit Herrn Morny befreundet oder bekannt und hat ihm einen Abzug geschickt.«
Kuttler warf einen fragenden oder vielmehr: Einverständnis heischenden Blick zu dem Mann auf der Anklagebank. Ekkehard Morny nickte kaum merklich, ein wenig so, als sei ihm alles Fragen gleichgültig.
»Schön.« Auch Eisholm nickte. »Aber warum haben Sie gerade dieser Fotografie Aufmerksamkeit geschenkt? So sehr, dass sie die Ehre bekam, den Akten hinzugefügt zu werden?«
»Wegen der Goldkette. Offenbar ist sie ein Erbstück, und Frau Morny hat die Kette auch nach Silvester gelegentlich getragen, wie ihr Mann uns gesagt hat. Aber er konnte uns nicht erklären, wo sie abgeblieben ist.«
»Ah ja«, meinte Eisholm, wandte sich halb ab und dann, unerwartet, mit einer plötzlichen Kehre, wieder zu Kuttler zurück. »Verstehe ich Sie richtig – diese Kette oder vielmehr: der Raub dieser Kette ist Ihnen als mögliches Tatmotiv erschienen?«
»Wir haben das nicht ausgeschlossen.«
»Ach? Und wann haben Sie begonnen, dieses Motiv nicht mehr gelten zu lassen?« Eisholms Stimme senkte sich. »Oder ist Ihnen von vorgesetzter Stelle nahegelegt worden, dem nicht länger nachzugehen?«
»Bitte, Herr Verteidiger«, kam es von der Richterbank. Der Vorsitzende Richter Michael Veesendonk hatte eine angenehme, freundliche Stimme, die ohne Mühe durch den ganzen Saal trug. »Stellen Sie konkrete Fragen. Wenn Sie glauben, dass irgendjemand Einfluss auf die Ermittlungen genommen hätte, dann nennen Sie Ross und Reiter. Alles andere führt in die Irre.«
Eisholm, die linke Hand leicht erhoben, als müsse er der Stimme des Richters nachlauschen, nickte.
»Wenn ich dazu etwas sagen darf...«, meldete sich Kuttler zu Wort. »Wir haben mit großem Nachdruck versucht, den Verbleib der Kette zu klären. Es ist mit allen in Betracht kommenden Aufkäufern gesprochen worden. Mit wirklich allen. Mit Goldschmieden, Antiquitätenhändlern, mit den uns bekannten Hehlern.« Kuttler hob die Hände, die Handteller nach oben gekehrt. »Alles Fehlanzeige.«
»Alles Fehlanzeige«, echote Eisholm. »Kann man nichts machen. Aber ich darf doch festhalten« – Eisholm blickte nach links, wo die Protokollführerin des Gerichtes saß -, »dass hier eine Frage, die in engem Zusammenhang mit dem Verbrechen steht, unbeantwortet geblieben ist. Ganz einfach unbeantwortet.« Er wandte sich wieder an Kuttler. »Gibt es vielleicht noch andere Fragen, die Sie nicht beantworten können?«
»Herr Verteidiger!« Wieder hatte sich Veesendonk eingeschaltet. »Es gibt viele Fragen, die der Mensch nicht beantworten kann, und also auch der Herr Kuttler hier im Zeugenstand nicht. Wir Menschen wissen nicht einmal, warum das Universum besteht. Im Übrigen gibt sich dieser Zeuge alle Mühe, Ihre Fragen umfassend zu beantworten. Respektieren Sie das bitte.«
Eisholm verbeugte sich wortlos, aber eine Spur zu tief. Für einen Augenblick herrschte Schweigen.
»Es ist richtig, dass einige Fragen offen geblieben sind«, sagte Kuttler in die Stille hinein. »Wir wissen nicht, wo Frau Morny den Nachmittag und den Abend vor ihrem Tod verbracht hat. Wir wissen nur, dass sie am frühen Nachmittag eine Gruppe indischer Geistlicher durch die Klosteranlage Wiblingen geführt hat, dass sie ferner gegen sechzehn Uhr in Neu-Ulm ihren Wagen aufgetankt hat und dass sie kurz vor Mitternacht nach Hause zurückgekehrt ist. Der Bordcomputer weist aus, dass mit dem Fahrzeug nach dem Tanken ungefähr einhundertvierundachtzig Kilometer zurückgelegt worden sind.«
»Sie treten sehr bescheiden auf, finden Sie nicht?« Eisholm war dicht an Kuttler herangetreten.
»Ich verstehe Sie nicht.«
»Oder täusche ich mich? Sollten Sie ganz im Gegenteil nicht noch sehr viel mehr Bescheidenheit an den Tag legen, was das Ausmaß Ihres Unwissens betrifft?«
»Herr Verteidiger!«, ertönte es vom Richtertisch. Der Vorsitzende Richter Michael Veesendonk hatte sich vorgebeugt, und seine Augen waren plötzlich sehr schmal geworden. »Im Umgang mit Zeugen duldet dieses Gericht weder Sarkasmus noch Hohn.«
Wieder verbeugte sich Eisholm. »Ich bitte um Entschuldigung.« Er wandte sich an den Vorsitzenden Richter. »Dieses Gericht wird mir aber wenigstens den Vorhalt zugestehen, dass dieser Zeuge nicht nur nicht weiß, wo Frau Morny ihre letzten Stunden verbracht hat, sondern dass er – und das ist noch sehr viel gravierender – vor allem nicht weiß, mit wem sie das getan hat...«
»Aber das ist doch schamlos!«, unterbrach ihn Rechtsanwalt Kugelmann, dessen Gesicht sich gerötet hatte. »Was wir hier aufzuklären haben, das ist das Geschehen im Haus des Ehepaars Morny... Was bitte ist passiert, nachdem Fiona Morny nach Hause gekommen ist? Und was im Obduktionsbericht steht, das ist doch allen Prozessbeteiligten zur Genüge bekannt, das muss man doch nicht breittreten...«
Eisholm hatte sich von Kuttler abgewandt und trat einen Schritt auf Kugelmann zu, den Kopf mit der vorspringenden Nase angriffslustig vorgereckt. »Doch, Herr Kollege, über diesen Obduktionsbericht werden wir noch sehr ausführlich zu sprechen haben, sehr, sehr ausführlich...«
Über den Nachmittag breitete sich Zwielicht aus und drückte auf die Augenlider. Mit gleichmäßiger Geschwindigkeit glitten struppige graugrüne Fichtenwälder an dem ICE vorbei, bemoostes Felsgestein, dann wieder Dörfer und Kleinstädte, die so schnell vorbeihuschten, als schämten sie sich ihrer Eternit-Fassaden und ihrer Dachantennen.
Der Mann, der jetzt die Leselampe über seinem Sitz einschaltete, hatte kurz geschnittenes graues Haar und einen Ausdruck in seinem Gesicht, als sei ihm neben vielen anderen Dingen auch völlig gleichgültig, ob er für die schwarzen Jeans, die er in Kombination mit einem Tweedsakko trug, nicht eigentlich zu alt sei. In Nürnberg hatte er sich eine Ausgabe des »Tagblatts« besorgt, nun nahm er die Seite, die er aufgeschlagen hatte, wieder auf und las ein zweites oder drittes Mal, was ihm schon beim ersten Lesen nicht gefallen hatte.
Mit dem rauchenden Revolver erwischt
Erster Tag im Prozess um Mord mit Handkantenschlag -Angeklagter streitet alles ab
ULM (frz) Bereits am ersten Verhandlungstag im Prozess um den Mord an der Kunsthistorikerin Fiona M. (27) haben sich gestern heftige Kontroversen zwischen der Verteidigung und der Staatsanwaltschaft angekündigt. Knut Eisholm, der Anwalt des angeklagten Ehemannes und Bundeswehr-Hauptmanns Ekkehard M. (32), wirft den Ermittlungsbehörden eklatante Versäumnisse vor.
»Ich war es nicht.« Mit kaum hörbarer Stimme hat Ekkehard M. gestern vor der Schwurgerichtskammer des Ulmer Landgerichts seine Unschuld beteuert. Zuvor hatte der 1.90 Meter große Mann scheinbar gefasst, aber aschfahl im Gesicht die Anklageschrift angehört, die der Erste Staatsanwalt Rüdiger Desarts vortrug. Danach hat der 32jährige Bundeswehroffizier, der zuletzt im Kosovo eingesetzt war, seine Frau aus Eifersucht ermordet: »Bei einem Heimaturlaub musste er entdecken, dass seine Frau ihr eigenes Leben führen wollte. Das ertrug er nicht.« Die Todesursache – vermutlich ein Handkantenschlag gegen den Kehlkopf – ist nach Desarts’ Ansicht ein un übersehbarer Fingerzeig auf den Angeklagten, der als Ausbilder von Nahkampf-Einheiten über ein tödliches Spezialwissen verfüge: »Das Tatgeschehen ist so offenkundig, als hätten wir ihn mit dem rauchenden Revolver erwischt.«
Der Mann im Zugabteil schüttelte den Kopf und legte die Zeitung wieder zur Seite, ohne den Artikel zu Ende gelesen zu haben. Er erinnerte sich an das letzte Mal, als er das »Tagblatt« gelesen hatte. Das war lange her. Damals war ebenfalls von einem rauchenden Revolver die Rede gewesen. Es war unmittelbar vor dem Einmarsch der Amerikaner in den Irak, und der Leitartikler hatte Luftbilder von irgendwelchen Röhren zum unwiderlegbaren Beweis für den Bau irakischer Atombomben erklärt.
Er blickte um sich und holte, als ihm niemand zusah, eine Klarsichtmappe aus seiner Aktentasche, schlug sie auf und blätterte, bis er eine der darin eingehefteten Fotografien fand.
Ein gälischer Name? Hießen Druidinnen so? Egal, Fiona also: ovales Gesicht, schmaler Mund mit fein gezeichneten Lippen, die Nase schmal, gerade, die Linie der Augenbrauen – ach!, dachte der Mann: Wie soll einer Anmut beschreiben? Das bloße Wort ist hübsch, aber auch das bloße hübsche Wort behauptet nur. Und Anmut, könnte man ihr Signalement für den Polizeibericht herrichten, wäre nicht mehr Anmut. Sie entzieht sich, sie gehört niemandem, schon gar nicht dem, den sie berührt.
Die Haare? Ein wenig sehr kurz. Ein Signal an das eigene Geschlecht? So kurz nun auch wieder nicht. Der Gesichtsausdruck? Nun ja, wie eine Frau eben in den Spiegel sieht: prüfend und aufmerksam, nicht so verklemmt, wie Männer das tun. Nur prüfend? Eher wachsam: also auf der Hut? Vor wem? Dem Alter? Den Falten? Dem Morgen danach?
Der Mann zog eine Grimasse. Plötzlich war er sich nicht sicher, was diese Fotografie wirklich zeigte. Wen betrachtete die junge Frau? Sich selbst, das Make-up überprüfend, oder beobachtete sie jemanden im Spiegel, verhohlen? Unversehens entschwand auch die Illusion von Anmut, die ihn so angesprochen hatte. Eine hübsche, eine aparte junge Frau, ja doch. Aber um den Mund war ein Zug, der – wenn man genau hinsah, sehr genau – ein Unbehagen andeutete, vielleicht auch Enttäuschungen oder sogar Bitterkeit...
Wie alt war sie? 27 Jahre? Die Bitterkeit ist ein wenig früh gekommen, dachte der Mann und wollte weiterblättern, aber dann warf er doch noch einen Blick auf die Goldkette und ihren Anhänger, einen breiten Ring, um den sich ein Relief zu ziehen schien. Eine Antiquität? Aber wer hatte solche Ringe gefertigt, und zu welchem Zweck? Irgendwo hatte er gelesen, die Kelten hätten ihren Toten deren Schmuck mit ins Grab gegeben, weil dieser Teil ihrer Identität gewesen sei... Er blätterte um, zu der handschriftlichen Notiz auf der Rückseite der Fotografie: »Kongresszentrum, Silvesterball II. Korps«, dazu die Jahreszahl.
Der Mann, die Mappe in der Hand, lehnte sich zurück und versuchte nachzudenken. Ein Tanz ins neue Jahr also. Aber von diesem neuen Jahr hatte die junge Frau nicht mehr viel gehabt, gerade fünf Monate und elf Tage, um genau zu sein. Denn in der Nacht auf Freitag, den elften Mai, irgendwann kurz vor oder nach Mitternacht, hatte man sie totgeschlagen.
Wo? Ein Zeuge hatte am Donnerstagabend Licht im Haus der Mornys gesehen. Vermutlich also dort.
Und dann? Dann war die Leiche in ein Kleingartengelände gebracht und dort in einer verlassenen, von verwildertem Busch- und Strauchwerk überwucherten Parzelle abgelegt worden, fürsorglich beschattet von Holunder und Haselnuss, Brombeerranken unter den zerkratzten Beinen, das schwarze Cocktailkleidchen hochgeschoben. Dort hätte sie eine Weile liegen bleiben können, den Maienhimmel im blicklosen Auge und Marienkäfer im blonden Haar.
Doch der verwilderte Garten gehörte zu den Jagdgründen einer Gang aufgeweckter Zwölfjähriger, und die riefen am Samstag, dem zwölften Mai, die Polizei.
Wie hatte man die Leiche dorthin gebracht? Mit dem französischen Kleinwagen, der auf Fiona Morny zugelassen war und an dessen Reifen sich Erd- und Lehmanhaftungen in exakt der mineralogischen Zusammensetzung fanden, wie sie in eben jenem Kleingartengelände vorkommt und vermutlich nur dort. Experten hatten das herausgefunden, ein geologischer Fingerabdruck also, Eisholm würde niemanden finden, der das widerlegte.
Was kennzeichnete den Fundort sonst? Der Mann kannte die Stadt gut genug, um sich selbst ein Bild zu machen. Die Gärten lagen gut vier Kilometer vom Haus der Mornys entfernt an einem Hang, auf der anderen Seite des Tals der Blau, unterhalb der Ulmer Wilhelmsburg und damit unterhalb des Militärgeländes, das Kommando und Stab des Zweiten Korps beherbergte. Und über den Weg oberhalb des verwilderten Gartens schnaufte und trabte morgens das zum Frühsport angetretene Militärpersonal, darunter vermutlich auch Hauptmann Ekkehard Morny, Nahkampf-Experte und gewesener Ehemann.
Noch immer hatte der Mann die Mappe mit den Fotografien und den Kopien der Gutachten und Vernehmungsprotokolle in der Hand. Er schlug die Mappe auf und blätterte sie durch, bis er die Fotografie vom Fundort der Leiche fand. Bei Gott, dachte er, das ist zu blöd. Wenn man es sich aussuchen kann, legt man eine Leiche so ab, dass selbst Polizisten an jeden, nur nicht an einen selbst denken. Also?
Eine Stimme mit sächsischem Anklang drang an sein Ohr. »Ihre Fahrgarte, bitte.«
Neben ihm stand eine junge dickliche Frau in einem blauen Kostüm und tat so, als habe sie das Foto der vom Gebüsch beschatteten, von Sträuchern umstandenen jungen Toten nicht gesehen. Der Mann seufzte, legte die Mappe zur Seite und holte sein Ticket aus der Innentasche seines Sakkos.
Eisholm hatte sich wieder auf seinen Platz gesetzt und blätterte in seinem Aktenordner. »Der Herr Vertreter der Nebenklage hat vorhin dankenswerterweise die Obduktionsergebnisse erwähnt, die den Ermittlungen ja offenbar eine entscheidende Wende gegeben haben«, sagte er schließlich in einem fast gleichgültigen Ton. »Eine entscheidende Wende, ja doch.« Er hatte eine Lesebrille aufgesetzt und blickte über deren Ränder hinweg zu Rechtsanwalt Kugelmann und dem kleinen, weißhaarigen Herrn, der neben Kugelmann saß: dem Nebenkläger, dem Vater der toten Fiona Morny. Eisholms Blick war weniger warnend als vielmehr prüfend, wie er seine nächsten Fragen zu dosieren habe. Schließlich wandte er sich wieder an Kuttler. »Den Mann, dem Sie die Sperma-Spuren an und in der Leiche zuordnen – haben Sie den inzwischen ermittelt?«
»Nein.«
»Nein?«
Kuttler warf einen Hilfe suchenden Blick zum Vorsitzenden Richter. »Zum Ergebnis der Obduktion bitte ich doch, den Gerichtsmediziner Dr. Kovacz zu befragen. Ich kann nur wiedergeben, was mir selbst dazu gesagt wurde: dass diese Anhaftungen nicht vom Ehemann stammen.«
»Deuten die Spuren auf eine Vergewaltigung hin?«
»Muss das denn sein!«, rief Kugelmann. »Das steht doch alles im Gutachten...«
»Es tut mir leid, Herr Vertreter der Nebenklage«, schaltete sich der Vorsitzende Richter ein, »aber wir können über diesen Punkt nicht hinweggehen.«
»Ich möchte noch einmal bitten, dazu Herrn Dr. Kovacz zu befragen«, sagte Kuttler. »Ich kann nur das sagen, was wir von ihm gehört haben. Und das habe ich so verstanden, dass Hinweise auf eine Vergewaltigung nicht gefunden worden seien.«
»Na schön«, meinte Eisholm. »Wir haben hier also eine tote Frau, von der wir wissen, dass sie vor ihrem Tod Geschlechtsverkehr hatte, aber nicht mit ihrem Ehemann. Und jetzt sehen Sie mich bitte nicht so an, als wollten Sie sagen: Na und?«
Kuttler wollte protestieren, aber Eisholm hob gebieterisch die Hand. »Sie sind noch ein junger Mann, Herr Zeuge. Vielleicht glauben Sie, ein Geschlechtsakt sei etwas von der Art, als trinke man ein Glas Wasser oder gehe vor die Tür und rauche eine Zigarette. Das aber wäre ein Irrtum.« Er unterbrach seine Wanderung, die ihn seit geraumer Zeit vor der Richterbank auf und ab führte, und blieb wieder vor Kuttler stehen. »Der Geschlechtsakt, Herr Zeuge, ist das einzige wirklich existenzielle Tun im menschlichen Leben, und eben deshalb ist es dem Töten so entsetzlich verwandt, wie es sonst keine zwei Dinge sind, die eigentlich ein Entgegengesetztes bewirken...«
»Herr Verteidiger!« Grollend hatte sich Veesendonks Stimme erhoben, und für einen Augenblick mochte man meinen, seine Haare hätten sich gesträubt, so dass man die Form des lang gestreckten schmalen Schädels sah. Aber das lag nur daran, dass das Licht der Deckenlampen durch das ein wenig schütter gewordene Haar des Vorsitzenden Richters fiel. »Wäre es Ihnen möglich, konkrete Fragen zu stellen? Für allgemeine Erörterungen ist der heutige Verhandlungstag bereits sehr fortgeschritten.«
»Wie Sie meinen.« Eisholm machte kehrt und setzte sich auf seinen Platz. »Ich habe dem Zeugen und damit auch dem Gericht nur vor Augen führen wollen, dass wir den Tod dieser bedauernswerten jungen Frau nicht aufklären können, wenn wir nicht wissen, mit wem sie in den Stunden zuvor wo zusammen war und welcher Art ihre Beziehung zu diesem Großen Unbekannten gewesen ist...« Er machte eine Pause und warf einen Blick auf die Zuhörer, der Blick blieb an dem mächtigen dicken Mann hängen, der nun schon seit Verhandlungsbeginn in der ersten Reihe saß – in der ersten Reihe sitzen musste, weil er seinen Bauch, den er gerne mit beiden Händen umfasst hielt, in den hinteren Reihen nicht hätte unterbringen können. Eisholm nickte.
»Aber das Hohe Gericht hat mich dazu angehalten«, fuhr er fort, »konkrete Fragen zu stellen. Also, Herr Zeuge: Haben Sie im Hause Morny irgendwelche Spuren entdeckt, deren DNA-Struktur mit dem gefundenen Sperma übereinstimmt?«
»Nein.«
»Der Geschlechtsakt hat also nicht dort stattgefunden?«
»Das schließen wir aus.«
»Ich verstehe Sie richtig, diese junge Frau...« – Eisholm hatte sich zurückgelehnt, die Arme vor der Brust verschränkt – »diese junge Frau fährt also einhundertachtzig Kilometer, um einen Mann zu treffen und mit ihm zu schlafen? Aber dann sagen Sie mir jetzt doch bitte, wie sie ihn gefunden und wie sie sich mit ihm verabredet hat.«
»Das wissen wir nicht«, antwortete Kuttler kleinlaut. »Es gibt zwar ein privates Adressenverzeichnis von Frau Morny, aber die darin enthaltenen Telefonnummern haben fast ausschließlich zu ihrem beruflichen Umfeld gehört – es waren Anschlüsse von Museen, Fremdenverkehrsämtern, Antiquitätenhändlern. Verzeichnet waren auch einige Anschlüsse von Studienkollegen.«
»Fast ausschließlich, sagen Sie. Und der Rest?«
»Frisiersalon. Autowerkstatt. Die Durchwahl zum Dienstanschluss ihres Mannes. Seine private Handy-Nummer. Der Installateur. Die Nummer ihrer Gynäkologin... Wir haben mit all diesen Personen gesprochen. Das Ergebnis war negativ.«
»Negativ?«
»Der Mann, mit dem sich Frau Morny getroffen hat, befand sich nicht darunter. Und niemand konnte uns sagen, um wen es sich gehandelt hat. Wiederholt hat man uns zu verstehen gegeben, Fiona Morny sei sehr verschlossen gewesen.«
»Habe ich Sie richtig verstanden?« Eisholm beugte sich vor, die Augen auf Kuttler gerichtet. »Sie haben herausgefunden, dass das Sperma nicht von der Gynäkologin herrührt? Sehr beruhigend. Besaß Frau Morny ein Mobiltelefon?«
»Ja. Auch hier haben wir die Anrufe zurückverfolgt.« Eine leichte Röte hatte sich über Kuttlers Gesicht gezogen. »Es war der gleiche Personenkreis, mit dem Frau Morny auch über das Festnetz telefoniert hat.«
»Haben Sie das gehört, Hohes Gericht?«, fragte Eisholm, an Veesendonk gewandt. »Warum sitzen wir hier eigentlich? Und warum, Herr Vorsitzender, ist dieses Fragment einer Anklage überhaupt zu einer Hauptverhandlung zugelassen worden?« Plötzlich lächelte er. »Oder sollte das Gericht der bestimmten Ansicht sein, bei dieser jungen Frau sei es nicht weiter darauf angekommen, wann sie mit wem zusammen war? Dann ist es …«
Er kam nicht weiter, denn Kugelmann war hochgefahren, mit hochrotem Kopf und wehenden Talarärmeln. »Hohes Gericht! Diese Unterstellungen sind infam...«
»Sie sind auch überflüssig«, ergänzte Staatsanwalt Desarts. »Hier interessiert doch einzig, was geschehen ist, nachdem die Ehefrau Morny nach Hause gekommen ist...«
»Geschätzter Kollege«, sagte Eisholm und fixierte Kugelmann, »warum unterstützen Sie eigentlich nicht meine Forderung, den wirklichen Ablauf aufzuklären? Das wäre doch der beste Weg, allen Unterstellungen das Wasser abzugraben, auch und gerade den infamen.«
»Sie!«, brachte Kugelmann heraus und wies zornig mit dem Zeigefinger auf Eisholm. »Sie...«
»Einen Augenblick.« Veesendonk war zum ersten Mal laut geworden. »Ich unterbreche jetzt die Sitzung. Der Wortwechsel gerade eben hat gezeigt, dass die Nerven der Verfahrensbeteiligten nicht mehr die besten sind. Das beeinträchtigt auch die Aufnahmefähigkeit.« Er beugte sich vor und fasste Kuttler ins Auge. »Können Sie morgen Vormittag noch einmal kommen?« Kuttler nickte.
»Na schön«, sagte Veesendonk. »Die Verhandlung wird morgen, neun Uhr, mit der weiteren Vernehmung des Zeugen Kuttler fortgesetzt.«
Nachtschwarze Wälder. Dahinter, nur zu ahnen, die Donauauen. Fern im Norden eine Hügelkette, von Lichtern gesäumt. Im Großraumabteil die Passagiere, vom Licht der Leselampen gegen die Dunkelheit abgeschirmt, lesend? Nein: Die meisten waren über ihre Laptops gebeugt, arbeitend oder elektronische Patiencen legend. Das Fahrgeräusch: einschläfernd, ein gleichmäßiges Brausen.
Der grauhaarige Mann hatte den Klarsichtordner wieder in seiner Reisetasche verstaut und starrte in die Dunkelheit hinaus. Vor einem Dreivierteljahr war auch Hauptmann Ekkehard Morny durch die Nacht gefahren, zurück nach Hause, wo er seinen überraschend bewilligten Heimaturlaub nicht angekündigt hatte – warum eigentlich nicht?
Er wird seine Gründe gehabt haben, dachte der Mann.
Und dann? Es war nicht der gleiche Zug gewesen, sondern einer der letzten Züge an diesem Tag. Irgendwann nach 23 Uhr war der Hauptmann angekommen und ausgestiegen und hatte nicht zuhause angerufen und hatte kein Taxi genommen und auch den Bus nicht, sondern war in die grauenvolle, von Neonröhren beleuchtete Bahnhofsrestauration gegangen und hatte ein Pils bestellt und einen Kurzen und dann noch ein Pils und noch einen Kurzen, bis man ihn hinauswarf. Warum tut sich jemand das an?
Weil er seine Gründe hatte, du Narr.
Und weiter? Dann hat ihn ein Taxifahrer nach Hause gefahren, kurz nach Mitternacht, in das schmucke Wohngebiet für die rechtschaffenen, die besser situierten Leute, und Hauptmann Morny schlug stolpernd den Weg durch den Garten ein, zu seinem Haus, zu seinem dunklen, unbeleuchteten Haus, wie der Taxifahrer sich erinnert. Und dann?
Was fragst du? Wenn du es wüsstest, hättest du Eisholms Auftrag nicht anzunehmen brauchen.
Vielleicht haben Herr Hauptmann wirklich einen Black-out gehabt und wissen von nichts und wachen am nächsten Morgen auf, noch in der Bundeswehr-Unterwäsche, allein im Ehebett, mit trockenem Mund und dem erbärmlichen Geschmack von zu viel Bier und zu viel Schnaps, und machen fünfzig Liegestütze und duschen sich und rasieren sich und finden ein Stützbier im Kühlschrank, und gehen hinunter in den Keller und holen das nächste Bier und wundern sich, wieso da der kleine französische Wagen steht, wenn doch das Haus und das Ehebett sonst so leer und verlassen sind, aber solange noch Bier da ist...
Das ist die eine Version. Die Version von Ekkehard Morny, der sich zielstrebig, gleichmäßig und unerschütterlich eine Nacht, einen Tag und noch eine Nacht hindurch betrunken haben will, bis es klingelte und die Polizei dastand und ihn nach seiner Frau fragte und eine Antwort haben wollte, wo sie doch riechen konnte, dass es keine geben würde, jedenfalls keine vernünftige...
Oder, und das ist die Version des Staatsanwalts Desarts: Ekkehard Morny erreicht stolpernd das Wohnzimmer, und da sitzt die Zauberfee mit den kurzen blonden Haaren und dem feinen Gesichtchen, frisch gevögelt, und erblickt ihren Mann und sagt, das ist aber eine nette Überraschung, wie lieb, dass du mir gleich auch einen Rausch mitgebracht hast! Ein Wort gibt das andere, bis der Herr Hauptmann – Sechs Fuß hoch aufgeschossen/Ein Kriegsgott anzuschauen – genug hat und die kleine blonde Zauberfee nicht einfach bloß grün und blau schlägt, sondern sie totmacht, einfach so, mit einem Hieb.
Hat nicht Kant gesagt, das Übel am Kriege sey, dass er mehr böse Menschen hervorbringe, als er wegnehme?
Vorausgesetzt, es ist wirklich Krieg, was Hauptmann Morny im Kosovo besorgt oder betrieben hat.
Und weiter vorausgesetzt, es war auch so abgelaufen, wie Staatsanwalt Desarts das behauptet. Aber selbst dann, dachte der Grauhaarige, hat Desarts nicht alle Tassen im Schrank, dass er wegen Mordes anklagt: Totschlag reicht auch. Nur ist das Eisholms Problem.
Deines ist ein anderes. Zum Beispiel das: Ist Ekkehard Morny tatsächlich so wenig betrunken gewesen, dass er die totgeschlagene Fiona in ihren Wagen packt und sie damit umsichtig aus dem Haus bringt, um dann wiederum so betrunken zu sein, dass er sie fast bis zur Wilhelmsburg fährt und an einer Stelle ablädt, bei der jeder...
Stopp.
Und was ist mit dem Schmuck? Warum lässt er ihr die Kette nicht? Warum muss sie abgemacht oder weggerissen und fortgeworfen werden?
Mittwoch, 13. Februar, Abend
Es war dunkel im Zimmer, nur die Straßenlaterne draußen gab gerade so viel Licht ab, um die beiden Rechtecke des Fensters gegen die nachtschwarze Wand abzuheben. Das Keuchen hatte aufgehört und war in ein tiefes erschöpftes Atmen übergegangen. Wenn es denn ein Keuchen gewesen war. Es gibt kein richtiges Wort dafür, dachte Kuttler, jedenfalls nicht für dieses Geräusch, Stöhnen kann man es nicht nennen: Wir sind doch nicht in einem Porno! Manches Mal war es ein Schreien gewesen, aber Puck hatte es sich abgewöhnt, seit Janina einmal davon aufgewacht war. Also können sie es, wenn sie es wollen, unter Kontrolle halten... Sie? Es?
Ach, was weißt du von den Frauen!
Puck kauerte noch immer über ihm, ihr Gesicht ganz nah bei dem seinen, und er spürte ihre Brustspitzen auf seiner Haut.
»Dieser blöde Anwalt, was hat der zu dir gesagt?«, flüsterte sie. »Dass Bumsen so etwas wie der Tod ist?«
»Bumsen hat er es nicht genannt.«
»Diese wichtigtuerischen alten Männer!«, stellte Puck fest und hob ihre Hüfte an, so dass sein Glied nass und satt aus ihr herausglitt.
»Na ja«, meinte Kuttler, »die Franzosen haben einen Ausdruck dafür: la petite mort...«
»La petite mort«, echote Puck, und sie sprach es so gedehnt aus, dass ihre Stimme ein wenig ins Gurren kam, »glaubst du nicht, dass ich vielleicht auch weiß, was das ist, lange schon?«
»Was stört dich dann?«
»Dass so ein alter Knacker mit dir darüber redet und dir ein solches Zeug vorhält und dabei in Wirklichkeit von dem einen keine Ahnung hat und von dem anderen auch nicht.«
»Egal«, sagte Kuttler. »Für heute hab ich Ruhe vor ihm.«
Puck hatte sich seitlich neben ihn gelegt, so dass ihre Hand sein Glied erreichte und es behutsam einschloss. Plötzlich schien ihre Hand zu erstarren: Das Telefon hatte angeschlagen. Es lag auf dem Nachttischchen und begann auf der Glasplatte zu vibrieren und sich zu drehen.
Warum hab ich das Scheißding nicht ausgeschaltet, dachte er, dann fiel ihm ein, dass er es ziemlich eilig gehabt hatte und Puck auch und dass er es das nächste Mal am besten im Wagen ließ …
»Geh halt in Gottes Namen dran!«, sagte Puck und zog ihre Hand weg. Er nahm das Handy und meldete sich. Eine Weile hörte Kuttler nur zu und sagte nichts, bis zu einem ergebenen: »Ja, ich komm so schnell wie möglich.« Dann legte er das Handy zurück und blieb einen Augenblick so liegen wie zuvor, den Oberkörper auf dem einen Ellbogen aufgestützt.
Beide schwiegen.
Schließlich atmete Puck tief durch. »Du musst also noch mal weg«, sagte sie. »Reicht es noch für eine Tasse Kaffee?«
»Nein«, meinte Kuttler, richtete sich auf und schwang die Beine vom Bett. »Es ist... ach Scheiße!«
»Was hast du sagen wollen?«
Kuttler schaltete die Nachttischlampe ein und stand auf. »Ich wollte sagen, dass es komisch ist. Aber das ist es nie.«
In das gleichmäßige Brausen des Fahrgeräuschs mischte sich der Bordlautsprecher: »Verehrte Fahrgäste«, gab der Zugführer durch, »in wenigen Minuten erreichen wir Ulm Hauptbahnhof.«
Der Mann stand auf, zog seinen schwarzen Mantel an und setzte seinen zerbeulten Hut auf. Auch der Hut war schwarz. Früher als der Mann erwartet hatte, wurde der ICE abgebremst. Bogenlampen schoben sich am Abteilfenster vorbei, Schuppen, Werkstattgebäude, wurden langsamer, blieben stehen. Der Mann bückte sich und sah hinaus. Das ist der Bahnhof von Neu-Ulm, dachte er, so schön ist der nicht, dass ihr hier halten müsst!
»Verehrte Fahrgäste«, über den Lautsprecher meldete sich schon wieder der Zugführer, »wegen einer Störung im Betriebsablauf ist die Einfahrt in den Hauptbahnhof Ulm vorübergehend blockiert. Wir hoffen, die Fahrt in wenigen Minuten fortsetzen zu können.«
Störung im Betriebsablauf? Der Mann runzelte die Stirn. Es geht dich nichts an, sagte er sich dann. Auf der Ausstiegsplattform vor ihm stritt sich ein Mensch, der einen Schlapphut zu einem Lodenmantel trug und einen cholerisch gesträubten Schnauzbart im Gesicht hatte, mit dem Zugschaffner, weil sich die Tür nicht öffnen ließ: Warum er – »Herrgottsakrament noch mal!« – nicht aussteigen könne, wenn dies der Neu-Ulmer Bahnhof sei und sie damit so gut oder so schlecht in Ulm angekommen seien wie am Hauptbahnhof? Der Schaffner erklärte ihm geduldig, dass in Neu-Ulm kein fahrplanmäßiger Halt vorgesehen sei, außerdem habe der Fahrgast ja ein Ticket bis nach Ulm gelöst und demnach Anspruch, auch dorthin gebracht zu werden, worauf der Mensch im Lodenmantel wissen wollte, wieso – wenn es hier keinen fahrplanmäßigen Halt gebe – dieser depperte Zug dann stehen geblieben sei und ob der Schaffner vielleicht glaube, die Bahn habe nicht ohnehin mehr als genug Verspätungen und selbst bei ihren eselsgeduldigsten Kunden längst allen Kredit verspielt und verwirtschaftet? Er wartete dann aber keine Antwort ab, sondern leitete über zu einigen ausführlicheren Mutmaßungen, welche die Intelligenz des Schaffners betrafen sowie die unternehmerische Kompetenz der Verantwortlichen der Bahn AG insgesamt und deren Rechtschaffenheit...
»Könnten Sie nicht Ihren Zugführer anrufen«, schaltete sich der Mann in dem schwarzen Mantel ein, an den Schaffner gewandt, »und bitten...«
Eine neuerliche Lautsprecherdurchsage unterbrach ihn: Die Weiterfahrt verzögere sich leider, aber die Fahrgäste mit Fahrziel Ulm könnten hier in Neu-Ulm aussteigen und ihr Fahrziel mit dem öffentlichen Personennahverkehr erreichen, die Fahrkarten seien für dessen Benutzung gültig.
Die Tür öffnete sich. »Na also!«, sagte der Mensch im Lodenmantel, stieg aus, eine schwere Aktentasche schwingend, der Mann im schwarzen Mantel folgte bedächtig, den Träger seiner Reisetasche über der Schulter.
Der Tag war von den Morgenstunden bis lange in den Nachmittag hinein spätwinterlich kalt, aber klar gewesen. Jetzt hing Nebel zwischen den Bahnsteigen und ihren Lampen, und die zugefrorenen Pfützen knirschten unter den Tritten. Der Mann ging rasch am Bahnhofsgebäude vorbei, aber das letzte freie Taxi war schon von dem Lodenmantelträger in Beschlag genommen worden. So musste er auf einen Bus warten. Er war nicht allein, auch andere Passagiere, die mit ihm ausgestiegen waren, vertraten sich fröstelnd die Füße an der Haltestelle.
Das hast du nun von deiner Eile, dachte er, der Zug wäre wenigstens geheizt gewesen. Und überhaupt – was hast du es so eilig? In diese Stadt da drüben zieht es dich nicht zurück. Und der Auftrag, den du übernommen hast – schweigen wir lieber davon! Nun ja, wer sich seine Aufträge aussuchen will, hat bald keine...
Von der Kneipe an der anderen Seite des Bahnhofsvorplatzes näherte sich ein Halbwüchsiger und schnippte seine halb gerauchte Zigarette nach einer lahmenden Taube. Dann verschwand er wieder, gleich darauf kam der Bus. Der Mann stieg als Letzter ein und setzte sich nach hinten, auf einen der erhöhten Plätze.
Der abendliche Berufsverkehr hatte sich längst aufgelöst, und auf den Gehsteigen waren nur noch einzelne Passanten unterwegs. Der Bus erreichte die Brücke, die über die Donau führt; der Mann reckte den Hals, aber den Fluss sah er nur als ein breites schwarzes Band, halb verdeckt von den Nebelschwaden, die ihm entstiegen. Rechts schien der gläserne Hotelturm des Hotels »Vier Jahreszeiten« über dem Nebel zu schweben, der Stadt enthoben: Eisholm würde dort abgestiegen sein.
Der Bus kam zu einem Platz, der eigentlich nichts weiter war als eine Haltestelle von Straßenbahn und der sich hier kreuzenden Buslinien. Der Mann blieb bis zur nächsten Station sitzen, dann stieg er aus. Er wartete, bis der Bus weitergefahren war, und blieb noch immer stehen. Vor ihm lag das Justizgebäude, ein Imponierpalast aus wilhelminischen Zeiten, und doch fühlte der Mann eine seltsame Vertrautheit. Er hätte jeden Einzelnen der Verhandlungssäle beschreiben können, und jeder hatte in seiner Erinnerung seine ihm eigentümliche Atmosphäre, sogar seinen eigenen Geruch (der notorische Mief von Saal 113, sobald dort auch nur länger als eine Stunde nicht gelüftet wurde!), und jeder Saal war voll der Geschichten vom Scheitern, vom Misslingen und vom alltäglichen Unglück. Und manchmal auch davon, wie das Böse in ein Leben einbricht und es zerstört. Das Böse? Merkwürdig, dachte der Mann. Die Menschen wissen im Grunde noch immer nichts darüber, und doch ist es Teil ihrer Natur.
Er lüftete seinen Hut und fuhr sich über die Stirn. Dann überquerte er die Straße, ging rechts am Justizgebäude vorbei und weiter die Gasse hinauf, die zu seinem Hotel führte. In Tonios Café brannte noch Licht, aus den Augenwinkeln sah er die Silhouette eines Mannes, der so dick war, dass er den Barhocker ein gutes Stück vom Tresen hatte wegrücken müssen. Für einen Augenblick überkam ihn die Empfindung, dieser Mann sei schon immer dort gesessen und würde dort bleiben bis ans Ende aller Tage.
Er aber wollte erst einmal sein Zimmer sehen und sein weniges Gepäck unterbringen, vielleicht auch duschen. Das Hotel lag links von der Gasse, es war ein altes Haus und konsequent altmodisch zugleich, man hätte es als Gegenbeispiel zum »Vier Jahreszeiten« nehmen können. Die junge Frau, die auf sein Klingeln hin an der Rezeption erschien, kannte er freilich nicht. Sie war eine Osteuropäerin, und aus irgendeinem Grund schien sie Misstrauen gegen ihn zu hegen oder gegen Hotelgäste im Allgemeinen.
»Für mich sollte ein Zimmer reserviert sein«, sagte der Mann und legte Hut und Handschuhe ab. »Berndorf ist mein Name, Hans Berndorf.«
Im Nebel«, wiederholte der Lokführer, der auf der anderen Seite des Schreibtisches saß, nach vorne gebeugt, die Hände im Schoß gefaltet, »im Nebel fährst du wie durch einen Tunnel, und die Tunnelwand ist ganz nah. Und trotzdem...« Noch immer hatte er diese flache Stimme, die so klang, als schwinge in ihr nichts mehr mit, keine Erregung, keine Emotion.
»Und trotzdem?«, wiederholte Kuttler fragend.
»Trotzdem hab ich die ganze Zeit gewusst, dass es passiert. Der Bahnsteig war leer, ein elendig langer leerer Bahnsteig und nichts und niemand sonst, nur dieser Tunnel im Nebel, und insgeheim hab ich gewusst, dass am Ende dieser Mann steht, glauben Sie mir das? Und da kam er auch schon aus dem Dunkel, es hat mich nicht einmal gewundert, auch nicht, dass er irgendwie krumm aussah, den Oberkörper nach hinten gebogen, aber wie ich ihn richtig gesehen hab, da ist er auch schon über die Bahnsteigkante geflogen, mit dem Gesicht nach vorne und so, dass es ihm den Hut vom Kopf riss, und gleich darauf war er im toten Winkel und die Lok über ihm.«
Kuttler sah zu Hauptkommissar Dorpat, als suche er sein Einverständnis. Aber Dorpat – seit einem knappen halben Jahr Leiter des Dezernates I der Ulmer Polizeidirektion – reagierte nicht. Noch immer lehnte er an der Fensterbank, als habe er sich den Hintern verkühlt und müsse ihn nun am Heizkörper aufwärmen.
»Sie werden ja den Fahrtenschreiber auswerten und sehen, wann ich die Vollbremsung eingeleitet habe«, fuhr der Mann fort. »Ich glaube nicht, dass ich Zeit verloren hab, ganz bestimmt nicht. Aber das dauert, bis die Bremsen greifen, das müssen Sie mir glauben: das dauert und dauert! Und der Mann ist vor die Lok gefallen, und ich hab ihn nicht mehr gesehen, und irgendjemand hat geschrien, ich glaube, das war ich...«
»Moment«, sagte Dorpat, »Sie sagen, der Mann stand irgendwie krumm, und dann ist er über die Bahnsteigkante geflogen. Kein Mensch fliegt von selbst. Auch nicht über eine Kante. Er springt. Er wirft sich. Vielleicht wird er auch gestoßen. Wie war’s denn nun?«