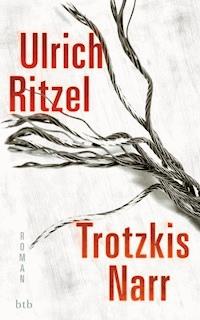8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb
- Kategorie: Krimi
- Serie: Berndorf ermittelt
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
Januar 1998: In einem verschneiten Steinbruch bei Ulm wird die Leiche eines Arbeitslosen gefunden. Was hat den Mann aus Görlitz hierher geführt und wer hat ihn mit Psychopharmaka voll gepumpt? Doch das ist nicht das einzige Problem, mit dem Kommissar Berndorf und seine Kollegin Tamar Wegenast sich herumschlagen müssen. Zugleich werden sie vom spektakulären Ausbruch eines „Lebenslänglichen“ in Atem gehalten: Der Rasiermesser-Mörder nimmt blutige Rache an den Juristen, die ihn vor Jahren verurteilt haben. In einer atemberaubenden Handlung zwischen der Schwäbischen Alb, Görlitz und Tel Aviv wird eine Spur sichtbar, die zurückführt in die düsteren Kapitel medizinischer Forschung in der NS-Zeit. Als Berndorf dabei den Schonraum eines schwäbischen Klüngels aus Polit- und Wirtschaftsprominenz verletzt, wird er von einer Stuttgarter Sonderkommission suspendiert.
Doch Berndorf, zwischen Montaigne-Lektüre, nächtlichen Ferngesprächen mit seiner Liebsten und maßvollem Whiskygenuss unbeirrbar an jener Aufklärung interessiert, die in der Nachkriegszeit verhindert wurde, lässt sich nicht einschüchtern und ermittelt heimlich weiter. Mit von der Partie ist dabei seine Assistentin Tamar, die ihrem (kritisch verehrten) Chef gegen den Druck des Apparats unerschrocken beisteht, obwohl sie mit der Tochter des Mörders in eine Serie verwirrender Begegnungen gerät.
Souverän führt Ulrich Ritzel in seinem hoch gelobten Krimidebüt drei Handlungsfäden zu einem engen Geflecht von Krimi, Thriller und Gegenwartsstudie zusammen – in dem auch die Liebe nicht zu kurz kommt – und lässt den Leser bis zum fulminanten Showdown am Fuße des Ulmer Münsters nur selten Zeit zum Atemholen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 419
Ähnliche
btb
Buch
Januar 1998: In einem verschneiten Steinbruch bei Ulm wird die Leiche eines Arbeitslosen gefunden. Was hat den Mann aus Görlitz hierher geführt und wer hat ihn mit Psychopharmaka voll gepumpt? Doch das ist nicht das einzige Problem, mit dem Kommissar Berndorf und seine Kollegin Tamar Wegenast sich herumschlagen müssen. Zugleich werden sie vom spektakulären Ausbruch eines »Lebenslänglichen« in Atem gehalten: Der Rasiermesser-Mörder nimmt blutige Rache an den Juristen, die ihn vor Jahren verurteilt haben. In einer atemberaubenden Handlung zwischen der Schwäbischen Alb, Görlitz und Tel Aviv wird eine Spur sichtbar, die zurückführt in die düsteren Kapitel medizinischer Forschung in der NS-Zeit. Als Berndorf dabei den Schonraum eines schwäbischen Klüngels aus Polit- und Wirtschaftsprominenz verletzt, wird er von einer Stuttgarter Sonderkommission suspendiert. Doch Berndorf lässt sich nicht einschüchtern und ermittelt weiter . . .
Souverän führt Ulrich Ritzel in seinem hochgelobten Krimidebüt drei Handlungsfäden zu einem engen Geflecht von Krimi, Thriller und Gegenwartsstudie zusammen – in dem auch die Liebe nicht zu kurz kommt – und lässt dem Leser bis zum fulminanten Showdown am Fuße des Ulmer Münsters nur selten Zeit zum Atemholen. »Ein toller Erstling: Plot, Personen und Atmosphäre – mit Witz und Wärme, hervorragend ausgeführt. Ich habe lange nicht mehr so lange an einem Stück gelesen, und zwar mit Genuss.« Gisbert Haefs
Autor
Ulrich Ritzel, Jahrgang 1940, geboren in Pforzheim, verbrachte Kindheit und Jugend auf der Schwäbischen Alb und lebt heute in Ulm. Er studierte Jura in Tübingen, Berlin und Heidelberg, schrieb danach für verschiedene Zeitungen und wurde 1981 mit dem begehrten Wächter-Preis ausgezeichnet. Sein Erstling, »Der Schatten des Schwans«, wurde zum Überraschungserfolg.Für »Schwemmholz«, seinen zweiten Berndorf-Krimi (bei btb in Vorbereitung), bekam der Autor Anfang 2001 den deutschen Krimipreis verliehen.
Inhaltsverzeichnis
27. April 1945
Die beiden Jagdmaschinen zogen steil vor der Hügelkette an der anderen Talseite hoch und tauchten über der Kuppe ab. Das Jaulen der Motoren erstarb, Stille breitete sich aus. Die Welt war taub geworden. Sogar die Vögel waren verstummt, als warteten sie auf den nächsten Angriff.
Es war später Vormittag, doch die Sonne stand noch tief und warf lange und kühle Schatten. Im Tal blieb es ruhig, und langsam kehrten die Geräusche des Waldes und des Talbachs zurück. Am Ufer hätte man die ersten Schlüsselblumen finden können.
Ein Mann löste sich aus dem Schutz einer Tannendichtung und trat vorsichtig auf die Waldstraße heraus. Er war hoch gewachsen und hatte ein schmales, scharf geschnittenes Gesicht mit den ungerührten blauen Augen friesischer Vorfahren.
Der Opel stand wenige Meter weiter, halb verdeckt unter den herabhängenden Zweigen einer Linde. Das Laub war frisch und jung, wie eine Fontäne von zartem Grün. Es würde ein schönes Frühjahr werden. Wenn du nicht aufpasst, dachte Hendriksen, wirst du nicht viel davon haben! Nachdenklich starrte er auf den Wagen, wie zufällig folgten seine Augen der Reihe von Löchern, die in gleichmäßigen Abständen in das Blech der Motorhaube und in die Windschutzscheibe gestanzt waren. Dann wunderte er sich, wie lange er gebraucht hatte, um zu begreifen, was sie bedeuteten.
Langsam ging er zur halb geöffneten Fahrertür. Koslowski hing über dem Steuerrad. Hendriksen hob ihm den Kopf an, dann sah er die feuchten Flecken, die sich auf der Uniformjacke des Fahrers ausbreiteten. Automatisch griff er nach dem Handgelenk des Mannes und fühlte nach dem Puls: nichts.
Aus dem Wagen tropfte Flüssigkeit. Kraftstoff? Kühlwasser? Gleichgültig, dachte Hendriksen. Den Wagen musste er aufgeben. Einen anderen würde er nicht mehr bekommen, nirgendwo. Morgen sollte er am Grenzübergang in Stein am Rhein sein. Wie viel Kilometer waren es bis dahin? Fünfzig? Oder sechzig?
Leclerc sei bei Villingen durchgebrochen, hatte ihm gestern Abend in dem überfüllten Wirtshaus ein Stabsoffizier gesagt, ein Major. Es war in einem kleinen Dorf hinter Saulgau, die Stromversorgung war unterbrochen, die Wirtin hatte ihnen eine Kerze und einen Krug mit saurem Most an den Tisch gebracht; sie war eine noch junge Frau, schwarz gekleidet, ihr Gesicht von Kummer gezeichnet. Aber ihre Augen waren überall, forschend und hungrig. Am Tisch neben Hendriksen wurde französisch gesprochen, die Männer trugen Anzüge mit spitz auslaufenden Revers und waren über eine Straßenkarte gebeugt. Es waren Versprengte des Sigmaringer Vichy-Hofstaates, der sich nun auf den Landstraßen Oberschwabens aufzulösen begann. Drei Frauen saßen dabei, mit breitkrempigen Hüten und in Mäntel gehüllt, die längst fadenscheinig waren und doch immer noch nach Paris 1942 aussahen. Eine der Frauen warf ihm einen prüfenden Blick zu und wandte die Augen sofort wieder ab. Sie hat begriffen, dachte er: Gute Gesellschaft für jemanden, der die nächsten Monate überleben will, sieht anders aus.
Im großen Nebensaal drängten sich Flüchtlingsfrauen mit ihren Kindern, die so erschöpft waren, dass sie trotz ihres Hungers eines nach dem anderen eingeschlafen waren. Und überall, in der Atemluft und in den Kleidern, hing der Geruch nach Schweiß und Elend.
Hendriksen fragte sich, ob die Menschen um ihn herum Angst empfanden. Oder ob sie einfach zu müde waren, um an die nächsten Tage zu denken. An Leclercs marokkanische Soldaten und das, was sie mit den Frauen und Kindern tun würden. Später am Abend hatte eine Kolonne ausgemergelter Männer mit halb toten Pferden vor dem Gasthof Halt gemacht. Zwei ihrer Offiziere, hagere Männer mit dem Andreaskreuz auf der Uniform, fragten in gebrochenem Deutsch nach dem Weg, offenbar wollten sie nach Ravensburg. Der Major gab Auskunft, dann kehrte er mit einer entschuldigenden Geste an den Tisch zurück. »Die Reste von Wlassows Leuten«, sagte er achselzuckend. Man werde sie entwaffnen müssen, sie seien nicht mehr zuverlässig. »Falls wir noch jemand haben, der ihnen die Gewehre abnimmt.«
Der Major verstand nicht, warum Hendriksen nach Südwesten, an den Oberrhein wolle. Leclercs Franzosen würden in drei Tagen am Bodensee und in Konstanz sein, sagte er. Inzwischen werde man versuchen, am Lech und im Allgäu eine neue Verteidigungslinie aufzubauen: »Vielleicht hält die Pastete dann noch zwei oder drei Tage.«
Nun ist es so weit, dachte Hendriksen. Die Wehrmacht läuft davon.
Das war gestern gewesen, und gestern hatte er noch einen Wagen gehabt und einen Fahrer und Treibstoff. Aber jetzt, in diesem verfluchten Waldtal tief irgendwo in Oberschwaben, wusste er: Das Spiel war wirklich aus. Ende. Vorbei. Er würde nicht mehr an den Franzosen vorbeikommen. Der Herr Syndikus Toedtwyler würde vergebens warten. Schade. Schade um die Forschungsergebnisse, die unendlichen Mühen der Versuche, die Zumutungen, die er und seine Mitarbeiter auf sich genommen hatten und von denen sie keinem Außenstehenden jemals würden berichten können. Schade um die Devisen, und gottverdammt schade um den schönen neuen Pass, den ihm Toedtwyler versprochen hatte.
Reiß dich zusammen, wies sich Hendriksen zurecht. Aus dem Gebüsch am Waldrand hinter ihm drang ein halb unterdrückter Schmerzenslaut, fast ein Wimmern. Also hatte es auch den Wehrmachtsleutnant erwischt, der ihm als Eskorte beigegeben war, das unbeschriebene Blatt, blond und blass und malariakrank. Als die Jagdmaschinen zum Sturzflug ansetzten, hatte auch er sich aus dem Wagen fallen lassen wie Hendriksen. Jetzt lag der junge Mensch zusammengekrümmt im Straßengraben. »Kamerad, so helfen Sie mir doch«, bettelte er. Hatte er wieder einen Fieberanfall? Dann sah Hendriksen das Blut. Offenbar hatte der kleine Leutnant einen Schuss in den Oberschenkel abbekommen, vielleicht war der Knochen getroffen. Trotzdem, der Kleine würde überleben. Wenn er nicht am Fieber starb. Jedenfalls hatte niemand einen Grund, ihn vor ein Peloton zu stellen. Oder ihn aufzuknüpfen.
Bei Dr. med. Hendrik Hendriksen sah das, wie er selbst nur zu gut wusste, ein wenig anders aus. Illusionen hatte er sich noch nie gemacht. Was soll’s, dachte er sich dann: »Auch die Nürnberger hängen keinen, sie hätten ihn denn.« Das hatte ein Raubritter gesagt und seinem Ross die Sporen gegeben. Freilich hatte der noch ein richtiges Pferd, nicht bloß einen Haufen kaputten Blechs.
Der Name des Haudegens wollte ihm nicht einfallen. Schall und Rauch. Im Getümmel dieser allgemeinen Auflösung ohnehin. Er wusste nicht einmal mehr den Namen dieses unglücklichen Leutnants. Der eine war so gut wie der andere. Was wäre denn, wenn man den Leuten, die so scharf aufs Erschießen und Aufhängen waren, ihren Toten gleich und ohne weitere Umstände liefern würde, so dass die Herren Sieger sich die Mühe gar nicht erst machen müssten?
Er ging zum Wagen. Der Tod hatte Koslowskis Gesicht gelöscht. Hendriksens Arzttasche stand unter dem Beifahrersitz. Er zog sie hervor und kehrte zu dem Verwundeten zurück. »Gleich ist dir geholfen, Kamerad«, sagte er dann, und zog seine Walther heraus. Der bleiche junge Mann blickte zu ihm hoch, fragend. Auf seiner Stirn unter dem schon zurückweichenden blonden Haar standen Schweißperlen. Dann trat Entsetzen in seinen Blick.
Freitag, 23. Januar 1998
»Was ist das für eine abscheuliche Geschichte!« Angewidert blätterte die Vorsitzende Richterin am Landgericht Isolde Kumpf-Bachmann durch einen der vor ihr liegenden Aktenordner: »Mit einem Rasiermesser . . . mein Großvater hatte so etwas, ich erinnere mich gut, das sah immer sehr gefährlich aus, und regelmäßig hat er sich geschnitten und man musste sofort einen Alaunstein drauftun. Aber heute?«
Ekkehard Lühns, Berichterstatter in der Strafvollstreckungskammer, warf einen leidenden Blick auf die Kakteen am Fenster des Kumpf-Bachmannschen Dienstzimmers: Auch diese blühten niemals, aber wenigstens waren sie nicht sprunghaft. Hinter dem Fenster hing grau und wolkenschwer ein Freitagnachmittag im Januar, am Abend würde es die ersten Schneefälle in diesem Winter geben, hatte es im Radio geheißen, und Lühns wollte übers Wochenende nach Schruns. So oder so würde es knapp werden.
»Rasiermesser werden noch heute benutzt, vor allem – aber nicht nur – von Friseuren, bei sehr starkem Bartwuchs zum Beispiel«, erklärte er dann betont sachlich, denn seine eigenen Kinnbacken wiesen nur eine sehr kümmerliche Behaarung auf. Im Übrigen lägen die fraglichen Vorgänge ja nun 17 Jahre zurück, fügte er in der Hoffnung hinzu, dass die Kammer nun zur Sache kommen könne.
»Das weiß ich auch, dass das 17 Jahre zurückliegt«, gab Isolde Kumpf-Bachmann gereizt zurück, »sonst säßen wir ja nicht hier . . . Immerhin ist das zweifacher Mord, dazu Mordversuch, erst macht er seinen Vorgesetzten betrunken, dann schneidet er ihm . . . ratsch! . . . die Kehle durch, wäscht sich die Hände, fährt nach Hause, gibt seiner Tochter Schlaftabletten, packt seine Frau und . . . ratsch! . . .« Sie schüttelte sich.
»Und dann geht er zu dem Mädchen. Aber da hat dann doch noch eine Hemmung gegriffen, denn es hat schwer verletzt überlebt«, kürzte Lühns die weitere Sachdarstellung ab.
»Ich bin gerührt. Und das alles, weil ihn die Frau verlassen wollte«, antwortete die Vorsitzende. »Na schön. Zur Frage der Schwere der Schuld hat sich das Ulmer Landgericht ja nicht besonders erschöpfend geäußert.«
»Das Urteil ist lausig«, sagte Lühns. »Der Mann war offenbar medikamentenabhängig, möglicherweise in einem Maß, dass es die Persönlichkeitsstruktur verändert hat. Aber wegen der Entrüstung in der Öffentlichkeit über den Fall wollte die Kammer keine Konzessionen machen und ist der Frage einer verminderten Schuldfähigkeit nicht weiter nachgegangen.«
»Und weil sie das nicht getan hat, konnte sie den Mann auch nicht in die Psychiatrie stecken«, warf der beisitzende Richter Holzheimer ein.
»Und ich hab’ die Bescherung«, seufzte Isolde Kumpf-Bachmann, die gern alles auf sich selbst bezog.
Schuld war das Bundesverfassungsgericht. 1977 hatte es entschieden, auch einem zu lebenslanger Freiheitsstrafe Verurteilten müsse die Hoffnung bleiben, in späteren Jahren auf Bewährung entlassen zu werden. Seither hatten immer wieder alt gewordene Lust-, Frauen- und Raubmörder vor dem Schreibtisch der Richterin gestanden, und fast alle waren sie nach 15 oder 20 Jahren Knast krumme, arthritische Kümmermolche geworden, mit Krebs oder wenigstens Hämorrhoiden geschlagen.
Der, um den es hier ging, Wolfgang Thalmann, war inzwischen 55 Jahre alt, das dunkle Haar grau durchsetzt, ein mittelgroßer, keineswegs geduckter Mensch, der bei der Anhörung fast gemessen und durchaus seriös gewirkt hatte. Aufgefallen waren ihr aber vor allem die schwarzen traurigen Augen. Es waren die Augen eines Menschen, der weiß, dass die Welt von Grund auf böse ist, vor allem zu ihm selbst. Isolde Kumpf-Bachmann waren solche Charaktere von jeher besonders verdächtig gewesen.
»Seine Führung ist nun wirklich einwandfrei«, hörte sie Lühns vortragen. »Sie haben ihm die Buchführung der Anstaltsschreinerei übertragen, die er dann auf moderne Datenverarbeitung umgestellt hat. Inzwischen läuft die ganze Schreinerei mit computergesteuerten Maschinen, und der Anstaltsleiter hat mir gesagt, er wisse gar nicht, was er machen solle, wenn wir ihm den Thalmann wegnehmen.«
»Was mich mehr interessiert, ist die Tochter, die damals überlebt hat«, sagte die Kumpf-Bachmann. Ob man eine Gefahr für das Mädchen, nein: für die junge Frau wirklich ausschließen könne?
Kontakt bestehe zwischen Vater und Tochter seines Wissens nicht, antwortete Lühns, und der Anstaltspsychologe habe Thalmann eine gute Prognose gestellt – was vor 17 Jahren geschehen sei, müsse als das Ergebnis einer zwar katastrophalen, aber eben doch unwiederholbaren Konstellation gesehen werden.
»Na ja, nachdem die Frau tot ist, kann er sie schlecht noch einmal...«, warf der Beisitzende Holzheimer ein.
»Es war keine Konstellation, sondern ein Rasiermesser«, sagte die Kumpf-Bachmann grimmig. »Und wie Sie mir vorhin erklärt haben, gibt es diese Dinger noch immer. Wir lehnen ab.«
Es war falsch gewesen, dachte sich Lühns Stunden später, als er auf der Schnellstraße durch das aufkommende Schneetreiben nach Süden fuhr. Aber wenn Isolde Kumpf-Bachmann in dieser Stimmung war, widersprach man ihr nicht. Rechts sah er das weit gestreckte Gelände von Mariazell, gespenstisch hell erleuchtet, im Licht der Suchscheinwerfer trieben die Schneeflocken. Es sah aus wie ein Irrenhaus aus Tausendundeiner Nacht, von einer wunderlichen Fee mitten ins winterliche Allgäu verhext, dachte sich Lühns.
Aber Mariazell war kein Irrenhaus. Mariazell war ein Knast.
Sonntag, 25. Januar
Die Straße führte über die verschneite Albhochfläche. Es war später Sonntagvormittag, die Fahrbahn war geräumt, dennoch fuhr Tamar für Berndorfs Gefühl wie immer zu schnell. Mit leisem Unbehagen – als geniere er sich wegen seiner Ängstlichkeit – legte er die rechte Hand stützend aufs Armaturenbrett, als Tamar den Passat scharf durch eine Linkskurve zog. »Fahr ich Ihnen zu schnell, Chef?«
»My dear Watson!«, antwortete Berndorf. Tamar entschuldigte sich. Zur Ablenkung wollte sie wissen, wie es in Münster-Hiltrup gewesen war. In der vergangenen Woche hatte Berndorf an der Polizeiführungsakademie dort einen Lehrgang über die neuen Möglichkeiten der DNS-Analyse besucht. »Es ging um den genetischen Fingerabdruck«, sagte Berndorf. »Dass man aus den winzigsten Blutspuren, aus Spucke oder Sperma ein Rasterprofil erstellen kann, das für jeden Menschen einmalig und unverwechselbar ist: das ist ja alles nicht neu. Aber jetzt werden die Leute in den Labors sehr bald noch sehr viel mehr können. Sie werden die Täter ausrechnen.«
»Ich dachte, dieses Rasterprofil wird von DNS-Abschnitten abgeleitet, die keine Erbinformationen enthalten?«, wandte Tamar ein. Sie hatte vor einigen Tagen einen Aufsatz darüber gelesen. Tamar Wegenast war Kriminalkommissarin und vor anderthalb Jahren nach Abschluss ihrer Ausbildung zur Polizeidirektion Ulm gekommen.
»Das wird behauptet. Damit sich niemand aufregt. Tatsächlich aber erlaubt die Struktur dieser Abschnitte bereits heute Rückschlüsse auf bestimmte genetische Vorgaben. Zum Beispiel darauf, ob jemand die Anlage zu Chorea Huntington hat, zu Veitstanz.«
Tamar schaltete herunter und steuerte in eine Rechtskurve. Das Heck rutschte weg, Tamar beschleunigte und schoss mit dem Wagen aus der Kurve heraus. »Veitstanz?«, fragte sie belustigt.
»Richtig«, antwortete Berndorf. »Ich hab’ auch noch keinen Totschläger mit Chorea Huntington gehabt. Aber das ist nur der Anfang. Sie werden demnächst aus der DNS-Struktur ableiten können, ob ein Täter – sagen wir einmal – rothaarig ist. Wenn wir das wissen, werden wir es auch für die Fahndung verwenden.«
»Und wo ist die Grenze?«
»Da ist dann keine mehr«, antwortete Berndorf. »Wenn in ein paar Jahren, also um 2005 oder 2010, die vollständige genetische Kartierung vorliegt, werden wir ganz selbstverständlich aus dem Speichelrest an einer weggeworfenen Zigarettenkippe das Persönlichkeitsprofil eines Tatverdächtigen ableiten oder sogar Phantombilder von ihm erstellen. Das heißt, ihr werdet das tun. Ich sitze dann irgendwo an der portugiesischen Küste und schaue dem Atlantik zu. ›Der Weltlauf ist mir einerlei, und ich muss mich weder um mein Geld sorgen noch um mein Ansehen. Und wissen muss ich auch nichts mehr.‹ So, ungefähr, beschreibt mein derzeitiger Lieblingsfranzose den hauptsächlichen Vorzug des Alters.« Vor der Fahrt nach Münster war Berndorf in seiner Buchhandlung eine Montaigne-Auswahl in die Hände gefallen.
»Das klingt aber ziemlich trostlos«, wandte Tamar ein. »Noch schlimmer als scheintot.«
»Darum geht es ja«, antwortete Berndorf. »Wer sterben gelernt hat, ist ein freier Mensch. Steht auch bei Montaigne.«
»Ein schöner Satz. Nur sehen unsere Toten meist nicht danach aus.« Tamar mochte es nicht, wenn Berndorf seinen Ruhestandsphantasien nachhing. »Vielleicht hätten sie mehr üben müssen.« Berndorf sagte nichts.
»Noch mal zu der Tagung.« Tamar hatte keine Lust, sich anschweigen zu lassen. »Wenn das stimmt, was Sie sagen, bekommen wir also doch den gläsernen Menschen. Und niemand findet das unheimlich?«
»Doch«, antwortete Berndorf bereitwillig. »Einer der Referenten, ein Israeli, hält das für den Einstieg in einen kriminologischen Rüstungswettlauf. Wenn die Täter damit rechnen müssen, dass sie von jeder Spur überführt werden können, die sich am Opfer findet, dann werden sie dafür sorgen, dass es überhaupt keine Opfer mehr gibt, an denen sich etwas finden lässt. Sie werden sie umbringen und verschwinden lassen. Außerdem hat er gemeint, in den USA würden sie demnächst wohl nach einem Gen suchen, das Menschen zum Verbrecher macht.«
»Wenn sie es finden, hätten wir es ja einfach.«
»Und Kain wäre ein genetischer Unfall gewesen. Wer nicht mit Drogen dealt, ist der von Natur aus bessere Mensch. Es ist nicht so, dass er nicht dealt, weil er das Dealen nicht nötig hat. Er hat die anständigeren Gene. Glauben die Amerikaner. Sie wollen nicht wahrhaben, behauptet Rabinovitch, dass es das an sich Böse gibt. Und dass dieses Böse die Bedingungen erst hervorruft, unter denen Verbrechen entstehen.«
»Rabinovitch?«
»Mordechai Rabinovitch. Der israelische Referent. Wir saßen an einem der Abende noch zusammen in einer Kneipe in Münster.«
»Zwei Bullen reden in der Kneipe über das Böse an sich«, sagte Tamar. »Da hätt’ ich Mäuschen sein wollen.«
»Hauptsächlich haben wir Fußball geguckt«, beruhigte Berndorf. »Außerdem weiß ich gar nicht, ob er Bulle ist. Er arbeitet am Kriminologischen Institut der Universität von Tel Aviv.«
Die Straße bog von der Albhochfläche in ein von Fichten bestandenes, lang gestrecktes Tal hinab. Tamar steuerte den Wagen durch mehrere tückisch abschüssige Kurven, dann wurde die Strecke wieder gerade. Links vorne, an einer unbeschilderten Einfahrt, stand ein Polizeibeamter. Tamar nahm den Gang heraus und ließ den Wagen ausrollen, bis er bei dem Polizisten stehen blieb. Jetzt erkannte ihn Tamar. Es war der Hauptwachtmeister Krauß vom Polizeiposten Blaustein. Er starrte ihnen hoheitlich in den Wagen, als ob er erst prüfen müsse, ob sie Diebesgut dabei hätten oder sonstwie unbefugt wären. Dann winkte er sie herein.
»Ach Gott, Krauß!«, sagte Tamar und fuhr – diesmal vorsichtig – auf einen weiten Platz vor einer Felswand. Fragend schaute sie sich um.
»Ein aufgegebener Steinbruch«, erklärte Berndorf. Vor ihnen stand ein Streifenwagen, dahinter eine Gruppe Männer in papageienhaft bunten Trainingsanzügen.
»Haben Sie eigentlich auch so etwas an, wenn Sie abends durch die Au rennen?«, fragte Tamar. Berndorf versuchte, ihr einen Vorgesetztenblick zuzuwerfen, und stieg aus. Die Männer in den Trainingsanzügen kamen auf sie zu. Tamar stellte den Motor ab. Erst jetzt bemerkte sie, dass noch ein weiteres Fahrzeug in dem Steinbruch stand. Es war verschneit, die Fahrertür war geöffnet, und als sie neben Berndorf trat, sah sie einen Mann am Steuer sitzen.
Tamar zögerte kurz und musterte den schneebedeckten Boden um das Auto. »Das hat keinen Sinn«, sagte Berndorf, »unsere Helden haben schon alles zertrampelt.«
Aus der Gruppe löste sich ein zweiter Grünuniformierter und grüßte, zwei Finger der Hand lässig an den Rand der Uniformmütze gelegt, es sollte jovial-vertraulich aussehen: Ach Gott, auch noch Krauser, dachte Berndorf. Die Männer da seien von der Leichtathletikabteilung des TSV Blaustein, erklärte Krauser und fügte so halblaut hinzu, dass es alle hören konnten: »Alle sehr vertrauenswürdig, kann die Hand dafür ins Feuer legen!«
Was redet der da, dachte Berndorf. Unter seiner Schädeldecke meldete sich der Whisky vom Vorabend zurück.
Jedenfalls, sagte Krauser, sei den Männern beim Waldlauf der Wagen da aufgefallen.
»Eigentlich nicht so sehr der Wagen, sondern dass er zugeschneit war und einer drinsitzt«, mischte sich ein Mann mit gerötetem Gesicht und einem Schnauzbart ein. Er steckte in einem grün-pink gestreiften Sportanzug.
»Es ist nämlich ein Toyota«, sagte ein zweiter. Er trug etwas, das rot-schwarz geflammt war.
Nämlich? dachte Berndorf und spürte dem Pochen in seinem Schädel nach.
»Und dann haben wir nachgeschaut und denken, dass der Mann, der da sitzt, tot ist«, sagte der Pinkgrüne. »Das Auto ist nämlich aus Görlitz«, erläuterte der Schwarzrotgeflammte.
»Was hat denn das damit zu tun?«, wollte der Pinkgrüne wissen. Der andere wies stolz auf das hintere Nummernschild, von dem er den Schnee abgestreift hatte: »Da – GR, ist bitte schön Görlitz.«
»Meine Herren, diese Ermittlungen wollen Sie dann doch bitte der Polizei überlassen«, sagte Krauser.
Berndorf hatte sich inzwischen in den Wagen gebeugt. Ein säuerlicher Geruch schlug ihm entgegen. Der Mann auf dem Fahrersitz hing zusammengesunken über dem Lenkrad. Sein Gesicht war der Fahrertür zugewandt. Aus dem halb geöffneten Mund war Speichel ausgetreten und zwischen den Bartstoppeln angetrocknet. Der Mann hatte sich schon mehrere Tage nicht rasiert. Er schien um die 50 Jahre alt, auf den ersten Blick unauffällig, Berndorf registrierte aschblondes zurückgekämmtes Haar und eine herabgerutschte Brille. Der Mann trug eine Stoffhose, dazu eine Art Freizeitjacke und einen Pullover mit V-Ausschnitt darunter. Er sieht tatsächlich aus, wie man sich vor ein paar Jahren einen Ossi vorgestellt hat, dachte Berndorf. Auf Pullover und Jacke fanden sich Flecken und Reste, die nach Erbrochenem aussahen, das nur nachlässig weggewischt worden war. Der Mann war tot, und das wohl schon seit einigen Stunden.
Tamar hatte vorsichtig die Beifahrertür geöffnet. Auf dem Sitz lag eine geöffnete Thermosflasche, ein Teil der Flüssigkeit darin war ausgelaufen und hatte auf dem Plastikbezug eine dunkle Lache gebildet.
Schnüffelnd beugte die Kriminalkommissarin ihren Nacken über die Lache. Dann blickte sie, die schmale lange Nase noch leicht gerunzelt, dem Toten ins Gesicht und musterte die verklebten Bartstoppeln. Von Berndorf war nichts zu sehen. Dafür hatten die Männer in den Trainingsanzügen einen Halbkreis um die Wagenseite mit der Fahrertür gebildet und stierten angelegentlich auf den Boden. Tamar richtete sich auf und ging um den Toyota herum.
Berndorf kniete dicht am Wagen. Seine Hose spannte, und außerdem schien sie ziemlich abgewetzt. Mit einiger Anstrengung zog er seinen Kopf unter dem Chassis vor und stand schnaufend auf.
»Was ist da unten?«, wollte Tamar wissen.
»Was wird da unten sein? Schnee«, sagte Berndorf. »Schnee?«
»Na ja, ist halt Winter. Außerdem brauchen wir vielleicht doch die Spurensicherung.«
Montag, 26. Januar, Mariazell
Das Dienstzimmmer des Anstaltsleiters Dr. Theo Pecheisen war in Esche natur möbliert. Er hatte es sich eigens so ausgesucht, weil es hell, freundlich und vor allem zivil aussehen sollte: »Ein Qualitätserzeugnis aus dem eigenen Hause«, pflegte er den Besuchern stolz zu erläutern. Der Bezug der Sitzmöbel war Ton in Ton mit dem goldbraunen Leinenstoff der Vorhänge abgestimmt. Durch die Fenster ging der Blick auf das Außengelände mit einem Basketball-Spielplatz und weiter zu den Mauern; auf dem Spielplatz und den Mauerkronen lag an diesem Morgen Schnee. Es war Montag, die Woche wartete grau und endlos.
Pecheisen bat Zürn an den Besuchertisch. Kurz sprachen die beiden Männer über den Freitagabend, als die Sensoren der elektronischen Hofraumüberwachung auf den einsetzenden Schneefall reagiert und Alarm ausgelöst hatten.
»Es ist wirklich unerträglich«, klagte Pecheisen. »Als ob unsere Klientel nicht schwierig genug wäre, erst recht an einem Freitagabend. Und da muss uns diese Alarmanlage die Leute für nichts und wieder nichts verrückt machen.«
Zürn sagte, in seinem Trakt sei es ruhig geblieben. »Aber die neue Sicherheitselektronik können Sie wirklich der Katz’ geben. Nur nimmt die’s nicht.«
Er verstehe das auch nicht, meinte Pecheisen: »Die Leute von der Lieferfirma quatschen mir die Ohren voll von Hardware und Software und Prozesssteuerung, aber Tatsache ist, dass das System zusammenbricht, sobald mehrere Alarmmeldungen gleichzeitig eingehen oder kurz nacheinander.«
»Neulich«, sagte Zürn, »bei der Schlägerei zwischen den Albanern und den Rumänen war das so. Wir müssen halt selber wissen, welche Meldung Vorrang hat.« Dann zögerte er und lächelte etwas schief: »Ich kann ja mal Thalmann fragen. In der Schreinerei haben wir solche Probleme nicht.«
»Ich weiß nicht, ob der Justizminister das für einen besonders guten Einfall hielte«, antwortete Pecheisen mit einem etwas gezwungenen Lächeln. Dann wurde seine Miene plötzlich besorgt. »Ach ja, Thalmann! Ich fürchte, dass ich da keine besonders gute Nachricht für Sie habe«, sagte er dann. »Die Vollstreckungskammer hat seine Haftentlassung abgelehnt. « Er machte eine Pause und sah Zürn sorgenvoll ins Gesicht. »Ich weiß, dass das Probleme geben wird. Er ist ja so etwas wie eine Vertrauensperson.«
Zürn gab den Blick ausdruckslos zurück: »Sie haben es ihm schon gesagt?«
»Ja«, sagte Pecheisen, »und er schien es auch ganz gelassen aufzunehmen, vielleicht sollte ich besser sagen: regungslos. Ich will sagen – es ist mir nicht geheuer.«
»Er ist ja nicht der einzige, dem so etwas passiert«, antwortete Zürn ruhig. »Wir fangen das schon auf.«
Dann ging er. Der Schreck rutschte ihm erst ins Gesicht, als er die Tür zum Dienstzimmer mit den Esche-Möbeln hinter sich geschlossen hatte. Thalmann würde hohl drehen, das war so sicher wie das Unheil, das dann über ihn und den kleinen Wohlstand im Bungalow der Familie Zürn hereinbrechen würde. Was war denn dabei, einen Menschen laufen zu lassen, der 17 Jahre gebüßt hat! Nichts wussten die Leute da draußen vom Leben im Knast. Und auch nichts davon, wie schwer es ist, mit dem jämmerlichen Gehalt eines kleinen Beamten im Justizvollzugsdienst eine Familie durchzubringen.
Zürn ging zu den Werkstätten hinüber. Er durfte keine Zeit verlieren. Heiß schlug ihm in der Schreinerei der Dunst aus Holzstaub, Schleifmittel, Leim und Politur entgegen. Gefangene mit Ohrenschützern waren dabei, Tische und Stühle aus massivem Eichenholz abzuschleifen und fürs Beizen vorzubereiten. Er fand Thalmann in dem Glasverschlag, wo er zusammen mit Maugg, dem Meister der Schreinerei, seinen Arbeitsplatz hatte. Maugg lehnte am Aktenschrank, sein zerklüftetes Gesicht sah noch grauer aus als sonst. Er hat wohl wieder Magenblutungen gehabt, dachte sich Zürn und schloss die Tür. Das Kreischen der Säge- und Schleifmaschinen klang gedämpfter. Thalmann saß auf einem Drehstuhl; er schien auf Zürn gewartet zu haben.
»Die lassen mich nicht raus«, sagte Thalmann zur Begrüßung. »Ich weiß«, antwortete Zürn.
»Jetzt seid ihr dran«, sagte Thalmann.
»Das weiß ich auch«, antwortete Zürn.
Es waren etliche zehntausend Mark, die jeder von ihnen in den letzten Jahren nebenbei verdient hatte – vor allem mit maßgefertigten Wohnungseinrichtungen für Privatkunden, an der Justizkasse vorbei abgerechnet. Thalmanns Anteil sollte ihm nach der Haftentlassung helfen, beim Start ins neue Leben oder was immer er dann vorhatte. Das war jetzt hinfällig. Zürn wusste zu gut, dass damit auch er in der Luft hing. Und Maugg. »Er kann es in einem Jahr doch noch einmal versuchen«, wagte Maugg einzuwerfen.
»Ich muss jetzt raus«, sagte Thalmann. »Verschaff mir einen Freigang.«
»Du weißt ganz genau, dass das jetzt nicht geht«, wehrte Zürn ab. »Wenn der Antrag abgelehnt ist, sind alle Freigänge vorerst gestrichen. Sicherheitsgründe.«
»Das ist mir egal«, gab Thalmann zurück. »Besorg mir einen Auftrag in Rodegg.« Rodegg war eine Außenstelle, und die Gefangenen dort arbeiteten in der Landwirtschaft. Die Anlage war kaum überschaubar, und es hatte immer wieder Ausbruchsversuche gegeben, einige waren sogar erfolgreich gewesen. Und bei einigen hatten die Kollegen auch schon schießen müssen. Gar keine so schlechte Idee, dachte sich Zürn.
Dann merkte er, dass Thalmann ihn mit einem kalten und prüfenden Blick fixierte. »Nein. Rodegg nicht«, sagte Thalmann nach einer Pause. »Es muss von hier aus gehen. Ich hab’ keine Lust, Unkraut zu jäten. Nicht einen Tag. Von den Narren, die dort zu schnell schießen, will ich gar nicht erst reden.« Zürn überlegte. An seinem rechten Daumennagel hatte sich ein kleiner Hautfetzen gelöst. Gedankenverloren kratzte er daran. »Hör auf«, sagte Thalmann. »Das macht mich verrückt.«
Zürn ließ die rechte Hand sinken. »Wenn es wirklich schnell gehen soll«, sagte er langsam, »hätten wir die Lieferung an den Tettnanger Zahnarzt, Mooreiche naturbelassen, da ist eine Sitztruhe dabei. Wofür die Leute nicht alles Geld haben.«
»Was hat die Mooreiche damit zu tun?«, fragte Maugg.
»Die Sitztruhe hat damit zu tun, meint Zürn«, sagte Thalmann. »Aber ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Ob nicht ein Schweinehund auf den dummen Gedanken kommt, die Truhe abzuschließen und mit Plastikfolie zuzukleben ...«
Zürn protestierte: »Wo denkst du hin!«
»Du hast recht«, sagte Thalmann trocken. »Wie kann ich nur so etwas denken! Und überhaupt. Ich hab’ da in dem Kasten«, er klopfte auf den PC der Schreinerei, »eine dritte Buchführung gespeichert, es ist die richtige, und wisst ihr, was daran besonders lustig ist? Sie wird in ein paar Tagen aktiviert, das heißt, sie meldet den exakten Fehlbetrag aus den letzten Jahren an den Hauptrechner der Verwaltung. Macht euch keine Gedanken, wann sie das tut. Ihr werdet es schon rechtzeitig erfahren.« »Bist du verrückt?« Das war Maugg. Zürn schwieg. Insgeheim hatte er bei Thalmann schon immer mit so etwas gerechnet. Um ihm hinter die Schliche zu kommen, hatte er sogar bei der Volkshochschule einmal einen PC-Kurs belegt. Aber er war nicht mitgekommen.
»Nein, Maugg, ich bin nicht verrückt«, sagte Thalmann. »Und du weißt, dass niemand so etwas zu mir sagen darf. Und dass dir nur deswegen jetzt noch nichts passiert, weil du ein abgewrackter alter Säufer bist, kurz vorm Endstadium. Wie viel Tage gibt dir der Arzt überhaupt noch? Deine Alte wird sich freuen, wenn du hinüber bist. Aber nicht lange, denn dann muss sie den Rest rausrücken, den du nicht versoffen hast.«
Maugg öffnete zornig den Mund. Zürn warf ihm einen warnenden Blick zu und schüttelte den Kopf. Alle drei schwiegen. Dann sprach Thalmann weiter. »Jedenfalls kommen die richtigen Zahlen irgendwann auf den Bildschirm, und nur ich weiß, wann das passiert. Und weil die Anlage vernetzt ist, nützt es überhaupt nichts, wenn irgendwelche Dummköpfe glauben sollten, sie bräuchten diesen PC hier nur mit dem Vorschlaghammer kurz und klein zu schlagen.«
Zürn wartete. »Und gibt es auch etwas, was nützt?«, fragte er dann.
»Doch«, sagte Thalmann. »Ihr braucht das Passwort. Und ein paar weitere Befehle. Ich geb’ sie euch telefonisch durch. Wenn ich dann noch leb’ und nicht in der Mooreiche erstickt bin. Und wenn ich das Geld hab’. Habt ihr das verstanden?«
»Ja«, sagte Zürn. »Wir haben es verstanden.«
»Aber ich muss es doch melden, wenn er fehlt«, warf Maugg ein.
»Das musst du nicht«, meinte Thalmann. »Ein paar Stunden Vorsprung brauch’ ich schon.«
Zürn dachte an die neue Sicherheitselektronik.
»Du kriegst den Vorsprung«, sagte er dann. »Auch wenn ich Maugg eins drüberziehen muss.«
Maugg murmelte, er verstehe überhaupt nichts mehr.
»Nur pro forma«, sagte Zürn beruhigend. »Damit es besser aussieht.«
Montag, 26. Januar, Ulm
Der glatte kahle Kugelkopf des Kriminaloberrats Englin war blass vor Entrüstung, und noch weniger als sonst konnte er das Zucken des linken Augenlids unterdrücken. Im Jugendzentrum Büchsenstadel hatten die Leute vom Stadtjugendring einen Kokain-Dealer erwischt und hinausgeworfen. Anschließend hatten sie eine Pressekonferenz gegeben und erklärt, der Dealer sei ein in der ganzen Stadt bekannter Spitzel des Rauschgiftfahnders Blocher gewesen.
Heute stand das nun alles in einem Zweispalter im »Tagblatt«, und Berndorf sah, dass Englin den ganzen Artikel, der auf dem ovalen Konferenztisch vor ihm lag, ausnahmslos gelb und rot markiert und mit Ausrufezeichen versehen hatte. Ein besonders dickes stand an der Stelle, an der es hieß: »Die Leitung des Büchsenstadels frage sich inzwischen, mit wie viel Sachverstand man im Neuen Bau eigentlich ermittle, wenn es um wirklich schwerwiegende Straftaten gehe.« Der Neue Bau mit seinen mächtigen, um einen Innenhof gruppierten Dächern ist Sitz der Ulmer Polizeidirektion.
»Einwandfrei«, sagte Englin, »das ist einwandfrei Beleidigung. Üble Nachrede ist das. Selbstverständlich werden wir Strafanzeige erstatten. Auch gegen das Tagblatt.«
»Warum machen wir keine Hausdurchsuchung, und zwar mit dem ganz feinen Rechen, von unten nach oben und links nach rechts, denen werden die Augen aufgehen«, sagte Blocher und hob drohend den rechten Zeigefinger. Hausdurchsuchungen waren Blochers Spezialität.
»So, wie ich die Tagblatt-Leute kenne, werden ihnen wirklich die Augen aufgehen«, warf Berndorf ein: »In deren Kruscht hat noch nie jemand etwas gefunden.«
»Ich mein’ den Büchsenstadel«, murrte Blocher.
»Ja, und dann spielt die Stadtjugend das ganze Jahr Räuber und Gendarm mit uns«, sagte Berndorf. Warum Englin nicht einfach einen freundlichen Brief schreibe, der angebliche Dealer sei der Ulmer Polizei völlig unbekannt, und sie habe auch keinerlei Grund, im Büchsenstadel zu ermitteln?
»Kollege Berndorf«, sagte Englin mit mühsam unterdrückter Entrüstung, und sein linkes Lid zuckte zweimal, »Sie schlagen ernsthaft vor, dass wir diese – diese Ungeheuerlichkeit auf sich beruhen lassen sollen?«
Tu was du willst, dachte Berndorf. In die Stille hinein platzte Tamar. »Vielleicht hab’ ich da was falsch verstanden – aber ist das nun ein V-Mann von uns gewesen oder nicht?«
Blocher lehnte sich in dem hohen Stuhlrücken zurück und faltete seine dicken Hände vor dem Bauch: »Junge Kollegin, ich schätze diesen Ausdruck nicht. Überhaupt nicht. Selbstverständlich sind wir offen für eine – äh – punktuelle Zusammenarbeit. Wie man auch an der Polizeifachhochschule gelernt haben sollte, ist das gesetzlich absolut abgedeckt. Ab-so-lut.« Also doch, dachte Berndorf und warf dem Kripo-Chef einen warnenden Blick zu. Zu Berndorfs Überraschung begriff Englin: »Also wenn das so ist, sollten wir uns vielleicht doch mit dem Präsidium in Stuttgart – ja nun, abstimmen«, sagte er dann.
Na also, dachte sich Berndorf: Ohne Absicherung nach oben riskierst du nichts. Und die Stuttgarter werden vielleicht doch noch mehr Verstand haben als der Kollege Blocher.
Die weiteren Besprechungspunkte betrafen Routinefälle. In der Nacht zum Montag war das Pelzgeschäft in der Herrenkellerpassage ausgeräumt worden; es sei eine professionelle Auftragsarbeit gewesen, sagte Hanisch vom Einbruchsdezernat. Am Tannenplatz hatte die Galatasaray-Gang zwei Skinheads aus dem Oberschwäbischen durchgeprügelt, und in den kommenden Wochen stand ein weiterer Transport von abgebrannten Kernbrennstäben aus dem benachbarten Atomkraftwerk Gundremmingen nach Gorleben an, man würde also die regionalen Greenpeace-Leute genauer überwachen müssen.
Außerdem war da noch der Fall aus dem Blausteiner Steinbruch. »Bei dem Toten handelt es sich um einen Heinz Tiefenbach, 52 Jahre alt, Bahningenieur aus Görlitz, geschieden, nicht vorbestraft, nicht polizeibekannt, wie uns die Görlitzer Kollegen am Telefon sagten«, trug Tamar vor. »Der Toyota, in dem er gefunden wurde, ist auf ihn zugelassen. In seiner Brieftasche fanden wir knapp 300 Mark, außerdem eine Eurochequekarte. Tiefenbach lebte allein und soll angeblich seit einigen Tagen verreist sein.«
Dann machte sie eine Pause. Englin zuckte mit dem Augenlid. »Es sieht aus, als ob er sich umgebracht hat«, fuhr Tamar fort. »Aber wir wissen nicht, ob wir es glauben sollen.«
»Und zwar deswegen nicht«, fügte Berndorf hinzu und schob eine Fotografie zu Englin hinüber. Auf dem Bild sah man nichts weiter als Schnee mit Fuß- und Reifenspuren darin. In der Mitte war ein weißes Rechteck zu erkennen, eine dünne, aber geschlossene rechteckige Schneedecke, die von den Spuren ausgespart geblieben war.
»Ich verstehe das nicht«, sagte Englin missbilligend. Sicher nicht, dachte Berndorf.
»Entschuldigung«, sagte er dann. »Die Leiche wurde am Sonntagvormittag gefunden. Nach vorläufiger Auskunft der Gerichtsmedizin war der Mann zu diesem Zeitpunkt seit mindestens 40 Stunden tot, also seit dem späten Freitagnachmittag.«
»Und?«, fragte Englin ungehalten nach.
»Die Schneefälle haben erst nach 20 Uhr eingesetzt«, erläuterte Tamar. »Genau gegen 20.20 Uhr. Das ist von der Wetterstation auf dem Kuhberg so bestätigt worden. Es waren die ersten Schneefälle in diesem Jahr.«
Englin begriff noch immer nicht.
»Der Toyota des Toten stand hier«, Berndorf deutete auf das unberührte weiße Viereck, das auf der Fotografie zu sehen war. »Nur – vor Freitagabend kann er noch nicht da gewesen sein. Sonst läge hier kein Schnee.«
»Tiefenbach ist also erst später da hingefahren«, ergänzte Tamar. »Bloß war er da schon tot.«
Englin wollte wissen, warum es dann keine Spuren von dem Menschen gebe, der den Toten und seinen Wagen bis zu dem Steinbruch gefahren habe.
»Das müssen Sie unsere Waldläufer vom TSV Blaustein fragen«, sagte Berndorf. »Beziehungsweise die Kollegen Krauß und Krauser. Sie haben alles zertrampelt, als ob sie es darauf angelegt hätten. Allerdings wird nicht viel zu sehen gewesen sein. Die Frontscheibe des Wagens war zugeschneit, und die Schneedecke unter dem Chassis ist dünn.«
»Ja – ist er nun vor dem Schneefall hingefahren oder hingefahren worden, oder danach?«, fragte Englin.
»Während«, antwortete Berndorf. »Wer immer am Freitagabend den Wagen mit der Leiche gefahren hat, bekam ein Problem, als es zu schneien anfing. Er musste den Wagen so schnell wie möglich abstellen und die Leiche auf den Fahrersitz rücken, damit seine eigenen Spuren möglichst auch noch zugeschneit würden. Es sollte ja so aussehen, als ob Tiefenbach Selbstmord begangen hätte.« Berndorf schaute zu Tamar hinüber.
»Wir meinen deshalb«, griff Tamar den Faden auf, »dass der unbekannte Fahrer möglicherweise einen anderen Plan gehabt hat, dass er ursprünglich weiterfahren wollte. Und wenn er das wollte, dann vielleicht deshalb, weil nichts auf Ulm hindeuten sollte. Wir sollten einen Fahndungsaufruf herausgeben, wer den Mann und seinen Wagen hier in der Stadt gesehen hat.«
Das Ulmer Gerichtsmedizinische Institut ist in einer alten, schmutziggelben Villa in der Prittwitzstraße untergebracht, oberhalb der Bahnlinie nach Heidenheim. Zu den Attraktionen des Hauses gehört die Eigenbau-Guillotine, mit der sich vor Jahren ein Bauernsohn aus einem Albdorf nach einigen Mühen doch noch erfolgreich um einem Kopf kürzer gemacht hatte. Sie steht jetzt in dem neugotisch getäfelten Saal im Erdgeschoss, der früher einer Ulmer Honoratiorenfamilie als Speisezimmer gedient hatte.
Berndorf stieg in den zweiten Stock hoch. Aus dem mit Fachliteratur und Aktenbündeln voll gestopften Dienstzimmer, in dem der Privatdozent und Pathologe Dr. Roman Kovacz hauste, sah man die Pauluskirche und dahinter das breit gelagerte Münster.
»Na, wie war es in Hiltrup?«, fragte Kovacz, stand von seinem Schreibtisch auf und kam Berndorf entgegen. »Ab morgen erfassen wir in Ulm den genetischen Fingerabdruck, oder wie?« Die beiden Männer schüttelten sich die Hände, dann ging Kovacz und holte eine zweite Tasse für den Kaffee. Zurück kam er mit einem geblümten Porzellanbecher, auf dem »Susi« stand, mit einem Herzchen auf dem »i«.
Der Kaffee war stark, Berndorf trank ihn schwarz. Die Sache mit der DNS-Analyse sei etwas für die nächste Polizistengeneration. »Für die cleveren jungen Leute am PC. Nichts für einen alten Kieberer wie mich.« Ob denn Kovacz überhaupt in der Lage wäre, eine Analyse durchzuführen: »Ihr Laden ist ja auch nicht der neueste.«
»Täuschen Sie sich da nicht«, sagte Kovacz. »Auch wir gehen mit der Zeit. Es ist ja auch eine faszinierende Sache. Mit der DNS-Analyse können Sie endlich eine Urfrage der Menschheit zuverlässig beantworten.« Berndorf schaute auf.
»Die Frage, wer Ihr Vater gewesen ist«, sagte Kovacz.
btb Taschenbücher erscheinen im Goldmann Verlag, München, einem Unternehmen der Verlagsgruppe Random House GmbH.
1. Auflage Taschenbuchausgabe Februar 2002
Copyright © 1999 by Libelle Verlag, Lengwil am Bodensee
Umschlaggestaltung: Design Team München/Phlox Art unter Verwendung eines fotografischen Motivs von Anselm Spring Satz: IBV Satz- und Datentechnik GmbH, Berlin TH Herstellung: Augustin Wiesbeck
eISBN 978-3-641-10477-1
www.btb-verlag.de
www.randomhouse.de
Leseprobe