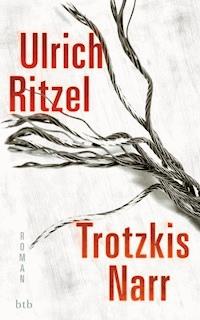8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb
- Kategorie: Krimi
- Serie: Berndorf ermittelt
- Sprache: Deutsch
Ein neuer Fall für Ex-Kommissar Berndorf: aktuell, brisant, temporeich
Eine Frühlingsnacht in Berlin. Ein junger Mann geht am Alten Garnisonsfriedhof vorbei, ein Landrover lauert im Dunkel und nimmt langsam Fahrt auf, am Ende liegt ein Toter auf der Straße – und Ex-Kommissar Hans Berndorf, mittlerweile Fachmann für private Ermittlungen, scheint als einziger an der Auflösung dieses Verbrechens interessiert. Besonders brisant: der Tote war vermutlich Opfer einer Verwechslung, die eigentliche Zielperson schwebt immer noch in höchster Gefahr. Als Berndorf dies begreift, ist er selbst schon ins Visier von Leuten geraten, die drei Nummern zu groß für ihn sind. Die es nicht zulassen, dass die lukrative Endabwicklung der glänzenden Geschäfte, die sie im zurückliegenden jugoslawischen Bürgerkrieg getätigt haben, von einem ausgedienten Polizisten durchkreuzt wird.
Doch manchmal scheitern die Mächtigen an Dingen, die zu unbedeutend sind, als dass sie sie ins Kalkül gezogen hätten. Ein Politiker gerät in die Verlegenheit, sich nicht mehr groß äußern zu können. André, ein halbwüchsiger Taschendieb, erbeutet ein Notebook mit verfänglichen Informationen. Ein kleiner Betrüger wittert die Chance zum großen Betrug. Eine geschwätzige alte Dame hat einen verfänglichen Zeitungsausschnitt aufbewahrt. Und Berndorf lernt, was für ein nützliches Gerät ein Spaten sein kann. Aber wird er damit durchkommen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 657
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Ulrich Ritzel
Schlangenkopf
Roman
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
1. Auflage
Copyright © 2011 by btb Verlag
in der Verlagsgruppe Random House GmbH, München
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-06809-7V002www.btb-verlag.de
Montag
Es gibt Abende, an denen Zlatan kein Trinkgeld bekommt. Nicht einen Cent. So etwas passiert, wenn die Gäste meinen, das sei Sache des Gastgebers, und der Gastgeber der Ansicht ist, er habe schon mehr als genug bezahlt, Service inbegriffen. Beamte denken so.
Ist das wichtig?
Ja und nein.
Weil es kein Trinkgeld gab, hat sich Zlatan kein Taxi geleistet.
Das muss ja auch nicht sein.
Zu lange waren die Gäste ja nicht geblieben.
Das war gut, denn so hatte er sich gerade noch umziehen können und die letzte U-Bahn erwischt.
Ist das wirklich gut? Die Straße vor ihm zieht sich zwischen dunklen hohen Häuserfronten hin, ganz selten nur ist eines der Fenster beleuchtet und gibt Zeichen davon, dass da noch ein anderer Mensch lebt und wacht, mitten in der Nacht. Und am Ende der Straße sieht Zlatan gestochen scharf die Mondsichel, die knapp über den Dächern hängt, als könnte sie weiß Wunder welche Märchen erzählen.
Zlatan verspürt einen Stich. Es gab einmal eine Zeit, da hatte er nachts nichts anderes zu tun, als den Mond anzusehen. Oder darauf zu warten, dass er sich wieder zeigte. Nur – er erinnert sich nicht gerne an diese Zeit. Er hat Gründe, sich nicht gerne zu erinnern. Jetzt bist du hier, ermahnt er sich, nirgendwo anders und in keiner anderen Zeit.
Hier! Jetzt! Er hört, wie seine Schritte auf der Straße widerhallen. Das ist doch er, der so geht? Er atmet scharf aus und tief wieder ein, er hat eine Empfindung in der Brust, die muss er ausschalten, weil … es ist keine Angst. Oder noch keine. Höchstens die kleine Angst, die verfluchte Vorbotin und Vorausschleicherin der großen, der richtigen Angst … Und die richtige Angst … davon reden wir besser nicht. Wer weiß, wie es ist, wenn sie nach dem Herzen greift und es zusammenpresst und einen ersticken will – wer das wirklich weiß, der will das nicht noch einmal erzählt bekommen, der ist froh, wenn er nichts davon hört und nicht daran erinnert wird. Und wer es nicht weiß, der soll das Maul halten und froh sein, dass er keine Ahnung hat …
Hier ist Berlin«, sagt die Stimme, »die Stadt, die niemals schläft, Sie hören Wanda Kuhlebrock auf Radio Fünf Neunundsechzig, es ist ein Uhr fünf, die Nacht hat also noch gar nicht begonnen, und mit mir und meinen schnuckeligen Oldies wird sie Euch nicht langweilig werden, die Außentemperatur liegt bei neun Grad – dass sich da draußen keiner den Hintern verkühlt! –, der Luftdruck liegt bei eintausendelf Hektopascal, der Wind kommt aus Südsüdwest, falls einer von euch Süßen segeln gehen will, keine Staus, keine Verkehrsbehinderungen, dann verkehrt mal schön, und wenn’s nicht flutscht, dann ruft mich an, Wanda weiß, wie’s geht … Damit ihr in Stimmung kommt, jetzt erst mal was von na … von Serge Gainsbourg und Jane Birkin, Viens entre mes reins, und wenn ihr nicht wisst, was die da treiben, dann dürft Ihr dreimal raten …«
Die Frau hinterm Steuerrad des Wagens, der am Straßenrand abgestellt ist, tastet mit der rechten Hand nach der Aus-Taste des Radios, dann lässt sie sie wieder sinken. Ein Mann kommt die Straße hoch, er geht auf der Fahrbahn, betrunken? Aber ja doch. Die Frau lehnt sich im Fahrersitz zurück, egal, was sie jetzt macht, es ist falsch. Es ist falsch, das Radio laufen zu lassen, und es ist falsch, es auszumachen. Der Betrunkene kommt am Wagen vorbei, merkt auf, scheint stehen bleiben zu wollen, Jane Birkin stöhnt, der Betrunkene hebt die Hand, als wolle er seinen Segen dazu geben, dann wendet er sich ab und torkelt weiter die Straße hinauf.
»Na«, meldet sich Wanda Kuhlebrocks Stimme, »wisst Ihr Schätzchen jetzt, was das heißt: Viens entre mes reins? Übrigens sollen das die Nieren sein, rein anatomisch hab ich das so eigentlich noch nie gesehen …«
Auf dem Beifahrersitz beginnt das Handy zu vibrieren, und das Display leuchtet auf. Diesmal stellt die Frau das Radio ab, greift zum Handy und meldet sich mit einem knappen: »Ja?«
»Er ist ausgestiegen«, kommt die Antwort.
Weiter wird nichts gesprochen.
Die Frau startet den Wagen. Es ist ein Landrover, fast neu, und der leise Motor ist im Leerlauf kaum zu hören. Noch einmal überprüft die Frau die Einstellung der Außenspiegel, dann lehnt sie sich wieder in ihrem Sitz zurück, entspannt, gelassen, die behandschuhten Hände auf das Lenkrad gelegt.
Das sind deine Schritte, die du da hörst, sagt sich Zlatan, es sind ruhige, gleichmäßige, sichere Schritte, jetzt geht es vorbei an der Baustelle, dann nach rechts, die Mauer des alten Friedhofs entlang, vielleicht noch dreihundert Meter, dann die Treppen hoch und Feierabend! Im Kühlschrank wird noch ein Bier sein, mehr braucht er nicht, oder vielleicht doch erst einen Pflaumenschnaps, denn es ist so kühl, dass ihn selbst in der neuen Lederjacke fröstelt, vielleicht läuft er deswegen ein wenig schneller …
»Warum rennst du denn so?« Aus der Dunkelheit der Baustelle löst sich ein Schatten und gleitet neben ihn. »Hast mal ne Zigarette?«
Zlatan ist Nichtraucher, aber er sagt, gerade vorhin habe er die letzte geraucht, »da vorne ist eine Kneipe, die hat noch offen«, sowieso habe er noch ein Bier trinken wollen, »da kriegen wir auch Zigaretten …«
»So ein netter Kumpel!«, sagt der Schatten, »nur blöd, ich lass mich nicht auf ein Bier und sonst noch was einladen, mit mir nicht, verstehst du?« Und plötzlich hört Zlatan dieses metallische Klicken, und der Schatten ist nicht mehr neben ihm, sondern vor ihm und drängt ihn zurück in die dunkle Ecke zwischen Bauzaun und brüchigem Gemäuer, ein Kerl in einem T-Shirt, nicht größer, nicht breiter als er selbst, und Zlatan sieht noch in der Dunkelheit das Grinsen und die Rattenzähne im mageren Gesicht und den Ziegenbart, nur das Springmesser sieht er nicht, das braucht er auch gar nicht zu sehen, das hat er ja schon gehört.
Er hebt beide Hände hoch, die Handflächen nach außen gekehrt. »Kein Problem, ich muss nur die Zigaretten erst holen.«
»Schöne Jacke haste da!«, sagt der Schatten, der so tut, als habe er gar nicht zugehört, und Zlatan begreift und zieht die Jacke aus, es ist wirklich eine schöne Jacke, eine Biker-Jacke, schwarz, mit weißen reflektierenden Besätzen, und reicht sie dem anderen. Der nimmt sie mit der linken Hand und hängt sie sich über die Schulter, denn in der rechten Hand hat er noch immer das Springmesser, und das heißt, dass er noch nicht fertig ist mit Zlatan.
»Den Geldbeutel«, sagt Zlatan, »den hab ich in der Hosentasche – Moment!« Und er dreht sich so, dass der andere sehen kann, wie er aus der rechten Hosentasche langsam eben kein Messer, sondern das Portemonnaie holt, es sind vielleicht fünfzig oder sechzig Euro drin, vielleicht ist der andere zufrieden damit, vielleicht geht es ihm auch gar nicht darum, sondern um die Angst, um die Angst, die Zlatan hat und mit der er, der Schatten, spielen kann wie die Katze mit der Maus … Motorengeräusch nähert sich, Scheinwerferlicht tastet die enge Straße ab und erfasst für einen Augenblick die beiden Männer in dem Winkel an der Baustelle, den einen mit dem Geldbeutel in der ausgestreckten Hand, den anderen mit der Lederjacke über der Schulter, der das offene Messer blitzschnell in der Hand hat verschwinden lassen, und für diesen einen Augenblick verharren die beiden Männer, als seien sie Standbilder, aus Stein gehauen oder in Bronze gegossen: Nächtliche Straßenszene, Neuer Deutscher Realismus …
André, ja?« fragt Wanda Kuhlebrock. »Noch nicht ganz achtzehn? Höre ich das richtig?«
»Noch nicht ganz«, antwortet die Stimme, die ein wenig brüchig ist, so als wisse sie selbst nicht, zu welchem Alter sie gehört.
»Und noch auf?«
»Das haben Sie doch selbst gesagt, dass das die Stadt ist, die nicht schläft!«
»Ja, dann«, lenkt Wanda ein, »und was kann ich für dich tun?«
»Ich will nur einen Gruß sagen. Einen Gruß an die Elke. Dass alles okay ist. Aber mal wieder melden könnte sie sich.«
»Oh!«, macht Wanda. »Höre ich da ein Herzeleid heraus? Ist deine süße kleine Elke womöglich ein klein wenig treulos?«
»Nö«, antwortet die Stimme. »Es ist schon alles okay. Ich weiß, dass sie immer Ihre Sendung hört …«
»Wenn du es sagst«, meint Wanda. »Also, Elke! Aufgepasst: Morgen meldest du dich bei André, und damit du es nicht vergisst, spielen wir von den Red Hot Chili Peppers … Moment … hier haben wir es schon: Don’t forget me …«
Der Lichtkegel schwenkt weiter, natürlich hält der späte Autofahrer nicht an und fragt, ob es ein Problem gebe und ob er die Polizei rufen solle, späte Autofahrer tun das selten oder nie, denn die Polizei wartet nur auf eins: auf Autofahrer, die man spät nachts ins Röhrchen blasen lassen kann. So verschwindet das Scheinwerferlicht, und das Motorengeräusch verklingt, und Zlatan öffnet den Geldbeutel, so dass der Schatten sich die zwei Zwanziger und den Zehner herausnehmen kann und dann endlich genug hat.
»Hau ab!«, sagt er zu Zlatan, und der wendet sich um und rennt über die Straße und auf dem Gehsteig weiter, an drei oder vier oder noch mehr Häusern vorbei, irgendwann bleibt er stehen, weil er auf einmal nicht mehr kann oder will und weil sein ganzer Körper zittert und ihm die Knie schier versagen. Und so blickt er zurück und sieht, wie der Schatten sich die Lederjacke anzieht und in die gleiche Richtung geht, nur auf der anderen Straßenseite, und wie er an der Einmündung zum Garnisonfriedhof nach rechts abbiegt, wie es auch Zlatans Heimweg gewesen wäre. Und während Zlatan sich gegen eine Hauswand lehnt und zusieht, wie sich der Schatten die Straße hinunterbewegt, mitten auf der Fahrbahn, und das spärliche Licht von den weißen Streifen am Schulteransatz der Biker-Jacke reflektiert wird – während Zlatan also an der Hauswand lehnt und Atem schöpft, springt am Straßenrand ein großer dunkler Wagen an, die Scheinwerfer leuchten auf, der Wagen wird aus der Parklücke heraus beschleunigt … und dann ist der Blick auf den Mann in der Lederjacke auch schon verstellt, Zlatan sieht nur noch die Rücklichter, hört den hochdrehenden Motor, die Rücklichter bewegen sich merkwürdig, als würde der Wagen in Schlangenlinien gesteuert, und tatsächlich gerät er sogar auf den Bürgersteig, schrammt an der Friedhofsmauer entlang und rauscht wieder zurück auf die Fahrbahn, und durch die Nacht hört Zlatan einen Schrei oder einen Schlag …
Und plötzlich begreift er, ein eiskalter Schrecken läuft ihm über die Arme und kräuselt ihm die Haut, und er wendet sich ab und geht, so schnell es eben geht, wenn man sich gerade noch auf den Beinen halten kann, und verschwindet in der Nacht.
Die Mondsichel, vor ein zwei oder drei Stunden noch links unten im Rechteck des Panoramafensters sichtbar, hängt dort nun rechts und fast oben. Im Atelier ist es zu warm und die Luft zu trocken, Christian Fausser braucht etwas zu trinken, und pinkeln muss er auch. Behutsam richtet er sich auf und wirft einen Blick nach rechts, Solveig liegt auf der Seite und hat ihm den Rücken zugekehrt, die dünne Decke zeichnet die Linie von Hüfte und Taille nach. Schläft sie? Er horcht auf ihre Atemzüge, aber sein Gehör ist nicht mehr besonders gut, schließlich sieht er, dass sich die Schulter ein wenig hebt und dann wieder senkt, in gleichmäßigem Rhythmus, und so schwingt er die Beine vom Bett und steht auf und tastet sich durch das Halbdunkel des Zimmers zum Bad … Dort schaltet er das Licht erst ein, als er die Tür hinter sich geschlossen hat. Er vermeidet einen Blick in den Badezimmerspiegel, setzt sich – nach vorne gebeugt – auf die Kloschüssel … Nach dem Geschlechtsverkehr ist gut Pinkeln, denkt er, warum sagt das keiner den alten Männern?
Weil es nur denen hilft, die von selber drauf kommen können.
Vorsichtig – als würde er damit etwas weniger Krach machen – drückt er auf die Spültaste, dann geht er zum Waschbecken, lässt kaltes Wasser in seine zu einer Schöpfkelle geformten Hände laufen und spült sich damit den Mund. Noch einmal schöpft er Wasser und klatscht es sich ins Gesicht, und weil seine rechte Hand sich pelzig anfühlt, hält er das Handgelenk unters kalte Wasser. Als er sich schließlich abtrocknet, kann er es nicht vermeiden und sieht einen nackten Männerkörper im Türspiegel, einen Körper mit dünnen Armen und einem auf die Hüfte hängenden Bauchansatz.
Er zieht eine Grimasse, verlässt das Bad und geht ins Zimmer zurück, das nun plötzlich erhellt ist vom bläulichen Licht des Fernsehers. Solveig sitzt im Bett, die Arme um die angezogenen Knie geschlungen, bekleidet mit nichts als ihrem langen schwarzen Haar, das über die linke Schulter fällt, und starrt über das Bett auf den Wandbildschirm, auf dem ein amerikanischer Nachrichtensender Aufnahmen zerschossener Lastwagen und aufgeregter Männer in Kampfanzügen zeigt.
»Muss das sein?«, fragt Fausser.
»Da haben sie wieder Scheiße gebaut, diesmal ganz gewaltig«, sagt Solveig und stellt den Ton des Fernsehers ab. »Dutzende von Leuten, die sich einen armseligen Kanister Benzin zapfen wollten, sind tot, verbrannt, zerrissen, vielleicht sind es nicht bloß Dutzende, sondern hundert oder mehr …«
»Wer soll das angestellt haben?«.
»Die Bundeswehr und die Amerikaner, was weiß ich! Beide zusammen. Erst hat sich die Bundeswehr beklauen lassen, dann haben die Amis die geklauten Tankwagen bombardieren müssen … Wenn ihr schon Krieg führen müsst …«
»Moment.« Fausser legt sich neben sie, so, dass er ihr Gesicht im Profil sehen kann. »Die haben die Amerikaner angefordert?«
»Sag ich doch. Das heißt, CNN sagt das. Wenn ihr schon Krieg führen müsst, warum zum Teufel könnt ihr die Unschuldigen dabei nicht verschonen?«
»Erstens tun wir das nicht, Krieg führen, ich schon gar nicht …«
»Doch!«, fällt sie ihm ins Wort. »Es ist eine Parlamentsarmee, heißt es immer …«
»Zweitens«, fährt Fausser ungerührt fort, »zweitens richtet sich Krieg immer und vor allem gegen Unschuldige, gegen die Zivilbevölkerung nämlich, also gegen Frauen und Kinder, seit jeher ist das so, lies das Alte Testament oder den Grimmelshausen oder lass dir in einem feministischen Proseminar sagen, was hier in der Gegend los war, im Frühjahr vor fünfundsechzig Jahren …«
»Anderes hast du nicht vom Starnberger See mitgebracht als diese abgelutschten zynischen Spruchbeuteleien?«
»Abgelutscht? Wenn Du zugehört hättest, Mädchen, was ein unbeachteter Hinterbänkler in der Akademie dort zur Lage der Bundeswehr in Afghanistan sich erlaubt hat zu bemerken« – Fausser hebt leicht die Stimme, als wollte er den Tonfall einer Parlamentsrede imitieren –, »dann wüsstest du immerhin, warum die Bundeswehr gezwungen war, amerikanische Kampfflugzeuge anzufordern! … Und zynisch! Weißt du, was dieses Unglück oder diese Katastrophe« – er deutet auf den Fernseher, der jetzt keine zerschossenen Lastwagen mehr, sondern nur noch einen seriösen schwarzen Kommentator zeigt – »für das politische Berlin heute vor allem bedeutet, welche Fragen es aufwirft, was also heute Morgen ganz vorrangig sein wird, auch in deiner Redaktion? Die vorrangige Frage wird sein, ob der Verteidigungsminister jetzt beschädigt ist oder nicht. Ob er, wenn er heute oder morgen an den Hindukusch fliegt und sich wohlriechend zwischen unsere Soldaten stellt und dabei fotografieren lässt – ob er damit in den Umfragen nicht womöglich mehr Punkte gutmacht, als selbst zweihundert tote Dörfler ihn kosten … Das ist es, was euch interessiert!« Er dreht sich zur Seite und will mit der Hand zwischen ihre Oberschenkel greifen. »Zynisch! Ehrlich ist nur …«
»Weg da!«, unterbricht sie ihn scharf und schiebt seine Hand weg. »Wann begreift so ein alter Macho endlich …?«
»Was sollen alte Machos begreifen? Und wieso im Gegensatz zu jungen? Wird es von denen nicht erwartet?«
»Dass es einen Zeitpunkt gibt, an dem sie nicht mehr gefragt sind. Das sollen sie begreifen.«
In eben dem Augenblick, als Miguel, die Arme aufgestützt, nach unten schaut, in das Gesicht der Frau unter ihm, das umrahmt ist vom Strahlenkranz der blonden, auf dem Leintuch ausgebreiteten Haare, in diesem Augenblick, als er sieht, wie die Blonde scharf durch den Mund atmet und die Oberlippe hochzieht und die Zähne freilegt, als wollte sie sie ihm in die Kehle schlagen, und er dabei dieses Ziehen in den Lenden spürt, die jetzt – gleich, sofort, beim nächsten Stoß – unaufhaltsam strömen und sich ergießen werden, in eben diesem Augenblick schlägt die Türglocke an. Das heißt, sie schlägt nicht an, sie ist auch nicht besonders laut, sie schnarrt eigentlich nur. Aber es ist ein Schnarren, das nun einmal in der Welt ist und in der Nacht.
Noch immer liegt das das Paar wie erstarrt, dann schlingt die Blonde ihre nackten weißen Beine um die seinen, hakt sich mit ihnen ein, umklammert ihn, hält ihm mit beiden Händen die Ohren zu, zieht seinen Kopf zu sich herunter, dass sie ihm ihre Zunge in den Mund stecken kann, er soll nichts hören und nichts reden, und weil er zu ficken aufgehört hat, ist jetzt sie es, die ihr Becken gegen seinen Schwanz drängt, in einem schnellen, fordernden Takt. Aber es ist verlorene Liebesmüh.
Miguel befreit sich von ihren Händen und richtet sich auf. »… Sorry, tut mir leid. Das ist wirklich Scheiße«, sagt er. »Aber ich muss wissen, was für eine.« Zögernd geben ihn die Beine frei, sein Schwanz glitscht aus dem Leib der Blonden, mühsam steht er auf, das Ding hängt nur noch, und mit ihm schrumpelt die Gummihaut des Kondoms, ein blödes Gefühl.
Er geht zur Tür des Appartements. Dort ist eine Sprechanlage.
»Was’n los?«
»Zlatan ist hier«, sagt eine flache, leere Stimme. Miguel erkennt sie zunächst nicht. Zlatan? Ja, doch. Die Aushilfe.
»Was willst du? Weißt du, wie viel Uhr es ist?«
Halblaut murmelt die Stimme etwas.
»Ich versteh dich nicht.«
»… bin überfallen worden«, kommt es aus der Sprechanlage.
»Bist du verletzt?«
»Nein, nicht verletzt. Aber es ist alles weg. Schlüssel. Geldbeutel. Kann ich …?«
»Nein«, sagt Miguel und wirft einen Blick auf die Bettcouch. Die Blonde liegt noch immer auf dem Rücken, mit angezogenen Knien, eine Hand zwischen den Beinen. »Kannst du nicht. Tut mir leid. Ich hab eine Frau hier.«
»Du musst entschuldigen …«, kommt die Antwort. »Wirklich. Aber kannst du mir vielleicht eine alte Jacke oder einen alten Pullover leihen? Und einen Zwanziger oder so?«
»Moment«, sagt Miguel seufzend und hängt den Hörer der Sprechanlage ein. In seinem Kleiderschrank findet er ein altes Sakko mit Fischgrätmuster auf den Ellbogen, das ist sowieso ein bisschen eng in der Taille, und auch einen Pullover, der aber keiner aus Cashmere ist. Weil nachts das Haus abgeschlossen ist, muss er den Bademantel überziehen und die Latschen und das Treppenhaus hinunter und nach draußen vor die Haustür, wo ein seltsam verstörter Mensch steht, Zlatan eben, seltsam war der schon immer, was hat er sich auch mit ihm bekannt machen müssen!
»Weißt du«, sagt Zlatan, »ich war schon fast zu Hause …«
»Ja«, unterbricht ihn Miguel, »erzähl es mir das nächste Mal! Hier …« Er drückt ihm das Bündel aus Sakko und Pullover in die Hände und holt den Fünfziger aus der Tasche seines Bademantels. Auf die Schnelle hat er keinen kleineren Schein gefunden. »Und das da. Aber Wiedersehen macht Freude!«
Als Miguel wieder oben in seinem Appartement im fünften Stock ist, hat die Blonde offenbar fertig. Jedenfalls hantiert sie nicht mehr zwischen ihren Beinen herum, sondern zieht sich gerade den Büstenhalter an.
»Ich will dich nicht aufhalten«, sagt sie. »Nicht bei den Dingen, die dir wirklich wichtig sind.«
»Hör zu …«, hebt Miguel an, lässt es dann aber bleiben und trottet ins Bad, damit er endlich dieses blöde eingerollte Ding von seinem Schwanz entfernen kann.
Fausser, noch einmal eingeschlafen, träumt von einer Hochebene, von Gestrüpp bestanden, und während er aufwacht, weiß er, dass die Hochebene die Brachwiese oberhalb der Siedlung meint, in der er aufgewachsen ist, und zugleich weiß er auch, dass hinter diesem Traumbild ein anderes verborgen ist, vielleicht sind Traumbilder wie russische Puppen, das eine enthält das andere, nur dass sich als Letztes ein winziges wimmerndes Kind findet …
Bist du damit gemeint?, fragt er sich und ist plötzlich hellwach. Aus dem Badezimmer dringt anhaltendes Brausen, offenbar müssen alle Anhaftungen und Erinnerungen an die Nacht abgespült werden, ein dermatologischer Unfug! … Er greift sich die Fernbedienung und sucht einen Radiosender. Merkwürdigerweise hätte er jetzt Lust auf klassische – nein: auf sakrale Musik, auf die Beschwörung aller Menschen Sünden und auf ihre Vergebung, auf irgendein Stück mathematisch-göttlicher Klarheit, am besten von Johann Sebastian …
»… noch immer läuft der Verkehr in und rund um Berlin reibungslos«, sagt eine Alt-Stimme, die für einen Alt eine Spur zu munter ist, »wie geschmiert also, dachte ich mir’s doch, ihr Süßen, aber so wird es nicht bleiben, die Bauarbeiten gehen ungebrochen weiter, die Karl-Marx-Allee ist auf jeweils einen Fahrstreifen verengt, ebenso die Torstraße bis zum Prenzlauer Tor …«
Fausser hat den Kopf aufs Kissen sinken lassen, plötzlich ist wieder die Müdigkeit da, sie ist so groß, dass er nicht einmal Lust hat, den nächsten Sender zu suchen, alles ist zu viel und alles ist vergeblich, er blickt zur Decke, und ihm ist, als gerate sie in Bewegung und entschwinde.
»… und dann bittet die Polizei noch um Hinweise – jetzt nicht weghören, es ist diesmal wirklich wichtig – die Polizei also bittet um Hinweise zu einem tödlichen Verkehrsunfall, bei dem gegen ein Uhr dreißig in der Kleinen Rosenthaler Straße in Berlin-Mitte ein dreiundzwanzigjähriger Mann ums Leben kam. Gesucht wird in diesem Zusammenhang der Fahrer eines dunklen Geländewagens, das Fahrzeug müsste an der linken Seite Beschädigungen, Streifspuren aufweisen …«
Nun rafft er sich doch auf und drückt die Aus-Taste, wie schön, dass es still ist, für einen Augenblick schließt er die Augen, ist er nun doch noch einmal eingeschlafen?
»Frühstückst du mit mir, oder willst du nochmal in dein Appartement?« Wieder die klare wache Stimme, Fausser taucht aus der Tiefe seines Sekundenschlafes auf, Solveig steht vor ihm, im Bademantel, die Haare frisch gewaschen und mit einem Handtuch eingebunden.
»Gern«, sagt Fausser, »mit dir frühstücke ich sogar sehr gern …«
»Wirklich?« Jetzt klingt die Stimme nicht nur wach und klar, sondern auch ein wenig kühl. »Sonst willst du morgens doch immer mit deiner Frau telefonieren.«
An diesem Morgen liegt ein Geruch in der Luft, als werde es nun doch Frühling, und dass einmal Winter war, sieht man nur noch am Splitt, der auf den Straßen und Gehsteigen zurückgeblieben ist. Ein Mann im offenen anthrazitgrauen Lodenmantel, den breitkrempigen schwarzen Hut in den Nacken geschoben, bleibt vor einer leeren Bierdose stehen und betrachtet sie und betrachtet den Bauschuttcontainer, der ein paar Schritte weiter aufgestellt ist, und sieht sich um, ob ihm wohl einer zusieht, wenn er die Dose mit dem Innenrist … Doch dann fällt ihm ein, dass in der Dose womöglich noch ein versiffter Rest Bier sein wird, der ihm dann den Schuh versaut. Und das eine Knie nutzt noch immer jede Gelegenheit, um übel zu nehmen. Seit wie vielen Jahren ist das nun schon so?
Der Mann mag nicht darüber nachdenken und geht weiter, vorbei an einer Baustelle. Die Wohnblocks um ihn herum treten zurück und lassen Platz für einen von Mauern umgebenen Park, den alten Garnisonfriedhof, überragt von Baumkronen, deren Blätter über Nacht aus den Knospen aufgebrochen sind wie lindgrüne Fontänen.
Vor dem Backsteinhaus gegenüber dem Park, das seit Wochen eingerüstet ist, will der Mann die Straße überqueren, bleibt aber unvermittelt stehen. Auf dem Pflaster vor ihm sind auf einzelnen Steinen weiße, kaum verwischte Kreidestriche zu erkennen, und der Mann ertappt sich dabei, wie er den Kopf schräg legt, um ein Muster in den Markierungen zu erkennen. Er zögert kurz, dann tritt er auf die Fahrbahn und folgt den Zeichen, es sind Pfeile, die auf den Gehsteig gegenüber weisen, zur Friedhofsmauer hin, deren graubrauner Verputz an einigen Stellen aufgerissen scheint, als sei ein Gefährt daran entlang geschrammt, auch diese Stellen sind mit Kreide bezeichnet … Die Pfeile weisen weiter, zurück auf die Fahrbahn, bis zu einem über mehrere Steine gezogenen Kreidestrich, der auf eine Unterbrechung oder – genauer – auf eine Kollision schließen lässt. Er betrachtet den Strich, dann geht er weiter, zu den mehr oder weniger angedeuteten Umrissen, die die eines Menschen sein könnten, den man dort auf der Fahrbahn gefunden hat. Schließlich bückt er sich und entdeckt – ohne große Überraschung – auf dem Pflaster und in den Fugen dazwischen die dunkel verfärbten und angetrockneten Reste einer Flüssigkeit.
»Gestern Nacht war das«, sagt eine Stimme.
Der Mann blickt auf. Die Stimme – hell, kurz vor dem Stimmbruch – gehört einem Jungen, der auf dem Gehsteig steht und ihm zusieht.
»Ich hab es gehört«, fährt der Junge fort. »Den Motor hab ich gehört. Wie er hochdreht. Und das Kreischen.«
»Das Kreischen?« Der Mann blickt zweifelnd.
»Ja doch«, versichert der Junge. »Als das Auto die Mauer entlang ist. Aber dann ist es zurück auf die Straße und hat den Mann erwischt. Ich hab den Schlag gehört.« Der Junge deutet auf die Gestalt, deren Umrisse auf der Fahrbahn skizziert sind. »Den da hat es erwischt …«
»Und wann hast du das alles gehört?«
»Hab nicht auf die Uhr gesehen«, kommt die Antwort, plötzlich abweisend.
»Schon recht«, meint der Mann und geht entlang der Markierungen zurück, langsam, als habe er beim ersten Mal etwas übersehen. An der Friedhofsmauer bleibt er stehen, bückt sich und mustert den beschädigten Verputz.
»Es muss ein Geländewagen gewesen sein«, meint der Junge, der ihm gefolgt ist.
»Erklärst du mir, warum?« Der Mann hat sich wieder aufgerichtet und wendet sich ihm zu.
»Wegen der Höhe«, meint der Junge. »Er muss die Mauer mit dem Kotflügel gestreift haben, aber bei einem normalen Auto müssten die Spuren tiefer sein. Und ein Lastwagen war es nicht, das hätt ich gehört. Also war’s ein Geländewagen.«
Der Mann nickte. »Das hast du sauber hergeleitet. Respekt. Aber eine Frage: Der Motor hat hochgedreht – das hast du doch gesagt?«
»Sicher hab ich das«, kam die Antwort. »War doch auch so.«
»Und gebremst hat er nicht?«
»Nein, hat er nicht. Kein bisschen.«
»Stand der denn irgendwo und ist dann losgefahren, und der Fahrer hat dabei aufs Gas gedrückt, oder kam er die Straße runter?« Wieder blickt er auf den Jungen: eher 14 als 15 Jahre alt, schmales Gesicht, Jeans und Anorak speckig, Turnschuhe, schon abgetreten, lange blonde Haare, schon länger nicht gewaschen, die rechte Hand in einem schmuddeligen, nicht mehr ganz festen Verband … Kaum halbwüchsig, ein Kind also, und wenn es ein Kind ist, warum ist es an diesem Montag, kurz vor zehn Uhr, nicht in der Schule? - Der Verband! Mit einer verbundenen rechten Hand kann man keine Hausaufgaben machen, natürlich nicht, und erst recht keine Klassenarbeiten schreiben …
»Weiß ich nicht«, antwortet der Junge, und wieder klingt seine Stimme unvermittelt ganz abweisend, als sei ihm der musternde Blick des Mannes nicht entgangen. »War ja nicht dabei. Hab nur was gehört.« Dann dreht er sich um, schlüpft durch die Pforte des Friedhofparks und ist auch schon weg.
André sieht sich kurz um, aber der Mann ist ihm nicht gefolgt. Trotzdem ärgert er sich. Was hat er mit ihm zu reden gehabt? Niemand muss wissen, dass er hier wohnt. Niemand muss wissen, was er gesehen oder gehört hat. Es ist dumm von ihm gewesen, ganz einfach dumm … Dumm! Dumm! Dumm! Plötzlich beginnt er zu rennen, an den eingezäunten Gräbern und steinernen Kreuzen vorbei, hinüber zur Friedhofskapelle und der kleinen Pforte dahinter, hinaus auf die Straße und weiter bis zur Anlage vor der Schule, wo die Eltern Geld zahlen, damit ihre Kinder hinein dürfen, viel Geld sogar! Dann zwingt er sich, wieder zu gehen, so, wie er sonst auch geht, nicht zu schnell und nicht zu langsam, am Verband hat sich das lose Ende wieder gelöst, er wickelt es um das Handgelenk und zieht es fest. An der Buchhandlung mit den Comics im Schaufenster bleibt er nicht stehen – das hebt er sich für den Rückweg auf –, sondern wirft nur einen Blick aus den Augenwinkeln hinein, aber was er sieht, sind nur Sachen für die Kleinen.
Am Kiosk vor der U-Bahn-Station hat ein Mann eine der Zeitungen mit den großen Schlagzeilen gekauft und ist noch vor dem Kiosk stehen geblieben, um zu lesen, vielleicht will er im Innern Fußballergebnisse gucken oder die Lottozahlen. André wirft einen Blick auf die Titelseite oder anders: die Titelseite zieht seinen Blick an, er kann gar nicht anders als hinsehen, der Kopf einer Frau ist dort abgebildet, für einen Augenblick pocht ihm das Herz bis zum Hals, dann sieht er, dass es nicht jenes eine Foto ist, vor dem er Angst hat, die ganze Zeit schon …
Er steigt die Treppe zur U-Bahn hinunter. Wie immer stinkt es dort nach Pisse, und vorsichtig macht er einen Bogen um eine Lache Erbrochenes. Vor dem Fahrkartenautomat verlangsamt er seinen Schritt und greift tastend in den Ausgabeschacht, aber niemand hat das Wechselgeld vergessen. Auf der Plakatwand gegenüber dem Bahnsteig räkelt sich eine Blonde in ihrem Bikini am Strand vor einem Meer, das blau und grün schimmert, und über dem Strand sind Berge, schneebedeckt: Dalmatien soll das sein … Er ist einmal dort gewesen, noch bevor er in die Schule gekommen ist, im Restaurant hat es immer Fisch gegeben oder Hackfleisch, und später ist er in einen Seeigel getreten. Die Blonde auf dem Plakat hat eine ganz und gar braune Haut und keinen Sonnenbrand wie die Elke damals, und auch keine Spur vom hellen Sand auf den Oberschenkeln oder an den Knien, obwohl sie doch mitten am Strand hockt, das eine Bein ausgestreckt und das andere angewinkelt …
Weiter vorn auf einer Bank sitzt eine alte Frau, ihre Handtasche vor sich wie ein Schoßtier, und weiter hinten stehen zwei oder drei Männer, vielleicht Polen oder Russen, hoffentlich hat keiner gesehen, wie er das Plakat mit der Blonden angestarrt hat. Die U-Bahn kommt, die Wagen sind fast leer, er steigt ein und bleibt an der Wagentüre stehen. Als der Zug Fahrt aufnimmt und in den dunklen Tunnel eintaucht, sieht er sein Spiegelbild im Fenster der Türe gegenüber, rasch wendet er den Blick ab. Einmal hat er einen Comic gesehen über einen Jungen im Krieg, die Stadt brannte, und die Menschen flohen in die Tunnels der U-Bahn, aber dann wurden die Tunnels geflutet, und nur der Junge kannte den richtigen Weg hinaus …
Die Alte hat sich auf einem Sitzplatz am Fenster niedergelassen, noch immer die Tasche auf dem Schoß, die Tasche ist prall von weiß der Teufel was für einem Zeug, vorne ist eine Seitentasche, auch sie ist ausgebeult, da muss das Portemonnaie drin sein, ein dickes vollgestopftes Portemonnaie, ganz bestimmt, aber da ist nur im dichten Gedränge etwas zu machen, und auch dann hätte er nicht die Nerven. Nicht für so etwas. Er blickt sich im Wagen um, und erst jetzt sieht er, dass die Polen – die mit ihm und der Alten eingestiegen sind – ihm zugesehen haben, wie er die Tasche der Alten mustert, und der eine von den Männern kneift das eine Auge zu und hebt warnend den Zeigefinger … Der Zug wird langsamer, die Bremsen beginnen zu greifen, vor dem Fenster wird es hell, und der Junge drückt hastig auf den Türöffner, der Zug kommt zum Halten, fauchend öffnet die Hydraulik die Tür, André springt nach draußen, so eilig, dass er beinahe mit einem älteren Herrn zusammenstößt.
»Warum so eilig, junger Mann? Du hast doch noch alle Zeit der Welt!«
»Entschuldigung«, bringt André heraus und läuft weiter.
Der Mann in dem anthrazitgrauen Lodenmantel geht die Friedhofsmauer entlang und biegt dann nach links ab, in eine Straße mit kleinen Restaurants und einzelnen Läden, bis er zu einem schmalen Haus mit einer schmutziggelben Fassade kommt, durch die sich frische Risse ziehen. Neben dem Klingelbrett ist ein Messingschild mit der Aufschrift: »Hans Berndorf, Ermittlungen« angebracht, an dem – schon vor einigen Monaten – irgendjemand Anstoß genommen und es mit roter Farbe übersprüht hat. Inzwischen ist es gereinigt worden, aber noch immer haften Farbreste an den Rändern und Zwischenräumen der Buchstaben.
Der Mann tritt ein, geht ins Hochparterre und schließt die Tür zu dem Büro auf, das er vor zwei Jahren von einem in Konkurs gegangenen Versicherungsmakler übernommen hat. Er zieht seinen Mantel aus und hängt ihn in den Garderobenschrank im Flur, geht dann durch die beiden Räume – von denen der eine als Wartezimmer dient und der andere als Büro – und öffnet überall die Fenster, um für Durchzug und frische Luft zu sorgen. Einen Augenblick lang verharrt er hinter seinem Schreibtisch, denn dort hängt die gerahmte Fotografie eines hohen Kirchturms, und sie hängt schief. Er rückt sie gerade, das ist er dem Ulmer Münster schuldig. Wie oft hat ihn sein Weg daran vorbeigeführt, in jenem früheren Leben, als er Kriminalbeamter war im Neuen Bau zu Ulm an der Donau? Vorbei! In der winzigen Küche füllt er den Wasserkocher und stellt ihn an, weil er sich eine Kanne Tee aufgießen will, dann schaltet er das kleine Transistor-Radio ein, das auf dem Küchenregal steht. Die Nachrichten haben schon begonnen, in der Regierung streitet man sich. Worüber? Der Nachrichtensprecher kündigt ein Interview mit der Fraktionsvorsitzenden der kleineren, der kleinfeinen Regierungspartei an, und Berndorf stellt den Ton ab.
Während der Tee zieht, blättert er die ersten der beiden Zeitungen durch, die er mitgebracht hat, und zwar zuerst das Berliner Blatt – jenes, das von den Berliner Blättern das am wenigsten unlesbare ist –, am Hindukusch hat es Tote gegeben, mehr als sonst, auffällig mehr, weshalb, warum? Er müsste es nachlesen, jeder anständige Mensch müsste wissen wollen, warum so etwas geschehen kann und sich nicht hat vermeiden lassen. Aber gerade darum hat er keine Lust, nur weil er eine Zeitung gekauft hat, will er sich nicht entrüsten müssen, nicht so, als hätte er eine Schachtel Zigaretten gekauft und müsse sich jetzt eine davon anzünden … Von einem Unfall beim Alten Garnisonfriedhof steht nichts drin, natürlich nicht, es muss ja spät in der Nacht gewesen sein, so hat der Junge es behauptet. Sein Blick fällt auf das Foto einer Kirchenruine, das gut erhaltene gotische Chorgewölbe hebt sich malerisch gegen den Himmel ab, es ist die Ruine der Franziskanerkirche, zwölftes oder 13. Jahrhundert, und sie steht nicht tief und von der Zeit vergessen in einem brandenburgischen Wald, sondern mitten in Berlin, nah beim Alex, und irgendwelche Nonnen haben dem Magistrat angeboten, die Ruine – unter Wahrung aller denkmalpflegerischen Kriterien, wie es in der Zeitung heißt – zu einer Begegnungsstätte auszubauen, und zwar für alle, die in der Stille Gott suchen …
Stille? Gott suchen? Das wird dem Magistrat aber ein böhmisches Dorf sein, das eine wie das andere, denkt Berndorf, faltet die Zeitung wieder zusammen, nimmt den Einsatz mit dem Teefilter aus der Kanne und schenkt sich ein. In der Deutschland-Ausgabe der Münchner Zeitung steht noch nichts von dem Fliegerangriff auf die Tanklastwagen, aber er findet – weil er danach gesucht hat – einen Hintergrundbericht über eine Tagung am Starnberger See, und tatsächlich kommt ein bestimmter Name darin vor:
So vertrat die Berliner Politologin Barbara Stein die Ansicht, die eigentliche Gefahr der in Afghanistan ganz selbstverständlichen Korruption bestehe in den Kickback-Provisionen, also darin, dass die Empfänger von Schmiergeld schon aus Gründen der Vertragssicherheit – und um das Gesicht zu wahren – Wert darauf legten, dass auch ihre Verhandlungspartner sich bereicherten. So sei Afghanistan unter den Augen der NATO zu einem Hauptexporteur nicht nur von Heroin, sondern auch von Regierungskriminalität geworden …
Berndorf liest es, und trinkt – die Augenbrauen skeptisch hochgezogen – einen Schluck Tee. Als er die Tasse absetzt, klingelt es.
Berndorf zögert. Der Hausmeister? Die Post kommt später. Er geht zur Tür und öffnet, vor ihm steht ein grauhaariger bärtiger Mann in einem ausgebeulten dunklen Anzug, es ist der türkische Änderungsschneider, der zwei Häuser weiter seine Werkstatt hat und der Berndorf erst vor Kurzem ein altes Tweedsakko aufgearbeitet und an den Ellbogen mit Lederflecken versehen hat. Aydin. Kemal Aydin.
Berndorf bittet den Besucher herein und geleitet ihn am Wartezimmer vorbei in sein Büro. Der Besucher – eine Plastiktüte in der Hand – sieht sich kurz um, während Berndorf das Fenster schließt. Viel gibt es nicht zu sehen: an der einen Wand ein Bücherregal aus Fichtenholz mit einer Reihe Aktenordner, einem Stapel Fachzeitschriften und den gängigen, in rotes Plastik gebundenen Gesetzessammlungen, an der anderen Wand ein Rollschrank, der verschlossen ist und sich auch gar nicht öffnen ließe. Das gerahmte Foto, das schon wieder schief hängt. Der Besucher wartet, bis er aufgefordert wird, Platz zu nehmen, dann setzt er sich bedächtig auf den Besucherstuhl vor dem altmodischen Eichenholz-Schreibtisch, den Berndorf für einen Fünfziger aus einem Nachlass ersteigert hat. Auch Berndorf nimmt Platz, zieht einen Schreibblock aus der Seitenschublade und legt ihn mitsamt seinem Füller in Griffweite. Dann wendet er sich – beide Hände offen auf den Schreibtisch gelegt – seinem Besucher zu und sieht ihm ins Gesicht, das übernächtigt ist und in dessen dunklen Augen Zorn und Trauer liegen.
»Ich hätte gern«, sagt Berndorf, »dass das ein guter Morgen ist. Aber ich weiß es nicht.«
»Guter Morgen, schlechter Morgen … das liegt nicht in unserer Hand«, antwortet der Besucher. »Trotzdem. Mein Neffe …« Er spricht den Satz nicht zu Ende, sondern greift in seine Plastiktüte und holt ein großformatiges Foto hervor und reicht es Berndorf. Der nimmt es, das Portrait eines schwarzlockigen jungen Mannes mit feurigen Augen und einem weichen Gesicht, dem die sorgfältige Retusche auch nicht einen einzigen Pickel gelassen hat und das von einem schmalen, sorgfältig gestutzten Kinnbart eingerahmt ist. Berndorf dreht die Aufnahme um und sieht sich den Stempel des Fotografen an, es ist einer aus dem Viertel, er kennt das Atelier, es liegt zwei Straßen weiter.
»Ein gut aussehender junger Mann«, sagt er.
»Er ist tot«, kommt die Antwort. »Sie haben ihn umgebracht. Gestern Nacht …« Mit einer müden Geste hebt Kemal Aydin die Hand und zeigt zur Seite. »Mit dem Auto haben sie es getan. In der Straße da hinten …«
Er legt die geballte, blau geäderte Faust auf den Tisch und stößt sie über die Platte, als sei etwas darauf geschrieben, das mit der bloßen Hand ausradiert werden müsste.
»So haben sie es gemacht«, sagte er. »Als wäre er ein Hund. Und er ist gestorben, und niemand war bei ihm.«
Berndorf hält noch immer das Foto in der Hand. Schließlich lässt er es sinken und blickt zu dem Besucher auf.
»Haben Sie kein anderes Bild von ihm?«, hört er sich fragen. »Eines von denen, die der Fotograf nicht ins Schaufenster stellt?«
Nichts passiert«, sagt Christian Fausser und steigt in die U-Bahn ein. Ein paar Stationen nur, dann wird er die millionenteure Parlaments-Metro nehmen, die man eigens durch den Schutt der Vergangenheit gegraben hat, und weil es nicht weit ist, will er eigentlich stehen bleiben, aber dann ist da doch ein freier Platz, und er setzt sich.
Was hast du zu dem Jungen gesagt? Du hast doch noch alle Zeit der Welt … Woher willst du das wissen? Niemand hat alle Zeit der Welt. Die Menschen am allerwenigsten. Immer weniger Zeit haben sie, und bald gar keine mehr.
»Unsinn!«, murmelt er tonlos, und holt aus der Seitentasche seines Koffers die Zeitung, die er am Kiosk gekauft hat, und schlägt sie auf – noch kein Foto von ausgebrannten Tankwagen und verkohlten Menschenleibern. Er überfliegt die Zeitung, der Leitartikel handelt vom Streit in der Regierung – ach! was für eine Neuigkeit … Mit der ganzen Inbrunst ihrer Tintenherzen haben sie diese Regierung herbeigeschrieben, und nun ist es ihnen auch wieder nicht recht. Gleichgültig, als erwarte er sich nichts davon, blättert er weiter, immerhin findet er einen Hintergrundbericht über die Tagung am Starnberger See (Überschrift: »Reden über Föhn, Kopfweh und ein bisschen Frieden«) und einen Absatz darin, der ihn betrifft:
In der anschließenden, sehr gereizten Diskussion über die doch etwas pauschale Behauptung, das gesamte Afghanistan-Abenteuer sei von Korruption durchtränkt, sorgte der Stuttgarter Bundestagsabgeordnete Christian Fausser für zusätzliche Irritation. Die Ausrüstung der Bundeswehr richte sich inzwischen nicht mehr so sehr nach militärischen Anforderungen, sondern nach den Vorgaben und Interessen der Rüstungsindustrie, insbesondere von EuroStrat, wie das Beispiel der für den Hindukusch-Einsatz vorgesehenen Kampfhubschrauber zeige. Auf den Einwand, die Bundeswehr habe in Afghanistan gar keine Kampfhubschrauber im Einsatz, antwortete Fausser nur: »Eben.«
Fausser nickt kurz. Vielleicht kommt es ja an die richtige Adresse. Er faltet die Zeitung zusammen und steckt sie wieder in die Seitentasche seines Aktenkoffers, den er neben sich auf den Sitz gestellt hat. Für einen Moment lehnt er sich zurück und hält die Augen geschlossen, ihm ist, als sollte er hier einfach sitzen bleiben, zurückgelehnt, schweigend, bis zur Endstation, vielleicht gibt es dort ein Schließfach, er würde den Aktenkoffer darin verstauen und dann durch Kiefernwälder gehen, sich irgendwann in ein Ausflugslokal setzen, einen Kaffee bestellen und einen Kognak dazu, dass man den Kaffee ertragen kann, mit Blick auf eine Waldlichtung, später würden vielleicht Wildschweine auftauchen, von denen es angeblich so viele gibt, und ihm Gesellschaft leisten …
Er spürt eine Bewegung und blickt auf. Ein Mann, Lederjacke, mit Schafpelzkragen, hat sich auf dem Gang neben ihn geschoben, als wolle er bei der nächsten Station aussteigen, dahinter – mit ein wenig Abstand – ein zweiter Kerl. Mit einer langsamen, bedächtigen und doch nachdrücklichen Bewegung legt Fausser seine linke Hand auf den Aktenkoffer und sucht den Augenkontakt zu den beiden Männern, doch sie vermeiden den Blick. Dann wird der Zug langsamer und hält, und beide steigen aus.
Auch das ist das Volk, denkt Fausser. Und: Das nächste Mal nehmen wir vielleicht doch die Fahrbereitschaft, die Fahrer machen sich schon längst keinen Kopf mehr darüber, wen sie warum wo abholen müssen.
Zwei Stationen weiter steigt Fausser aus und geht zu der Rolltreppe, die ihn zu der neuen Linie bringen soll, der Kanzler-U-Bahn, aber kurz vor der Rolltreppe stößt ihm jemand einen schweren abgegriffenen Koffer gegen die Beine. Erschrocken fährt er zurück und macht einen Schritt zur Seite, vor ihm steht eine kleine, dicke, schwarz gekleidete Frau und starrt suchend und empört durch halbkugelförmige Brillengläser um sich, es ist ihm nicht klar, ob sie ihn überhaupt sieht. Außer dem abgegriffenen Koffer schleppt sie eine ausgebeulte Ledertasche und ein zusammengerolltes Plaid mit sich.
Die Brillengläser haben sich auf Fausser fokussiert. »Können Sie nicht aufpassen? Sehen Sie nicht, was ich alles schleppen muss? Ich muss nämlich zum Busbahnhof, ganz dringend, ein Trauerfall …«
Fausser hofft, dass sich nicht im Koffer befinden möge, was beerdigt werden muss. Laut sagt er, dass die Dame sich irrt. »Wenn Sie zum Busbahnhof wollen, sind Sie hier falsch. Sie müssen die S-Bahn nehmen.«
»Oh Gott!«, schreit die Frau und stellt den Koffer ab und greift sich an die Brust, »was mach ich nur! Mein Onkel … gestern Abend kam das Telegramm …«
»Mein Beileid«, sagt Fausser und sieht sich um, aber nicht einen sieht er, der so aussieht, als würde er für einen Fünfer einen kleinen Gefallen übernehmen. »Ich bring Sie mal eben zum richtigen Bahnsteig, wenn Sie wollen, können Sie mir Ihren Koffer geben …«
Die Augen hinter den Halbkugeln mustern ihn oder versuchen es vielmehr. »Wenn Sie meinen …!«, kommt schließlich eine Antwort. »Aber geben Sie Acht, dass Sie nirgends damit anstoßen, er ist nicht mehr der Jüngste. Das ist wie mit meinem Onkel, der hat auch keinen Stups mehr ausgehalten, der alte geizige Bock!«
Als Fausser feststellt, dass man das Möbelstück von einem Koffer nur tragen und nicht ziehen kann, ist es bereits zu spät.
Das kleine Büro ist keineswegs überheizt, noch nicht einmal richtig warm, aber Jonas Regulski sitzt gleichwohl in Hemdsärmeln hinter seinem Schreibtisch, ein untersetzter breitschultriger bebrillter Mann mit nach hinten gekämmtem aschblondem Haar, das olivfarbene Hemd der Polizei-Uniform spannt an den Schultern. Er hält die Visitenkarte in der Hand, die der Besucher ihm überreicht hat, und nimmt sich alle Zeit der Welt, den Namen und die Anschrift darauf in die Kladde mit seinen Notizen zu übertragen.
Der Besucher, die Augenbrauen ganz leicht angehoben, hat es aufgegeben, ihm dabei zuzusehen. Er betrachtet den Spruch, der an die Wand hinter Regulski gepinnt ist:
Wer glaubt,
ein Dienststellenleiter
leitet eine Dienststelle,
der glaubt auch,
ein Zitronenfalter
faltet Zitronen.
Der Besucher erinnert sich, den Spruch schon einmal gelesen zu haben. Mindestens einmal. Wenn er sich nicht sehr irrt, war es am Schwarzen Brett der Führungsakademie der Polizei in Münster-Hiltrup gewesen.
Regulski hat notiert, was er notieren wollte, und reicht dem Besucher die Karte zurück. Der Blick, den er ihm dabei über die Brille hinweg zuwirft, ist eher gleichgültig. Dass er den Besucher nicht für jemanden ansieht, mit dem man Visitenkarten tauscht, hat er bereits klargestellt. Dann beugt er sich wieder über seine Kladde:
»Berndorf, Hans – der Name sagt mir nichts. Seit wann sind Sie hier tätig?«
Er habe sein Büro vor zwei Jahren eröffnet, kommt die Antwort.
»Was haben Sie davor gemacht?«
»Ruhestand.«
»Haben Sie auch einmal gearbeitet?«
Wieder hebt Berndorf die Augenbrauen, ganz leicht, um anzudeuten, dass er verstanden hat: Seine jetzige Tätigkeit ist nach Regulskis Ansicht nichts, was man Arbeit nennen könnte.
»Ich war Polizeibeamter.«
»Wo?«
»Ulm/Donau.«
Regulski runzelt die Stirn, trägt wieder etwas in seine Kladde ein, betrachtet, was er sich notiert hat, und blickt auf. »Kripo?« In der knappen Frage schwingt ein Unterton mit, dem der Besucher – wenn er es nicht schon wüsste – mühelos hätte entnehmen können, dass Regulski der uniformierten Polizei angehört.
»Ja.«
»Und?« Regulski hat sich zurückgelehnt, die Arme vor der Brust verschränkt, und betrachtet sein Gegenüber.
Fragend gibt Berndorf den Blick zurück und antwortet nichts.
»Was führt Sie zu mir?«
»Murad Aydin ist heute Nacht bei einem Verkehrsunfall getötet worden. Die Familie hat mich beauftragt herauszufinden, ob es sich wirklich um einen Unfall gehandelt hat.«
»Noch einmal: Warum kommen Sie zu mir?«, fragt Regulski. »Wenn die Familie Aydin der Ansicht ist, die Berliner Polizei verstünde ihre Arbeit nicht, wohl aber Sie –, dann gehen Sie hin und finden heraus, was Sie herausfinden sollen, aber fragen Sie uns nicht!«
»Können Sie denn ausschließen, dass es kein Unfall war?«
»Was ist denn das für eine Frage!«, ruft Regulski und schiebt die Brille zurück, die ihm auf die Nasenspitze gerutscht ist. »Von hinten durch die Brust! Meister, wir suchen den Fahrer, und wenn wir den haben, werden wir ihm ein paar Fragen stellen, und dann wissen wir es vielleicht … Aber dort, wo Sie her sind, macht man das vielleicht anders, da legt man vielleicht erst fest, was man in den Abschlussbericht schreiben wird, und dann sucht man sich den passenden Ganef dazu … Wie kommen Sie überhaupt darauf, dass dieser Unfall noch etwas anderes war? Wenn Sie oder wenn diese Familie Aydin mehr weiß, dann wäre es vielleicht angezeigt, uns das mitzuteilen …«
»Es gibt Leute«, sagt Berndorf, »die verreißen das Steuer und schrammen an einer Mauer entlang, nur, um einer Katze auszuweichen. Und dann kommt die Katze trotzdem unter die Räder. Und wieder andere Leute, die verziehen das Steuer extra, damit sie das arme Vieh auch richtig erwischen, und dass die Kotflügel sich an der Mauer eine Schramme einfangen, das ist ihnen schon deshalb ziemlich egal, weil das Auto ein gestohlenes ist.«
Wieder zieht Regulski die Augenbrauen zusammen. »Woher sagten Sie, dass Sie kommen, Meister?« Er wirft einen Blick in seine Kladde. »Aus Ulm, na gut. Hat einen hohen Turm, hab ich mir sagen lassen. Aber die Uhr daran, die ist wohl stehen geblieben, was?« Er beugt sich vor und mustert Berndorf über die Brillengläser hinweg. »Eigentlich hab ich keine Zeit, nicht die Bohne. Aber bevor Sie hier im Kiez herumlaufen und die Leute kopfscheu machen, sprechen wir uns vielleicht doch besser ab … Offenbar haben Sie sich diese Lackspuren an der Mauer angesehen. Was haben Sie daraus entnommen?«
»Hochgelegtes Chassis, schwarz-metallic lackiert.«
»Ein Landrover, schwarz-metallic, ja doch«, bestätigt Regulski. »Mit Bullenfänger, vermute ich mal. Jedenfalls sieht es mir ganz danach aus, so, wie es den Toten erwischt hat. Im Übrigen genau die Edelkutsche, mit der sonst Zahnarzts Gattin ihren Sprössling in den Kindergarten bringt. Teures Gerät, die Gattin will ja nicht für eine MTA gehalten werden.«
Berndorf versteht. Zahnarzts Landrover wird nicht so einfach geklaut. Zahnarzts Landrover verfügt über eine elektronische Wegfahrsperre und steht auch nicht irgendwo in Kreuzberg auf der Straße herum. Wer sich ein solches Teil unter den Nagel reißen will, braucht die Schlüssel, sowohl die fürs Auto als auch die für die Garage. Gewiss, das kann man sich alles besorgen. Wenn man den Bohrer richtig ansetzt, gibt auch der Zahnarzt die Schlüssel gerne her. Nur bleibt das selten unbemerkt.
»Also ist kein solcher Wagen als gestohlen gemeldet?«
»Aktuell nicht«, bestätigt Regulski. »Car-Jacking hat sich hier noch nicht so eingebürgert. Aber was anderes – was wissen Sie über den Toten?«
Berndorf zuckt mit den Schultern. »Nichts, genau gesehen. Gearbeitet hat er nichts. Sonst war aus dem Onkel nur herauszubringen, dass er schlechte Freunde gehabt hat.«
»Er war ein Eierdieb«, wirft Regulski ein. »Ein Kleinkrimineller am Beginn einer viel versprechenden Kleinkriminellen-Karriere. Dem einen oder anderen hat er wohl auch schon mit einem Messer vor dem Gesicht herumgefuchtelt. Bleibenden Eindruck hat er im Kiez damit aber nicht hinterlassen. Und künftig …« Energisch schiebt er die Brille wieder an ihren Platz. »Verstehen Sie, worauf ich hinauswill?«
Fausser, endlich wieder allein und ohne den verfluchten Koffer, dessen Gewicht er noch immer in der Schulter spürt, lässt sich mit dem Fahrstuhl zum Bahnsteig der Kanzler-U-Bahn bringen. Wohin es die Halbblinde wohl verschlagen würde? Sie hatte ihm noch gesagt, sie wolle nach Frankfurt – nach Frankfurt am Main wohlgemerkt! – und es müsse einen Bus dorthin geben, mit dem Zug fahre sie nicht, das sei viel zu teuer, zumal der alte geile, geizige Bock ihr ohnehin nichts hinterlassen haben werde …
Der Zug wartet bereits, nur wenige Passagiere steigen ein, die meisten sind erkennbar Touristen. Männer in Lederjacken, die mit Schaffell gefüttert sind, sieht er jedenfalls nicht. Hier ist kein Revier für sie – zu viel Uniformierte überall, zu viel Überwachung, zu viel postmoderne Prachtbauten und zu viel leere weite kahle Fläche drum herum … Diesmal ist er neben der Tür stehen geblieben, gleich darauf ist er auch schon da und steigt aus, geht die Treppe hoch und bleibt oben wieder stehen, die Hand am Geländer des U-Bahn-Schachts, und schöpft Atem. Hoch über ihm bläht ein Windstoß die rote Fahne mit dem weißen Kreuz. Jeden Morgen flattert sie da im Wind, sofern einer weht, Fahnen haben das so an sich …
»Was hast du?« Ein großer kräftiger Mann mit buschigen Augenbrauen und einem geröteten Gesicht tritt neben ihn, Fausser atmet durch und löst die Hand vom Geländer, so dass die beiden Männer einen Handschlag tauschen können. Frieder Vochazer gehört der Staatspartei an, aber da sie beide Mitglieder des Haushaltsausschusses sind, duzen sie sich, seit langer Zeit schon …
»Dieser Kasten da …«, sagt Fausser und weist auf die Schweizer Botschaft, die in selbstverständlicher Bedächtigkeit und mit recht wenig Abstand neben dem Kanzleramt hockt wie der Igel im Märchen vom Wettrennen mit dem Hasen, »ausgerechnet das ist das einzige Gebäude hier, das so etwas wie eine Geschichte hat.«
»Ein Relikt«, meint Vochazer und wirft ihm einen prüfenden Blick zu. »Warum fällt dir das jetzt auf? Der Kasten ist schon lange alt.«
»Eben«, meinte Fausser. »Der Kaiser ist vor dem Haus vorbei geritten, es hat den Hitler kommen und gehen sehen, den Ulbricht und den Honecker … Was denkt sich so ein altes Gemäuer, wenn unsereiner vorbeikommt?«
Vochazer legt horchend die Hand ans Ohr. »Ich kann’s nicht verstehen«, sagt er dann und lässt die Hand wieder sinken. »Es redet Schweizerdeutsch«.
Die beiden Männer wenden sich dem Parlamentsgebäude zu, vor dem ein Dienstwagen der teureren Sorte vorgefahren ist. Eine untersetzte, etwas kurzbeinige Frau steigt aus und läuft – als habe sie anderes gar nicht erwartet – dem Aufnahmeteam eines TV-Senders in die Kamera. Sie trägt ein Kostüm, das etwas zu gelb ist, und beginnt sofort und ohne Ansatz in das Mikrofon zu reden, das ihr vorgehalten wird.
Die beiden Männer sehen sich kurz an.
»Das wird schon noch«, sagt Vochazer schließlich. »Wem Gott ein Amt gibt …«
»… dem gibt er auch den Verstand dazu«, vollendet Fausser den Satz. »Aber für das eine lässt er sich manchmal doch sehr viel mehr Zeit als für das andere, findest du nicht?«
»Gottes Wege sind wunderbar«, antwortet Vochazer fromm. Sie passieren die Eingangskontrolle und gehen zu den Aufzügen, die sie in ihre Büros bringen sollen. »Aber manche Leute reden viel, das ist schon wahr, Du glaubst nicht, was da alles in Umlauf gesetzt wird …« Der Aufzug kommt, die Tür öffnet sich, und Vochazer lässt Fausser den Vortritt.
»Ich nehme mal an«, sagt Fausser, als sich die Tür geschlossen hat, »du hast mir auch ein Beispiel für das, was so in Umlauf gesetzt wird?« Er fährt sich über die Stirn, die Luft im Aufzug ist stickig, plötzlich spürt er einen Schweißausbruch.
»Wenn du partout darauf bestehst«, meint Vochazer, »es heißt, dein Wahlkreis wäre schon so gut wie vergeben, an eine …« – Er hebt die Hand, als habe er etwas abgewogen und für zu leicht befunden – »… an eine von euren jungen Quotenfrauen, tut mir leid, der Name ist mir entfallen …«
»Ach das!«, antwortet Fausser. »Übrigens gibt es bei uns keine Quotenfrauen. Nur hoch qualifizierte Expertinnen. Migrationsforscherinnen. Fachfrauen für eine geschlechtsneutrale Sprache … Aber ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt noch eine Runde dranhängen soll.«
Der Aufzug hält, Vochazer sieht an Fausser vorbei, hinaus auf den lichten Flur, vor dem sich die Aufzugtür geöffnet hat.
»Mir tät’s leid«, sagt er. »Ich meine, wenn nicht …«
»Mir nicht«, meint Fausser, hebt grüßend die Hand und wendet sich dem Korridor zu, der zu seinem Büro führt.
Es ist still in der Änderungsschneiderei Aydin, und es wird nicht gearbeitet. Die Fenster sind geöffnet, aber der Geruch nach Bügeleisen und feucht gedämpftem Tuch liegt noch in der Luft. Berndorf ist nicht der einzige Besucher, dunkel gekleidete Männer stehen umher, blicklos huscht ein blasses Mädchen vorbei, ein Mädchen mit Kopftuch, ganz recht. Man begrüßt sich eher leise, überhaupt hört Berndorf kein Wehklagen, kein Geschrei, niemand rauft sich die Haare, was hatte er sich eigentlich vorgestellt?
Kemal Aydin nickt ihm zu und kommt herüber. Er hat einen Umschlag in der Hand und legt ihn auf den Tresen, auf dem sonst ausgebreitet wird, was die Kunden geändert haben wollen. Es sind nicht viele Fotos, auf einem davon ist der kleine Murad zu sehen, elf Jahre alt und gerade nach Deutschland gekommen, mit dunklen Augen, aus denen man herauslesen kann, was immer man will: Was denkt, träumt, hofft ein Elfjähriger, der zum fremden Onkel ins fremde Land gebracht wird, weil der Vater verschwunden ist oder eingesperrt wurde oder umgebracht …?
Spätere Fotos zeigen einen Jungen mit vollem Gesicht, der so aussieht, wie junge Leute in der Pubertät aussehen, albern und affig oder trotzig oder mit prahlerischer Geste, bald mit schwarzem flaumigem Bartansatz. Berndorf greift sich eines der Fotos, einen Schnappschuss, entstanden offenbar bei einem Familienfest, Murad blickt mit angestrengter Gleichgültigkeit in die Kamera, sein Gesicht ist nicht mehr ganz so rund, und statt des Flaums zieht sich ein am Rand sorgfältig ausrasierter Bartstreifen senkrecht übers Kinn. Er trägt ein adrettes schwarzes Hemd zum schwarzen Jackett, schwarze genestelte Strickkrawatte … »Das Foto ist ein Jahr alt, etwa ein Jahr«, erklärt Kemal Aydin, »es war am Ende vom Ramadan …«
Berndorf will wissen, was Murad zuletzt getragen hat, und Kemal Aydin ruft nach Nezahat, dem Kopftuchmädchen. Murad war ihr Bruder, und als Berndorf sie aus der Nähe sieht, bemerkt er, dass sie nicht einfach blass ist. Sie ist totenblass.
»Die schwarzen Jeans hatte er an«, sagt Nezahat, »und den schwarzen Lederblouson …«
Ein neuer Besucher betritt die Schneiderei, zwei Henkelmänner tragend, offenbar bringt er Essen mit. Berndorf verstaut das Foto in der Mappe, die er mitgebracht hat, und holt dafür eine vorbereitete Erklärung des Inhalts heraus, dass er – Berndorf, Hans – bevollmächtigt sei, die Familie Aydin in allen den verstorbenen Murad Aydin betreffenden Angelegenheiten zu vertreten … Das hatten sie zwar schon in seinem Büro so besprochen, aber Aydin setzt sich erst einmal abseits an einen Arbeitstisch und muss eine Brille herausholen und das Schriftstück sorgfältig studieren, ehe er ebenso sorgfältig eine schöne geschwungene Unterschrift daruntersetzt. Berndorf nimmt es mit gebührendem Respekt entgegen, nickt Aydin zu und Nezahat und den anderen Trauergästen, soweit sie seinen Blick erwidern, und geht.
Kemal Aydin hat ihm ein Café genannt.
»Murad war oft dort. Aber Sie müssen wissen – es kann sein, dass die Leute dort nicht sehr freundlich sind …«
Ja, er soll Sie gleich anrufen, wenn er kommt, ich richte es ihm aus«, sagt die Sekretärin Carmen Ruff und legt mit einem genervten Blick zur Decke den Hörer wieder auf.
»Da fängt die Woche ja gut an«, bemerkt die Wissenschaftliche Mitarbeiterin Carla Jankewitz und blättert weiter in der neuen Spiegel-Ausgabe. »Er war gestern also gar nicht mehr zu Hause.«
»Das geht so lange gut, wie es gut geht«, antwortet die Sekretärin und überprüft den Terminplan für die neue Woche.
»Aber nicht mehr lange«, sagt Carla Jankewitz. »Ich wundere mich, dass diese Solveig Lunden das überhaupt noch mitmacht.«
»Und ich wundere mich, dass ihm die Frau nicht davon läuft …«
Die Tür öffnet sich, Christian Fausser tritt ein, wünscht allseits einen guten Morgen und fragt – während er den Mantel auszieht und ihn in den Garderobenschrank hängt – was denn heute kaputt sei.
Die beiden Frauen sehen sich an, und die Sekretärin antwortet gleichmütig, nichts sei kaputt. Sowohl die Frage als auch die Antwort und der Blick der beiden Frauen gehören zum morgendlichen Ritual im Büro des MdB Christian Fausser.
»Ihre Frau hat angerufen«, fügt die Sekretärin hinzu. »Mehrmals. Sie möchten sie zurückrufen. Es sei dringend.«
»Danke, Carmen«, antwortet Fausser und geht in sein Büro. Carla Jankewitz folgt ihm und zieht die Tür hinter sich zu. Dann bleibt sie stehen, an den Türrahmen gelehnt und die Arme verschränkt. »Haben Sie sich gut erholt?«, fragt sie.
Fausser stellt sein Aktenköfferchen auf das Sideboard, zieht den Schreibtischstuhl vom Tisch zurück und setzt sich. Der Papierstapel, der vor mir liegt, ist gar nicht so hoch, denkt er. Warum flößt er mir einen solchen Widerwillen ein? Ganz oben liegt die Zeitung, die er schon durchgesehen hat, aufgeschlagen auf der Seite mit dem Bericht von der Tagung am Starnberger See, die Passage über Faussers Bemerkung mit einem roten Marker gekennzeichnet. Er stützt die Ellbogen auf dem Tisch auf und faltet die Hände und legt sein Kinn darauf, dann hebt er den Blick und betrachtet seine Assistentin: eine schlanke Frau, schwarz die kurz geschnittenen Haare, schwarz der lange Rock, schwarz der Rollkragenpullover. Nur die Lippen sind rot. Sehr rot. Und die Nase ist ein wenig schief. Ein wenig sehr schief.
»Das waren jetzt drei Unverschämtheiten auf einmal.«
»Ach ja?« Carla Jankewitz dreht ein wenig den Kopf und schaut elsternhaft.
Fausser hebt die Hand, Daumen, Zeige- und Mittelfinger hochgestreckt. »Erstens unterstellen Sie mir mal wieder, dass ich ausgebrannt bin, zweitens, dass ich zur Erholung am Starnberger See war, und dass mir dort – drittens – ein Ausraster unterlaufen sei. Nett.« Er wirft einen zweiten Blick auf den Papierstapel und zwingt sich ein Zähnefletschen ab, als betrachte ein alter gelangweilter Tiger einen sehr dürftigen und schon sehr abgenagten Knochen. »Was muss ich wissen?«
»Dieser Segeltörn«, sagt Carla bedächtig, als müsse sie die Mitteilung auskosten, »der ist nicht besonders gut angekommen.«
»Ich war nicht zum Segeln dort.«
Carla Jankewitz wirft einen genervten Blick zur Decke. »Ich rede auch nicht vom Segeln, sondern von Ihren Diskussionsbeiträgen dort. Oder diesem einen Beitrag.«
»Das hatten Sie mir bereits signalisiert. Und sonst?«
»Der Stuttgarter Kreisvorsitzende hätte Sie gerne bei der Kundgebung des Klinikpersonals dabei …«
»Bei dem Stuttgarter Kreisvorsitzenden, liebe Carla«, erwidert Fausser mit sanfter Stimme, »handelt es sich um genau jenen hochgeschätzten Genossen, der seit Monaten damit beschäftigt ist, meinen Wahlkreis einer strebsamen jungen Sozialpädagogin zuzuschanzen, Fachfrau für eine geschlechtsneutrale Sprache, liebe Parteimitgliederinnen und -mitglieder! Was soll ich übrigens auf einer Kundgebung des Klinikpersonals? Ich gehöre dem Haushaltsausschuss an, liebe Carla, also zu den Leuten, die das Geld zusammenhalten sollen, und nicht es ausgeben. Warum hat er nicht …?«
»Die sind alle verhindert«, antwortet Carla Jankewitz und betrachtet prüfend die lackierten Fingernägel. Auch diese sind sehr rot. »Aber wie Sie meinen. Ich werde ihm absagen. Und Ihr – wie soll ich sagen? – alter Freund Jörg Matthaus will mit Ihnen bei Borchardt essen, er hat einen Tisch für halb eins reserviert. Soll ich …?«
»Borchardt!« Fausser verzieht das Gesicht. »Von mir aus. Aber nennen Sie ihn nicht meinen alten Freund.«
»Außerdem ist da noch Holtzenpflug. Er will Sie nach der Fraktionssitzung sprechen.«
»Holtzenpflug?« Fausser muss gähnen. »Was will er denn, unser Schleicher? Ich bin doch für nix mehr zuständig, was er mir wegnehmen könnte.«