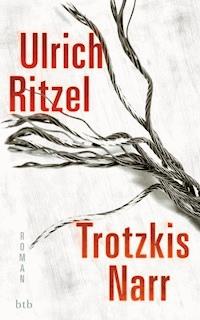7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb
- Kategorie: Krimi
- Serie: Berndorf ermittelt
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
Es ist ein heißer Sommer, als Kommissar Berndorf sein Rentnerdasein beginnt. Doch der Brief eines Selbstmörders zwingt ihn nicht nur, Ermittlungen in einem weit zurückliegenden Todesfall aufzunehmen, sondern sich auch der eigenen Vergangenheit zu stellen. Widerwillig erinnert sich Berndorf an das Jahr 1972, als die RAF-Hysterie nicht nur die Polizei elektrisierte und zu überstürzten Handlungen trieb. Schließlich greift er die Lebensfäden einer Hand voll Menschen auf, die sich in jener Zeit unter dramatischen Umständen mit Berndorfs Biographie verknüpften. Dabei gerät er in eine lebensgefährliche politische Intrige.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 647
Ähnliche
btb
Buch
Es ist ein heißer Sommer, als Kommissar Berndorf sein Rentnerdasein beginnt. Doch der Brief eines Selbstmörders zwingt ihn nicht nur, Ermittlungen in einem weit zurückliegenden Todesfall aufzunehmen, sondern sich auch der eigenen Vergangenheit zu stellen. Widerwillig erinnert sich Berndorf an das Jahr 1972, als die RAF-Hysterie nicht nur die Polizei elektrisierte und zu überstürzten Handlungen trieb. Schließlich greift er die Lebensfäden einer Hand voll Menschen auf, die sich in jener Zeit unter dramatischen Umständen mit Berndorfs Biografie verknüpften. Dabei gerät er in eine lebensgefährliche politische Intrige.
»Ein literarischer Genuss weit über dem Durchschnitt des Genres.« Focus
Autor
Ulrich Ritzel, Jahrgang 1940, geboren in Pforzheim, verbrachte seine Kindheit und Jugend auf der Schwäbischen Alb und lebt heute in Ulm. Er studierte Jura in Tübingen, Berlin und Heidelberg. Danach schrieb er für verschiedene Zeitungen und wurde 1981 mit dem begehrten Wächterpreis ausgezeichnet. Nach 35 Jahren Journalismus, in deren Verlauf er auch viele Gerichtsreportagen verfasste, hatte er genug. In wenigen Wochen entstand sein Erstling »Der Schatten des Schwans«, der bei seinem Erscheinen zum Überraschungserfolg wurde und seinen Autor zu einem gefeierten Hoffnungsträger des deutschsprachigen Kriminalromans machte. 2001 bekam er für »Schwemmholz« den deutschen Krimipreis verliehen.
Inhaltsverzeichnis
»Im Juni 1972 hat es in Mannheim zwei Geschichten gegeben, für die sich heute noch jemand interessieren könnte«, sagt Steffens schließlich in die Stille. »Das eine war der Überfall auf einen Geldtransporter der Landeszentralbank, angeblich waren es Terroristen, die mit anderthalb Millionen Mark Beute abgezogen sind. Und dann war noch die Geschichte mit Franziska, das war eine Redakteurin des Aufbruch, der die Polizei in der Nacht darauf den Lover erschossen hat, einen Iren. Wegen welcher Sache sind Sie nun wohl zu mir gekommen?«
»Es ist eine Geschichte«, sagt Berndorf zu dem Lichtkegel, hinter dem Steffens sitzt.
»Mag sein«,antwortet es von dort. »Aber was ist daran so aufreizend, dass es heute noch die pensionierten Polizisten auf die Beine bringt?«
»Wir waren damals ein ziemlich wilder Haufen, und eingenistet hatten wir uns bei Rüdiger, der war Feuilleton-Chef, eins von diesen Weicheiern, würden die Kids heute sagen, der sich stark vorkam, wenn die richtig harten Typen bei ihm aus und ein gingen. Schatte war einer davon, ein entschlossener Kämpfer gegen den US-Imperialismus, vor allem auf dem Papier, denn für alles andere hatte er zwei linke Hände. Ich dagegen hielt mich für einen wirklichen Revolutionär, für einen Proletarier, der schreibt. Und der vielleicht auch kämpft. Also ich hätte damals schon Wert darauf gelegt, dass man es mir zutraut.«
Heidelberg, Mittwoch, 28. Juni
Die Sonne, schon über den Ausläufern des Odenwalds, wirft lange blauschwarze Schatten auf den am Vortag gemähten Rasen. In der Luft hängt der Geruch nach Heu und Sommer, später am Tag wird es heiß werden. Schrappend dreht sich der Sprenger und regnet eine fein sprühende Fontäne über Brombeerhecken und Rosenbeet, die Wassertropfen spritzen hoch und fallen funkelnd durchs Sonnenlicht, bis die Fontäne kehrtmacht und wieder zu den beiden Apfelbäumchen wandert. Im Rasen, jenseits der Reichweite des Sprengers und unterhalb der marmorgefliesten Terrasse, kauert ein fuchsroter Kater und frisst mit bedächtiger Aufmerksamkeit von einem Teller. Die Frau, die barfuß auf die Terrasse tritt, ist schlank und dunkelhaarig und trägt ein kurzes, braun-grün geflammtes Leinenkleid. Behutsam nähert sie sich dem Kater, bleibt aber sofort stehen, als das Tier zu fressen aufhört und wachsam aus grünblauen Augen zu ihr hochsieht.
»Du brauchst doch keine Angst zu haben«, sagt sie mit leiser lockender Stimme. »Ich bin es doch nur, die Birgit. Die bescheuerte Birgit, die extra in den Supermarkt fährt, um das Katzenfutter aus der bescheuerten Fernseh-Werbung zu holen.«
Der Kater verharrt ungerührt.
»Wir werden uns schon noch kennen lernen«, fährt sie beschwörend fort. »Wir haben jede Menge Zeit. Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne ...«
Die Gartentür öffnet sich. Der Kater witscht zur Seite und Birgit bekommt nur noch den buschigen Schwanz zu sehen, der hinter Nachbars Holzzaun abtaucht.
»Jetzt hast du meine Katze vertrieben«, sagt sie zu ihrem Mann, der verschwitzt auf die Terrasse tritt. Hubert Höge steckt in einem Sportdress mit kurzen Hosen, die den Blick auf muskulöse, behaarte Beine freigeben.
Es sind keine Hosen, denkt Birgit. Es sind Höschen. Sie sitzen zu knapp. Ich will nicht, dass ihn die Nachbarinnen so sehen. Oder was für Weiber er sonst trifft.
»Das ist erstens nicht deine und zweitens überhaupt keine Katze«, antwortet er kurzatmig. »Das ist ein herrenloser Fritzthe-cat, und wenn du ihn ins Haus bringst, müssen wir ihn kastrieren lassen. Der Gestank ist sonst nicht auszuhalten. Da hilft auch kein Rilke.«
»Das war nicht Rilke, mein Lieber. Auch als Musikerzieher solltest du etwas an deiner Allgemeinbildung arbeiten«, bemerkt Birgit honigsüß. »Außerdem bin ich durchaus nicht damit einverstanden, dass hier kastriert wird, was nach Mann riecht.« Plötzlich ist ihre Stimme ins Rauchige umgeschlagen. »Ich geh ja schon unter die Dusche«, antwortet Hubert. »Aber mit dem Kater wird das nicht so einfach. Das Duschen von Katern zählt unter Kennern zu den ausgesprochen heftigen Events. Außerdem hat das Vieh Flöhe. Sonst kann man dich mit so etwas doch jagen . . .«
»Flöhe?« Birgit ist empört. »Hunde haben Flöhe. Meine Katze nicht. Du müsstest mal sehen, wie die sich putzt . . .«
»Das stört die Flöhe nicht. Aber du wirst es schon noch merken. Du erkennst Flohstiche übrigens daran, dass sie immer hübsch in einer Reihe sind.« Hubert Höge – im Jargon des Droste-Hülshoff-Gymnasiums Piano-Bertie genannt – geht mit schwingenden Hüften am gedeckten Frühstückstisch vorbei und verschwindet im Wohnzimmer. Birgit sieht ihm nach. Flöhe? Plötzlich spürt sie einen Schauder. Sie geht auf die Toilette im Erdgeschoss und untersucht ihre Beine. Kein Stich. Nirgends. Hubert, du Lügner. Wie immer, bevor sie sich auf die Klobrille setzt, wischt sie sie vorher mit Sagrotan ab.
Eine gute halbe Stunde später sind sie auf dem Weg zur Schule, vor dem Fußgängerüberweg an der Kußmaulstraße springt die Ampel auf Rot, fluchend bremst Hubert den Peugeot ab, und ein kleiner krummbeiniger Mann in kurzen Sporthosen rennt watschelnd über den Zebrastreifen.
Birgit lächelt und streckt die Hand aus dem offenen Wagenfenster, um dem Mann zuzuwinken.
»Wieso kennst du den?«, will Hubert wissen.
»Hast du gesehen, er hat auch so schicke Shorts wie du«, sagt Birgit. »Ich hätte ihn fast nicht darin erkannt. Es ist der Kaplan von Maria Immaculata.« Der Gedanke zuckt durch ihren Kopf, dass die Neuenheimer katholische Kirche so wahrscheinlich doch nicht heißt. »Ein sehr einfühlsamer Mann.«
»Einfühlsam? In seine Ministranten, wie?«
Volltreffer. Hubert hat einige Schuljahre in einem katholischen Internat verbracht. »Ach Gott, das wollen wir nicht so eng sehen«, antwortet sie heiter. »Jedenfalls hat er in unserem Dienstagskreis ein sehr schönes Referat über Julien Green gehalten.«
Noch ein Treffer. Der Literarische Dienstagskreis steht auf Huberts Hassliste ganz weit oben und kommt gleich nach dem Oberschulamt, der Schulleiterin Bohde-Riss, dem Hausmeister des Droste-Hülshoff-Gymnasiums und allem, was mit der katholischen Kirche zu tun hat.
»Ein Grund mehr, warum ich da nicht hingeh«, bemerkt Hubert dunkel. »Im Übrigen trag ich keine solchen Shorts. Solche nicht. Das weise ich zurück. Mit Abscheu und Empörung.«
Birgit setzt das silberhelle Lachen auf. »Aber ganz gewiss tust du das, mein Lieber. Nur ahnst du wahrscheinlich gar nicht, wie du von hinten aussiehst. Ich meine, wenn du diese Höschen anhast. Die Ministranten von dieser Kirche da würden ganz feuchte Augen bekommen.«
Hubert schweigt. Vor der Theodor-Heuss-Brücke staut sich der Verkehr. Sie würden zwei oder drei Phasen brauchen.
»Du hast doch heute die 12b?«, fragt er unvermittelt.
Abweisend sieht Birgit durch die Frontscheibe. »Ja. Leider. Eine blasierte Bande unmotivierter und überernährter Professorenkinder. Gottes Strafe für die 68er.«
»Bist doch selber eine davon.«
»Aber ich habe mich nicht fortgepflanzt«, erwidert Birgit nicht ohne Schärfe. »Was interessieren dich eigentlich meine halslosen Ungeheuer? Reichen dir die deinen nicht?«
»Bettina ist doch in der 12b?«
Unwillkürlich zieht Birgit die Augenbrauen zusammen. Was heißt hier Bettina? Das Bild eines grünäugigen Mädchens taucht vor ihr auf, mit Grübchen im Babyspeck und einem zu knappen T-Shirt oder einem zu dicken Busen darin. »Und was soll mit dieser Bettina sein?«
»Sie hat einen recht schönen Alt, brawny, vibrating«, erklärt Hubert. »Ich hab ihr diesen Schmachtfetzen gegeben, den die Zarah Leander im Repertoire gehabt hat.« Er hebt die Stimme und beginnt, tuntig die Windschutzscheibe anzusingen: »Kann denn Liebe Sünde sein ...«
»Bitte nicht«, unterbricht ihn Birgit. »Der Morgen ist mir zu früh für so etwas.« Bettina also. Recht schöne Altstimme. Genug Holz vor der Hütte für einen Resonanzboden. Kann denn Liebe Sünde sein. Glauben Sie das? Tiefer grüner Blick in Lehrers Augen. Und dann nach Schulschluss von hinten auf dem Flügel im Musikzimmer, oder wie?
»Eigentlich sollte ich noch den Hit von dieser neuen kanadischen Band einbauen«, fährt Hubert fort, die Stimme wieder normal. »Die wird Kult, ganz bestimmt wird die das.« Seine Stimme bekommt einen hämmernden Klang:
»Nothing is like it seems to be . . . Sehr schön gerappt ist das. Und passt doch wie bestellt fürs Droste und für Heidelberg.«
Vibrating, ja. Die dümmste Kuh war wohl wieder einmal sie selbst. Dass das Droste zum Schuljahresschluss eine Herz-und-Schmerz-Travestie aufführen sollte, im Stil des neuen französischen Kino-Singsangs, ist schließlich ihre Idee gewesen, niemand sonst war darauf gekommen, Hubert schon gar nicht, von alleine kommt er auf nichts. Höchstens auf diese Bettina drauf. Verhüten sie wenigstens?
»Bettinen hab ich übrigens zwei in der Klasse.« Ihre Stimme klingt heiser. Sie schluckt. Nur keine Wirkung zeigen. »Aber ich weiß, wen du meinst. Nettes Mädchen. Schade, dass sie dieses Problem mit ihrer Figur hat.«
Hubert schüttelt den Kopf. »Was für ein Problem? Reden wir wirklich vom selben Mädchen?«
»Sicher doch. Angenehmer Alt, auffallend grüne Augen. Ich vermute allerdings, dass sie zu früh mit der Pille angefangen hat. Oder mit der falschen. Manche Mädchen gehen davon auf wie ein Hefekuchen.«
Sie wirft einen kurzen prüfenden Blick auf Hubert. Ihr Mann starrt auf die Ampel, als sei er von dem Gedanken an Bettinas Vorkehrungen unangenehm berührt. So etwas sind Frauengeschichten für ihn, und sie stehen auch ziemlich weit oben auf seiner Liste. Aber vielleicht weiß er wirklich, wie sie verhütet. Was tu ich, wenn er sagt: nöh, wir nehmen Gummis?
»Redet ihr mit den Girlies nicht über solche Sachen?« Seine Stimme klingt harmlos, unbeteiligt.
»Von uns lassen die sich noch weniger sagen als von ihren Müttern.« Welches Stück führen wir eigentlich gerade auf? Das vom leicht trotteligen, aber väterlichen Lehrer? Oder bilde ich mir das alles nur ein? Wieso erzählt er mir von dieser Bettina, wenn er etwas mit ihr hat? So blöd ist er doch nicht.
Doch, denkt sie dann. Der ist so blöd, und kommt sich dabei noch schlau vor. Ich erzähl ihr von der Bettina, dann meint sie, es kann nichts dahinter sein, weil ich es ihr sonst nicht erzählt hätte.
Der Peugeot rollt an, wird aber wieder jäh abgebremst. Hubert flucht. Birgit blickt hoch. Die Kreuzung ist blockiert, der Wagen steht mitten auf dem Zebrastreifen, Passanten zwängen sich an der Motorhaube vorbei, mit ärgerlichen, manchmal auch höhnischen oder verächtlichen Blicken auf Hubert Höge und auf sie selbst, junge Leute sind es, ältere Leute, Birgit sieht durch die Passanten hindurch, als ob sie Luft seien, ich will jetzt von niemandem gesehen werden, und niemanden will ich sehen, diese Frau mit den Staubfängern um den Kopf sieht aus wie . . . ich will gar nicht wissen wie, außerdem bin ich nicht wirklich hier, ich habe nichts zu tun mit diesem Menschen da neben mir. Hätte ich nur nichts zu tun mit ihm . . .
Franziska Sinheim schiebt sich zwischen der Kühlerhaube des Peugeot und einem empört schnaufenden Rentner hindurch, der schwer mit Einkaufstüten beladen ist. Für den Bruchteil eines Augenblicks zögert sie. Dann schüttelt sie unmerklich den Kopf und geht mit raschen Schritten zur anderen Straßenseite hinüber. Sie hat ein schmales, noch jugendliches Gesicht unter einem kühnen Gewirr grauer Haare, die wie ein Strahlenkranz von ihrem Kopf abstehen, und trägt Jeans und ein weites, schlabbriges Jackett.
War das Birgit?, überlegt sie. Ähnlich sähe es ihr. Die Neue Deutsche Unhöflichkeit. Noch einmal schüttelt sie den Kopf. Der Morgen ist zu schön.
Später am Vormittag würde sie zu einer Buchvorstellung gehen. Eine der Koryphäen der Universität Heidelberg hat eine Abrechnung mit der political correctness verfasst; das Ereignis soll nun in einem ehrwürdigen Universitäts-Innenhof der Öffentlichkeit nahe gebracht werden. Als Festredner ist einer der renommierteren Schriftsteller der Republik gewonnen worden, ein höchst renommierter, überhaupt ist alles höchst renommiert, der Autor, der Festredner, der Verlag und der Innenhof. Franziska ist von Mannheim herübergefahren, weil sie hofft, einen Artikel über das Ereignis an die Berliner Zeitung verkaufen zu können, die ihr ab und an eine Gerichtsreportage oder einen Artikel über die Heidelberger Universität abnimmt.
Es ist mühsam verdientes Geld, und in der letzten Zeit immer mühsamer erarbeitet. Denn in den Chefetagen der Zeitungen sind die Kenzo-gekleideten Rationalisierungsexperten eingezogen, in handgearbeiteten spitzen Schuhen und mit italienischen Seidenkrawatten, und haben sich darangemacht, den Journalismus in niedliche kleine Formate zu tranchieren und kleinzuköcheln, bis nichts übrig bleibt als eine appetitliche Garnitur fürs Werbeumfeld.
Die Buchvorstellung soll um 11 Uhr beginnen, bis dahin ist noch mehr als genug Zeit, eine Freundin zu besuchen. Sie geht zwei Straßen weiter, dann biegt sie nach rechts in eine kleine baumbestandene Seitenstraße ab. Hinter den Bäumen erheben sich mehrgeschossige Backsteinhäuser, deren Erker und Rundbögen nach spätem, gut abgelagertem 19. Jahrhundert aussehen. Im Erdgeschoss oder besser: im Hochparterre eines der Häuser ist Isabellas Galerie eingerichtet, als Ausstellungsraum hat sie genutzt, was früher einmal der Salon einer wilhelminischen Professorenfamilie gewesen sein mochte, vielleicht hatte Max Weber hier Tee getrunken oder stefan george ein biskuit genommen.
Franziska schiebt die beiden gläsernen Flügeltüren auf, die die Galerie von der Garderobe trennen, und tritt ein. Der hohe Raum ist angenehm kühl.
An der zartgrau tapezierten Wand hängen kleinformatige Aquarelle und Bleistiftzeichnungen auf Japanpapier, Franziskas Blick fällt auf die krakelige Zeichnung eines Tierkadavers, und darunter steht, akkurat und etwas linksgeneigt in Tusche geschrieben, der Satz: Alles, was unbegreiflich ist, besteht dennoch weiter.
Franziska unterdrückt ein Schulterzucken. Kein Kunde da. Sie wird enttäuscht sein, dass nur ich es bin.
In Glasvitrinen ist einzelner Schmuck ausgestellt, Franziska sieht näher hin, es sind Silberarbeiten, in einem Stil, der an die Handarbeiten bolivianischer Indios erinnert.
Isabella schnauft in den Verkaufsraum. Sie ist eine untersetzte Frau mit grauen Strähnen im kurz geschnittenen dunklen Haar. Ihre stämmigen Beine sind in Jeans verpackt, die sie oberhalb der derben Schuhe aufgekrempelt hat. Darüber trägt sie ein kariertes Baumwollhemd. Sie umarmt Franziska und drückt ihr, die filterlose Zigarette in der gelb verfärbten linken Hand, einen Kuss auf die Wange.
»Wenn du weiter so qualmst, werde ich vorsichtshalber schon mal einen Nachruf auf dich schreiben. Was hast du da an den Wänden?«
»Aus dir spricht die typische Intoleranz der Konvertiten. Die Aquarelle sind zauberhaft, findest du nicht auch? Anrührend und tief.« Sie überlegt, ob sie einen hastigen Zug aus der Zigarette nehmen soll, und vergisst es wieder. »Ganz versteh ich es auch nicht. Aber das eben ist Kunst. Dass der Bruch bleibt, und der Schrei, und dass dir keiner einen Trost weiß.« Franziska nickt höflich. »Vielleicht nehm ich das.«
Ein Leuchten zieht über Isabellas Gesicht. »Eins von den Aquarellen, ja?«
»Nein, tut mir Leid. Kann ich meinem Bankkonto nicht zumuten. Diesen Satz da von dem Schrei wollte ich nehmen.«
Isabella sieht sie verständnisvoll an und inhaliert nun doch einen tiefen Zug.
»Für deinen Nachruf«, erklärt Franziska.
»Miststück«, antwortet Isabella und schnaubt zwei mächtige Rauchwolken durch die Nase. Die Türklingel schlägt an, und die Postbotin bringt einen Stapel Prospekte und Briefe, die nach Franziskas Erfahrung verdächtig nach Mahnungen aussehen. Taktvoll wendet sie sich ab und betrachtet den Silberschmuck in den Glasvitrinen, eine der ausgestellten Arbeiten ist ein Kette aus Silberfäden mit fein gearbeiteten Blättern, und die Kette hält einen kleinen blauroten Granat. Nicht schon wieder, denkt Franziska, wie lange ist das alles her? Sie blickt hoch, ein Strichmännchen irrt durch ein Gewirr aus labyrinthischen Linien, und in der linksgeneigten Tusche-Schrift steht darunter der Satz: Das ewige Schweigen dieser unendlichen Räume erschreckt mich.
Die Postbotin ist wieder gegangen, Isabella überfliegt einen der Briefe, für eine kurze Weile kehrt Stille ein.
»Hör dir das mal an«, sagt Isabella plötzlich. »Die wollen hier einen Fahrstuhl einbauen, das ist doch verrückt, die machen das ganze Treppenhaus kaputt, das darf doch niemand genehmigen! Und Thermopen-Fenster, oder wie dieser Scheiß heißt, von dem man Schimmel in die Wohnung kriegt . . .«
»Gib mal her.« Franziska nimmt den Brief und liest ihn sorgfältig durch. Der Absender ist eine Frankfurter Firma, eine Helios Heimstatt GmbH & Co. KG, die das Haus vor einigen Wochen einer Erbengemeinschaft abgekauft hat. Der Name sagt ihr nichts, aber die Sprache scheint ihr bekannt.
»Über den Schimmel brauchst du dich nicht aufzuregen«, sagt sie dann. »Wirklich nicht.«
Isabella sieht sie nur an, fragend und unsicher.
»Diese Leute haben eine Luxus-Sanierung vor«, fährt Franziska fort. »Entweder gehst du Pleite, während die noch das Haus zur Baustelle machen, oder danach. Weil du dann nämlich die Miete nicht mehr bezahlen kannst.«
Franziska tritt auf die Straße hinaus. Die Alleebäume geben Schatten, aber der frische Geruch des Sommermorgens ist verflogen. Schon jetzt ist zu spüren, wie sich die Hitze zwischen den Häusern staut. Ein Satz, der unter einem der Aquarelle in Isabellas Galerie steht, klingt nach.
Der Mensch ist nur ein Schilfrohr, das schwächste der Natur, aber er ist ein denkendes Schilfrohr.
Schwer genug fällt es einem ja, denkt Franziska, sich die Freundin als Schilfrohr vorzustellen. Sie sieht auf die Uhr. Es ist später, als sie gedacht hat.
An der Ecke stößt sie beinahe mit einem stirnglatzigen, stämmigen Mann zusammen, der die Jacke seines dunklen Anzugs über den Arm gehängt hat. Im letzten Augenblick stoppt der Mann ab und lässt sie vorbei.
Die Mieter sollten sich zusammentun und an die Öffentlichkeit gehen, hat sie Isabella geraten. Vielleicht haben die neuen Eigentümer noch andere Altbau-Häuser aufgekauft. Vielleicht weiß man in Frankfurt etwas über diese Kommanditgesellschaft; sie würde noch am Nachmittag, wenn sie wieder in Mannheim in ihrer Wohnung ist, eine Kollegin in der Rundschau anrufen.
Aber mach dir keine Illusionen. Geld lässt sich von nichts aufhalten und nirgendwo auf der Welt gibt es einen Naturschutzpark für kettenrauchende chaotische Galeristinnen und krakelige Aquarelle.
Franziska erreicht die Haltestelle und bleibt auf dem Trottoir stehen, dort, wo noch Schatten ist. Die Straßenbahn zum Bismarckplatz muss gleich kommen.
Aber wehren muss man sich trotzdem.
Der Mann sieht Franziska unschlüssig nach. Dann geht er langsam bis zu einem Fußgängerüberweg weiter. Dort bleibt er stehen und wartet – obwohl keine Autos kommen –, bis die Ampel schließlich auf Grün schaltet.
Auf der anderen Straßenseite gelangt er zu einem spitzgiebligen Backsteinhaus, dessen Vorgarten mit einem schmiedeeisernen Zaun gegen die Straße abgegrenzt ist. Er klingelt an dem Schild einer neurologischen Praxis und tritt ein. Das Haus ist durch eine Klimaanlage gekühlt, plötzlich spürt er den Schweiß auf seinem Körper.
Die Assistentin im Sekretariat sieht zu ihm hoch und lächelt. Das sollte sie nicht tun, findet der Mann. Sie hat schiefe Zähne, und gelbe dazu. »Bei diesem schönen Wetter sollten Sie aber nicht zu uns kommen müssen.«
An der Wand hinter dem Arbeitsplatz der Assistentin hängt ein großes blaues Bild. Es ist nichts als blau, und die dunkle satte blaue Farbe scheint mit einem Spachtel aufgetragen. Vermutlich ist es Acryl. Der Mann weiß, dass in manchen Therapien damit gearbeitet wird. Er sieht wieder zu der Assistentin. »Ich wollte das Rezept abholen«, sagt er. »Der Doktor hat mir am Telefon gesagt, es liegt für mich bereit.«
Die Assistentin hat das Lächeln eingestellt. »Ich weiß.« Sie sieht einen Hängeordner durch. »Sie hören ja nicht auf mich. Aber es gibt einen Lauftreff, da sind wirklich nette Leute drin. Auch Patienten von uns. Die schwören darauf. Jetzt wisse sie wieder, was Lebensfreude ist, hat mir eine Frau neulich gesagt. Kein Medikament schafft das.«
»Ich weiß«, antwortet der Mann. »Aber ich bin zu schwer. Ich muss erst abnehmen. Das geht sonst auf die Bänder.«
Die Assistentin zuckt mit den Achseln. Dann hat sie das Rezept gefunden und reicht es ihm.
»Er warf ihm die Gewänder auf die Schulter . . . welche er für den . . . Ausgang geholt hatte«, übersetzt der blonde Junge, angestrengt über den Text gebeugt, »sittsame Gewänder des ordnungsgemäßen Lebens, dessen Armut . . . mit dem Waschtisch des . . . Maskenballs beschworen wurde.« Erwartungsvoll sieht er zu Birgit hoch. Im Klassenzimmer hängt der strenge Geruch einer die Lider beschwerenden vierten Schulstunde. Niemand hört zu.
»Thorsten«, sagt Birgit sanft, »überlegen Sie noch einmal, was Sie da übersetzt haben? Il lui jeta sur les epaules les vêtements qu’il avait apportés pour la sortie. Wer wirft da wem etwas über die Schulter?«
»Ihm wirft er das«, antwortet Thorsten. »Einem ihm halt.«
»Und sind Sie ganz sicher, dass jurer avec quelq’un beschwören heißt?« Thorsten zuckt mit den Achseln. Birgit sieht sich resigniert um. »Phan, versuchen Sie es?«
Phan ist der Sohn eines vietnamesischen Ordinarius (Angewandte Mathematik). »Er legte ihr den Mantel über die Schultern, mit dem sie ausgegangen war«, übersetzt er, als ob er den fertigen Text vorlese, »einen bescheidenen Alltagsmantel, dessen Ärmlichkeit in einem schreienden Gegensatz zur Eleganz ihres Ballkleides stand.«
Birgit nickt. »Na also. Glauben Sie nicht, Thorsten, dass das eher einen Sinn ergibt?«
Der blonde Junge verzieht das Gesicht. »Das is nich fair. Bei Charlie zu Hause reden sie zum Nachtisch Französisch.« Eines der Mädchen kichert. Bettina? Nein, die betrachtet ihre lackierten Fingernägel.
Phan bemerkt, seines Wissens sei Thorsten bisher noch nicht bei ihm eingeladen gewesen.
»Das Problem ist, dass diese ganze Geschichte keinen Sinn ergibt«, wirft Donatus (Internationales Zivilrecht) ein. »Ich verweise nur auf den Schluss. Da beschwert sich die Freundin, dass sie das Collier so spät zurückbekommt, dann schaut sie es aber nicht einmal an, und nach zehn Jahren will sie noch immer nicht gemerkt haben, dass sie statt einer falschen eine echte Kette im Tresor hat. Natürlich versteht da einer, der ein bisschen einfacher gestrickt ist, nur noch Bahnhof.«
Thorsten (Regierungsdirektor, Kreiswehrersatzamt) runzelt die Stirn.
Bettina (Chefarzt Endokrinologie) hat den Blick von ihren Fingernägeln losgerissen und richtet große schläfrige grüne Augen auf Birgit. »Da ist noch was. Maupassant hat das doch irgendwann nach 1870 geschrieben, oder lieg ich da falsch?«
Birgit, plötzlich unsicher geworden, nickt zurückhaltend.
»Also. Damals hat es bereits Versicherungen gegeben, Assekuranzen hieß das, glaub ich. Und wenn der Schmuck wirklich kostbar gewesen wäre, hätte diese Madame Forestier ihn auch versichern lassen. Also wäre es die erste Frage von Mathilde gewesen, ob das Collier versichert ist, und die Madame hätte sagen müssen, nöh, isses nich, hat auch bloß vier Mark fünfzig gekostet, und wir könnten alle ins Freibad oder die Backyard Boys hören, Nothing is like it seems to be, da ist doch diese ganze Geschichte schon drin.«
Die Klasse lacht, nur Donatus fragt pikiert, woher sie das mit der Versicherung wissen wolle.
Bettina legt den Kopf schief und schließt träumerisch die großen grünen Augen.
»Carius II«, erklärt Esther (Homiletik, prot.), die zwei Tischreihen weiter hinten sitzt.
»Exakt«, ergänzt Bettina. »Er hat gerade ein Praktikum beim Zentralverband der deutschen Versicherungswirtschaft gemacht.« Sie wirft einen selbstzufriedenen Blick auf Birgit und lässt die Augen langsam bis zu deren Füßen gleiten.
»Zu schade«, sagt Birgit, zieht den Stuhl neben ihrem Arbeitstisch hervor und setzt sich mit übergeschlagenen Beinen, »zu schade, dass Maupassant keine deutschen Versicherungsfuzzis hat konsultieren können.« Schau du nur meine Beine an. »Es wäre überhaupt zu prüfen, was von der Weltliteratur übrig bliebe, wenn alle rechtzeitig bei der Allianz vorgesorgt hätten.« Wo hab ich diesen Schlagertext schon einmal gehört? Aber natürlich. Hubert hat davon geredet. Wer sonst.
Im Efeu-umrankten Innenhof des Instituts für Rechtsgeschichte drängt sich erwartungsvolles Publikum, die Herren im hellen Sommeranzug, die Damen in luftigen Kleidern, wie sie es sich sonst für einen Tagesbummel in Salzburg oder Verona ausgesucht hätten, für einen Augenblick muss Franziska gegen das heftige Gefühl ankämpfen, sie sei underdressed. Aufatmend erblickt sie die Kollegin vom Intelligenzblatt für den gehobenen Schuldienst, die Kollegin glänzt im schwarzlilaseidenen Cocktailkleid, wie beschissen das aussieht! Schmalhüftige junge Frauen in hochhackigen Pumps und knappen schwarzen Miniröcken balancieren Serviertabletts durch das Gedränge, ein Fernseh-Team bringt Scheinwerfer in Stellung, Franziska erkennt den Rektor der Universität und den Dekan und auch den Baron, der ihr aus der Entfernung zunickt, sehr aus der Entfernung, zum Glück.
Neben einem Tisch mit Stapeln von neuen Büchern im immergleichen Hochglanz-Umschlag steht ein Mensch mit nach hinten gekämmten dünnen Haaren und lächelt panisch, es sieht aus, als habe ihm sein Zahnarzt zum festlichen Anlass ein perlweiß neues Gebiss gefertigt.
Aus ihren Unterlagen weiß Franziska, dass der Autor bisher nur mit Abhandlungen wie zum Beispiel über die Hinterbliebenenansprüche im Staatshaftungsrecht hervorgetreten ist. Eines Tages aber fand er heraus, dass unsere Gesellschaft die Begabten und schöpferisch Tätigen krass benachteiligt zu Gunsten von Homosexuellen, von Frauen und anderen Minderheiten, und schrieb ein Buch darüber. Und nun ist der Rektor da und sogar das Fernsehen und filmt seine neuen perlweißen Zähne. Kommt er sich vielleicht komisch vor, überlegt Franziska. Vielleicht wird sie doch den Baron befragen müssen, was den guten Mann zu seinen Einsichten gebracht hat.
Neben ihr unterhalten sich halblaut zwei Männer, beiläufig stellt der eine – hoch gewachsen und mit einem Gesicht, als sei er einmal durch die Windschutzscheibe geflogen – eine Frage, Franziska glaubt zu verstehen: Schatte konnte nicht kommen? Und der andere antwortet: Nein, er kümmert sich um diese Elsass-Geschichte.
Nicht schon wieder, denkt sie, ich seh und höre Gespenster. Sie wendet sich ab, denn die Menge teilt sich und schiebt sie zur Seite. Sanfte Röte überfliegt das Gesicht des Autors, sommerlich-duftig gewandetes Verlagspersonal geleitet den Festredner zum Mikrofon, einen in dieser Umgebung fremd und mit dem Publikum doch wieder auf distanzierte Weise vertraut wirkenden Mann. Sein Gesicht mit den hängenden Backen und buschigen Augenbrauen sieht wach und misstrauisch aus, so als verberge er hinter seiner scheinbaren Schwerfälligkeit eine höchst empfindliche Aufmerksamkeit für alle Verletzungen und Kränkungen, die Menschen weniger einander als vielmehr ihm zuzufügen in der Lage sind.
Die Gespräche im Innenhof verstummen, der Verlagschef zelebriert die Begrüßungsrituale der Branche, Franziska sieht sich um und versucht, von dem Mann weiteren Abstand zu gewinnen, der durch die Windschutzscheibe geflogen ist, aber dann geriete sie neben den Baron, jetzt noch nicht, der Mundgeruch ist sehr streng, so bleibt sie stehen. Natürlich ist es nicht die Windschutzscheibe gewesen, weiß der Dichter eigentlich, in welcher Gesellschaft man ihn da sieht? Der Verlagschef plaudert über das Diktat der Mittelmäßigkeit und die wahre Freiheit des Geistes, die darin bestehe, selbst zu entscheiden, was dem freien Geist wichtig sei – der Verlagschef deutet eine leichte Verbeugung an, einmal zum Autor hin, dann zum Festredner –, Freiheit sei es also auch, den Fernsehapparat abzuschalten, was redet der da, denkt Franziska, wenn das keine Binse ist, was ist es dann?
Der Autor hat das Lächeln eingestellt, langsam verblasst die Röte, vielleicht suckelt er mit der Zunge an der Gebissplatte, ob sie denn auch wirklich festsitze, der Festredner ergreift das Wort oder vielmehr das Weinglas und nimmt einen tiefen Schluck Rotwein. Dem Wort nähert er sich eher zögernd, als sei es ein fluchtbereites Wesen und entziehe sich dem Zugriff blitzartig und gewandt wie eine Seeforelle, Franziska hat ihren Block aus der Jackentasche geholt und versucht mitzuschreiben, der Festredner redet von den Verhältnissen und Bedingungen des Gewissens, die nicht verfügbar seien, sich nicht zur Fertigung von Moralkeulen eigneten. Worauf will nun das hinaus? Der Festredner nimmt einen zweiten tiefen Schluck. In den Fragen der Nation und des Gewissens gebe es Dinge, fährt er fort, die könnten zu dieser Zeit so nur über die Deutschen gesagt werden, noch immer nur über sie, plötzlich sind die Worte nicht mehr wie Seeforellen, sondern nur noch schlüpfrig und aalglatt, dann ist das Glas ausgetrunken, beflissen nähert sich eine Mini-Berockte mit der Flasche.
Was tu ich hier?
Der Mann verlässt die Apotheke und tritt auf die Gasse hinaus, die zur Plöck führt, die Jacke noch immer über dem Arm. Der schmale Gehsteig liegt im Schatten, die Tabletten hat er in einer der Jackentaschen verstaut. Er holt sie immer hier, weil der Apotheker ein ruhiger älterer Mann ist, der ihm die Packung bringt und nichts weiter dazu sagt, nichts darüber, wie man sie nehmen müsse, und auch nichts über den schönen Tag und dass die Sonne scheint, und der ihn vor allem nicht ansieht, nicht mit diesem forschenden Blick, und auch nicht mit dem mitleidigen, der noch schlimmer ist.
Der Mann will zur Plöck, aber dort steht eine Gruppe junger Männer, glatzköpfig und in Springerstiefeln, und verteilt Flugblätter, er mag sich von ihnen nicht ansprechen lassen. Widerstrebend wendet er sich zur Hauptstraße. Vielleicht sollte er besser gleich eine der Tabletten nehmen, aber dazu bräuchte er einen Schluck Wasser. Er hätte den Apotheker darum bitten können, aber dann hätte ihn der angesehen wie jemanden, der es wirklich braucht. Soll er in ein Café gehen? Es ist Mittagszeit, vermutlich sind die Cafés voll und er würde keinen Tisch für sich allein bekommen.
Dann fällt ihm das Kaufhaus am Bismarckplatz ein. Dort hat es Toiletten, und er kann die Tablette mit einem Schluck aus dem Wasserhahn herunterspülen. Er biegt in die Hauptstraße ein, aber dort ist ein so dichtes Gedränge, dass er immer wieder anderen Leuten ausweichen muss, vor allem Touristen, die ihm in ganzen Trupps entgegenschlendern, als ob es niemanden gäbe, der vielleicht arbeiten muss oder sonst einen wichtigen Grund hat, unterwegs zu sein. Junge Mädchen auf Rollschuhen, die wie Schlittschuhe aussehen, schießen an ihm vorbei, sie tragen knapp sitzende kurze Hemdchen, die den Bauchnabel frei lassen, er versteht nicht, warum die Eltern das erlauben, und gefährlich sind diese Rollschuhe auch, im öffentlichen Verkehrsraum darf das doch gar nicht zugelassen sein. Etwas unterhalb der Providenzkirche sind Leute stehen geblieben und bilden einen Kreis, manchmal spielen russische Geiger dort oder Indios, Bettelmusikanten eben, aber diesmal hört er keine Musik.
Der Mann schiebt sich an dem Kreis der Zuschauer vorbei, dann fällt sein Blick auf eine weiße lebensgroße stumme Marionette, auch das Gesicht kalkweiß, eine Puppe, und die Puppe verharrt bewegungslos, wie lange schon?, um plötzlich in einer abgezirkelten und ruckartigen Geste einen Arm zu bewegen oder besser: zu verschieben, der Arm schlägt hoch, als ob ein Mechanismus eingerastet sei, und die Hand richtet sich auf den Mann und zittert dabei ein klein wenig wie der Sekundenzeiger einer Bahnhofsuhr, wenn er auf die volle Minute vorrückt und kurz verharrt. Der Mann schüttelt den Kopf, was hatte dieses Ding auf ihn zu zeigen, auf einmal sieht er, dass die Marionette nackt ist, am ganzen Körper nackt, und nur weiß geschminkt. Nein, sagt der Mann, vielleicht schreit er es auch, und rennt los, mit schweren plumpen Schritten, er stößt eine Frau zur Seite, die ihn verschreckt oder eher höhnisch ansieht, rennt die Hauptstraße hinab, die Touristen weichen ihm aus, der Mann rennt und läuft und holpert, seine schwarzen Straßenschuhe drücken ihn, und seine Jacke, die er zusammengeknüllt hält, schlägt ihm gegen das Hosenbein.
Birgit reibt sich die Schulter. Was für ein gestörter Mensch! Zu allem Überfluss hat sie Kopfschmerzen, es ist drückend heiß geworden, eine Dunstglocke hat sich über Stadt und Flusstal gelegt. Hubert ist noch im Droste geblieben, um für das Schulfest zu proben. Ich lass dir den Wagen, hatte sie gesagt, und geh im Schafheutle eine Kleinigkeit essen. Aber dann hatte sie doch keinen Appetit und war durch die Hauptstraße geschlendert, bis sie vor einem Plakat stehen geblieben war. Die Schwetzinger Schlossfestspiele bringen am Sonntag Shakespeares Was ihr wollt, das ist weder Huberts Geschmack noch kommt er auf den Gedanken, dass das vielleicht der ihre sein könnte. Sie hat sich schon wieder weggedreht, als dieser Rüpel sie unversehens rempelt.
Der Morgen ist schön, denkt sie, und du bist fröhlich und freust dich an den Rosen, und auf einmal siehst du nur noch Mehltau. Vielleicht liegt es an dir? Birgit überlegt. Welchen objektiven, nachprüfbaren Grund hat sie eigentlich? Nur einen. Hubert hatte nach Bettina gefragt.
Na und?
Vielleicht hatte er einen ganz zufälligen harmlosen Anlass. Gut möglich, dass er sie heute zur Probe eingeteilt hat. Sie hätte ihn doch einfach danach fragen können. Vielleicht hat er ein dramaturgisches Problem mit seinem Singspiel, vielleicht gerade mit diesem albernen Kann denn Liebe Sünde sein, warum nimmt sie nicht mehr Anteil daran? Schließlich hat sie ihn auf dieses Projekt gebracht.
Und dann dieser Carius römisch zwo. Ist es nicht sehr einleuchtend, dass Miss Babyspeck sich einen dieser flotten jungen Schnaftis aussucht? Praktikum bei der Versicherungswirtschaft, BWL also, zweisitziger Roadster vom Vater zum Abitur, auch wenn ich nicht weiß, wie sie es darin treiben, jedenfalls hat das mehr Chic als im angejahrten Peugeot des Lehrerehepaars Höge, also wirklich. Trotzdem wird sie sich die Sitzpolster nächstens einmal genauer ansehen.
Schluss jetzt. Sie wird die Straßenbahn nehmen, zu Hause eine Tablette schlucken und erst einmal schlafen.
»Ach das«, sagt der Baron, ein Sektglas in der einen und ein Brötchen mit Räucherlachs in der anderen Hand, »ich dachte schon, dass Sie danach fragen würden.« Der Baron arbeitet im Pressereferat der Universität, gelegentlich kann Franziska etwas von ihm erfahren, was brauchbar ist, vielleicht hat er ein unterdrücktes Mitteilungsbedürfnis, weil die Leute sonst nur ungern mit ihm reden, es sei denn am Telefon.
»Es ist sein Sohn«, fährt der Baron fort und nimmt einen Schluck Sekt, »Junior war an einer dieser NRW-Unis auf der Vorschlagsliste für irgendwas schrecklich Alttestamentarisches, bei dem Vater ist es ein Wunder und dann irgendwo auch wieder keins, dass der Sohn Theologe geworden ist, und dann hat es eine Mitbewerberin gegeben, wieso studieren Frauen so etwas? Aber das Besetzungsgremium hat entschieden, gleiche Qualifikation, also kommt die Frau zum Zug.«
»Und jetzt übt der Senior Rache?«
»Auge um Auge, Buch um Buch. Steht schon im Alten Testament, hab ich mir sagen lassen.«
»Danke«, sagt Franziska. »Wenn ich einen Stein finde, schmeiß ich ihn in Ihren Garten.«
»Wer schmeißt heut noch mit Steinen. Moralkeulen sind angesagt . . .«
Über den Kies der kleinen Grünanlage hüpfen graubraun gefiederte Spatzen. Sie sehen staubig aus und suchen zwischen Zigarettenkippen nach Brotkrumen. Der Mann sitzt auf einer Bank. Eine Taube lässt sich auf dem Kies nieder, wenig später folgt ein Täuberich und beginnt, sie gurrend zu umkreisen. Der Mann versucht durchzuatmen. Irgendwie ist er hierher gekommen, es war vor ein paar Minuten, vielleicht war es auch schon länger her, bleiben kann er hier nicht. Wer sagt es denn, dass ihm die Marionette nicht folgen wird und auf ihn zeigen will, wieder und wieder?
Dann fällt es ihm ein. Er wollte in das Kaufhaus. Es liegt auf der Südseite des Bismarckplatzes, man muss nur die Straßenbahngleise überqueren. Er zwingt sich aufzustehen, und trotz der Hitze zieht er das zerknautschte Jackett an, das neben ihm auf der Bank liegt. Wenn man mit der Jacke über dem Arm in ein Kaufhaus geht, werden die Detektive misstrauisch.
An den Auslagen mit Sommerkleidern vorbei betritt er die Eingangshalle, die kühle Luft, die aus der Klimaanlage bläst, lässt ihn frösteln. Suchend sieht er sich um, das Kaufhaus muss vor einiger Zeit umgebaut worden sein, früher hat es ein Selbstbedienungsrestaurant im Untergeschoss gegeben, jetzt ist dort ein Heimwerkermarkt. Das ist ärgerlich. Wo ein Restaurant ist, müssen sie auch eine Toilette haben, sonst darf es nicht genehmigt werden.
»Kann ich Ihnen behilflich sein?« Ein Mensch mit Hundeblick hat sich vor ihm aufgebaut. An der Brusttasche seines hellblauen Hundediensthemdes baumelt ein Plastikausweis.
»Danke«, antwortet der Mann. »Das heißt nein. Ich suche. . .« Ja, was sucht er eigentlich?
»Menschenskind, du . . .!« sagt Hundeauge. »Ich hab dich erst gar nicht erkannt.« Er packt die Hand des Mannes und drückt zu. Der Mann erschrickt. Revier Mannheim-Innenstadt? Oder noch in Weinheim. Irgendwas mit – Welt. Weltner? Wellner? Wallat?
»Chikago, mittlerer Bezirk«, fährt der Untersetzte fort, »unsere Späßchen von damals. Na ja. Wie lange ist das her? Auch schon bald 30 Jahre. Und so lustig war das alles ja auch nicht.«
Stegner? Nein. Steguweit. »Nein, besonders lustig war es nicht«, sagt der Mann.
»Richtig«, meint Steguweit, und seine Stimme klingt plötzlich lauernd. »Jetzt weiß ich es wieder. Du bist dann ja ausgeschieden. . . Und was machst du jetzt denn so?«
»Ich bin in Rente.«
»Sei froh.« Steguweit schaut ihn zweifelnd an. »Doch nicht wegen der Sache von damals?«
»Es ist halt nicht mehr gegangen«, sagt der Mann.
»Ah ja«, macht Steguweit. »Kann ich gut verstehen. Bin ja auch nicht mehr dabei. Der Schichtdienst, verstehst du. Ich mach jetzt hier den Sicherheitsdienst. Wenigstens hab ich da meinen regelmäßigen Feierabend.«
Der Mann nickt.
Steguweit nähert sich ihm vertraulich. »Was brauchst du denn? Wir haben hier nämlich Kollegenrabatt. Und vielleicht gibt es auch noch Remittenden-Ware, das geht« – Steguweit zwinkert kurz – »also das geht praktisch unter der Hand ...«
Ein Glas Wasser, denkt der Mann. Aber das muss ich nicht gerade dir auf die Nase binden. »Einen Schlagbohrer, aber es muss etwas Solides sein.« Wie kommt er darauf? So weit ist das sogar richtig, er hat wirklich keinen. Und die Decke im Wohnblock ist der reine Stahlbeton.
»Wenn es weiter nichts ist.« Steguweit zeigt zur Rolltreppe. »Wir haben da unten eine erstklassige Heimwerkerabteilung. Aber ich geh mit und rede ein Wort mit dem Ersten Verkäufer.« Er neigt vertraulich den Kopf und sagt halblaut: »Der Junge ist mir noch was schuldig.«
Der Junge ist ein etwa 40 Jahre alter Mann mit einem fliehenden Kinn und einem Ausdruck in den Augen, den der Mann sofort versteht. Es ist Angst, Steguweit hat den Verkäufer in der Hand und nimmt ihn aus wie eine Weihnachtsgans, plötzlich erinnert sich der Mann an die Geschichte mit dem Mädchen, das außerhalb des Sperrbezirks auf den Strich gegangen war. Es war keine schöne Geschichte gewesen, und Steguweit war nur davongekommen, weil ein paar Kollegen einen glatten Meineid geschworen hatten.
Sie stehen zu dritt in dem kleinen Kabuff hinter der Kasse, und der Verkäufer schleppt eine Schachtel nach der anderen her. »Es ist Eins-a-Ware«, versichert er, »nur die Verpackungen sind ein wenig angestoßen, bitte sehen Sie selbst, und das Gerät hier hat einen Fehler im Lack . . .«
Es ist ein solide Maschine mit stufenlos verstellbarem Getriebe, die dem Mann schwer und Vertrauen erweckend in der Hand liegt, den Ladenpreis schätzt er auf gut und gerne 150 Mark. Aber das hat keine Bedeutung. Er muss hier raus. Er erträgt es nicht. Was erträgt er nicht? Steguweit. Die Erinnerungen. Das Kabuff. Den Blick des Ersten Verkäufers.
»Wie viel?«, fragt er. Der Verkäufer wirft einen ängstlichen Blick auf Steguweit. »Zwanzig Mark.« Der Mann holt sein Portemonnaie heraus und fingert zwei Zehn-Mark-Scheine heraus, dazwischen fällt ihm ein grüner Zettel zu Boden, er will sich bücken, aber der Verkäufer ist schneller und reicht ihm den Zettel, der Mann nimmt ihn und steckt dem Verkäufer das Geld zu, der grüne Zettel ist der Beleg des Schuhmachers, dem er vor einer Woche ein paar schwarze Halbschuhe zum Besohlen gebracht hat.
»Du siehst«, sagt Steguweit, »wir lassen einen alten Kumpel nicht im Stich.«
Als er das Kaufhaus wieder verlässt, schlägt ihm die Hitze wie eine Wand entgegen. Er hat die Jacke wieder ausgezogen und trägt sie in der einen Hand, in der anderen hält er die Einkaufstüte mit dem Schlagbohrer, den Dübeln und den Haken, die der Verkäufer ihm als Dreingabe herausgesucht hat. Die Schuhmacherwerkstatt liegt in der Nähe des St.-Josefs-Krankenhauses, nur wenige Minuten Fußweg entfernt, aber schon nach wenigen Schritten breiten sich in seinem Hemd große nasse Schweißflecken aus.
Er überquert die Kreuzung an der Kurfürstenanlage und kann dann wenigstens im Schatten gehen. Doch die Hitze brütet überall zwischen den Häusermauern. Auf einem Innenhof spielen Kinder Seilhüpfen. Der Mann bleibt stehen und wischt sich den Schweiß von seiner Stirnglatze. Die Kinder sind Mädchen, acht oder neun Jahre alt, zwei lassen das Seil kreisen, das dritte hüpft lässig und in aufrechter Haltung darüber hinweg, es trägt einen blonden Pferdeschwanz und einen Rock, der beim Hüpfen hochfliegt und ein weißes Höschen zeigt.
Der Mann spürt, dass ihn jemand beobachtet. Es ist eine Frau mit Brille und scharfen Gesichtszügen. Er nickt ihr zu und geht weiter, ehe sie zu zetern beginnt.
Der Laden des Schuhmachers liegt in einer Seitenstraße. Er mag den Geruch der Werkstatt. Der Schuhmacher bringt die Schuhe, sie sehen nicht aus wie neu, sondern so, wie getragene und frisch besohlte Lederschuhe aussehen sollen. Der Mann bezahlt und verlässt den Laden, die Plastiktasche mit dem Werkzeug in der einen, die Jacke und eine Papiertüte mit den Schuhen in der anderen Hand.
Er geht zurück, in Richtung des Busbahnhofs, und kommt dabei an einem kleinen Platz mit Recycling-Containern vorbei. Einer der Behälter ist von einem Hilfswerk aufgestellt, das gebrauchte Schuhe sammelt. Der Mann bleibt stehen, dann holt er die beiden Lederschuhe aus der Tüte und bindet sie mit den Schnürsenkeln zusammen und steckt sie in den Container. Wenig später erreicht er den Bahnhof, ein Bus der Linie 41 wartet schon, er steigt ein und stellt sich in den tiefer gelegten Mittelraum, denn die Sitzplätze sind schon belegt von jungen Leuten mit Badezeug, die zu einem der Baggerseen wollen, und von Frauen, die vom Einkaufen kommen oder vom Arzt. Kurz darauf startet der Busfahrer und der Mann überlässt sich seinen Gedanken.
Birgit irrt durch die langen Flure, links und rechts gleiten die Verschläge mit den halbhohen Glasfenstern an ihr vorbei, die Glasscheiben sind blind von Staub, warum findet sie das Feuilleton nicht? Sie hat die Maupassant-Novelle übersetzt, die Blätter liegen glatt und sauber getippt in ihrer Hand, die Novelle soll in der Juni-Beilage erscheinen, und die wird doch vor der Abendmesse gedruckt, die Flure werden immer dunkler, plötzlich ist sie in der Bierschwemme in Q 11, das kann aber nicht sein, sie arbeitet doch in Heidelberg im Droste, irgendjemand hämmert auf dem verstimmten Klavier, vor dem Tresen sitzt das Mädchen aus der Lokalredaktion und trinkt Bier aus der Flasche, ich hab die Übersetzung, will Birgit sagen, aber dann sieht sie, dass das Mädchen sie schon hat, die Übersetzung ist aus Silber mit blassroten Granatsteinen.
Hat gerade mal vierfuffzich gekostet, sagt das Mädchen und schüttelt ihre Staubfängerlocken, und Birgit wacht auf, den Mund klebrig vom Schlaf.
Unten in seinem Musikstudio klimpert Hubert auf seinem Flügel, irgendwie klingt es aber nicht nach Chopin. Birgit schließt die Augen, das Geklimper hört nicht auf, plötzlich fällt ihr der Titel ein, es ist Non, je ne regrette rien, also arrangiert er wieder an seinem Potpourri herum. Was das nur werden mag, manchmal gibt es schon etwas zu bedauern, zum Beispiel, einen Pianisten zum Mann zu haben und keinen, der einem einen Kaffee kocht.
In einem der ersten Dörfer außerhalb Heidelbergs steigt der Mann aus, geht an einer kleinen Kirche aus schmutzig gelbem Sandstein vorbei und eine Straße hinab, die an kümmerlichen Häusern mit Eternit-verkleideten Fassaden vorbeiführt. Er nickt zwei Männern zu, die ihm entgegenkommen und die er vom Sehen kennt, und sieht lieber weg, als er der alten Vettel begegnet, die einen Stützwagen vor sich her schiebt. Nun hängst du mal nicht am Fenster, das trifft sich aber gut. Vor einem Wohnblock mit verblasstem rotem Anstrich bleibt er stehen und schließt auf und wirft einen Blick auf seinen Briefkasten. Er ist leer. An Kinderwagen und Fahrrädern vorbei geht er zur Treppe. Langsam und bedächtig, sodass er nicht außer Atem kommt, steigt er bis zum dritten Stock hoch.
In seiner Wohnung geht er in die Küche, legt die Plastiktüte mit dem Schlagbohrer auf den Tisch und holt aus dem Kühlschrank eine angebrochene Flasche Mineralwasser. Er nimmt einen kräftigen Schluck, dann schraubt er die Flasche wieder zu und stellt sie zurück. Er überlegt kurz, ob er eine der Tabletten nehmen soll. Es ist nicht mehr nötig. Er geht zum Besenschrank und holt die Trittleiter. Im Wohnzimmer schließt er mit einem Verlängerungskabel den Schlagbohrer an und steigt auf die Leiter. Er würde zwei Haken brauchen, und er würde sie seitlich der Deckenlampe anbringen, damit er nicht auf die Stromleitung trifft.
Er setzt den Schlagbohrer auf und drückt den Starthebel. Kalkiger Putz spritzt ihm in die Augen, aber die Betondecke ist so hart, dass sie den Schlagbohrer abfedern lässt wie eine Gummiwand. Der Mann lässt den Starthebel los und wischt sich den Kalk aus den Augen. Dann setzt er den Bohrer noch einmal an. Die Maschine kreischt auf und versucht auszubrechen, aber der Mann hält sie mit harten kräftigen Händen gepackt und zwingt sie, sich in den Beton zu fressen.
Schließlich setzt er den Bohrer wieder ab. Sein Gesicht ist kalkverschmiert. Das Loch ist noch nicht tief genug, bei weitem nicht. Er stellt eine höhere Geschwindigkeit ein und versucht es erneut. Das Kreischen schwillt an, aber diesmal dringt der Bohrer tiefer.
Das müsste reichen.
Der Mann lässt den Hebel los. Irgendjemand hämmert gegen seine Wohnungstür. Er steigt von der Leiter, geht zur Tür und späht durch den Spion.
Vor der Tür steht ein dicker unrasierter Mann in einem schmuddeligen T-Shirt. Der Bosnier aus der Dachwohnung.
Der Mann öffnet.
»Wastu machen für Krach? Ich haben Spätschicht, Menschekind.«
»Entschuldigung«, sagt der Mann. »Ich bin gleich fertig. Nur noch einmal. Kommt nicht mehr vor.«
Er schließt die Tür und kehrt zur Trittleiter zurück. Der Dübel passt in das Bohrloch. Er dreht den Haken ein, bis er unverrückbar fest sitzt.
Wenig später hat er auch den zweiten Haken eingedübelt. Er steigt von der Trittleiter und geht mit dem Schlagbohrer in die Küche zurück und verstaut ihn in einer Schublade mit anderem Werkzeug. Im Bad wäscht er sich das Gesicht und die Hände. Mit dem Staubsauger säubert er den Teppichboden. Dann geht er durch die Wohnung und schließt die Fenster. Er blickt auf den gegenüberliegenden Block und überlegt, ob er die Jalousie herunterlassen soll. Aber die Alte, die dort sonst immer am Fenster hängt, ist nicht zu sehen. Brave Alte. Schieb dein Wägelchen.
Aus seiner Kommode holt er Schreibzeug und setzt sich an den Tisch. Er hat lange keinen Brief mehr geschrieben, und auch früher hatte er es nicht gerne getan. Lange überlegt er, schließlich fällt ihm ein, dass er im Grunde nur eine Frage hat, und dass sie ganz einfach ist. In einem Zug schreibt er Datum, Anrede, den einen Satz und darunter seinen Namen. Er liest den Brief noch einmal durch, dann steckt er ihn in einen Umschlag, klebt den Umschlag zu und adressiert ihn.
Er sollte noch aufs Klo.
Wieshülen, 28. Juni, abends
Die Sonne ist untergegangen, und ein rötlicher Schimmer zieht sich über den Himmel. Die Tafelberge der Alb schieben sich in die dunstige Ebene vor, scharf umrissen und doch fast durchscheinend, als seien sie aus dunklem Glas. Tief unten auf der Bundesstraße haben die Autofahrer die Lichter eingeschaltet und kriechen aneinander vorbei wie Prozessionen von Leuchtkäfern. Sie kommen von den Industriedörfern des Unterlandes, deren Lichterteppiche sich im Nordwesten erstrecken, oder sind auf dem Weg dorthin.
Neben dem Vorsprung, auf dem Florian Grassl steht, sind Stufen in den Fels geschlagen. Hier beginnt der Franzosensteig, doch ein weißrotes Plastikband versperrt den Weg, der zwischen Krüppelkiefern und Buchengehölz hindurch in eine Tiefe geführt hätte, die bereits mit der Dunkelheit zu verschmelzen beginnt. Den Steig hinab kam man sonst ins Tal hinunter und zu der Bushaltestelle dort. Aber der Dauerregen des Frühsommers hat einen Teil des Weges weiter unten weggespült und nahezu unpassierbar gemacht.
Florian Grassl, ein mittelgroßer, trotz seiner kaum 30 Jahre schon etwas dicklicher Mann, blond und mit sorgfältig gestutztem Schnurrbart, hat ohnehin nicht vor, ins Tal zu gehen. Beim Abendessen hat er zwar angekündigt, er wolle noch nach den Fledermäusen sehen. Gerolf Zundt hatte ihn nur leer angesehen. Schließlich macht Grassl öfters solche Spaziergänge. Und am Felsen gibt es wirklich Fledermäuse.
Grassl dreht sich um und geht auf dem Weg zurück. Nach wenigen Metern kommt er zu der Kreuzung mit dem Wanderweg, der den Albtrauf entlangführt. Er wendet sich nach rechts, in Richtung zum Schafsbuck. Ein wenig Abwechslung ist nicht zu viel verlangt. Den ganzen Tag über hat er sich durch den Staub und Moder von Bücherkisten wühlen müssen, die Zundt von einem seiner Gönner hinterlassen worden waren. Nachtwache auf dem Toten Mann, Sturm um die Höhe 304, Wetterleuchten auf dem Linge heißen die Titel, die er erfassen und verzetteln muss. Manche der alten Scharteken sind in Leder gebunden, andere broschiert und zum Teil noch nicht einmal aufgeschnitten.
»Kostbarkeiten der Zeitgeschichte«, hatte Gerolf Zundt geraunt, das Runzelgesicht verschwörerisch zusammengefaltet, als er am Nachmittag kurz in der Bibliothek vorbeischaute und von Grassls Arbeitstisch einen der broschierten Bände aufnahm.
Grassl lächelt fein. Er muss daran denken, wie sich Zundts Gesicht unversehens ins Kummervolle umgefaltet hatte. »Wie dürfen wir denn das verstehen?« Der broschierte Band ist Oskar Wöhrles »Bumserbuch«, 1925 in Konstanz erschienen.
»Es ist ein Kriegsbuch«, hatte Grassl geantwortet. »Der Autor war Kanonier. Ein Bumser also. Lustig gemeint hat er den Titel aber nicht. Wöhrle war damals Pazifist und linker Sozialist. Später allerdings hat er sich den Nationalsozialisten angeschlossen. Oder besser: sich ihnen angedient.«
»Ein Märzgefallener also?«, hatte Zundt gefragt.
»Nein, erst später. Es war sozusagen eine Überlebensfrage.«
»Stellen Sie es in den Giftschrank«, hatte Zundt angeordnet. »Ich möchte nicht, dass meine Gattin das sieht. Morgen kommt übrigens ein Besucher, Professor Schatte aus Freiburg, dem können Sie es natürlich zeigen.«
Auch beim Abendessen – Kräuterquark und Apfelschalentee – war der morgige Besucher Thema gewesen. Margarethe Zundt, die Hohe Frawe, wie Grassl sie insgeheim nannte, hatte wissen wollen, ob der Gast über Nacht bleiben werde.
»Nein«, hatte Zundt geantwortet, »wir wollen uns nur unterhalten, Faden schlagen . . . Vielleicht kann ich ihn für unser nächstes Frühjahrsseminar gewinnen.«
»Ein Weisheitslehrer?«, hatte die Hohe Frawe wissen wollen. »Nein«, antwortete Zundt, »kein Philosoph. Ernst Moritz Schatte hat einen Lehrstuhl für Kommunikationstheorie und Internationale Politik, hochinteressanter Mann, die Medien reißen sich um ihn . . .«
Die Hohe Frawe war nicht angetan. »Ich wünschte, es gäbe noch Wissende«, bemerkte sie strafend. »Nicht nur solche, die sich ins Fernsehen drängen und die Hände in den Hosentaschen haben.«
Zundt hatte etwas davon gemurmelt, dass die Akademie doch auch mit der Zeit gehen müsse, und sich seinem Knäckebrot mit Kräuterquark zugewandt. Nach einer Weile, noch kauend, war er wieder auf das Frühjahrsseminar zu sprechen gekommen. »Es soll sich diesmal mit der globalen Herausforderung für das Europa der Nationen beschäftigen, ein eminent wichtiges Thema . . . der Erhalt unserer gesamten abendländischen Kultur hängt davon ab. Wenn ich nur daran denke, welchen Schund und Schmutz ich dieser Tage in der Kreisbücherei habe entdecken müssen, Romane von diesem Grass, Asterix-Hefte, alles mit Steuergeldern angeschafft, kein Wunder, dass die jungen Leute keine Werte mehr kennen . . .«
»Und dieser Gelehrte – der wird darüber sprechen?«, hatte die Hohe Frawe wissen wollen.
»Ich denke, er wird tiefer graben . . . Im Grunde geht es um nichts weniger als den Begriff des Gesellschaftlichen im 21. Jahrhundert. Wir wollen da eine umfassende Ausarbeitung vorlegen, vielleicht wird daraus auch eine —«, er hatte gezögert und mit einem Anflug von plötzlichem Zweifel das angebissene Knäckebrot betrachtet, »wie soll ich sagen – eine institutionelle Mitarbeit.«
Jetzt, im Wald, überlegt Grassl, wie er das im Sinn der Hohen Frawe am besten ausdrücken würde. Anstaltshafte Mitarbeit? Oder gar eine leitungsweise? Auch für ihn kein so besonders schöner Gedanke. Der Herr Professor aus Freiburg könnte sonst wo Leute kennen . . . Vergiss es. Ewig ist nirgends. Er verlässt den Wanderweg und folgt behutsam einem Pfad entlang einer Fichtenschonung. Rechts neben ihm liegt ein Buchenwald, dessen glatte helle Stämme er mehr ahnen als sehen kann. Weiter vorne ist ein Wanderparkplatz. Vorsichtig sucht er sich seinen Weg, schließlich bleibt er stehen und horcht.
Der Wald schweigt. Grassl geduldet sich. Zeit muss man haben, sonst hat es keinen Sinn. Das Ohr muss sich auf die Geräusche des Waldes einstellen, auf das Rascheln der Tiere und auf das, was sonst noch zu hören ist. Man muss ein Teil des Waldes werden, Teil der Dunkelheit, unsichtbar und unhörbar.
Hoch und klagend schreit ein Vogel. Ein Käuzchen? Grassl überlegt, ob er sich vorsichtig durch die Schonung hindurch auf den Parkplatz zubewegen soll. Er würde sogar sehr vorsichtig sein müssen. Irgendetwas liegt in der Luft. Manchmal fahren sie mit ihren Autos bis unter die Bäume.
Er schiebt sich an einer Jungfichte vorbei.
Das matt glänzende schwarze Auto steht so unmittelbar vor ihm, dass er beinahe gegen die Fahrertür gelaufen wäre. Grassl spürt, wie sein Herz bis zum Hals schlägt. Für einen Augenblick überkommt ihn das dringende Verlangen, sich umzudrehen und durch die Schonung zu brechen und davonzurennen, so schnell ihn die Füße tragen.
Doch in dem Wagen rührt sich nichts. Niemand ist darin. Es ist ein schwarzer BMW mit einem Rennlenker und gelben oder jedenfalls hellen Lederpolstern. Grassl legt die Hand auf die Motorhaube. Sie ist noch warm.
Er überlegt. Wenn sie ausgestiegen waren und hier irgendwo zwischen den Fichten liegen, hätte er sie längst hören müssen. Aber er hatte nichts gehört.
Also ist es etwas anderes. Ein einzelner Mann? Jedenfalls keiner aus dem Dorf. Keiner der jungen Leute von dort hat ein solches Auto. Aus seiner Hosentasche holt er den Schlüsselbund mit der Minilampe, bückt sich und sieht sich das Kennzeichen an, wobei er den Lichtschein mit der Hand abschirmt. Der BMW ist in Stuttgart zugelassen.
Womöglich jemand wie ...? Grassl verzieht das Gesicht. Der Wagen ist nicht klug geparkt. Überhaupt nicht klug. Falls es kritisch wird, muss der Fahrer mit dem BMW ja auf den Wanderparkplatz zurückstoßen.
Na ja, du wirst schon sehen, wie dir das bekommt.
Behutsam schiebt er sich an den Jungfichten vorbei und gelangt in ein Waldstück mit älteren Bäumen. Er umgeht den Wanderparkplatz, bis er zu einem Holzstoß am Waldrand kommt, von dem aus er sowohl den Parkplatz als auch die Zufahrt zu ihm einsehen kann. Es ist ein günstiger Standort, denn wenn er sich umdreht, überblickt er den Waldrand links davon und die Hochfläche mit den Wacholderweiden bis hin zum Gelände der Johannes-Grünheim-Akademie.
Er holt sein Fernglas hervor und stellt es ein. Es ist ein Nachtsichtgerät, wie es eine Blondine in einem Outdoor-Katalog um den Hals hängen hatte. Die Blondine steckte in Springerstiefeln und einem fleckfarbenen Bustier.
Der Parkplatz ist leer. Er zuckt mit den Achseln und beginnt, mit dem Glas den Waldrand abzusuchen.
Auch da ist niemand. Vielleicht ist es noch zu früh am Abend. Er wendet sich nach rechts, zur Akademie, und bekommt zunächst nur das dunkle Dach des Gästehauses ins Blickfeld. Dann plustern sich die Kronen der Kastanien, satt und dunkelgrün, vor dem Nachthimmel auf und schimmern im Widerschein des Lichtes, das aus dem Akademiegebäude fällt. Licht brennt nicht nur in Zundts Arbeitszimmer, sondern auch in den Bibliotheksräumen im ausgebauten Walmdach und unten im Erdgeschoss. Grassl kann einen Schatten sehen, der sich im Arbeitszimmer hin und her bewegt.
Was treibt Zundt da? Um diese Zeit hockt er sonst vor dem Fernseher, trinkt Portwein und schlummert sanft in die Schlafenszeit hinüber, während die Hohe Frawe ihre Tarotkarten legt. Vermutlich tut sie das auch jetzt, denn im Brentano-Salon brennt Licht. Die Hausmeisterwohnung hingegen ist dunkel.
Freißle sitzt also schon im »Waldhorn«. Grassl geht mit dem Fernglas noch einmal den Waldrand ab. Nichts. Vielleicht liegt es daran, dass er gewohnt ist, auf andere Hinweise zu achten. Die Stelle, an der die Dunkelheit auf andere Weise dunkel ist als die Bäume darum herum, hätte er fast übersehen. Er ist mit dem Fernglas schon darüber hinweg, als er innehält und noch einmal den Waldrand davor absucht.
Beim zweiten Hinsehen wundert er sich, dass es ihm nicht gleich aufgefallen war.
Unter dem Schutz einer ausladenden Buche steht ein Mann, dunkel gekleidet und an den Stamm gelehnt. Angelehnt hat er sich, um sein Fernglas besser halten zu können.
Der Kollege. Wenn man ihn so nennen kann. Aber wieso hat er es auf die Akademie abgesehen?
Donnerstag, 29. Juni
In einem Büro des Neuen Baues, dem Sitz der Ulmer Polizeidirektion, ist die Kriminalkommissarin Tamar Wegenast – Dezernat I, Kapitalverbrechen – damit beschäftigt, Ablagekörbe aus Plastik mit Papierservietten auszulegen und Butterbrezeln darin zu arrangieren. Auf dem Tisch, auf den sie die Körbe stellt, steht außerdem eine Batterie von Weinflaschen, Großbottwarer Trollinger für den, der Rotwein vorzieht, und Auggener Schäf Gutedel.
»Die Kollegen werden ja so intelligent sein und Gläser mitbringen?« , fragt sie einen älteren Mann, der sich über eine herausgezogene Schreibtischschublade gebeugt hat.
»Schauen Sie, was ich gefunden habe«, antwortet der Mann und richtet sich wieder auf. Er steckt in einem grauen Glencheck-Anzug und hat sich zu einem blauen Hemd eine rote Krawatte umgebunden. »Eine alte Ausgabe von Johann Peter Hebels Kalendergeschichten.« Er lächelt verlegen und hält einen in verblasstes rotes Leinen gebundenen Band hoch. »Ich erinnere mich, dass ich das irgendwann im Herbst bei einem Antiquar gekauft habe. Als Trost. Es war nasskalt und neblig, und ich hätte mich am liebsten damit nach Hause verkrochen. Aber ob das jetzt drei oder fünf Jahre her ist, weiß ich wirklich nicht mehr.« Dann bemerkt er Tamars Blick.
»Entschuldigen Sie. Zur Intelligenz der Kollegen möchte ich mich eigentlich nicht mehr äußern. Für die Beschaffung von Trinkgefäßen wird es wohl reichen.«
btb Taschenbücher erscheinen im Goldmann Verlag, einem Unternehmen der Verlagsgruppe Random House GmbH
1. Auflage Genehmigte Taschenbuchausgabe Juli 2003
Copyright © 2001 by Libelle Verlag, Lengwil am Bodensee
Umschlaggestaltung: Design Team München Umschlagfoto: Wolf Huber Satz: IBV Satz- und Datentechnik GmbH, Berlin RK · Herstellung: Augustin Wiesbeck
eISBN 978-3-641-10476-4
www.btb-verlag.de
www.randomhouse.de
Leseprobe