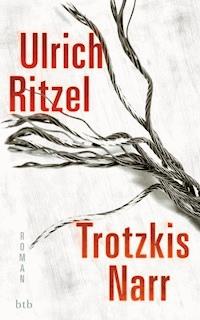7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb
- Kategorie: Krimi
- Serie: Berndorf ermittelt
- Sprache: Deutsch
Ulm, in einer Wohnung der Gemeinnützigen Heimstätten: Charlotte Gossler, Jahrgang 1936, wird tot, fast mumifiziert aufgefunden, nachdem das besorgte Schreiben türkischer Nachbarn an die Hausverwaltung, man habe die Frau seit langem nicht mehr gesehen, offensichtlich monatelang verschlampt wurde. Trotzdem scheint es zunächst ein absoluter, wenn auch trauriger Routinefall zu sein. Das Ableben der alten Dame war ein natürliches, eine Fremdeinwirkung kommt laut Gerichtsmedizin wohl nicht in Frage. Da stößt Kommissar Markus Kuttler beim Sichern des Tatortes auf ein Tagebuch mit aufschlussreichen und teilweise verstörenden Notizen. Es stammt vom Sohn der Toten, einem gewissen Tilman Gossler – er hat es bis kurz vor seinem mysteriösen Unfalltod geführt. War es vielleicht gar kein Unfall, war es vorsätzlicher Mord? Gemeinsam mit seiner Kollegin Tamar Wegenast macht sich Kommissar Kuttler daran, den Fall von damals neu aufzurollen. Sie stechen in ein Wespennest. Denn Tilmans Tagebuch enthält brisante Beschuldigungen, die von ungeahnter Tragweite für laufende Geschäfte sind und bis in die besten Kreise Ulms führen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 528
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Ulrich Ritzel
Uferwald
Roman
btb
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Datenkonvertierung eBook:
Kreutzfeldt Electronic Publishing GmbH, Hamburg
www.kreutzfeldt.de
1. Auflage
Copyright © by btb Verlag
in der Verlagsgruppe Random House GmbH, München
ISBN-13: 978-3-641-01282-3V003
www.btb-verlag.de
Schere, Stein, Papier
Die Fensterläden waren vorgelegt, das Fenster stand offen. Ein Radio lief, kaum hörbar, die grünen Lichtpunkte des Monitors flimmerten im Halbdunkel. Sonst brannte kein Licht. Tagsüber drang ein Widerschein der roten Farbe, mit der die Fensterläden gestrichen waren, ins Zimmer. Einer der Fensterflügel war durch ein Buch festgehalten, das zwischen Rahmen und Kante klemmte. Der andere Flügel schwang auf und wieder zurück, wenn ein Windstoß an den Fensterläden rüttelte. Früh am Morgen hörte man, wie der Berufsverkehr auf dem Autobahnzubringer einsetzte, ein gleichmäßiges Rauschen, das erst am späten Abend wieder abebbte.
Oben an der Kante der Fensterlaibung schlossen die Läden nicht ganz, so dass bei Sonnenschein ein schmaler Lichtstreifen ins Zimmer fiel. Er zeigte sich, wenn die Sonne über den Michelsberg hochgestiegen war, und wanderte dann allmählich durch das Zimmer nach links. Am späten Vormittag erreichte er den Schreibtisch und die Fotografie, die dort in einem Holzrahmen aufgestellt war, so dass das Bild einen trapezförmigen Schatten auf das helle Eschenholz der Schreibtischplatte warf. Am frühen Nachmittag berührte der Lichtstreifen das Tastentelefon, auf dem seit einem Samstagnachmittag im Juni das rote Signal des Anrufbeantworters blinkte. Zuletzt fiel das Licht auf ein halbhohes Gebilde aus Kabeln und Drähten, das einen Autoscheinwerfer trug wie ein einzelnes herausgerissenes Auge.
Es war ein heißer Sommer, und im Juli gab es einige heftige Gewitter. Bei einem hatte sich der rechte Fensterflügel aus seiner provisorischen Verankerung gerissen. Das Buch, das man dazu benützt hatte, lag seither aufgeblättert auf dem Boden. Damals war auch die Fotografie umgestürzt, und aus der obersten Ablage waren einzelne Blätter ins Zimmer gewirbelt worden. Im August erschien der Lichtstreifen etwas später und wanderte tiefer ins Zimmer hinein, so dass er auch die Hand erreichte, die auf der Schreibtischplatte lag und bei der die Fingernägel inzwischen deutlich aus dem Nagelbett hervorgetreten waren. Es sah aus, als seien sie gewachsen, aber es ist ein Volksmärchen, dass sie das tun.
Nach dem Anruf im Juni hatte das Telefon noch einige Male geläutet, aber niemand hatte mehr auf den Anrufbeantworter gesprochen. Im Juli hatte es einmal an der Wohnungstür geklingelt, es waren Adventisten auf Hausmission. Einige Tage später hatten zwei Schulmädchen, die auf dem Sperrmüll eine verrostete Spendenbüchse des Roten Kreuzes gefunden hatten und damit die Wohnblocks abklapperten, Sturm geläutet. Danach blieb es lange ruhig, bis Anfang September der Türke Murad Inönü, der im Erdgeschoss eine Änderungsschneiderei betrieb, klingelte. Er wartete eine Weile vor der Wohnungstür, dann stieg er wieder die Treppen hinunter und rief nach seiner zwölfjährigen Tochter Fatima, die ihm auch sonst seine Briefe aufsetzte, wenn die Gewerbeaufsicht etwas von ihm wollte oder die Berufsgenossenschaft.
Der Oktober war warm und sonnig. In der zweiten Monatshälfte setzte Föhn ein, im Süden sah man die Alpen als blassblaues, gezacktes Band. In der neuen Naturbau-Siedlung Eschental überlegte Harald Treutlein, ob er später das Rennrad nehmen und eine Zwanzig-Kilometer-Runde übers Hochsträß und durch das Blautal zurück drehen sollte, so viele schöne Tage würde es nicht mehr geben. Einstweilen hatte er noch immer den orange-farbenen Anorak in der Hand, den Johannes auf gar keinen Fall anziehen wollte, während Mona – bereits für das Rad eingepackt – das wohlerzogene Gesicht aufsetzte, mit dem sie den Kraftproben zwischen ihrem Bruder und ihrem Vater zusah.
»Wenn du den Anorak nicht anziehst und krank wirst, können wir heute Nachmittag nicht ins Hölzle.«
Im Hölzle hatte die Elterninitiative einen Abenteuerspielplatz angelegt, aber das Argument war trotzdem schwach, weil man niemandem, auch keinem fünfjährigen Kind, einen Zusammenhang zwischen dem Anorak am Morgen und dem Spielplatz am Nachmittag einreden kann.
»Wir verhandeln hier erst gar nicht«, ertönte von oben die energische und ein wenig scharfe Stimme von Isolde. Dann kamen ihre Füße, die in gut gearbeiteten Lederstiefeletten steckten, die Treppe herab, und gleich darauf die ganze Person, die klein und kompakt war, Aktentasche in der einen, Autoschlüssel in der anderen Hand.
Mit Isoldes Auftreten war der Fall entschieden. Johannes schlüpfte gehorsam in seinen Anorak, Mona zog enttäuscht eine Schnute, und Harald wandte sich zur Garage, um das Fahrrad mit den beiden Kindersitzen auf die bekieste Einfahrt zu schieben.
»Ach Schatz!«, hörte er Isolde in seinem Rücken, »holst du mir meinen Kamelhaarmantel vom Schneider? Du weißt doch, der Türke auf dem Michelsberg ...«
Harald verzog das Gesicht.
»Der Zettel liegt auf der Kommode unterm Garderobenspiegel.«
Im Verwaltungsgebäude der Gemeinnützigen Heimstätten saß Luzie Haltermann am Besprechungstisch ihres Dienstzimmers dem Personalrat Hundsecker gegenüber und betrachtete etwas ratlos den Schreibblock, den sie sonst für ihre Notizen benutzte.
»Bitte«, sagte Hundsecker und beugte sich über den Tisch, »keine Notizen! Ein vertrauliches Gespräch, verstehen Sie? Es geht ja auch nicht um Kritik an Ihrem Führungsstil, in keinster Weise...«
Luzie Haltermann sah über Hundsecker hinweg auf das Bild an der Seitenwand ihres Büros. Es war eine Leihgabe aus dem Depot des Städtischen Museums und zeigte eine Winterlandschaft, kahle Bäume säumten eine Straße, die sich am Horizont verlor. Immer noch redete Hundsecker, Luzie verstand nicht genau, was er eigentlich wollte. Die Wortgirlanden tasteten sich an den Begriff der sozialen Kälte heran, an die Probleme einer alleinerziehenden Mutter, allmählich begriff sie.
»Das ist aber nett«, unterbrach sie den Personalrat, »dass Sie die Probleme alleinerziehender Mütter ansprechen... Denken Sie da vielleicht an die Mütter, in deren Wohnungen die tropfenden Wasserhähne nicht gerichtet werden und die kaputten Jalousien auch nicht, weil alle Aufträge im Schreibtisch einer bestimmten überforderten Arbeitskraft hier im Hause liegen bleiben?«
»Überfordert!«, echote Hundsecker, »das ist ein Wort, das so leichthin gesagt wird, was heißt das schon? Vielleicht stimmt da im Organisationsplan etwas nicht, und wenn es so ist, dann müssen wir darüber reden...«
Harald Treutlein hatte Johannes und Mona im Freien Kindergarten abgeliefert und noch kurz mit der blonden Mutter von Monas Freundin Rebecca über die Demonstration gesprochen, mit der die Bürgerinitiative Eschental in den nächsten Tagen den Leuten im Stadtplanungsamt »d’ Henna rein tun« würde, wie er sich ausdrückte. Die Blonde hatte ihn etwas verständnislos angestarrt, zu spät war ihm eingefallen, dass sie aus Norddeutschland stammte, und so hatte er eilends ein schwächliches: »Die Flausen werden wir ihnen schon noch austreiben...« nachgeschoben. Die Blonde war in dieser Woche als Hilfe eingeteilt. Ohne die Mitarbeit der Eltern wären die Beiträge nicht zu halten. Harald zum Beispiel hatte in den Ferien den neuen Fußboden selbst verlegt, er hatte das absolut fachmännisch gemacht, nicht einmal das städtische Bauamt – das ihnen sonst gerne jeden Knüppel in den Weg warf, der aufzutreiben war – hatte etwas zu beanstanden gehabt. Jetzt fuhr er von der Au über den Michelsberg zurück, er kannte den Weg gut, es wunderte ihn nur, wie lässig er die Steigung hochfuhr, er musste nicht einmal aus dem Sattel. Früher hatte er spätestens an der zweiten Querstraße in den Wiegetritt wechseln müssen.
Dann lag auch schon die Steige hinter ihm, er rollte an den Villen vorbei, von denen einige in den letzten Jahren aufwendig renoviert worden waren, schließlich war das hier eine begehrte Wohnlage. Der graubraune Wohnblock mit den abblätternden roten Fensterläden freilich sah nicht so aus, als sei dort in den letzten Jahren auch nur ein Cent investiert worden, und der Apfelbaum streckte seine kahlen Zweige so hilflos über den vertrockneten Rasen wie eh und je. Merkwürdig, ein Haus zu sehen, in dem jemand gelebt hatte, den man früher ganz gut kannte, mit dem man sogar befreundet war.
Er stieg ab, schob das Rad zu dem überdachten Fahrradständer neben den Mülltonnen und schloss es sorgfältig ab, mit zwei Stahlseilen. Ohne es eigentlich zu wollen, warf er einen Blick auf die Schilder der Klingeltafel. Unverändert, mit dem immer gleichen altmodischen Schriftzug, stand der Name »Gossler« an seiner alten Stelle.
Die Änderungsschneiderei Inönü lag im Erdgeschoss. Es roch nach Bügeldampf, an einer Deckenschiene hingen Anzüge, Mäntel, Kleider, an einer Nähmaschine saß ein grauhaariger Mann. Eine gebückte Frau mit Kopftuch brachte Isoldes Mantel, dessen Seitentaschen eingerissen gewesen waren. Offenbar hatte Isolde noch anderes ändern und Säume herausnehmen lassen, die Frau mit Kopftuch zeigte die Änderungen vor und erklärte sie. Harald verstand zwar nichts, nahm aber an, dass alles in Ordnung war, und fand den Preis von 25 Euro »praktisch geschenkt«, wie er später Isolde sagen würde.
Er zahlte, verstaute den Mantel in seinem Rucksack und wandte sich zum Gehen.
Dann blieb er noch einmal stehen. »Ach, sagen Sie – wie geht es denn der Frau Gossler? Wissen Sie, die Dame im vierten Stock...?«
Luzie lehnte sich in ihrem Schreibtischstuhl zurück, schloss für einen Moment die Augen und massierte sich die Schläfen. Das Gespräch mit Personalrat Hundsecker war doch noch recht unerquicklich geworden, und ihr Vorschlag, dass sie gemeinsam den Schreibtisch der krank gemeldeten Sachbearbeiterin und alleinerziehenden Mutter Gudrun Fudel in Augenschein nehmen sollten, war von ihm empört zurückgewiesen worden.
Das Telefon klingelte, Luzie meldete sich, ein Herr Harald Treutlein sei am Apparat, sagte die Sekretärin, und lasse sich nicht abwimmeln.
Seufzend nahm Luzie das Gespräch an.
»Juffy, was willst du?«
»Das ist ein ziemliches Geschiss, bis man dich am Apparat hat«, hörte sie Treutleins Stimme sagen, die wie immer ein wenig zu munter klang. »Bist du so wichtig geworden?«
Es lag Luzie auf der Zunge, etwas über die Arbeit im Allgemeinen und die von Hausmännern im Besonderen zu sagen. Aber sie war heute schon in genug Fettnäpfchen getreten.
»Du erinnerst dich doch an die alte Frau Gossler?«, fuhr Harald fort. »An Tilmans Mutter?«
Ja doch, dachte Luzie. Natürlich erinnere ich mich.
»Ich weiß nicht, ob du es weißt – aber sie wohnt noch immer in eurem Block auf dem Michelsberg. Nur hat man sie dort seit Monaten nicht mehr gesehen«, fuhr Treutlein fort. »Die übrigen Mieter hat das wohl nicht weiter gekümmert, nur den türkischen Änderungsschneider aus dem Erdgeschoss, er hat seine Tochter einen Brief an die Hausverwaltung schreiben lassen, also an euch, und weißt du, was passiert ist?«
»Ich ahne es«, antwortete Luzie müde. »Nichts ist passiert, und die Tochter des türkischen Schneiders hat auch keine Antwort bekommen, nicht wahr?«
»Aber du hast den Brief?«
»Nein«, sagte Luzie, »ich habe den Brief nicht, aber ich kann mir denken, wo er ist. Wir haben hier nämlich ein kleines Problem mit dem Organisationsplan, verstehst du? Aber der Personalrat wird darüber nachdenken, und dann wird alles gut.«
»Ich kann dir gerade nicht ganz folgen.«
»Macht nichts. Aber ich schicke sofort jemand hin, der nach der Wohnung sieht.«
»Und nach der Frau«, hakte Treutlein ein. »Weißt du, ich habe immer gedacht, wir hätten...«
»Sicher«, unterbrach ihn Luzie. »Wir hätten. Immer gibt es etwas, was man hätte tun sollen. Aber du hast ja jetzt angerufen, und ich denke, dass ich keine Zeit verlieren sollte. Gruß an Isolde!«
Und damit war das Gespräch zu Ende.
In seiner Wohnung legte Harald Treutlein den Hörer auf. Der guten Luzie ist ihr Job ein bisschen zu Kopf gestiegen, dachte er.
Auf Gleis 1 des Hauptbahnhofs schlossen sich die Türen des ICE, fast unmerklich setzte sich der Zug in Bewegung, Kriminalkommissarin Tamar Wegenast, eine groß gewachsene, schlanke Frau, hob den Arm und winkte. Sie war noch jung und trug langes, dunkles, hochgestecktes Haar.
»Und du glaubst wirklich, dass der jetzt weg ist?«, fragte der Mann neben ihr. Tamars Kollege Markus Kuttler war kleiner als sie und hatte ein Gesicht, das sich niemand merken konnte. »Einfach weg und nicht mehr da?«
»Kuttler, halt’s Maul«, antwortete Tamar und winkte weiter. Ein Mobiltelefon klingelte. Der Zug verschwand in der Kurve, die ostwärts am Michelsberg vorbeiführt.
Tamar trat zwei oder drei Schritte zurück, in den Schutz einer Plakatwand. Noch im Gehen holte sie das Handy aus der Tasche ihres Jacketts. Während sie zuhörte, verzog sie ein wenig das Gesicht. Kuttler betrachtete die Plakatwand, sie zeigte eine frei im Raum stehende Skulptur aus Metall, oder genauer: aus Schrott, und kündigte eine Ausstellung freier oberschwäbischer Künstler an.
»Wir kümmern uns drum«, sagte Tamar schließlich, stellte das Handy ab und wandte sich an Kuttler. »Eine Leichensache, oben auf dem Michelsberg. Du oder ich?«
»Wie üblich«, antwortete Kuttler und hob die Hand. Eigentlich ist das keine gute Idee, dachte er dann. Bisher hatte er bei Schere-Stein-Papier noch jedes Mal verloren. Besonders gern bei Leichensachen. Im Herbst zum Beispiel, wenn die Pilzesammler finden, was sie nicht gesucht haben. Das letzte Mal war es ein Junkie gewesen, in einem Austragshaus auf der Alb, schon drei Wochen tot, Tamar hatte Schere genommen und er dummerweise Papier. Also wird sie denken, dachte Kuttler, ich werde denken, dass sie das nicht schon wieder tun wird, also wird sie wieder Schere nehmen, und ich gewinne mit Stein...
Aber Tamar hatte Papier genommen.
»Ich hasse dich«, sagte Kuttler.
»Es ist eine alte Frau«, teilte ihm Tamar mit. »Offenbar die getrocknete Variante. Also mach kein Gesicht.«
Charlotte Gossler war 1936 geboren und hatte – nach dem Passfoto zu schließen – ein schmales Gesicht mit einer spitzen Nase gehabt. Als das Foto entstand, war sie noch nicht grau gewesen oder hatte sich das Haar tönen lassen, und trug eine Dauerwelle.
Den Reisepass hatte Kuttler in dem Sekretär gefunden, der in dem kleinen Wohnzimmer mit der blauen Sesselgarnitur stand. Auch im Wohnzimmer waren die Läden vorgelegt. Der Sekretär war aus lackiertem hellem Holz, mit zierlichen Messingbeschlägen auf den einzelnen Fächern. In dem Fach mit dem Reisepass befanden sich außerdem Kontoauszüge, die bis zum April dieses Jahres datiert waren, die Rentenbescheide der letzten Jahre, ferner eine Urkunde der Industrie- und Handelskammer, mit der die Sekretärin Charlotte Gossler für ihre 30jährige Betriebszugehörigkeit geehrt wurde, und schließlich ein Vertrag mit einem Bestattungsunternehmer, an den eine Art Scheckkarte geheftet war.
Kuttler zog ein zweites Fach auf, die Schublade ging ziemlich schwer und war bis obenhin mit Fotoalben voll gepackt. Er schlug eines davon auf, die Fotos zeigten fast ausnahmslos nur ein Motiv: einen jungen Mann mit schmalem, etwas spöttischem Gesicht, einmal auf dem Fahrrad, dann wieder bei einem Badeurlaub, lesend oder Schach spielend. Ein Foto schien im Spätherbst oder Winter aufgenommen worden zu sein, der junge Mann schob einen Rollstuhl mit einem kümmerlichen Menschen, der aus breiten Zahnlücken in die Kamera griente. Andere Aufnahmen zeigten ihn mit Gleichaltrigen, auch Mädchen darunter, aber im Vergleich zu ihnen allen wirkte er schmächtig und sah aus wie der Junge, der beim Völkerball als Letzter in die Mannschaft geholt wird.
Kuttler legte das Album zurück und nahm ein zweites heraus, wieder der junge Mann, diesmal deutlich jünger, halb ein Kind, einmal in einem dunklen Konfirmationsanzug, mit einer weißen Nelke im Knopfloch. Auch dieses Album legte Kuttler zurück und wollte schon die Schublade schließen, als er plötzlich – ohne recht zu überlegen, warum – innehielt und den ganzen Stapel herausnahm.
Ganz unten in der Schublade, in einer blau getönten Klarsichtfolie, lag eine Todesurkunde. Er nahm sie heraus, sie war ausgestellt auf Tilman Lukas Gossler, geboren am 5. Juni 1975, gestorben am 1. Januar 1999.
Kuttler verzog das Gesicht. Er war selbst Jahrgang 1975, aber was hatte ihn das zu stören? Ihn beschäftigte etwas anderes. Der Hausmeister hatte die Leiche nicht etwa hier gefunden oder im Schlafzimmer, sondern im Zimmer nebenan. Es war das Zimmer eines jungen Mannes, vermutlich eines Studenten, für einen Augenblick hatte Kuttler gedacht, es könnte das Zimmer eines Untermieters sein, und das wäre ein doch etwas merkwürdiger Fundort gewesen. Aber jetzt sah das anders aus.
Er erhob sich und ging in die Küche. In der Spüle stand eine Tasse mit einem angetrockneten Bodensatz, der Teebeutel lag noch auf der Untertasse. Es war ein Hagebuttentee gewesen, so stand es auf dem kleinen Papierschild am Ende des Fadens, der den Beutel hielt. Kein Teller, kein Besteck. Im Abfalleimer grünlich-weißer Schimmel, Kuttler zog einen Plastikhandschuh über die rechte Hand und durchsuchte den Abfall. Es waren keine Tablettenschachteln darunter, und so ging er ins Bad. In einem Fach des Toilettenschranks entdeckte er einen Nassrasierer und eine gebrauchte, völlig eingetrocknete Tube Rasiercreme. Ein anderes Fach hatte als Hausapotheke gedient; neben Venensalben, Korodintropfen zur Herzstärkung und gewöhnlichen Kopfschmerztabletten fand Kuttler darin ein Flakon mit Johanniskrautpastillen, dazu eines der stärkeren Schlafmittel und ein Antidepressivum. Alle Packungen waren angebrochen, aber nicht leer.
Kuttler zuckte die Schultern. Kovacz würde schon herausfinden, woran die alte Dame gestorben war. Schlimmer war, dass er noch immer keine Adresse eines Angehörigen gefunden hatte. Widerstrebend ging er noch einmal in das Zimmer, in dem man die Leiche gefunden und vor einer knappen halben Stunde abgeholt hatte.
Er schaltete das Oberlicht ein. Eine Schlafcouch mit einer rotweiß gemusterten indianischen Decke darüber. Ein Schwarzweißposter zeigte einen abgerissenen zahnlosen alten Mann. Ein Clochard? Aber einer mit einem Schreibblock in der Hand. Der Schreibtisch. Das Radio, das noch immer lief. Fast körperlich spürte Kuttler Unbehagen. Schlimm war nicht der Geruch. Er hatte das Gefühl, dieses Zimmer erwarte jeden Augenblick die Rückkehr des rechtmäßigen Bewohners, als sei dieser nur eben Zigaretten holen gegangen.
Noch immer blinkte der Anrufbeantworter. Er ging zum Schreibtisch und drückte auf die Abspieltaste.
»Sie haben eine neue Nachricht«, sagte die Telekom-Stimme. Dann eine zweite Stimme, die einer Frau, mit einer kaum merklichen schwäbischen Tonfärbung:
»Guten Tag Frau Gossler, hier spricht die Isolde Scheuch, vielleicht erinnern Sie sich an mich. Ich wollte Sie fragen, ob ich Sie einmal besuchen darf. Rufen Sie mich doch einfach an. Ach – ich heiße jetzt Treutlein...« Sie nannte ihre Telefonnummer.
Kuttler notierte sich den Namen. Dann sah er das gerahmte Foto, das mit der Rückseite nach oben auf dem Schreibtisch lag, und drehte es um, das Foto war die Vergrößerung eines Schnappschusses und zeigte den jungen Mann aus dem Fotoalbum, aber rechts unten war ein Trauerband eingelegt, ein schräger schwarzer Balken. Kuttler wandte sich vom Schreibtisch ab und musterte das Bücherregal. Ein dicker roter Kunststoffband sprang ihm ins Auge – der Schönfelder, die Gesetzessammlung, mit der – unter den Arm geklemmt – Juristen so gerne spazieren gehen. Daneben entdeckte er juristische Fachliteratur, genauer: Lehrbücher. Ein Jurastudent? Der deutlich größere Teil der Bücher schien aber aus Romanen, Erzählungen und Gedichtbänden zu bestehen. Wenn er das alles wirklich hat lesen wollen, hat er nicht viel studiert, dachte sich Kuttler und bückte sich über ein Buch im Taschenformat, altmodisch in Leinen gebunden, das auf einem kleinen Wandbrett am Kopfende der Schlafcouch lag, und entzifferte den Titel: »Hunger« von Knut Hamsun.
Er wandte sich ab und wäre beinahe über ein weiteres Buch gestolpert, das aufgeschlagen, mit dem Rücken nach oben, auf dem Boden lag. Er bückte sich und hob es auf. Der Band hatte dazu gedient, den einen Fensterflügel festzuhalten, war dann aber heruntergeweht worden. Auf dem grünen Umschlag mit dem Titel: »Materialien zur Tradition der sozialistischen deutschen Literatur« war von der Fensterkante ein schwärzlich verfärbtes Dreieck eingedrückt worden. Kuttler schlug das Buch auf, aber die Seiten waren leer. Er schüttelte den Kopf und blätterte weiter, plötzlich erschienen Seiten, die beschrieben waren, von Hand beschrieben, die Handschrift war flüchtig, stark rechts geneigt, aber einigermaßen leserlich. Ein Tagebuch? Kuttler blätterte bis zur ersten Seite und wollte zu lesen beginnen.
In diesem Augenblick schlug die Türglocke an.
Die Büros der Vorstandsetage der Gemeinnützigen Heimstätten sind geräumig, aber nicht zu aufwendig möbliert, und das Dienstzimmer der Assistentin der Geschäftsführung ist in Größe und Ausstattung noch um ein Geringes – aber doch erkennbar – kleiner als die Büros der beiden Geschäftsführer. Vor allem aber besitzt es ein Panoramafenster, von dem aus man auf die mächtige Turmhaube der Wiblinger Klosterkirche sieht, die dort thront wie ein Dreispitz auf dem Kopf eines oberschwäbischen Kirchenfürsten.
In ihrem Blickfeld hatte Luzie Haltermann an diesem Nachmittag einen Karton voll unerledigter Vorgänge. Er stand auf ihrem Schreibtisch, und darin stapelten sich Briefe, Mahnungen, Beschwerden, Kostenvoranschläge, ein ganzes Archiv der Überforderung und Indolenz, darunter sogar eine Anfrage aus dem Gemeinderat, warum der Frauentreff im Sozialzentrum Buchenbronn seit Monaten leer stehe. Einen der Briefe hatte Luzie herausgenommen und vor sich auf die Schreibtischmatte gelegt. Der Brief war auf kariertem Papier geschrieben, in einer adretten runden Kinderhandschrift, und lautete:
»Sehr geehrter Herr Hausverwaltung! Die Frau Gossler aus dem vierten Stock habe ich nicht mehr gesehen seit Wochen. Bitte wollen Sie Euer Hausmeister schicken nachsehen das ihr nichts passiert ist sie ist viel krank und traurig. Das Haus ist Herwegh- Strasse 5.«
Darunter stand, in einer anderen, krakeligen Schrift, der Name Murad Inönü.
Für einen Augenblick überlegte Luzie, ob sie Personalrat Hundsecker anrufen und ihm den Brief vorlesen sollte, nur so, zur Tierquälerei. Doch dazu war jetzt keine Zeit. Vor einer halben Stunde hatte der Hausmeister, den sie in die Wohnanlage Michelsberg geschickt hatte, Bericht erstattet. Dass ein alter Mensch monatelang tot und vergessen in seiner Wohnung liegt, das mochte überall vorkommen. Aber dass ein Hinweis darauf wochenlang in der Verwaltung der Gemeinnützigen Heimstätten liegen blieb, war wieder etwas anderes.
Luzie gab sich einen Ruck. Der eine Geschäftsführer war seit Monaten krank, der andere auf einer Tagung der Katholischen Akademie. So konnte sie gleich den Schmied anrufen, in diesem Fall den persönlichen Referenten des Oberbürgermeisters, der erst vor kurzem mit dem Slogan »Für eine menschliche Stadt« wiedergewählt worden war und der in einem seiner Nebenämter auch dem Aufsichtsrat der Gemeinnützigen Heimstätten vorsaß. Andreas Matthes meldete sich fast sofort.
»Schleicher, da ist was blöd gelaufen«, sagte Luzie. »Dein Chef sollte vorgewarnt sein.«
Matthes hörte schweigend zu, während Luzie berichtete, und unterm Reden sah sie ihn vor sich, wie er Notizen machte. Den Spitznamen »Schleicher« hatte er sich schon in seinen frühesten Schuljahren eingefangen und war ihn seitdem nicht mehr losgeworden.
»Und wer ist die Tote?«, fragte er schließlich.
»Das kommt erschwerend hinzu«, sagte Luzie. »Es ist eine Charlotte Gossler.«
»Aber nicht...?«
»Doch«, sagte Luzie. »Wir werden nicht umhin können, einen Kranz zu kaufen.«
»Lass mal«, antwortete Schleicher, »wir müssen das offensiv behandeln. Die Heimstätten sollten die Beerdigung übernehmen, und ich rede mit dem Chef, dass er die Trauerrede hält.
Verstehst du, als Zeichen gegen die Vereinsamung alter Menschen.«
Luzie verzog das Gesicht. »Wenn er da mitspielt...«
Dann legte sie auf und drehte den Schreibtischsessel so, dass sie zum Panoramafenster sehen konnte, auf die Klosterkirche und weit hinaus auf die Hügellandschaft Oberschwabens. Aber was sie sah, war nicht die Landschaft, sondern ein Gesicht, ein mageres, spitzes Gesicht mit einem spöttischen Ausdruck darin, als wolle es sagen: Das ist unser Schleicher, liebe Luzie, wie er leibt und lebt und ich es nicht anders von ihm erwartet habe.
Der Mann, der vor der Tür stand, war um die dreißig und kräftig. Die muskulösen, ein wenig krummen Beine steckten in Radlerhosen, über seine Windjacke trug er einen kleinen Rucksack geschnallt. Er hatte dunkles Haar, das in einem Zopf nach hinten gebunden war, und lächelte Kuttler fast zutraulich an.
»Ich nehme an, Sie sind von der Polizei«, sagte er, »und vermutlich störe ich Sie in Ihrer Arbeit, aber Sie müssen wissen, dass ich es gewesen bin, der heute Morgen Alarm geschlagen hat... Treutlein ist mein Name, Harald Treutlein.« Er streckte Kuttler eine kräftige behaarte Hand hin. Kuttler erwiderte den Händedruck und bat den Mann in den kleinen Flur mit den gerahmten Fotos von Lanzarote und dem Garderobenständer, an dem noch ein Wintermantel mit einem kleinen Pelzbesatz hing.
»Weiß man denn schon, woran sie gestorben ist?«
Kuttler ging nicht darauf ein. »Sie kannten Frau Gossler?« »Ja«, antwortete Treutlein, »natürlich kannte ich sie...« »Wann haben Sie sie zum letzten Mal gesehen?«
»Das weiß ich gar nicht.« Die Antwort kam zögernd. »Wissen Sie, ich kannte vor allem ihren Sohn, und der ist ja nun schon eine Weile tot... das sind, warten Sie – das sind auch schon wieder sieben Jahre her, und seither komme ich nur selten hier vorbei, heute eigentlich nur, weil meine Frau ihren Kamelhaarmantel zum Schneider hier im Erdgeschoss gebracht hat.«
Wie hieß noch einmal die Frau, überlegte Kuttler, die auf den Anrufbeantworter gesprochen hatte? Isolde? Ich heiße jetzt Treutl ein...
»Ihre Frau heißt Isolde?«
»Woher wissen Sie?«, fragte Treutlein zurück.
»Sie hatte engeren Kontakt zur Frau Gossler?«
»Eigentlich nicht. Aber...«
»Wissen Sie, ob Frau Gossler irgendwelche Angehörigen hat?«
»Nein«, sagte Treutlein, »ich glaube nicht, da war nie die Rede davon... Fragen Sie wegen der Beerdigung?«
»Das hat sie wohl schon selbst geregelt.« Kuttler machte eine Pause und sah Treutlein ins Gesicht. »Dieser Sohn«, fragte er dann, »woran ist er denn gestorben?«
»Bei einem Unfall«, antwortete Treutlein. »Er war mit dem Fahrrad unterwegs, und da hat ihn ein Autofahrer angefahren und liegen gelassen. Gefunden hat man den Autofahrer nie. Wahrscheinlich war er betrunken. Es war in der Neujahrsnacht, müssen Sie wissen, in der Neujahrsnacht vor sieben Jahren.«
Nach dem Dienst war Kuttler noch ins Westbad gefahren und war zwanzig Runden – 1000 Meter – geschwommen, wobei er sorgfältig vermieden hatte, auf die Zeit zu achten. Jetzt stieg er, etwas müde, nicht ganz unzufrieden, die Treppe zu der Altbauwohnung hoch, die er vor einem Monat in der Neustadt bezogen hatte, einem Kleine-Leute-Viertel, das sich noch nicht entschieden hatte, ob es Slum oder Szene werden wollte.
Er schloss auf, legte seine Lederjacke über eine Bücherkiste und schaltete die kleine Stehlampe ein, die neben seinem Feldbett stand. Kuttler war hier eingezogen, als er und Kerstin sich getrennt hatten, und in den Wochen danach hatte er sich vor allem um die Renovierung ihrer bisherigen gemeinsamen Wohnung kümmern müssen. Er war es ja auch gewesen, der sie verwohnt hatte, zumindest hatte Kerstin das gesagt.
Im Bad hängte er sein Schwimmzeug auf, dabei stellte er zu seiner Verwunderung fest, dass die Plastiktüte mit dem als Materialien zur sozialistischen Literatur getarnten Tagebuch in seine Sporttasche geraten war. Das ging nun wirklich nicht, dass er sich Beweismaterial nach Hause mitnahm... Aber was hieß hier Beweismaterial? Die alte Frau war einfach gestorben, wahrscheinlich hatte sie nicht einmal nachgeholfen, ein Fremdverschulden, wie es im Polizeibericht heißt, war ausgeschlossen.
Er ging in die Küche, deren Einrichtung er vom Vormieter hatte übernehmen können. Er war sogar froh darum gewesen, denn das Mobiliar ihrer früheren Wohnung war bei Kerstin verblieben, die es ja auch ausgesucht hatte, damals, als sie noch zusammen waren. Er verstaute drei der vier Flaschen Bier, die er sich in der Kneipe an der Ecke hatte geben lassen, im Kühlschrank, die vierte öffnete er und nahm einen kräftigen Zug, Schwimmen macht Durst. Zum Abendbrot hatte er noch etwas Käse und eine Dose Thunfisch, morgen würde er vielleicht etwas Frisches besorgen können. Schließlich ging er aus der Küche in das, was sein Wohnzimmer werden sollte, setzte sich in den Korbsessel, den er vor drei Wochen als Grundstock einer Einrichtung gekauft hatte, und schaltete den kleinen tragbaren Fernseher ein. Die Landesschau berichtete über das Wetter, das schlechter werden würde, über die Weinlese, die reichlich ausgefallen war, über einen Banküberfall in Ochsenhausen, wo zwei bewaffnete und maskierte Männer über 20000 Euro erbeutet hatten, und schließlich auch über die Verabschiedung des Innenministers, der seinen politischen Ruhestand als Vorstandschef einer landeseigenen Brauerei verbringen würde... Kuttler überlegte, ob das Land Baden-Württemberg ihm wohl dereinst eine Kneipe überlassen würde, er wäre ja schon mit einer schnuckeligen kleinen zufrieden.
Das Programm, das danach kam, ödete ihn an, der einzige Film, der ihn hätte reizen können, wäre ein Western gewesen. Aber auf einem Kleinbildschirm kann man sich keinen Western anschauen. Nicht, wenn man Western mag. Kuttler stand auf, griff sich die Sporttasche und holte das Buch aus der Wohnung der Toten. Auf halbem Weg zu seinem Sessel blieb er stehen. Was hatte er in diesem Tagebuch zu lesen? Es ging ihn nichts an. Es gab keinen dienstlichen Anlass, es zu tun.
Er setzte sich, drehte den Schirm der Stehlampe zu sich herum und nahm das Buch aus dem Schutzumschlag. Es war in rotes Leinen gebunden und hatte ein merkwürdiges Format.
Schließlich schlug er es auf.
Tilmans TagebuchErster Teil
Samstag, 17. Oktober
Der Band stand in dem angestaubten Regal im Verschlag des Alten, zwischen trauernden Kakteen und Blechdosen mit Klebstoff.
»Klein Oktav, quer«, sagte der Alte, »was willst’n damit? Gedichte schreiben, was?«
Ich glaube, ich verzog mein Gesicht. Aber man soll die Leute nicht enttäuschen. Wenn er glaubt, dass der Studiker nach der Schicht in der Buchbinderei Gedichte schreibt, dann soll er das glauben. »Wenn Sie’s nicht weitererzählen.«
Ein Buch also, alles zu schreiben, was ich will. Was will ich? Ein bisschen Spaß. Also will ich aufschreiben, was mir begegnet. Wenn es lustig ist. Was begegnet mir?
Vorhin war Luzie da, schauen, wie es mir geht. Ist das lustig? Sie war mit Schleicher in den USA gewesen, erst in New York und dann mit dem Mietwagen quer durch den Westen, übernachtet haben sie in Motels, die Leute sind so freundlich, du machst dir keine Vorstellung, und wenn du einmal New York gesehen hast, dann lässt du keine andere Stadt mehr gelten...
»Es gibt nur eine Stadt, von der du das behaupten kannst: das ist Paris«, sage ich, und Luzie sagt, dass ich ihres Wissens noch gar nie dort gewesen bin, weder in New York noch in Paris, und erzählt weiter von den kalifornischen Stränden, und ich streite mich nicht mit ihr, weil das sowieso keinen Sinn hat, sondern bewundere ihre Nase, auf der sich die Haut vom Sonnenbrand schält. Wie hat der Schleicher das eigentlich ausgehalten?
»Oh, das glaubst du nicht, wie brav der sich eingecremt hat«, sagt sie, »rührend, wie ein kleiner Junge, der es von Mama eingetrichtert bekommen hat.«
Ich stelle mir Schleicher vor, wie er mit der emsigen Umsicht eines Waschbären seine Epidermis salbt, aber dann muss ich pinkeln, und als ich zurückkomme, hat Luzie diesen Blindband in der Hand und blättert ihn durch, die Oberlippe leicht hochgezogen, so dass die Pferdezähne freiliegen. Es ergibt sich folgender Dialog, auch wenn ich nicht glaube, dass wir das alles so gesagt haben, wie ich es hier aufschreibe, aber da ich ein bisschen Spaß haben will, erinnere ich mich eben so, wie ich es aufschreiben mag.
Luzie: »Deine gesammelten Werke, wie? Lauter leere Seiten.«
T: »Es ist ein Blindband. Ein Muster für Papierqualität und Einband. Ich hab’s mir mitgenommen. Für Vorlesungen und so.«
L: »Für eine Mitschrift ist das aber nicht sehr praktisch. Was hätte denn das für ein Buch werden sollen?«
T: »Ein philosophisches. Da hatte einer herausgefunden, wie die Welt sich dreht und warum es uns gibt und wozu das gut ist...«
L: »Und wozu ist es gut?«
T: »Ich weiß es nicht. Das Buch ist nie erschienen. Bevor es in Druck gehen sollte, kam der Autor nach Schussenried, in die Klapsmühle.«
L (sachlich, leicht beleidigt): »Das hast du jetzt wieder erfunden. Aber bitte. Und was machst du wirklich damit?«
T: »Im Sommer habe ich eine Geschichte gelesen, von der der Erzähler behauptet, er schreibe sie um seines Vergnügens willen auf, stell dir das mal vor! Das ist ein Satz, den heute keiner mehr schreiben könnte, schon deswegen nicht, weil keiner mehr weiß, was das ist: ein Vergnügen... Ey du! Is’ das so was wie Fun?«
L: »Schon gut, so schwer von Begriff bin ich auch wieder nicht. Aber sag mal – warum kannst du eigentlich nicht normal wichsen wie andere auch?«
So ist Luzie, und so redet sie. Wir fahren dann ins Kino, in Luzies neuem Wagen, einem blauen Mini Cooper mit roten Rallye-Streifen, sie hat ihn von ihren Großeltern bekommen, zum glücklichen Abschluss ihres Grundstudiums an der Verwaltungshochschule, mein Gott! Was legen sich die Leute für Autos zu, von den Berufen ganz zu schweigen. Außerdem ist es nicht ganz einfach, mit Luzie irgendwohin zu gehen, weil sich ständig irgendwelche Typen nach ihr umdrehen. Ihr schmeichelt das, aber mir, der ich neben ihr hertrotten muss, ist es lästig. Sie hat eine blonde Mähne, die ihr fast bis auf den Hintern hängt, aber außerdem den Ansatz zu einem Speckgürtel, ziemlich hoch an den Hüften, der beim Gehen den Eindruck erweckt, die ganze Masse könne ganz schnell ins Schlingern geraten. Ich nehme an, die Typen sehen ihr mit einer gewissen Beunruhigung nach, als überlegten sie, wo man da welche Schrauben anziehen müsste, damit die Unwucht behoben ist.
Im Kino gibt es einen lustigen Neuen Deutschen Film über lustige Neue Deutsche Männer mit Haargel-Frisuren, danach in den Glucks- Kasten, wo nur der Bilch sitzt, der aber auch kein wirklich lustiger Neuer Deutscher Mann ist, sondern Kaffee mit Kognak trinkt, weil das, wie er erklärt, die am meisten weltmännische Art ist, nicht betrunken zu werden. Außerdem teilt er uns mit, dass er demnächst dank irgendwelcher Optionen auf schwedische Elektronik-Aktien zehn Riesen einfahren wird, er hat sie praktisch schon in der Tasche und will sie alsbald erstklassig auf den Kopf hauen, und zwar in London: »Bisschen in der Börse rumschnüffeln, gucken, wie die Jungs da ihren Faden abspulen, vielleicht auch ein paar Connections knüpfen, und am Abend nach Covent Garden, ein feines altes Händel-Oratorium reinziehen...«
Luzie hört ihm zu, und ich betrachte ihr Gesicht und ihre Augen, aufgerissen und groß wie Scheunentore. Täusche ich mich, oder ist die ironische Bewunderung ein wenig zu dick aufgetragen, so, als gäbe es da einen Kernbestand, der nicht ironisch ist? Sollte sich Schleicher vielleicht ein wenig zu sehr um die eigene Epidermis gekümmert haben und ein wenig zu wenig um die Luzies? Blüht deswegen womöglich ein neues Glück mit dem Bilch? Sollte es so sein, will ich dabei nicht stören und gehe nach Hause, wo ich dieses Tagebuch beginne, mit Luzie und leider auch mit dem Bilch, etwas Besseres habe ich im Augenblick nicht zu bieten.
Sonntag, 18. Oktober
Sonntagnachmittag, und nichts hat sich geändert, manchmal denke ich, die Sonntagnachmittage sind die wahre Hölle. Spaziergang mit der Alten Frau auf dem Hochsträß, ja, schön ist das Herbstlaub in der Sonne, Indian summer sagen die Amerikaner zu dieser Jahreszeit... Ach, fragt die alte Frau, tun sie das?
Später zu Juffy, in die Einliegerwohnung, die ihm seine Eltern eingerichtet haben, Schachspielen mit Juffy ist ein etwas einseitiges Vergnügen. Irgendwann erzählt er mir von einem Rollstuhlfahrer, den er bei seinem Praktikum kennen gelernt hat, ein ganz kaputter Typ, zwanzig Jahre auf der Straße, aber ausgefuchst. Sie hätten immer um einen Fünfer gespielt, aber gegen Rolli-Rolf hätte er keine Chance, ob ich es nicht mal versuchen wolle?
Nun bezahlt die Neithardtsche Buchbinderei ihre Ferienarbeiter nicht so üppig, dass diese gleich mit Fünfern zocken könnten, und ich sage ihm das. Eine Flasche Bier als Einsatz gehe auch, meint er. Irgendwann ruft Isolde an, ob wir mit ins Roxy wollen, zu »Arsen und Spitzenhäubchen«, und ich sage, ich sei aus dem Alter raus, dass ich die Grimassen von Cary Grant lustig finde. Juffy ist dann mit ihr gegangen. Mit flatternden Fingern.
Sperrsitz, vermute ich mal, hintere Reihe.
Zuhause sagt mir die alte Frau, Isolde hätte angerufen. »Ich weiß«, sage ich.
Ganz spät nehme ich noch das Rad, nur so, um ein bisschen Luft zu schnappen. Das Fenster von Juffys Einliegerwohnung ist dunkel, ich sehe auch nirgends Isoldes alten Renault. Dass sie es bei ihr tun, glaube ich nicht, Isoldes Vater ist Werkmeister bei Magirus, fährt einen Daimler und hat auch sonst ziemlich viereckige Ansichten.
Montag, 19. Oktober
Die siebte Woche in der Buchbinderei hat begonnen. Neun Tage noch. Noch neun Mal um sechs Uhr in der Nacht das höhnische »Guten Morgen« des Radioweckers. Die Alte Frau im Morgenmantel, die mir einen Tee aufsetzt. Der Radweg in die Oststadt. Der Mief im Umkleideraum, Schweiß, Kernseife, die Ausdünstungen der Toiletten daneben, die nicht richtig abgetrennt sind, der Geruch nach heißem Leim und Maschinenöl, die scharfkantigen Ränder der frisch abgetrennten Papierbögen, die den Handballen immer wieder haarfeine Schnitte verpassen. Die zwei endlosen Stunden, bis auch nur die erste Pause erreicht ist. Die Nachmittagsstunden, die sich quälend hinziehen. Der Vorarbeiter Lengle, der mich ganz selbstverständlich duzt und sauer ist, wenn ich es mit ihm genauso tue. Die polnischen Hilfsarbeiterinnen, darunter Sofia, die scharfe Sofia, wie der Lengle sie nennt...
»Aber glaub bloß nicht, dass der schon mal irgendwas in der Sofia drinne gehabt hat, nich mal nen Finger«, sagt mir Rocco, als wir im »Bären« noch ein Bier trinken. Rocco arbeitet am Schneideautomaten und spricht ein Deutsch, wie man es nur in der Wiblinger Grundschule lernt.
Dienstag, 20. Oktober
Nach der Schicht im »Wichtig«, will Zeitung lesen, aber es sind ziemlich viele Leute da, so dass nur das »Tagblatt« noch zu haben ist. Ich sehe mich nach einem freien Platz um und sehe plötzlich, dass am Tischchen neben mir Isolde sitzt und zu mir hochschaut.
T: »Hast du das eigentlich bei uns in der Klasse gelernt?« Isolde (verhuscht lächelnd): »Was?«
T: »So zu gucken, dass man dich nicht sieht.«
I: »Ach, das! Das kannst du nicht in der Schule lernen. Das muss vorher da sein.«
Ich frage, wie »Arsen und Spitzenhäubchen« war, und sie fängt an, mir den Film zu erzählen, und ich sage, dass Filme-Erzählen noch unausstehlicher ist als Nudelsalat, und sie sagt, warum fragst du mich dann? Lies doch deine Zeitung!
Freitag, 23. Oktober
Wieder dämmert ein Freitagabend übers Land, also gehe ich in den GlucksKasten, etwas zu früh, aber Luzie und Schleicher sind schon da, beide noch immer leicht nachgedunkelt von der kalifornischen Sonne und der guten Hautcreme, aber Schleicher befindet sich im Geist bereits wieder ganz auf der Höhe der gesellschaftlichen Theorien und studiert irgendwelche Monographien, und damit er auch versteht, was er studiert, unterstreicht er jeden Satz, wobei er ein Lineal benutzt und zwei Kugelschreiber, einen mit roter und den anderen mit blauer Mine, und Luzie schaut ihm andächtig beim Unterstreichen zu. Der Bilch ist also wohl doch nicht näher in Betracht gezogen worden.
»Warum unterstreichst du nicht einfach bloß die Sätze, die du nicht unterstreichen willst?«, frage ich ihn, »dann hast du weniger Arbeit.« Aber Schleicher will dem nicht näher treten, auch treffen ein der Bilch und wenig später Isolde und Juffy, so dass Schleicher etwas widerwillig das Unterstreichen sein lässt und das Gespräch sich alsbald Luzies neuem Cooper zuwendet, dessen Rallye-Streifen aber so was von vorgestern sind, wie der Bilch vorträgt, fast so, wie wenn eine Schnepfe von ihrem Lover sagt, er sei ihr Lebensabschnittsgefährte, von all den anderen Dingen ganz abgesehen, die zu diesem Ding zu sagen wären, denn ein Auto könne man es ja wohl nicht nennen, und was Luzie sich überhaupt denke? Was würden denn die Wähler in Schnürpflingen sagen, wenn sie dort Bürgermeisterin werden wolle und mit einem entlaufenen Autoscooter vorfahre? Luzie sagt nichts, fragt aber irgendwann beiläufig, wie es denn den schwedischen Elektronik-Aktien geht, und der Bilch zieht die Mundwinkel herunter und sagt:
»Ein kleiner Schwächeanfall, eigentlich nur eine Kursbereinigung nach unten, hat nichts zu bedeuten...«
Dann kommt Puck, die freitags sonst nicht kellnert, und Schleicher bestellt eine Apfelsaftschorle, und Juffy sagt, dass Rallyestreifen zwar schon ziemlich übel seien, aber Apfelsaftschorle! Es gebe wohl keine schlimmere Pansche als dieses Schulausflugsgetränk, womöglich noch aus biodynamisch-ökologischem Anbau, und Schleicher antwortet doch tatsächlich, er wolle heute Nacht noch eine Doktorarbeit aus den sechziger Jahren exzerpieren, und wir anderen sehen uns an. Er brauche es für seine Diplomarbeit, fügt Schleicher hinzu und schaut sich um und bleibt mit seinem Blick ausgerechnet an mir hängen und sagt:
»Ich hab nicht so viel Zeit wie manche andere Leute hier...«
Ich sage, dass das eine lustige Art sei, Zensuren zu verteilen, was mich aber nicht besonders überrasche, weil ich Schleicher immer für den gehalten habe, der sich als erster in eine sichere bürgerliche Existenz begeben werde, und zwar im Schweinsgalopp in die eines Schulmeisters.
Er lacht nur, aber Luzie schaut mich an und sagt:
»Da gibt es Sachen, da darf man dich nicht danach fragen, was?«
Samstag, 24. Oktober
Frühstück zu Hause, die Alte Frau ist nervös, wuselt herum, schaut mich an, was hat sie nur? Dann muss sie plötzlich aufstehen und etwas holen, es ist eine Art Freizeitjacke, grün, aus einem Stoff, der so aussieht, als ob er wie Wildleder aussehen soll.
»Ich weiß, dass ich das nicht soll... aber eine kleine Freude muss ich dir doch machen dürfen... Wo du doch die ganze Zeit so hart arbeiten musst.«
Ich mache dann den Fehler und zieh das Ding an, aus Gutmütigkeit, und bin damit in den GlucksKasten, aus Dummheit, wo der Bilch hockt. Wie er mich sieht, ist er plötzlich hellwach:
»Was hast’n da? Aus dem Secondhand-Shop von Karstadt, ja?« Er schaut mich an, zupft am Stoff und gibt keine Ruhe. »Nett, wirklich. Ossis haben so was getragen, bis vor zwei oder drei Jahren, aber in Grün?« Schließlich bückt er sich, hebt eine Plastiktüte hoch und holt eine Jacke heraus, es ist eine Jacke aus richtigem Leder, und sie wird zehn Mal so viel gekostet haben wie dieses grüne Jöppchen hier.
»Kannste haben«, sagt der Bilch, »für einen Fünfziger. Praktisch neuwertig. Praktisch umsonst. Nur dass du nicht sagen musst, ich hätt dir ne Jacke geschenkt.«
Ich sage ihm, dass er sich seine Jacke sonst wo hinstecken soll, und gehe. Ich will ins »Wichtig«, treffe aber unterwegs die Puck, die heute nicht zum Kellnern eingeteilt ist und mich fragt, ob ich zufälligerweise und gegen alle Wahrscheinlichkeit ein Auto zur Verfügung habe und sie ins Kleine Lautertal fahren könne, wo sie sich in einer Kneipe vorstellen will. Ich schaue sie nur an, und sie lacht, und wir gehen im »1 7a« einen Kaffee trinken...
P: »Wo kommst du heute her?«
T: »Vom GlucksKasten.«
P: » War der Bilch da?«
T (unfröhlich): »Ja.«
P: »Hat er dir die Jacke verkaufen wollen?«
Schließlich erzählt sie mir die Geschichte, aber ich hätte es mir eigentlich denken können. Bilch war mit einer Frau und mit der Lederjacke vor ein paar Tagen im Jazzkeller, die beiden hatten sich aber in die Besenkammer verirrt, wo es dann auf der Lederjacke und im Handbetrieb zur Sache ging. Danach hatte das teure Stück einen Fleck, was den Bilch erboste und die Frau erheiterte, und zwar erheiterte es sie umso mehr, je mehr es den Bilch erboste.
»Und seither sucht er einen, dem er die Jacke andrehen kann.« »Die Frau – kenn ich die?«
»Glaub ich nicht.«
Mittwoch, 28. Oktober
Schleppe Rocco zur Neuen Linken ins Nebenzimmer der »Heidenheimer Stuben« mit, Juffy ist da, Pippi, Groucho und der Stächele Frieder, alle ganz angetan, dass ich einen richtigen Arbeiter mitbringe, der Stächele nimmt ihn gleich in Beschlag, redet von einem Listenplatz für die Kommunalwahl, Rocco wird es unbehaglich, ich gebe Frieder ein Zeichen, dass er sich Zeit lassen soll. Irgendwann muss dann Juffy das Wort ergreifen und auch zeigen, dass er wichtig ist, und erzählt von seinem Praktikum im Heim Zuflucht, das ist ein Heim für kranke Obdachlose, die dort zwangsbetreut werden, falls ich das richtig verstanden habe, auch der schachspielende Rollstuhlfahrer, den Juffy auf mich hetzen will, ist dort untergebracht. Juffy ist ganz aufgebracht, das sei ein Thema für die Kommunalwahl, sagt er, die armen Teufel hätten kaum ein Taschengeld und müssten um jede Fluppe betteln... Ich überlege, wie viele Prozentpunkte ein Wahlkampf für die Obdachlosen wohl zusätzlich bringen wird, 0,01 Prozent? Das wäre nicht einmal wenig, wenn man auch so bestenfalls auf 1,1 kommt. Plötzlich stelle ich fest, dass Rocco nicht mehr da ist, und finde ihn im Schankraum, wo ein Spiel um den Europapokal übertragen wird, Juventus gegen Olympique Marseille. Ich setze mich zu ihm, so blöd das auch sein mag.
Freitag, 30. Oktober
Letzter Arbeitstag beim Neithardt, ich muss eine Runde Bier ausgeben, immerhin fragt der Alte, ob er im nächsten Frühjahr wieder mit mir rechnen kann, so fragt er das wirklich, aber ich sage, dass ich vielleicht ein Auslandssemester belege, wahrscheinlich in den USA, ich weiß auch nicht, wie ich darauf komme, aber der Alte war es zufrieden. Ich glaube, er wäre enttäuscht gewesen, wenn ich nur gesagt hätte, ja, mal gucken...
Danach in den GlucksKasten, Bilch sitzt vor einem Glas mit Leitungswasser, das aber keins ist, sondern ein Gin Tonic, wie er mir erklärt, denn davon werde man »praktisch nicht betrunken«, freilich hätten sie hier keinen wirklich guten Gin, er werde dem Glucks einen besorgen, aber nur als Privatflasche für ihn selber, den Bilch also.
»Hast deine Jacke losgeschlagen?«
Plötzlich muss er lachen, er hat so eine kichernde Mädchenlache, dabei ist er ein plumper viereckiger Kerl.
»Noch am gleichen Abend!«
Auf dem Weg zu seinem Wagen, die Jacke unterm Arm, hätten ihn zwei Typen aus Klein-Kasachstan angehalten, was er denn da habe? Und Bilch hatte mehr Schiss als Verstand und doch noch so viel Geistesgegenwart, dass er ihnen das Stück hinhielt und jammerte, dass sie ihm das nicht wegnehmen könnten, das habe 3000 Mäuse gekostet, Einzelanfertigung!
»Und jetzt läuft da in Böfingen einer in meiner Jacke herum, stolz wie zehn nackte Neger...«
Ja, und die Jacke hat einen Fleck, nett.
Juffy kommt, und schließlich auch die anderen, wir reden über das Wintersemester, das für die meisten von uns in der kommenden Woche beginnt und inzwischen für keinen von uns ein so rasend spannendes Thema mehr ist, nicht einmal für Schleicher, dann hat Juffy den Einfall, dass er den Wetterbericht gesehen hat und dass es morgen schön wird und dass wir uns eigentlich einen Semester-Eröffnungs-Ausflug angewöhnen könnten... Ich glaube, Juffy ist in einem anderen Leben Dekanatsjugendführer gewesen.
Aber Puck schnappt das auf und sagt, das wär eine tolle Idee, wir könnten ins Kleine Lautertal gehen und uns die alternative Kneipe angucken, die dort aufgemacht hat. Zwar zieht Luzie gleich eine krause Nase und will fragen, wieso und wozu die Puck dort einsteigen will, aber wenn Luzie eine krause Nase zieht, dann ist es so gut wie sicher, dass die Clique anders entscheidet.
Samstag, 31. Oktober
Der Wetterbericht hat sich nicht geirrt, und ich mich auch nicht. Als mich Isolde abholt, sitzt auch schon Juffy in ihrem Renault, und im Fond auf dem Platz, neben den ich mich setzen soll, liegt Juffys Klimpermaunze...
T: »Was ist das?«
I: » Was?«
T: »Frag nicht so blöd.«
I: »Nun steig doch ein.«
T: »Nein.«
I: »Warum nicht?«
T: »Weil ich nicht bei den St.-Georgs-Pfadfindern bin. Weil ich nicht neben diesem Ding sitze. Weil ich wahnsinnig werde, wenn der da das Klimpern anfängt, womöglich noch ›We shall overcome‹ ...«
Das geht eine Weile so, schließlich nimmt Juffy das Ding nach vorne, und wir fahren los, der alte Renault röhrt gequält, vielleicht verträgt er Isoldes Fahrstil nicht, Juffy meint, wir werden froh sein müssen, wenn wir überhaupt bis Blaustein kommen, aber Isolde sagt, dass der Motor vor Behagen schnurre, wenn er so klingt, außerdem habe sie ihm versprochen, dass er in den nächsten Wochen frisches Öl kriegt und einen neuen Keilriemen, sie hat da hinter Söflingen eine kroatische Werkstatt zur Hand, da kostet die Inspektion noch nicht einmal ein Drittel von dem, was du sonst blechen musst... So kommen wir ins Kleine Lautertal hinter Blaustein, nett, ja doch, die Sonne scheint, die Lauter glitzert und mäandert zwischen den Bäumen mit ihrem bunten Herbstlaub, und von den Hängen schauen dich die Kalkfelsen mit ihren Höhlen an, dass du denkst, es sind prähistorische Götzen oder Trolle wie bei Tolkien. Irgendwann kommen wir zu fünf Häusern und einer Kirche, die Kirche sieht ziemlich evangelisch aus, ein’ feste Burg ist unser Gott, und die Häuser erinnern an feuchte Keller. Dazwischen erstens der Quelltopf der Kleinen Lauter, ein Becken unterhalb einer schrundigen Felswand, das Becken grün von Wasserpflanzen, und zweitens die Gastwirtschaft »Zum Lamm«, bei der man raten muss, dass sie so heißt, denn die altertümliche Aufschrift ist fast schon ganz abgeblättert. Drinnen ist eine Wirtsstube mit einem freistehenden Eisenofen und Holzbänken und einer Holzdecke, aber keiner neo-rustikalen, sondern einer, die es dort schon immer gegeben hat, mindestens seit dem 19. Jahrhundert, oder wie alt diese Kneipe sein mag... Juffy ist ganz still, und ich kann sehen, wie seine Dekanatsjugendführerseele sich ganz andächtig dem Anblick der alten Balken hingibt. Schleicher und Luzie sind auch schon da, Puck macht sich mit den beiden Frauen bekannt, die den Gasthof übernommen und wiedereröffnet haben, eigentlich dachte ich, auf die Eröffnung und den Betrieb von alternativen Landkneipen sei man in den Achtzigern verfallen und lasse es inzwischen wieder bleiben, aber bei uns geht offenbar alles irgendwie langsamer. Irgendwo höre ich Isolde schrill entzückt kreischen, wir suchen besorgt nach der Ursache und finden sie im früheren Stall, in dem jetzt eine Tischtennis- platte steht, wobei Tischtennis eine ähnliche Wirkung auf Isolde hat wie die Gitarre auf Juffy, mit dem Unterschied allerdings, dass Isolde nicht in diesem Maß unbegabt ist wie Juffy. Jedenfalls fliegen Schleicher, der von uns noch der sportlichste ist, die angeschnittenen Bälle nur so um die Ohren, was mir sehr gut gefällt, so dass ich mich befriedigt wieder vor mein Bier setze. Später essen wir alle Pfannkuchen zu Mittag, Juffy wird immer seliger, Holzbalken und Eisenofen und Pfannkuchen! Zum Glück gibt es noch andere Gäste außer uns, am Nebentisch sitzt ein Mann allein, als sei ihm der Kneipenlärm Gesellschaft genug. Vor allem aber hat er einen schwarzen Labrador bei sich, der daliegt und Juffy aus bernsteingelben Augen betrachtet, was diesen doch etwas dämpft, denn er hat Schiss vor Hunden.
Ich weiß nicht, aus welchem Grund, aber nach dem Essen fahren wir nicht zurück, mir ist es recht, es gibt Lustigeres als einen samstäglicher Fernsehabend mit der Alten Frau. Juffy und Luzie versuchen sich an der Tisch tennisplatte, ich will zu der Schlossruine, die etwas oberhalb der fünf Häuser liegt, Isolde und Bilch kommen ungefragt mit, was will der Bilch mit einer Ruine? Die Ruine liegt auf Baumwipfelhöhe über der Talsohle, oder genauer: die von Gehölz und Moos überzogenen Mauerreste tun das, eine Tafel teilt mit, dass hier einmal Paracelsus zu Besuch war. Der Anstieg ist nur kurz, aber Isolde und der Bilch schnaufen, Isolde, weil sie sich beim Tischtennis verausgabt hat, der Bilch, weil er noch nie Kondition hatte. Von der Ruine führen zwei Wege weiter den Hang hoch, ich will den steileren davon ausprobieren und sage den beiden, dass sie mich nicht zu begleiten bräuchten, Fußkranke könne ich nicht gebrauchen!
Der Weg führt nicht ganz den Hang hinauf, sondern verläuft etwas unterhalb der Alb-Hochfläche, aber doch hoch genug, dass man auf die Felsen auf der anderen Talseite herunterschauen kann. Ich denke – ich weiß nicht mehr was, Tagträume eben, oder warum ich meine Zeit mit solchen Langweilern wie dem Bilch oder Juffy vertue. An einer Weggabel gehe ich nach rechts, das ist ungefähr die Richtung, aus der ich gekommen bin, schließlich stoße ich auf einen Pfad, der wieder ins Tal führt, und sehe sehr bald unter mir den Vorsprung, auf dem die Ruine steht. Ich gehe weiter und bleibe stehen, weil irgendetwas merkwürdig klingt, ein Rascheln und Keuchen und Getue... die werden doch nicht? denke ich und gehe vorsichtig zwei oder drei Schritte weiter. Ich habe noch nie Leuten beim Bumsen zugesehen, ich weiß auch nicht, ob ich das will, eigentlich kann ich das nicht wollen.
Isolde liegt im Moos, etwas unterhalb der Ruine, und Bilch auf ihr drauf, aber er ist, soweit ich sehen kann, noch nicht sehr weit gekommen. Offenbar hat er die eine Hand in ihrer Hose, aber sie hat sie noch an und will sie sich auch nicht ausziehen lassen, jedenfalls wehrt sie sich und versucht, die Hand wegzustoßen. Plötzlich sieht sie mich, »Til, hilf mir doch«, ruft sie halblaut, ich mache ein paar Schritte auf sie zu und bleibe dann stehen, gegen einen Baum gelehnt. Wenn es ihr wirklich so schlimm ist, denke ich, warum schreit sie dann nicht richtig? Dann sehe ich, dass der Bilch ihr den Mund zuzuhalten versucht, aber das geschieht alles ein wenig täppisch, und plötzlich rammt ihm Isolde das Knie irgendwohin, und er rollt zur Seite und hält sich die Weichteile.
Dann steht Isolde auf und zieht den Reißverschluss ihrer Hose wieder zu und fängt an, sich das Laub aus Kleidern und Haar zu klopfen. Auch der Bilch kommt wieder auf die Beine, und während er seinen Hosenladen zuknöpft, bemerke ich, dass ich noch nicht viele Vergewaltigungen gesehen habe, aber das hier sei wohl ein besonders dilettantischer Versuch gewesen. Beide sagen nichts, wir gehen zu dritt und schweigend ins »Lamm« zurück, wo es Kaffee und Kuchen gibt und Juffy tatsächlich an seiner Gitarre herumzuklimpern beginnt. Ich warte darauf, dass jetzt das Große Tribunal stattfindet. Aber nein, es fällt kein Wort, Isolde sagt überhaupt nichts, und wenn das so ist, muss ich ja auch nicht davon anfangen.
Dienstag, 3. November
Wieder in dem kalten Loch in Tübingen-Lustnau, das kleine elektrische Heizöfchen macht einen staubigen Geruch, und die Lampe auf dem Kinder-Schreibtisch beleuchtet das Lehrbuch über Schuldrecht, Besonderer Teil, das ich vor zwei Semestern schon hätte durcharbeiten müssen. Mit dem Tauchsieder mache ich mir Wasser heiß für einen Tee, und zwar nicht, weil ich jetzt unbedingt einen Tee bräuchte, sondern nur so, und überlege mir dabei, ob ich versuchen soll, die Sätze, von denen mir keiner in den Kopf gehen will, von denen ich nicht einen auch nur annähernd verstehe und deren Worte in dem Augenblick jeden Sinn verlieren, in dem ich versuche, sie in einen Zusammenhang zu bringen – ob ich also versuchen soll, diese Sätze zu unterstreichen, nach der Methode Schleicher, ich hätte sogar einen Vierfarben-Stift, da würden die Wortgirlanden sich zu einem bunt gewirkten Teppich ausbreiten, einem Wunderteppich der Jurisprudenz, mit dem ich Tausendundeine Klausur überfliegen könnte... Bevor ich ganz und gar verrückt werde, fahre ich aber mit dem Bus in die Stadt und gehe in die Kneipe an der Neckarmauer und trinke einen Glühwein, ich sitze an der Theke und bin – so kommt es mir vor – der einzige, der da allein hockt, ohne Gesellschaft, ich trinke den Glühwein und höre zu, keinem einzelnen Gespräch, sondern dem gleichförmig rauschenden Kneipenlärm, dieser akustischen Ausdünstung trinkender, rauchender Menschen...
Einmal hat mich die Alte Frau zu Ferien auf dem Bauernhof – wie soll ich sagen? – deportiert, wir saßen in einer Ferienwohnung fest und sahen uns die Streifentapete an, es war also ganz schrecklich, und abends musste ich Milch aus dem Kuhstall holen, den seltsamen Geruch nach Gras und Kuhscheiße habe ich noch immer in der Nase, aber vor allem war mir die kauende dampfende Geschäftigkeit der Kühe merkwürdig, wie man nur so mit sich selbst beschäftigt sein kann!
Und solches Zeug geht mir durch den Kopf, während ich den Leuten zusehe, manchmal auch den Mädchen, und wegschaue, wenn sie merken, dass ich sie beobachte.
Freitag, 6. November
In der Neuen Aula treffe ich Schleicher, der tut, als hätten sich noch niemals zwei Ulmer in Tübingen getroffen, dabei waren wir zuletzt so innig nicht miteinander, und mich zu einem Kaffee einlädt und mir erzählt, dass man ihn gestern Abend zum zweiten Vorsitzenden vom Argument Club gewählt hat und ob ich nicht auch einmal kommen wolle, Juristen gebe es eigentlich weniger oder gar nicht im Club...
T. : »Juristen sind von Haus aus reaktionär.«
Schl. : »Du doch hoffentlich nicht.«
T.: »Wart es ab.«
Dann erzählt er mir, dass der Club ein Wochenendseminar über Staat und Politik im dritten Jahrtausend vorbereite, das wäre doch ein unheimlich guter Einstand für mich, wenn ich ein kleines Referat hielte über die Weiterentwicklung der Grundrechte zum Beispiel...
T. : »Grundrechte werden abgebaut, nicht weiterentwickelt.«
Schl. : »Markier nicht den Zynischen! Im Umweltrecht gibt es doch so was, oder dass niemand benachteiligt werden darf, weil er schwul ist oder eine Lesbe...«
T. : »Schon recht. Ich weiß aber nicht, ob ich bei euch überhaupt einen Einstand haben will.«
Schl.: »Hab dich nicht so. Oder traust du es dir nicht zu?«
Ich antworte kühl, dass ich es mir überlegen werde, auch wenn das Thema für ein kleines Referat ein bisschen schwergewichtig sei. Schleicher ist es zufrieden. Such dir einen Schwerpunkt aus, sagt er, und irgendwann kommen wir darauf, dass ich am Wochenende doch nicht in Tübingen bleibe, sondern mit ihm in seinem Golf nach Hause fahre.
Zur Strafe habe ich mir seine Zukunftspläne anhören müssen, dass er zum Beispiel im Frühjahr für den Bundesvorstand vom Argument Club kandidieren will.
»Deswegen muss die Diplomarbeit bis dahin in trockenen Tüchern sein...«
Seine Diplomarbeit handelt, falls ich das richtig verstanden habe, vom Abstimmungsverhalten der südwürttembergischen Metallarbeiter bei den Betriebsratswahlen in den fünfziger Jahren, was um alles in der Welt soll daran noch feucht sein?
»Und irgendwann«, frage ich, »kandidierst du dann für den Bundestag?«
Er schaut zu mir herüber, und über seinen ohnehin weiß-rötlichen Teint zieht sich eine zusätzliche Röte.
»Ich denke, du traust mir nur zu, dass ich einen Schulmeister abgebe?«
Ich sage erst nichts. Soll ich ihm vielleicht erklären, dass es mir am Arsch vorbeigeht, ob er dermaleinst einen Schulmeister oder einen Bundestagsabgeordneten abgeben wird? Und dass ich der Partei, für die Schleicher mutmaßlich antreten wird, jeden sesselfurzenden, aber politisch korrekten Klarsichtmappen träger als Kandidaten zutraue?
»Ich finde«, bemerke ich in so höflichem Ton, wie es irgend geht, »dass das eine ein so nützlicher Beruf ist wie das andere. Und Rente kriegen schließlich beide.«
Er schweigt, etwas beleidigt, zum Glück kommt auch schon die Ausfahrt Ulm-West, und so gelangen wir schließlich direkt in den Glucks- Kasten, wo Luzie gerade dabei ist, dem Juffy die Hucke voll zu quasseln. Damit hört sie auch nicht auf, als wir kommen, im Gegenteil, sie zieht den Schleicher ohne weitere Umstände an ihre Seite und redet weiter und erzählt von ihrem zweiten Praxisjahr, das jetzt im Städtischen Wohnungsamt begonnen hat, und dem Stress mit den alleinerziehenden Müttern, die von der Stütze leben, und dass man geradezu zugucken könne, wie ein ganzer Wohnblock herunterkommt, wenn mehr als eine Problemfamilie dort untergebracht wird.
Schleicher unterstreicht diesmal nichts, sondern hört eine Weile lang zu, und sagt dann etwas davon, dass die Luzie nicht von Problemfamilien reden soll, wir müssten lernen, deviantes Verhalten zu akzeptieren, und das Problem seien nicht die Familien, sondern die Leute, die ihnen das Etikett der Problemfamilien aufbügelten, aber schließlich sagt auch Juffy etwas, dass Schleicher nämlich einerseits Recht habe und andererseits nicht den Hauch einer Ahnung von dem, worüber er da rede, und er solle doch bei seinen Broschüren über die IG Metall in den fünfziger Jahren bleiben!
Nur ich bin still, bis ich plötzlich niesen muss. Mehr hab ich, glaube ich, nicht zur Unterhaltung beigetragen.
Samstag, 7. November
Ich erwache mit einem Schnupfenkopf, benommen und versch wiemelt, und erkläre der alten Frau, dass ich schwimmen gehen will, damit der Schnupfen vorbeigeht oder ein richtiger wird. Das will ich sogar wirklich, aber wie ich ins Westbad fahre und fast schon dort bin, hupt es hinter mir, und es ist der Bilch. Er fährt einen fast neuen BMW, das heißt, er hat ihn ganz neu, auch wenn er gebraucht ist, ob ich nicht Lust hätte, eine Spritztour zu machen, vielleicht nach Konstanz, da gebe es ein Mineralbad. »Ein bisschen spießig, aber keine solche Inkubationsanstalt für Fußpilz wie das hier, am Abend geben sie im Theater ›Così fan tutte‹, na ja Konstanz, aber warum soll man sich das nicht anhören, einfach so!«
Sagte ich bereits, dass ich an diesem Morgen nicht ganz klar im Kopf war? Ich stelle das Rad ab und steige beim Bilch ein, und wir fahren durch Oberschwaben, und Bilch redet von Autos und von Schweizer Bio tec-Aktien, das sei überhaupt der Hype jetzt, wer es klug anstelle, könne damit praktisch nur gewinnen, wie ich an seinem vorzüglichen Schlitten sehe, und ob er für mich nicht auch mal ein Engagement tätigen darf? Ich antworte, dass ich dafür kein Geld übrig hätte, die paar Kröten aus der Buchbinderei seien wirklich zu sauer verdient, um sie aufs Spiel zu setzen, und Bilch erklärt, dass ich eben keine Ahnung habe, was Geld wirklich sei...