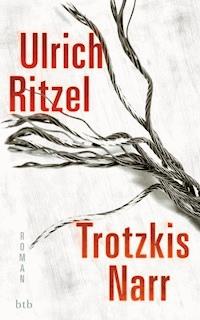Inhaltsverzeichnis
Buch
Autor
Ulrich Ritzel bei btb
Dienstag, 27. September
Copyright
Buch
Spätsommer in Kattowitz. Ein Mann irrt durch die Straßen, eine grell bedruckte Plastiktüte in der Hand, im leeren Beichtstuhl einer katholischen Kirche gelingt es ihm schließlich, sie zu entsorgen. Am gleichen Vormittag begibt sich in Ulm die Kriminalkommissarin Tamar Wegenast ins Büro. Auch sie ist ein einer angespannten Verfassung. Seit Wochen wird sie mit Drohbriefen belästigt, als deren Verfasser ein Kai Habrecht firmiert. Aber der ist tot, sie selbst hat ihn vor Jahren erschossen. Abends erreicht sie der Hilferuf einer in Krakau lebenden Freundin, einer Malerin, in deren Wohnung die enthauptete Leiche einer Frau gefunden wurde - den Kopf findet man später in einem Beichtstuhl in Kattowitz.
Die Spur führt nach Berlin, wo ein Mann ohne Gedächtnis Ärzte und Pressevertreter narrt, was ein älteres Ehepaar vom Bodensee nicht davon abhält, ihn als ihren vor Jahrzehnten verschollenen Sohn Bastian zu identifizieren. Tamar Wegenast glaubt, dass der Mann etwas mit dem Mord in Krakau zu tun hat. Doch als sie die Ermittlungen aufnimmt, bringt sie sich selbst in tödliche Gefahr …
Autor
Ulrich Ritzel, geboren 1940, gilt als einer der besten Krimiautoren Deutschlands. Nach seinem Jurastudium arbeitete er jahrelang für verschiedene Zeitungen, 1981 erhielt er für seine Gerichtsreportagen den renommierten Wächter-Preis. Ausgezeichnet wurden auch seine Kommissar-Berndorf-Krimis Schwemmholz und Der Hund des Propheten. Ulrich Ritzel lebt heute abwechselnd am Bodensee und im Schwarzwald.
Ulrich Ritzel bei btb
Der Schatten des Schwans. Roman (72800) Schwemmholz. Roman (72801) Die schwarzen Ränder der Glut. Roman (73010) Der Hund des Propheten. Roman (73256) Halders Ruh. Erzählungen (73332) Uferwald. Roman (73667)
Dienstag, 27. September
Aus dem Schatten, den die Morgensonne in die Häuserschluchten warf, rollte eine blaue Tramwaj, ruckte über eine Weiche und nahm wieder Fahrt auf. Dem Mann, der mit einer Plastiktüte in der einen Hand stehen geblieben war und mit der anderen die Augen abschirmte, kam es so vor, als liefen die Waggons auf ungewöhnlich kleinen Rädern, wie Raupenfahrzeuge, die enge Kurven und steile Rampen überwinden müssen. Die Haltestelle war nur fünfzig Meter entfernt. Wenn er sich beeilte, würde er sie noch rechtzeitig erreichen und mitfahren können, vielleicht bis zur Endstation, irgendwo da draußen zwischen Abraumhalden und Schrottplätzen müsste eine geeignete Stelle zu finden sein.
Aber er wollte nicht rennen. Nicht mit der Plastiktüte und dem Ding darin, das ihm gegen die Beine schlagen würde. Außerdem hatte er kein Bilet. Soviel er wusste, hätte er sich vorher eins in einem Tabak- oder Zeitungsladen kaufen müssen. Die Straßenbahn hielt, ein paar Leute stiegen aus, darunter zwei Frauen, die nun auf ihn zukamen, mit kleinen energischen Schritten, und als sie an ihm vorbei waren, folgte ihnen der Mann, weil es offenkundig einen vernünftigen und unverdächtigen Grund gab, diese Richtung zu nehmen.
In der Nacht hatte es geregnet, und noch immer roch es, als sei ein Teil des Staubs und der Abgase aus der Luft herausgewaschen. Zumindest schienen die Bewohner der Stadt es so zu empfinden, denn sie hatten ihre altersschwarzen Wohnblocks verlassen, überall sah er Leute, alte und junge, gebrechliche, gleichgültige oder solche, deren Gesicht Misstrauen verbergen mochte.
Es ist lächerlich, dachte der Mann, dem die Plastikträger in die Hand schnitten, aber seit dem Frühstück war er unterwegs und hatte nirgendwo einen Platz gefunden, an dem er es gewagt hätte, die Tüte abzustellen. Dabei war es eine Tüte wie hunderttausend andere auch, von einer Hamburger-Kette ausgegeben, deren gelbroter Schriftzug deutlich zu sehen war, ziemlich genau an der Stelle, an der sich die Plastikfolie über einer Wölbung spannte. Vor einer halben Stunde noch hatte er sich damit getröstet, wie komisch es sein würde, wenn er von seiner Irrfahrt erzählen könnte, seiner Odyssee durch die staubigen, von Schlaglöchern übersäten Straßen der Stadt, auf der Suche nach einer Ruine, von denen es doch genug geben musste, oder auch nur nach einem abseits gelegenen Müllbehälter, und wie er sich dabei immer genauer, immer hartnäckiger beobachtet fühlte, bis er schließlich begriff, dass es nicht allein die Menschen auf der Straße waren, denen er sich ausgeliefert fühlte.
Wirkliche Gefahr droht von dem, den man nicht sieht, der vielleicht nur aus einem Fenster späht, hinter einem Vorhang verborgen. Es gab unzählige Fenster in dieser Stadt, mit Gardinen oder bunten Vorhanglappen drapiert und dicht an dicht in die staubgrauen Mauern gestanzt, als bohrten sich hunderttausend Augen in seinen Nacken, aber wer glaubt einem das?
Die beiden Frauen vor ihm bogen nach links ab, die ältere der beiden trug einen mausgrauen Mantel mit einem mausgrauen Pelzkrägelchen und ging etwas schneller als die andere, die jünger war und schwerfälliger, die breiten Hüften in Jeans gezwängt. Der Mann blieb etwas zurück. Vor einem Motorradladen mit schweren japanischen Maschinen waren zwei Tische und die Plastikstühle dazu auf das Trottoir gestellt, an einem der Tische saßen zwei Burschen in Lederjacken und räkelten ihre Beine über den Gehsteig, die Bierdosen vor sich, und musterten ihn, fast belustigt, als sei etwas komisch daran, wie er hinter den Frauen herlief und ihm die rot und gelb bedruckte Plastiktüte neben den Knien baumelte. Aus dem Laden dröhnte ein Lautsprecher, fast gerührt erkannte der Mann den alten Seelenfeger »Bobby Mc-Gee«, und es war wirklich und wahrhaftig die Stimme von Janis Joplin, wie schön, dass es eben auch Lieder mit Worten gab, wenn man sie nur singen konnte. Für einen Augenblick überlegte er, stehen zu bleiben und den Biertrinkern zuzunicken, wie jemand, der gerade genug Zeit hat, sich an einem guten alten Lied zu erfreuen, aber im gleichen Atemzug verscheuchte er den Gedanken wieder, dies war kein Morgen für den Austausch von Sentimentalitäten, schon gar nicht mit Leuten, die die Zeit und das Geld übrig hatten, sich vormittags vor einer Kneipe herumzudrücken.
Nicht mit mir, dachte der Mann und ging weiter, zügig tat er das, aber nicht so schnell, dass es irgendjemandem hätte auffallen können, dann bog auch er ab, hinter sich hörte er die beiden Biertrinker auflachen, er geriet in eine Seitenstraße, an deren Ende eine rußgeschwärzte, geduckte Kirche stand, mit einem kümmerlichen neogotischen Aufsatz, der gerne so getan hätte, als sei er ein himmelhoch ragender Turm.
Du bist Betschwestern nachgelaufen, dachte der Mann, das hättest du eigentlich etwas früher merken können, in diesem Land musst du mit so etwas rechnen. Fast zu spät bemerkte er, dass ihm ein Passant mit einem Hund entgegenkam, der Hund trug einen Maulkorb, aber trotzdem wechselte er rasch über die Fahrbahn auf die andere Straßenseite. Hunde hatte er noch nie leiden können und das Geschnüffel schon gar nicht, was hast du da, was riecht da so? Die Fahrbahn war an manchen Stellen mit grobem Klinker gepflastert, und an anderen war sie asphaltiert, es sah aus, als sei die Straße niemals neu gewesen, sondern immer nur ausgebessert worden.
Er sah sich um und nahm die Plastiktüte in die andere Hand. Der Mann mit dem Hund war um die Ecke gebogen. Niemand schien ihn zu beachten. Die beiden Frauen hatten das Kirchenportal erreicht und verschwanden darin, zuerst die eine im Mäntelchen hineingehuscht, dann die andere nachgewalzt. Das Fragment eines Bibelspruchs tauchte aus seiner Erinnerung auf, wie von einem Suchscheinwerfer erfasst, irgendetwas von Mühseligen und Beladenen, das Fragment verschwand wieder und machte einem Gedanken Platz.
An Rabatten und vom Regen grün gewaschenen Hecken vorbei kam er zum Portal, stieß die Kirchentür auf und schob einen erstickend muffigen Vorhang zur Seite.
Die Frau, die die Tür des Appartementhauses aufgezogen hatte und nun auf der Schwelle stehen blieb, war groß und schlank und hatte langes, dunkles, von einer einzelnen grauen Strähne durchzogenes Haar. Ihre rechte Hand steckte in der Tasche eines ausgebeulten grauen Jacketts mit Fischgrätmuster, mit der linken Hand hielt sie die Tür geöffnet, während sie sich draußen umsah. In einigen, wenigen Briefkästen steckten Zeitungen, Post war noch nicht gekommen, aber das ging sie nichts an, denn sie hatte schon vor Wochen ihren Briefkasten zugeklebt und das Namensschild entfernt.
Auf den überdachten Vorplatz neben den Briefkästen hatte der Wind ein paar Blätter geweht. Sonst lag da nichts, nicht an diesem Morgen. Schließlich hatte die Frau genug gesehen, sie ging an der hoch gemauerten Gartenböschung vorbei zur Straße. Wieder blieb sie stehen. Die meisten Wagen, die entlang der Straße geparkt waren, kannte sie. Auch die anderen waren nicht auffällig, keine Nummernschilder mit der Zahl 88, aber was hieß das schon!
Der Morgen versprach einen schönen Spätsommertag, wenn sich der Nebel über der Stadt erst aufgelöst haben würde. An der Bushaltestelle wartete ein einzelner Mann, rauchend, unförmig dick, und warf ihr einen vorwurfsvollen Blick zu. Der Bus, der von der Universität kam und zum Hauptbahnhof fuhr, war pünktlich und fast leer. Der Dicke nahm einen letzten Zug aus der Zigarette, ehe er sie wegwarf und schnaufend das Trittbrett erklomm.
Die Frau wartete, bis er seinen Körper vollends in den Fahrgastraum gewälzt hatte, und folgte ihm dann. Im Bus saßen ein paar Frauen und zwei oder drei Rentner. Sie setzte sich nicht, sondern blieb an der Ausstiegstür stehen.
Nach zwei Stationen, am Theater, verließ sie den Bus, überquerte die Kreuzung und nahm den Weg durch die Gassen in Richtung Münster, dessen Umrisse allmählich aus dem Nebel hervortraten. Das sah sie freilich erst, als sie durch eine Passage auf den Münsterplatz selbst gelangte. Dort hielt sie sich rechts und kam so zum Eingangstor eines massigen rotbraunen Ziegelbaus, der in der Stadt nur der Neue Bau hieß. Das Tor führte auf einen mit Einsatz- und Zivilfahrzeugen der Polizei voll gestellten Innenhof.
Die Frau betrat den Haupteingang und nickte den beiden uniformierten Beamten zu, die hinter dem mit einer Glasscheibe abgetrennten Tresen saßen, dann stieg sie mit raschen Schritten die Treppe hoch, die zu den Räumen der Kriminalpolizei führte. Wie jeden Morgen schaute sie zuerst bei der Post- und Fernschreibstelle vorbei und wünschte einen guten Tag. Schaufler, der Beamte, der dort Dienst tat, war seit einem Unfall gehbehindert. Trotzdem stemmte er sich hoch und humpelte ihr entgegen, einen Umschlag im DIN-A4-Format in der Hand.
»Ich glaube, die haben sich wieder gemeldet.«
Die Frau nahm den Umschlag entgegen, ohne erkennbares Widerstreben. Der Umschlag war dünn und fühlte sich an, als sei nur ein einziges Blatt darin. Die Adresse:
An die Kriminalkommissarin Tamar Wegenast, Neuer Bau, Ulm/Donau
sah aus, als sei sie mit einem Computer geschrieben worden.
»Ja«, sagte Tamar, »sieht wohl so aus.«
Schaufler hatte sie beobachtet, nun blickte er weg. »Es ist die schiere Ohnmacht«, sagte er. »Sonst können die nichts.«
»Wer weiß das schon«, antwortete sie und ging in ihr Büro. Es war leer, denn ihr Kollege Markus Kuttler feierte Überstunden ab. Für einen oder zwei Augenblicke hielt sie den Umschlag in der Hand, als überlege sie, ob sie ihn nicht einfach in den Papierkorb werfen solle. An ihrem Telefon blinkte der Anrufbeantworter, aber es war nur eine Nachricht aufgezeichnet: Staatsanwalt Desarts bat um Rückruf. Sie setzte sich, legte den Umschlag ab und wählte, fast sofort meldete sich Desarts. Es sei schön, dass sie so schnell zurückgerufen habe, sagte er, aber es sei nicht eilig gewesen.
»Eine Information wegen der Sache Berisha, nichts weiter.«
Azlan Berisha war vom Landgericht wegen Zuhälterei und Menschenhandel zu vier Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden.
»Sein Anwalt hat mir gerade mitgeteilt, dass Berisha auf Rechtsmittel verzichtet.«
»Und was ist mit Ihnen?«, fragte die Kommissarin zurück.
»Wir können mit dem Urteil leben«, kam die Antwort. »Für ein paar Monate mehr gehen wir nicht in Revision. Das wäre auch kaum im Interesse dieser Kwiatkowski oder wie sie heißt...«
Tamar Wegenast verzog das Gesicht. Sie hätte zu dem Strafmaß einiges zu sagen gehabt. Aber Desarts hatte Recht. Wenn das Urteil erst einmal rechtskräftig war, würde auch für die Hauptbelastungszeugin das Leben etwas einfacher. Vielleicht würde es das.
»Sie ist doch jetzt wieder in ihrer Heimat?«
»Jedenfalls ist sie wieder in Polen«, antwortete die Kommissarin. »Sie hat in Krakau fürs Erste eine Unterkunft und einen Aushilfsjob gefunden.«
»Schön«, meinte Desarts. »Damit hätten wir doch alles wieder ins Lot gebracht.«
»Sind wir nicht alle Pfadfinder?«, sagte Tamar, verabschiedete sich und legte auf. Der Umschlag lag noch immer auf ihrem Schreibtisch.
Kein Gottesdienst, niemand psalmodierte. Ein dunkles Kirchenschiff, der Geruch nach Weihrauch, im Chor ein Glasfenster, durch das strahlend die Sonne fiel, eine Heilige Jungfrau Maria, die so aussah, wie sie in Sossenheim oder Höchst auch aussehen mochte, falls sie dort in den frühen Fünfzigern eine Marienkirche gebaut hatten.
Die jüngere der beiden Frauen kniete vor dem Durchgang zum Chor. In den Bankreihen weiter vorne saßen ein Dutzend oder mehr Leute, schweigend, die meisten mit gesenktem Kopf, rechts außen die Frau mit dem Pelzkragen. Der Mann trat ein wenig zur Seite, im Seitenschiff rechts sah er zwei Schränke aus dunklem Holz, jeder mit zwei Türen, die Türen hatten kleine Fenster, die aber verhängt waren. Nur an dem - zum Chor hin gesehen - vorderen Schrank brannte eine kleine Lampe. Er kam ein paar Schritte näher, natürlich sind das keine Schränke, dachte er dann und zog vorsichtig an der ersten Tür. Zu seiner Überraschung öffnete sie sich, er schlüpfte hinein und kniete sich auf das dafür vorgesehene Brett, weil die enge Kabine keine große Wahl für eine andere Haltung ließ.
Er war überzeugt, dass ihm auf der Stelle der Geruch aller kleinen lässlichen lausigen Sünden in die Nase steigen müsse, ein Geruch wie von Unterhosen, die brettsteif sind von getrocknetem Sperma. Aber nichts. Stickig roch es, weiter fiel den Ganglien nichts dazu ein, vielleicht war er auch zu sehr damit beschäftigt, die Tüte unter dem Kniebrett so zu verstauen, dass sie dort eine Zeitlang unbemerkt liegen bleiben mochte. Doch das Ding darin sperrte sich, es war zu groß, er musste sich dazu zwingen, die Tüte in beide Hände zu nehmen und abzutasten, welches die schmalere Seite war, so dass er es wenigstens ein Stück weit unter das Brett schieben konnte, und während er das tat, spürte er eine glatte Fläche und dann unerwartet einen Vorsprung.
So plötzlich, als hätte er einen Schlag gegen den Magen bekommen, fiel ihn Übelkeit an, gleich würde er sich übergeben müssen. Er schloss die Augen, hob den Kopf und versuchte, tief einzuatmen, aber die Luft war zu stickig oder seine Kraft reichte nur für ein paar lausig flache Atemzüge. Mühsam richtete er sich auf, seine Knie zitterten, und kalter Schweiß brach ihm aus. Vorsichtig lehnte er sich gegen die Rückwand, zum Glück war sie massiv und stabil genug, dass sie nicht nachgab.
Ganz ruhig bleiben, sagte er sich, du kippst jetzt nicht um, es gibt keinen Grund dazu, du bist in einem Beichtstuhl, warum auch nicht? Man muss alles einmal gesehen haben im Leben. Hauptsache, du hast alles im Griff, und niemand will etwas von dir, kein Hoch- und kein Merkwürden und auch sonst kein Pope, und wäre einer da, du hättest nichts zu beichten, das da unten bist du nicht gewesen, und sonst? Nichts, Hochwürden, gar nichts, auch nicht mit Tabea, mit der schon lange nicht mehr, mit mir knallt es nicht, verstehen Sie? Deswegen hat sie mich doch rausgeschmissen, oder ich hab mich rausschmeißen lassen...
Er fuhr sich über die Stirn. Noch immer fühlte er sich schwach, aber die Übelkeit hatte sich zurückgezogen. Er öffnete die Augen und sah wieder das dunkle vergitterte Fensterchen vor sich, fast war es ihm, als hätte er soeben wahrhaftig zu einem verborgenen Gegenüber gesprochen. Wovon denn?, wies er sich zurecht, und zu wem denn? Nichts ist hinter dem Gitter... Die Tüte lag noch immer auf dem Boden. Vorsichtig, während er sich mit der einen Hand an der Leiste festhielt, die unterhalb des Gitterfensters verlief, kniete er sich nieder und schob die Tüte mit der anderen Hand unter das Brett, so gut es eben ging. Dann zog er sich wieder hoch, wischte sich mit dem Ärmel seiner Jeansjacke das Gesicht ab und wagte es schließlich, die Tür aufzudrücken und den Beichtstuhl zu verlassen.
Niemand achtete auf ihn.
Trotzdem hielt er seinen Kopf gesenkt. Man würde ihm ansehen, dass er soeben fast ohnmächtig geworden wäre. Seit seinem fünften Lebensjahr gab es kaum etwas, das er so sehr verabscheute wie die Gesichter neugieriger Menschen, die sich über einen beugen und so tun, als nähmen sie Anteil.
Am Mittelgang des Kirchenschiffs fiel es ihm ein, sich zum Altar zu wenden und kurz niederzuknien. Als sich gleich darauf das Kirchenportal wieder hinter ihm schloss und er in die Sonne hinaustrat, blieb er einen Augenblick stehen, mit geschlossenen Augen, und bewegte seine Schultern, die sich verspannt anfühlten. Aber zu Anspannung gab es keinen Grund mehr. Was er zu verlieren hatte, hatte er verloren, er war es los und durfte sich also so frei fühlen, wie es die gute alte Janis besungen hatte: »freedom’s just another word for nothing left to loose...«
Jedenfalls konnte er jetzt gehen, wohin er wollte, warum tat er es nicht? Weil er keine Eile hatte, gab er sich die Antwort, oder genauer: Niemand sollte sagen können, er habe es eilig gehabt oder sei aus dieser Kirche gerannt, und so zählte er drei tiefe Atemzüge ab, ehe er die Augen wieder öffnete und bedächtig an den Rabatten vorbei die Straße hinabging und den Weg zurück einschlug.
Vor sich sah er das Schild einer Kawiarnia, in der trübe ein Licht brannte. Keinen Kaffee, dachte er, nicht jetzt, nicht in dieser Phase, und auch keinen Wodka, das schon gar nicht. Aber er könnte einen Tee trinken, vielleicht gab es auch ein Stück Kuchen dort, nicht dass er wirklich Hunger gehabt hätte, er hatte einfach Lust darauf, eine Tasse Tee zu trinken und ein Stück Kuchen zu essen und aller Welt zu zeigen, dass er keine anderen Sorgen hatte.
Er stieß die Tür zur Kawiarnia auf, über der Theke brannte Licht, in der Küche hörte er jemanden hantieren, sonst schien das Lokal leer. Er betrachtete die Fotografien an den Wänden, sie schienen ihm Erinnerungen an die Zeit zu sein, als die Kohle noch Wohlstand bedeutete oder jedenfalls nicht das nackte Elend und die Depression. An der Wand stand ein Klavier, der schwarze Lack war aufgesprungen, und weil er nicht rufen wollte oder aus sonst einem Grund ging er zu dem Instrument, klappte den Deckel auf und schlug einen Akkord an, wie ging noch einmal »freedom- is just another word...«?
Das Klavier war fürchterlich verstimmt, außerdem sollte er vom Klavierspielen besser die Finger lassen, hatte Tabea gesagt. »Weißt du« - und ihre Stimme war honigsüß geworden -, »wenn einer gar kein Talent hat und auch noch faul ist, dann sind die Aussichten nicht gerade glänzend...«
Eine hübsche junge Frau erschien, die Augen mit Schminke schwarz umrändert. Sie wollte seine Bestellung aufnehmen, merkte aber sofort, dass er Ausländer war, und sprach ihn auf Englisch an. Auch recht, dachte er und bestellte a cup of tea, darjeeling, please, und bekam heißes Wasser mit einem Teebeutel darin, Kuchen gab es keinen, nur irgendwelches Mürbegebäck, aber darauf kam es auch gar nicht an, er wollte nur für einen Augenblick entspannen und Atem holen.
Merkwürdig - unzweifelhaft hatte Tabea ihn verlassen, hatte ihn allein sitzen lassen in dieser Stadt. Die rostfleckige Rückfront ihres Renault mit dem Aufkleber gegen den Irak-Krieg war das Letzte gewesen, was er von ihr gesehen hatte. Und doch war ihre Ausstrahlung noch immer gegenwärtig, unsichtbar wie Radioaktivität und tückisch wie jene. Ständig war er einer Art erzieherischer Missbilligung ausgesetzt gewesen, und nun hatte sie sich in ihn hineingefressen, da half keine Jodtablette und kein Crystal, helfen konnte da höchstens die Zeit. Er nahm einen Schluck Tee und verzog das Gesicht, außerdem war das Gebäck zu süß und mit zuviel Puderzucker überschüttet, so vertrieb die gegenwärtige Wirklichkeit die vergangene, das hatte auch etwas für sich.
Selbst an diesem Morgen war in dem mit altertümlichen Eichenmöbeln vollgestellten Besprechungszimmer das elektrische Licht eingeschaltet. Ein Bunker, dachte Tamar und sah über die Köpfe ihrer über den Tisch gebeugten oder in sich versunkenen Kollegen hinweg zum Fenster und zu dem kleinen blauen Fetzen Himmel, der über den Dächern zu ahnen war.
»Der Sonderzug aus Dresden trifft um 17.48 Uhr ein«, referierte Markert, der Leiter der Schutzpolizei, »und die Stadtwerke bieten zusätzliche Busse an. Bis zum Spielbeginn müssten die Leute bequem im Stadion sein.«
»Ist das nicht ein bisschen knapp?«, fragte Kriminalrat Englin.
»Die Bahn hat uns versichert, dass sie mit keinen Verspätungen rechnet.«
»Seit wann können die rechnen?«, fragte Blocher vom Rauschgiftdezernat.
Englin schüttelte missbilligend den Kopf.
»Um die Wahrheit zu sagen«, fuhr Markert fort und schob herausfordernd seinen Unterkiefer vor, »wir haben das Zeitfenster bewusst eng gehalten. Nicht, dass sonst morgen die Fußgängerzone neu verglast werden muss.«
Die Fans des Dresdner Fußball-Clubs, der am Abend im Ulmer Donaustadion zu einem Spiel der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals antreten sollte, waren in den letzten Wochen in der Rangliste der deutschen Hooligans auf einen der vorderen Plätze vorgestoßen.
»Das verstehe ich, sicher doch. Auf der anderen Seite...« Englin zögerte, während sein Augenlid heftig zuckte, »auf der anderen Seite wollen wir das nicht dramatisieren.«
Was ist das für eine neue Einsicht?, dachte Tamar und fing einen Blick von Blocher auf.
»Wir werden präsent sein, aber vor allem besänftigend, freundlich... Deeskalation, verstehen Sie?«
Blocher zog verächtlich seine Mundwinkel nach unten, und Markert starrte auf seine Notizen. »Ja«, sagte er widerstrebend, »natürlich verstehe ich das... Ärger kann es aber immer geben. Wir müssen darauf vorbereitet sein.«
Die Konferenz wandte sich der Frage zu, wie viel Vernehmungsbeamte für den Fall bereitstehen sollten, dass sich die Gäste am Ende doch nicht sollten besänftigen lassen.
»Trag mich auch ein«, sagte Tamar zu Markert. Es gab keinen Grund, warum sie etwas gegen Überstunden hätten haben sollen. Leider gab es keinen Grund. Merkwürdig nur, dass der Kriminalrat zu einem Einwand anzusetzen schien. Aber als sie sich ihm zuwandte, sah sie nur das Zucken des Englinschen Augenlids. Dann beendete der Kriminalrat auch schon die Lagebesprechung, weil er noch mit der Polizeiführung im Innenministerium telefonieren wollte.
»Das ist nicht mehr meine Zeit, Mädchen«, sagte Blocher zu Tamar, als sie über den Flur zurückgingen.
»Und warum nicht?«
»Deeskalation, das ist doch den Mäusen gepfiffen... Wenn du willst, dass erst gar nichts eskaliert, dann musst du rechtzeitig den Gummiknüppel zeigen. Jedenfalls hab ich das noch so gelernt.«
»Ich fürchte, alter Mann«, antwortete Tamar, »soviel Gummiknüppel, wie wir dazu bräuchten, haben wir gar nicht mehr.«
Aber es war nicht das, was sie hatte sagen wollen. Wir sitzen in einem Bunker, das hatte ihr auf der Zunge gelegen, und wer im Bunker hockt, Blocher, der hat den Krieg schon verloren.
Also, wer war es eigentlich, der hier wie ein alter Mann dachte?
Er bezahlte und ging, er musste sich jetzt bewegen, vielleicht konnte er im Gehen seine Gedanken sortieren, die schon wieder durch das Raster fielen wie ein zu schnell abgespulter Film. Vorhin, vor der Kirche, hatte er sich für einen Augenblick befreit gefühlt, aller Mühsal entledigt, jetzt schien ihm das ein wenig übertrieben, um es vorsichtig auszudrücken, vermutlich hatte die Phase des Abklingens eingesetzt, nur half ihm das nicht weiter. Die Welt ist so, wie sie ist, egal, wie er sie wahrnahm und in welcher Phase der Achterbahnfahrten seines Bewusstseins er sich gerade befand. Vielleicht kam er in manchen Augenblicken der Wirklichkeit näher als in anderen, berührte sie sogar nahezu wie ein Asteroid die Erde, von der er angezogen wird, um dann doch an ihr vorbeizurauschen in die Tiefe des Weltalls... Aber darauf kam es nicht an. Es genügte zu wissen, dass der Zustand der Welt am ehesten der Stimmungslage und den Erwartungen entsprach, die die eines bad turkey waren. Trotzdem war es wahrscheinlich eine eher gute Nachricht, dass er die Plastiktüte entsorgt hatte. Nicht nur wahrscheinlich, sondern ganz sicher war sie das. Aber was folgte jetzt, und wie viel Zeit hatte er, zu was auch immer?
In der Kirche war gerade kein Gottesdienst gewesen und von den Beichtstühlen nur einer besetzt. Sollte die Nachfrage nach und das Angebot an Priestern in dieser Kirche womöglich so groß sein, dass demnächst auch der zweite Beichtstuhl öffnete oder in Betrieb ging, wie immer man das nannte? Möglich. Vielleicht gingen die Leute in diesem Land am späten Vormittag zur Beichte wie andere in die Kneipe oder ins Bordell, oder taten erst das eine und dann das andere. Vielleicht auch wurde der eine Beichtvater von einem zweiten abgelöst, und der zweite legte Wert auf einen eigenen, unverhockten Starenkasten. Er hatte keine Ahnung, aber soviel war klar: Die Tüte konnte jeden Augenblick entdeckt werden.
Der Mann blieb stehen und fuhr sich über die Stirn. Er war auf dem Weg zurück zu dem Pensjonat, in dem er übernachtet und wo er seine Reisetasche zurückgelassen hatte. Vor ihm war die breite Straße mit den Gleisen, wieder kam eine Tramwaj vorbei, ja, sie war blau, und? Plötzlich fiel ihm ein, dass es noch ein anderes Problem gab als bloß die Plastiktüte von McJunkFood und die Beichtväter der Heiligen Maria zum staubigen Turm. Dieses Land gehörte, ob es einer glauben mochte oder nicht, zur Europäischen Union, und eben deshalb war Tabea an der Grenze sehr wahrscheinlich nicht kontrolliert worden, man hatte sie ungestört und ungehindert einreisen lassen, wie ein kleines Mäuschen, das die Katze laufen lässt, gerade einen Tatzenhieb weit. Aber dann, irgendwo hinter Bautzen, irgendwo vor Dresden, hatte die Katze zugeschlagen und sich ein Wagen vor den Renault gesetzt und die Kelle gezeigt: Polizei! Bitte folgen... Am späten Abend würde das gewesen sein, und weiter?
Dann hatte die Bullerei ein bisschen was zum Nase pudern gefunden, ein halbes Pfund Crystal Speed, das war für ein paar Monate gut und für Tabea schlecht, aber es war nicht das, wonach sie gesucht hatten und was sie finden sollten und weswegen sie am späten Abend auf der Autobahn Dienst schoben. Sie hatten finden sollen, was man für sie versteckt hatte, in einer Sporttasche im Kofferraum eines rostigen alten Renault, aber da war kein Osterei mehr gewesen.
Und nochmals weiter? Dann hatte Tabea von nichts gewusst und alles auf ihn geschoben, die Schnüffler hatten schlechte Laune bekommen und den Kollegen geholt, der telefonieren konnte. Er sah es vor sich, als sei er dabei gewesen, und vor sich sah er auch die polnischen Polizisten, wie sie jetzt im Kabuff hinter der Rezeption des Pensjonats hockten und mit der Wirtin schäkerten, neben seinem Gepäck, und auf ihn warteten... Janis hatte Recht. Du bleibst nur frei, wenn du nichts mehr zu verlieren hast, soviel Durchblick hast du noch, und deine Reisetasche zu verlieren, diesen Müllsack voll dreckiger Unterwäsche und stinkiger Socken, das ist noch gar nichts, alles muss weg, weil alles versaut oder besser: kontaminiert ist von den Menschen und ihren Ausdünstungen und ihren Blicken, mit denen sie dich abtasten, während sie überlegen, wie sie dich hereinlegen können und vorführen und zum Narren halten.
Tamar Wegenast hatte mit der Gerichtsmedizin telefoniert und danach noch mit der Jugendgerichtshilfe, jetzt hatte sie Kopfweh. In den Telefonaten war es um einen inzwischen so gut wie abgeschlossenen Fall gegangen, den eines 17jährigen, der in den Anlagen unterhalb des Hauptbahnhofs einen betrunkenen Obdachlosen so lange geschlagen und getreten hatte, bis dieser sich nicht mehr rührte. Danach war der junge Mann nach Hause gegangen und hatte sich von der Mama die Jeans und die übrigen blutverschmierten Sachen waschen lassen, damit es keinen Ärger mit der Polizei gab, und sich ins Bett gelegt und gut geschlafen, während der Obdachlose unten in den Anlagen noch ein paar Stunden zu leben oder genauer: zu sterben gehabt hatte, bis er an seinen inneren Verletzungen verblutet war.
»Was geht denn mich das an, wann der krepiert ist?«
So gab es der junge Mann zu Protokoll, als es dann doch Ärger mit der Polizei gegeben hatte und Tamar ihn nach seiner Festnahme verhörte. Und was hatte die Jugendgerichtshilfe dazu mitzuteilen? Nein, hatte die Jugendgerichtshilfe gemeint, da hat es wohl zwei Freizeitarreste gegeben, aber von schädlichen Neigungen des 17jährigen sei ihr nichts bekannt, und im Übrigen handle es sich doch wohl nur um Körperverletzung mit Todesfolge …
Du sollst nicht urteilen, dachte die Kommissarin, schloss die Augen und massierte sich die Schläfen. Als sie ihre Augen wieder öffnete, fiel ihr Blick auf den Brief, der noch immer auf ihrem Schreibtisch lag. Warum warf sie ihn nicht weg? Es war lächerlich, ihn da liegen zu lassen.
Sie zog den Brief zu sich her und betrachtete einen Augenblick lang den auf die Rückseite geklebten Zettel: Abs.: Kai Habrecht. Sie nickte und riss den Umschlag auf. Er enthielt nichts weiter als den vergrößerten Abzug einer Schwarzweißfotografie, die für Tamar so aussah, als sei sie mit einem Teleobjektiv gemacht worden. Die Fotografie zeigte eine Gruppe: drei Frauen, die auf den Steinstufen vor einem Denkmal saßen, die eine von ihnen - die in der Mitte saß - hatte eine Tüte Eis in der Hand und bot sie einer zweiten Frau an, deren Haar auffällig kurz geschnitten war und die eine viel zu knappe Jacke aus dem Imitat eines Leopardenfells trug. Die dritte Frau, die den beiden zusah, war deutlich größer als die anderen, sie trug Jeans und eine eng sitzende Lederjacke. Ihr Gesicht war ruhig, entspannt, fast fröhlich.
Die Kommissarin stand auf und ging ans Fenster, von dem aus man über die Häuser an der Donau sah.
Es kommt näher, dachte sie. Schon heute Morgen habe ich es gewusst.
»Mädchen, was hast du da?«, fragte eine Stimme in ihrem Rücken.
Tamar hob unwillig den Kopf. »Du sollst anklopfen, bevor du bei mir reintappst.«
»Lass sehen«, beharrte Blocher.
»Bitte!« Sie hielt ihm den Abzug hin. Er nahm ihn und betrachtete ihn mit ausgestrecktem Arm, denn mit den Jahren war er weitsichtig geworden, so wie auch seine früher blonde Haarmähne längst weißgelb ausgeblichen war.
»Nettes Foto«, sagte er schließlich. »Bei uns schaust du nie so … War das im Urlaub?«
»In Krakau, im Juli.«
»Und die da?« Es war nicht genau zu erkennen, worauf sein dicker Finger zeigte.
»Das sind die Füße von Adam Mickiewicz, und der ist oder war ein Dichter.«
»Du weißt genau, was ich meine. Die beiden da, sind das Freundinnen von dir?«
»Die eine hatten wir im Zeugenschutzprogramm«, antwortete Tamar. »Die andere... ach, das verstehst du nicht, alter Mann.«
»Und wer hat das Foto gemacht?«
Statt einer Antwort wies sie auf den Umschlag. Er nahm ihn und musste diesmal seine Brille herausholen und aufsetzen, um den Absender zu lesen. Es war eine randlose Brille, und sie gab ihm ein merkwürdig zerbrechliches Aussehen.
»Kai Habrecht? Muss ich den kennen?«
»Kaum«, antwortete Tamar. »Habrecht ist seit sechs Jahren tot.«
Er war an einer Kreuzung angekommen, wohin jetzt? Ein Wegweiser zeigte zur Autobahn nach Krakau, ein anderer zum Dworzek Glowny. Man soll in diesem Land nicht mit der Eisenbahn fahren, hatte ihm jemand gesagt, noch in Krakau war das gewesen, und die Pensionswirtin mit dem hurtigen Blick hatte ihm gestern immerhin eine Busverbindung herausgesucht, es gab eine, da wäre er am nächsten Morgen in Hamburg, was immer er dort tun wollte.
Aber das brauchte ihn jetzt nicht mehr zu kümmern. Man hatte ihm den Bus empfohlen, also würde er den Zug nehmen, irgendeinen, wie hieß die Stadt gegenüber von Görlitz?
Das Hinweisschild zum Hauptbahnhof hatte sich an die Autofahrer gerichtet, also müsste es für Fußgänger einen direkteren Weg geben, nur wollte er niemanden danach fragen, war das schon paranoid? Dass man niemanden fragen will, weil man Angst hat, der geht zur Polizei und sagt, da hat sich der und der nach dem Weg zum Bahnhof erkundigt? Unsinn. Es war keine Angst, es war Vorsicht. Aber die Panik kehrte zurück, er spürte es auf der Haut, als ob sie ein Wesen wäre, das langsam und glitschig an einem hochkroch. Er kam an die Einmündung einer Seitengasse. An einem Backsteinbau, dessen Erdgeschoss gelb gestrichen war, sah er das Schild eines Salon fryzjerski, traute er sich das zu? Er blieb stehen, plötzlich spürte er sein Herz bis zum Hals klopfen, das war doch lächerlich, wie wollte er über die Grenze kommen, wenn ihn schon die alberne Frage, ob er sich die Haare schneiden lassen sollte, solchen Zuständen aussetzte.
Ich kann mich nicht entscheiden, dachte er dann, aber die Panik... Ich darf nicht tun, was die Panik mir sagt, und die Panik sagt, ich soll weggehen, nein: laufen soll ich, sagt die Panik, so schnell wie möglich, also ist es genau das, was ich nicht tun werde. Er bog in die Seitengasse ein und stieß die Tür des Salons auf, ein Glockenspiel schlug an, ein einzelner Friseur erhob sich aus einem Sesselchen und legte eine Zeitung mit großen schwarzen und roten Schlagzeilen zur Seite und kam mit einem fragenden Blick auf ihn zu.
»Can you cut my hair, please?« Er hatte keine Ahnung, ob das halbwegs richtig klang, hoffentlich sprach der Fryzjer kein Englisch, oder kein richtiges, und verwickelte ihn auch in kein Gespräch. Er setzte sich in den Frisierstuhl, der ihm angeboten wurde, der Friseur legte den weißen Umhang um ihn, zu spät bemerkte er, dass man durch die Fensterscheibe des Salons hereinschauen konnte, er saß also hier im weißen Umhang wie auf einem Präsentierteller, allen Blicken ausgeliefert und nicht zuletzt diesem Menschen, der sich nun Schere und Kamm gegriffen hatte und ihn im Spiegel auffordernd ansah, als erwarte er nähere Anweisungen... Er betrachtete den Friseur und sich selbst, sein Spiegelbild missfiel ihm, und plötzlich missfielen ihm auch seine nach hinten fallenden blonden oder besser: seine strohgelben Haare, und es missfiel ihm auch der magere Bart, der ihm vom Kinn hing, das Missfallen kam ihm gerade recht, es lenkte ab.
»Short«, sagte er und hob die Hand und zeigte eine Entfernung zwischen Daumen und Zeigefinger an, die vielleicht vier Zentimeter betragen mochte. Dann fuhr er sich mit der Hand den Bart entlang:
»Away.«
Der Friseur nickte und machte sich schweigend an die Arbeit. Sein Kunde sah ihm zu und hörte das gleichmäßige Klappern der Schere, er suchte nach einem Wort, um dieses leicht metallisch reibende Geräusch zu beschreiben, das von den beiden Scherenblättern kam, kein Klappern, Unsinn, es so zu nennen, Unsinn auch, sich den Kopf darüber zu zerbrechen, aber das war noch immer besser, als anderes zuzulassen, er würde sich jetzt verändern, in wenigen Minuten, im Spiegel sah es so aus, als sei es zwanzig vor eins, also war es vermutlich zwanzig nach elf Uhr, um halb zwölf würde er ein anderer sein, nicht nur äußerlich, sondern jemand, der es ausgehalten hatte, sich in diesen Stuhl zu setzen und sich in diesen Umhang wickeln zu lassen, jemand also, der die Panik hatte an sich abtropfen lassen wie ein paar Regentropfen von der Sommerhaut, er musste sich nicht einmal schütteln, nur, was hatte dieser Friseur zu klappern und zu tun ohne Ende?
Mehrmals hatte Tamar versucht, in Krakau anzurufen, aber jedes Mal war nur ein kurzes Klicken zu hören gewesen, und eine Tonbandstimme hatte ihr auf Polnisch etwas erklärt, von dem sie gerade soviel verstand, dass sie die gewünschte Teilnehmerin nicht erreichen könne. Und auf die SMS, die sie Hannah geschickt hatte, war keine Antwort gekommen und vermutlich auch keine zu erwarten. Hannah war seit ein paar Tagen in London und bereitete eine Ausstellung vor, was zugleich bedeutete, dass sie nichts und niemanden und vor allem kein Mobiltelefon an sich heranließ.
Mit einem Anflug von Resignation zog die Kommissarin ihr Notizbuch hervor und schlug die Nummer der kleinen Londoner Galerie nach, in der die Ausstellung stattfinden würde. Diesmal kam eine Verbindung zustande, die Frauenstimme, die sich meldete, war von kultivierter eisgekühlter Freundlichkeit, die noch um zwei oder drei Grade zurückgefahren wurde, als Tamar ihren Wunsch vorbrachte.
Es tue ihr sehr leid, aber Miss Thalmann sei nicht zu stören.
Doch, antwortete Tamar. »Sagen Sie ihr meinen Namen und dass es ein Problem in Krakau gibt. Es ist dringend, dass Sie es ihr sagen.«
Sie wartete, noch ärgerlicher als zuvor. Irgendwann einmal, in New York, war eine Ostküsten-Schnepfe ganz hingerissen gewesen von Tamars Englisch, und zwar deshalb, weil sie - die Schnepfe - angeblich bisher nie habe glauben können, dass wirklich jemand einen solchen Akzent habe »like the germans in our funny Nazi soap operas«. Heute noch musste Tamar jedes Mal, wenn sie englisch sprechen sollte, und sei es nur ein paar Sätze, an die Schnepfe denken. Sie war rothaarig gewesen und hatte gezupfte Augenbrauen gehabt.
Das Schweigen am anderen Ende der Leitung wurde von einem Knacken unterbrochen, eine andere Stimme meldete sich mit mühsam gebremster Ungeduld. Was denn los sei?
»Ich erreiche Milena nicht. Und bei dir meldet sich nur irgendein Telefondienst.«
»Milena wird spazieren gegangen sein. Einkaufen. Arbeit suchen. Was weiß ich... warum rufst du mich deshalb an?«
»Es gibt Leute, die uns in Krakau gefolgt sind. Die uns fotografiert haben. Ich möchte sicher sein, dass in deiner Wohnung...«
»Was für Leute?«
»Leute, die ein Problem mit mir haben«, antwortete Tamar. »Kannst du mir jetzt sagen, ob mit deiner Wohnung alles in Ordnung ist...«
»Es wäre wirklich reizend von dir, wenn du die Leute, die ein Problem mit dir haben, selbst managen würdest.« In Hannahs Stimme wich die Ungeduld einem leisen, zornigen Vibrieren. »Aber sollte das nicht möglich sein, dann sag mir doch bitte, was ich von hier aus für dich tun kann.«
»Ruf deine Hausverwalterin oder die Vermieterin an und bitte sie, in deiner Wohnung nachzusehen und Milena zu sagen, dass sie mich dringend zurückrufen soll.«
»Und warum soll die Verwalterin nachsehen?«
»Sie soll nachsehen, ob bei dir eingebrochen worden ist«, antwortete Tamar, nun selbst ärgerlich geworden. »Und wenn du ihr das so nicht sagen willst, dann erklär ihr eben, das Telefon sei kaputt und sie soll gucken, ob der Hörer richtig aufgelegt ist.«
Für einen Moment herrschte Schweigen. Dann kam Hannahs Stimme wieder. »Wenn du meinst«, sagte sie, und es klang so, als sei ihr auf der ganzen Welt nichts gleichgültiger.
Toilet?«
Der Friseur hielt inne, fast erschrocken oder verständnislos, dann nickte er, nahm dem Kunden den Frisiermantel ab und ging ihm - sich zuvor verbeugend - voran, hinter eine Trennwand, wo zwischen Kartons und Trockenhauben ein schmaler Durchlass zu einer Tür führte. Das Klosett dahinter hatte eine gesprungene Schüssel, und das Email des Handwaschbeckens war angerostet. Aus der linken Brusttasche seiner Jeansjacke holte der Mann ein Tütchen, aus dem er sich zwei knapp bemessene Linien eines kristallinen weißen Pulvers auf die Oberfläche der linken Hand schüttete.
Er hatte nicht vorgehabt, seine Notration schon jetzt anzubrechen. Natürlich hat man so etwas nicht vor. Aber die Panik fragt nicht danach. Der kann man zehn Mal erzählen, dass man sie von sich abgeschüttelt hat wie den Sommerregen. Wenn du meinst, sagt sie und macht ein demütiges Gesicht, und im gleichen Augenblick schleicht sie schon wieder heran, verkleidet diesmal, sie tut, als wäre sie nicht die Panik, aber nicht doch! Sondern nur die Angst vor ihr, aber es kommt auf das Gleiche heraus, und deshalb hilft nur das eine, der klare, der kristallklare Trennungsstrich... Er schnupfte die beiden Linien die Nase hoch und zog - um den Anschein zu wahren - die Toilettenspülung.
Der Friseur erwartete ihn im Salon, der Mann setzte sich und bekam wieder den Frisiermantel umgehängt. Es war kurz vor halb, erst jetzt stellte er fest, dass der Friseur dabei war, ihm einen Bürstenhaarschnitt zu verpassen, er hätte lauthals herauslachen können, so blöd sah das aus. Aber warum nicht? Du wolltest ein anderer sein, bitte sehr, beklag dich nicht, hinweg mit allem, »freedom’s just another word...« Der Friseur holte eine elektrische Schneidemaschine und begann damit, den Haaransatz nachzuarbeiten. Die Maschine war an ein merkwürdiges, braun geflecktes Teil angeschlossen, das entweder der Motor oder aber der Trafo war, der Mann hatte ein solches Teil zuletzt in einem Offenbacher Vorort gesehen, als er ein Kind gewesen war und man ihn alle Monate zu einem Friseursalon geschickt hatte, der zwei Straßen weiter lag.
Dieser da, der fryzjer, hatte sich inzwischen dem Bart zugewandt und schnitt an ihm herum, was sollte das nun werden? Ein Knebelbart oder ein neckisches Kinnbärtchen nach der Art junger deutscher Fußballspieler?
»No, no. All away.«
Der Friseur zuckte die Achseln und machte sich daran, den Bart mit der Schere abzunehmen, das ziepte ein wenig, warum wurde dieser Mensch nicht fertig, und was hatte er aus seiner Brusttasche zu fingern? Es war ein schmales Teil, das er plötzlich herauszog, gebogen wie eine Banane und mit Schildpatt besetzt, und er klappte es auf, einfach so, vor den Augen des Mannes blitzte die glatte geschliffene Klinge des Rasiermessers auf, wie gelähmt starrte er in den Spiegel und sah zu, wie sich die Klinge seiner Kehle näherte, so wird das also gemacht, dachte er, ein Schnitt, schnell und sauber und tief, und du läufst einfach aus, aber wie trennten sie dann die Knorpel und die Knochen durch, da würde die Klinge doch abbrechen, du musst ihm die Hand wegschlagen, aber so - eingepackt in den Frisiermantel - geht das nicht, der merkt jede Anspannung, und es macht ratsch!, ehe du auch nur die Hand gehoben hast...
Behutsam legte der Friseur seine linke Hand auf den Kopf des Mannes und drückte ihn leicht zurück und begann, die Stelle zwischen Nase und Oberlippe auszurasieren. Der Mann sah zu ihm hoch, das heißt, in Wirklichkeit glaubte er, sich zuzusehen, wie er dem Friseur zusah, es war alles schon geschehen, und was er sah, war nur eine Art Rückblende, in der sich noch einmal die letzten Sekunden vor dem entscheidenden, dem finalen Schnitt in seinem Gehirn abspulten.
Der Friseur holte den Spiegel und zeigte seinem Kunden das Bild eines kurzhaarigen blonden Mannes mit einem anstößig nackten Gesicht, das fliehende Kinn jeder Deckung beraubt. Der Mann nickte und bezahlte in Złoty, nicht in Dollar oder Euro, wie der Empfänger vielleicht gehofft haben mochte, und auch das Trinkgeld war nur bescheiden.
Draußen schlug der Mann den Weg zum Hauptbahnhof ein, den er sich vom Friseur hatte zeigen lassen. Was sonst sollte er tun? Er wollte nicht darüber nachdenken, was ihm widerfahren war oder vielleicht doch nicht widerfahren war, vielleicht gab es einen Weg zum Hauptbahnhof und vielleicht sogar auch einen Hauptbahnhof und Züge darin, und er würde mit einem der Züge fahren, durch weites Land und über Flüsse und Brücken, die Welt würde sich vor ihm öffnen wie im Breitwandformat, nichts mehr würde ihm in diesem einen Augenblick verborgen bleiben, auch nicht der winzige Salon fryzjerski mit der puppenhaft kleinen, in einen Frisiermantel gehüllten Gestalt, der sich eine zweite Gestalt nähert, das aufgeklappte Rasiermesser in der Hand.
Die Straße, die er gegangen war, mündete in einen weiten unübersichtlichen Platz. Vor sich sah er eine Front von zweigeschossigen Bogenfenstern, die ein Betondach trugen, die rußgrauen Fenster voll gehängt mit bunten Reklameschildern. Vor dem Eingangsbereich warteten Taxen, andere Autos drängten sich vor zwei Haltebuchten. Alles in allem sah dieser Hauptbahnhof nicht viel anders aus, als er es von einer Stadt erwarten konnte, die irgendwie in der gleichen Liga spielte wie Offenbach, allenfalls die Menschen in der großen Wartehalle sahen anders aus, oder jedenfalls ihr Gepäck, reich an Bündeln und zugeschnürten Kartons. Was er nicht erwartet hatte, waren die Fahrtzeiten. Der nächste Zug nach Zgorzelec ging um 12.54 Uhr, aber er würde erst um 19.27 Uhr dort ankommen, dabei war es angeblich ein pociag pospieszny, für den auch noch Zuschlag verlangt wurde. Um Fahrkarte und Zuschlag bezahlen zu können, musste er an einem mächtig vergitterten Bankschalter seinen letzten Hundert-Euro-Schein wechseln. Er würde also am Abend in Zgorzelec sein, mit gerade noch ein paar Złoty in der Jeansjacke, ohne Gepäck, mit einer angebrochenen Schachtel Zigaretten und gerade noch zwanzig Gramm Crystal oder weniger als einzigem Besitz.
Bis zur Abfahrt des Zuges hatte er noch etwas Zeit, er kaufte sich an einem Kiosk eine Flasche Wasser, dabei hatte er gar keinen Durst, aber er wusste, dass er zwischendurch etwas trinken musste, jeder, der sich auskennt, weiß das. Während er bezahlte, fiel ihm aus dem Krempel der Souvenirs und der anderen Unnützlichkeiten, mit denen die Auslage des Kioskes vollgestellt war, ein Sortiment von Taschenmessern auf, billige Ware, aber fabrikneu, er suchte sich eines davon aus... Wieso gab er seine nahezu letzten Złoty dafür aus? Offenbar war es eine Eingebung gewesen, er musste lernen, seinen Eingebungen zu vertrauen, vor allem hatte das Messer eine kleine Schere, mit der man ein Pflaster zurechtschneiden oder ein Etikett abtrennen konnte, er fand das praktisch. Warum fand er es praktisch? Darum. Er musste es nicht erklären. Das war es: Von jetzt an musste er überhaupt nichts mehr erklären. Nichts und niemandem.
Der Zug kam pünktlich, so übel ist das doch gar nicht mit der Eisenbahn hier, dachte er, und die Graffiti auf den Waggons und darin sind auch nicht wilder als an der S-Bahn zwischen Niederrad und Offenbach. Er fand ein fast leeres Abteil - einzig eine dicke Frau saß dösend in der Ecke am Fenster, sie warf ihm einen abschätzenden Blick zu und entschied sich, ungefährdet weiterdösen zu können. Freilich war es offenbar ein Abteil für Niepalacy, vermutlich also für Nichtraucher, aber im Augenblick brauchte er keine Zigarette, schon den ganzen Tag über hatte er kein Bedürfnis danach gehabt, überhaupt hatte er in ebendiesem Augenblick begriffen, was Janis Joplin gemeint hatte (auch wenn sie selbst sich vielleicht gar nicht daran gehalten haben mochte): nichts erwarten, nichts befürchten - das war es schon, zwei Grundsätze, kristallklar und mit Goldrand, damit konnte man durchs ganze Leben kommen, wenn man es denn nicht schon verloren hatte. Das Schweigen sollte er sich vielleicht noch angewöhnen, nie wieder diesen Geschwätzigkeitsdurchfall, dieses Wortgepfluder, das immer nur eines verrät: das, was man auf keinen Fall hat sagen wollen.
Er sah zum Bahnsteig hinaus und betrachtete einen Fahrplan-Aushang, der mit Hakenkreuzen verschmiert war, dann bewegte sich der Aushang langsam nach rechts, der Zug nahm Fahrt auf. Er lehnte sich zurück, geschwärzte Mauern glitten an ihm vorbei, braunrostige Güterwaggons auf einem Seitengleis, Kohlenhalden, von irgendwelchen Hügeln sahen Wohnblocks auf die Bahnstrecke herab, aus den Fenstern der Häuser war buntfarbige Wäsche in die Sonne gehängt. Fast körperlich spürte er, wie sich die Stadt von ihm löste, die Stadt und ihre hunderttausend Augen, sie hatten sich an ihm festgesaugt, und nun mussten sie loslassen, mit so einem schmatzenden glitschigen Geräusch taten sie das, wenn einer die Ohren dafür hat, dann konnte er das gut hören und die anderen Dinge auch, das verborgene Knistern und Knacken in der Welt, und in der Tiefe dieses schuppende anschleichende Geräusch, das vor allem.
Die Kriminalkommissarin Tamar Wegenast hatte den Nachmittag am Computer verbracht und ihren Abschlussbericht zum Fall des Obdachlosen geschrieben, den man aus Frust und Ärger und Langeweile zu Tode getreten hatte. Sie hatte sich gezwungen, kühl und emotionslos zu bleiben. Es war ihr Job, einen präzisen, sachlichen und unanfechtbaren Bericht darüber vorzulegen, wie dieser Mann zu Tode gekommen war, einen von keiner Gefühlsregung verfälschten Bericht. Es war auch das Einzige, was sie noch für den Toten tun konnte. Nur fiel ihr diese professionelle Sachlichkeit in letzter Zeit immer schwerer.
Es war das Gespräch mit Hannah, sagte sie sich, als sie den Neuen Bau verließ und am Münster vorbei in Richtung von Tonios Café ging, wo sie ein Sandwich essen wollte. Nie tun dir diese Gespräche gut. Immer bleibt ein Widerhaken. Und gemeldet hat sie sich auch nicht mehr, natürlich nicht, immer mehr ähnelt sie diesen Galeristinnen und Kunsthändlerinnen, all diesen Maskenfrauen mit ihrem Kometenschweif schwuler Experten.
Schluss, ermahnte sie sich und verlangsamte ihre Schritte, alle unsere Klischees tun wir jetzt brav wieder ins Schächtelchen. Es war noch warm genug, um draußen zu bleiben, und so waren die meisten Tische vor Tonios Café besetzt. An einem davon saß ein Mann mit stoppelkurzem Haar und gerötetem Gesicht, er winkte ihr zu und wies einladend auf den freien Platz ihm gegenüber.
Tamar dankte und setzte sich. »Erzählen Sie mir was.«
»Da haben Sie was falsch verstanden«, antwortete Frenzel, der Mann mit den Stoppelhaaren. »Es ist ja wohl an der Mordkommission, einem Not leidenden Gerichtsreporter...«
Tamar schüttelte den Kopf. »Was ich Ihnen erzählen könnte, will vermutlich nicht einmal ich in der Zeitung lesen.« Maria kam, und Tamar bestellte ein Mineralwasser und ein Salami-Sandwich.
»Aber was unsere hoffnungsvolle Jugend so treibt, um nur ein Beispiel zu nennen: das möchte man doch gerne wissen, ansatzweise wenigstens, finden Sie nicht?«
»Nein«, entschied Tamar. »Außerdem hat es zu dem Mord an dem Obdachlosen bereits eine Pressemitteilung gegeben...«
»Eine Pressemitteilung!«, rief Frenzel klagend aus und hob beschwörend beide Hände. »O Herr, lass Blumen blühen am trockenen Holze!«
Das Mineralwasser wurde vor Tamar abgestellt, und sie registrierte, dass die Bewegung, mit der dies geschah, eine wenig marienhafte war. Aber so ist das Leben, dachte sie. Mit den Jahren geht der Liebreiz flöten, vor allem der, den man ehedem an anderen fand. An wem liegt das? Vermutlich an einem selbst.
Frenzel hatte ihren Blick beobachtet. »Vielleicht sollten wir Tonio bitten, diese da nicht mehr Maria zu nennen«, schlug er plötzlich vor. »Sondern Liesel. Oder Kätter.«
»Tun Sie das.« Kätter brachte das Sandwich. Tamar biss ein Stück ab. »Kennen Sie eigentlich Devils Race?«
Er schüttelte den Kopf.
»Eins von diesen Computerspielen. Umbringen oder umgebracht werden, und das in einer Endlosschleife. Je mehr Sie totmachen, desto schneller geht es Ihnen von der Hand. Sie können also Ihre eigene Software selbst perfektionieren. Aber dafür wird auch das Umbringen jedes Mal schwieriger.«
»Nett«, meinte Frenzel. »Was mich betrifft - perfektionieren kann ich nicht mal mein eigenes Handy.«
»Kein Problem«, fuhr Tamar fort, »die Software fürs immer fixere Totmachen können Sie sich auch aus der Internet-Börse runterladen, wenn Sie fürs Selbermachen zu blöd sind. Gegen Geld natürlich. Gegen richtiges Geld.«
Frenzel betrachtete sie aufmerksam. »Ja, und?«
»Wissen Sie, im Internet kann man auch beschissen werden«, schloss Tamar. »Nicht bloß virtuell, sondern richtig.« Sie biss ein weiteres Stück von dem Sandwich ab. »Und damit, das müssen Sie doch verstehen, kann so ein Kerlchen nicht umgehen«, fügte sie kauend hinzu.
»Das«, sagte Frenzel und winkte der Bedienung, »das hab ich jetzt verstanden.«
Es dunkelte schon, als er in Zgorzelec ankam. Die meiste Zeit hatte er in einem Schwebezustand verbracht, nicht schlafend (obwohl er das gerne getan hätte), nicht dösend, nicht träumend, sondern irgendwo zwischen Gedankensplittern und angerissenen Traumbildern flirrend, unfähig, irgendwo zu verweilen. Ein paar Mal war er auf die Toilette gegangen, natürlich ist die Toilette in einem Pociag pospieszny ein Ort, an den man sich erst gewöhnen muss, aber mit der Zeit findet man sich auch dort zurecht. Lästig war nur, dass er die herausgetrennten Etiketten seiner Klamotten und Unterwäsche einzeln aus dem Toilettenfenster flattern lassen musste, weil die Spülung nicht funktionierte.
Danach hatte er wieder zugesehen, wie die Landschaft am Abteilfenster vorbeizog, einmal waren Soldaten eingestiegen und hatten begonnen, Zigaretten zu drehen, aber die Alte hatte es zeternd unterbunden. Irgendwann war die Alte ausgestiegen, er hatte es gar nicht bemerkt, dann auch die Soldaten, später waren jüngere Leute zugestiegen, was heißt jüngere Leute! Albern waren sie und von der unverschämten Vergnügtheit, die einen plötzlich spüren lässt, dass man bald dreißig sein wird.
Die Jungen hatten mit ihm den Zug verlassen, ziemlich aufgekratzt, offenbar gab es hier eine Disco, die man kennen musste, wie hieß der Ort noch mal? Zgorzelec. In der Bahnhofshalle fand er einen Plan mit dem Netz der regionalen Buslinien, wenn er den Plan richtig las, hielten direkt am Bahnhof zwei Busse, mit denen er über die Neiße und damit über die Grenze kommen würde. Die eine Linie führte durch das Zentrum von Zgorzelec bis fast zum Bahnhof von Görlitz auf der anderen Flussseite, die andere ging weiter nördlich über die Grenze und dort zu irgendwelchen Dörfern tief in der Lausitz.
Es war verlockend. Er hatte kein Gepäck, er würde aussehen wie jemand, der in Görlitz ein Date hat oder ins Kino will. Niemand würde einen Blick an ihn verschwenden, nicht an der Grenze, aber die war sowieso nicht das Problem. Falls Tabea aufgeflogen war - und ganz sicher war sie das -, würden sie jetzt überall lauern, vermutlich nicht an der Grenze, aber irgendwo dahinter, hechelnd vor Erwartung. Und wenn da einer käme und hatte sich gerade eben die Haare abschneiden lassen: also, da mussten denen doch alle Hundemarken klappern.
Er verließ die Bahnhofshalle, die jungen Leute aus dem Zug drängten sich in einen Bus, vielleicht war es eben jener, der direkt über die Grenze nach Görlitz fuhr, vielleicht konnte er es damit riskieren, die BTM-Fahnder würden nicht eine ganze Busladung filzen wollen. Außerdem brauchte er in dem Gedränge kein Ticket, bis sich ein Kontrolleur zu ihm hätte durchquetschen wollen, wäre er längst vorher ausgestiegen. Er beeilte sich, mit Mühe drängte er sich noch in den Bus, dann schob sich auch schon die Türe zu.
Der Bus rollte an, der Mann versuchte gar nicht erst, etwas von der Stadt zu sehen, was er sah und roch, war das Rückendekolletee einer üppigen Rothaarigen. Tabea hatte eine Phase gehabt, in der sie sich die Haare brandrot hatte färben lassen, schon damals hatte es nicht mehr geknallt. Er wandte den Kopf ab, der Bus hielt, zwei oder drei weitere Leute drängten hinein, vor ihm gab es etwas Luft, und über den Kopf der Rothaarigen hinweg erhaschte er einen Blick auf Wohnblocks, die wieder sehr nach Offenbach aussahen. Wieder hielt der Bus und ließ einen ganzen Schwall junger Leute ausschwärmen, der Mann stieg mit ihnen aus, in einem halb oder zu drei Viertel leeren Bus wollte er nicht über die Grenze gefahren werden.
Vor ihm öffnete sich ein Park, der sich von einem mit Marmorsäulen und einer Kuppel geschmückten Gebäude zum Fluss hinab erstreckte. Auf der anderen Seite des Tales zeichnete sich vor einem rot unterlegten Abendhimmel die Silhouette einer zweiten Stadt ab, Görlitz also, so kommt einer in der Welt herum. Auf dem Rasen flanierten junge Leute oder hockten in Gruppen beieinander, weiter unten spielte eine Band, es hörte sich angestrengt nach Free-Jazz an, der Mann erinnerte sich an einen Abend im Grüneburgpark in den neunziger Jahren, da hatte man solche Musik auch hören können, von irgendwoher wehte ihm der Geruch nach Gras in die Nase, da konnten doch... Er sah sich um, bemüht unauffällig, wahrscheinlich war gerade das schon wieder verdächtig, fast sofort hatte er einen Kandidaten: einsneunzig, Jeans, Lederweste, Schnürstiefel, vor sich hin schlendernd, wie man in der Polizeischule das Schlendern so lernt.
Aber für ihn schien er keinen Blick zu haben.
Die Band war nun doch zu einem Ende gekommen, Saxophonist und Gitarrist verbeugten sich, eine junge blonde Frau trat ans Mikrofon, sie hatte ein Pferdegesicht, und die Haare fielen ihr bis zum Arsch, sie rezitierte in einem fragenden verwunderten Tonfall einen Text mit vielen Zischlauten, offenbar war es ein Gedicht, natürlich war es das, und er verstand es auch, alles, kein Wort ging ihm verloren, es ging darum, warum man nicht auf dem Kopf gehen kann und warum von der Liebe nur die Flecken auf dem Bettlaken bleiben.
»Irgendwie«, sagte eine Frauenstimme vor ihm, »ist das hier nicht mein Ding.« Die Stimme gehörte einer mageren bebrillten Deutschen mit schulterlangen schwarzen Haaren.
»Und mit den Mackern«, sagte ihre Freundin und fingerte nach ihrer Zigarettenschachtel, »ist auch nicht viel los.« Die Freundin war stämmig und hatte dunkelblondes Haar, mit braunen geflochtenen Strähnen darin. Die Packung war leer, sie zerknüllte sie und warf sie weg.
Eine Hand hielt ihr eine andere Schachtel hin, aus der eine Zigarette bereits griffbereit ein Stück weit herausgeschüttelt war. Die Frau betrachtete die Schachtel und die Hand und den Mann, der dazu gehörte, der Mann war eher klein und schmächtig, das hellblonde, fast weiße Haar zu einer Igelfrisur geschnitten.
»Was’n das?«
Der Blonde schüttelte leicht den Kopf und lächelte. Die Frau nahm die Zigarette. »Eine polnische, wie?« Sie ließ sich Feuer geben, der Mann benutzte ein altes Benzinfeuerzeug und sah dabei fragend zu ihrer Freundin. Aber die hatte sich abgewandt.
»Wo kommst denn her?«
Auch der Mann hatte sich eine Zigarette angezündet und ließ sie im Mundwinkel hängen. Wieder antwortete er nicht, sondern sah sie nur an, den Kopf leicht schief und das eine Auge wegen des Rauchs etwas zusammengekniffen.
»Schweigsames Kerlchen.«
»Frag ihn doch mal«, sagte die Freundin, »ob er noch was anderes hat als seine papieros polski.«
Der Mann schaute durch den Zigarettenrauch zu ihr hinüber, dann wandte er den Kopf und blickte zu dem Mann in der Lederweste, der inzwischen der Dichterin zuhörte oder ihr auf die Titten sah, wer wusste das schon. Die Schwarzhaarige folgte seinem Blick, dann sahen sie sich wieder an, und sie nickte.
Schließlich hörte die Dichterin zu rezitieren auf, und die zwei deutschen Frauen und der Mann gingen langsam durch den Park zur Bushaltestelle. Die Frauen waren aus Weißwasser, fünfzig oder sechzig Kilometer entfernt, Margot - die Schwarzhaarige - arbeitete bei der AOK, und Ella war Kontoristin in einem Computerladen. Ihren Toyota hatte Margot auf dem Görlitzer Marktplatz geparkt.
Niemand wollte im Bus einen Ausweis von ihnen oder ihrem Begleiter sehen.
Eine Glocke aus Flutlicht schirmte das Stadion gegen den Abendhimmel ab. Der Geräuschpegel war nicht sehr hoch, manchmal drang ein kollektives Aufstöhnen bis in den Wagen der Einsatzleitung, »schon wieder drüber«, sagte Markert dann. Manchmal flackerten Sprechchöre auf, unterbrochen immer wieder von einem höhnischen Grölen, das sich Tamar Wegenast nicht erklären konnte, sie verstand ein »Umba-Humba« und blickte fragend zu Markert, der sich auf einem Monitor die Aufnahmen der Überwachungskameras einspielen ließ.
»Hoffentlich haut er ihnen eins rein«, sagte er und änderte die Einspielung auf dem Monitor. Eine Gruppe Glatzköpfiger erschien auf dem Bildschirm, einige mit dem hoch gestreckten Mittelfinger, andere die Hände als Schalltrichter vor den Mund haltend.
»Dresdner sind das. Das Grölen geht gegen den Ogi«, erklärte er. »Ogilveya, die Nummer zehn beim SSV, kommt aus Ghana.« Er sah zu ihr hin. »Das soll Affengebrüll sein, verstehst du?«
»Warum bricht der Schiedsrichter nicht ab?«
»Deshalb?«
»Ja, deshalb.«
Markert schnaufte auf. »Was glaubst du, wie viele Spiele da jedes Wochenende abgebrochen werden müssten in diesem Land...«
Irgendetwas pochte an Tamars Hüfte. Sie griff in ihr Jackett, holte ihr Mobiltelefon heraus und meldete sich, mit der freien Hand die Sprechmuschel abschirmend, und fügte hinzu: »Einen Augenblick bitte.« Sie nickte Markert zu, eine wortlose Bitte um Entschuldigung, schob die Tür des Einsatzwagens auf und sprang nach draußen.
»Ja?«
»Kannst du...?«, sagte eine ferne fremde Stimme und wurde im nächsten Augenblick begraben unter einer anschwellenden Woge von Gebrüll. Tamar ging hinter den Einsatzwagen, hielt sich mit der freien Hand das andere Ohr zu und rief:
»Hannah, bist du das?«
»... kannst du kommen, nach Krakau?«, fragte die Stimme, die jetzt flach und atemlos klang wie die eines verstörten Kindes. »Morgen vielleicht schon? Bitte...«
Ein Lautsprecher dröhnte über das Stadion hinweg, noch einmal brüllte die Menge auf, und auf der Anzeigetafel blinkte in Leuchtschrift:
42. Min. 1:0 Ogilveya
Der Regionalexpress aus Cottbus, fahrplanmäßige Ankunft 01.02 Uhr, kam mit wenigen Minuten Verspätung in Berlin/ Ostbahnhof an. Es stiegen nur wenige Fahrgäste aus, darunter ein Mann mit kurzen weißblonden Haaren, der mit Jeans und Jeansjacke für die Tages- und Jahreszeit zu dünn angezogen war. Er hielt eine Wasserflasche unter dem Arm, sonst hatte er kein Gepäck.
Ella und Margot hatten ihn mit nach Weißwasser genommen. Dafür und für einen Hunderter hatte er ihnen den Rest seines Notvorrats abgegeben, dazu seine letzten Złoty. Andere Vereinbarungen waren erst gar nicht angestrebt worden.
Von Weißwasser aus war er mit der Lausitzbahn nach Cottbus gefahren und von dort nach Berlin/Ostbahnhof. Warum? Weil es sich so ergeben hatte. Weil kein anderer Zug mehr fuhr. Weil er in Berlin niemand kannte, was bedeutete, dass auch ihn niemand kannte, und weil, wer niemand sein will, am besten eine große Stadt aufsucht.
Er hielt Berlin für eine große Stadt.
In Cottbus hatte er eine Bratwurst gegessen, jetzt besaß er noch sechzig Euro und ein paar Münzen. Er war müde und aufgedreht zugleich, und noch immer sah er auf den Grund der Dinge. Wenn er sich jetzt eine Absteige suchte, war er in ein paar Stunden so gut wie blank und hatte vielleicht nicht einmal richtig geschlafen. Ach, Schlaf! Nur wer nichts braucht... Ein- oder zweimal war er schon in Berlin gewesen, einmal, als er noch in der Realschule war, mit der Klasse, das andere Mal zur Love Parade, da hatte er sich bei einer Evelyn Filzläuse eingefangen.